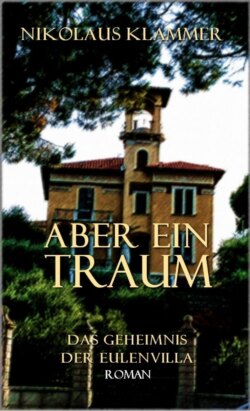Читать книгу Das Geheimnis der Eulenvilla - Nikolaus Klammer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEINS
Katharinas Aufzeichnungen
Nein, ich wollte nicht in die Eulenvilla hinein. Alles in mir sträubte sich dagegen. Ich wollte nicht diese Türen öffnen, ich wollte nicht diese Schwellen überschreiten, ich wollte nicht in diese Zimmerfluchten treten. Aber mir blieb keine andere Wahl. Denn im Inneren des Hauses befand sich die letzte Zufluchtsmöglichkeit, die mir jetzt noch verblieben war.
Durch einen Blick über die Schulter überzeugte ich mich. Ich saß keiner Täuschung auf. Der Ort, an dem ich mich eben noch befunden hatte, existierte nicht mehr. Er war vielleicht für immer für mich verloren und so fern von mir, als hätte er nur in einem luziden Traum existiert. All das, was vorher gewesen war, vor diesem Moment, der mich über einen kurzen Gartenweg und dann ein paar ausgetretene Steinstufen direkt vor die Eingangspforte der Villa geführt hatte: Das war nach einem kurzen Augenzwinkern fort gewesen – fortgewischt, als wäre es nie gewesen. Diese Altstadtgasse mit ihren eng an eng aneinandergeschmiegten, vornübergebeugten Fachwerkfassaden, die ermattet ihre Schatten auf die Pflastersteine kippten, die mich stolpern machten: Sie gab es nicht mehr. Verschwunden war sogar der vom schier endlosen Sommertag müde, orangefarbene Abendhimmel über den Ziegeldächern, den ein paar schimmlige Wolkenflecken verschmutzt hatten.
Was ich sah, war nicht Kansas, aber auch nicht Oz. Es war eine andere und unheimliche Welt, in die ich nicht gehörte. Ich fühlte mich so verlassen, als wäre ich auf einem unbewohnten Planeten gestrandet. Mein wandernder Blick ging ungläubig die Stufen zur Eingangspforte hinunter und anschließend drei, vier Schritte durch den Vorgarten. Danach endete der Kiesweg, der links und rechts von zu perfekten Kugeln geschnittenen Buchsbäumen eingefasst wurde. Er wurde so abrupt vom Sand der Wüste verschluckt, als hätte ihn jemand an dieser Stelle mit einem Beil abgetrennt. Hinter ihm dehnte sich in alle Richtungen eine schier endlose Ebene aus, deren ferner Horizont in Schlieren mit dem grauen Himmel darüber verschwamm. Hier gab es keine Erhebungen, keine Landmarken, nicht einmal ein ausgetrocknetes Flussbett. Dies war eine trostlose, in der Hitze schwimmende Wüstenei, über der Staubschlangen kreiselten. Es war die einzige Bewegung, die ich wahrnahm. Die kleinen Windtrichter führten umeinander verwickelte Tänze auf, deren komplizierte Schrittfolgen sie wohl nur selbst kannten. Trügerisches Licht drang durch die Schleierwolken zu mir herab, die die Sonne fast hinter sich verbargen. Sie war ein bleicher Fleck in der Höhe. Ihr Strahlen war diffus und doch grell; pochte im Puls eines mir unbekannten Herzens. Von meiner eigenen Welt war mir nur ein Schmerz verblieben, ein lautes Kreischen in den Ohren. Nur dieses hohe Pfeifen war nun übrig von der Stadt, die ich bewohnt, von dem Leben, das ich geführt hatte.
Und dann war da noch dieses Haus, vor dessen großen Flügeltüren ich stand. Inmitten der Einsamkeit erhoben sich vor mir die Front und darüber das pittoreske Glockentürmchen einer in hellen Terracotta-Farben verputzten Villa. Die recht schmale Vorderseite ließ ein viel kleineres Gebäude vermuten, als es in Wirklichkeit der Fall war. Die Villa war der einzige von Menschen errichtete Gegenstand in meinem Blickfeld und das einzige Anzeichen von Leben in der vollkommen toten Welt, in der ich gelandet war. Diese verlorene Sandkiste wartete wohl schon seit Äonen geduldig auf die Rückkehr ihres Schöpfers, der sie nach einem ersten, rohen Entwurf abgelenkt zur Seite geschoben und vergessen hatte.
Ich rang nach meiner hilflosen Flucht um Atem. Ich habe schon geschrieben, dass ich mich vor dem unheimlichen Haus fürchtete. Mich ängstigte vor allem die Türklinke. Sie hatte die Form einer messingfarbenen Eule, die sich mir gierig entgegenstreckte, als wäre meine Hand ihre Beute. Sie hatte die Flügel zum Sturzflug entfaltet und den spitzen Schnabel in einem für die Ewigkeit erstarrten Schrei geöffnet. Nein! Ich wollte nicht hinein in den Hort dieses Ungeheuers. Die Villa wirkte auf mich wie eine Mausefalle. Drinnen würde mich ein Schicksal einholen, dem ich bislang erfolgreich entflohen war. Das fühlte ich. Doch es gab für mich keinen anderen Weg.
Ich beschattete die Augen und sah nach oben, versuchte, vom Äußeren des Gebäudes auf sein Innenleben zu schließen. Ich wollte durch die Fenster eine Bewegung in den hinter schweren Vorhängen verborgenen Räumen erhaschen. Vergeblich, denn die Villa wirkte so tot wie alles um mich herum. Ich hatte sie noch nie gesehen. Sie war nicht in der Altstadtgasse gestanden, durch die ich vor Sekunden noch gejagt worden war. Ich war mir sicher: Sie war gleichzeitig mit mir in jener Wüste am Anfang oder am Ende der Zeit erschienen. Hatte ich sie mir in meiner Verzweiflung selbst herbeigewünscht?
Ich zuckte zusammen. Mir fiel mein Verfolger ein, dem ich nur entkommen konnte, wenn ich so schnell wie möglich die Eulenvilla betrat. Sonst gab es hier kein Versteck für mich. Ich hatte den Mann durch den Schock meiner Versetzung kurz vergessen. Vor ihm war ich um Hilfe rufend durch die Altstadt geflüchtet. Nur weg wollte ich von Binderseils Atelierfest. Es war eine Falle gewesen, die eigentlich für Jonas gedacht und in die unversehens ich selbst getappt war, weil ich ihn warnen wollte. Während meiner panischen Flucht war ich durch ein verwirrendes Labyrinth enger Gassen und Hinterhöfe gerannt, war über Zäune und Hecken geklettert, hatte an verschlossenen Haustüren gerüttelt. Doch in meinem Rücken war mir ein immer näher kommender Schatten auf den Fersen! Ich konnte ihn nicht abschütteln, egal, was ich unternahm. Ich wusste: Würde mein Feind mich endlich einholen, dann würde er mich ohne zu zögern mit dem Steakmesser töten, das er beim Grill mitgenommen hatte. Ich war der einzige Mosaikstein seines Plans, der noch nicht an seinem von ihm vorbestimmten Platz lag. Ein gezielter Stich in meinen Rücken und alles erfüllte sich für ihn. Ich konnte die Stelle bereits spüren, an der sein Messer wie ein heißer Blitz in meine Lenden dringen würde.
Gleichzeitig mit meinem Erschrecken hatte ich eine Erkenntnis, sie übergoss mich wie Eiswasser. Selbst an diesem fremden Ort, undenkbar weit von Zuhause entfernt, würde ich ihm nicht entkommen können: So einfach ließ er mich nicht ziehen! Er war weiter hinter mir her, war mir bis hierher gefolgt. Wahrscheinlich stammte er sogar von hier. Vielleicht hatte er mich auch bewusst verschleppt, an diesen Ort, an dem ich mich nicht verbergen konnte und an dem es keine Zeugen für seine Mordtat gab. Gut möglich. Dazu war er sicherlich fähig.
Erneut sah ich zurück. In der unendlichen, von Hitzefäden durchwaberten Staubwanne der Ebene flackerte in der Ferne eine schmale, schwarze Flamme. Sie wirbelte wie ein irrer Derwisch um sich selbst. Das war mein Mörder! Ein Irrtum war ausgeschlossen. Er kam rasch näher, um sein Werk zu vollenden. Nun kannte ich kein Zögern mehr. Es gab für mich ja nur den einen Fluchtpunkt, einen Ort allein, an dem ich mich verstecken konnte. Es war das Haus, das ich instinktiv so sehr fürchtete. Denn ich spürte auch, dass es der Schauplatz eines unaussprechlichen Verbrechens war. Die Eulenvilla war eine blutbesudelte, entweihte Zuflucht, die ihre trügerische Macht verlor, wenn man sich zu lange in ihr aufhielt. Ganz plötzlich, nach ein paar Reim- oder Zauberworten, konnte die Villa auch zur Falle werden. Wenn ich mich jedoch für den Augenblick vor dem heraneilenden Monstrum retten wollte, musste ich mich diesen Ängsten stellen.
Ich packte die Eulenklinke mit beiden Händen, zerrte an ihr, rüttelte verzweifelt. Die Tür blieb von meinem Versuch unbeeindruckt. Sie ließ sich nicht öffnen, auch nicht einen winzigen Spalt. Wieder ein panischer Blick zurück. Er war näher gekommen. Deutlich zeichneten sich die Umrisse des Verfolgers gegen das grelle Licht ab. Er rannte, fürchtete wahrscheinlich, ich würde ihm doch noch entwischen. Vielleicht war ihm wie mir der Gedanke gekommen, dass das Haus eine Anomalie im endlosen Nichts war, ein Platz der Zuflucht und des Waffenstillstands, wo man ausruhen und Kräfte sammeln konnte. Die Eulenvilla war ein Ort des Asyls. Sie war wie die Stelle, die wir als Kinder beim Fangenspielen immer als Gotto bezeichnet hatten. Ich habe keine Ahnung, woher das Wort stammt und was seine eigentliche Bedeutung ist. Aber Gotto, das war ein magisches Wort, es gab mir Mut. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen, konzentrierte sie an einem Punkt und hängte mein Gewicht an den Griff. Je eine Hand an einem Flügel zerrte ich und schrie dabei erneut um Hilfe. Vergeblich, denn wer sollte mich in dieser Einöde schon hören? Jetzt vermeinte ich bereits den keuchenden Atem meines finsteren Verfolgers in meinem Nacken zu spüren. Das war nur Einbildung, so schnell konnte er nicht herankommen. Selbst wenn er wie der golden glänzende Nachtvogel in meinen Händen über den Teppich aus Hitze hinter mir fliegen konnte, der über der Wüste lag. Ich traute mich nicht, nachzusehen, doch mein panisch umherirrender Blick fiel auf den Klingelzug neben der Tür.
Konnte es so einfach sein? Nur an dieser Klingel ziehen? »Ober mir, unter mir – vorder mir, hinter mir, links, rechts gült es nicht! Gotto, Gotto, eins-zwei-drei! Ich bin jetzt frei!«, rufen und eintreten durch das wie von Geisterhand geöffnete Tor? Hinein in die trockene, staubige Kühle des Hausgangs? Die Zehen entschlusslos in den weich ausgetretenen Orientteppich bohren, mit nackten Füßen vorwärts schleichen in das Dämmerlicht, weil die hohen, unbequemen Sandalen während der heillosen Flucht durch die Gassen meiner Heimatstadt längst hinweggeschleudert worden waren?
Manche Märchen, sagt man, erzählen die Wahrheit. Die Tür jedenfalls schwang nach meiner Zauberformel nach innen, ließ mich eintreten und fiel dann lautlos hinter mir ins Schloss. Ich atmete auf, denn ich fühlte mich zum ersten Mal seit meiner Flucht von dem Fest in Sicherheit. Jeder kennt den Eindruck, wenn er an einem hellen Sommertag nach einem längeren Aufenthalt im Freien in einen abgedunkelten Raum tritt. Alle Farben scheinen in die Wände gewichen und lastende, abwartende Stille liegt über den grauen und stumpfen Dingen. Es ist, als wären sie beleidigt, dass man ihre Abgeschiedenheit mit Sonnenwärme und Gerüchen stört, die man von draußen mit sich hereinträgt. Es ist eine Sinnestäuschung, ich weiß. Die Dinge, auch die altmodischen Schränke und Kommoden in diesem langen Korridor, sahen mich nicht an. Sie lebten eine andere Zeit. Und doch fühlte ich mich beobachtet, als wären überall in den hochherrschaftlich holzgetäfelten Wänden verborgene Ritzen und Löcher, durch die mich abschätzig feindselige Augen musterten.
Jemand rumpelte mit einem lauten Krachen gegen die gerade wieder verschlossene Tür hinter mir. Ein schwerer Körper warf mit voller Wucht von außen gegen das Holz. Ich drehte mich zu Tode erschrocken herum. Das kam so plötzlich, dass mein Herz für einen Moment aussetzte. Die Tür ächzte und stöhnte. Staub rieselte aus den Zargen. Aber sie hielt stand. Sie hielt auch einen weiteren und dann noch einen dritten Schlag aus, die sich schon etwas schwächer und resignierter anhörten.
»Sei verdammt, Lina! Sei verdammt!«, brüllte da draußen auf den Stufen vor dem Haus eine sich überschlagende Stimme. Ich wich vorsichtig rückwärts und stieß gegen eine Gestalt, die vom hinteren Teil des Hausflurs unbemerkt an mich herangetreten war. Eine junge Frau mit burschikos kurzem Pagenschnitt stand in einem altmodisch geschnittenen schwarzen Kleid da. Sie musterte mich mit neugierigen, hellen Augen. Ich hatte sie nicht an mich herantreten hören, was bei dem Lärm, den mein Verfolger vor der Tür veranstaltete, auch nicht weiter verwunderlich war. So wie ich trug sie keine Schuhe, aber ihre nackten Beine steckten in seidig glänzenden Nylons. Ihre ganze Erscheinung hatte etwas so gespenstisch Durchscheinendes, dass ich mich fürchtete, sie anzusprechen, damit sie sich nicht in einer Nebelschwade auflöste.
Jetzt schlug der Mann draußen vor der Tür mit der flachen Hand gegen das Holz:
»Herrgott, Lina! Ich bring dich um!« Seine brechende Stimme klang, als würden ihm gleich die Tränen kommen. Aber die Frau zog ironisch ihren knallrot geschminkten Mund nach oben.
»Das würde ich gerne erleben.« Ihr Lächeln verstärkte sich. Erleichtert stellte ich fest, dass ich es trotz der bleichen Hautfarbe durchaus nicht mit einem Gespenst oder einer anderen übernatürlichen Erscheinung, sondern mit einer jungen Frau in meinem Alter aus Fleisch und Blut zu tun hatte.
»Was ist hier los, Lina?«, fragte ich. »Du bist doch Lina?« Sie senkte bestätigend den Kopf.
»Komm, wir suchen uns ein ruhiges Zimmer. Leider haben wir nicht viel Zeit«, entschied sie. Entschlossen hakte sie sich bei mir unter, führte mich aus dem Flur durch eine hohe Flügeltür nach rechts in einen Wohnraum, dessen barock angehauchte Möbel mich an die frühen Sechziger Jahre erinnerten. Hierher passte Lina mit ihrem Kleid, das hochgeschlossen spitz ihre Büste ausformte und eine Handbreite unter dem Knie endete. Hinter uns entdeckte der Verfolger offenbar den Klingelzug, den er hartnäckig betätigte. Lina ließ die Türflügel hinter sich ins Schloss fallen und sperrte auf diese Weise das Meiste von dem Lärm aus. Sie trat einen Schritt näher an mich heran.
»Ich würde dich so gerne kennenlernen«, stellte sie fest und berührte mich wieder am Arm, als müsse sie sich von meiner Existenz überzeugen. Ich nickte abgelenkt. Mein umherirrender und noch immer gehetzter, ein sicheres Versteck suchender Blick war auf einen großen, schrankartigen Fernseher gefallen. Dessen spiegelnde und nach vorn gewölbte, stumpfgraue Bildschirmscheibe kennzeichnete ihn als ein uraltes Schwarzweißgerät. Wenn der Fernseher, auf dem eine goldene Zimmerantenne und ein Azaleenstock ruhten, noch funktionierte, musste er ein Vermögen wert sein. Ich kicherte, weil mir das Absurde meiner Situation bewusst wurde: Ich stand mit bloßen Füßen auf einem dicken Teppich aus Schafswolle in einem von einem Mörder belagerten Haus inmitten einer unwirklichen Marslandschaft vor einer attraktiven Frau, die aus ihrer Zeit gefallen war und schätzte dabei den Wert einer ihrer Antiquitäten ab. Lina fiel in mein Lachen ein, auch wenn ihr der Grund nicht klar sein konnte. Eine dritte, hohe Stimme ließ sich glucksend lachend hören: Sie stammte von einem sehr fetten Mann, der im Hintergrund des Raumes neben einer hohen, laut tickenden Standuhr auf einem geblümten Sofa saß. Er schaffte es gerade so, seine Finger über seinem gewaltigen Bauch zu verschränken.
»Das ist Onkel Balder«, flüsterte mir Lina zu, »das Beste ist, du beachtest ihn nicht.« Sie senkte ihre Stimme noch weiter. Ich musste mein Ohr ganz nah zu ihrem Mund bewegen, um sie noch zu verstehen: »Er ist ein wenig seltsam, aber vollkommen harmlos. Darf ich, Katharina?« Ohne auf meine Antwort zu warten, hob sie die Hand vom Arm an meine Wange. Sie streichelte sie mit dem Rücken ihrer schmalen Finger, deren sauber und spitz gefeilte Nägel exakt im Farbton des Lippenstifts leuchteten. Ich wich vor der plötzlichen, mir viel zu intimen Nähe zurück.
»Woher kennst du meinen Namen?«, staunte ich. Onkel Balder in der Ecke steigerte sein Lachen in einen besorgniserregenden Erstickungsanfall, den er allerdings so abrupt beendete, wie er ihn begonnen hatte. Es war, als besäße er einen verborgenen Schalter, mit dem er sein Gelächter ein- und ausknipsen konnte. Lina senkte resigniert ihre Hand. Sie wartete geduldig, bis der Dicke verstummte.
»Willst du nicht in die Küche gehen und uns einen kleinen Imbiss zusammenstellen, Onkelchen? Wir speisen später in der Bibliothek«, wandte sie sich an ihn. Der fette Mann erhob sich erstaunlich gewandt aus dem Sofa und entfernte sich ohne eine Antwort durch eine unscheinbare Tapetentür. »Du hast doch ein wenig Hunger, Katharina, oder?«
Ich wollte auf meiner Frage, woher Lina mich kannte, beharren. Aber sie ließ mich nicht zu Wort kommen: »Dabei können wir auch alles bereden. Du willst dich sicher vorher noch frisch machen, oder? Du bist ja ganz staubig und verschwitzt von dem Dreck und der Hitze da draußen vor der Tür. Wie scheußlich ist die Welt, die die beiden Brüder uns übriggelassen haben! Ein wenig Zeit ist noch, denke ich. Es wäre auch kein Fehler, sich zum Essen etwas Anständiges anzuziehen.« Sie musterte abschätzend mein durch die Flucht in Mitleidenschaft gezogenes Sommerkleid. Sie hatte recht: Ich war nicht gesellschaftsfähig. Wenn ich mich fünfzig oder sechzig Jahre in der Vergangenheit befand, dann sollte ich mich besser den Gepflogenheiten dieser Zeit anpassen. Eine Frage wusste ich allerdings noch. Sie war die Frage, die schon die ganze Zeit in mir war und mich quälte:
»Aber ein Traum ...«, ich zögerte, »… ein Traum ist das nicht, oder?«
Lina lachte wieder. Es war das freundliche, ansteckende Lachen eines kindlichen, warmherzigen Gemüts. »Nein. Ein Traum ist das nicht. Es sei denn, das Leben wäre ein Traum; ein Traum, gefangen in einem Traum.« Sie nickte, als hätte sie etwas sehr Wichtiges gesagt. Mit sehnsuchtsvollem Blick sah sie zum Fenster, dessen zugezogene Vorhänge zwar Licht in den Raum ließen, aber die schreckliche flache Wüste mit ihrer Hitze und ihrem Staub ausschlossen.
Ein Schatten zeichnete sich auf dem Stoff ab. Jemand stand draußen vor dem Fenster. Richtig, die Klingel war seit einer Weile verstummt. Das war mein Verfolger, er gab nicht auf! Wie ich geahnt hatte, war die Sicherheit des Hauses nur eine brüchige. Wir spielten auf Zeit. Lina drückte mir gedankenschnell ihren Zeigefinger auf den Mund. Aber diese Geste war nicht nötig. Ich wagte es ja kaum, Luft zu holen. Zu Statuen unser selbst erstarrt, verharrten wir regungslos und lauschend. Das Gleiche machte wahrscheinlich die Gestalt draußen im Freien. Ich hörte ein leichtes Klirren von Fensterglas. Es folgte ein Geräusch, das sich wie das Schaben eines Werkzeugs auf Holz anhörte.
»Lina, Lina«, war eine Stimme zu vernehmen, ganz nah und kaum gedämpft, als würde sie nicht draußen im Sand, sondern direkt neben uns erklingen. War das Fenster hinter den Vorhängen etwa geöffnet? Wenn er jetzt einfach den Stoff zur Seite schob, dann würde er uns doch zweifellos entdecken. »Lina, ich krieg dich!« Trotz der hörbar mitschwingenden Wut sang die Stimme die Worte fast. Ich zuckte zusammen, hätte laut aufgeschrien, wenn mir nicht meine Beschützerin weiterhin fest den Finger auf die Lippen gepresst hätte. An meinen Armen stellten sich Haare auf, als würde jemand auf sie hauchen.
»Und morgen«, fuhr der Mann mit seinem Singsang fast fröhlich fort, als sage er einen alten Kinderreim auf, der ihm gerade in den Sinn kam, »hole ich mir mein Kind. Lina, Lina, sieben, acht, neun, du wirst das noch bereu’n.« Der Schatten bewegte sich, glitt über den Vorhang, verschwand. Die Stimme wurde zugleich schwächer, summte nur noch ihre einfache Melodie, verstummte dann. Es dauerte einige Zeit, bis wir es wagten, uns zu bewegen. Ganz vorsichtig löste Lina ihren Finger von meinem Mund.
»Nein. Dies ist kein Traum«, sagte sie so ruhig, als hätte das Intermezzo sie gerade überhaupt nicht erschreckt, »denn der Traum bringt uns den Tod.«
Ich stand in dem kleinen Gästezimmer, das mir meine Beschützerin zugewiesen hatte. Ich weinte. Die Tränen liefen mir als Rinnsal über die verschmierten Wangen, sammelten sich an der Spitze meines Kinns und tropften herab. Zu mehr war ich nicht fähig: Ich konnte stehen und heulen und ab und an krampfhaft schniefen, damit mir nicht auch noch der Rotz aus der Nase lief.
Als ich vorhin mit dem Aufschreiben dieses Berichts begann, war es mein Plan gewesen, meine Erlebnisse in der Villa so genau, wie es mir möglich ist, zu beschreiben. Ich wollte von jeder noch so bedeutungslosen Kleinigkeit zu berichten, die ich gesehen oder erlebt habe. Du solltest dir die Farben, Formen, Stimmungen, die Worte, die gesagt und die, die verschwiegen wurden, die Augenblicke, die Handbewegungen, einfach alles, vorstellen können. Ich dachte, nur so würde ich die Schimäre bannen und in dem Netz fangen, das ich mit meinen Worten webe. Ich wollte mir selbst versichern, dass ich nicht irregeworden bin. Ich hatte vor, mich mit den Fingern an dem Unfassbaren festklammern, es im sicheren Bereich des Versteh- und Nachvollziehbaren herabziehen. Ich wollte erzählen, als wären meine Erlebnisse so normal wie ein Spaziergang in der Stadt. Daran bin ich gescheitert: Ich kann beispielsweise in diesem Notizbuch nicht berichten, wie ich in das Zimmer gelangt bin, in dem ich nun stand und heulte. Erst später stellte ich fest, dass es im 1. Stock der Eulenvilla lag. Ich habe ab dem Moment der Gefahr in dem Fernsehraum alles bis zu dem Augenblick vergessen, an dem ich weinend vor einem unbezogenen Bett stand. Auf ihm lagen ein Unterhemd, eine schlichte, weiße Bluse und ein dunkler Rock aus dickem Wollstoff. Ich vermutete, es wären Kleidungsstücke von Lina, was sich allerdings später als falsch herausstellte.
Irgendwann in der Zwischenzeit hatte auch der Tinnitus in meinen Ohren aufgehört. Aber ich habe für die Zeit davor in meiner Erinnerung einen buchstäblichen Filmriss. Er wies sogar die klassischen ein, zwei überlappenden Bilder an der Klebestelle auf. Sie zeigten zum einen die graue Scheibe des antiken Fernsehers und darüber gelegt, wie in einer Doppelbelichtung, ein von meinen Tränen verschwommenes Gemälde. Es hing hier im Raum über dem Bett. Das gerahmte Bild war ein Picasso aus seiner kubistischen Periode oder auch ein Braque. Ich kann das nicht unterscheiden. Ob die Collage eine Kopie, ein Druck oder ein Original war, vermochte ich auch nicht zu beurteilen. Vermutlich war es jedoch echt und eine Kostbarkeit, denn meine Gastgeber erschienen mir sehr reich. Ich selbst kann nicht viel mit dieser Art von Kunst anfangen.
Nach einer Weile siegte die Neugierde. Ich wurde etwas ruhiger und sah mich um. Das schmale Gästezimmer hatte drei Türen: Da war der Eingang, durch das ich es wahrscheinlich betreten hatte, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnerte. Dann gab es noch eine Glastür, die auf einen quadratischen Balkon führte und schließlich einen Durchgang in ein enges Bad ohne Fenster. Da ich das Ungeheuer fürchtete, das uns sicherlich weiterhin belagerte und nach einem Eingang suchte, traute ich mich nicht, näher an die Balkontür zu treten, von der man vielleicht früher einmal auf einen Garten an der Rückfront des Gebäudes oder doch eher auf eine Parkanlage hinuntergesehen hat. Jetzt waren von meinem Platz aus über der Umzäunung des Gebäudes nur ein verwaschener, grauer Himmel und die aufgeblähte, bleiche Sonnenscheibe zu sehen. Merkwürdig! Ich hatte nicht den Eindruck, als hätte sie sich in der Zwischenzeit weiterbewegt.
Inzwischen hatte ich mich wieder so weit an meine absurde Situation gewöhnt, dass meine Tränen versiegten. Ich war leer geweint. Das gibt es, ich hatte das schon erlebt. Zurück blieb wie jedes Mal ein stumpfes, nicht ganz greifbares Gefühl von Verlust und Resignation. Es war eine sich langsam mit Gleichgültigkeit füllende Leere. Achselzuckend nahm ich die für mich vorbereitete Kleidung auf und trat ins Bad. Es tat gut, die glatte, weiße Tür zu schließen, sich gegen sie zu lehnen und ihre Kühle an den Armen zu spüren. Ich ließ auf diese Weise alles außen vor und funktionierte nur noch. Du weißt, das ist meine Art, mit Krisen fertigzuwerden. Ich schotte meinen Geist vor mir selbst ab und reduziere mich auf alltägliche Handlungen. Wie eine durch einen Puppenspieler gelenkte Marionette erledigte ich die Rituale der Körperpflege und kam dabei ein wenig zur Ruhe.
Ich ließ die freistehende Badewanne mit warmem Wasser volllaufen und fügte etwas nach Flieder riechendes Badesalz aus einer Karaffe hinzu, die griffbereit am Beckenrand stand. Ist es glaubhaft, dass ich mir keine Gedanken darüber machte, woher das Wasser kam oder der Strom für die kahle Lampe, die das fensterlose Bad beleuchtete? Wohin das Abwasser der Toilettenspülung gelangte? Wie es dieses Haus inmitten des Nichts überhaupt geben konnte? Ich war entschlossen, mich zu nicht wundern und nahm die seltsamen Dinge, wie sie kamen. Etwas anderes blieb mir ja auch nicht übrig.
‚Mag sein, dass das kein Traum ist‘, dachte ich, als ich entspannt in der Wanne lag und mir den juckenden Sand abwusch, ‚aber ich werde so handeln, als wäre es einer. In meinen Träumen wundere ich mich schließlich ebenfalls über nichts. Egal, wie absurd die Situationen sind.‘
Während auch die dumpfen Rückenschmerzen verschwanden, die ich seit meiner Ankunft spürte, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf, die wie Motten zum Licht zurück zu dem Straßenfest vor dem Haus des Bildhauers Linus Binderseil flatterten. Obwohl objektiv nicht einmal eine Stunde vergangen sein konnte, seit ich die Veranstaltung in panischer Flucht verlassen hatte, fühlte sich meine Erinnerung an den Abend wie Geschichte an, die mir jemand vor langer Zeit erzählt hatte. Ich wusste, es wäre besser für mich, ich würde so schnell wie möglich zurückkehren, falls das noch möglich war und es einen Weg nach Hause gab. Je länger ich hier im Gotto der Eulenvilla ruhte, umso spürbarer verlor ich den Anschluss an mein Leben, vergaß ich, was wichtig war.
Nein! Ich durfte nicht auf die trügerische Ruhe hereinfallen. Ich musste mich dem Ungeheuer dort draußen stellen, meinen Heimweg erzwingen und Jonas vor dem alten Mann warnen, der, wie ich erlauscht hatte, auf makabere Weise seinen Tod plante. Wenn es noch einen Funken Zuneigung zwischen uns gab, vielleicht sogar eine kleine Liebe, dann hatte ich die Verpflichtung, ihn zu warnen.
Dort in der Wanne, während ich Gefahr lief, im warmen Wasser einzuschlafen, in einem Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlafen, kam mir zuerst der Gedanke, dies alles für Jonas aufzuschreiben. Ich wollte ihm zumindest eine Flaschenpost zukommen lassen, wenn es mir nicht gelingen sollte, heil zurückzukehren. Ich brauchte nur einen Stift und Papier, das Weitere würde sich schon ergeben. Es war zudem wahrscheinlich der einzige Weg, auf dem ich ihn erreichen konnte, denn er würde mir sicherlich nicht zuhören. Vielleicht konnte ich ihn auch anrufen. Gab es im Haus ein Telefon? Konnte es zwischen den Welten funktionieren? Das war zwar absurd, aber versuchen musste ich es.
Ich schreckte hoch, schob meinen nackten Oberkörper aus dem seifigen Wasser, das sich mit einem Mal eiskalt anfühlte. Es war ein krampfhaftes Zusammenzucken aller Muskeln, als hätte ich einen Kuhdraht berührt. Ich war wieder hellwach, nachdem ich eben fast eingenickt war. Oder hatte ich bereits geschlafen? Denn in dem Moment vor meinem gefühlt nur eine Sekunde andauernden epileptischen Anfall war ich zuhause gewesen. Ich war aus der endlosen Wüste zurückgekehrt. Ich hatte meine Augen unter einem üppig von Sternen übersäten Nachthimmel geöffnet, das unregelmäßige Altstadtpflaster unter meinem Rücken gespürt. In diesem zeitlosen Augenblick lag ich am Boden, atmete flach und stoßweise. Ein mir nicht bekanntes, besorgtes Gesicht beugte sich zu mir herab. Ich wollte etwas sagen, öffnete den Mund und spürte viel Feuchtigkeit und einen ekligen, salzigen Geschmack auf der Zunge. Blutete ich? War ich verletzt? Starb ich?
Mit diesem Gedanken kehrte ich, wie durch einen Stromstoß geweckt, zurück in das längst erkaltete Wannenbad.
Die geliehene Kleidung war mir zu eng. Die Bluse spannte unter den Achseln und warf Falten über der Taille, auch der enge Rock ermöglichte nur kurze, tippelnde Schritte. Aber wenn niemand größere gymnastische Übungen von mir verlangte, würde es gehen. Nach dem Essen könnte ich wahrscheinlich wieder meine eigenen, modernen Sachen anziehen, die ich im Waschbecken oberflächlich gesäubert und zum Trocknen mit einem Kleiderbügel aus dem leeren Schrank des Gästezimmers an die Lampe gehängt hatte. Die bereitgestellten spitzen Pumps mit halbhohen, dünnen Pfennigabsätzen ignorierte ich, die waren mir dann doch zu altmodisch und unbequem. Wenn die Gastgeberin barfuß ging, dann durfte ich das auch. Fertig angezogen setzte ich mich auf die Matratze und wartete. Ich wunderte mich über das helle Licht, das vom Balkon in das Zimmer fiel. In meiner Welt war es vor meinem Wechsel hierher bereits auf zehn Uhr abends gegangen. Die lange Dämmerung jenes Sonntags kurz vor der Sommersonnenwende war dabei gewesen, sich endgültig in die Hände der Nacht zu begeben. Hier jedoch herrschte noch immer heller Tag. Hatte die Zeit in der Eulenvilla einen vollkommen anderen Rhythmus und zerdehnte sich wie ein Kaugummi? Das war vielleicht der Grund, aus dem Lina mich warten ließ.
Inzwischen knurrte mein Magen. Ich entschied, mich selbst nach der Bibliothek umzusehen, wo der versprochene Imbiss auf mich warten sollte. Der kleine Teller mit Reissalat, den ich beim Atelierfest von Binderseil ergatterte, hatte nicht lange vorgehalten und mein Magen knurrte bei dem Gedanken an Essen. Ich öffnete behutsam die Tür des Zimmers und trat in den langen Gang, der den ganzen Gebäudeflügel kreuzte und auf der einen Seite von einer Treppe, auf der anderen von einer Glastür begrenzt wurde. Links und rechts lagen in regelmäßigen Abständen Räume, deren Türen allerdings bis auf meine und eine weitere in der Nähe des Treppenhauses verschlossen waren. Hier sah es ganz wie in einem Hotel aus, es fehlten nur die Zimmernummern. Ich konnte mich wirklich nicht erinnern, dass ich vorhin mit Lina diesen Flur entlanggekommen war.
Der einzige weitere offene Raum stellte sich als ein altmodisches Arbeitszimmer heraus: Schreibtisch, Sessel dahinter, Regale mit Aktenordnern und irgendwelche in Leder gebundene Bücher. Es war wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur, wie ich ihren Rückentiteln beim oberflächlichen Betrachten entnahm. Der Tisch war penibel aufgeräumt. Außer einer Briefwaage, einer Dose mit gespitzten Bleistiften und einer dünnen Mappe mit Schreibpapier war er vollkommen leergeräumt. Ich schob einen Bleistift in die Brusttasche meiner Bluse und versuchte mein Glück mit den Schubladen des Tischs. In einer lag neben weiteren Büroutensilien ein schwarzes Notizbuch in Oktavformat. Als ich es in die Hand nahm, blieb ein scharf geschnittener Rahmen am Boden der Schublade zurück. Ich blies den Staub vom Umschlag. Beim Öffnen sah ich, dass die Seiten etwa zu einem Drittel von einer engen, recht jugendlich wirkenden Hand beschrieben waren. Der Rest der vergilbten Blätter war noch leer. Mir schien, dieses kleine Buch hätte viele Jahre hier auf mich gewartet. Es war ideal für meinen Zweck, meine Erlebnisse aufzuschreiben, damit ich Jonas warnen konnte. Ich blätterte ohne großes Interesse in dem bereits benutzten Teil. So weit ich es in der Eile sah und begriff, waren es Aufzeichnungen über physikalische Versuche und Testreihen. Ich fand Skizzen von Stromkreisen, Schaltpläne und einige recht gute Detailzeichnungen eines ein wenig an einen Herd erinnernden, elektrischen Gerätes, das ich nicht identifizieren konnte. Auf jeden Fall war es nichts Wichtiges, das hier jemand vermissen würde. Schließlich schien das Notizbuch bereits seit Ewigkeiten in der Schublade geruht zu haben. Ich schloss den Band und überlegte, wie ich ihn bei mir tragen konnte, ohne dass es jemandem auffiel. Schließlich lockerte ich den Gürtel meines Rocks, schob den Band hinten halb in den Bund und ließ die Bluse darüber hängen. Das sah sicher nicht elegant aus, aber es verbarg meinen kleinen Diebstahl. Ich musste nur vorsichtig sein, wenn ich mich setzte.
Dennoch wollte ich in diesem Zimmer nicht ertappt werden und trat eilig zurück in den Gang. Mir war dabei, als würden bereits unsichtbare, missbilligende Augen auf mir lasten. Die Stille in der großen Villa fing erneut an, mir auf die Nerven zu gehen. Wohnten hier wirklich nur die zwei Menschen, denen ich begegnet war, und waren sie zusammen mit dem Verfolger und mir die einzigen Lebewesen dieser Wüstenei? Konnte es das geben, eine Welt, die nur wegen vier Leuten existierte? Wie geisteskrank musste ein Gott sein, der sich diese Mühe machte?
Ich stieg die Treppe zum Erdgeschoss hinunter. Auf der letzten Stufe verharrte und lauschte ich: Außer dem fernen metallischen Ticken der Standuhr, die ich im Fernsehzimmer gesehen hatte, drang kein Geräusch an mein Ohr. Wo konnten die Bibliothek oder die Küche sein? Aufs Geratewohl wandte ich mich nach rechts und gelangte in einen Salon, der wie ein Raucherzimmer des 19. Jahrhunderts eingerichtet war. Zwei riesige Ohrensessel und ein niedriger Nierentisch, auf dem ein schwerer steinerner Aschenbecher stand, waren vor den erloschenen offenen Kamin gerückt. Über ihm hing ein in naturalistischer Manier ausgeführtes Gemälde. Es bildete als überlebensgroßes Ölportrait einen hageren, alten Patriarchen mit stechendem Blick ab. Er hatte wahrscheinlich sehr unwirsch wegen des Zeitverlusts auf den Maler geblickt und musterte jetzt hochmütig und überlegen den Betrachter seines Konterfeis. Das Gefühl der Unwirklichkeit nahm zu. War ich denn noch tiefer in der Zeit versunken, war 1965 erst eine Zwischenstation gewesen und ich jetzt in den Gründerjahren angekommen? Ich trat näher an das Bild heran und musterte es. Die harten, unnachgiebigen Gesichtszüge des Alten erinnerten mich von fern an meinen Verfolger und verrückterweise auch ein wenig an Jonas. Er konnte ebenso abweisend und arrogant blicken. Das war sein Schild, wenn ihm jemand zu nahe kam. Aber ich saß sicher nur einer Täuschung auf. Denn was sollten denn der missgelaunte Großbürger auf dem Bild und Jonas gemein haben?
Auf einem Messingschild unter dem Bild war zu lesen: »Julian Waldescher sen., 1886 – 1952«.
»Mein alter Herr hasste dieses Bild. Man hat ihn zu den Sitzungen beim Maler zwingen müssen. Ein Industrieller, der etwas auf sich hielt, musste sich damals einfach porträtieren lassen.« Musste mich denn heute jeder von hinten anreden? Erneut erschrocken drehte ich mich um. In einem der Sessel saß der dicke Mann, den Lina ‚Onkel Balder‘ nannte. Ich hatte ihn beim Hereinkommen nicht bemerkt. Ohne den Blick vom Gemälde zu lösen, deutete er einladend auf die andere Sitzgelegenheit und fuhr fort:
»Obwohl er sich vom preiswertesten Künstler, den man auftreiben konnte, malen ließ, ist das Gemälde wirklich gelungen. Es zeigt ihn genau so, wie er war. Trotzdem versteckte Vater es bis zu seinem Tod im Dachboden. Malerei und Kunst allgemein waren ihm lästige Zeitverschwendungen. Alles außer seiner Arbeit war für ihn Zeitverschwendung. Wie er zu zwei Söhnen gekommen ist, weiß ich nicht. Obwohl ich vermute, dass meine Wenigkeit seine Existenz einem Fehltritt von Mutter zu verdanken hat. Nun, das werden wir nie erfahren, nicht?« Er kicherte und machte eine wegwerfende Handbewegung. Nachdem er bisher nur das Bild gemustert hatte, fiel sein Blick auf mich.
»Wo ist Lina?«, fragte ich. Balder stutzte. Er wirkte plötzlich verwirrt.
»Lina Brunswick? Meinst du das Kindermädchen? Was weißt du von ihr? Woher kennst du sie denn, Agnes? Als sie in den Eulenhorst kam, da warst du doch ...«, stotterte er und verlor dann vollkommen den Faden. Er verstummte und starrte mich an, als würde er einen Geist sehen. ‚Ausgerechnet‘, dachte ich. Agnes? Wer war denn das schon wieder? Sprach er von einer weiteren Frau, die hier lebte und mit der er mich gerade verwechselt hatte? Balder presste eine Hand gegen seine Stirn und kniff die Augen zusammen. Als er sie wieder öffnete, wirkte er, als habe er meine Frage vergessen und würde das Gespräch ganz von vorne beginnen.
»Ich wollte dich das schon lange fragen, meine süße Agnes mit dem roten Haar. Hast du irische Vorfahren?« Jetzt setzte ich mich doch, der Sessel fühlte sich wegen des Notizbuchs in meinem Rücken ein wenig unbequem an. Der Fette verwechselte mich in der Tat mit jener Agnes, wer immer das auch war. Dies war auf jeden Fall meine Gelegenheit, mehr über die Menschen im Haus und ihre Beziehungen zueinander zu erfahren.
»Ich glaube nicht«, antwortete ich vorsichtig. Ich verschwieg ihm, dass ich meine Haare seit meiner Jugend rot färbte und sie darunter von einem verwaschenen Allerweltsbraun waren, das ich schon immer abscheulich gefunden hatte.
»Ach, das ist aber schade. Das bringt mein Weltbild doch etwas durcheinander. Aber vielleicht war ein vorwitziger Kelte unter deinen Vorfahren, wer weiß? Diese Haarpracht, die grünen Augen, die Sommersprossen, die kommen nicht einfach von allein. Dein Name jedenfalls kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‚die Reine’, ‚die Aufrichtige’, weißt du?«
Fast hätte ich mich staunend verraten: Auch ‚Katharina‘ hatte diese Bedeutungen im Griechischen. Ich nickte bestätigend.
»Freilich weißt du das. Ich habe es dir schon oft genug erzählt. Wie ich Julian um dich beneide ... Ihr zwei seid aber auch solch ein schönes Paar. Agnes und Julian Waldescher; das ist wie Titania und Oberon.«
Ich sah erstaunt hinauf zu dem Alten über dem Kamin. Balder folgte meinem Blick.
»Ja, der Herr Kommerzienrat war gar nicht einverstanden mit eurer – wie nannte er das? - Liaison, Mésalliance? In der Richtung ... Er liebte jene französischen Wörter, die auch dann noch hübsch klingen, wenn sie abfällig gemeint sind. Ausgerechnet sein Junior Julian enttäuschte ihn! Mein wohlgeratener Bruder, den er nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit seinen ganzen Hoffnungen belastete, der immer treu und brav dem Herrn Papa alles recht zu machen suchte. Er war nicht so faul und aus der Art geschlagen wie meine Wenigkeit, sein Erstgeborener. Julian war nicht an der französischen Küche, sondern am Wohl der Firma interessiert. Ausgerechnet dieser gute Sohn wirbt um die Tochter eines subalternen Angestellten. Was für ein Skandal! Der eine Nachkomme ist schwul ... Verzeihung!« Balder legte geziert zwei Finger auf die Lippen und kicherte.
»Harpokrates, wo sind deine Manieren? Mein Vater nannte mich ... indifferent. Ja, genau, das waren sein Wort. Der Ältere war indifferent, der Jüngere wollte sich unter Stand und Möglichkeiten verloben. Er drohte sogar offen mit dem Bruch. Kein Wunder, dass diese Aufregung zu viel für das Herz des Alten war. Er nahm schon seit Jahren Nitroglyzerin wegen seiner Angina pectoris. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihn der Schlag treffen würde.« Der Dicke machte eine dramatische Pause.
»Du hast es nicht miterlebt. Der Patriarch sitzt am Sebastianstag an der Spitze der Tafel, in der einen Hand eine fetttriefende Keule von der Festtagsgans, in der anderen sein Weißweinglas. Das war ein leichter Riesling aus dem Rheingau, wenn ich mich richtig erinnere. Da wird er mit einem Mal ganz käsig, hustet einmal. Das Glas rutscht ihm aus den Fingern und entleert sich, während es über das Tischtuch rollt. Ich sehe dem Ganzen erstaunt zu und denke noch: ‚Schade um den guten Tropfen.‘ Vaters Augen quellen hervor. Er krächzt etwas, das man mit etwas schlechtem Willen schon für eine Obszönität halten könnte. Selbst wenn so etwas niemals aus seinem Munde gekommen wäre … auch nicht in solch einem Augenblick. Anschließend knallt er mit dem Kopf in seinen Teller, einfach hinein ins Blaukraut, dass es spritzt. Patsch!« Balder klatschte vergnügt einmal in die Hände.
»Den Arm, in dessen Hand er den Gänsefuß hielt, streckte er noch nach oben. Das sah so komisch aus! Eine Sekunde herrschte betretenes Schweigen. Dann prustete ich los, lachte schallend; auch noch, als unser Butler respektvoll von links an unseren alten Herrn herantrat, sich gelassen einen seiner weißen Handschuhe auszog, sanft am Hals des Alten nach einem Puls suchte und stumm und ergriffen den Kopf schüttelte. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Mein Vater hatte mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht zum Weinen, sondern zum Lachen gebracht. Dein Julian führte mich aus dem Zimmer. Er lachte nicht. Aber glaube mir, er war ebenso erleichtert wie ich. Er hat den Alten genauso gehasst und wenn er seinen Tod schon nicht herbeisehnte, so nahm er ihn doch wie ein Geschenk billigend an. Niemand trauerte am Grab des Herrn Kommerzienrats Julian Waldescher senior, des großen Wirtschaftsmagnaten und Lobbyisten. Meine Mutter, die sich schon vor dem Krieg von ihm getrennt hatte, kam nicht einmal zur Beerdigung. Sie schickte nur eine Postkarte aus dem Seebad, in dem sie wahrscheinlich recht behaglich im Exil lebte. Sie interessierte in erster Linie, wie viel vom Erbe er ihr vermacht hatte.
Für Julian war der Weg nun frei. Er erbte die Firma und heiratete dich einen Monat, nachdem wir Vater unter die Erde gebracht hatten. Wunderbare neue Zeiten brachen für die Eulenvilla an. Ich habe dir das nie gesagt, Agnes, aber du warst das Beste, was dem alten Gemäuer und den beiden sonderbaren Brüdern, die es nun mit dir und ein paar Dienstboten bewohnten, passieren konnte. Du hast auch alles sofort auf den Kopf gestellt. Du hast gelüftet, endlich das muffige Gerümpel und Interieur, das sich seit dem ersten Weltkrieg angesammelt hatte – Vater schmiss ja nie etwas weg - zum Sperrmüll gegeben. Die alten, schweren Vorhänge und die Stofftapeten verschwanden, der ganze Plüsch und die verstaubten Orientteppiche und diese unmöglichen Kerzenständer überall. Der Butler und die Köchin wurden entlassen, denn ihre Dienste wurden nicht mehr benötigt. Die Moderne kehrte in der Villa ein: Neue sanitäre Anlagen, moderne Stromversorgung, statt der Kandelaber und Lüster helle Lampen. In jedes Zimmer kam ein Radio, aus dem alten Empfangssalon wurde das Fernsehzimmer gemacht ... und mein Reich erst! Was für ein Vergnügen. Die Küche – welch eine Wandlung machte sie durch. Ich bekam endlich den modernen Gasherd, den Hans-Peter und ich uns wünschten, eine Braun-Küchenmaschine, einen Gefrierschrank und sogar eine Mikrowelle!« Balder stockte.
»Ja, eine Mikrowelle«, murmelte er. Seine Augen flatterten erstaunt und er wirkte, als wisse er kurz nicht, wo er war. Doch gleich darauf fasste er sich und redete weiter.
»Was habe ich dort mit Hans-Peter zusammen für leckere Gerichte gezaubert, nachdem die alte Köchin weg war! Endlich kamen wir los von der langweiligen, gewürzlosen Gutshofküche. Vive la cuisine française! Kannst du dich noch an das Cordon Bleu erinnern, das wir anlässlich unseres Erntedankfests am Ende des ersten Sommers genossen? Allein für die Reduktion der Sauce habe ich drei Flaschen vom 51er Vino Nobile verdampft. Dazu gab es, allerdings etwas unpassend, den traumhaften Burgunder, den ich in Musigny einem alten Winzer abgeschwätzt hatte. Du hast hinten im Garten unter der alten Ulme aufdecken lassen. Dort, wo Julian im darauffolgenden Frühjahr den Tennisplatz bauen ließ. Was war das für ein Abend, einer von denen, die endlos scheinen und doch so schnell vergehen! Ein letzter, südlicher Wind brachte Wärme. Bunte Girlanden und Lampions hingen in dem Baum. Du hast ein gemustertes Kleid getragen, das aussah, als hätte Mondrian selbst noch den Stoff entworfen. Als es kühler wurde, brachte ich dir eine Strickjacke von mir, weißt du noch? Du warst so fröhlich, so ausgelassen wie ein kleines Kind. Du hast uns verzaubert, uns, die berüchtigt schwermütigen und misanthropen Gebrüder Waldescher. Alles schien mir mit einem Mal möglich und ich sah durch das Licht, das dein Lachen erschuf, eine strahlende Zukunft vor mir, wo vorher nur Düsternis geherrscht hatte. Der berüchtigte Familien-Fluch, wir pfiffen auf ihn. Die Welt war neu und wartete nur auf uns. Und du bist uns vorausgegangen mit sanften, schwebenden Schritten wie die ‚Freiheit‘ auf dem Gemälde von Delacroix. Dein feuerrotes Haar loderte wie eine Fackel über dir. Einem Engel gleich erschienst du mir in jener Nacht. Nein, kein Engel: Du warst eine Elfe, ein keckes, sommersprossiges Wesen vom Anderen Volk. Großzügig teiltest du mit uns das Übermaß an Liebe, das dir gegeben war. Wir sonnten uns in dieser Liebe und du gabst uns Kraft.
Wenn wir nur geahnt hätten, wie zerbrechlich du doch in Wirklichkeit bist, wir hätten den Eulenhorst mit Watte ausgefüllt und dich in ihr wie in einer gepolsterten Porzellankiste behütet. In jener Nacht, beim Dessert – ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, es gab Hans-Peters überirdische Crème bavaroise – hast du uns mitgeteilt, du wärst schwanger. Julian war nie glücklicher, glaube ich.« Onkel Balder verstummte. Ich sah, wie er um Worte rang und keine fand. Eine Träne glitt über seine Wange, während seine schwitzige Hand die meine suchte. Ich beugte mich nach vorn und drückte sie fest, weil ich dachte, es würde ihm helfen.
»Aber Onkelchen. Du weißt, du sollst dich nicht aufregen!« Lina trat zu uns in den Salon. Ihre ruhige, hypnotische Stimme wirkte sogleich: Der unförmige Mann wand verschämt und ertappt seine Hand aus der meinen, lächelte zur Seite und beruhigte sich. Ich sah, wie er auf seinen Lippen kaute, aber keinen Widerspruch wagte. Schade, ich hätte gerne mehr über die Geschichte der Hausbewohner von dem vielleicht etwas wirren, aber durchweg sympathischen Mann mit dem seltsamen Namen erfahren.
Lina wandte sich an mich. Sie klang ungehalten:
»Ich bat dich doch, ihn in Ruhe zu lassen. Wo warst du denn? Ich warte schon seit einiger Zeit in der Bibliothek auf dich.« Ich erhob mich vorsichtig mit gerade durchgestrecktem Rücken wie eine Schwangere aus dem Sessel, damit mein kleiner Buchdiebstahl nicht bemerkt wurde. Dabei beobachtete mich Lina ironisch, als hätte sie mich längst durchschaut. Wie immer, wenn ich mich eigentlich kleinlaut verteidigen müsste, wurde ich wütend. Das ist ein Reflex, den ich nicht unter Kontrolle habe.
»Woher soll ich denn wissen, wo diese blöde Bibliothek ist?«, giftete ich zurück. »Das ist kein Haus, sondern ein Irrgarten! Ich dachte, vielleicht holt mich ja jemand von meinem Zimmer ab. Als niemand kam, begann ich zu suchen.«
»Katharina, ich habe dir vorhin gesagt ...«, brauste Lina auf. Offenbar konnte auch sie manchmal zornig werden. Aber sie hatte sich gut im Griff und ruderte sofort zurück. Sie nickte.
»Ich verstehe. Entschuldige bitte, wir hatten schon so lange keinen Besuch mehr.« Und damit hakte sich mal wieder familiär bei mir unter. Sie schob mich mit sanfter Gewalt zur Tür hinaus. Ich hörte Onkel Balder hinter mir ein paar zusammenhanglose Wörter murmeln. Es hörte sich an, als würde er die Zutaten für ein Kochrezept aufsagen.
»Wir müssen uns beeilen. Ich fürchte, unser Feind wird bald einen Eingang finden. Du bist hier nicht mehr sicher, Katharina.«
Ich blieb stehen, befreite mich aus ihrem Arm. Wann begriff sie endlich, dass ich diese Nähe nicht wollte? »Er hielt mich für eine Frau namens Agnes, das war ...«
»Ja. Das war Julians Gattin, die Ehefrau seines Bruders. Ich bin ihr nie begegnet, ich kam erst Jahre später in die Eulenvilla. Aber es gibt hier viele Fotos von ihr. Du siehst Agnes tatsächlich etwas ähnlich. Sie hatte rote Haare und du trägst gerade einige ihrer alten Sachen. Julian brachte es nie über sich, ihre Kleidung wegzuwerfen. Ein paar der Zimmer sind wie ein Museum für seine Frau hergerichtet. Wahrscheinlich hat dich Onkel Balder wegen dieser Ähnlichkeit mit ihr verwechselt. Er ist schon lange nicht mehr vollkommen bei sich. Das passiert manchmal, wenn der Andere drüben in der Welt stirbt. Das ist ganz so, als würde ein Faden durchtrennt. Balder kam nicht damit zurecht, plötzlich auf sich allein gestellt zu sein.«
»Das wird mir alles zu viel. Was willst du damit sagen? Von welchem Anderen sprichst du? Und was ist mit Agnes geschehen?« Nun war es so weit: Ich explodierte. »Jetzt rede endlich Klartext: Wer, zum Teufel, steht da draußen und will mich umbringen?«
Ich packte Lina fest an den Schultern und schüttelte sie. Sie ließ es sich wie eine willenlose Puppe gefallen und ihr Kopf schwang dabei vor und zurück. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, ich hielte eine Tote in meinen Händen. Entsetzt ließ ich sie los und wich einen Schritt zurück. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie leblos zu Boden gesunken wäre. Zum ersten Mal, seit ich in der Villa Unterschlupf gefunden hatte, kamen mir Zweifel, ob ich es bei den beiden Bewohnern mit lebendigen Menschen zu tun hatte oder mit mechanischen Aufziehpuppen, die für mich ein seltsames, von ihrem Schöpfer programmiertes Theaterstück aufführten. Lina jedenfalls stand nach meiner Attacke still, legte den Kopf zur Seite, als würde sie auf eine innere Stimme hören, die ihr Anweisungen gab.
»Du verschwendest deine Wut«, sagte sie mit kalter und gleichgültiger Stimme, die mich noch mehr erschreckte als ihr vollkommenes körperliches Unbeteiligtsein. »Hebe sie dir auf, du wirst sie für den Übergang brauchen.«
»Was meinst du damit?«, blaffte ich. Lina verzog die Lippen. Es wirkte auf mich, als würden ihre Mundwinkel mit einem dünnen Faden nach oben gezogen. Das Lächeln erreichte nicht ihre Augen.
»Du willst doch wieder zurück, oder? Du möchtest nicht hier stranden, in diesem Haus in einer untergegangenen Welt, umgeben von den unglücklichen Geistern einer Vergangenheit, die nicht die deine ist?«
»Dann seid ihr tatsächlich nur Gespenster, du und Onkel Balder und wer auch immer hier noch wohnen mag?«
»Wirken wir wie Untote auf dich?«, erwiderte Lina ironisch. Sie zeigte wieder Emotionen. Der Moment, in dem sie wie eine Maschine gewirkt hatte, war so schnell vergangen, wie er gekommen war. Ihre Belustigung wirkte echt. Doch sogleich wischte sie ihr Lächeln und ihre Anteilnahme achtlos zur Seite, als würde sie einen lästigen Krümel vom Kleid entfernen.
»Auf der anderen Seite stimmt es aber doch: Bei dir, in deiner wohleingerichteten, funktionierenden Welt sind wir schon seit Jahren tot; wahrscheinlich existieren nicht einmal mehr unsere Gräber. Obwohl, Onkelchen liegt sicher in der Familiengruft ... aber mein Begräbnis? Wer sollte sich schon um die Grabstätte eines jungen, früh verstorbenen Kindermädchens kümmern, das als Waise in einem Heim aufwuchs und es nur der Mildtätigkeit der Waldescher-Stiftung zu verdanken hatte, dass sie die Schule abschließen und dann hier eine Anstellung finden konnte.« Sie seufzte und forderte mich mit einer Armbewegung auf, ihr nach links in einen dunklen Gang zu folgen, den ich schon kannte. An seinem Ende lag das Fernsehzimmer.
»Ich dachte tatsächlich«, fuhr sie fort, »die Eulenvilla böte mir die Chance meines Lebens. Wie naiv war ich doch! Ich dachte, ich könne mir eine Zukunft schaffen. Ich machte mir sogar Hoffnungen ... Egal, die ‚Andere‘ hat dem ein Ende gesetzt. Soll sie in Frieden ruhen in ihrem namenlosen Grab.« Lina musterte mich scharf. Sie überlegte, was sie sagen konnte und was nicht. Ich durfte jetzt nicht locker lassen! Ich wusste, dass ich durch ihre Worte endlich das entscheidende Puzzleteil zwischen den Fingern hielt. Ich hatte nicht vor, es so schnell wieder aus der Hand zu geben.
»Dieses Kind, das du hier gehütet hast, das war das Kind von Agnes und Julian Waldescher, habe ich recht? Was ist passiert? Und was hat das alles mit mir zu tun?« Lina blieb vor einer verschlossenen Tür stehen, aber anstatt sie zu öffnen, zögerte sie.
»Du bist ein Schlüssel«, sagte sie fast tonlos. »Es gibt insgesamt fünf.« Furcht schwang mit ihrer Stimme. »Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber du musst mir vertrauen. Du musst zurückgehen, bevor dir in deiner Welt etwas zustößt. Heute ist Sonntag, der 16. Juni – nicht wahr? Es fehlen noch ein paar Tage bis zur Sommersonnenwende und du gehörst nicht hierher. Doch zuerst solltest du dich etwas für den Rückweg stärken und ich möchte dir noch einen Bewohner des Eulenhorstes vorstellen.«
Lina führte mich zu einem Raum, der dem Fernsehzimmer gegenüber lag und eine spiegelbildliche Kopie von ihm war. Hier jedoch hatte man an allen Wänden außer der mit Vorhängen abgedunkelten Fensterseite Regale angebracht, die bis unter die Decke mit Büchern gefüllt waren. Sogar die Eingangstür wurde von den dicken, in Leder gebundenen Bänden eingerahmt. So weit ich es durch einen schnellen Rundblick erkennen konnte, handelte es sich ausschließlich um bibliophile Klassikerausgaben. Hier war die gesamte Weltliteratur versammelt. Fast vermeinte ich, die Stimmen der Autoren flüstern zu hören, deren Werke hier beisammenstanden und alphabetisch geordnet waren. Falls du jemals in dieses Zimmer gelangst, Jonas, dann würdest du es wahrscheinlich nie mehr verlassen wollen und vor lauter Leseglück wie Burians Esel zwischen all den Büchern verhungern. Ehrfürchtig trat ich in die Mitte der Bibliothek, in der ein Tisch und Stühle standen. Dort war für vier Personen gedeckt und ein Mann saß bereits mit dem Rücken zu mir vor seinem Teller. Lina wies mir einen Platz ihm gegenüber an.
»Das ist René«, stellte sie ihn vor. »Er wohnt seit einiger Zeit bei uns.« René war ein gutaussehender, noch sehr junger Mann, wahrscheinlich ein Teenager. Er machte einen durchtrainierten und sportlichen Eindruck. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass auch mit ihm etwas nicht stimmte. Seine unstetigen Augen unter seiner blonden, tief ins Gesicht hängenden Haartolle wichen mir schüchtern aus, als ich ihn neugierig musterte. Er trug eine blaue Schuluniform, die ich nicht zuordnen konnte. Das kreisrunde Strickemblem auf der Jacke zeigte die Schweizer Flagge und davor eine Edelweißblüte.
»Hallo, René«, grüßte ich ihn, doch er brummte nur eine unverständliche Antwort und sah nicht auf. Lisa lächelte und setzte sich neben mich.
»Der jüngste Bewohner des Eulenhorsts ist ein wenig schüchtern. Aber er ist bestimmt der Intelligenteste von uns. Ich glaube, er hat alle Bücher gelesen, die hier in der Bibliothek stehen. Nicht wahr? Du bist ein schlauer Bursche, René?«
»Das ist wirklich beeindruckend«, versuchte ich mit ihm ein Gespräch anzuknüpfen. »Wie lange braucht man denn, all diese Werke zu lesen?«
Der junge Mann senkte seinen Kopf noch tiefer und verbarg nun sein Gesicht beinahe komplett hinter seinem langen Haar. Ich konnte jedoch sehen, dass er errötete. Ich fand, Lina behandelte René ein wenig zu herablassend. Sie war ein paar Jahre älter als er, aber das gab ihr kein Recht, ihn wie einen kleinen Jungen zu behandeln. Obwohl er keinen allzu sympathischen Eindruck erweckte, hatte ich sofort Mitleid mit ihm und hätte gerne deutlich gemacht, dass ich auf seiner Seite stand. Mir fiel allerdings nichts ein, was ich sagen oder tun konnte, um der Situation die Peinlichkeit zu nehmen. Wahrscheinlich hätte René auch jeden Versuch der Unterstützung von sich gewiesen. Auch wenn ich kaum abschätzen konnte, aus welchem Jahrzehnt er selbst stammte – denn er war kein Teenager des gerade erst begonnenen 21. Jahrhunderts – musste es für ihn entsetzlich sein, in dieser Villa im zeitlosen Nichts zu leben und dabei von Gespenstern umgeben zu sein, die fast vollständig in einer muffigen Vergangenheit existierten.
»Oh, wenn wir etwas haben, dann ist es Zeit«, antwortete Lina für ihn, nachdem wir vergebens auf eine Antwort gewartet haben. »Sie ist hier nach dem Kampf beinahe zum Erliegen gekommen und kriecht nur noch wie eine Schnecke vorwärts. Manchmal setzt sie ganz aus.« Von welchem Kampf sprach sie? Doch sie ließ keine Frage zu. »Dieser Stillstand ist der Fluch unserer Existenz. Doch es ist genau dieser Moment, der nicht vergehen will, der dir und uns das Leben bewahrt. Wir werden älter, ohne zu altern. Aber das hat auch seine Vorteile.« René schnaubte verächtlich, aber er blieb weiterhin stumm.
Auch in der Bibliothek gab es einen geheimen Durchgang durch die Wand. Es war eine wie ein gefülltes Bücherregal gestaltete Tür, die von Onkel Balder mit Schwung geöffnet wurde. Er trug ein Tablett mit vier dampfenden Tellern Suppe vor sich her, das er zur Hälfte auf seinem hervorragenden Bauch balancierte. Die verborgene Tür, die wohl in die Küche führte, klappte hinter ihm wieder in die Wand. Selbst ein aufmerksamer Beobachter hätte Schwierigkeiten gehabt, sie von den anderen Bücherregalen zu unterscheiden. Wie ein aufmerksamer Bediensteter teilte Balder die Teller aus und nahm sich dann den vierten Stuhl, der unter seinem Gewicht verdächtig ächzte, aber standhielt. Hungrig stellte ich meine Fragen hintenan und beugte mich über meinen Teller. Es schien sich um eine dicke Gemüsecremesuppe zu handeln, in der ein paar Speckwürfel schwammen, die er für uns gezaubert hatte. Ich bin zwar Vegetarierin, wie du weißt, aber in diesem Moment wollte ich nicht päpstlicher als der Papst sein. Merkwürdig! Sie roch nach nichts. Aber sie sah heiß aus und mein Magen knurrte vernehmbar. Wie die anderen legte ich mir meine gestärkte Serviette über die Oberschenkel und tauchte den großen, angelaufenen Silberlöffel in die Suppe. Sie war wirklich sehr heiß, aber sie schmeckte zu meiner Enttäuschung nach absolut nichts. Überrascht sah ich auf. Lina und René aßen eifrig. Nur Balder legte mit einem unzufriedenen Brummen seinen Löffel in den Teller. Irrte ich mich, oder rollte da eine dicke Träne über seine Wange?
»Der Ort, an dem wir uns befinden, hat viele Makel«, erläuterte plötzlich René, der meinen Blick bemerkt hatte. Er hatte eine leise Stimme, in der nur ein Hauch Schwyzerdütsch herauszuhören war. »Der schlimmste für den Onkel, ist, dass hier keine Speise einen Geschmack hat. Alles ist fade und ausgelaugt wie der graue Himmel über uns. Es ist, als hielte diese Vorhölle für jeden von uns eine besondere Folter bereit.« Für einen sechzehn- oder siebzehnjährigen jungen Mann drückte sich René ausgesprochen gewählt aus. Ich vermutete den Grund in seiner Lektüre.
»Aber wenn auch alles ohne Geschmack ist, so ist es doch nahrhaft«, ergänzte Lina. »Du solltest tüchtig zugreifen. Weißt du, wie ich das mache, Katharina? Ich schließe die Augen und träume mir dann den Geruch herbei – aus meiner Erinnerung. Und dann ist auch der Geschmack wieder da und er ist immer unbeschreiblich gut. Versuche es nur, es klappt.«
‚Wie erbärmlich‘, dachte ich. René zuckte mit den Schultern und Balder schluchzte in seine Hände. Um mir zu demonstrieren, wie sie es meinte, schloss Lina tatsächlich ihre Lider, legte den Löffel seitlich an ihre gespitzten, rotgeschminkten Lippen und schlürfte genüsslich. Dann nickte sie mir aufmunternd zu. Ich schob den Teller entschieden von mir weg. Lieber verhungerte ich, als diesen zähen Tapetenkleister zu mir zu nehmen.
»Können wir diese Farce nicht ein wenig beschleunigen? Da draußen schleicht ein wahnsinniger Mörder ums Haus und ich glaube, dass er nicht nur hinter mir her ist. Essen kann ich, wenn ich wieder Zuhause bin.« Lina seufzte ungehalten und vorwurfsvoll. Sie wirkte auf mich wie eine Kindergärtnerin, deren Schutzbefohlene sich trotzig zeigte.
»Du musst verstehen …«, begann sie, aber weiter kam sie nicht.
Das große, bis zum Boden reichende Fenster flog auseinander, die Flügel wurden mit lautem Krachen zu den Seiten geschleudert und ihr Glas zerbarst. Die Vorhänge wurden zur Seite gerissen. Grelles Licht, wie von einem großen Scheinwerfer ausgesendet, fiel in die abgedunkelte Bibliothek. In dem blendenden Strahl tanzte eine fiebrige Wolke aus gelbem Wüstensand. Hitze rollte wie eine Welle herein und vor unsere nackten Füße. Dort im Rahmen der Fenstertür stand ein hoher Schattenriss. Er wirkte wie von einer Schere aus schwarzem Papier ausgeschnitten und dazwischen geklebt. Alle am Tisch erstarrten. Wir weigerten uns, das Offensichtliche zu begreifen. Er hatte zuletzt doch einen Weg in die Villa gefunden. Das Gotto war kein Schutz mehr für mich: Dort stand mein Verfolger, um zu beenden, was er drüben begonnen hatte! René sprang auf und sein Stuhl kippte hinter ihm zu Boden. Er stellte sich zwischen mich und den Eindringling.
»Schnell«, rief Lina verzweifelt und zerrte an meinem Arm. »Wir müssen durch die Tür zur Küche. Von dort aus kommen wir in den Keller! Das ist unsere einzige Fluchtmöglichkeit.« Wir wichen zu dem Regal zurück, in dem sich die verborgene Tür befand. Nun stellte sich auch Balder neben René, um uns Deckung zu geben. Der Eindringling schien nicht allzu beeindruckt. Er hob sein Messer und schritt betont lässig und langsam auf unsere Beschützer zu. Er nahm dabei sein Lied von vorhin wieder auf.
»Lina, Lina, bald hole ich dein Kind.« Und da erkannte ich ihn; zuerst an seiner Stimme, die nun nicht mehr von einem Fenster und einem Vorhang verzerrt war. Ein hartes Schlaglicht fiel seitlich vom Gang auf sein von unbeschreiblicher Wut verzerrtes Gesicht, das ich einmal geliebt hatte. Ich spürte, wie mein Herz um seinen nächsten Schlag rang. Der Verfolger, der gewissenlose Mörder:
Das warst du, Jonas!