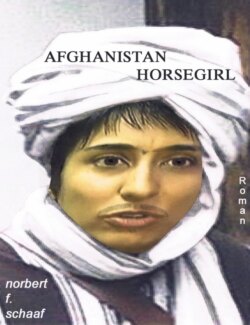Читать книгу Afghanistan Horsegirl - Norbert F. Schaaf - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Die Seilbrücke
Der rotblonde Mann unter den Zuschauern, vorhin noch kurz auf den Großbildleinwänden zu sehen, mittleren Alters mit westeuropäischen Zügen und einer Gesichtshaut so voller Sommersprossen, dass sein Teint wie leicht gebräunt wirkte, blickte dem jungen, gebeugten Reiter mit seinem verletzten Pferd neben sich gedankenvoll aus seinen hellblauen Augen nach; er hatte ihn die ganze Zeit, auch auf der Großbildleinwand, beobachtet. Besonders fiel ihm außer der Jugend des forschen Chapandas dessen auffällig graziler Gang auf, so völlig verschieden von dem der anderen Männer, die aufgrund der hohen Absätze ihrer Stiefel stets ein wenig plump und unbeholfen ihre besonders viril wirken sollenden Schritte setzten. Noch bevor nun das Buskashi in seine spannendste Phase ging, vernahm der Rotblonde einen Ruf, der ihm selbst galt: „German.“ Er schaute sich um, und obwohl er den Rufer nirgends gewahrte, folgte er, unwillig und widerstrebend, dem Ruf und drängte sich durch die Reihen der enthusiastisch schreienden und wild gestikulierenden Zuschauer, die ihn kaum beachteten, aber froh waren über den guten freiwerdenden Aussichtsplatz. Der Mann stieg in einen bereitstehenden Geländewagen, der die beiden Männer in eine abgelegene Gegend bringen sollte, um zunächst eine größtenteils zerstörte Hängebrücke instandzusetzen und womöglich noch nach Bedarf die eine oder andere Brunnenbohrung und kleinere Sprengungen von Felsbarrieren vorzunehmen.
Der Fahrer, ein junger Einheimischer mit lose herabhängenden Turbanenden, steuerte den Pick-up japanischer Herkunft, so schnell es die reichlichen Schlaglöcher zuließen, über die schlechte, mit einer dicken Staubschicht bedeckten Asphaltstraße, die nach wenigen Kilometern in eine enge Schotterpiste überging, die sich steil ins Gebirge hochschlängelte neben einem Flussbett, das in dieser Jahreszeit nur ein kleines Rinnsal schäumenden Gletscherwassers führte. In Regenzeiten war die Piste ein einziger Schlammfluss und kein Fahrzeug konnte sie passieren außer vielleicht Allradgeländewagen.
Zumeist war dieser Weg friedlich und verlassen, nur spärlich benutzt von Menschen der Region, Bauern, Handwerkern, Händlern und Hirten. Zwei Mal im Jahr aber wurde sie belebt, wenn im Frühling die Karawanen der Herdennomaden auszogen und im Herbst wieder heimkehrten, wie jetzt, da ihnen die ersten Rückkehrer entgegenkamen.
Die Ladefläche des kleinen Trucks war voll ausgelastet mit Stahlseilrollen und Metallgestängen in rucksackartigen Tragevorrichtungen sowie Werkzeugen wie Brechstange und Holzkeile hinter einer voluminösen, aufklappbaren Kiste hinter der Doppelkabine. Der Rotblonde schien sogleich nach Fahrtbeginn in Schlaf verfallen zu sein, den auch das Rumpeln der Räder über die wellige, raue Piste nicht zu stören vermochte. Erst das scharfe Einlenken in die erste enge Serpentine veranlasste den Mann, die Augen blinzelnd zu öffnen, und nötigte ihn, sich an den Haltegriff unter der Handschuhfachklappe zu klammern. Manchmal geriet der Wagen ins Schlingern, besonders beim Überholen von arg überladenen Lastwagen und schwankenden Kamelkarawanen. Hier begannen die „unknown territories“, wie die fremdländischen Militärs die unerforschten, von Drogenbaronen und Waffenschiebern kontrollierten ruralen Gebiete nannten. Der Aufenthalt in ihnen war stets gefährlich, selbst wenn eine gewisse Sicherheit von dem jeweiligen Stammesfürst oder Clanchef, der gleichzeitig die Geschäfte mit Drogen oder Waffen betrieb, erkauft werden konnte.
Schweigend fuhren die Männer in endlosen Windungen hinauf bis auf die erste Passhöhe, wo der Fahrer anhielt und ausstieg, um hinter einem Felsen sein Wasser abzuschlagen. Der Blick des Beifahrers schweifte über diese seltsame Örtlichkeit, die wie verloren auf einem Rücken dieses gewaltigen Bergmassivs im Herzen von Mittelasien lag. In der Ferne war der Salang-Pass zu ahnen mit seinen gewaltigen Menschenströmen, denen dieser schmale Weg zur ewigen Bettstatt geworden war: Züge der Eroberer, Heere der Religionen ...
Unter ihnen breitete sich die pittoreske Berglandschaft des nördlichen Hindukusch aus, für die die Wageninsassen nun kaum mehr einen Blick hatten. Man fuhr weiter, die Passstraße hinunter, die schmaler, steiler und gefährlicher in engeren Kurven zu Tal abfiel, als sie hinaufgeführt hatte. Auf der Fahrerseite ragten spitze Felsen empor und überhängende Klippen heraus, auf der anderen gähnte der unabsehbare Abgrund. Herabgestürzte Felsmassen mit zum Teil riesigen Gesteinsbrocken verengten oder versperrten den Weg. Der Chauffeur musste mehrmals anhalten, bei laufendem Motor, während der Beifahrer im Schweiße seines Angesichts die steinigen Hindernisse aus dem Weg räumte, manche mit der Brechstange. Karawanenführer und Maultiertreiber, Hirten und Vieh hatten es ebenso wenig leicht in der eisigkalten Temperatur und der dünnen, schneidenden Luft dieser Höhe, doch war ihr Weg weniger gefährlich, da sie wie eine Kette Ameisen dicht an der Felswand entlang dahinzogen.
Völlig anderes galt für den Geländewagen: Die Wegstrecke war bisweilen derart schmal, dass sie seine gesamte Breite einnahm und die Räder manchmal sogar über die Kante des ausgebröckelten, unbefestigten Randes am Abgrund hinausragte. Der Fahrer musste jede kleinste ungeschickte Bewegung vermeiden, durfte sich nicht den kürzesten Augenblick der Unaufmerksamkeit leisten. Hochkonzentriert lenkte er den Pick-up um tiefe Schlaglöcher und dicke Felsbrocken, möglichst dicht an den Felsen längs, und vermied den Blick in den Abgrund auf der anderen Seite.
Das Fahrzeug schlich so langsam vorwärts, dass der Beifahrer die Gebirgskette und die weißen Gipfel des Hindukusch – unmerklich fast – vorüberziehen sah. Die Felswände waren grau in grau mit ihren Spitzen und Graten, ein bleiernes Grau der Urzeit und der Trostlosigkeit. Der riesige Berg schien vollständig bedeckt von feinkörniger Friedhofsasche, jeder Felsvorsprung, jede enge Spalte, bis hoch empor zu den Eisbahnen des Himmels, die den Horizont bildeten.
Keiner der Männer empfand jedoch Angst oder Traurigkeit. Mit innerem Auge sah jeder jenseits dieser abgestorbenen Mondlandschaft verlockende Täler und lärmerfüllte Ortschaften, brennendheiße Wüsten und unendliche Steppen: Ihr Afghanistan mit all seinen Provinzen, seinen Straßen, Wegen und Pfaden, die aus dem Inneren zu den Grenzen führten, der iranischen, turkmenischen, usbekischen, tadschikischen, tibetanischen und pakistanischen.
Plötzlich gerieten die Linien der Bergkämme und der Wolkengebilde am Himmel ins Wanken. Der Wagen war beim Befahren der Gesteinsböschung mit zwei Rädern in Schräglage geraten, wobei der Fahrer den Motor abwürgte. Während das Gefährt langsam zurückzurollen begann, versuchte der Chauffeur vergeblich, den Motor neu zu starten. Schon ragte ein Hinterrad über den gähnenden Abgrund und rutschte noch ein wenig weiter, als die heiße Bremse voll griff. Der Beifahrer stieg rasch aus und sicherte ein Vorderrad mit einem Holzkeil. Nach mehreren Startversuchen sprang der Motor endlich wieder an und zog den Jeep dank des Allradantriebs wieder auf die Piste. „Allah sei gepriesen!“ stöhnte der Fahrer, während der hereinkletternde Beifahrer lächelnd aufatmete.
Stumm erreichten sie eine kleine Senke, wo sie sich auf einer Fotolandkarte orientierten und nach kurzer Beratung in einen steinigen Nebenweg einbogen, auf dem es sofort wieder steil bergan ging. Von jetzt an kamen sie kaum schneller voran als ein Wanderer. Der miserable Straßenzustand nötigte die nun nur noch vereinzelt auftauchenden Fußgänger, Maultiere, Kamele und Fahrzeuge zu gleichem Tempo. Bei einer halbverfallenen Chaikhana – eine Teestube eingezwängt in einen engen Taleinschnitt – gelang es ihnen, die Rastsuchenden zu überholen, und bei jetzt freier Strecke vermochten sie doch nicht an Fahrt zu gewinnen.
Unvermittelt wurden sie von einigen verwegenen Gestalten auf der Piste angehalten. Die Männer waren sämtlich mit Gewehren bewaffnet und trugen schwere Patronengürtel über der Brust. Der Beifahrer erschrak innerlich, während der Fahrer routinemäßig das Seitenfenster herunterkurbelte, grüßte und dem Anführer mit ein paar Worten ein Dokument in einer Plastikhülle hinhielt. Nach kurzer Prüfung wurden sie wortlos durchgewunken.
Nach wenigen Kilometern in geraumer Zeit langten sie an einer Passenge an, die ob ihrer Schmalheit keine Weiterfahrt mehr erlaubte. Nachdem der Wagen zwischen einem Felsen und einem Panzerwrack aus Sowjetzeiten abgestellt und gesichert war, luden sich die Männer die Gepäckstücke von der Ladefläche, eine Stahlseilrolle und zusammengegurtete Metallstangen im Tragegestell sowie aus der Klappbox je einen Rucksack mit C4-Sprengstoff, Akkus und Trinkflaschen sowie Bohrmaschine, Werkzeug, Sprengkapseln und Proviant plus obenauf je einen Thermoschlafsack, auf Rücken und Brust, gerade soviel als sie zu schleppen vermochten. Nach wenigen hundert Metern Anstieg lief ihnen bereits der Schweiß in Strömen aus den Poren.
An diesem Tag machten die Bergwanderer die Erfahrung, wie unerbittlich und grausam der Hindukusch für den sein kann, der nicht in diesem Hochgebirge heimisch ist.
Steine rutschten plötzlich unter den Füßen weg auf einem so schmalen Pfad, der kaum breit genug war für eine Bergziege, geschweige denn für einen kräftigen Mann mit reichlich Gepäck auf dem Rücken und vor der Brust. Abgrundtiefe Schluchten gähnten urplötzlich hinter einer Wegbiegung auf einem nie ebenen, geraden, sicheren Saumpfad. Keinerlei Weite öffnete sich dem Blick, da man entweder die steile Felswand sah oder den gähnenden Abgrund. Bei dem kleinsten Fehler, dem geringsten Stolpern, einer einzigen falschen Bewegung, dem winzigsten unsicheren Schritt drohte unweigerlich der Tod zuzupacken.
Keine geringe Furcht ergriff sehr bald die Männer und ließ sie nicht mehr los. Der Afghane, ein Mann der nordischen Steppen, musste den Weg suchen durch diese Steinwüste, sich durch Felsgänge und Spalten hindurchtasten, seinen fremdländischen Begleiter umsichtig und achtsam den bald steil ansteigenden, bald abschüssigen Saumpfad entlang führen und, sich unvermittelt in einem Höhlengang sehend, wieder zurückgehen und einen anderen Weg finden. Zudem bei jedem Schritt, den er wagte, er sich vor dem Absturz in den Abgrund in acht nehmen musste.
Schließlich war er eigentlich nur ein schlichter Hirte der Steppe, sein Gespür, seine Muskeln, seine Nerven und seine Augen waren für solche Abenteuer nicht geschaffen. Und zu alledem hatte er noch einen Fremden zu führen, vorwärts zu bitten, zurückzuhalten und zu ermutigen, dessen ferne Heimat ebenfalls ein eher flaches Land war.
Die Stunden vergingen und ihr Weg führte immer weiter durch dieses Labyrinth aus Fels und Steilwand, aus Schlucht und Abgrund.
Von irgendwoher ertönte ein lauter Pfiff.
„Was war das?“ fragte der Rotblonde.
„Nur ein Tier“, antwortete der Begleiter.
„In dieser Einöde?“
„Ja. Hier oben lebt das Marmot, wie der Nager hierzulande heißt, das langschwänzige Murmeltier. Es hat wirklich einen langen, fetten Schwanz. Besonders zum Ende des Sommers. Hier oben ist es nicht überall vollkommen kahl.“ Der junge Afghane redete im Plauderton, er kicherte sogar dabei, es vermochte ihm bei dem anstrengenden Bergwandern den Atem nicht zu verschlagen.
Plötzlich kamen sie zu einem so langen dunklen, engen Tunnel, dass sie dachten, er würde nie ein Ende nehmen, und in dem man unsichtbare Berggeister an den Wänden entlang huschen zu hören glaubte.
Schwer atmend bewältigten sie wieder einen jähen, schwierigen Anstieg, und der schmale Felsabsatz, den sie nicht mehr lange vor Einbruch der Dämmerung erreichten und von dem sie endlich weit unten ein Tal entdeckten, war so schmal, dass die Männer mehrmals die Augen schlossen und öffneten, um nicht schwindlig zu werden.
Keiner der Männer hatte während dieser gefahrvollen Stunden Durst oder Hunger verspürt. Jetzt aber, wieder auf halbwegs sicherem Pfad, hatten sie nur den einen Wunsch: zu trinken. Der Afghane entnahm der Seitentasche seines Rucksacks eine Wasserflasche, öffnete sie und reichte sie dem Begleiter mit aufmunterndem Blick. Dieser nahm sie mit kleinem Zögern und trank langsam, Schluck für Schluck, bevor er die halbvolle Flasche zurückreichte.
Plötzlich spürten sie den leichten, kühler gewordenen Wind. Durch die Sträucher, die Krüppelbäume und die Gräser ging ein leichtes Rauschen, das Herannahen der Nacht ankündigend. Schon stiegen Adler mit schnellem Flügelschlag bis zu den Gipfeln der Berge empor, die noch für kurze Zeit vom Abendlicht beschienen waren, bevor sie sich dann rasch verdüstern würden. Der Rotblonde verfolgte mit seinen Blicken die Greifvögel bei der Rückkehr in ihre Nester. Und er dachte daran, dass sie, sein Fahrer und er, die langen Stunden bis zur Morgendämmerung in diesem hohen Gebirge in Düsternis und Kälte verbringen mussten im Schlafsack, der allein sie vor dem eisigen Nachtwind schützen würde.
Der Rotblonde richtete seinen Blick den steilen Berghang entlang nach unten. Dunkelheit hatte sich bereits über das Tal gelegt, klare Konturen waren nicht mehr auszumachen.
„Ist das die Schlucht?“ fragte er.
„Ja.“
„Ich habe keine richtige Erinnerung mehr an sie.“
„Morgen früh, wenn es hell ist, kann man sie deutlich erkennen.“
„Ja“, bestätigte der Rotblonde. „Aber jetzt werden wir erst mal etwas essen. Wie war noch mal dein Name? Er ist mir entfallen, verzeih.“ Dass er ihm entfallen war, wurmte ihn, und es war sicher kein gutes Zeichen.
„Mein Name ist Haschem“, antwortete der junge Mann. „Ich bin Haschem Modh aus Khanabad. Komm, ich helfe dir mit der Trage.“
Der große, schlanke rotblonde Mann mit dem Sommersprossengesicht, das aussah wie sonnen- und windgegerbt, ging in die Knie, streifte die Trageriemen von den Schultern und ließ die schwere Last mit Haschems Hilfe zu Boden gleiten. Sein Hemd war nassgeschwitzt. Sie halfen sich gegenseitig beim Ablegen der Tragelasten.
„Danke“, sagte Haschem. „Und dein Name ist German, ja?“
„Hermann“, entgegnete der Rotblonde, der sich nicht wunderte, dass der andere seinen Rufnamen kannte, „Hermann Karfurt. Aus Deutschland. Also sag nur weiter German zu mir, wie alle anderen.“ Er lehnte seinen Rucksack vorsichtig an einen Felsblock und schnallte den Schlafsack ab. Der Afghane tat es ihm gleich, und die Männer rollten die Schlafsäcke aus. Sie aßen jeder noch eine Kleinigkeit von dem Proviant aus Haschems Rucksack, den er außen neben sich abgestellt hatte, bevor sie sich in die Daunen verkrochen. Die Helligkeit war mit einem Schlag von den Berggipfeln verschwunden und hatte jäher Dunkelheit Raum gegeben.
Die Männer wünschten sich guten Schlaf und eine ruhige Nacht, und keiner von beiden wunderte sich im Geringsten darüber, dass der jeweils andere kein Gebet verrichtete, ja nicht einmal daran zu denken schien.
Rasch waren die Männer, zusätzlich ermüdet von dem beschwerlichen Marsch, eingeschlafen – mit guten Gedanken: An die Frau, die ihm versprochen war, der Afghane, an die Frau, die er noch kennen lernen würde, irgendwann, vielleicht bald, der Deutsche.
Einmal wachte Hermann Karfurt auf, er hatte stark geträumt, an Genaues vermochte er sich nicht zu erinnern, doch es war um eine junge Frau gegangen, sehr anmutig und sehr begehrenswert, aber mit sogleich verschwimmenden Gesichtszügen und weich gezeichneten Körperkonturen. Hermann fragte sich wieder einmal, wie es in einem Land wie diesem überhaupt Liebe geben konnte. Es herrschten strenge Regeln, das Leben war hart, und alles erschien so unveränderbar. Hier der Koran und die Tradition, da die Trennung der Geschlechter und der Status der Frau. Wo hatte da die Liebe ihren Platz? Nie hatte er etwas davon bemerkt. Er geriet ins Grübeln, eine Gedanke überkam ihn: Wäre ich Muslim, hätte ich meine erste Liebe womöglich geheiratet, indem ich sie gekauft hätte, ganz einfach – wenn ich das Geld gehabt hätte. Darüber schlief er wieder ein, eingekuschelt in den Schlafsack, die kleine freie Stelle seines Gesichts empfand die schneidende Kälte.
Er erwachte von dem Geklapper, das Haschem verursachte beim Hantieren mit dem kleinen Samowar, den er zum Teekochen aus seinem Rucksack gezaubert hatte, wie auch den Gaszünder, mit dem er aus bereits gesammelten dürren Zweigen ein kleines Feuer entfachte. Nach nicht allzu langer Zeit sang der Samowar und duftender grüner Tee war zubereitet, den die Männer ebenso genüsslich wie geräuschvoll in sich hinein schlürften. Sie aßen noch etwas Hartbrot und getrocknete Aprikosen aus dem Proviantvorrat, bevor sie ihre Sachen abmarschbereit zusammenpackten.
„Die Schlucht“, sagte Haschem und deutete zu Tal, „jetzt kannst du sie sehen, German.“
Der Rotblonde nahm ein kleines, aber leistungsstarkes Fernglas aus der rechten Brusttasche seines verschossenen großkarierten grauen Popelinhemdes hervor, setzte es an die Augen und drehte die Einstellrädchen zurecht, bis die Ränder der Schlucht sich scharf von der Umgebung abhoben. Er schwenkte das Glas zwei- dreimal hin und her, bevor er innehielt und befriedigt ausatmete.
„Die Trosse?“ fragte Haschem. „Ist sie straff?“
Hermann nickte und reichte das Fernglas weiter.
„Niemand zu sehen“, sagte Haschem.
„Wieso auch?“ erwiderte Hermann. „Wenn die Hängebrücke unpassierbar ist.“
„Das ist sie nicht mehr lange“, sagte Haschem überzeugt. „Ehe die Sonne im Zenit steht, haben wir drei neue Stahlseile gespannt. Und dann sind die Kameraden da und installieren den Steg vollends.“ Er bewegte leicht das Fernglas nach oben. „Schau, sie haben bereits den Maschendraht herbeigeschafft.“
Hermann nahm das Glas. „Gut“, sagte er. „Einen neuen Holzsteg würden sie gleich wieder abfackeln.“
„Oder als Feuerholz rausreißen, ja. Aber der Tiere wegen werden sie den Maschendraht trotzdem wieder mit Holz belegen. Wenn vom nächsten Treibholz noch genug übrig bleibt. So Allah es will.“
Hermann sah ihn stirnrunzelnd an. „Die nächste Schneeschmelze kommt bestimmt.“
„So Allah es will“, wiederholte Haschem.
„Wegen mir“, sagte Hermann. „Und wie geht’s nun weiter?“
„Abstieg. Wird eine ziemliche Kraxelei.“
Die Männer halfen sich gegenseitig, ihre Lasten aufzunehmen und schüttelten sie auf den Schultern zurecht.
„Fertig“, sagte Hermann. „Auf geht’s.“
„Abwärts“, sagte Haschem.
Aufrecht, als hätten sie jeder eine Bohnenstange verschluckt, wegen der Gewichte auf der Brust und auf dem Rücken, stiegen sie mit vorsichtigen Schritten den schmalen, steilen Saumpfad hinab. Hermann kam wieder rasch ins Schwitzen.
„Wie schaffst du´s?“ fragte er.
„Recht gut“, antwortete Haschem, der überhaupt nicht schwitzte, obwohl seine Muskeln zuckten von der Anstrengung des steilen Abstiegs.
Immer schroffer und schwieriger ließ sich das Gefälle begehen, bis sie nach zwei Stunden einen großen Felsblock vor der Kante der Schlucht erreichten.
„Halt“, gebot Haschem. „Vielleicht ist schon jemand da. Ich mache den Adlerschrei, um uns anzukündigen.“
„Muss das sein?“
„Sicher ist sicher. Oder willst du wirklich, dass man auf uns schießt – mit dem ganzen Zeug im Rucksack?“
„Nicht mal im Traum“, erwiderte Hermann. „Obwohl gar nichts passieren kann, da wir Sprengmasse und Zündkapseln getrennt tragen.“
„Sicher ist sicher“, bekräftigte Haschem, legte die Hände trichterförmig an den Mund und stieß einen Schrei aus, schrill und scharf wie ein Adlermännchen, das seinen Rivalen warnt, bevor es zum Angriff übergeht.
Nichts rührte sich. Erst als Haschem zum zweiten Mal schrie, erhielt er eine Antwort. Und gleich darauf erschien ein Adlerweibchen und blickte sich im Schwebeflug erstaunt und suchend um. Der Afghane kicherte noch in sich hinein, als sie beim Rand der Schlucht ankamen und ihr Gepäck neben dem Felsen ablegten, an der Stelle, an der das verbliebene Stahlseil angebracht war.
„Schau“, sagte er und wies auf ein Loch im Felsen. „Da ist das andere Seil aus der Verankerung gerissen.“
„Niemand hat Schuld“, konstatierte Hermann nach einem prüfenden Blick. „Der Fels ist abgesprengt worden, nachdem Sickerwasser von oben in den Berg eingedrungen und gefroren ist.“
„Deshalb werden wir ja auch drei neue Trossen verankern. Bist du Fachmann für solche Sachen, German?“
Hermann, der Ex-Pionieroffizier und Brückenbauingenieur, nickte nur. „Bist du Experte im Seilbalancieren, Haschem?“
„Ich werde mich rüberhangeln. Du wirst sehen.“
Sie packten Bohrmaschine und Zubehör aus und gingen an die Arbeit. Nachdem die Ösenhalterung für die Paralleltrosse verankert war, rollten sie die Trommel ab, und Haschem machte sich bereit, die abgrundtiefe Schlucht zunächst mit einer Hanfleine zu überqueren, an der Hermann das erste Stahlseil befestigte.
„Womöglich ist die Verankerung drüben ja noch intakt“, gab er dem Jungen mit auf den Weg.
Ohne zu zaudern hangelte sich Haschem, das Leinenende zwischen den Zähnen, die Kniekehlen über dem schwankenden Stahlseil eingehängt, sich kraftvoll Hand vor Hand vorwärts ziehend, über die mehrere hundert Meter tiefe und fast fünfzig Meter breite Felsenschlucht, deren Steilhänge zu beiden Seiten beinahe lotrecht abfielen.
Hermann ließ die Hanfleine, die er zur Sicherung mit einem Karabinerhaken am Stahlseil eingehängt hatte, durch seine Hände laufen, wobei er Haschem bei seiner stetigen, nie unsicheren Vorwärtsbewegung gedankenvoll mit den Augen verfolgte. An der Art, wie er sich mit zupackenden Händen an dem drei Zentimeter dicken Stahlseil voranzog, erkannte Hermann, dass der junge Mann diesen Drahtseilakt wohl nicht zum ersten Mal vollführte.
Hermann verspürte starken Hunger im Magen und schwere Gedanken im Kopf. Seinem Hungergefühl gab er regelmäßig nach, doch unnütze Gedanken pflegte er sich nicht zu machen. Er nahm sich nicht wichtiger als jeden anderen, obwohl er sich selbst für einen ganz besonderen Menschen hielt, diesen Status freilich jedem anderen ebenfalls zubilligte. Was anderen widerfahren mochte, konnte auch ihm selbst passieren. Wenn andere starben, bei Verkehrsunfällen, bei Raketenangriffen, bei Selbstmordanschlägen, er selbst aber lebte, glaubte er sich dennoch nicht gegen den Tod gefeit. Natürlich vertraute er sich selbst und erwartete selbstverständlich, dass andere ihm ebenfalls trauten, die wiederum ihm gleichermaßen vertrauen durften. Vor allem mussten sich Leute, die zusammenarbeiteten, voll und ganz vertrauen – oder gar nicht. Die Frage war, ob man sich den Menschen immer aussuchen konnte, dem man vertrauen musste. Da blieb oftmals keine Entscheidungsfreiheit, das einerseits. Andererseits gab es da immer die andere Seite, für jedermann. Die andere Seite, das war der Feind, das waren die feindseligen Menschen. Und für jeden waren es stets die anderen, für die einen die Taliban, für die anderen die Besatzungssoldaten, und die Warlords, die Drogenbarone, die Al-Quaida, die Regierungstruppen, die Polizisten, die Paschtunen, Hasaras, Tadschiken, Usbeken, Pamiris und die Zivilisten, Greise, Frauen und Kinder. Alle empfanden andere als Gegner, und man musste froh sein, wenn die anderen sich wenigstens richtig einschätzen ließen, sich berechenbar erwiesen. Heute waren die anderen nicht in Sicht. Da musste man sich jetzt keine Gedanken machen. Da gab es andere Dinge. Hermann, für sich allein und unbeobachtet, erlaubte sich einen kleinen Seufzer.
Er sah Haschem auf der anderen Seite der Schlucht anlangen und sogleich die Hanfleine mit dem Stahlseil daran einholen, das er, Hermann, mit beiden Händen nachführte. Er sah, dass er Haschem vertrauen konnte. Über den Burschen musste er sich keine Gedanken machen, und das Problem mit der Hängebrücke war nicht schwieriger als jede andere Aufgabe. Er wusste, wie man Brücken baute, Brücken jeder erdenklichen Art, er hatte schon viele Brücken gebaut. Brücken jedweder Art und Konstruktion und Größe. Brücken über Flüsse und Täler und Wege, aber auch Brücken von Mensch zu Mensch. Diese Hängebrücke hier sollte die lebenswichtige Verbindung wiederherstellen zwischen den Ackerbauern und Viehzüchtern einer ländlichen Bergregion und den Märkten von Kundus und Faïzabad, auf die Mensch und Tier schon lange verzichten mussten.
Das lose Stahlseil hing aufgrund seines Gewichts tief in der Schlucht durch, doch Haschem hatte es rasch nach oben gezogen und machte sich sofort daran, es in der Öse der intakten Halterung im Fels zu verspleißen. Als er fertig war, gab er Zeichen durch zwei kräftige Schläge auf das Seil, und während er mit der Hanfleine zurückhangelte, begann Hermann mit dem Verankern und Spannen der Stahltrosse auf seiner Seite. Dies vollendet, wiederholten die Männer ihr Werk mit den beiden anderen notwendigen Strängen, wobei sie mehrmals über die Stahlseile balancierend die abgrundtiefe Schlucht überquerten, um Löcher zu bohren, Metalldübel einzusetzen und Ösenschrauben anzubringen. Als alle Trossen verankert und gespannt waren, nicht zu lasch, damit die Konstruktion nicht in unkontrolliertes Schwingen geriet, nicht zu stark, damit sie nicht aus dem Fels gerissen wurde, verbanden der Afghane und der Deutsche vereint in einem erneutem Drahtseilakt die unteren Stränge in gemessenen Abständen untereinander durch die mitgebrachten Metallstäbe und hernach die unteren mit den oberen zu beiden Seiten.
Nach einem Imbiss verstauten sie befriedigt das Gepäck, das erheblich geschwunden war, in und an die beiden Rucksäcke und versteckten die fast leere Stahlseilrolle in einer Felsspalte. Mit spielerischer Leichtigkeit turnten sie, jeder seinen Rucksack auf dem Rücken, über die teilfertige Hängebrücke, um auf die Kameraden zu warten und sie beim Anbringen des Maschendrahtbodens des Hängebrückensteges zu unterweisen und zu unterstützen.
Auf der anderen Seite der Schlucht wollten sie gerade ihre Rucksäcke wieder abnehmen, als leichter Steinschlag sie aufhorchen und aufblicken ließ. Etwa fünfzig Schritt talaufwärts sahen sie die erwarteten Kameraden wie Ziegen über den Fels den Steilhangs herunterkommen. Die Gruppe bestand aus einem halben Dutzend Männern in der traditionellen Kleidung der Landbevölkerung mit groben, stark gebräunten, bartstoppeligen Gesichtern, ausgenommen ein Junge mit dunklem, flaumigem Gesichtshaar, der Hermann sogleich sehr bekannt vorkam. Sie näherten sich und grüßten Haschem freundschaftlich, während Hermann kaum seinen Blick von dem Jungen im hellbraunen Kaftan lassen konnte, der ihm bereits bei dem Buskashi aufgefallen war durch seine Haltung, seinen Gang, sein Verhalten und vor allem durch sein frühes Scheitern in dem wilden Kampfspiel und seinen schmählichen Rückzug. Hinter dem jungen Menschen trat ein kleingewachsener, stämmiger Mann hervor, der seinen Rucksack auf einem Felsvorsprung abstellte, auspackte und ihm ein Funkgerät entnahm mit einer ausklappbaren Satellitenschüssel.
Nach einem kurzen Wortwechsel machten sich die Männer, mit Ausnahme des Funkers und des jungen Menschen, sogleich daran, die Maschendrahtrolle abzuwickeln und über der Bodenfläche der Hängebrücke, die noch aus gähnenden Löchern bestand, auszulegen und Masche für Masche zu verdrahten. Hermann blieb nichts zu tun, als den mit zweckmäßigem Werkzeug gewappneten Männern zuzusehen bei ihrer qualifizierten Arbeit, die ihnen flott von der Hand ging und bei der ihnen bald warm wurde, sodass sie ihre Kaftane ablegten und über die oberen Seile der Hängebrücke hingen.
Der Funker hielt seinen schweifenden Blick auf dem kleinen Ausschnitt des Himmels über der Schlucht, während der junge Mensch die Saumpfade zu beiden Seiten hin sichernd im Auge behielt. Plötzlich, aus dem heiteren Himmel, näherte sich Ohren betäubendes, Luft zusammenpressendes Treibwerkgetöse, in dessen unmittelbarem Gefolge zwei Düsenmaschinen auftauchten, gekennzeichnet mit dem Stern, der sie als US-amerikanische Jagdbomber auswies, offenbar F-15-Jets.
Der Mann am Funkgerät stülpte sich rasch ein Paar Kopfhörer über und begann, an seinem Funkapparat zu hantieren, während die Kampfmaschinen bereits wieder außer Sicht gerieten. Bald hatte er das Gerät so eingestellt, dass er den Funkverkehr der Flieger mit ihrer Kommandozentrale mithören konnte. Die Piloten meldeten, was sie sahen und sprachen von arbeitenden Zivilisten, während die Stimme des Kommandeurs, der wohl die Livebilder von den Kamerasystemen der Jets vor Ort direkt überspielt bekam, energisch widersprach und von unmittelbarer Bedrohung mit direkter Feindberührung redete, die von bewaffneten Aufständischen ausginge und auf der Stelle gebannt werden müsse. Zudem würde ein intakter Brückenübergang Nachschubwege eröffnen für Waffen der Taliban sowie für ihrer Finanzierung dienenden Rohopiumlieferungen.
Der junge Mensch an der Seilbrücke, einen grellen Warnruf ausstoßend, deutete zum Himmel und winkte seinen Kameraden energisch, von der Brücke zu kommen.
Ob sie noch ein oder zwei Mal über die Schlucht, die Hängebrücke und die Leute hinwegfliegen sollten, erkundigte sich einer der Piloten über Funk, während die Kampfjets sich wieder der inzwischen fertiggestellten Hängebrücke näherten.
„Negativ“, kam die lakonische Antwort.
„Es sind Handwerker, in Zivil, bei der Instandsetzung einer Stahlseilbrücke“, insistierte der Pilot weiter.
„Negativ“, war der abermalige Bescheid. „Man sieht Aufständische mit ihrer Bewaffnung.“
„Was tun?“ fragten die Piloten.
„Zielobjekt ausschalten“, kam der Befehl.
„Schießbefehl?“ vergewisserte sich der kommandierende Pilot.
„Positiv.“
Der Luftschlag erfolgte prompt, zielgenau und vernichtend. Je eine Rakete aus jedem der beiden Jets schlug rechts und links in die Brückenkonstruktion ein, die gespannten Trossen rissen auseinander und knallten gegen die Felswände wie Stahlpeitschen, während alles, was sich noch auf der Hängebrücke befand, hoch empor durch die Luft gewirbelt wurde wie aufflatternde Vogelscheuchen.
Nach der unmittelbaren Zielüberprüfung durch die Piloten mit der Meldung an die Operationszentrale der erfolgreichen Zielbekämpfung sowie einer einzelnen flüchtenden, einen nicht identifizierten waffenähnlichen Gegenstand mitführenden, humpelnden Person verschwanden die F-15-Bomber, so schnell sie gekommen waren.
Was die Piloten und die Kameras an Bord der Kampfflieger nicht auszumachen vermochten, waren überraschende Fakten, die von den US-Militärs verkannt wurden. In den Gewändern der scheinbaren Vogelscheuchen befanden sich keineswegs menschliche Wesen, denn diese hatten sich unter Hinterlassung von Werkzeug- und Kleidungsteilen, derweil die Bomber während des Funkverkehrs mit ihrer Kommandozentrale ihre Schleife flogen, flink und unbemerkt um die nächste Wegbiegung aus dem Staub machen und unter einen tiefen Felsüberhang zurückziehen können, der als Unterschlupf vor Unwettern oder zum Übernachten für die Nutzer der Hängebrücke diente.
Hermann Karfurt trat als letzter unter den Felsüberhang und traf als ersten auf den jungen Menschen, der offenbar den Zugang bewachte, während sich die anderen Männer im hinteren Teil des Unterschlupfs aufhielten.
„Sei gegrüßt, Freund“, sagte Hermann lächelnd zu dem jungen Menschen mit dem jugendlichen Gesicht, „und Friede sei mit dir.“
„Friede desgleichen“, kam die unwillige Antwort. Nun konnte Hermann sein Gegenüber aus direkter Nähe betrachten: Sein weiches Gesicht mit dem feinen Bartflaum, das oval war mit zwei markanten Wangenknochenecken in einem eiförmigen Kopf, der auf einem langen, schlanken Hals saß. Die hellbraunen Augen waren groß und scheinbar etwas eng beieinander stehend, aber klar und tiefgründig, als bargen sie ein unergründliches Rätsel oder geheimnisvolles Wissen. Die Ohren, groß und fleischig, standen ein wenig ab, weil sie den nachlässig gewickelten Turban trugen wie eine Krone. Die Figur war schlank, dabei kräftig und reichte an die volle Größe Hermanns nur mit der Turbanspitze heran. Aus dem weiten Gewand ragten feingliedrige Hände und Füße, schlank und rank, dabei keineswegs sehr klein. Die Handrücken, meist bedeckt durch die langen Ärmel, wiesen hervortretende Adern und unter den feinen dunklen Härchen Striemen und Kratzer auf. Die Nase war schmal und klein, auch ein wenig gebogen, und gab dem Gesicht mit den ein wenig lauernden Augen einen klugen, angriffslustigen, greifvogelartigen Ausdruck. Unter dem Flaum der rechten Wange saß ein schwarzes Muttermal, unter dem der Oberlippe und des Kinns lief eine dünne, fast unsichtbare Narbe quer über die fein geschwungenen vollen Lippen.
„Er ist unser Wächter“, rief eine Bassstimme aus der tiefe der Höhlung. „Der beste.“
„Aliz kannst du nichts vormachen“, rief jemand anderer.
„Aha“, sagte Hermann und lächelte um ein weniges stärker. Ihm gefiel der junge Mensch auf Anhieb, das war schon sein Eindruck von der Großbildleinwand beim Buskaschi her gewesen, und innerlich strahlte er unwillkürlich vor Lächeln, was ihn erstaunte und sogar ein klein wenig schockierte.
„Wer bist du?“ fragte Aliz energisch und legte den Kopf ein wenig schief. „Ich habe dich doch schon einmal gesehen, nicht wahr?“
„Das kann ich nicht sagen“, erwiderte Hermann.
„Was machst du hier?“ Aliz´ energische Stimme war gleichwohl weich, hatte Tiefe und klang ein wenig heiser und rauchig. Er sieht gut aus, der Fremdling, dachte Aliz, er wäre ein schöner Mann, wenn sein Haar nicht so bleich wäre mit diesem verstörenden Stich ins Rote und seine Augen nicht so stechend hell.
„Nun, Aliz, mein Freund“, erwiderte Hermann mit weiter verstärktem Lächeln, „ich bin Hermann Karfurt, man nennt mich German. Ich habe die Seilbrücke instandgesetzt.“
„Sie hat nicht lange gehalten, o German. Deine Fremdenbrüder haben gleich wieder ganze Zerstörungsarbeit geleistet.“
„Sie sind Fremde, ja, aber nicht meine Brüder.“
„Mit welcher Berechtigung bist du hier in diesem Land?“
„Ich gehöre zu einer Hilfsorganisation, keine Regierungsorganisation.“
„Wie kannst du das nachweisen?“
Hermann knöpfte die linke Brusttasche seines Popelinhemdes auf und entnahm der integrierten Sicherheitstasche ein in durchsichtige Folie eingeschweißtes Plastikkärtchen. Er reichte es dem jungen Menschen, der es mit spitzen Fingern annahm und hin- und her drehend argwöhnisch betrachtete. Plötzlich hielt er inne und blaffte Hermann barsch an: „Nichtregierungsorganisation, he? Aber Ungläubigenorganisation, was, Christenorganisation, verfluchte!?“ Damit deutete er wild mit dem Zeigefinger pochend auf ein Kreuz im Kreis auf der Karte.
„Aber nein“, entgegnete Hermann ruhig mit sanftem Lächeln, „das ist kein christliches Symbol, sondern stellt das Sonnenrad dar und ist uralt. Im Zusammenhang mit dem Sinnspruch bedeutete es auch: Wir stellen uns quer! Und zwar eben zu den Regierungsorganisationen. Und bringen Dinge ins Rollen wie die Brückeninstandsetzung. Hier, lies bitte selbst.“
„Ich kann diese Buchstaben nicht lesen“, gab Aliz unwirsch zurück, obwohl er einigermaßen englisch sprach.
„Auf der anderen Seite steht es in Paschtu“, sagte Hermann freundlich. „Dreh um.“
Aliz drehte die Karte um und schaute verständnislos. „Hier sprechen wir Dari“, sagte er.
Du kannst überhaupt nicht lesen, dachte Hermann und sagte: „Sieh dir die Stempel an.“
„Was sind das für Stempel?“
„Hast du sie noch nie gesehen?“
Aliz schaute ihn fragend an.
„Der deutsche Adler und die afghanische Moschee.“
Aliz betastete den Prägestempel. „Natürlich habe ich diese Stempel schon gesehen“, sagte er herrisch. „Doch hier hast du gar nichts zu befehlen! Aber ich. Was hast du in deinem Rucksack?“
„Proviant, Werkzeug, Sprengkapseln.“
„Sprengstoff können wir brauchen“, sagte Aliz und reichte Hermann das Ausweiskärtchen zurück. „Ja, ja, für Sprengstoff haben wir Verwendung. Wie viel hast du uns mitgebracht?“
Hermann öffnete seinen Rucksack und zeigte eine Handvoll Sprengkapseln vor. „Aber ich habe sie nicht für euch mitgebracht.“
Aliz zog eine enttäuschte Miene. „Das ist Sprengstoff?“
„Es sind Sprengkapseln. Sie funktionieren mit der Sprengmasse, die erst an Ort und Stelle angebracht wird.“
„Von wem?“
„Von einem von euch. Ihr seid gute Männer. Auch du bist ein guter Mann, wie ich gesehen habe.“
„Wo willst du das gesehen haben?“ fragte Aliz misstrauisch.
Hermann dachte an seine Beobachtungen bei dem Buskashi. „Als die amerikanischen Bomber kamen“, sagte er rasch.
„Was habe ich da schon gemacht“, erwiderte Aliz. „Nichts Besonderes.“
Der junge Mensch ist für Schmeicheleien nicht zugänglich, dachte Hermann. „Man sieht, dass du Erfahrungen hast“, sagte er trotzdem. „Und dass du ein Sohn der Steppe bist.“
„Ja“, nickte Aliz und wechselte das Thema. „Was soll gesprengt werden?“
„Felsen. Wenn nötig.“
„Welche Felsen?“
„Felsbrocken zum Beispiel, die vom Berg herabgestürzt sind und den Weg versperren.“
„Welchen Weg?“
„Irgendeinen Weg, den wir nehmen müssen, und der passierbar sein muss. Oder eine Schlucht.“
„Das bestimmst nicht du, welcher Weg frei sein muss und welcher nicht. Wer hier lebt, muss sicher sein, dass nicht der Falsche einen Weg benutzt, der Verderben bringt. Wer hier lebt, lebt besser und vor allen Dingen länger, wenn nicht jeder Weg für jeden offen ist. Auf dem Weg, den der Schakal geht, kann der Wolf kommen.“ Eine melancholische Trotzigkeit lag in Aliz´ Stimme, seine großen Augen funkelten angriffslustig.
Da musste jemand eine Niederlage verdauen und kompensieren, sich an irgendwem abreagieren, sich und frische Kräfte sammeln, um wieder zum Angriff überzugehen. „Wir werden uns darüber verständigen“, sagte Hermann, dem das nicht schlecht gefiel, „wenn es an der Zeit ist.“
„Man muss wissen, wer Schakal ist und wer Wolf. Was bist du: Schakal oder Wolf?“
„Der Wolf kann nur im Rudel jagen. Der Schakal findet allein seine Beute. Es kommt auf das Gelände an, ob man besser Wolf ist oder Schakal.“
Schritte näherten sich aus dem Inneren der Höhle. „Es ist gut, Aliz“, sagte ein älterer Mann. „Lass ihn zufrieden. Das ist doch German. Der gehört zu uns. Hast du noch nie von German gehört?“
Aliz schüttelte den Kopf.
„Wir müssen jetzt gehen“, sagte der Mann und schritt voran hinaus aus dem Felsüberhang. Alle schlossen sich ihm an, zuletzt Haschem, Hermann und der junge Mensch, der den Weg nach hinten absicherte.