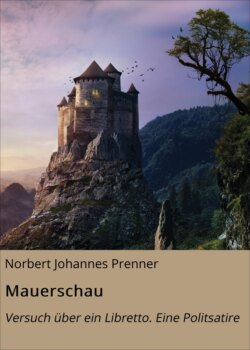Читать книгу Mauerschau - Norbert Johannes Prenner - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеVersuch über ein Libretto Der Himmel über der Stadt begann sich langsam zu bedecken. Es wäre übertrieben zu sagen, er hätte sich völlig verdunkelt, doch verstärkte sich langsam die bodennahe Nordsüdströmung, die in der Folge deutlich kältere Luft heranbrachte. Häufig konnte es regnen, örtlich sogar intensiv. Die Windstille wurde von einer schwachen Brise aus nördlicher Richtung durchbrochen. Dies führte dazu, dass nicht nur Wetterfühlige seit längerem mit andauernden Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu rechnen hatten. Dabei waren die Beschwerden vielfältig. Die einen, so die Herz-Kreislaufpatienten, litten unter vermehrten Beschwerden, Asthmatiker hingegen atmeten erleichtert auf, als der Regen eintraf. Nichtsdestotrotz war die Neigung zu leidenschaftlichen Affären ebenso wie zu romantischen Abendessen, anregenden Begegnungen oder riskanten Spekulationen stets vorhanden. Wer immer in dieser Zeit den Rat eines loyalen Menschen finden konnte, nahm ihn in Anspruch. Von sozialer Kälte war die Rede. Oft wurde bei Geschäftsbeteiligungen nicht immer sofort nach sinnverlangender Kosten-Nutzen Rechnung gefragt. In einigen Fällen jedoch blieben davon nur Entwürfe übrig, ohne genauen Plan, sie umzusetzen.
Auf der Suche nach dem Licht der Wahrheit, gleichsam in einer stürmischen Nacht, genauer gesagt, in einer Wachphase früher Morgenstunden war der Entschluss gefasst worden, quasi Stoff für ein Libretto zu sammeln, einem Befund gleich, der über die gegenwärtigen Verhältnisse Auskunft geben sollte, wie es denn so bestellt sei, mit dem Inneren und dem Äußeren dieses Theaters, mit dem Persönlichen und dem Unpersönlichen und vor allem mit dem Politischen und dem Kulturellen wie auch dem Speziellen im Detail. Inventur sollte gemacht werden über den medialen Diskurs, der persönlichen Ordnung halber wie auch für einen kleinen Kreis Interessierter, so ganz ohne Index und Hochzahl, vor allen Dingen aber ohne die Geisel evaluierender Wissensinstanzen. Wie zu entnehmen war, lebte man in einem Land republikanischer Inszenierungen grotesker Affären, im Land der Operette also, wie gesagt wurde. Auf unerklärliche Weise verschwanden kostbare Dinge aus schlecht behüteten Requisitenkammern, die bald darauf ganz plötzlich wieder auftauchten. Sogleich wurde der Kopf derer gefordert, welche darüber zu hüten gehabt hätten.
Doch die Kultur der Freunde wollte, dass sie blieben, um, zu Unrecht aufgescheucht, wieder aufs Neue in gewohnt selbstgefällige Zufriedenheit zurückzusinken. Wenn überdies die Rede auf das Thema von „einem einzigen Volk“ kam, wäre es grundsätzlich falsch gewesen, von einem solchen als untrennbares Ganzes zu sprechen. Nicht konform, könnte man sagen, in Art und Weise. Die große Verbrüderung war bühnenweit ja schließlich nie wirklich ein Bedürfnis gewesen, zumal das große Händeschütteln in den eigenen Reihen seit je her ausgeblieben war. Das galt für die aus den Logen und im Parkett ebenso wie für die zwischen den niedereren und höheren Rängen. Meinungen waren im Westen bei Gott nicht ident mit denen derer aus dem Osten, ganz zu schweigen mit denen des rebellischen Südens. Aber, und das muss angemerkt sein, wenn es um die Grande Opéra ging, war man für diese im Westen mehr dafür als im Osten. Historisch gesehen war diese Bühne ja immer gut für den Dialog gewesen, wenngleich auch immer seltener imstande, den eigenen zu führen. Damals aber, vor sechzig Jahren, als das Vertrauen in die Allianz die Attribute für ein gemeinsames Bühnenschicksal aus Emotionen der Westlichkeit und Neutralität gemeißelt hatte, wurde die Nähe eines unausweichlichen Konfliktes begreifbarer und ließ sie zusammenwachsen, die ungleichen Teile, wobei paritätische Reibepunkte für kurze Zeit verblassten, bereit, sich zu einem Wir-Gefühl aus Verantwortungsbereitschaft und geistig-ideeller Homogenität einer Gemeinschaft gegenüber der konfliktträchtigen, feindlichen Weltbühne zu verschieben.
Und doch gehörte dieses Gefühl in Zeiten wie jenen längst der Vergangenheit an und war nicht wieder zu beleben. Im besten Fall vielleicht gerade noch dann, wenn es um die großen Söhne und Töchter ging, besser um die Söhne, des reinen Reimes wegen, Komponisten, Dichter und Maler, denn was reimt sich letztendlich schon auf „Töchter“? In so einem seltenen Fall konnte es durchaus geschehen, dass sich auch die Unbequemen aufgezählt fanden im Kanon der Begnadeten, derer man sich üblicherweise schämte. Bühnenverantwortlichkeit - die zeigte sich häufig sehr relativ. Sie konnte einerseits übernommen werden oder auch nicht. Sie konnte übernommen und Konsequenzen abgelehnt werden, durch Versprechungen auch sogar mal abgelehnt werden. Von außen wurde schlampiger Umgang mit dieser Verantwortung registriert, woraufhin externe Kritiker heftig am Bollwerk des verlorenen Bühnenehrenkodexes rüttelten. Vorwürfe, sich möglichst viel unter den Nagel reißen zu wollen lagen in der Luft. Emotionen in Richtung Opfer aus dunkler Vergangenheit fehlten, wurden nicht gezeigt, noch gab es Anerkennung für jene.
Nach Tagen heftiger Auseinandersetzung zwischen Choristen und Regie wurde festgestellt, es ginge wieder bergauf mit Operettenland, man wäre langsam wieder im Reinen mit sich. Die morsche Lebenslüge, erstes Opfer gewesen zu sein, wäre nun endgültig vom Tisch, die Mitschuld am Unrecht, welches allgemein hinlänglich bekannt war, sei umstritten gewesen, die Causa des „Unverrückbaren Reiterstandbildes“ vor zwanzig Jahren zum Synonym des Selbstbetruges geworden. Spät kam der Entschluss, denen Entschädigung zu leisten die Opfer waren und noch lebten.
Als ginge es nunmehr darum, eine neue Bewusstseinslage zu schaffen, die es Unbelehrbaren unmöglich machen sollte, mit dem Rückfall in alte Gewohnheiten zu reüssieren, wie es widerspruchsvollen Rebellen, und nicht nur solchen aus dem Süden, stets gelungen war. Und siehe, was bis vor kurzem schier unmöglich schien, war geschehen. Einer der Laiensänger war auf dem allzu glatten Parkett unverarbeiteter Vergangenheit ausgerutscht und zu Fall gekommen, so dass in diesem ganz und gar nicht unalltäglichen Fall längst vorgesehene und bestehende Gesetzte Anwendung finden konnten. Wenn auch einige gehofft hat-ten, nun würde endlich der Gerechtigkeit zum Siege verholfen, verlief die Sache ebenso wenig dramatisch wie eben nur ein Schuss vor den Bug, mehr nicht. Eine kleine Warnung an alle öffentlichen Leugner, Gutheißer und Verharmloser. Niemand war dabei ernsthaft verletzt worden. Aus einer anderen Welt versuchten die Ärmsten, angelockt durch den scheinbaren Wohlstand, die kontinentale Festungsbühne zu erstürmen, was manchen von ihnen sogar für kurze Zeit gelungen war. Die Entwicklung der Grande Opéra, deren Haushalt niemand mehr zu über-blicken vermochte, war seit Jahren in aller Munde.
Widersprüchliches wurde ihr angelastet, es würde überproduziert und gewissen Anleihen derart hoch dotiert sein, dass manche Mitglieder gar nicht wüssten, wie sie das erhaltene Geld eigentlich ausgeben sollten, während man allgemein unter Ideenlosigkeit litt, die wiederum, traurigerweise, nicht förderbar war. Geld gab es genug, bloß, wem geben war die Frage? Kampagnen gegen den blauen Dunst waren ins Leben gerufen worden, und trotzdem wurde die Zucht der Zier- und Heilpflanze, um 1519 ursprünglich von Jean Nicot als solche bezeichnet, später zweckentfremdet, weiterhin gefördert. Solches und mehr sorgte für ein uneinheitliches Bühnenbild hierzulande und Teile des Publikums wurden zu Skeptikern aus Überzeugung. Das rasche Wachstum der Grande Opéra bot stets genügend Anlass zu heftigem Diskurs.
Da wurde ihr seitens übergeordneter Großbühnenregie eine Atempause verordnet, damit sie wegen ihres rasanten Emporsprießens nicht kollabiere. Die großen Vorhänge gegen Osten hin waren ja bereits teilweise zur Seite geschafft und auf die Vorteile für das Publikum ausreichend hinge-wiesen worden. Wenn sie auch nicht gleich erkennbar waren, so waren sie durchaus nicht für alle von gleicher Bedeutung gewesen. Bloß einige Wenige profitierten davon, hieß es aus den Reihen der Analysten, und die könnten es sich leisten, niedrigere Eintrittspreise zu bezahlen und würden überdies auch noch großzügig unterstützt werden. Leidtragend wäre das Publikum aus den billigen Reihen, so hieß es, und es wäre überaltert, ebenso wie das aus den Logen und im Parkett. Rückläufig wäre man, und neues Publikum sollte hereingelassen werden, Qualitätspublikum versteht sich. (Wer konnte damals schon ahnen, dass das Land eines Tages völlig überrannt werden würde?)
Das Problem war, man hatte zu viele Unbeschäftigte in der Statisterie, daher durfte man in der Öffentlichkeit nicht einfach so darüber reden. Als es jedoch da-rum ging, der Grande Opéra ein neues Statut zu verordnen, welches kurze Zeit später publik geworden war, ging ein Raunen durch die Reihen des Publikums, denn es wäre zu umfangreich. Von Sprachverwirrung war die Rede, ein Sprachdschungel wäre es. Den Vertretern der Chordirektion, der Laiensänger und den Leuten aus der Publikumsvertretung wurde obendrein vorgeworfen, sie würden auf der heimischen Operettenbühne ganz anders agieren als auf jener der Grande Opéra. Und dann kam es, wie es eben kommen musste – noch kaum am Leben und beinahe, nun ja, eine Totgeburt sozusagen / Stillstand des Lebensprozesses / vorzeitiger Exitus. Derselbe wurde sofort genauestens amtlich registriert. Requiescat in pace! Fünfhundert Seiten stark / so etwas wäre nicht zu kapieren, schrien die Theaterkritiker. Dieses Statut war also tot, an das sich Choristen und Darsteller, allen voran die Regie und Chor wie an ein Seil, welches rettend vom Schnürboden gehangen war, geklammert hatten, um daran jene Ideen festzumachen, die alle hätten einigen sollen. Was war nun zu tun? Fürwahr ein schwerer Schlag für die Ersten, die in dieser An-gelegenheit eine wichtige Rolle gespielt hatten. Für die erste Hälfte der Zweiten eigentlich auch, die gespalten waren und mit den Ersten vernabelt waren. Die zweite Hälfte der Zweiten, die schon immer Bedenken gegen die internationale Großbühne hegte, rieb sich vergnügt ihre vom Beifallgeklatsche wunden Händchen. Die Dritten und Vierten mimten Betroffenheit die sich in Grenzen hielt.
Die Schuld am Scheitern des „Esprit de lois“ lag an der Entscheidung aus der Comédie, war zu vernehmen, also dort, wo die Hähne angeblich lauter krähten als anders wo. Die Nachricht vom Tod des Statutes trieb den Keil der Uneinigkeit nur noch tiefer in die Wunden kollektiven Bühnenunbewusstseins, nämlich auch zwischen die unterschiedlichen Altersgruppen der Publikumsgenerationen. Die Jungen sahen erwartungsgemäß immer alles etwas positiver und reagierten mit Coolness. Aus Sicht des älteren wie auch des Seniorenpublikums assoziierte man eher negative Phänomene und befürchtete in diesem Zusammenhang die Einschränkung bisheriger Vergnügungen und mehr Verschwendung, was wiederum die Skepsis gegenüber Fremdpublikum nährte. Sofort richteten sich geistige Kreuzzüge unerbittlich gegen alle Bedroher abendländischer Operettenkultur. Da wollte man schon lieber unter sich sein, im Süden besser am Untersichsten. Ja, schon, ein bisserl dabei sein, aber doch nicht gleich so, von überall nur ein wenig naschen, auf keinen Fall aber etwas hergeben müssen, das kam über-haupt nicht in Frage.
Und während einige vehement forderten, das Publikum müsste sich radikal verändern, verfielen andere jammernd in konservativ Nostalgisches. Überdies stand da noch eine Frage im Raum: Was - was bitte schön sollte denn erinnert werden, um sich als Operettenländler mit der Grande Opéra identifizieren zu können? Ein Ort und eine Münze waren dafür herzlich wenig. Vielleicht sollte man im christlichen Schauspiel danach suchen? War dies etwa bisher überbewertet worden? Aber nein, denn was wäre die Operettenbühne ohne ihre teleologische Vorstellung? Was wäre sie ohne christliches Gotteslob, ohne Marienvesper und Requiem?
Bisher war alles, was auf heimischem Bühnenboden entstanden war, stets in biologistischer Manier auf erklärbare Weise gewachsen, zurechtgestutzt, emporgeschossen, ausgerissen und neu angepflanzt worden und niemals zuvor hatte etwas über Nacht gekeimt, so aus dem Nichts heraus, wie – wie – na, wie eben eine Zauberbohne. Beobachtern und Kennern einzelner Szenen war nicht entgangen, dass das Wissen und Bewusstsein um Vorführungen aus der Vergangenheit im Publikum langsam zu verblassen drohte, und damit verschwand die Symbolik wie auch der Mythos, um nur noch zu nostalgischer Lebenswelt von Freizeitunterhaltung abzugleiten, in all´ ihrem Schick, welcher sich jenseits der Lebenspraxis anzusiedeln begonnen hatte. Emotional-symbolische Stabilität hatte sich zu Ökonomisch-Politischem hin verlagert, Operette drohte zu Regietheater zu verkommen. Danach also war an eine weitere Vergrößerung des Zuschauerraumes nicht mehr zu denken und dem Publikum war dies noch weniger ein Anliegen als zuvor. Alles Event-hafte drum herum reflektierte ohnehin nur viele Fragen und inhalts-lose Floskeln, jedoch keine konkreten Antworten auf die Frage nach kollektivem Bewusstsein. Die alten Metaphern der Freiheit, Gerechtigkeit und Mitspracherecht genügten nicht mehr, um die Identität anspruchsvollen Theaters zu definieren.
Alle Leute fragten sich, ob es nicht noch mehr gäbe? – Es herrschte Ratlosigkeit. Bühne durfte nicht zum Publikumsschlager verkommen, nein, sie sollte – ganz richtig – mehr sein! Die Grande Opéra litt entsetzlich unter Wachstumsschmerzen, und einige monierten, sie wäre in einer – Krise. Sie sei in keiner Krise, dementierte die Regie. Möglicherweise etwas zu rasch gewachsen. Man müsste das Tempo ihrer Entwicklung hinterfragen! Das alte Vereinigungsstatut sei zwar tot, jedoch die Reflexionen über ein neues müssten fortgesetzt werden. Eine Klausur wurde beschlossen um darüber zu beraten, wie man künftig vorgehen wollte. Diese müsste wohl ein Jahr dauern. Schon war von „Grande Museé“ die Rede. In einem kryptischen Ballspieltopos sinnierte die Regie kunst-voll über eine Nachspielzeit, weil es noch nicht zum Elferschießen gekommen sei. Derweil fanden Volksfeste für Wunderkinder aus der Vergangenheit und Gegenwart statt, die eine Zeit lang für Ablenkung sorgten.