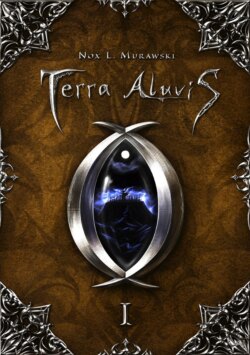Читать книгу Terra Aluvis Vol. 1 - Nox Laurentius Murawski - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление~2~
Zum Morgen hin war das Gewitter tiefer ins Gebirge gezogen und hatte die Küste in einem Zustand herrlichster Regenfrische zurückgelassen. Die ersten Menschen liefen schon auf den Straßen Hymaetica Aluvis' umher, um den ein oder anderen abhanden gekommenen Wagen oder Karren wieder zurückzuholen und eventuell aufgetretene Schäden in Ordnung zu bringen. Die Bauern waren vollends damit beschäftigt, nach ihrem Vieh zu sehen und dabei nicht wenige entlaufene Schafe und Reittiere wieder einzufangen. Die Fischer wiederum taten sich zusammen, um ihre Schiffe und verlorene Fracht aus den Gewässern zurück an Land zu ziehen.
Das Wasser auf den Feldern war schon größtenteils in den Boden eingesickert und erlaubte den Gräsern und Blumen, sich wieder aufzurichten und ihre Blätter kräftiger denn je auszubreiten. Der Tical und seine Bäche hatten sich wieder in ihre Becken zurückgezogen und plätscherten munter in gemächlichem Fluss vor sich hin. Die ersten Vögel wagten bereits, zwitschernd den neuen Tag zu begrüßen und sich in die Lüfte zu schwingen. Hier und da mochte manch einer sogar das eine oder andere Kleintier erhaschen, welches aus dem Dickicht über die Wege hüpfte und sich kurz an dem Nass einer Pfütze erquickte, nur um wieder raschelnd im nächsten Gebüsch zu verschwinden. Das Leben nahm langsam erneut seinen gewohnten Lauf und schien die Schrecken der vergangenen Nacht schon fast wieder vergessen zu haben.
Unter den Gestalten, die zu jener früh morgendlichen Zeit in der Stadt unterwegs waren, befand sich auch ein junger Mann in einer leichten, dunklen Lederrüstung und einem laubgrünen Umhang. Er trug ein silberglänzendes Schwert und einen Dolch an der Hüfte sowie einen Bogen und Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken. Sein Haar war honigblond, seine tiefblauen Augen ziemlich unausgeschlafen, aber entschlossen und ungetrübt zum Horizont gerichtet. Auf einem mit Gepäck und Proviant versehenen Schimmel beschritt er seinen Weg aus der Stadt heraus am Tical entlang ins Landesinnere.
Lewyn blickte nicht zurück – es machte keinen Sinn. Stattdessen sah er zu den kahlen Gipfeln am gewitternden Horizont. Dort, in der Ferne, wo immer noch leises Donnergrollen erklang und sich die dunklen Wolken an den felsigen Berghängen brachen, ja, dort lag sein Ziel. Vierzehn Tage; mehr waren ihm nicht geblieben. Dann musste er das Feld der Himmelsspeere und den Berg des Ahiveth erreicht haben. Er würde den Pass zur Senke des Schicksals bei Henx tief durch das Gebirge des Grauens nehmen, um zu vermeiden, dass er in die westlichen Territorien der 'Anderwesen' kam, wie man sie nannte.
Die Anderwesen bevölkerten die gesamte Westküste bis hoch zum Norden hin, wo ununterbrochen Eis und Schnee vom Himmel fielen und den Ozean selbst zum Erstarren brachten. Manche behaupteten sogar, sie hätten sich bis in die Hochebene des Todes ausgebreitet: einem unwirtlichen Ort klirrender Kälte und frostiger Winde, an welchem kein Mensch – und war er noch so dick in warme Felle eingepackt! – den nächsten Morgen erlebte.
Es gab verschiedene Rassen von Anderwesen und sie alle waren auf ihre Art und Weise intelligent und den Menschen, wenn auch nur entfernt, ähnlich. Eine von ihnen war als 'Exenier' bekannt. Sie waren die ersten, die einem begegneten, stieß man an der Küste entlang in den Norden vor. Diese Wesen hatten eine schuppig glänzende Haut, welche an die von Echsen erinnerte, Schwimmhäute zwischen ihren Fingern und kiemenartige Ohrenflossen. Sie waren an sich sehr agil und zäh und konnten nur in schattig feuchten Gebieten, wie an bewaldeten Seen und Flüssen, überleben – so trocknete die Sonne ihre Haut aus, dass es sie verbrennen mochte. Sie waren am schlimmsten auf die Menschen zu sprechen, sofern bei ihren Schnalz- und Zischgeräuschen überhaupt von 'Sprache' die Rede sein konnte. Intelligent waren sie zweifelsohne, aber nicht sonderlich kooperativ. Händler und Reisende mieden ihre Lebensräume in einem großem Bogen, denn sie brauchten keinen Anlass, um jemanden anzugreifen. Als Rechtfertigung für ihr aggressives Verhalten schien ganz allein die Tatsache zu genügen, dass man noch am Leben war.
Die Menschen erzählten sich von einer weiteren Rasse in den Bergen und Wäldern, die einem weitaus häufiger begegnen mochte, glücklicherweise jedoch wesentlich sanftmütiger zu sein pflegte. Sie wurden von den Menschen 'Tephias' genannt und erinnerten an teils aufrecht gehende, katzenartige Wesen. Sie waren zumindest aus der Ferne her niedlich anzusehen, wie sie sich entweder mit aufgeplustertem Fell in der Sonne fläzten oder gerade süße, reife Früchte von den Bäumen ernteten. Sie zählten eigentlich zu den Pflanzenfressern und lebten wie die Exenier in lockeren Gruppen zusammen. Nicht selten sah man sogar beide Arten in einer größeren Gemeinschaft miteinander leben. Ließ man sie in Ruhe, blieben sie friedlich und ignorierten einen schlichtweg; und so sollte man die Begegnung mit ihnen auch auf sich beruhen lassen. Ansonsten mochte bei dem betroffenen Tephia rasch seine Ader als 'Gelegenheitsfleischfresser' erwachen – und das nur, um den störenden Eindringling loszuwerden.
Einer weiteren, weniger bekannten Art sagte man nach, im kalten Norden zu leben und den ewigen Wintern auf dem Eis die Stirn zu bieten. Kein Mensch hatte sie jemals zu Gesicht bekommen und doch gab es viele Gerüchte über sie …
Einst war ein tollkühner Abenteurer nach langer Vorbereitung zur Hochebene des Todes aufgebrochen, um mehr über sie herauszufinden – so ungestillt war seine Neugierde über ihre rätselhafte Existenz jenseits des Eisgrenze gewesen. Er war nach langen Jahren zurückgekehrt, als man ihn schon längst tot gewähnt und eine Rückkehr für unmöglich gehalten hatte. Seine linke Hand sowie sein linkes Ohr waren abgefroren und das linke Auge vollkommen trüb gewesen. Der endlose Frost hatte seinen Tribut gefordert. Entstellt aber glücklich hatte er seine Aufzeichnungen dem Menschenvolk darbringen wollen. Doch noch bevor es dazu hatte kommen können, war seine Leiche in den Gassen aufgefunden worden – seine Aufzeichnungen entwendet. Nur eines hatte auf eine sonderbare Art und Weise den Weg zu den Menschen gefunden; nämlich die Tatsache, dass jene Wesen die menschliche Sprache beherrschten. Seine Mitmenschen erwiesen ihm die letzte Ehre, indem sie die von ihm erforschte Art nach seinem Namen benannten: 'Nexus'.
Auch die Elfen in ihren fernen Wäldern jenseits der Wüsten von Rayuv zählten zu den Anderwesen, obwohl sich die Menschen dank der Wissenden mit ihnen verständigen konnten und Frieden mit ihnen geschlossen hatten. Sie nannten sich selbst 'aelyphen' und waren neben den Menschen vermutlich das größte Volk, welches Terra Aluvis je besiedelt hatte. Sie lebten in Symbiose mit der Welt und all ihren Elementen, Tieren und Pflanzen, richteten sich nach den Strömen der Natur und gehorchten der Wahrerin des Gleichgewichts und allen Lebens: ah'nya. Die Menschen hielten nicht viel von dieser – in ihren Augen – primitiven Kultur, waren soweit jedoch froh, jenes zweifelsohne mächtige Volk nicht auch noch gegen sich zu haben.
Es gab einen großen Landstrich an der Westküste, welcher von sanften Hügeln geformt und von fruchtbaren Weiden und reichen Gewässern durchzogen war. Selbst die Winde und Schauer glichen einem süßen Flüstern und leisen Rieseln, wenn sie über jene Wiesen, 'die Auen der Tausend Seen', zogen. Sie waren das heilige Herzstück des Anderreiches und keinem Menschen zugänglich.
Es hieß, einst hatten die Menschen mit den Anderwesen zusammen in jenen Auen gelebt. Eines bitteren Tages war dann etwas geschehen, was die Menschen in Ungnade hatte fallen lassen. Daraufhin hatten sich die Anderwesen gegen sie verbündet und gewaltsam aus ihrem Reich verstoßen – nur wobei es sich bei dieser Tat eigentlich gehandelt hatte, war weitestgehend ungeklärt geblieben. Seitdem hatten die Menschen zusehen müssen, wie sie alleine mit den weniger fruchtbaren Böden des südlichen Gebirges und dem trockeneren Klima zurechtkamen.
Als Lewyn bereits eine ganze Weile geritten war, kam er dann doch nicht umhin, sein Pferd wenigstens einmal zu wenden, um einen letzten Blick auf das so sehr geliebte Hymaetica Aluvis zu werfen …
Glitzernd lag es da in der Bucht des Tical, schillernd im Sonnenlicht, das sich seinen Weg durch die dichten Wolken vom Osten her bahnte und die Hauptstadt der Menschen in all ihrer Pracht erstrahlen ließ. Der Blonde seufzte und wollte sich wieder abwenden, da bemerkte er eine dünne Rauchfahne bei den Weidenhängen südlich der Stadt. Er stockte und flüsterte: "Die alte Mühle …"
Erinnerungen an seine gemeinsame Kindheit und Jugend mit Sacris flackerten in seinem Geiste auf und ließen ihn für einen kurzen Augenblick an seinem Vorhaben zweifeln. Lewyn zögerte und betrachtete noch einmal flüchtig die rauchende Ruine in der Ferne – bevor er heftig den Kopf schüttelte und seine Stute erneut wenden ließ.
Wesentlich schwerer fiel es dem jungen Mann plötzlich, seinen Weg fortzusetzen und weiterzureiten, obwohl er sich immer wieder einredete, dass das Ganze gar keine Bedeutung hatte und dass es so etwas wie 'höhere Zeichen' gar nicht gab, und … und überhaupt sollte er sich endlich zusammenreißen und auf das konzentrieren, was vor ihm lag, anstatt dem nachzutrauern, was er gerade dabei war, hinter sich zu lassen, verdammt nochmal aber auch!
***
"Eure Hoheit …? Eure Hoheit …!" Sacris raunte etwas Unverständliches vor sich hin und öffnete widerwillig die Augen. "Eure Königliche Hoheit, wie lange gedenkt Ihr noch zu schlafen? Die Sonne hat schon längst ihren Zenit überschritten und Seine Majestät, der König, lässt nach Euch rufen."
Der Prinz schloss seine Augen wieder und zog die Decke murrend über den Kopf, wobei er sich zur Seite wegdrehte und keinen weiteren Ton von sich gab – eine eindeutige Reaktion. "Wie Ihr wünscht, Eure Königliche Hoheit. Ich werde Eure Antwort umgehend Seiner Königlichen Majestät ausrichten." Anschließend war ein behutsames Schreiten und das Geräusch einer leise ins Schloss fallenden Tür zu vernehmen.
Sacris hatte seine Lider wieder geöffnet und die Decke umgeschlagen. Er hatte das Gefühl, dass es keinen Muskel an seinem Körper gab, der sich in der vergangenen Nacht nicht verkrampft hatte; und ihn fröstelte es unentwegt, als hätte er die Kälte des Windes selbst in sich aufgesogen. Seine Augen brannten und er fühlte sich einfach erschöpft, müde und ausgelaugt.
Gleichzeitig wusste der junge Mann jedoch, dass er nicht würde schlafen können: Seit dem Morgengrauen war er zwar ab und zu immer wieder in einen leichten Halbschlaf gefallen, doch niemals wirklich zur Ruhe gekommen. Allerdings war ihm gerade auch alles andere als nach Aufstehen und der Begegnung mit seinem Vater – nicht zu vergessen dessen 'allwissendem Berater' und all den anderen aufgeputzten Witzfiguren im Palast. Nein, nein … Er wollte lediglich hier liegenbleiben und-
Die Tür des Zimmers schwang auf und ein alter Mann in purpurnem, mit Pelz umsäumtem Mantel, dunkelblauen Gewändern und einem goldenen, edelsteinbesetzten Stirnreif betrat den Raum. König Rex Faryen schloss die Tür hinter sich und ging zum großen Bett seines Sohnes hin.
Sacris sah nicht auf und ließ seinen Blick stattdessen leer auf die gegenüberliegende Wand gerichtet. "Sohnemann, so geht das aber nicht …!", begann sein Vater in tadelndem Tonfall, "Müßiggang ist keine der Tugenden, die ich dir beigebracht habe." Sacris verharrte regungslos in seiner Lage und schwieg. Als sein Vater das sah, seufzte er, zügelte sein Temperament und setzte sich auf den Bettrand. Sein nunmehr milder Blick ruhte auf dem matt traurigen Gesicht des Prinzen. "Was hast du nur, mein Sohn …?", fragte er leise, "Was ist geschehen …?" Sacris regte sich daraufhin langsam und sah seinem Vater stumm in die dunklen, braunen Augen …
Nach einer Weile des stillen Blickkontaktes stellte Rex ruhig fest: "Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass jemand gestorben ist. Aber dem ist nicht so, habe ich recht …?", der alte Mann hielt kurz inne und musterte sein Gegenüber aufmerksam, "Sage mir, mein Sohn, wo ist Lewyn?"
Sofort huschte Sacris' Blick wieder zur Wand. Er merkte, wie sich sein Körper bei der Erwähnung jenes Namens von Neuem verkrampfte und ein schmerzhafter Stich durch seine Brust ging. Der König seufzte erneut – doch dieses Mal deutlich schwerfälliger – und stützte seinen Kopf auf einer Hand ab, ohne dabei den besorgten Blick von seinem Sohn abzuwenden …
Wie lebhaft hatte er die beiden Rabauken noch in Erinnerung, als sie ihm damals nicht einmal zur Hüfte gereicht hatten …! Ständig hatten sie etwas Dummes angestellt und es ihm stets verschwiegen, bis dann plötzlich der Bauer oder der Fleischer – der seine 'frechen Unruhestifter' bis in den Palast verfolgt hatte! – an den Toren gestanden und lautstark zeternd Wiedergutmachung gefordert hatte. Oh, wie oft hatte er sich schon für seinen ungezogenen Sohn entschuldigen und schämen müssen! Sacris hatte stets seinen eigenen Dickschädel durchgesetzt, aber dieser Lewyn hatte es tatsächlich geschafft, ihn in seiner Sturheit sogar noch zu übertreffen …!
König Faryen seufzte und entsann sich daran, wie diese kleinen Knaben dann Jahr um Jahr immer mehr zu jungen Männern herangewachsen waren: Lewyn hatte sich trotz aller Schicksalsschläge seine Lebendigkeit und seinen Frohsinn bewahrt; doch Sacris, sein eigener Sohn, war mit dem Tod der Mutter schlagartig ernst und pflichtbewusst geworden – als wäre er zu jenem Zeitpunkt von der Realität eingeholt worden …
Nur ab und zu, wenn Rex die beiden hatte zufällig alleine beobachten können, war ihm noch etwas von jener unbefangenen Natur begegnet, welche sein Sohn einst besessen hatte. Ja, es machte für ihn sogar den Anschein, als wäre einzig Lewyn in der Lage, jene Schale zu durchdringen, die sich Sacris seit jenem unglückseligen Tag geschaffen hatte …
Und nun …? Was war nur geschehen? Was war seinem einzigen, geliebten Sohn widerfahren, dass er so offensichtlich litt ...? Sein Vater wartete auf irgendeine Regung, irgendeinen Hinweis, doch jener schwieg und blieb von ihm abgewandt.
Nach schier endlosen Augenblicken, ohne dass irgendeiner der beiden Männer etwas von sich gegeben hatte, legte der König seinem Sohn eine warme Hand auf die Schulter und drückte diese herzlich. "Ich lasse dir Essen bringen, damit du mir zumindest nicht verhungerst", sprach Rex besorgt, "Iss es bitte wenigstens auf, sonst weiß ich auch nicht mehr, was ich mit dir anstellen soll …" Dann erhob sich der alte Mann, um mit einem weiteren Seufzer aus dem Zimmer hinaus zu schreiten. Die Tür fiel ein weiteres Mal in ihr Schloss – und der Prinz blieb allein zurück.
Diese Stille … Es war auf einmal so unheimlich ruhig, dass Sacris sogar das Rauschen in seinen Ohren hören konnte. Sein Puls war erhöht, ohne dass er sich den Grund dafür erklären konnte – so hatte er sich schließlich in keinster Weise bewegt.
Schweigend lauschte der junge Mann seinem eigenen Herzschlag … Es war auf eine seltsame Art mehr als beruhigend, ihm zuzuhören. Mit der Zeit wurde auch der Puls ruhiger, … noch ruhiger, … bis er ganz langsam geworden war und in jenem beständigen, langsamen Rhythmus fortwährte … Seine Augen fielen ihm kaum merklich zu … Sein Atem wurde tief und regelmäßig … Der ganze Rest seines Körpers entspannte sich … Und endlich fand sein Geist Ruhe … Ruhe im Schlaf.
Die Luft war von Hufgetrappel und Blätterrascheln erfüllt, die feuchte Erde mit dem Laub unter ihren Hufen aufgewühlt; und als die beiden Männer ihre Pferde zum Galopp anspornend durch den dichten Wald preschten, war nichts mehr von Bedeutung außer der Freiheit selbst.
Sacris wich einigen zu tief hängenden Ästen aus, sprang über einen von Farn umwucherten Baumstamm und holte Lewyn ein. Jener lachte, legte sich flacher auf seinen Schimmel und trieb diesen noch weiter an, sodass er dem dunkelhaarigen Mann wieder davonritt. "Na, warte …!", rief der Prinz daraufhin und blieb seinem Freund auf den Fersen. Lewyn lachte erneut, musste dann aber um einen halb umgestürzten Baum herumreiten und verlor dadurch seinen Vorsprung.
Nunmehr Kopf an Kopf ritten die Männer durch das langsam wilder werdende Dickicht, doch sie und ihre Pferde kannten den Weg. Sie waren mit dem Wald und seinem Unterholz vertraut, wussten, wo es weniger passierbar war und an welchen Stellen sie am besten durchkamen.
Plötzlich brachen sie durch die Baumreihen zu einem flachen Fluss durch, dessen Lauf sie umgehend folgten. Als die Pferde durch das Gewässer hindurchritten, spritzte das kalte Wasser bis zu ihren Beinen hoch – allerdings ließen sich die Männer dadurch herzlich wenig stören. Der herrlich frische Wind wehte ihnen entgegen und weckte ihre Lebensgeister. Sacris sah neben sich und freute sich sehr über das glückliche Gesicht seines Freundes. "Gefällt es dir?", rief er lächelnd zu ihm hinüber. "Merkt man das denn nicht …!?", erwiderte Lewyn strahlend und spornte seinen Schimmel noch ein wenig mehr an.
Das Flussbett wurde felsiger und steiler – so entschieden sich die Männer für eine Uferseite und folgten dem Fluss hangabwärts, während sich ihnen durch die Baumschneise des Wassers ein atemberaubender Ausblick in die Ferne bot: hohe, kaltgraue Berggipfel mit grünen, ausgedehnten Waldhängen, so weit das Auge reichte!, und ein weiter, dunkelblauer Himmel bis über den Horizont hinaus. Ein einsamer Adler flog hoch über ihnen hinweg und erhob sich kreischend noch höher in die Lüfte. Die helle, ferne Sonne sandte ihre dünnen, und doch warmen Strahlen zu allen Seiten hinaus und verjagte jeden noch so kleinen Wolkenhauch, sodass die Himmelsgewölbe durchweg ungetrübt und klar blieben.
Der Fluss mündete in einen tiefen, ruhigen See, der sich in die Breite erstreckte und den dunklen Wald zu den Uferseiten hin sanft abfallenden Wiesenhängen weichen ließ. Das nun entstehende Panorama offenbarte einen sich scharf abzeichnenden, kahlen und hohen Gipfelkamm zum Osten hin und weiche, waldige Hügelberge zum fernen Ozean der Träume im Westen hin. Vor ihnen in den weiten Süden hinein vermengten sich beide Elemente wiederum zu einer ganz und gar umwerfenden Komposition, die das Auge und Herz erfreute.
Einige Kunags – harmloses Wild – wurden durch die herannahenden Pferde von den Ufern verscheucht und entflohen hüpfend in die hohen Gräser der Auen. "Sieh dir das an, Sacris …! Ist das nicht herrlich?", lachte der Blonde und breitete seine Arme in den Wind aus, während sie im seichten Wasser am See entlangritten.
Sacris schmunzelte unwillkürlich. Es würde ihn nicht wirklich wundern, wenn sein Freund jenem Adler gleich selbst jeden Moment in die Lüfte emporschweben würde. Er genoss es, Lewyn so unbeschwert zu sehen. Es beflügelte auch ihn, seine eigenen Fesseln des Alltages fortzuwerfen und alle Pflichten für den Augenblick zu vergessen, um sich einfach dem Gefühl der Freiheit hinzugeben.
Auf der glatten Oberfläche des dunklen Sees spiegelte sich so all die Schönheit wider, die jener Ort mit sich brachte. Seine südlichen Ufer bildeten eine geschlossene und nahezu kreisförmige Felsensichel, welche von Lianengewächsen, dichten Farnen und hohen Schilfen umwuchert wurde. Von jener Sichel aus stürzten die Wasser des Sees in hohen Fällen hinab und traten durch eine niedrige Steinhöhle hindurch wieder als strömender Fluss in die Welt hinaus.
Die Männer wussten ganz genau, wohin sie wollten; und so ritten sie zielstrebig die Wiesenhänge hinunter, bis sie an die Stelle kamen, bei welcher der Fluss wieder unter der Felsenwand hervortrat. Dort stiegen sie von ihren Pferden herab, nahmen ihnen Sattel samt Gepäck ab, legten diese zur Seite ins Gras – und ließen Concurius und Lydia frei auf den üppigen Hängen weiden.
Die zwei Freunde wiederum entkleideten sich bis auf einen Schurz und sprangen rasch ins kühle, erfrischende Wasser des Flusses. Während sich Lewyn kurz ob der Kälte schüttelte, schwamm Sacris bereits gegen die Strömung zur Felsenöffnung an. "Beeil dich, Lewyn!", rief der dunkelhaarige Mann grinsend hinter sich, ohne dabei mit dem Schwimmen aufzuhören, "Sonst wirst du am Ende doch noch Letzter sein …!"
Als Sacris an der Öffnung angekommen war, die weniger als eine Handbreite über dem sprudelndem Wasser verlief, holte er tief Luft und tauchte ins Höhleninnere hinein. Mit kraftvollen Arm- und Beinbewegungen kam er gegen die besonders starke Strömung an jener Verengung zwischen den Felsen an und passierte die kritische Stelle sicher. Anschließend griff der Prinz nach einem herausragenden Steinvorsprung, zog sich daran wieder an die sprudelnde Wasseroberfläche und wartete schnaufend darauf, dass Lewyn ihm folgte.
Die Höhle verlief nicht sonderlich tief und war zum anderen Eingang hin weit geöffnet. Eine Wand aus fließendem Wasser und tief herabhängenden Ranken verhinderten allerdings einen Blick auf das, was sich dahinter verbarg. Tropfende Felszapfen hingen von der Höhlendecke herab oder ragten aus dem rauschenden Wasser heraus – und mochten auf eine unheimliche Art und Weise das Gefühl vermitteln, sich eher im Rachen eines gierig aufgerissenen Tiermauls denn in einer Höhle zu befinden. Die verstärkte Strömung an der Felsenverengung betonte den unangenehmen Eindruck, jeden Moment verschluckt zu werden, dabei dermaßen, dass dem wartenden Prinzen ein Schauer über den Rücken fuhr …
Sacris schüttelte diesen unangenehmen Gedanken ab und blickte auf einmal besorgt um sich. Sein Freund blieb allmählich ungewöhnlich lange fort. "Lewyn …?", fragte er unsicher und wartete auf irgendeine Antwort …
Nichts.
Plötzlich wurde der junge Mann unruhig und versuchte, etwas in den Tiefen des Flusses zu erkennen. "Lewyn …!"
Wieder nichts.
"Lewyn!" Sacris glitt ins reißende Wasser hinein und ließ sich zur Enge zurücktreiben. Als er dort untertauchte, spürte der Prinz, wie er unerwartet gegen etwas Weiches stieß. Sofort griff er danach und stellte erschrocken fest, dass es sich dabei um den Arm seines Freundes handelte. Lewyns Körper hing schlaff zwischen zwei schmalen, vom Grund her aufragenden Felsenspitzen fest und regte sich nicht.
Angst machte sich in Sacris breit und er verhakte sich mit seinen Füßen in den Steinen, um nicht weiter fortgerissen zu werden. Er stemmte sich mit aller Kraft gegen die mächtige Strömung auf und versuchte, den Blonden vorsichtig, aber zügig zu befreien. Nach kurzer Zeit war es dem jungen Mann auch gelungen, sodass er seinen Freund nun sicher unter den Armen an der Brust umfassen und mit sich ziehen konnte.
An der rauen Höhlenwand festklammernd brachte Sacris sich und seinen Gefährten von der Felsenenge fort. Doch ging sein Atem plötzlich gefährlich schnell zur Neige; und er spürte, wie sein Herz heftig zu pochen begann, sich die Finger an den Felsen verkrampften und seine Kräfte schwanden. Nein … Nein!
Mit einem Mal bekam der junge Mann einen Vorsprung zu fassen und zog sie beide an die wild tosende Oberfläche. Sacris hielt sich, so gut er nur konnte, am Stein fest und schnappte atemlos nach Luft. Mit bangem Blick sah er zu seinem Freund, den er gegen den Felsen gelehnt hatte, damit dessen Kopf über dem Wasser blieb: Lewyn war vollkommen blass, seine Augen geschlossen und sein bläulich angelaufener Mund leicht geöffnet. Der Prinz starrte ihn entsetzt an und ergriff die eiskalte Hand, um nach dem Puls zu suchen …
"Verdammt, Lewyn …! Nein, nein …! Nein! Sag, dass das nicht wahr ist- …!"
– Sacris wachte schweißgebadet auf. Sein Herz raste und er rang verzweifelt nach Atem. Er stützte seine nasse Stirn auf den Händen ab und ballte diese zu zitternden Fäusten. "Nein …! Nicht … n-nicht schon wieder …!", keuchte der junge Mann und verbarg sein Gesicht im Ellbogen. Das konnte doch einfach nicht wahr sein! Warum verfolgte ihn dieser Alptraum seit jenem Augenblick?! Warum nur? Warum?!? Jener Tag hätte so schön werden sollen …! Der Tag, an welchem sie ihren Ausflug zu den Nayayami Wasserfällen hatten machen wollen …
Die Prinzresidenz war in einem unbewohnten Landstrich errichtet worden. Die Menschen mieden die Küste nordwärts alles, was jenseits von Hymaetica Aluvis und dem Tal des Tical lag – zu sehr fürchteten sie, den Auen der Tausend Seen zu nahe zu kommen. Die Exenier und anderen Anderwesen wiederum schienen niemals südlich ihres eigenen Herzlandes zu gehen, als ob sie das Reich der Menschen ebenso mieden, wie die Menschen das ihrige.
Allein die Durchgangszone zwischen den Anderreichen und den Auen der Tausend Seen in der Nördlichen Einöde bei der Grafenstadt Henx blieb ein stetiger Konfliktherd. Alles südwestlich davon war sowohl von den Menschen als auch von den Anderwesen unberührt; und in genau jenem Grenzbereich hatte sich Sacris seinen Wohnsitz errichten lassen. Dadurch konnte er sich mehr als alles andere sicher sein, dass er seine Ruhe hatte und ungestört seinen eigenen Angelegenheiten nachgehen konnte.
So begab es sich auch, dass die Wasserfälle, von denen der Prinz geträumt hatte, in ebenjenem Gebiet lagen und dass er mit seinem Freund gewisslich die einzigen Menschen waren, die überhaupt von ihrer Existenz wussten. Sie hatten jenen Ort einst bei einem ihrer vielen Ausflüge zu Pferd entdeckt und ihnen dann den Namen gegeben: 'Nayayami Wasserfälle'.
Seltsamerweise wollte Sacris nicht mehr einfallen, warum sie diese Wasserfälle überhaupt so benannt hatten. Aber … das war nunmehr irrelevant. Er hatte im Moment ohnehin nicht das Gefühl, als würde er in nächster Zukunft so schnell dazu kommen, wieder einmal dorthin zu reisen … – und allein … schon gar nicht.
Der Prinz ließ sich mit einem bedrückten Seufzer zurück in die Kissen sinken und sah sich um: Es war noch nicht ganz dunkel, ja, der Färbung des Himmels außerhalb seiner hohen Fenster nach zu urteilen, war die Sonne gerade dabei unterzugehen. Der junge Mann verbrachte eine geraume Weile damit, lediglich die ruhigen Farbwechsel der Wolken zu betrachten – wie sie langsam ihr flammendes Orange verloren, eher rotstichig purpurfarben wurden … und schließlich in ein kühles Blauviolett verblassten, um die heranziehende Nacht einzuleiten …
Sacris wandte seine Aufmerksamkeit danach seiner näheren Umgebung zu und bemerkte, dass man ihm ein großes Silbertablett mit einem reichhaltigen Buffet gebracht hatte. Der Prinz seufzte abermals und betrachtete das üppige Mahl auf dem Tisch unglücklich.
Was sollte er bloß mit all dem Essen anfangen …? Am liebsten würde er alles Lewyn zukommen lassen. Er wusste ja nicht einmal, was sich sein Freund überhaupt auf den langen Weg eingepackt hatte …! Vermutlich nur etwas Brot und Trockenfleisch und- … Ach, er wollte gar nicht daran denken und stattdessen lieber aufstehen, so schmerzte es ihn doch nur wieder in seiner Brust.
Der junge Mann ging zum Waschbecken in seinem Badezimmer nebenan, ließ etwas kaltes Wasser hinein und wusch sich das Gesicht. Mit einem anschließenden Blick in den Spiegel stellte Sacris erschrocken fest, dass er einfach nur fürchterlich aussah. Dass seine zerzausten Haare stets nur das taten, was sie wollten, und sich nicht im Geringsten darum scherten, wenn er versuchte, sie auch nur ansatzweise in etwas wie eine Frisur zu bringen, war ihm ja nichts Neues; aber nun kam diese ungewöhnliche Blässe im Gesicht und dann auch noch diese rot unterlaufenen Augen mit dunklen Ringen hinzu …!
Als sich der Prinz für einen Moment selbst in diese Augen sah, schüttelte es ihn innerlich. Ihr Ausdruck bereitete ihm mehr als Unbehagen, sodass er sein Gesicht prompt wieder im Becken versenkte.
Anschließend kehrte Sacris in sein Schlafzimmer zurück und zog sich eine dunkelbraune, bequeme Hose sowie ein lockeres, weißes Hemd an, welches er nur zur Hälfte zuknöpfte. Nachdem er einen Schluck Wasser aus einem Glas vom Tablett getrunken hatte, verließ er seine Gemächer.
Der junge Mann schlich mehr denn dass er schritt durch die mit Fackeln beleuchteten Gänge des Palastes, ohne dass er seine Umgebung wirklich wahrnahm. Nachdem Sacris seinen Vater im privaten Teil des Königshauses nicht auffinden konnte, beschloss er, im öffentlichen Bereich nach ihm zu suchen.
Auf einem abgelegenen Gang kamen dem Prinzen unerwartet einige angeheitert schnatternde, adlige Frauen entgegen. Doch war er geistesabwesend genug, um sie nicht zu bemerken und einfach an ihnen vorbeizugehen. Die Damen wiederum hielten herzlich wenig davon; denn als sie den königlichen Thronfolger erkannten und auch noch feststellten, dass er ohne Begleitung war, blieben sie begeistert – und in ihrem Rausch leicht taumelnd – vor ihm stehen, um seine Aufmerksamkeit zu provozieren.
Sacris fielen die betrunkenen Frauen erst auf, als sie ihm direkt den Weg versperrten. Er blinzelte verwirrt in die Runde und verstand nicht, warum sie ihn angehalten hatten. "Na, aber hallo, Mädels! Wen haben wir denn da …?", zwinkerte ihm eine leicht bekleidete, schlanke Kayranerin verführerisch zu, "Eure Königliche Hoheit, heute so ganz allein unterwegs?" Ihr Kichern klang unangenehm kratzig in seinen Ohren.
"Also wirklich, mein Sssüßer, du sssiehst ja richtich niedergeschlag'n aus …!", stellte eine aufreizende Lunidin zu seiner Rechten fest, stemmte die Hände in die kurvige Hüfte und beugte sich zu ihm vor, um ihren ohnehin schon betonten Ausschnitt noch mehr zur Geltung kommen zu lassen. Was … wollten diese Fremden?
"Ah, ssseht, Hoheit …! 'S bricht mir schier 's Hersss …!", beteuerte eine andere Lunidin in übertriebenem Mitleid zu seiner Linken und fuhr sich über die Brust, um auf das vermeintlich gebrochene Herz hinzuweisen. Eine war ja aufgeputzter und freizügiger als die andere …!
Die auffällige Alkoholfahne, welche von den drei Adligen ausging, ließ den Atem des jungen Mannes stocken, dass er den Kopf abwandte und angeekelt die Nase rümpfte. Abwertend blickte Sacris von einem lüsternen Weib zum nächsten … und hielt es für das Beste, einfach nicht auf sie einzugehen. Er wollte nichts mit ihnen zu tun haben – und mit den Gedanken war er gerade ohnehin ganz woanders.
Schon wollte sich der Prinz schlichtweg wortlos an ihnen vorbei drängeln; da lachte eine der Lunidinnen gackernd auf, umfasste keck seinen Arm und lallte dann mehr zu ihren Freundinnen als zu ihm gewandt: "Ach, nu guck doch nich' so böööse …! Ich wüsst' da ja 'ne ausssgessseichnete Möglichkeit, deine Laune sssu heben, mein Sssüßer …! Nich' wahr, Mädelsss?" Mit einem begeisterten Kichern stiegen ihre Begleiterinnen auf den Vorschlag ein und fingen ebenfalls an, sich dem jungen Mann unziemlich zu nähern.
Sacris begriff nur langsam, was vor sich ging – riss sich jedoch sofort los, als ihm die Absicht der adligen Frauen dämmerte. Der Prinz ging entschieden auf Abstand, verengte die Augen zu Schlitzen und zischte: "Ihr widert mich an. Verschwindet."
Daraufhin rief die hochgewachsenen Kayranerin jagdlustig: "Ohohooo, habt ihr das gehört, Mädels …? Er will uns tatsächlich abweisen …!" – "Uuuuu~h …!", erklang es von den Lunidinnen im Chor; und schon setzten sie gemeinsam zu einer Verfolgung auf den schlagartig mehr als verstörten Prinzen an – als plötzlich zwei sich unterhaltende, ältere Männer um die Ecke bogen. Augenblicklich verstummten die Weiber, ließen von ihrer königlichen Beute ab und liefen klappernden Schrittes den Gang davon.
"Oh, Sacris, mein Sohn …!", bemerkte König Faryen überrascht und blieb jäh stehen, "Wir waren just in diesem Moment auf dem Weg zu dir!" Auch der Mercurio betrachtete ihn – allerdings mit einem gänzlichen anderen Gesichtsausdruck.
Sacris sah stumm zum dunklen Ende des Ganges hin, in welchem die adligen Frauen verschwunden waren, und wandte sich stirnrunzelnd dem König zu. "Was möchtest du mir mitteilen, Vater?", fragte er gefasst. "Nun …", begann der alte Mann langsam und legte einen Arm um die Schultern seines Sohnes, während sie den Seitengang zurück zum Thronsaal einschlugen, "Unsere Wachen und Händler berichten, … dass sie Lewyn auf der Straße nach Tyurin begegnet sind."
Sacris schwieg. Der König wartete, bis sie beim Baum der Väter im hinteren Teil des Thronsaales angekommen waren, bevor er stehenblieb, ihm beide Hände auf die Schultern legte und ihn mit warmen Augen ansah. "Wenn er nach Eksaph aufgebrochen ist …", kam es leise von Rex, "… wieso bist du dann nicht einfach mit ihm gegangen?"
Der Prinz schaute seinen Vater still an und schwieg fort. "Bitte, sprich mit mir, mein Sohn …!", bat König Faryen und sah ihn sanft an, "Was ist los mit dir? Warum ist Lewyn losgezogen?" Doch Sacris erwiderte daraufhin noch immer nichts … und warf dem kahlköpfigen Berater neben ihnen lediglich einen finsteren Blick zu …
Anschließend wandte sich der junge Mann ab und setzte sich mit angezogenem Knie seitlich auf die marmorne Mauer, die den Baum der Väter mit all seinen exotischen Pflanzen und Gewächsen umgab. Die gekräuselte Rinde leuchtete in weichem Schein, während die weißen Flecken auf den gewundenen Blättern der Äste ihrerseits wundersam glitzerten und den Baum so in einen hellen Mantel des Lichts hüllten …
Sacris betrachtete diese sonderbare Erscheinung mit trübem Blick und erklärte auf einmal unhörbar: "Lewyn … ist zum Feld der Himmelsspeere aufgebrochen."
Der König sog hörbar die Luft ein. Nach langem Zögern setzte er sich seinem Sohn auf der Mauer gegenüber hin und fragte ruhig: "Sage mir, mein Sohn: Wieso ist er dorthin aufgebrochen …? Dies ist kein Ort für einen kurzen Ausflug – ja, dies ist ohnehin überhaupt kein Ort, zu welchem ein junger Mann wie er jemals aufbrechen sollte …!" Sacris' Augen wanderten traurig zu seinem Vater hin. Seine Stimme war gedämpft und brüchig, als er ihm antwortete: "Das weiß ich … Das weiß ich doch …! Aber- …!", und plötzlich verbarg er sein Gesicht im Ellbogen, "Celine …! Er glaubt, dort Celine zu finden!"
Der ältere Mann hob beide Augenbrauen an. "Celine? Aber warum?", hakte er verdutzt nach, "Wie kommt Lewyn denn dazu, sie ausgerechnet dort zu vermuten?" Der Prinz lachte trocken in seinen Arm hinein, schüttelte bitter den Kopf und meinte: "Weil ein Junge es ihm gesagt hat."
"Weil ein … Junge … es ihm gesagt hat …?", vergewisserte sich der König ungläubig. Sacris blickte sichtlich unglücklich auf und bestätigte: "Ja, ein Junge …!", und mit einem Mal brach alles aus ihm heraus, "Er kam daher und erzählte etwas von einer 'Vision' und von 'Schicksal' und dass er in einem Traum gesehen hätte, wie Lewyn sie beim nächsten Vollmond auf dem Berg des Ahiveth finden würde, weil sie dort angeblich von irgendwem geopfert wird …!", der Prinz wurde immer aufgebrachter und gestikulierte mit den Händen um sich, "Und, u-und dass das wohl diejenigen sein würden, die auch alle anderen verschwundenen Menschen auf dem Gewissen haben, und dass es zwar vergebens sei und überhaupt, aber dennoch war er so – argh!", Sacris verkrallte die Hände am Kopf, während sein Redefluss zunehmend stockte, "Ich … i-ich weiß nicht warum, aber danach … danach war Lewyn wie ausgewechselt! Wir, w-wir redeten nur noch aneinander vorbei; zur Vernunft bringen konnte ich ihn nicht und, und meine Hilfe wollte er auch nicht und-" Der junge Mann raufte sich verzweifelt die Haare, bevor er sein Gesicht in den Händen vergrub und sich wieder mit aller Kraft zu beruhigen versuchte.
Sein Vater fuhr sich sprachlos über den langen, gepflegten Vollbart und wusste nicht, was er sagen sollte …
Rex hatte mit allem, mit wirklich allem gerechnet – aber nicht mit einer derartigen Erklärung. Daher wusste er nun umso weniger, wie er darauf reagieren sollte, ohne die Gefühle seines einzigen Sohnes, den er doch so sehr liebte!, zu verletzen. Es schmerzte den König sehr, ihn derartig leiden zu sehen, also setzte er schließlich zögernd zu einem Vorschlag an: "Wir könnten … einen Falken an die nördliche Grafenstadt Henx schicken und dem Hauptmann der Wache den Befehl geben, Lewyn aufzuhalten, sobald er dort vorbeikommt; und er wird dort vorbeikommen müssen, sofern er nicht einen großen Umweg über die westlichen Territorien der Anderwesen machen und sich damit schon einer fast noch größeren Gefahr aussetzen will."
Sacris schüttelte den Kopf und ließ seine Arme sinken. "Du verstehst das nicht, Vater", meinte er und fing wieder an, seine Hände zur Verdeutlichung einzusetzen, "Lewyn war dermaßen erfüllt von diesem, diesem … 'Gedanken', dass es vollkommen sinnlos war, ihn aufzuhalten! Mit Vernunft und Verstand bist du bei ihm überhaupt nicht mehr weitergekommen …! Ich … i-ich hatte vielmehr das Gefühl, dass seine Beweggründe einer, einer völlig 'anderen' Natur waren."
Als der Prinz dem unterdrückt skeptischen Blick seines älteren Gegenübers begegnete, hob er eine Hand und wandte sich resigniert kopfschüttelnd ab. "Bitte, zwinge mich nicht, dir das näher zu erklären, Vater, denn das kann ich nicht. Der kleine Junge war einfach nur seltsam … Seine Ausstrahlung, sein Benehmen – ja, schlichtweg alles an ihm war seltsam! Und nach der Begegnung mit ihm wurde Lewyn genauso seltsam …!"
Plötzlich lachte Sacris hilflos auf und zog seine Schultern an. "Ich meine, wenn wir Lewyn gefangen haben, was soll ich dann bitte mit ihm anstellen? Ihn in eine Zelle sperren …?!", und sein Lachen verschwand schlagartig, "Er wird mich hassen, das wird er!" Kurz darauf senkte der junge Mann seinen Blick erneut, atmete einmal besonders tief durch und schloss schmerzlich die Augen …
"Es gibt nichts, was ich für ihn tun könnte."
König Faryen schaute seinen Sohn bitter an. Der ganze Fall überstieg seine Vorstellungskraft. Wie konnte er ihm nur helfen? Ratsuchend blickte Rex zum Mercurio hinauf, welcher die ganze Zeit über still und bewegungslos an einer näheren Säule verharrt hatte.
Der Wissende regte sich daraufhin und trat still in den Schein des Baumes. "Nun …", er legte die dürren Fingerspitzen aneinander und guckte auf den Prinzen hinab, welcher infolgedessen stirnrunzelnd zu ihm aufsah, "Wie mir scheint, wird dieses Vorkommnis nicht ohne Opfer gelöst werden können."
Sacris sagte nichts. "Eure Freundin Celine wird offensichtlich sterben", führte der Mercurio sachlich aus, "und Euer Freund Lewyn höchstwahrscheinlich ebenso – wenn man die Statistiken bezüglich aller Aufbrüche zum Feld der Himmelsspeere betrachtet. Und Ihr …", der königliche Berater hielt inne und musterte den jungen Mann mit einem äußerst rätselhaften Blick, "Ihr wart vernünftig genug, ihm nicht zu folgen, und somit Euer Leben und das des ganzen Königshauses Faryen zu verschonen."
Die trockenen Worte des Wissenden ließen die Miene des Prinzen düster werden. Eine immer größer werdende Antipathie dem Mercurio gegenüber machte sich in ihm bemerkbar. "Des Weiteren", fuhr Hal ruhig fort, "hätte ein fremdes Eingreifen in die Reise Eures Freundes, wie Ihr bereits richtig festgestellt habt, den Tod Eurer Freundschaft zum Opfer – was sich für Euch unter Umständen als noch schlimmer erweisen könnte als sein tatsächliches Ableben selbst."
Sacris hatte mit einem Mal alle Mühe, sich zu beherrschen und nicht einfach aufzustehen, um den königlichen Berater zum Schweigen zu bringen. Er wollte es nicht hören! Es brachte nichts! Nichts außer Schmerz! Doch behielt der junge Mann auch weiterhin seine Fassung und schaffte es, dem eindringlichen Blick des Mercurios selbstsicher standzuhalten – zähneknirschend.
"Ihm ab der Grafenstadt Henx weitere Einheiten zur Seite zu stellen", setzte Hal gelassen fort; und seine Stimme bildete einen absoluten Kontrast zur negativen Spannung, die in ihrem intensiven Blickkontakt lag, "würde lediglich zur Folge haben, dass nur noch mehr Menschen ihr Leben für eine aussichtslose Reise opfern – wenn man die Statistiken bezüglich aller Aufbrüche zum Feld der Himmelsspeere betrachtet."
Und so schloss der Wissende kühl kalkulierend: "Die geringste Anzahl an Opfern würde somit durch die Aufrechterhaltung des Status quo gewährleistet."
Der nüchterne Vortrag des Mercurios über die Verluste im Zusammenhang mit Lewyns Vorhaben war nicht gerade das gewesen, was sich der König erhofft hatte; so fürchtete er, dass dieser nur mehr Schaden angerichtet als geholfen hatte. Tatsächlich bemerkte er, dass sein Sohn den Worten des Wissenden mit wenig Begeisterung begegnete.
Sacris starrte den kahlköpfigen Mann über sich unbeirrt und über alle Maßen finster an. "Ach, wirklich …?", ging er grimmig auf seine Worte ein, "Nun, stellt Euch einmal vor, dass ich all das schon gewusst habe. Vielen Dank für die Darlegung des ohnehin schon Offensichtlichen!", und er deutete erst auf sich und danach auf ihre Umgebung, "Was meint Ihr denn bitte, warum ich mich gerade hier befinde? Und warum ich auch nichts weiter unternommen habe, um Lewyn in der Ferne aufzuhalten oder anderweitig mit Truppen zu unterstützen?"
Der Prinz stand ruhig auf, ohne den Blickkontakt zum Mercurio zu unterbrechen, und fuhr nahtlos fort: "Und damit Ihr auch noch jenes wisst, 'Wissender': Es war Lewyn selbst, der bereits von vornherein jede Hilfe meines Vaters abgelehnt hat – da ihm offenbar klar gewesen ist, wie unglaubwürdig das alles auf andere wirken musste. Immerhin hat er es noch nicht einmal geschafft, mich, seinen besten Freund!, davon zu überzeugen."
Sacris kniff seine Augen unmerklich zusammen und ballte die Hände zu Fäusten. "Tut also bloß nicht so, als würden Eure 'Ratschläge' zu irgendetwas nütze sein!", er rümpfte flüchtig die Nase, während seine Stimme mehr und mehr zu einem Zischen wurde, "Ihr redet viel und wisst …", er nickte verbittert, "… ja, wisst gewiss noch wesentlich mehr als Ihr nach außen hin preisgebt. Aber Eure Zunge ist ungezügelt und scharf, nimmt weder Rücksicht auf Gefühl noch Zustand desjenigen, mit dem Ihr sprecht; so rate ich Euch dringend, in Euren 'allumfassenden Büchern' nachzuschlagen, was es mit den Begriffen 'Taktgefühl' und 'Mitleid' auf sich hat."
Der König beobachtete die Reaktion seines Sohnes ernst und nachdenklich … Sacris bot dem Mercurio offenkundig die Stirn und wirkte im Vergleich zu all den anderen Menschen völlig unbeeindruckt von dessen autoritärem Auftreten. Der Wissende hatte während der Tirade des Prinzen eine Augenbraue gehoben und seinen Blick ebenso beherrscht erwidert wie er ihn von dem jungen Mann empfangen hatte. Sowohl der König als auch der Berater schwiegen.
"Wenn Ihr nichts mehr zu sagen habt, werde ich mich nun zurückziehen", endete Sacris knapp und nickte seinem Vater kurz zu, bevor er sich auf dem Absatz herumdrehte und den Thronsaal verließ. Der Mercurio sah ihm mit einem still interessierten Blick nach. Der König seufzte.
Sacris ging zielstrebig auf sein Zimmer zurück und war innerlich erleichtert, keinen weiteren ungewünschten Personen auf dem Weg begegnet zu sein. Als er in seinen Gemächern angekommen war, griff er nach dem Wasserglas vom Silbertablett und trank daraus einen kleinen Schluck. Im Vorbeigehen langte der Prinz dann noch nach einer belegten Brotscheibe, biss in diese hinein und ging damit im Mund weiter zum Stuhl neben seinem Bett hinüber. Er nahm das darum gehangene Schwert, gürtete es sich routiniert um, kehrte dabei wieder zum Tisch zurück – und biss nun endlich erstmals ein Stück von seinem Brot im Mund ab. Nachdem er es mit einem weiteren Schluck Wasser hinuntergespült hatte, verließ der dunkelhaarige Mann den Raum auch schon wieder.
Sacris war das Ganze zuwider: Er hielt es nicht aus, erleben zu müssen, wie der ganze Adel Jahr um Jahr immer dekadenter wurde. Seit Frieden im Reich herrschte, kam es dem Prinzen vor, als wäre jeder Mensch, der es sich leisten konnte, dem Genuss und Amüsement verfallen. Zu ihren immer ausfallender werdenden Aufzügen kam nun hinzu, dass er zunehmend auf betrunkene Adlige im öffentlichen Teil des Palastes traf, auch wenn Sacris zugeben musste, dass ihn bisher noch niemand auch nur im Ansatz so ungehemmt angefallen hatte wie die Weibsbilder im Säulengang vorhin.
Die Menschen hatten sich vorrangig an den Küstengebieten des südlichen Gebirges bis hin zu den Wüsten von Rayuv ausgebreitet. Sie handelten hauptsächlich über Hafenstädte und Schiffe, da das Landesinnere weitestgehend unbewohnt war und es kaum zugängliche Pässe gab, welche über die hohen Gipfelkämme der Berge führten.
Die Menschen fürchteten die Einsamkeit des Gebirges des Grauens. Nur wenige Pflanzen und Tiere vermochten in jener Ödnis zu überleben – und man erzählte sich von einem unvorstellbaren Schrecken, der dort wohnte: einem Grauen, welches Mark und Bein erschüttern ließ. Niemand verlor auch nur ein Wort darüber, was einem in der Abgeschiedenheit jener Berge begegnen mochte; doch mied ein jeder sie wohl wissend, dass sie gleich dem Feld der Himmelsspeere ein Ort ohne Rückkehr waren.
Es gab vier mächtige Grafenhäuser, welche die Pfeiler des Menschenreiches darstellten: Henx, Lun, Xorn und Kayran. Jedes von ihnen verfolgte einen eigenen Kodex und hielt bestimmte Werte und Prinzipien für heilig. So verkörperten die vier Grafenhäuser gänzlich unterschiedliche Ansichten von Kultur, Wissenschaft und Moral und hatten ihre Rivalitäten untereinander nie ganz abgelegt. Allerdings gab es mit der Herrschaft König Faryens III seit Ewigkeiten erstmals wieder ein vereintes Reich – und dass dies mit dem plötzlichen Auftauchen der Wissenden zu Beginn seiner Regentschaft zusammenhing, war ein offenes Geheimnis.
Das Königshaus Faryen hatte seinen Sitz in Hymaetica Aluvis, der Hauptstadt der Menschen, während die Grafenhäuser Henx, Lun, Xorn und Kayran in ihren gleichnamigen Städten residierten.
Die Menschen jenseits dieser fünf Großstädte waren meist eher einfach gestrickt und lebten von Viehzucht und Landwirtschaft. Über die Jahrhunderte hinweg hatte sich ein starker Ahnenkult manifestiert, der ohne geistliche Führungspersonen in Tempelanlagen praktiziert wurde. Dabei wurden die Verstorbenen rituell in dem Glauben verbrannt, dass ihre Lebenserfahrung in den Baum der Väter einging und zur Weisheit für die Könige wurde.
Die Kriegerfestung Henx war die einzige Grafenstadt, welche sich nicht an der Küste zum Ozean der Träume befand. An der Quelle des Tical auf dem Pass zur Senke des Schicksals gelegen sorgte Henx für die Sicherheit des Reiches – indem es die beständig von außen einfallenden Exenier-Horden am Großen Wall zurückschlug. Da die Grafenstadt Henx als Festungsanlage zwischen zwei Bergen errichtet worden war, stellte sie die nördliche Bastion gegen die hereinfallenden Anderwesen vom Norden, Osten und Westen her dar.
Henx besaß die am besten ausgebildeten Truppen des ganzen Menschenreiches und hatte sie bei Weitem auch am häufigsten einsetzen müssen. Entsprechend wies der Graf von Henx einen unübertroffenen, militärischen Erfahrungsschatz auf; sodass es niemanden wunderte, dass er zugleich der Oberbefehlshaber der menschlichen Armee war. Die Grafschaft Henx hatte dem König seit jeher treu gedient und ihre Krieger dienten als Hüter des Gesetzes im ganzen Menschenreich.
Die Berge, zwischen denen Henx eingebettet lag, flankierten den Fluss Tical zur Meeresmündung im Ozean der Träume, wo die Hauptstadt der Menschen Hymaetica Aluvis lag.
Folgte man von der Hauptstadt aus der Küste in den Süden, so traf man zuallererst auf die Grafschaft Lun am Ansatz des Drachenrückens – einem sichelförmigen Bergkamm, welcher in den Ozean hineinführte. Dabei handelte es sich um das Ende des Gebirges des Grauens, das sich fernab der Küste in den Tiefen des Meeres zerlief. Der Gebirgskamm unterteilte das Menschenreich in den fruchtbaren Norden und kargen Süden, da es die Meeresströmungen umlenkte und den Niederreichen dadurch ein trockenes Klima bescherte.
Lun war eine verhältnismäßig kleine Grafschaft und bildete den Handelsknotenpunkt zwischen dem Norden und dem Süden. Durch seinen hohen Zoll war Lun auffällig wohlhabend und reich an Schätzen. Seine Bewohner verstanden es, ihren größtmöglichen Profit aus einer jeden Situation zu ziehen, und dabei eher selten Rücksicht auf ihre Geschäftspartner und Mitmenschen zu nehmen.
Doch der Handel und Wohlstand stellten nur einen Bruchteil der Kultur Luns dar. Die Luniden waren in erster Linie Schöngeister, Dichter und Künstler. Wo das Wesen der Henxer vom Kampf um die Gerechtigkeit bestimmt war, so bestand das Wesen der Luniden aus der Liebe für Ästhetik, Kultur und Sinnlichkeit. Entsprechend groß war jedoch auch der Schatten der Dekadenz und Intriganz, den Lun mit sich brachte; und ein jeder wusste, dass Vorsicht geboten war, wenn man mit Luniden umging – denn sie waren Meister des falschen Spiels.
So undurchsichtig und listig die Luniden waren, so klar und aufrichtig waren die Xorniden. Die Grafenstadt Xorn lag südlich von Lun in der Drachenbucht und war als zuletzt rettender Anker von großer Bedeutung für viele Seefahrer, welche von den unberechenbaren Wirbeln des Drachenrückens heimgesucht wurden.
Xorn war vergleichsweise arm und bildete den direkten Gegensatz zur Grafschaft Lun, da seine Menschen nicht im Geringsten auf materiellen Reichtum aus waren und das einfache Leben und die Familie schätzten. Xorn war die Stadt der talentierten Handwerker und tüchtigen Arbeiter. Durch die in ihren Gewässern auftretenden 'Drachenwirbel' waren die Xorniden allerdings ebenso dafür bekannt, ungeschlagen in Schiffstechnik und Seefahrt zu sein. Ihre Navigatoren zählten zu den geschicktesten und zuverlässigsten des Reiches und wurden häufig mit der Überfahrt wichtiger Frachten beauftragt.
Den Menschen Xorns sagte man allgemein nach, dass sie ihr Herz am rechten Fleck trugen und viel Wert auf praktisch Verwertbares legten – sodass sie als Bezahlung lieber ein gebratenes Schwein auf dem Tisch als eine Münze im Geldbeutel sahen.
An der Küste in den Ausläufern des Gebirges zur Wüste hin lag schließlich Kayran. Jene Grafenstadt war für ihre Wissenschaft und Forschung bekannt. Viele Gelehrte und Meister arbeiteten dort im direkten Auftrag des Königshauses – nicht selten unter Beobachtung der Wissenden selbst.
Die Intelligenz und Auffassungsgabe der Kayraner galten als herausragend und allein ihre Errungenschaften in der Medizin sogar als 'Wunderwerk'. Daher waren sie im ganzen Reich als Heilkundige, auch 'Medici' genannt, zu finden und wurden von den meisten Menschen entsprechend hoch geschätzt.
Doch hörte man im Norden auch von manch anderen Dingen über Kayran und seine wissensdurstigen Forscher – von Dingen, die dem König überhaupt nicht gefielen: von dunklen Ritualen und schwarzer Magie, von Experimenten mit Menschen, die im Wahnsinn in die Wüsten hinausgetrieben wurden und Wochen später völlig verändert zurückkehrten …
– Das gewöhnliche Volk galt dort allerdings als besonders abergläubisch, so sah man in solcherlei Aussagen keinen ernsthaften Grund zur Beunruhigung.
Die Hauptstadt der Menschen, Hymaetica Aluvis, vereinte letztlich alle vier Grafenhäuser in sich – sowohl vom Menschenschlag als auch von den Eigenschaften her, die sie jeweils mit sich brachten. Nur hatte Sacris den Eindruck, als würde Hymaetica zwischen den Fronten eine eigene Identität und Orientierung fehlen. Er dachte an all die klugen Köpfe Kayrans, die tapferen Krieger Henx', die gerissenen Adligen Luns und die fleißigen Handwerker Xorns … und schüttelte den Kopf.
Wie hart und ehrlich arbeiteten die Xorniden für ihr Brot und dachten nicht einmal im Entferntesten daran, ihre Mitmenschen auf dieselbe Art und Weise auszunutzen, wie es ihre Nachbarn aus Lun taten. Ja, diese verdammten Luniden …!
Der Prinz ließ ein zynisches Schnauben hören, während er durch die verlassenen Gänge des Palastes schritt. Nun, es lag natürlich im Interesse der Luniden, ihre 'Kultur' auch in der Hauptstadt durchzusetzen. Schließlich mussten sie das Geld irgendwo herbekommen, das sie jeden Abend zusammen mit ihren adligen Gesellen aus Kayran in Rausch und Lust ertränkten.
Voller Abscheu stieß Sacris die Tür zu den Hinterhöfen des Palastes auf und schlug den Weg zu den Ställen ein. Wie konnte es eigentlich sein, dass zwei der großen Adelsgeschlechter derart verkommen waren? Erst hatten sich Lun und Kayran gegen den König und seine loyalen Häuser Henx und Xorn aufgelehnt; und nun, wo sie gebändigt worden waren, stürzten sie die höhere Gesellschaftsschicht in den Schmutz! Und dann sollte er, Sacris, auch noch darauf bedacht sein, ihnen nicht negativ aufzufallen?! Pah! Er war doch kein Spielzeug, das alles mit sich machen ließ, was den Herrschaften angenehm erschien …! Er war der angehende König des Volkes und nicht der angehende Lakai des Adels.
Lun und Kayran hatten sich einst gegen Xorn verbrüdert, um erst den Süden und dann die ganze Küste einzunehmen. Jedoch hatten sie die unberechenbaren Strömungen der Drachenbucht fatal unterschätzt; sodass die Truppen Henx' rechtzeitig eingetroffen waren, bevor eine ernsthafte Machtübernahme hatte stattfinden können – zumal Xorns Schiffe wesentlich robuster gebaut und seine Schiffsmänner denen der anderen in den wilden Gewässern weit überlegen waren.
Nach diesem Vorfall hatte Henx einen Teil seiner Armee dem Grafenhaus Xorn überlassen und gemeinsam mit dem Königshaus ein Bündnis geschlossen, um das Reich zusammenzuhalten. Kayran und Lun hingegen hatten sich seither zurückgezogen und suchten ihre Machteinflüsse nunmehr im Verborgenen.
Durch die Anwesenheit der Wissenden hatte sich die Situation zumindest in Kayran wesentlich entspannt; so waren der König und das Volk schließlich auf die Dienste der Medici angewiesen. Des Weiteren kamen sie um eine Zusammenarbeit mit dem Handelsbindeglied Lun ebenfalls nicht herum, da ansonsten der Kontakt zwischen den Ober- und Niederreichen versiegen würde. Folglich hatte König Faryen nichts dagegen einwenden können, dass sie ihren Zoll nochmals erhöht hatten …
Sacris rümpfte die Nase in Missfallen. Diese nichtsnutzigen Parasiten …! Scherten sich einen Dreck um andere, jammerten aber lauthals herum, sobald ihnen etwas nicht passte – schlimmer als Kinder. Er durchquerte einen weiteren, mit Fackeln beleuchteten Innenhof und trat durch eine Gittertür auf eine gepflasterte Straße hinaus, die zu den Stallungen hinter dem Palast außerhalb der Stadt führte.
Zwei henxische Krieger hielten vor den Ställen Wache und grüßten den vorbeikommenden Prinzen mit einem hochachtungsvollen "Wir grüßen Euch, Hoheit!". Der junge Mann erwiderte ihren Gruß mit einem knappen Nicken, betrat den Pferdestall und schritt auf eine der hinteren Boxen zu – in welcher bereits ein großer, schwarzer Hengst aufgeregt hin und her scharrte und es kaum erwarten konnte, bis er endlich bei ihm ankam.
Sacris tätschelte seine dunkle Nase und begrüßte ihn leise: "Na, Concurius, du vermisst Lydia auch, nicht wahr …?", er lächelte traurig, "Komm, lass uns ein wenig ausreiten. Das wird uns beiden gut tun …" Nachdem der junge Mann dem Rappen noch einmal über den Kopf gestrichen hatte, öffnete er die niedrige Tür, ließ Sattel und Zügel an der Wand hängen und verließ neben seinem Pferd schreitend das Gehöft.
Sobald die Wachen sahen, dass das königliche Reittier völlig ungesattelt war, fragte eine von ihnen pflichtbewusst: "Hoheit, soll ich den Stallmeister rufen, damit er das Pferd für Euren Ausflug vorbereitet?" Der Prinz hielt im Gehen inne, drehte sich langsam auf dem Absatz herum und sah den henxischen Krieger mit gehobener Augenbraue an. "Ich bin sehr wohl in der Lage, mein Pferd eigenhändig zu satteln", meinte er kühl und verlieh seinen Worten durch einen vernichtenden Blick unmissverständlich Nachdruck. Infolgedessen räusperte sich die Wache verlegen, entschuldigte sich mit einem "Selbstverständlich, verzeiht, Hoheit!" und nahm wieder ihre Position am Tor ein.
Sacris ging noch einige Schritte weiter, bevor er Concurius über die pechschwarze Mähne strich, … sodass jener stehenblieb und darauf wartete, dass er sich auf ihn setzte. So begab sich der Prinz in einer schwungvollen Bewegung auf den Rücken seines Rappen und ließ seine Hände zu beiden Seiten des kräftigen Halses ruhen. Dann gab er ihm mit einem leichten Druck der Fersen zu verstehen, dass er bereit war – was sich Concurius nicht zwei Mal sagen ließ und über die mondbeschienenen Weiden davongalloppierte.
Es war eine klare Sommernacht. Der junge Mann hatte sich flach auf seinen Hengst gelegt und gab mit den Händen in dessen Mähne nun ihre grobe Richtung vor. Dabei ließ er seinen Rappen den Weg ohnehin fast gänzlich frei wählen; so mied Concurius von sich aus die Stadt und das war ihm im Moment nur recht.
Sacris schloss die Augen, sog dabei die frische Nachtluft ein und ließ den Reitwind sein wildes Haar durchkämmen. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen … Ja, hier gehörte er hin – nicht in die Stadt, nicht hinter Mauern aus Stein, nicht hinter ein Kostüm aus Puder und Rüschengewändern. Je mehr der Prinz damit konfrontiert wurde, desto stärker wurde sein Verlangen, sich davon zu distanzieren.
Sacris lachte trocken auf und dachte bei sich: 'Und du willst der Prinz sein …!? Als König erwartet dich doch ein einziges Leben hinter diesen Toren aus Trug und Glanz!' Er schlug die Lider wieder auf und stellte fest, dass Concurius auf den Tical zuritt. Ja, sollten sie ruhig zum anderen Ufer wechseln … Die Hänge dort drüben waren ohnehin üppiger und die Stadt auf jener Seite auch nicht derartig ausgedehnt wie auf der hiesigen.
Der Tical war ein recht breiter und tiefer Fluss, welcher bei seinem Delta in der Bucht von Hymaetica allerdings nur über eine sehr ruhige, gemäßigte Strömung verfügte. Sacris stieg von seinem Rappen herab und tauchte ohne zu zögern ins dunkle, kalte Wasser hinein, um zum anderen Ufer zu gelangen. Concurius folgte ihm ohne Umschweife, sodass sie nun gemeinsam durch den großen Fluss schwammen.
Sacris genoss es, die Kühle der Strömungen an seinem Körper zu spüren … Es war ein gewisses Gefühl von Freiheit, das damit einherging – denn wilde Strömungen wie diese gab es in keinem der Luxusbäder der Paläste. Der Prinz seufzte befreit und ließ sich von den glitzernden Reflexionen des Mondlichtes umspielt auf den sanften Wellen davontragen …
***
Lewyn blickte nachdenklich zum Sternenhimmel hinauf, während er auf einer Strohmatte lag und die Arme hinter seinem Kopf verschränkt hielt. Seine Stute Lydia graste gemächlich in der Nähe und schnaubte ab und zu leise auf, wenn sie das ein oder andere Ungeziefer mit einem mächtigen Schwung ihren Schweifes abwehrte. Knisternd verzehrte das Lagerfeuer die Äste und schenkte mit seinen züngelnden Flammen beruhigende Wärme und Licht. Die Insekten in den dichten Gräsern um sie herum zirpten unablässig, während in der Ferne der Nacht gelegentlich der einsame Ruf eines Vogels erklang …
Lewyn ließ seinen Blick über die zahllosen Sterne schweifen, bis er an einer bestimmten Konstellation hängenblieb. Es war ein gewundenes Sternbild – einem Drachenschwan ähnelnd – welches die Menschen 'den Suchenden' nannten. Der hellhaarige Mann betrachtete das Bildnis am Himmelsgewölbe unter all den anderen Gestirnen … und fragte auf einmal verloren in die Nacht hinein: "Was suchst du, Lewyn …? Was suchst du …"
Der Blonde hielt die rechte Hand in die Höhe und betrachtete seine Fingerspitzen. Dieses Kribbeln … Es war so eigenartig gewesen, so befremdlich und so, so- … – Lewyn konnte es einfach nicht in Worte fassen. Er wusste lediglich, dass das Kribbeln in jenem Augenblick nicht nur durch seinen Körper, sondern durch sein Innerstes, seine Seele selbst, gegangen war.
Und die Augen jenes rätselhaften Jungen erst …! Das sonderbare Feuer in ihnen war auf ihn, Lewyn, übergesprungen und hatte eine unerklärliche Glut in ihm entfacht. Jene Glut versengte ihn seit jenem Moment und versetzte ihn dadurch in einen Zustand unsäglicher Unruhe, der ihm nun arge Mühe bereitete, an Ort und Stelle zu verharren. Am liebsten würde er sofort weiterziehen und erst dann wieder zum Stillstand kommen, wenn er sein Ziel endgültig erreicht hatte.
Es fühlte sich an, als würde sich sein Geist in einem undurchdringlichen Nebel befinden – und seine Gedanken irrten wirr und formlos umher, ohne klare Gestalt anzunehmen. Nur in einer Richtung befand sich eine kleine Öffnung, zu welcher hin sich alles in ihm auszurichten schien. Es zog und zerrte den Blonden zu jenem Punkt hin, ja, als gäbe es keine andere Möglichkeit, außer dem inneren Streben nachzugeben und sich von diesem Sog mitreißen zu lassen …
Das Feld der Himmelsspeere … Der Berg des Ahiveth … Celine …
Es war vollkommen in Ordnung; so kam dem jungen Mann schließlich nichts in den Sinn, was ihn hätte ernsthaft davon abhalten sollen, sich diesem tosenden Strom hinzugeben und sich darin zu verlieren …
Sie wartete auf ihn, … wartete darauf, dass er sie dem sicheren Tod entriss, … ja, dass er sie diesen Wesen entriss, bevor sie geopfert wurde …! Nein, sie würde nicht sterben – und wenn er sich selbst dafür opfern musste. Er, Lewyn, würde erfahren, wer für all die Zwietracht zwischen den Menschen und Elfen verantwortlich war; und er würde mit eigenen Augen sehen und begreifen, warum sie es getan hatten …
Er würde Zeugnis ablegen vor den Menschen und vor den Elfen und vermeiden, dass weitere Opfer gebracht wurden – und vor allem verhindern, dass ein Krieg ausbrach. Er würde zum Berg des Ahiveth gehen und zurückkehren … mit Celine an seiner Seite. Er durfte nicht scheitern- … Nein, falsch: Er durfte das Scheitern nicht überleben.
***
Sacris fuhr mit seinen Fingern über die raue, verkohlte Oberfläche der Holzmühle und fühlte dabei, wie kleine Kohlebrocken ins hohe, taubedeckte Gras hinabrieselten. Er zog seine Hand zurück und betrachtete ihre Innenfläche im kühlen Mondlicht: Sie war schwarz verdreckt und staubig. Der dunkelhaarige Mann strich mit ihr durch das feuchte Gras und meinte, den Ruß daran abgewischt zu haben. Als er seine Hand wieder zum Vorschein brachte, merkte er jedoch, dass der Ruß lediglich verschmiert und gleichmäßiger verteilt worden war.
Sacris runzelte die Stirn in Unbehagen und ließ den Blick von seiner Hand zur niedergebrannten Ruine schweifen, … bevor er wieder zu Concurius schritt und gemeinsam mit ihm Hang aufwärts weiterging.
Hinter ihnen lag Hymaetica Aluvis und zu ihrer Rechten das endlose, dunkle Meer. Gemächlich liefen sie über die Wiesen der Steilhänge, welche zum Sandstrand des Ozeans überleiteten – bis sich am Horizont eine Baumsilhouette gegen das Gras und die weit dahinter liegende Bergwand abzeichnete.
Der Prinz begrüßte das sanfte, ihm so sehr vertraute Blätterrascheln des großen, alten Baumes mit traurigem Blick. Dieser hatte einen derart breiten Stamm, dass eine Hand voll Männer ihn nur schwerlich umfassen mochten. Dazu besaß er eine prächtige, ausladende Krone mit so vielen starken Ästen und feinsten Zweigen, dass selbst der Baum der Väter aus dem Palast vor Neid erblassen würde, wenn er diesen holzigen Bruder hier an den Küstenhängen je zu sehen bekäme.
Das Meer rauschte mit der weiten Wiese und den zahlreichen Blättern des alten Baumes im Akkord, während die Nacht weiter voranschritt. Mit einem schwermütigen Seufzen ließ sich der Prinz bei den stattlichen Wurzeln des Baumes nieder, lehnte sich an den knorrigen Stamm und lauschte mit einem nostalgischen Lächeln den Klängen des Windes …
"Meine Güte, was ziehst du denn für ein Gesicht …?", lachte Lewyn, während er seine Hände in die Seiten stemmte und sich zu seinem Freund hinabbeugte. Sacris, welcher vor ihm im Gras saß, blickte sichtlich schlecht gelaunt zu ihm auf und entgegnete in zynischem Tonfall: "Was soll ich deiner Meinung nach sonst tun? Etwa heiter rufen: 'Juhu, mein Vater liegt im Sterben – Lasst uns feiern'?!" Der Blonde schüttelte lächelnd den Kopf, setzte sich zu ihm an den großen Baum und legte den Kopf schief, während er zum Meer am Horizont blickte …
"Nein", meinte Lewyn nach einer Weile ruhig, "Aber würdest du ihm mit einem fröhlichen Gesicht die ihm noch hier auf Erden verbliebene Zeit nicht wesentlich verschönern, anstatt ihn mit einem Herz voll Trauer in die andere Welt zu entlassen?" Als sein Freund auf diese Worte hin nichts erwiderte und lediglich voll Verdruss vor sich hin starrte, fügte der Blonde mit einem aufmunternden Blinzeln hinzu: "Doch an deiner Stelle würde ich ihn gar nicht erst so schnell aufgeben. Ich denke nämlich, dass er sich erholt und schon bald wieder ganz der Alte ist", und er seufzte nachdenklich, lehnte sich etwas an seinen großen Gefährten und sandte den Blick zum fernen Meer hinaus, "Vertraue der Zeit, Sacris, einfach der Zeit …"
Da begann der Prinz in einem jähen Anflug aus unterdrücktem Zorn: "Ich soll der Zeit vertrauen?", und er schnaubte, "Die Zeit hat mir bereits meine Mutter genommen. Ich zweifle nicht daran, dass sie mir auch meinen Vater nehmen wird", und seine Finger bohrten sich in die Erde unter ihnen, "Die Zeit ist grausam, Lewyn."
Zuerst war Lewyn über die pessimistische Reaktion seines Freundes überrascht; doch legte er ihm schon nach kurzer Zeit eine Hand Mut gebend auf die verkrampften Finger. Stirnrunzelnd blickte Sacris von ihren Händen am Boden zu seinem Gefährten auf.
"Dann vertrau mir, Sacris", sprach der hellhaarige, junge Mann und lächelte ihn aufrichtig an. Aber sein Gegenüber schüttelte nur verwirrt den Kopf und entgegnete: "Woher willst du- " – "Intuition, Sacris, Intuition", fiel ihm der Blonde bestimmt ins Wort, "Er wird wieder gesund werden, vertrau mir."
Daraufhin sah ihn Lewyn mit einer solch erstaunlichen Ruhe an, dass der Prinz nichts zu erwidern wusste. Jene reinen, blauen Augen vermittelten in jeder einzelnen Nuance ihrer Schatten und Schimmer eine derartige Klarheit und Zuversicht, dass Sacris sprachlos dasaß und ihm nichts in den Sinn kam, womit er der Aussage seines Freundes hätte widersprechen können.
Da durchbrach Lewyn mit einem jähen Lachen die Stille zwischen ihnen, hakte sich bei seinem dunkelhaarigen Gefährten ein und schubste ihn von der Seite her verspielt an. "Oder hältst du mich etwa auch für grausam?"
Sacris schaute verdutzt zu seinem strahlenden Gefährten und wusste nicht, ob er über dessen Naivität lachen oder weinen sollte. Der Optimismus seines Freundes überraschte ihn immer wieder aufs Neue – doch er gab ihm Mut. Denn die Vergangenheit hatte gezeigt, dass auf seine Intuition erstaunlicherweise Verlass war.
Lewyns Charakter war durch und durch von empathischen und intuitiven Zügen geprägt. Er erfasste Hinweise in der Sprechweise, Gestik, Mimik, ja, im gesamten Auftreten seines Gegenübers, die ihm mehr über dessen Empfindungen und Gedanken verrieten als Sacris manchmal lieb war. Gleichzeitig wusste er, dass Lewyn diese sensible Art auch sehr verletzlich machte – selbst wenn sein Freund alles andere als schwach war … alles andere als schwach …
Der Prinz betrachtete den bereits dämmernden Himmel und blickte dann zu seiner Linken ins Gras hinab. Wie viele Jahre war es nun her, dass sein Vater zum ersten Mal derart erkrankt war? Zwei, … vielleicht drei Jahre? "Tz …!", er schüttelte den Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch sein dichtes, dunkelbraunes Haar, "Jetzt sieh dich doch einmal an …! Reiß dich zusammen, verdammt, das ist ja jämmerlich!" Sacris lachte trocken in seinen Ellbogen hinein und schloss die Augen in schmerzlicher Bitterkeit.
Plötzlich berührte ihn etwas Feuchtes am Handgelenk, dass der junge Mann aufschrak und bemerkte, wie Concurius ihn mit seinem Maul anstupste. Die großen, dunklen Augen des Rappen sahen traurig zu ihm hinab und die Nüstern blähten sich auf, als jener leise vor sich hin schnaubte und ihm dabei einige Haarsträhnen aufwirbelte. Der Prinz lächelte matt und tätschelte die große Nase seines Hengstes, bevor er aus dem Gras aufstand und tief Luft holte …
Noch war nichts verloren. Er durfte die Hoffnung nicht aufgeben – um Lewyns Willen.
***
In den darauffolgenden Tagen ritt Lewyn auf dem Handelsweg am Tical entlang weiter ins Landesinnere. Er passierte die Stadt Tyurin, überquerte die erste große Handelsbrücke, welche über eine Insel im Fluss zum südlichen Ufer führte, und setzte seinen Weg durch die Wälder an den weiten Wasserfeldern nach Rafalgar fort.
Während die Ufer des Tical zum Delta hin sehr ausladend und weit waren, wurden sie zur Quelle hin immer schmaler, gewundener und unbegehbarer. Gleichzeitig nahm die Bewaldung der abnehmenden Uferfläche zu – und die steilen Berghänge keilten den gesamten Flussverlauf zu beiden Seiten hin gnadenlos ein.
Der ruhige Tical wurde auf dem Weg zu seinem Ursprung seinerseits immer unbändiger, seine Strömungen rauer und seine Gewässer von spitzen Felsen und Geröll durchsetzt; so musste die meiste Handelsfracht zwischendurch auf kleinere Schiffe verlagert werden, damit sie überhaupt ihr Ziel erreichte. Kurz vor der Quelle bildete der Fluss schließlich einen großen See, an welchem die Grafenstadt Henx zwischen den zwei Bergrücken eingebettet lag, die auch den Tical zur Meeresmündung hinab begleiteten.
Zwischen Rafalgar und Henx lag noch eine kleinere Stadt namens Kanfar in einem besonders menschenarmen Abschnitt. Die Besiedlung nahm ins Landesinnere nämlich immer mehr ab – denn wo in der Nähe der Hauptstadt noch große Viehfarmen und Getreidefelder die Wege säumten, fand man später über Tage hinweg häufig nur noch vereinzelte Häuseransammlungen vor, in denen sich einige Familien in der Einsamkeit niedergelassen hatten.
Wie arm die Siedlungen aber auch sein mochten, so hatte jede von ihnen zumindest einen provisorischen Hafen, in welchem ein, zwei Boote vor Anker lagen; denn die großen Gewässer waren der Hauptverkehrsweg im gesamten Königreich. Die Landwege mochten in manchen Gegenden nach dem ein oder anderen Regenschauer unzugänglich geworden sein, doch der Tical und die Ozeane waren stets zuverlässig gewesen.
Am Ende des dritten Tages erreichte Lewyn einen Zulauf des Tical. Er stieg vom Pferd herab und füllte seine Trinkschläuche auf, während sich Lydia ihrerseits am kühlen Nass gütlich tat. Als der Blonde das Schild an der Weggabelung bemerkte, seufzte er. "Eksaph …" Wie sehr wünschte sich der junge Mann, dass er dem Flusslauf folgend in jener Siedlung auf Celine treffen würde – welche ihm fröhlich zulächelte und ihn verwundert fragte, warum er sich denn all solche Sorgen um sie gemacht hatte …
Als sie weiterritten, machte der Schimmel Anstalten, aus Gewohnheit in jene Richtung abzubiegen, doch Lewyn hielt ihn davon ab und lenkte ihrer beider Augenmerk wieder zurück auf die Berge am fernen Horizont. "Dorthin, meine Gute …", flüsterte er der schneeweißen Stute zu, "Dorthin führt uns heute unser Weg." Sie schnaubte verständnislos, gehorchte ihm jedoch. So überquerten sie den kleinen Flusslauf und ritten auf den entfernten Wald vor ihnen zu. Bevor sie ihn allerdings erreicht hatten, war die Sonne bereits untergegangen, sodass sie ihr Nachtlager kurz vor der Baumgrenze aufschlugen.
Lewyn war dieser Weg recht bekannt, da er als Knappe eines henxischen Kriegsveteranen nicht selten hatte zwischen der Grafenstadt und Hymaetica hin und her reiten müssen …
Thorn, der Tapfere, hatte ihn damals auf die Bitte seiner Eltern hin unter die Fittiche genommen. Es ergab sich nämlich, dass der Klingenmeister Thorn mitunter der königliche Schwertlehrer war und er selbst somit häufig die Gelegenheit gehabt hatte, etwas mit dem Kronprinzen zu unternehmen.
Lewyn war verhältnismäßig unbegabt im Umgang mit dem Schwert – der Langbogen lag ihm da schon wesentlich mehr; sehr zum Leidwesen seines Herrn und Meisters, der schnell feststellen musste, dass bei ihm wenige Unterrichtseinheiten im Bogenschießen wesentlich mehr Früchte trugen als das Zehnfache an Schwertübungseinheiten. Er war nicht sonderlich schlecht im Schwertkampf, das bei Leibe nicht!, aber neben dem hochtalentierten Prinzen einfach … nicht weiter erwähnenswert.
Henx bildete hervorragende Krieger aus, keine durchschnittlichen Kämpfer. 'Merke dir eines, mein Junge', hatte Thorn ihm stets gesagt, ''Gut' ist niemals gut genug, 'sehr gut' vielleicht noch akzeptabel, doch 'herausragend' erst das, was wir einen wirklichen 'Krieger' nennen.'
Gedankenverloren strich der Blonde über das glatte, dunkle Holz seines Langbogens vor sich und holte aus einer Gürteltasche ein Stück Wachs hervor. Mit großer Sorgfalt begann er, die Sehne damit einzureiben und zu pflegen. Der Köcher mit den Pfeilen lag gleich neben ihm auf dem Boden bei seinem Schwert.
Lydia rupfte an den Wiesengräsern und kaute munter vor sich hin, während die Vögel einer nach dem anderen verstummten und die dunkle Nacht hereinbrach. Der junge Mann ließ den Tag ruhig ausklingen: Im behaglichen Schein des Lagerfeuers überprüfte er seine Rüstung und anschließend auch seine Schwert- sowie Dolchklinge. Er würde diese in den nächsten Tagen wieder schärfen müssen, aber das hatte Zeit.
Gerade als Lewyn die Waffen wieder in ihre Halterungen zurückgetan hatte, fiel ihm die unnatürliche Stille auf, die sich um sie gelegt hatte. Seine Stute hatte aufgehört zu grasen und streckte den Kopf lauschend in die Höhe, während ihre Ohren in unterschiedliche Richtungen zuckten. Da ließ der Blonde seine Hand langsam zum Bogen wandern und legte ganz beiläufig einen Pfeil auf. Er blieb ruhig, schloss seine Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche in seiner Umgebung …
Das leise Knistern des Lagerfeuers dicht neben ihm … Das sanfte Rauschen der Baumkronen weiter hinter ihm … Das weitläufige Rascheln des vom Wind durchkämmten Grasmeeres um ihn herum … – Das Knacken eines durchbrochenen Zweiges von schräg hinter ihm.
Augenblicklich schnellte Lewyn herum und schoss den Pfeil in diese Richtung ab. Ein Schrei erklang aus dem hohen Gras. Sofort ertönte ein Rascheln aus einer völlig anderen Richtung – gefolgt von einem leisen Surren, dessen Ursache seine Schulter nur knapp verfehlte. Lydia wieherte auf und galoppierte davon. Der Blonde hingegen ließ sich kontrolliert zu Boden fallen, bevor er von der Feuerstelle weg ins Gras rollte und auf dem Weg zwei weitere Pfeile aus dem Köcher am Boden zog. Ein erneutes Surren hörte direkt in der Erde neben ihm auf, wo er eben noch sein Bein gehabt hatte.
Während Lewyn in Windeseile einen weiteren Pfeil auflegte, bemerkte er, dass er soeben einem Bolzen ausgewichen war: schlecht gearbeitet, keine Soldaten, vermutlich Wegelagerer. Er schoss seinen Pfeil dem akustischen Ursprung des Fremdgeschosses entgegen und suchte geduckt durch das Gras huschend nach demjenigen, den er vorhin getroffen hatte. Der junge Mann fand ihn sehr schnell; denn dort, wo jener lag, waren die Halme umgeknickt. Mit einem Satz war er bei ihm, zog den Dolch, hielt ihn dem Fremden an die Kehle und rief: "Komm raus! Zeig dich und ich verschone das Leben deines Gefährten!"
In der Zeit, da Lewyn die Gestalt vor sich fest im Griff hielt und im schattigen Schutz des Grases auf eine Reaktion wartete, bemerkte er, dass sich sein Pfeil tief in den Oberschenkel des Angreifers gebohrt hatte. Keuchend hielt sich jener sein blutendes Bein und schien noch unter Schock zu stehen. Der Fremde trug eine viel zu große und schon sehr abgenutzte Lederrüstung und machte auch ansonsten einen eher zerschlissenen Eindruck …
Nach einem kurzen Moment der Stille trat jemand vom Waldrand her in den Schein des Lagerfeuers – die Hände mit einer Armbrust in die Höhe gestreckt. So erhob sich auch der Blonde langsam mit seinem Opfer und zog es mit sich zum Lager zurück. Die Person in seiner Gewalt war nicht sonderlich schwer und auch mehr als zwei Köpfe kleiner als er. Ein Kind …?
Am Feuer angekommen bedeutete Lewyn seinem Gegenüber mit einem knappen Nicken, die Armbrust abzulegen – geräuschvoll landete die Waffe im Gras. Nachdem der junge Mann dem Angreifer in seinem Griff das Kurzschwert abgenommen hatte, schubste er ihn seinem Komplizen entgegen und schwang die soeben erworbene Klinge sofort in ihre Richtung. "Was wollt ihr hier, Streuner?"
Die unverletzte Person fing die andere auf und wich einen Schritt vor dem Blonden zurück. Sie trug einen dunklen Kapuzenumhang, aber ansonsten nicht weniger abgetragene Kleidung als ihr kleinerer Gefährte. Sie nahm ihre Kapuze ab und gab somit den Blick auf ihr halbkurzes, wild zerzaustes Haar und ihr ungepflegtes Gesicht preis, welches allerdings eindeutig einer jungen Frau gehörte. Die Fremde stierte ihn nun böse an und rief: "Wie kannste's wagen, mein' Bruder zu verletz'n!?"
Lewyn keuchte fassungslos auf und traute seinen eigenen Ohren nicht. Er besah sich flüchtig die beiden Bolzen am Boden, ehe er mit hochgehobenen Augenbrauen zu der Fremden sprach: "Du beliebst zu scherzen, wenn du meinst, dich zur nächtlichen Stunde in mein Lager schleichen zu müssen, mich fast tödlich zu treffen, um mir dann vorzuwerfen, mich verteidigt zu haben!"
Der Blonde hielt das Kurzschwert weiter auf sie gerichtet und wartete auf eine Erklärung. Der halbwüchsige Junge sackte zusammen, dass die Frau in die Knie ging, um seinen Sturz abzufangen. Sie legte ihn vor sich ins Gras und funkelte den langhaarigen Mann stinksauer an: "Ihr Großstädter habt doch eh' nichts and'res als 'n Tod verdient! – Und jetz' hilf endlich meinem Bruder, sonst stirbt er!"
Lewyn konnte nicht anders als trocken aufzulachen. "Was für ein freches Biest bist du eigentlich?!", erwiderte er und schüttelte ungläubig den Kopf, "Ich war nicht derjenige, der euch hier angefallen hat! Hilf ihm doch selbst, denn es scheint ja nicht das erste Mal zu sein, dass ihr arglose Reisende überfallt!" Damit ließ der junge Mann das Schwert sinken und murmelte abschließend: "… Und deine Treffsicherheit wird auch nicht von ungefähr kommen."
Der Blonde ging hinüber zur Armbrust, hob sie auf und legte das schartige Kurzschwert des Jungen zusammen mit seinem eigenen Bogen zum Köcher auf die Erde zurück. Dann setzte er sich hin und betrachtete die Armbrust: einfache Bauweise, nichts für lange Distanzen. Ein Wunder, dass sie ihn damit fast zwei Mal getroffen hatte.
Als Lewyn zu der Fremden hinübersah, bemerkte er allerdings, dass sie ihn immer noch hasserfüllt anstarrte. "Und? Was erwartest du nun von mir?", meinte er und lachte sarkastisch, "Dass ich mich vielleicht noch dafür entschuldige, deinen Bolzen ausgewichen zu sein …?!" Der langhaarige Mann zog die beiden Geschosse in seiner Umgebung aus der Erde und hielt sie kopfschüttelnd der jungen Frau hin, bevor er diese zusammen mit der Armbrust zum Kurzschwert legte und seinen Kopf schüttelte. "Törichtes Kind."
Das Mädchen hatte aber noch immer nichts Besseres zu tun als ihn vorwurfsvoll anzustarren; sodass der Blonde aufseufzte, in seine Tasche griff, eine kleine Verbandsrolle herauszog und sie der Fremden zuwarf. Diese fing die Rolle zwar auf und schaute kurz darauf hinab, richtete ihren Blick dann jedoch gleich danach wieder unbeirrt auf den jungen Mann wenige Schritte entfernt.
Lewyn sah sie stirnrunzelnd an. "Nein, ich glaube dir jetzt nicht, dass du nicht weißt, wie man einen Pfeil entfernt. Ihr führt nicht erst seit gestern dieses Leben und seid mit Sicherheit nicht immer ohne Verletzungen davongekommen." Der Blonde holte seinen Trinkschlauch hervor und nahm daraus einen großen Schluck, wobei er den Jungen aus den Augenwinkeln näher betrachtete … Jener hielt sich weiterhin sein blutendes Bein und weinte mittlerweile leise vor sich hin – Verdammt nochmal aber auch, warum musste er so ein ausgeprägtes Gewissen haben?!
Der junge Mann schloss den Schlauch wieder und begann, nach etwas in seiner Tasche zu suchen. "Wie heißt du, Fremde?", raunte er, während er ein kleines Fläschchen hervorholte und wieder in seiner Tasche herumwühlte. Sie aber schwieg nur und starrte ihn weiterhin an. "Dein Name?!", Lewyn wandte sich ihr mit genervtem Blick zu, der eindeutig sagte: 'Entweder du kooperierst oder dein Bruder verblutet.'
In höchster Missbilligung verengte das heranwachsende Mädchen die Augen zu Schlitzen – wovon sich ihr langhaariges Gegenüber herzlich wenig beeindrucken ließ – dann gab sie plötzlich einen zischenden Laut von sich und wandte beleidigt ihren Kopf ab. Lewyn wartete noch einen Moment, ob sie etwas sagen würde, bevor er die Tinktur wieder zurücklegen und die streunenden Jugendlichen einfach ignorieren würde …
"Sheena", murmelte die Fremde schließlich leise und undeutlich. "'Schna'?", wiederholte der junge Mann gelassen; mehr war bei ihm nicht angekommen. "Sheeeenaaa", sie überbetonte ihren Namen, damit er ihn richtig verstand. "Geht doch." Lewyn kam nicht umhin, unmerklich zu schmunzeln, während er zwei Tücher, den Wasserschlauch, ein anderes Fläschchen und die Tinktur nahm, aufstand und zu den beiden hinüberschritt. Die junge Frau wich auf seine Annäherung hin instinktiv zurück, während sie ihren Bruder schützend in den Armen hielt. Lewyn ignorierte diese Abwehrhaltung einfach und tat, was getan werden musste.
Er hatte ungern Menschenleben auf dem Gewissen. Für gewöhnlich begegneten ihm so weit im Landesinneren allerdings nun mal eher weniger gut gesinnte Menschen als vielmehr Banditen und Räuber. Wilde Raubtiere gab es hier in dem Landstrich noch nicht wirklich und Pflanzenfresser schlichen sich nicht derart verstohlen an. Doch es war zum ersten Mal, dass ihn solche Jungspunde – und das auch noch in so kleiner Anzahl – angefallen hatten.
"Wie heißt dein Bruder, Sheena?", wollte Lewyn wissen, "Und was machen Kinder wie ihr allein hier draußen? Wo sind eure Eltern?" Der hellhaarige Mann hielt das Mädchen beschäftigt, während er ihr den vorhin zugeworfenen Verband abnahm, den Puls des Jungen überprüfte und seine Stirn abtastete, um herauszufinden, ob jener Fieber hatte. Nachdem er sichergegangen war, dass der Puls stabil und noch keine Entzündung aufgetreten war, begann Lewyn damit, sich die Pfeileintrittsstelle näher anzusehen. Dazu zückte er seinen Dolch und schnitt die Hose des Jungen am Oberschenkel weit genug auf, dass er die Wunde ungehindert behandeln konnte. Es war ein sauberer Schuss gewesen, deswegen war das Fleisch nicht verrissen. Der Bruder des Mädchens konnte dankbar sein, dass er nur mit Jagdpfeilen geschossen hatte, sonst wäre das Ganze äußerst hässlich geworden.
Sheena beobachtete seine Handlungen mit sehr besorgtem und gleichzeitig gequältem Blick. Es schien ihr ganz und gar nicht zu gefallen, auf die Hilfe dieses 'Großstädters' angewiesen zu sein. "Kayne …", meinte sie dann zögernd, "Er is' mein klein'rer Bruder. Wir wohnt'n bis vor Kurzem noch in 'ner Hütte hier im Wald mit uns'rem Vater. Aber …", ihre Stimme wurde plötzlich finster, "… der is' verschleppt word'n … schon vor viel'n Woch'n – keine Ahnung von wem oder was. War'n keine Spuren oder so zu seh'n." Der Blonde sah stirnrunzelnd auf, während Sheena immer aufgebrachter wurde. "Einfach weg! Alles steh'n un' lieg'n gelass'n! Die Leute sag'n alle, 's war'n diese Wölfe, aber ich glaub' den' nich'! Un', un' mein Bruder erst recht nich'!" Ihr Tonfall war zum Ende hin immer bissiger und schmerzerfüllter geworden und sie betrachtete das verletzte Bein ihres Bruders beklommener denn je …
"Verschleppt?", hakte Lewyn ernst nach, "Ohne jede Spur?" – "Ja, Mann, sagt' ich doch grad'!", warf das Mädchen zurück, "Und jetz' sind wa hier allein un' wiss'n nich', was wa jetz' mach'n soll'n." Der Blonde nickte nachdenklich und wandte sich wieder der Verletzung des Jungen zu. Er begann allmählich zu verstehen, wie es zu alldem hier gekommen war. "Deswegen habt ihr also angefangen, Leute zu überfallen", murmelte er, "um euch selbst am Leben zu erhalten …"
Das Mädchen zuckte hilflos mit den Schultern und erwiderte: "Ja, was sollt'n wa denn bitte sonst tun? Diese ganz'n Stadtleute in Rafalgar, die hab'n uns schnurstracks rausgeschmiss'n und gesagt, wir soll'n wo anders hin!", und sie verstellte ihre Stimme zu einem abfälligen Keifen, "'Für Bettler un' Streuner kein' Platz' un' so! Halt'n sich eben für was Bess'res, diese elenden Stadtleute, pah!" Der junge Mann blickte ungläubig auf. Er wusste ja, dass die Menschen in Rafalgar sehr stolz sein konnten, aber verwaiste Kinder abzulehnen …! – Lewyn schüttelte seinen Kopf und arbeitete weiter. "Ihr hättet nach Hymaetica kommen sollen", meinte er gefasst, "Es gibt dort sogar eine spezielle Einrichtung für Kinder wie euch, die mittellos von ihren Eltern zurückgelassen worden sind."
Sheena sah ihn auf einmal mit großen, überraschten Augen an. "Wirklich?!" Dann zügelte sie sich aber schnell wieder und setzte erneut ihren misstrauischen Gesichtsausdruck auf. "Warum sollt'n die sich um solche wie uns kümmern …? Alles gelog'n-!" – "Warum sollte ich dich anlügen?" Der Blonde hatte die Wunduntersuchung abermals unterbrochen und schaute sein weibliches Gegenüber nun ruhig schweigend an …
Je länger sich Lewyn mit den beiden Jugendlichen befasste, desto jünger kamen sie ihm vor: Das Mädchen zum Beispiel, welches er noch vor Kurzem fast für eine ausgewachsene Frau gehalten hatte, machte auf ihn mittlerweile den Eindruck, als hatte sie nicht mehr als vierzehn, … vielleicht fünfzehn Winter erlebt.
Sheenas dunkelgrüne Augen begannen zu flackern, als sie der junge Mann so aus der Nähe musterte; und auf ihren Wangen zeichnete sich ein Hauch von Röte ab. "Weil … w-weil …", stammelte sie jäh verunsichert und musste sich zusammenreißen, "… weil ihr uns're Väter un' Mütter verschleppt habt!!!"
Lewyn wich unter der Wucht ihrer Worte zurück. Mit so einer Anschuldigung hatte er nun wirklich nicht gerechnet. Es folgte ein höchst angespannter Moment der Stille, … bevor der Blonde in berstendes Gelächter ausbrach und damit einige Vögel in den nähergelegenen Bäumen aufscheuchte.
"Und was genau", setzte der Lewyn schließlich äußerst vergnügt an, nachdem er sich wieder gefangen hatte, "sollten 'wir elenden Stadtleute' mit euren Eltern tun, nachdem wir sie verschleppt haben?" Sheena war sichtlich erbost darüber, dass sie von ihrem Gegenüber nicht ernst genommen wurde. Aber jener lachte nur: "Sie vielleicht als Sklaven in unseren Häusern halten, damit sie für uns kochen und putzen?!" Der Blonde sah sie unter erneutem Kopfschütteln an und tätschelte grinsend ihren zerzausten Kopf. Das Mädchen duckte sich daraufhin weg und fauchte ihn an, wobei sie seine Hand abschüttelte.
Doch dann ließ Lewyn von ihr ab und richtete seinen Blick wieder auf die Wunde vor ihm … Sein Lächeln war verschwunden. "Weißt du eigentlich, dass auch aus den großen Städten nicht wenige Menschen verschwinden?" Und wesentlich leiser und ernster fügte er dann an: "Vor wenigen Tagen hat es meine beste Freundin erwischt." Der junge Mann wartete nicht auf eine Antwort, sondern legte das große Tuch vorsichtig um die Pfeileintrittsstelle, bevor er das Fläschchen öffnete und eine klare Flüssigkeit über die Wunde goss. Kayne schrie prompt auf und krümmte sich, sodass Lewyn ihn wieder zur Erde hinab drücken und seiner Schwester bedeuten musste, ihn festzuhalten. Dann umfasste er den Pfeil so nah am Ansatz wie möglich und zog ihn vorsichtig und routiniert aus dem Bein des Jungen heraus – welcher daraufhin abermals aufschrie.
Sheena stand unter sichtlicher Anspannung und zuckte bei jedem Schrei zusammen, während sie die Handgriffe des langhaarigen Mannes mit gebanntem Blick verfolgte. Sofort nachdem der Pfeil entfernt worden war, presste Lewyn das große Tuch auf die nun noch stärker blutende Wunde und wies das Mädchen an, das Andrücken für ihn zu übernehmen. Der Blonde nahm etwas von der Tinktur und tränkte damit ein zusammengefaltetes, kleineres Tuch. Danach ersetzte er den großen, blutgetränkten Stofflappen durch das nasse Tuch und schickte sich dann an, das Bein zu verbinden.
Kayne wimmerte vor sich hin und hatte die Augen schmerzerfüllt zusammengekniffen, war aber offenbar noch immer zu schockiert, um die Situation wirklich zu begreifen. Nachdem Lewyn die Wundbehandlung abgeschlossen hatte, fasste er ihm wieder prüfend an die nunmehr schweißgebadete Stirn und redete ihm in beruhigendem Tonfall zu: "Schhh, ganz ruhig, gleich sollte der Schmerz nachlassen. Ruhe dich aus." Er stand mit den eben verwendeten Gegenständen auf, legte die Tinktur in die Tasche zurück und sprach, ohne sich Sheena zuzuwenden: "In deiner Nähe sollte eine Decke liegen. Nimm sie und leg sie über deinen Bruder, damit er nicht auskühlt."
Anschließend entfernte sich Lewyn vom Lagerfeuer, nahm den blutigen Stofflappen sowie den Pfeil und wusch sie zusammen mit seinen Händen unter Zuhilfenahme der klaren Flüssigkeit und seinem Wasserschlauch über der Wiese aus. Am Ende breitete er den Lappen in der Nähe des Feuers zum Trocknen aus und legte den Pfeil zurück in seinen Köcher.
Doch der junge Mann blieb nicht bei den Kindern, sondern hielt nun Ausschau nach Lydia. Als er sie nirgends auffinden konnte, pfiff er laut mit seinen Fingern in die Nacht hinaus. Kurz darauf wehte der Wind ein leises Wiehern zu ihm herüber – und schon wenig später zeichnete sich bereits die Silhouette eines schlanken Pferdes gegen den Sternenhimmel ab.
Lewyn kam Lydia entgegen und tätschelte behutsam ihre Nase, bevor er sich zu ihr vorbeugte und besänftigend zuredete: "Na, hast dich ganz schön erschreckt, was, meine Gute …?" Die Stute wieherte zutraulich auf und trabte kurz auf der Stelle, bevor sie wieder ruhig wurde. Der junge Mann lachte leise, ehe er eine Hand an ihre Seite legte und sie vom Lagerfeuer fort führte.
Nach einer Weile blieben sie an einem weich abfallenden Wiesenhang stehen, der einen weiten Ausblick in die Ferne zurück Richtung Westen bot. Schwer seufzend setzte sich der Blonde auf die Erde und stützte die Hände hinter seinem Rücken ab, um zu den hellen Sternen über ihnen hinaufzublicken. Sie waren wunderschön … Auch der Schimmel ließ sich nun gemächlich neben ihm im Gras nieder und schnaubte müde vor sich hin, während sein Schweif ab und zu aufpeitschte. Lewyn fuhr mit seinen Fingern durch die weiße Mähne der Stute, lächelte und lehnte sich dann seitlich an sie an. "Ach, Lydia, wenn ich dich nicht hätte …" Er seufzte erneut und schaute wieder zum klaren Nachthimmel auf …
"Wie war sie …?", ertönte es plötzlich kleinlaut hinter ihnen. Der junge Mann wandte seinen Kopf zur Seite und sah, dass das fremde Mädchen einige Schritte von ihm entfernt im Gras stand und ihre Hände knetete. Sie fühlte sich offensichtlich unwohl … Lewyn hob eine Augenbraue, legte die Stirn in Falten und blickte wieder zum Himmel hoch. Dann erwiderte er nachdenklich: "Celine gehört zu den gutmütigsten Menschen, die mir je begegnet sind …" Er vernahm ein leises Rascheln, bevor er merkte, wie sich Sheena neben ihn ins Gras setzte.
Als der Blonde aber nichts weiter von sich gab, begann das Mädchen, ihn zum ersten Mal genauer zu betrachten: seine langen Wimpern, seine schmale Nase, seine geschwungenen Lippen, sein rundes Kinn … Die kurzen Strähnen seiner hellen Haare umspielten sein schlichtweg schönes Gesicht im Wind, während die längeren Strähnen nur vereinzelt träge hin und her flatterten. Sheena fand allerdings, dass die Augen des jungen Mannes – sofern sie nicht gerade von fliegenden Haaren verdeckt wurden – irgendwie furchtbar einsam in die Ferne gerichtet waren …
"Sie bedeutete dir sehr viel, nich' wahr?", wagte das Mädchen zaghaft die Stille zu durchbrechen. "Hör bitte auf, von ihr zu sprechen, als sei sie schon tot!", zischte Lewyn plötzlich und warf ihr einen harschen Blick zu, ehe er sich wieder abwandte. Sheena zuckte betroffen zusammen und traute sich, kein Wort mehr zu sagen.
Nach einer längeren Zeit unangenehmen Schweigens wollte sich die junge Frau gerade wieder erheben, als der Blonde völlig unvermittelt in wesentlich sanfterem Tonfall zu erzählen begann: "Sie ist immer wie eine Schwester für mich gewesen … Meine Eltern haben Celine nach dem Tod ihrer Mutter bei uns aufgenommen – auch wenn sie darauf bestanden hat, das Handwerk ihrer Mutter fortzusetzen und auf eigenen Beinen zu stehen …", der junge Mann atmete wehmütig aus und fuhr sich durch die offenen Haare, "Sie will stets den Menschen helfen, wie es ihre Mutter ihr Leben lang getan hat. Die Menschen in ihrer Siedlung lieben sie dafür. Sie hat die Kranken geheilt und den Schwachen geholfen, ganz ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Standes – einfach nur geholfen, wo sie konnte …"
Sheena hatte sich wieder gesetzt und lauschte seinen Worten still angespannt. "Sie ist stark und hat so viel von ihrer Kraft an ihre Mitmenschen abgegeben, dass ich sie einige Male habe davon abhalten müssen, sich ganz in ihrer Arbeit und Hingabe zu verzehren!", Lewyn schüttelte niedergeschlagen den Kopf, "Eine sehr ungesunde Leidenschaft …" Er lachte kurz auf und ergänzte traurig: "Frech und eigensinnig ist sie aber wie keine andere …! Und so lebendig und aufgeweckt, doch gleichzeitig sanftmütig und einfach … einfach herzensgut …"
Dann verschwand das Lächeln des jungen Mannes jedoch und er senkte sein Haupt, dass die Haare gänzlich seine Augen verdeckten. "Und ausgerechnet sie …!", meinte er kaum hörbar, "Das hat sie nicht verdient …! Niemand hat es so wenig verdient wie sie – so selbstlos, wie sie ihr Leben geführt hat …!" Lewyn ballte seine Hand zur Faust. "Ich bereue es, dass ich in letzter Zeit so selten bei ihr gewesen bin, … mich kaum noch um sie gekümmert habe, auch wenn sie schon längst selbstständig genug ist, dass sie mich ohnehin nicht mehr braucht …!"
Der junge Mann wandte seinen Kopf ein wenig in Sheenas Richtung, jedoch nicht weit genug, als dass sie seine Augen hätte sehen können. Dabei öffnete er seine Faust und hielt sie vor sich. "Als mein Vater auf dem Sterbebett lag, hat er meine Hand erfasst und gesagt: 'Nun liegt es an dir, dich um sie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass ihr nichts passiert – Mein Sohn, beschütze sie, denn sie ist unser größter Schatz. Beschütze sie, was es auch kosten mag. Beschütze sie, … denn ohne sie … sind wir …'"
Lewyns Stimme war zum Schluss hin immer leiser und schwächer geworden. Er stützte die Stirn auf seinem Unterarm ab, sog die kühle Luft der Nacht ein und sprach nun etwas bestimmter: "Er hat den Satz nie zu Ende gebracht. Und ich habe das Gefühl, die vollständige Bedeutung seiner Worte bis heute nicht verstanden zu haben …"
Als der Blonde jedoch versuchte, genauer darüber nachzudenken, begannen seine Gedanken plötzlich wirbelartig um seinen Geist herumzuschwirren; und er erkannte das beunruhigende Gefühl wieder, sich in einem starken Sog zu befinden, dem er nicht entfliehen konnte …
Das Gesicht seines Vaters erschien, während jener ihm die letzten Worte nochmals mitteilte … Celines unbeschwertes Lachen in der Ferne … Das eigenartige Gefühl, als seine Hand die Finger jenes Jungen berührte … Sacris' verzweifeltes Gesicht, während er auf ihn einredete, um ihn von seiner Reise abzuhalten! – Der geheimnisvolle Ausdruck in den Augen jenes Jungen – Sacris, wie er mit wehendem Mantel in der Menge verschwand …
Stille um ihn herum. Leises Kribbeln. Da war mehr. Er wusste es.
Lewyn schrak auf, als ihn etwas heftig an der Schulter schüttelte. Als er die Augen öffnete, begegnete ihm das besorgte Gesicht eines zerzausten Wildschopfes. "Shee…na …", murmelte er und blinzelte einige Male. Lydia lag nicht mehr auf dem Boden, sondern trabte unruhig auf der Stelle. Er saß seltsamerweise auch nicht mehr, sondern befand sich rücklings im Gras. Seine Hände zitterten.
Der Blonde schüttelte heftig den Kopf, atmete einmal tief durch und stand auf. "Was … w-was war das gerade …?", hörte er das Mädchen unsicher fragen. "Was war 'was'?", entgegnete Lewyn abgewandt und versuchte, sich von seiner Aufgewühltheit nichts anmerken zu lassen. "Na … n-na, das eben …! D-du hast geredet un' dann warste auf einmal ganz still, un' ... un' dann haste dich gekrümmt und mehrmals gezuckt wie wild u-un' bist dann einfach nach hinten umgekippt u-un' ich weiß nich'!"
Lewyn warf ihr einen flüchtigen Blick zu, ehe er sich zu der Stute wandte und ihr betont langsam über den Rücken strich. "Ich weiß nicht, was mit mir geschieht …", sprach er dann leise. Das Mädchen trat vorsichtig näher. "B-bist du krank oder so? Es … 's gibt bestimmt irgendwas, um das z-" Doch der junge Mann wandte sich jäh um und unterbrach sie mit erhobener Hand und festem Blick. "Gute Nacht, Sheena. Unser Gespräch ist hier beendet. Ruhe dich aus, denn morgen werden du und dein Bruder zur Hauptstadt der Menschen aufbrechen." Lewyn ließ seine Hand wieder sinken und stieg auf sein Pferd auf. Er klopfte Lydia auf den Hals und machte Anstalten, loszureiten.
Das Mädchen stand mit geöffnetem Mund vor ihnen und wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Aber gerade, als der junge Mann seiner Stute einen leichten Druck mit den Fersen versetzt hatte, rief sie ihm zu: "Wie … w-wie heißt du überhaupt?" Das Pferd kam wenige Schritte von ihr entfernt wieder zum Stehen, während sich der Umriss ihres Reiters dunkel gegen den Mond abzeichnete. "Lewyn", meinte er nur knapp und ritt von dannen.
Der Geruch von gebratenem Fleisch ließ Sheena mehrmals verwundert schnuppern, bevor sie – noch ein wenig verschlafen – ihre Augen öffnete … Leicht geblendet von der Morgensonne erblickte sie die Gestalt eines jungen Mannes, welcher gerade mehrere Fleischstücke über einem Lagerfeuer röstete. Wer um alles in der- … Aber dann erinnerte sie sich wieder an alles und saß auf einmal kerzengerade auf ihrer Decke. Moment, Decke? Sie hatte beim Einschlafen keine gehabt, woher denn auch …?! Ein wenig verlegen räusperte sich das Mädchen und suchte nach Worten.
Lewyn bemerkte, dass sie wach geworden war, und wandte sich gelassen zu ihr um. "Guten Morgen." Sheena, welche ihn zum ersten Mal bei Tageslicht erblickte, war sprachlos. Ihr Mund war zwar zum Sprechen geöffnet, doch kam wie in der Nacht zuvor kein Laut über ihre Lippen. Er war … schön. Sie war fasziniert von diesen kristallblauen Augen und ihrem so tief gehenden Ausdruck …! Und … und diese Haare erst …! Wie flüssiges Gold tanzten sie im Sonnenlicht und schienen so weich wie Samt …
"Stimmt etwas nicht?", riss sie der junge Mann aus den Gedanken. "I-ich …", Sheena zupfte unbewusst an ihren eigenen, verfilzten Strähnen und merkte, wie sie rot wurde. Plötzlich wehte allerdings ein besonders deftiger Fleischduft zu ihr herüber und ein unmissverständliches Knurren durchbrach die peinliche Stille, "… ich h-hab' Hunger, hehe." Sie lachte verlegen und kratzte sich am Hinterkopf, während ihr Gegenüber ein leichtes Schmunzeln sehen ließ.
Lewyn drehte sich wieder zum Feuer hin, nahm eines der drei Stöcke aus dem Boden, auf denen das Fleisch aufgespießt worden war, und hielt es ihr mit einem höchst amüsierten Grinsen hin. "Hier, iss", meinte er vergnügt, "Bevor dein Bruder noch durch die Hungerschreie deines Magens aufwacht …" Sheena plusterte sich in Empörung auf, nahm den Stock dann aber still entgegen und begann, davon zu essen.
Der Blonde indes stand auf, ging zum Waldrand und holte eine Hand voll mittelkleiner Äste, die er anschließend neben sich ins Gras fallen ließ, um sie einzeln nach und nach ins Feuer zu geben. "Wo hast du eigentlich so gut Schießen gelernt?", fragte er auf einmal mit einem Kopfnicken zur Armbrust in ihrer Nähe. Das Mädchen verschluckte sich beinahe, als sie das implizierte Kompliment vernahm, fing sich aber, kaute zu Ende und antwortete: "Naja … Mein Vater is' immer mit mir jag'n gegang'n. Nur irgendwie find' ich hier, seit er weg is', kaum noch wilde Tiere zum Erleg'n …!" Ihr Blick fiel dabei auf das angebissene Stück Fleisch in ihren Händen … und sie verstummte. Offensichtlich hatte ihr Gegenüber keine Probleme diesbezüglich gehabt. Sheena seufzte resigniert, ließ ihre Schultern hängen und fügte hinzu: "Vielleicht mach' ich auch einfach was falsch …"
Da musste Lewyn lachen. "Das passt nun überhaupt nicht zu dir: Eine Wildkatze wie du würde doch niemals so leicht aufgeben!", und er blinzelte ihr zuversichtlich zu, "Du hast noch viel Zeit. Irgendwann bekommst du den Dreh sicher raus."
Das Mädchen bemerkte fasziniert, dass der junge Mann tatsächlich in der Lage war, sogar von innen heraus zu strahlen. Sie war vom Ausmaß seiner Ausdrucksfähigkeit einfach überwältigt. Bis auf Kayne und ihren Vater war Sheena ansonsten nur Menschen begegnet, die sie eiskalt abgewiesen und fortgeschickt hatten. Und hier saß sie auf einmal zusammen mit ihrem Bruder und diesem Menschen – den sie noch vor wenigen Stunden hatte mehr tot als lebendig sehen wollen! – und aß das Essen, welches ebendieser Fremde ihr gegeben hatte. "D-danke …", stammelte die junge Frau plötzlich. Es war für sie so ungewohnt, dieses Wort zu sagen …! Und ihr erwachsenes Gegenüber antwortete lediglich mit einem stillen Lächeln, welches sofort einen weiteren Hauch von Röte in ihr mädchenhaftes Gesicht zauberte.
Anschließend stand Lewyn auf und ging zu Kayne hinüber. Er überprüfte seine körperliche Verfassung und den Zustand seiner Wunde: Der Junge hatte leichtes Fieber, befand sich aber ansonsten in einem stabilen Zustand. Die Wundheilung war ebenfalls vorangeschritten, die Blutung zumindest gestillt. Der Blonde rief das Mädchen zu sich, damit sie lernte, einen Verband zu wechseln. Sie folgte seinem Ruf und saß im Handumdrehen neben ihm im Gras. Der junge Mann verwendete erneut etwas von der Tinktur zur Schmerzlinderung sowie Entzündungshemmung der Schusswunde und wies Sheena Schritt für Schritt an, ihrem Bruder zu helfen; schließlich würde sie ihn die nächsten Tage alleine weiterpflegen müssen.
Während sie den Jungen verarzteten, wachte jener auf und gab einen zischenden Laut von sich. "Au, tut das weh …" Kayne hielt sich die Hand vor Augen, da ihn die Sonne blendete und er nichts um sich herum erkennen konnte. "Bruder …!", hörte er seine Schwester neben sich rufen. Als ihm seine Lage allmählich zu dämmern begann, schreckte Kayne nicht minder überrascht wie Sheena zuvor hoch – oder … versuchte es zumindest. In der Hälfte seiner Bewegung schrie er jedoch schmerzerfüllt auf und wurde sofort mit sanfter Gewalt zurück in die Decke gedrückt.
"Bleib ruhig liegen, dir wird nichts mehr passieren", sprach Lewyn besänftigend. "Mein Bein … m-mein Bein tut so weh …!", ächzte der Junge und griff nach seinem Oberschenkel. Als er den Verband sah, erschrak er und sah mit ängstlich aufgerissenen Augen zu Sheena. "Keine Sorge, Kay, du wirst im Nu wieder gesund werd'n un' bald wieder putzmunter sein!" Seine Schwester lächelte ihm aufmunternd zu.
Der Blonde vergewisserte sich, dass der Verband richtig saß, und holte dem Verletzen etwas zu trinken. 'Im Nu gesund werden', ts …! Und er schüttelte den Kopf. Es würde zahlreiche Wochen, gar Monate dauern, bis der Junge wieder halbwegs laufen konnte. Doch es war richtig von dem Mädchen, ihrem Bruder Mut zu machen.
Lewyn selbst machte sich allerdings Vorwürfe, in der letzten Nacht so schnell gehandelt zu haben. Doch in jedem ernsten Überfall wäre ein Zögern seinerseits tödlich gewesen. Nun gut, es war auch ein ernster Überfall gewesen; das Mädel hätte ihn schließlich beinahe erschossen. Der junge Mann sah zu den Kindern hinüber, hörte, wie sie sich angeregt unterhielten, und schüttelte erneut den Kopf …
Er hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendjemanden auf dem Gewissen hatten – dafür waren sie viel zu unbeschwert. Vielmehr hegte Lewyn den Verdacht, ihr erstes Angriffsopfer gewesen zu sein. Andererseits war dies eine offizielle Handelsroute … Vielleicht hatten die beiden den ein oder anderen unvorsichtigen Bauern oder Händler überfallen, der gerade mit seinem Güterkarren auf dem Weg in die Stadt gewesen war. Wie dem auch sei. Solch ein Leben war falsch. Es war an der Zeit, dass ihnen jemand den Weg wies. Und dafür war die 'Zuflucht der Suchenden' ein guter Anfang.
Lewyn kannte einen Pferdezüchter in der Umgebung der zweiten großen Handelsbrücke, welche über den Tical zurück zum anderen Ufer – und damit nach Rafalgar – führte. Sein Pferdehof lag gut sichtbar für alle Reisenden in der Nähe des Handelsweges auf einer lichten Wiese mitten im Wald. Viele Händler und Botschafter ließen ihre Reittiere dort rasten und mieteten sich ausgeruhte Pferde für den weiteren Teil ihrer Reise, um auf dem Rückweg wieder ihre erholten Tiere mitzunehmen.
Das warme Sonnenlicht ließ die Wiese aus dem kühlen Schatten der Bäume heraus hell erstrahlen, während die unterschiedlichsten Pferde galoppierend durch das Gras tollten und dabei glücklich wieherten. Lydia wurde von der Freude ihrer Artgenossen spürbar angesteckt, denn sie schien es auf einmal sehr eilig zu haben, zu ihnen zu stoßen – ja, Lewyn musste sie am Zügel haltend daran hindern, die zwei Jugendlichen aus Versehen von ihrem Rücken zu werfen! Diese schienen von der Idylle dieses Ortes allerdings nicht minder begeistert; so rief Kayne aufgeregt: "Sieh, Schwester, dort!"
Ein schwarzes und weißes Pferd bäumten sich mit freudigem Wiehern voreinander auf und wichen dann jeweils zu den Seiten hin aus, bevor sie kreisförmig umeinander trabten und ihre Köpfe ab und zu aneinander rieben. "Werden wir den ganzen Weg zur Hauptstadt auf solchen Pferden reiten?", fragte Sheena begeistert. Lewyn lachte und erwiderte: "Ja, ansonsten würdet ihr ja ewig unterwegs sein, zumal dein Bruder nicht laufen kann." Er warf dem Jungen einen prüfenden Blick zu, doch jenem schien es bestens zu gehen. Die Aufregung bezüglich ihrer bevorstehenden Reise in die größte Stadt der Menschen schien ihn genug von seiner Verletzung abzulenken, dass er sogar unbeschwert lachen konnte. Das beruhigte den Blonden und bestätigte ihn in seinem Entschluss, diesen Kindern eine bessere Zukunft zu geben.
Als sie am Zaun angekommen waren, der das gesamte Gelände umfasste, öffnete Lewyn das Tor und hielt Ausschau nach dem Pferdehalter. Einige Reittiere waren zu ihnen gekommen und begrüßten die ihnen wohlbekannte Stute schnaubend, welche freudig ihre helle Mähne hin und her schüttelte. Die fremden Pferde wiederum hatten sich zurückgezogen und musterten die Neuankömmlinge neugierig bis misstrauisch.
"Na, wenn das mal keine Überraschung is' …!", rief eine tiefe Stimme plötzlich vom anderen Ende der Wiese zu ihnen herüber, wo sich ein größerer Stall befand. Ein stämmiger und hochgewachsener Mann trat aus dem Schatten jenes Gebäudes hervor und kam ihnen gelassen entgegen. Er trug nur eine halblange Hose und begegnete ihnen ansonsten mit nacktem, sonnengebräunten Oberkörper. Der junge Mann war kahlköpfig, durch breite Gesichtszüge gekennzeichnet und besaß einen Ohrring, während zwischen seinen Zähnen ein langer Grashalm herausguckte. Trotz seiner auf die Kinder eher Angst einflößenden Erscheinung zeugten seine dunklen Augen von einem warmen Charakter.
"Brey!", rief ihm Lewyn strahlend entgegen und begrüßte ihn mit einem herzlichen Händedruck, "Lange nicht gesehen …! Wie ich sehe, geht es deinen Hufe tragenden Freunden bestens!", und er warf den Pferden auf der Wiese einen bedeutungsvollen Blick zu. Der Pferdehalter erwiderte lachend: "Ja, denen könnt's nich' besser gehen! Die sind aufgeweckter denn je, wie du siehst …!", und er wies einladend zu den Ställen hin, "Aber komm doch erst mal rein und erzähl mir, was ich für dich tun kann." Der dunkelhäutige Mann musterte die Kinder auf der Stute kurz, ehe er über die Weide voranging.
Der vordere Teil des Gebäudes war gänzlich aus dunkleren, groben Holzstämmen errichtet und in zwei Stockwerke unterteilt, während der hintere Teil ein einziger großer Stall war. Die Eingangstür erreichte man über eine Holzterrasse, welche überdacht war und durch zwei schmale Holzsäulen gestützt wurde. Auf ihr stand eine lange, gemütlich wirkende Bank, von der aus man die gesamte Wiese hervorragend überblicken konnte – zumal das Haus erhöht lag und der ganze Hof auf einem leichten Abhang errichtet war.
Lewyn half Sheena, vom Pferd herabzusteigen, bevor er Kayne herunter hob und ihn zur Bank auf der Terrasse trug. Dort setzte er ihn vorsichtig ab und sagte zu den Jugendlichen gewandt: "Ruht euch hier ein wenig aus und genießt die Heiterkeit dieses Ortes. Ich kehre gleich zu euch zurück, nachdem ich mit meinem Freund gesprochen habe."
Das Mädchen weigerte sich jedoch und erwiderte mit geschürzten Lippen: "Ich trau' dem nich' …!" Der Blonde lachte leise und tätschelte ihren dunkelroten Schopf. "Du kannst ihm vertrauen, glaube mir!", und er blinzelte ihr aufmunternd zu, "Bleib lieber bei deinem Bruder und pass auf, dass ihn nicht plötzlich ein 'bösartiges Pferd' anfällt …!" Sheena verengte die Augen in sichtlicher Empörung, sodass der hellhaarige Mann erst recht grinsen musste. Dann setzte sie sich jedoch – wenn auch unter deutlichem Protest – neben ihren Bruder auf die Bank, verschränkte ihre Arme und schmollte vor sich hin. Lewyn schüttelte lächelnd den Kopf, ehe er durch die Haustür schritt und sie hinter sich angelehnt ließ.
Der junge Mann betrat einen ländlich eingerichteten, größeren Raum, der als Wohn- und Speisezimmer genutzt wurde. An einem der grob gearbeiteten, runden Holztische saß Brey bereits und hatte für ihn einen Wasserkrug sowie einen Becher bereit gestellt. Der Blonde setzte sich ihm gegenüber an den Tisch hin und faltete die Hände zusammen. "Also, Kumpel, was gibt's?", begann der Pferdezüchter in munterem Tonfall und beugte sich zu ihm vor, um etwas leiser hinzuzufügen: "Und wer sind eigentlich diese Kinder?"
Lewyn holte tief Luft und begann in gefasstem Tonfall: "Brey, … ich möchte dich um einen Gefallen bitten." Jener war ganz Ohr. "Ich brauche jemanden, der die beiden hier zur Zuflucht nach Hymaetica bringt." Sein Freund dachte gar nicht erst lange darüber nach, sondern erwiderte sogleich: "Wieso kannst du's denn nich' selbst tun? Is' doch nur 'ne Sache von drei Tagen."
Doch da lachte der hellhaarige Mann nur trocken auf und wich seinem Blick aus. "Ich kann es leider nicht tun, tut mir leid …", meinte er unglücklich, "Ich … ich bin in Eile." Brey runzelte daraufhin nachdenklich die Stirn, nickte allerdings und sprach: "Also gut, ich werde mich darum kümm-" – "Un' … un' wer versichert uns bitte", tönte es plötzlich aufgebracht vom Hauseingang her, "dass wa dort auch heil ankomm'n, un' nich' stattdess'n was weiß ich wohin verschleppt werd'n?!" Sheena stand breitbeinig im Türrahmen und wirkte sauer, aber gleichzeitig auch verletzt, dass Lewyn sie einfach so verlassen wollte.
Die beiden Männer schraken aus ihrem Gespräch auf und wandten sich verdutzt zu dem Mädchen um. Kurz darauf brachen beide in vergnügtes Lachen aus. "Was is'n bitte so lustig d'ran?" Sheena stampfte empört auf und stemmte ihre Hände in die Hüften, während sich die Männer amüsiert von ihren Stühlen erhoben. "Sag mal, wo hast du denn diesen Wildfang her? Das ist ja nich' zu fassen …!", meinte der Pferdezüchter lachend und schritt auf das Mädchen zu, welches ihm höchst misstrauisch aus dem Weg ging und stattdessen in wenigen Sätzen an die Seite des Blonden gehüpft kam.
Verwundert blickte Lewyn zu Sheena hinab, welche ihn trotzig und fest entschlossen ansah. "Ich! Will! Mit dir! Geh'n!", rief sie mit allem Nachdruck, den sie aufbringen konnte. Der junge Mann hob die Augenbrauen und wechselte einen überraschten Blick mit seinem Bekannten, der sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. "Tja, Lewyn, altes Haus, da kann ich wohl nich' mithalten …" Brey schlug dem Kleineren auf die Schulter und nahm eine übertrieben resignierte Haltung ein.
Der hellhaarige Mann kam nicht umhin zu lächeln, doch dieses Lächeln erstarb nach wenigen Augenblicken – und er wurde schlagartig ernst. Der plötzliche Wandel in seinem Gesichtsausdruck stimmte Sheena sofort unruhig. Er legte dem Mädchen eine Hand auf die Schulter und sprach mit umso ruhigerer Stimme: "Dort, wo ich hingehen werde, kannst du mir nicht folgen." – "A-aber wieso'n nich'?", warf sie verzweifelt ein, "Warum sol-" – "Sheena, du darfst mir dorthin nicht folgen", unterbrach sie Lewyn bestimmt, festigte den Druck auf ihrer Schulter und fixierte sie mit einem eindringlichen und bedeutungsvollen Blick, um ihrer Argumentationsreihe von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Mädchen legte die Stirn in Falten und sah ihn verständnislos und völlig verwirrt an. "Aber warum denn nicht?"
Es kehrte eine anspannte Stille ein, während aller Augen auf den Blonden gerichtet waren. Auch Brey horchte auf, denn er war eigentlich davon ausgegangen, dass Lewyn lediglich auf einem weiteren Botengang zurück zur Grafenstadt Henx war.
So hell die Sonne die Außenwelt erstrahlen ließ, so finster und dunkel wirkte es plötzlich im Inneren des Hauses. Der ganze Vogelgesang und das heitere Wiehern schienen an der geöffneten Türschwelle abzuprallen und nur als dumpfer Geräuschschwall zu ihnen durchzudringen.
Der junge Mann rang sichtlich nach Worten. Er wusste selbst nicht wirklich, wie er es ausdrücken sollte … und ließ es schließlich ganz bleiben. Der Blonde schüttelte nur den Kopf und schloss die Augen. "Lebt wohl", sprach er leise und sanft, nahm die Hand von Sheenas Schulter herunter und wandte sich schließlich zum Gehen. Höchste Beunruhigung zeichnete sich auf dem Gesicht des Mädchens ab, der das Ganze viel zu schnell ging.
Auch seinem Freund behagten die jähen Abschiedsworte nicht, denn so kannte er Lewyn überhaupt nicht. Und dass jener nun ohne ein einziges Wort der Erklärung verschwinden wollte, gefiel ihm erst recht nicht. Als der langhaarige Mann an ihm vorbeiging, ergriff Brey entsprechend seinen Arm und redete auf ihn ein: "He, mach bloß keine Dummheiten, Kumpel. Was hast du vor?"
Daraufhin wandte Lewyn langsam seinen Kopf zur Seite – sodass nur sein Freund allein seinem Blick begegnen konnte – und sah ihn für einige Augenblicke einfach nur stillschweigend an …
Der intensive Ausdruck der Einsamkeit und des Leidens, die Brey in jenen tiefblauen Augen zu Gesicht bekam, schnürte ihm dermaßen die Kehle zu, dass er mehrmals schlucken musste, um den Knoten wieder zu lösen. Es verging ein weiterer Moment bedrückten Schweigens, bis er sich leise räusperte, Lewyns Arm mit einigem Zögern freigab und dabei bedeutsam nickend sprach: "Dann geh … und die Ahnen mit dir."
So kehrte ihnen Lewyn den Rücken zu und verließ sie. Als er aus der Türschwelle herausgetreten war, verharrte er dann noch für einen kurzen Augenblick im Gehen … Der junge Mann wandte seinen Kopf zur Seite, als wollte er noch etwas Letztes sagen – ließ aber auch jenes bleiben und setzte seinen Weg nicht mehr zurückblickend fort.
Lewyn sah Lydia trotz des ganzen Gepäcks auf ihrem Rücken mit ihren Artgenossen herumspielen und dachte einen Moment ernsthaft darüber nach, sie hierzulassen und sich ein anderes Pferd für die Reise zu nehmen. Doch ehe er den Gedanken hatte weiter ausreifen lassen können, war seine Stute schon von den anderen Pferden weggelaufen und schnaubte auf der Stelle
tretend neben ihm, als hätte sie nur darauf gewartet, dass ihre Reise weiterging. Der Blonde lächelte traurig und schlug seiner treuen Gefährtin sanft gegen die Seite, bevor er schwungvoll auf ihren Rücken aufstieg und mit ihr davonritt.
Ein weiterer Ort, der mit schönen Erinnerungen verbunden war, lag nun endgültig hinter ihm. Seine Füße schienen aus Blei zu sein, so schwer fiel es Lewyn, Abschied zu nehmen; denn je weiter er kam, desto stärker wurde das Gefühl in ihm, einen Weg ohne Wiederkehr gewählt zu haben. All die Menschen, denen er begegnet war, und all die Freunde, mit denen er so viel Zeit seines Lebens verbracht hatte – all dies verblasste einfach im Nichts.
Im Nichts des Wirbels. Im Wirbel der Erinnerung.
Im Wirbel des Vergessens.