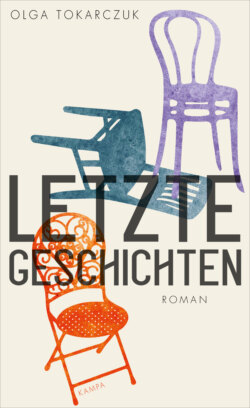Читать книгу Letzte Geschichten - Ольга Токарчук, Olga Tokarczuk - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDer Nebel draußen vor dem Fenster hat sich wieder bewegt, und jetzt sieht man, woraus er besteht – aus weichen, wogenden Streifen, wie Rauchwolken, die in Schichten und Mäandern fließen, aus kleinen, unscharfen Wirbeln, aus glatten Wellen mit unterschiedlichen Längen, die sich zu Hindernissen verwickeln, Schlingen, Kreise und Spiralen bilden. Ida betrachtet diese Bewegung vor dem Fenster, und sie meint hinter diesem Wogen dunklere, entferntere Gestalten zu erkennen. Sie legt den Hörer, den sie gedankenlos die ganze Zeit in der Hand gehalten hat, wieder auf die Gabel und nimmt eine dampfende Pellkartoffel aus dem Topf. Sie ist heiß, die Haut lässt sich in Streifen abziehen.
So kochte ihre Mutter die Kartoffeln für die Hühner, sie knetete sie und gab gemahlenen Weizen dazu. Eine Zeit lang hatten sie ziemlich viele Hühner, bis der Fuchs sie holte. Er war fleißig, jede Nacht ein Huhn, so ging es einen Monat lang. Zum Schluss blieb noch eines übrig, ein mutiges, kämpferisches Huhn. Ganze Tage verbrachte es auf der Treppe vor dem Haus, es fühlte sich zu den Menschen hingezogen, vielleicht aus Einsamkeit, vielleicht wegen des Fuchses. Die Mutter jagte es fort, sie mochte keine Hühner, überhaupt keine Vögel, sie ekelte sich vor Federn, Eiern und Fleisch. Der Vater rupfte die geschlachteten, abgebrühten Hühner. Die Mutter ging dann in den Garten, um Unkraut zu jäten, oder sie ging einfach aus. Sie trug immer Strümpfe, im Haus dicke, die mit Strumpfbändern gehalten wurden; wenn sie ausging, zog sie dünne, schlüpfrige Strümpfe an, dann sahen ihre Beine aus wie die einer Plastikpuppe. Zu den dünnen Strümpfen trug sie einen Strumpfhalter, und die Knipsverschlüsse griffen fest in das knisternde Nylon und hielten es stramm, in permanenter Bereitschaft. Eines Nachts verschwand auch das mutige Huhn.
Ida beißt in die Kartoffel, sie ist wohlschmeckend, weich, zerschmilzt sofort mit einer angenehmen Wärme im Mund.
Wenn die Mutter ausging und sie und ihr Vater weit weg ihre Gestalt in einem ihrer geblümten Kleider sahen, wie sie fast im Laufschritt ins Dorf hinuntereilte, warf der Vater der Tochter einen flüchtigen Blick zu, als bitte er um Verständnis für die Mutter, als wollte er sagen: »Es ist nicht ihre Schuld, dass sie so ist«, und dann kehrte er zu seinen stillen Arbeiten zurück.
Die Untersuchungen ergaben nichts Bemerkenswertes. Sie hatte eine leichte Arhythmie, wahrscheinlich seit ihrer Geburt oder infolge von Anginen in der Kindheit.
»Nichts Gefährliches. Sie sind gesund«, sagte der Arzt und warf einen Blick auf die zwei Ziffern, die am oberen Rand ihrer Karte standen. 54. »Für Ihr Alter sind Sie in guter Kondition.«
Dann füllte er schweigend ein Rezept aus, ein mildes Beruhigungsmittel, für den Schlaf, zur Stärkung.
An einem Samstag Anfang Dezember fuhr sie in eine saubere, sterile Privatklinik. Sie bekam eine Nummer, einen Kaffee und eine Art Speisekarte. Auf elegantem, mit dem Logo des Krankenhauses geschmücktem Karton waren alle möglichen Untersuchungen aufgeführt. Daneben standen klein die Preise. Sie saß mit dem Bleistift da und kreuzte an: Toxoplasmose, Hepatitis B, HIV, Cholesterin HDL und LDL, TG/TGC, BUN, OB/ESR, WBC … Die meisten Namen verstand sie nicht. Sie kreuzte sie nur deshalb an, weil sie ihr gefährlich erschienen, wie die Namen prähistorischer Raubtiere – Thrombozyten, Hämatokrit, Monozyten, Urobilinogen, Bilirubin. Eine elegante junge Frau an der Rezeption nahm die Karte entgegen, gab ihr einen Termin, zu dem sie nüchtern erscheinen sollte. Sie reichte ihr diskret einen komischen Behälter für den Urin und wünschte ihr einen angenehmen Tag. Das ist jetzt Mode, dass man sich einen angenehmen Tag wünscht. Auf dem Weg hinaus kaufte Ida in der Klinikapotheke ein kleines Fieberthermometer im Plastiketui und nahm sich vor, jeden Tag systematisch gleich nach dem Aufwachen die Temperatur zu messen. Ein paar Tage schaffte sie es auch. Die gemessenen Werte trug sie auf einer Karte ein, die mit einem Magnet am Kühlschrank befestigt war. 36,7, 36,4, 36,6, 36,6 – alle lagen in einem vollkommen unauffälligen Bereich, doch erst jetzt wurde ihr dank dieser sanften Monotonie klar, dass sie ja keinen Eisprung mehr hatte und daher das Meer, der dunkle innere Ozean, verstummt war und dass eine noch dunklere Nacht auf ihn hinabsank. Ein stilles, unermessliches Gewässer. Wogen, die keine Muschel mehr in Bewegung versetzten.
Früher hatte sie sich so die Temperatur gemessen, vor über dreißig Jahren, im Studium. Alle Mädchen hatten Thermometer im Zimmer, kleine Kalender voller Zahlen und ein Ausrufezeichen an der Stelle, wo die Körperwärme mit verhältnismäßiger Regelmäßigkeit – einmal im Monat – plötzlich um ein paar Striche in die Höhe ging. Schläfrige Mädchenhände, die nach dem Thermometerglas griffen, der verschlafene Körper, in den die Quecksilbersäule eindrang.
Es war eine unangenehme Erfahrung, sich selbst mit dem kalten Instrument zu messen, mit einer gläsernen Rute, die auf der entsprechenden Skala den Prozess anzeigte, der sich im abgeschlossenen dunklen Innern des Körpers vollzog. Überhaupt mit einem Instrument den eigenen Körper erkunden zu müssen, weil aus irgendwelchen empörenden Gründen, infolge eines skandalösen Irrtums der Natur, der Mensch nichts über den eigenen Körper weiß. Scheinbar ist er eins mit diesem Körper und ist dieser Körper, zeigt mit dem Finger auf die Brust und nennt ihn »ich« und hat doch keine Ahnung, was sich in ihm tut. Scheinbar fühlt er da etwas, ein Kribbeln, Schwindel und Schmerzen, vor allem Schmerzen, aber er hat kein Wissen, das doch, wenn es logisch zuginge, angeboren sein müsste. Erst musste man für sich selbst zum Objekt werden, das gläserne Röhrchen in sich hineinstecken, um zu erfahren, was sich im eigenen Innern tut.
Schweigende, klebrige Zellen, eine unförmige Uhr aus Gewebe, die kein Ticken von sich gibt, sondern Materie in Form von Kügelchen, die die Zeit präzise abmessen. Anschwellen von Gewebe und Erschlaffen. Das runde »o« gleitet durch enge Labyrinthe in die Zukunft. Der Körper weiß nichts über sich, er muss an sich einen Test durchführen, um zu erfahren, wie sein Mechanismus funktioniert.
Ida meint, sie und ihr Körper haben keine gemeinsamen Wurzeln. Sie kommen von verschiedenen Polen. Deshalb müssen sie sich mithilfe von Thermometern, Tomographen und Röntgenstrahlen verständigen.
Für die Untersuchungen musste sie sich ausziehen. Man teilte ihr ein kleines Zimmerchen zu, ohne Fenster, mit Waschbecken und Kleiderbügeln. Sie zog etwas Weißes an, eine Art Pyjama oder Leinenhemd, und Wegwerfschlappen aus Plastik. Zweimal nahm man ihr Blut ab – aus der Vene und aus dem Finger. Danach ging sie mit einer jungen Frau zum Röntgen, sie redeten nicht miteinander, sie wechselten keinen einzigen Satz, als verstünde es sich von selbst, dass sie jetzt mit wichtigeren Dingen beschäftigt waren und die sozialen Konventionen nicht mehr galten. Die an die Metallscheibe geschmiegten Brüste wurden flach gedrückt, dann ließ die eilige Krankenschwester sie mit der Maschine allein, während einen Sekundenbruchteil lang der Geist Gottes darauf herniederstieg, damit sie sehen konnte, was verborgen, was verdrängt war, was immer im Dunkeln lag. Eine andere Krankenschwester nahm ihren Urinbehälter entgegen, diesen peinlichen Beweis chemischer Prozesse, die ganz von selbst vor sich gehen, seit sie vor über fünfzig Jahren aus unbekannten Gründen angefangen haben. Der Behälter wurde mit ihrem Vor- und Nachnamen versehen und zu anderen ebenso beschrifteten Gefäßen gestellt. Das Datum stand auch darauf. 8. Dezember 2003. Sie war hier und hat eine Spur hinterlassen, aus der man ablesen kann, wer sie ist.
Anschließend führte man sie in eine kleine Cafeteria in einem unterirdischen Geschoss dieses Privattempels. Sie bekam einen Kaffee und Croissants. Am Nachbartisch saß seitlich zu ihr eine andere Frau. Im Profil war ihr schmaler zusammengekniffener Mund sichtbar, der sich bei jedem Biss wie ein Eidechsenmaul öffnete. Daran erinnert sie sich noch genau. Sie blickten einander mit ausdruckslosem Lächeln an und aßen schweigend weiter.
Ein paar Tage später ging sie wieder hin. Eine junge Ärztin, ein Mädchen noch, sah einen Stapel Blätter mit Resultaten durch und sagte dasselbe wie der erste Arzt: Ida sei gesund.
»Vielleicht könnte man beim Hämoglobin Bedenken anmelden, das ist das Einzige, was mir auffällt,« sagte sie. »Aber abgesehen davon ist Ihr Körper völlig in Ordnung, beneidenswert.«
Bestimmt hatte sie erwartet, dass die Patientin sich freute, dass sie erleichtert aufatmen und freudig hinaus in die regennasse Stadt gehen würde, um Weihnachtseinkäufe zu machen. Sie hatte mit Erleichterung bei der Patientin gerechnet, aber offenbar hatte sie sich getäuscht. Ida dankte und ging. Die junge Ärztin blieb in ihrem Sprechzimmer zurück, wo sie sicher Pythia gleich auf den nächsten Patienten wartete, dem sie vielleicht dasselbe sagen würde. Oder auch nicht – womöglich bereitete sie ein Todesurteil vor und würde der Frau mit dem Eidechsenmaul sagen: Sie sind todkrank und werden sterben. Wir können nichts für Sie tun. Es entspräche ja auch der Wahrheit, wenn sie jedem, der vor ihr Platz nahm, einfach sagen würde: Sie werden sterben, meine Dame, und Sie werden sterben, mein Herr, du wirst auch sterben, liebes Kind, und ich werde auch sterben. Wir werden alle sterben und sollten uns darauf vorbereiten, wir sollten eine Gesellschaft zur Unterstützung des Sterbens ins Leben rufen und Schulen gründen, in denen man sterben lernt, um wenigstens bei dieser letzten Gelegenheit im Leben nichts falsch zu machen. Im Sportunterricht sollte man üben, wie man stirbt, wie man sich sanft ins Dunkel gleiten lässt, wie man das Bewusstsein verliert und wie man im Sarg adrett aussieht. Es müsste Schauunterricht geben, bestimmt würde sich jemand erbieten, seinen Tod der laufenden Kamera preiszugeben, damit ein Unterrichtsfilm gedreht werden könnte. In diesem Kurs müsste es auch Ethnographie geben, alles Wissenswerte über den Tod, was man über ihn denkt, wie er verstanden wird, warum er einmal als Frau und einmal als Mann auftritt, wohin man nach dem Tod kommt und ob man überhaupt irgendwohin kommt. So wie Biologie ein Abiturfach ist, müsste auch die Thanatologie eines sein, es müsste Tests geben, die für das Halbjahreszeugnis gelten würden, und Noten auf dem Versetzungszeugnis. »Ich glaub, ich werd Thano verhauen«, würden die Schüler bei der verbotenen todbringenden Zigarette auf der Toilette sagen, und dann würden sie bis zum Morgen alle möglichen Definitionen, Diagramme und Zahlen pauken. Und alle wären dankbar für diese Mahnung und Lehre.
Idas Herz interessiert sich nicht für die Untersuchungsergebnisse. Von Zeit zu Zeit startet es nachts kleine Provokationen. Es bleibt einen Augenblick lang stehen, wie in einer Geste der Rebellion – es hat genug von dieser Schaumschlägerei.
Ida hört Lärm auf dem Hof, die großen Scheunentore quietschen. »Dort stecken die Wirtsleute sicher«, denkt Ida. Sie vermutet, dass sie in dieser Scheune etwas züchten, vielleicht Füchse für Pelze, vielleicht Nerze oder bloß Hühner. Für diese wird die Grütze gekocht. Olga ist bestimmt so alt, wie Idas Mutter jetzt wäre. Nein, jünger, vielleicht ein bisschen jünger. Das Haus ist leer. Ida steht über der erhitzten Herdplatte und wärmt sich die Hände. So ein Herd ist ein Goldstück. Sie denkt daran, dass sie Holz nachlegen und Wasser in den Wasserkessel nachgießen muss. Die Hündin hebt leicht den Kopf und verfolgt ihre Bewegungen.
»Was willst du?«, fragt Ida.
Der Hund schaut auf den Teekessel, dann auf die Schüssel. Sie ist leer. Er will etwas trinken.
»Du benimmst dich wie ein Baby«, sagt sie zu ihm und lächelt vor sich hin. Sie hat etwas Dummes gesagt. Sie gießt Wasser in die Schüssel und setzt sie dem Hund vor. Aber der reagiert gar nicht, schaut nur auf die Schüssel, als wollte er sie mit seinen Blicken bewegen, deshalb hebt Ida vorsichtig den Kopf des Hundes. Unter ihren Fingern spürt sie, wie sein Hals leicht zittert und wie schwer der Hundekopf ist. Der Hund verharrt reglos mit der Nase über dem Wasser, als müsse er Kraft schöpfen, dann schlabbert er ein paarmal unbeholfen, verspritzt Wasser und erstarrt wieder in derselben Position mit der Nase über dem Wasser. Ida nimmt mit der einen Hand die Schüssel fort, mit der anderen bettet sie den zotteligen Kopf auf das Lager. Der Hund seufzt. Da streicht Ida ihm über die Wange – wenn man so sagen darf.
Die Hauswirte kehren zurück. Sie stapfen mit den Schuhen, um den Schnee abzuschütteln, denn es hat wieder angefangen zu schneien. Der Nebel ist in kleine Teilchen zerrissen, die sich in Schneeflocken verwandelt haben. Olga wühlt im Kühlschrank, holt den Käse heraus, ein Glas Meerrettich, Mayonnaise. Ida versucht, bei den Vorbereitungen für das Essen zu helfen, und räumt auf dem Tisch auf.
»Ich wollte anrufen und hab es vergessen. Ich weiß nicht, wo meine Gedanken sind«, sagt sie. »Heute hab ich nicht schlafen können. Ich bin im Morgengrauen aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen.«
»Dann herrscht auch so ein seltsames Licht, deshalb war dir nicht gut«, sagt Stefan langsam.
Ida betrachtet aufmerksam sein Gesicht, forscht darin nach einer Erklärung: Ein Lächeln würde heißen, dass es eine Art Scherz war, eine ernste Miene, dass er einfach ein komischer Kauz ist, vielleicht hat er auch Probleme mit dem Gedächtnis, vielleicht liegt es am Alter, obwohl er nicht nach einem gebrechlichen Alterchen aussieht. Sie begegnet Olgas Blick. Sie macht eine winzige Bewegung mit den Augenbrauen, die vielleicht nur Anführungsstriche andeuten soll: »Versteh alles, was er sagt, in Anführungsstrichen.«
Der Mann gibt eine Dose Hundefutter in den Topf mit der Grütze und vermischt das Ganze mit einem Holzlöffel.
»Meiner Meinung nach sehen Sie prächtig aus. Wir haben hier gute Luft und gutes Wasser. Das verjüngt die Leute.« Stefan nimmt den Topf mit der Grütze in beide Hände und schlurft zur Tür.
Ida öffnet die Tür für ihn.
»Komm dann sofort zum Frühstück. Und setz deine Mütze auf!«, ruft ihm seine Frau hinterher.
Beide schneiden Scheiben von dem Käse und legen sie auf den Teller. Dazu eine saure Gurke.
Olga fragt: »Woher kommst du? Du hast es mir sicher schon mal gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Aus Wrocław?«
»Aus Warschau«, erwidert Ida.
»Aha, aber wie bist du hierhergekommen?«
Ida erzählt noch einmal geduldig ihre Geschichte.
»Und die Eltern, leben deine Eltern noch?«, fragt Olga.
»Nein, sie leben nicht mehr. Das Haus wurde verkauft«, sagt Ida und verspürt plötzlich den verzweifelten Wunsch zu fliehen. In Gedanken prüft sie, ob sie alles bei sich hat – Schlüssel, Papiere, wo haben sie ihren Mantel hingehängt? Sie wirft einen Blick auf das Telefon, sie muss sofort anrufen. Sie wird sich auf den Weg machen, sie hat sich wieder gefangen. Von diesen Leuten hat sie jetzt genug – sie wird bei ihnen noch ganz durcheinander. Energisch tritt sie näher an den Kalender mit dem Fisch, heute ist also Samstag. Samstag oder Freitag? Am Montag hat sie in Warschau einen Arzttermin. Am Mittwoch muss sie bei der Arbeit sein.
Olga gießt Tee in die Gläser, aus einem Beutel macht sie zwei Tassen.
»Also, mir scheint es, als hätten wir immer hier gewohnt«, erklärt sie. »So viele Leute sind in dieses Haus gekommen und wieder gegangen. Ich hab ihm ja gesagt«, mit einer Bewegung der Brauen deutet sie auf die Tür, »er soll so ein Schild machen, ›Ferien auf dem Bauernhof‹, und es an der Straße aufstellen, denn das Haus selbst kann man von der Straße aus nicht sehen. Aber man findet uns auch ohne Schild. Und du, was machst du denn da in Warschau? Hast du Familie? Du siehst mir nach einer gescheiten Frau aus.«
Ida lächelt vor sich hin, sie freut sich über dieses unerwartete und altmodische Kompliment und nimmt sich vor, ihnen für Übernachtung und Verpflegung Geld zu geben, offensichtlich verdienen sie an verirrten Reisenden, wie sie eine ist. Den zweiten Teil von Olgas Frage ignoriert sie. Sie überlegt, ob sie vor der Abreise noch einen Tee trinken soll. Olga sieht sie neugierig an und verschlingt einen Bissen nach dem anderen. Ihre Wangen sind so beweglich, als wären sie nicht am Kopf befestigt.
»Ich bin Reiseführerin.«
»Ist das ein Beruf?«, wundert sich Olga.
Stefan erscheint, besser gesagt, er steckt den Kopf ins Zimmer und sagt zu seiner Frau: »Komm!« Es hört sich ernst und dringend an, als sei etwas Wichtiges geschehen. Ida erstarrt mit offenem Mund, sie hat das Gefühl, als habe sich genau dasselbe schon heute oder gestern ereignet, als stecke sie in einem seltsamen, langen, bruchstückhaften Déjà-vu. Sie schüttelt den Kopf hin und her, dieses Gefühl ist wie Wasser im Ohr, es verzerrt die Geräusche, überlagert alles mit seinem Summen, man muss es unbedingt herausschütteln.
Olga erhebt sich gehorsam vom Tisch, zieht eine Fellweste über, setzt eine Filzmütze auf und geht hinaus. Sie müssen mit etwas beschäftigt sein, das keinen Aufschub duldet.
Worauf sollte sie noch warten? Ida wählt die Nummer der Polizei, 997, die kennt sie aus dem Fernsehen, aus diesen Programmen, in denen Verbrechen unbeholfen nachgestellt werden. Sie hört den langen Ton, wie ein beunruhigendes Signal der Leere. Sie versucht es noch einmal. Der Klang ist lang und traurig, wie das Pfeifen einer fernen Lokomotive. Von hier muss es überallhin weit sein, sogar für das Telefon. Plötzlich hat sie das Gefühl, dass dort am anderen Ende Nikolin den Hörer abhebt und mit seiner schwachen, müden Stimme sagt: »Ja, bitte.«
So nennt sie ihren Mann, wenn sie an ihn denkt – immer beim Nachnamen Nikolin. Früher klang das vertraut, früher, also damals, als sie jung waren und die gleichen Jeans trugen und die gleiche Frisur hatten. Jetzt klingt »Nikolin« so, wie es sich gehört und wie es der Wahrheit entspricht – wie der Name eines Bekannten. Wenn nötig treffen sie sich in einem Café, wo er ohnehin ganze Vormittage versitzt. Der Eingang des Cafés liegt an einer Hauptverkehrsstraße, aus der Menschenmenge und dem Autolärm tritt man durch die dunkle Tür in eine plötzlich verstummte, beruhigte Welt, es riecht ein wenig feucht, ein Geruch, der die Nähe eines Parks oder Gartens zu verheißen scheint, in Wirklichkeit jedoch von ein paar Kübeln mit Kletterpflanzen herrührt, die zwischen den Tischen stehen und im Sommer ins Freie gestellt werden.
Nikolin sitzt immer in einer bestimmten Ecke, drinnen, wo es am dunkelsten und am stickigsten ist und nur eine kleine Wandlampe das Lesen ermöglicht.
Ida erkennt schon von Weitem sein blasses, etwas schlaffes Gesicht und die hellgrauen, sich lichtenden Haare. Irgendwie weiß er immer genau, wann sie, seine Ex-Frau, eintritt, und aus seiner Ecke verfolgt er sie mit Blicken. Er ist überzeugt, dass sie ihn noch nicht sieht oder zumindest noch so weit entfernt ist, dass sie seinen Gesichtsausdruck nicht ausmachen kann. Immer sitzt er demselben Irrtum auf, denn in Wahrheit hat Ida seine verdrossene Miene längst wahrgenommen, bevor er sein Gesicht strafft und den Mund zu einem Lächeln verzieht, das nicht zu herzlich, nicht übertrieben ist, nur freundschaftlich, normal. Sie sieht sein Gesicht, bevor es dazu bereit ist, und sie weiß, was es aussagt: Ablehnung, ein Hauch von Wut, Ekel – nicht unbedingt ihr gegenüber, aber allem gegenüber, was nicht er selbst ist.
Nikolin trägt viele Kleidungsstücke, die nicht zueinander passen oder die er aus Trotz so unpassend ausgewählt hat: ein Hemd, eine Wollweste, ein dreieckiges Halstuch, das eine Art Schal darstellen soll, dazu ein Jackett mit Flicken auf den Ellbogen, ausgebeulte Cordhosen und im Knopfloch der Jacke noch ein Ziertuch. Von allem zu viel, die absonderliche Eleganz eines Menschen, der sich mechanisch ankleidet. Nikolin legt sein Buch beiseite und sieht sie mit einem inzwischen freundschaftlichen Lächeln an, er greift nach seinem Bier, an dem er seit einer Stunde nippt.
Meistens ist er derjenige, der anruft, in der Regel geht es um einen kleinen Gefallen: eine Arztempfehlung, ein kleines Darlehen, ein Anlass – ein Theaterstück, Vortrag, Abendessen –, zu dem er partout nicht allein gehen möchte. Sie kommt widerwillig, müde, zwischen Reisen, oft mit gefülltem Einkaufsnetz. Im Grunde geht es ihm immer um dasselbe: Ich bin hilflos, sagten sein kariertes Jackett, sein kahler werdender Kopf, das Tüchlein im Knopfloch, die müde Hautfalte neben dem Mund, die aschfarbenen Augenlider, die kleinen, schmalen Hände mit dem Kugelschreiberabdruck auf einem Finger. Ich bin verlassen und hilflos, ich weiß nicht, wie ich mit alldem fertigwerden soll, der Nachbar hat mir das Badezimmer überschwemmt, ich habe meinen Versicherungsvertrag verloren, ich habe erhöhten Blutzucker, ich kann nachts nicht schlafen, ich bin alt, ich habe mein Leben vergeudet, nimm mich mit nach Hause, kümmer dich um mich, ich bin krank, ich hab keine Kraft.
Doch sein Mund berichtet nur konkrete Fakten: Meine Heißwasserleitung ist im Eimer, kennst du keinen Handwerker, könntest du ihn anrufen, dass er zu mir kommt, ich bin jetzt die ganze Zeit zu Hause. »Ich kann dir die Nummer geben«, sagt Ida. »Natürlich, ich werde ihn selbst anrufen«, beschwichtigt er und setzt hinzu: »Kann ich mal zum Kaffee zu dir kommen?« Ida zuckt mit den Schultern. »Ich fahre bald wieder weg«, sagt sie. »Und wann kommst du zurück?«, fragt er nach.
Er kommt mit einer Zeitung, setzt sich auf seinen alten Platz an den Tisch in der Küche, sie schneidet etwas, kocht etwas. Er sitzt in ihrer Küche über der auf dem Tisch ausgebreiteten Wochenzeitung, die großen Zeitungsseiten segeln zu Boden. Die Küche ist klein. Nikolin und seine Zeitung nehmen den ganzen Raum ein, atmen die ganze Luft, nehmen das Licht weg. Die beiden unterhalten sich leise, ohne Energie. Das haben sie unfreiwillig gelernt, sobald sie einander sehen, werden sie müde. Ida gibt ihm etwas zu essen, setzt ihm den Teller mit Suppe vor die Nase, auf die Zeitung. Nikolin lächelt dankbar und isst schweigend. Er ist wie ein Küken, das zu unglaublichen Dimensionen angewachsen ist, doch die Fähigkeit zur Nestflucht verloren hat. Und je größer die Dankbarkeit in seinem Lächeln ist und je mehr ihm die Suppe schmeckt, desto größer ist der Zorn, der Ida ergreift. Das ist derselbe Zorn, den man verspürt, wenn man festgehalten wird und sich nicht befreien kann. Es ist eine Raserei. Ida versucht sich zu beherrschen, sie wartet, bis der Mann fertig ist, nimmt die leere Schale fort. Sie stellt sie in den Ausguss und sagt, er solle jetzt lieber gehen. Ohne ein Wort, ohne das geringste Seufzen nimmt er die Jacke vom Haken und geht. Nur ein paar Worte wie »Auf Wiedersehen« oder »Mach’s gut« werden gewechselt. Aber murmelnd, unklar.
Als Maja zur Uni ging, teilten sie die Wohnung in zwei kleinere. Das erste Jahr über kam er, um seine Bücher zu holen, die bei ihr in Kartons standen, jedes Mal nahm er nur drei oder vier, damit er immer einen Vorwand haben würde, wiederzukommen. Er behauptete, in seiner Wohnung fehle es noch an Regalen. Er warf einen Blick in den Kühlschrank, sie aßen etwas zusammen, dann ging er. Er dehnte den Abschied in die Länge, quengelte.
Seit Urzeiten befasst sich Nikolin mit Kitsch, vor zwanzig Jahren sollte er darüber eine Doktorarbeit schreiben. Jetzt ist er Geschichtslehrer, aber das stört ihn nicht, er verfolgt den Kitsch in allem, was seines Weges kommt. Er analysiert Kitsch, untersucht ihn, hasst ihn und betet ihn zugleich an. Er kann nie genug von diesem Spiel bekommen – alles betrachtet und untersucht er als potenziellen Kitschträger. Er tut es still, hartnäckig, systematisch notiert er seine Beobachtungen mit seinen kleinen fraulichen Händen in ein Notizbuch und wirft sie seinen Gymnasiasten als Aphorismen vor.
Kitsch ist die leere, unreflektierende Nachäffung von etwas wirklich Erlebtem, einer einmaligen, originalen, unwiederholbaren Entdeckung. Kitsch ist Verdoppelung, Vervielfältigung, Mimikry, die von einer bereits geschaffenen Form zu profitieren sucht. Kitsch ist die Imitation von Rührung, ein Wühlen im grundlegenden, ursprünglichen Affekt, dem dann ein zu enger Inhalt übergestülpt wird. Jede Sache, die vorgibt, etwas anderes zu sein, um bestimmte Gefühle hervorzurufen, ist Kitsch.
Jede Imitation ist moralisch schlecht – deshalb ist Kitsch gefährlich. Nichts ist so gefährlich für den Menschen wie der Kitsch, nicht einmal der Tod.
Ida vermutet, dass dieses Thema einen tieferen, symbolischen Grund hat und Nikolin, hoffnungslos darin versunken, ein Mysterienspiel vollführt, er nähert sich diesem tiefen, dunklen Geheimnis, in dem Kitsch bloß ein Vorwand, ein Schlüssel ist.
Menschen kommen nur zusammen, um zu sehen, wie sie sich voneinander unterscheiden. Je mehr sie sich unterscheiden, desto länger bleiben sie zusammen. Als wollte das Leben ihnen alles zeigen, was sie nicht sind. Jeder Tag mit Nikolin beweist, dass diese Unterschiede unaufhebbar sind. Sie leben achtzehn Jahre miteinander.
Sie sieht zu, wie er seine kleinen Notizen auf Zetteln macht, höchstens zwei Worte, wie Chiffren. Emotionen sind deshalb so gefährlich, weil sie wie besessen nach einer Ausdrucksform suchen, sie sind ungeduldig, können es nicht abwarten, etwas Neues, Eigenes zu schaffen, und verfallen so aus Hast in abgenutzte Formen. Je stärker die Emotion, desto größer die Versuchung, sich einer abgenutzten Form zu bedienen – je mehr die Füße wehtun, umso eher finden sie einen alten ausgelatschten Pantoffel. Kitsch ist die Affektation von Emotionen, schreibt Nikolin in seiner kleinen, zerfahrenen Handschrift, die aussieht wie eine Chromosomenreihe.
Irgendwann stehen sie in der Küche einander gegenüber. Sehr lange. Sie messen sich mit Blicken – das ist die einzige Kampfesform, auf die sie sich einlassen können. Sie sieht die Miene, die sogleich unter den erstaunt hochgezogenen Brauen verschwindet. Doch der kurze Gesichtsausdruck, der nur einen Augenblick lang erscheint und ansonsten sorgfältig verborgen ist, bleibt ihr in Erinnerung. Ein leeres, fremdes Gesicht. Jedwede Liebe ist Kitsch, es gibt keine neuen Formen für die Liebe, denn alle sind schon tausendfach abgenutzt. Es gibt keine Form, also gibt es keine Liebe. Ida spürt einen Schmerz irgendwo in der Herzgegend, weil Nikolin erstorben ist.
»Manche beschäftigen sich mit Dingen, von denen sie sich fernhalten sollten«, denkt sie. Wenn sie anfingen, von einem anderen Thema zu reden, von einem Thema, das ihnen nicht einmal bewusst ist, sie aber wirklich berührt, dann könnten sie etwas Wichtigeres sagen. Doch sie erkennen ihr Thema nicht und widmen sich einem ganz anderen. Auf diese Art und Weise sterben sie bei lebendigem Leib.
Im Hörer das enttäuschende monoton gedehnte Freizeichen. Niemand hebt ab. Ist das möglich?
Die kranke Hündin seufzt plötzlich, dann setzt sie sich auf, schwankt leicht hin und her. Sie schaut gleichgültig vor sich hin. Atmet schwer.
»Willst du rausgehen? Was möchtest du?«
Das Tier reagiert nicht. Ida setzt ihm wieder die Wasserschüssel vor. Anfangs schnuppert es desinteressiert an dem Wasser, dann, plötzlich, als fiele ihm alles wieder ein, beginnt es gierig zu trinken, verspritzt das Wasser auf dem Lager und auf Idas Rock. Es hört genauso plötzlich auf, wie es begonnen hat, und legt sich schwerfällig hin, genauso wie zuvor. Es liegt auf der Seite und atmet schwer, flach, hat die Augen halb geschlossen, Ida ist sich nicht sicher, ob das Tier sehen kann oder ob seine Augen schon erblindet sind und höchstens noch die einen oder anderen inneren Hundebilder verfolgen. Sie meint, es tue nicht gut, die ganze Zeit so auf einer Seite zu liegen, deshalb verschiebt sie den Körper der Hündin vorsichtig. Sie hört ein Stöhnen, das fast menschlich klingt.
»Ich will dich doch nur umdrehen, tut das denn so weh?«, flüstert sie.
Behutsam stellt sie das Tier auf die Beine und dreht es dann langsam auf die andere Seite; der Körper überlässt sich ohne Widerstand, zeigt keine Reaktion, keinen Versuch, die Stellung zu ändern, sich bequemer hinzulegen. Sie streichelt den Kopf, die Ohren, ein Auge zittert, das Lid hebt sich, und Ida weiß, dass die Hündin sie erkannt hat.
Sie kehrt zum Tisch zurück und schlägt das Telefonbuch auf, das seit gestern hier liegt, als hätten sie es extra für sie zurechtgelegt. Sie wird noch einmal anrufen, erst bei der Polizei, dann bei der Straßenwacht. Bei der Arbeit. Sie wird auch bei Maja anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Und sie wird Ingrid anrufen. Sie wird sagen: Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich hab einen Unfall gehabt. Ich bin gegen einen Baum geprallt, hab das Auto kaputt gefahren. Rums. Hahaha. Mir ist nichts passiert, ich fühle mich nur ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Ich habe bei zwei alten Leuten Unterkunft gefunden, hier bleibe ich, bis ich alles erledigt habe, bis spätestens morgen. Sie sind sehr nett, sie haben eine Hühnerfarm oder so. Abgesehen davon ist alles in Ordnung. Taratatata. Ida spürt plötzlich einen wohltuenden Energieschub, als wäre sie endlich aus dem quälenden Halbschlaf erwacht.
In diesem Augenblick fährt ein Auto vor, dieser Diesel, der hellblaue Lieferwagen des Enkels. Türenschlagen. Ida hört die Stimmen der drei. Sie schaut aus dem Fenster und sieht Adrian, er öffnet die Hintertür des Lieferwagens und zieht Kisten heraus, lange Kisten mit Löchern im Deckel, ähnlich wie die, in denen man Hühner transportiert. Vorsichtig tragen sie eine nach der anderen durch das dunkle Tor. Dann verschwinden die drei im Innern der Scheune.
Der Nebel hat sich aufgelöst, sanft, freigiebig und großherzig scheint die Sonne. An den Dachrinnen haben sich kleine Eiszapfen gebildet, die wie Messerklingen glänzen. Bald wird es warm, vielleicht fängt nun wirklich der Frühling an. Ida geht an das andere Fenster. Der Berg erhebt sich über dem grauen Baumbestand, der von der Last des Schnees niedergedrückt wird. Der Berg erhebt sich in vollkommener Symmetrie, er ist fast kahl, bis auf die weißen Sprenkel der Birken. Ein spiralförmig aufsteigender Weg zieht zwei dünne Linien durch den Birkenwald. Ja, jetzt sieht man, dass es eine Halde ist, auf der rechten Seite ragen noch die Metallteile der früheren Bahn auf, über die die Wagen fuhren und einen Berg aus dem aufschütteten, was aus der Erde geholt worden war und als unbrauchbar galt. Dieser Berg musste demnach seine unterirdische Entsprechung haben, sein Gegenstück, eine Bergmulde, einen leeren Raum. Ida stellt ihn sich in genau dieser Kegelform vor, umwunden von der aufsteigenden Wegspirale, nur dass dort, unter der Erde, der Gipfel nach unten zeigt und der Weg hinabführt, anstatt sich hinaufzuwinden. Dieser unterirdische Gegenberg ist aus Leere gebaut und strebt zum Inneren der Erde, er hängt von der Unterseite der Erdoberfläche wie ein Tropfen Nichts, wie ein Stalaktit aus Leere. Wer an den Hängen der Halde hinaufsteigt, geht gleichzeitig nach unten, er ist zwei Personen. Der Körper steigt am Hang des Positivs nach oben, dem Himmel zu, der Körperlose, der aus Leere besteht, strebt nach unten, der Erdmitte zu.