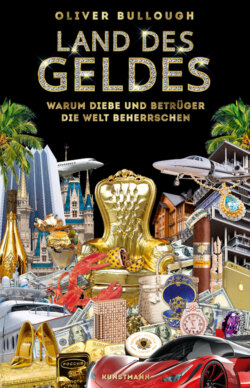Читать книгу Land des Geldes - Oliver Bullough - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 UNTER PIRATEN
ОглавлениеNACH DEM ERSTEN WELTKRIEG funktionierte die Welt ungefähr so wie heute, wenn auch mit weniger technischer Raffinesse. Das Geld floss mehr oder weniger nach dem Belieben seiner Besitzer zwischen den Ländern hin und her, und auf der Suche nach Erträgen brachte es Währungen und Wirtschaften aus dem Gleichgewicht. Die Reichen wurden reicher, während die Wirtschaft vor die Hunde ging. Deshalb verdanken wir den Dreißigerjahren sowohl Zärtlich ist die Nacht als auch Früchte des Zorns, sowohl Lust und Laster als auch Erledigt in Paris und London. Das Chaos führte schließlich zur Machtübernahme von Diktatoren in Deutschland und anderen Ländern, zu einer Spirale aus Währungsabwertungen und Zinserhöhungen, zu Handelskriegen und schließlich zu den Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit seinen Abermillionen Toten.
Nach dem Willen der Alliierten sollte es nie wieder so weit kommen. 1944 trafen sie sich daher zu einer Konferenz im Wintersportort Bretton Woods in New Hampshire, um die Einzelheiten einer internationalen Währungsordnung auszuhandeln und unkontrollierte Geldströme ein für alle Mal abzustellen. Damit sollte verhindert werden, dass Staaten den Handel als Waffe gegen ihre Nachbarn missbrauchten und Banker mit der Aushöhlung der Demokratie Geschäfte machten. Die erzwungene Stabilität sollte Kriege in Zukunft schon im Vorfeld verhindern und ein neues System des Friedens und der Stabilität schaffen. Die Alliierten blickten auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück, die sich (zumindest im Westen) durch freien Handel und eine stabile Weltordnung auszeichnete. Damals basierte das Währungssystem auf dem Goldstandard. Der Wert einer Währung hing von der Größe der Goldreserven eines Landes ab, die mit dem Handelsvolumen wuchsen oder schrumpften, sich damit auf die Geldmenge und Preise auswirkten und das Gleichgewicht erhielten.
Allerdings ließ sich der alte Goldstandard nicht wiederbeleben, denn 1944 befand sich der Großteil der weltweiten Goldvorräte in den Vereinigten Staaten. Also mussten sich die Delegierten etwas anderes ausdenken. Der britische Vertreter John Maynard Keynes sprach sich für eine neue internationale Währung aus, an die alle anderen Währungen geknüpft sein sollten. Sein amerikanischer Kollege Harry Dexter White war jedoch skeptisch: Er wollte nicht hinnehmen, dass der Dollar seine Stellung als wichtigste Währung der Welt verlor. Da die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt das einzige zahlungsfähige Land der Welt waren, setzte er sich schließlich durch: Alle Währungen wurden an den Dollar geknüpft, und der wiederum basierte auf Gold. Eine Unze Feingold sollte 35 Dollar kosten.
Soweit der Grundgedanke des Systems. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten verpflichtete sich, jeder ausländischen Regierung, die mit 35 Dollar in der Hand anklopfte, eine Unze Gold zu geben. Außerdem wollten die Vereinigten Staaten Dollar in ausreichender Menge bereitstellen, um den internationalen Handel zu ermöglichen, und genug Gold vorhalten, damit der Dollar seinen Wert behielt. Man brauchte keine Edelmetalle, wenn der Dollar Gold wert war.
Auch die anderen Länder machten Zusagen. Wenn sie ihre Währung auf- oder abwerten wollten, würden sie dazu die Zustimmung eines neuen Organs einholen, das den Namen Weltwährungsfonds erhielt. Damit sollte verhindert werden, dass Diktatoren ihre Währung manipulierten, um ihre Nachbarn in den Ruin zu treiben und Konflikte zu schüren. Um zu verhindern, dass Spekulanten das System der festen Wechselkurse angriffen, wurden grenzüberschreitende Geldströme stark reglementiert. Man konnte Geld im Ausland anlegen, aber ausschließlich in Form langfristiger Investitionen, nicht zur kurzfristigen Spekulation mit Währungen oder Staatsanleihen.
Stellen Sie sich zur Veranschaulichung einen Öltanker vor. Wenn das Schiff nur einen einzigen großen Tank hat, dann kann das Öl in immer größeren Wogen hin und her schwappen, bis es das gesamte Schiff zum Kentern bringt. Dieses Bild steht für das System nach dem Ersten Weltkrieg, als die Wellen des spekulativen Geldes zum Untergang der Demokratien beitrugen. In Bretton Woods erfanden die Delegierten nun ein neues Schiff, in dem das Öl auf viele kleinere Tanks verteilt war, wobei jeder Tank für ein Land stand. Die Ölmenge blieb dieselbe, sie wurde nur anders verteilt. Die Flüssigkeit konnte in den kleinen Tanks herumschwappen, aber dort würde sie nicht mehr genug Schwung entwickeln, um das ganze Schiff zu gefährden. Und wenn ein Tank ein Leck bekam, dann wäre nicht mehr die gesamte Fracht bedroht. Es war möglich, Öl von einem Tank in den anderen zu pumpen, aber dazu war die Erlaubnis des Kapitäns erforderlich, und das Geld musste durch die offiziellen Pumpen des Schiffs gepumpt werden (womit die Metapher endgültig an ihre Grenzen stößt).
Wer die Finanzwelt kennt, wie sie sich seit den 1980er-Jahren darstellt, der kann sich das System von Bretton Woods kaum vorstellen, denn seither hat sich die Finanzwelt von Grund auf verändert. Unentwegt fließt Geld von einem Land ins andere, auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten in China, Brasilien, Russland oder wo auch immer. Ist eine Währung überbewertet, dann spüren die Investoren ihre Schwäche und umkreisen sie wie Haie einen kranken Wal. In globalen Krisenzeiten flüchtet sich das Geld in sichere Häfen wie Gold oder amerikanische Staatsanleihen. Zu Boomzeiten bläht es anderswo die Börsenkurse auf und sucht rastlos nach besseren Erträgen. Die Wellen des flüssigen Kapitals sind so gewaltig, dass sie selbst starke Staaten fortreißen könnten. Konzertierte Angriffe von Spekulanten auf den Euro, den Rubel oder das Pfund, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, wären unter dem System von Bretton Woods unvorstellbar gewesen, denn das war darauf ausgelegt, genau so etwas zu verhindern.
Eine der vielleicht besten Beschreibungen dieses längst vergessenen Währungssystems stammt aus dem James Bond-Roman Goldfinger von Ian Fleming, der 1959 erschien. Der gleichnamige Film hat eine andere Handlung, doch in beiden geht es um einen sowjetischen Agenten, der das westliche Finanzsystem zum Einsturz bringen will, indem er sich an den Goldreserven vergreift. Im Roman schickt »M«, der Chef des britischen Geheimdienstes, Bond zur Bank von England, wo dieser einen Colonel Smithers kennenlernt (»Colonel Smithers sah exakt so aus, wie man sich jemanden mit dem Namen Colonel Smithers vorstellen würde«). Smithers soll verhindern, dass Gold aus England ins Ausland geschmuggelt wird.
»Gold und goldgestützte Währungen sind das Fundament des internationalen Finanzgeschäfts«, erklärt Smithers 007. »Wir wissen nur, wie stark das Pfund ist, und andere Länder wissen das nur, wenn wir wissen, wie viele echte Werte hinter unserer Währung stehen.« Das Problem ist nur, dass die Bank von England nicht bereit ist, mehr als 1000 Pfund für einen Goldbarren zu zahlen, was dem Preis von 35 Dollar pro Unze in den Vereinigten Staaten entspricht, und das, obwohl das Gold in Indien, wo die Nachfrage nach Goldschmuck hoch ist, 70 Prozent mehr einbringt. Es ist daher extrem gewinnträchtig, Gold außer Landes zu schmuggeln und im Ausland zu verkaufen.
Der Schurke Auric Goldfinger hat einen teuflischen Plan: Er will alle Pfandleiher in ganz Großbritannien aufkaufen, den Goldschmuck der Briten horten, ihn zu Tafeln schmelzen, diese in seinen Rolls-Royce einbauen, damit in die Schweiz fahren, sie dort umschmelzen und dann nach Indien bringen. Damit will er nicht nur die britische Währung und Wirtschaft untergraben, sondern mit den Gewinnen will er gleichzeitig Kommunisten und andere Missetäter finanzieren. Ein Sechstel der 3000 Mitarbeiter der Bank von England hat die Aufgabe, Betrügereien wie diese zu verhindern, erklärte Smithers, doch Goldfinger sei einfach zu gerissen für sie. Inzwischen sei er der reichste Mann Großbritanniens, in einem Banktresor auf den Bahamas stapele er Goldbarren im Wert von 5 Millionen Pfund.
»Das Gold gehört England, oder zumindest das meiste davon. Die Bank kann nichts dagegen unternehmen. Deswegen wollen wir, dass Sie Mr. Goldfinger das Handwerk legen, Mr. Bond, und das Gold zurückholen. Sie haben von der Währungskrise und den hohen Zinsen gehört? Natürlich. Also, England braucht das Gold dringend, je schneller umso besser.«
In dieser etwas langatmigen, aber unverzichtbaren Einleitung (Spoiler-Warnung: Bond schafft es tatsächlich, Goldfinger zu überwinden, doch zuvor legt er sich mit der Mafia von Chicago an, verhindert einen Überfall auf Fort Knox und verführt eine Lesbe, »die sich vorher noch nie mit einem Mann getroffen hat«) wirft Colonel Smithers eine philosophische Frage auf, die uns in das Innerste des Systems von Bretton Woods führt. Aus heutiger Sicht könnte man Goldfinger nichts zur Last legen, außer vielleicht, dass er Steuern hinterzieht. Er kauft das Gold zu einem Preis, den die Kunden akzeptieren, und verkauft es auf einem anderen Markt, auf dem sie mehr zu zahlen bereit sind. Es war sein Geld. Es war sein Gold. Er ölte das Getriebe des Handels und investierte das Kapital in effizienter Weise da, wo es den größten Ertrag erbrachte, oder etwa nicht?
Nein, denn so funktionierte Bretton Woods nicht. In den Augen von Colonel Smithers gehörte dieses Gold eben nicht nur Goldfinger, sondern auch Großbritannien. Für das System war der Besitzer des Geldes nicht der Einzige, der darüber zu entscheiden hatte, was damit passierte. Nach den ausgeklügelten Regeln hatten auch die Nationen, die das Geld ausgaben und seinen Wert hüteten, ihre Rechte daran. Um eine Wiederholung der Schrecken der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs zu verhindern, hatten die Alliierten in Bretton Woods beschlossen, dass beim internationalen Handel das Recht der Gesellschaft über dem der Reichen stand.
Das war nur eine von vielen Vorkehrungen, die in den Dreißiger- und Vierzigerjahren getroffen wurden, um Vollbeschäftigung, Stabilität und Wohlstand zu sichern. In den Vereinigten Staaten schob die Gesetzgebung des New Deal der Spekulation einen Riegel vor, und in Großbritannien und anderen westlichen Ländern garantierte der Wohlfahrtsstaat die medizinische Versorgung und kostenlose Schulbildung für alle. Diese Neuerungen waren erstaunlich erfolgreich: Während der Fünfziger- und Sechzigerjahre erlebte der Westen ein nahezu ungebrochenes Wirtschaftswachstum, die Infrastruktur und Volksgesundheit verbesserten sich dramatisch. Das war allerdings nicht ganz billig und wurde mit Steuergeldern finanziert: Beatlesfans erinnern sich an George Harrisons »Taxman«, den Steuereintreiber, der 19 Shilling einsteckte und ihm nur einen einzigen ließ. Das entsprach tatsächlich ziemlich genau dem, was das Finanzamt von den Einnahmen der Beatles behielt. Für die Reichen war es nicht einfach, ihr Geld vor dem Zugriff des Finanzamts in Sicherheit zu bringen – dank der Einzeltanks des Öltankers. Steuern ließen sich kaum vermeiden, es sei denn man wechselte den Wohnsitz (wie die Rolling Stones, die nach Frankreich zogen, um Exile on Main Street aufzunehmen).
Was man von dem innovativen Tanker hielt, hing davon ab, ob man zu den Leuten gehörte, die Steuern zahlten, oder zu denen, die in den Genuss eines noch nie da gewesenen Lebensstandards kamen. Die Beatles und die Rolling Stones konnten dem jedenfalls nicht viel abgewinnen, genauso wenig wie Rowland Baring, ein Spross der Dynastie der Barings Bank, Dritter Earl von Cromer und von 1961 bis 1966 Direktor der Bank von England. »Die Kontrolle der Wechselkurse stellt einen Eingriff in die Rechte der Bürger dar«, schrieb er 1963 an die britische Regierung. »Daher halte ich sie für ethisch falsch.« Seiner Ansicht nach sollten die Bürger mit ihrem Geld machen können, was sie wollten, und die Regierung dürfe ihre Rechte, dieses Geld im Ausland anzulegen, nicht beschneiden. Den neuen Öltanker hielt er für einen Irrweg. Kapitäne sollten das Öl nicht daran hindern dürfen, dahin zu schwappen, wo sein Besitzer es haben wollte, egal wie sehr es das Schiff beutelte.
»M« sah das interessanterweise genauso. Im Roman Goldfinger erklärt er James Bond, er verstehe gar nicht, wovon Colonel Smithers da rede. »Ich persönlich würde meinen, dass die Stärke des Britischen Pfunds davon abhängt, wie viel wir alle arbeiten, und nicht davon, wie viel Gold wir haben«, sagt er mit der Überheblichkeit eines Mannes, der glaubt, seine Ansichten stünden über der Politik. »Aber diese Antwort ist wahrscheinlich zu einfach für Politiker. Oder eher zu kompliziert.« Diese Ansicht war auch in der City of London verbreitet, wo die Banker glaubten, die Bewertung einer Anlage solle dem Markt überlassen werden, und nicht der Politik.
In der City war diese Ansicht vor allem deshalb so verbreitet, weil das System von Bretton Woods die Verdienstmöglichkeiten der Banker einschränkte. Vor dem Ersten Weltkrieg war das Britische Pfund die wichtigste Währung der Welt gewesen, und die Banker der City hatten mit der Finanzierung des Welthandels gute Geschäfte gemacht. Mit ein bisschen Einsatz und den richtigen Beziehungen konnte man ein gewaltiges Vermögen verdienen. Doch zwei Weltkriege später war Großbritannien verarmt, der Dollar war die neue Leitwährung, und die Banker der City drehten Däumchen.
»Es war, als würde man einen Sportwagen mit 30 Stundenkilometern fahren«, klagte ein Banker über seine Zeit an der Spitze einer britischen Großbank. »Die Banken waren gelähmt. Es war, als würde man im Traum leben.« Die Leute kamen spät zur Arbeit und gingen früh wieder nach Hause, und die Zeit dazwischen vertrödelten sie im Pub. Ein Banker erinnert sich an seine Mittagspausen auf der Themse. Mit der Fähre fuhr er flussabwärts nach Greenwich, aß an Bord Sandwiches und trank Bier, dann nahm er die nächste Fähre zurück, verdrückte noch ein paar Sandwiches, trank mehr Bier, und ging wieder ins Büro. Der Ausflug dauerte zwei Stunden, doch das interessierte niemanden, denn es gab sowieso kaum etwas zu tun. Auf diese Weise kam er wenigstens an die frische Luft. Die Banker der City verdienten nicht viel, aber ihre Arbeit war ja auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Die Banken hielten es für anrüchig, einander die Kunden wegzuschnappen, und die wenigen Kunden, die sie hatten, konnten mit ihrem Geld nicht viel unternehmen. Bis weit in die Sechzigerjahre hinein trug die City die Narben der Bomben, die die Deutschen zwei Jahrzehnte zuvor über der Stadt abgeworfen hatten. In den Ruinen, in denen einst emsige Börsenmakler gewirkt hatten, wuchs das Unkraut und spielten die Kinder. Warum sollte man diese Gebäude auch wiederaufbauen, wenn sie doch zu nichts gebraucht wurden?
Wer die lange Geschichte Londons kannte, dem konnte das nicht gefallen. Noch vor Ankunft der Römer war der Hügel am Nordufer der Themse ein wichtiger Handelsplatz. Die Römer hatten die Sache einfach in geordnete Bahnen gelenkt, als sie hier die Provinzhauptstadt errichtet und Londinium genannt hatten (wenn es Sie interessiert und Sie sonst nichts Besseres vorhaben, können Sie sich ja an einem verregneten Nachmittag im Keller der Guildhall die Ruinen des römischen Amphitheaters ansehen). Es war eine gute Wahl, denn London ist perfekt für den Handel. Die Stadt ist trocken, leicht zu verteidigen und mit Schiffen gut zu erreichen. London blickt hinaus in die Welt, nicht hinein ins Land. Hier können Sie Ihre Fracht löschen und Ihre Waren an die Provinzler aus dem Hinterland verkaufen. Oder Sie können sie an ausländische Kaufleute verkaufen. Die City ist die Schnittstelle zwischen England und dem Rest der Welt. Die Themse und das Meer haben London reich gemacht, und reich zu werden war die Bestimmung Londons. Im Grunde ist London gar nicht die Hauptstadt von England – das ist Westminster, eine ganz andere Stadt weiter flussaufwärts, die zwar räumlich, aber nie geistig mit London zusammengewachsen ist. Westminster verzettelte sich im Kleinkram des britischen Alltags, aber London hatte immer seine eigene Politik und wurde von großen Banken beherrscht, die eher nach Manhattan oder Mumbai blickten als nach Machynlleth oder Maidenhead.
Es waren Londoner Unternehmer, die Indien, Afrika und Nordamerika eroberten, nicht der britische Staat. Sie finanzierten die Eisenbahnen und Dampfschiffe, die Kontinente miteinander verbanden, und sie versicherten die Fracht, die auf ihnen transportiert wurde. Und wenn die City unter den Bestimmungen von Bretton Woods keinen Handel mehr finanzieren, kein Geld mehr verdienen und nicht mehr überall auf der Welt bei Geschäften mitmischen durfte – und so war das in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg –, wozu war sie dann überhaupt noch da?
Das Ärgerliche war nur, dass New York brummte. Viele der Geschäfte, die früher in London abgewickelt wurden – Handelskredite, Versicherungsgeschäfte und alles andere, das man in London als angestammtes Recht ansah –, gingen nun an diese lästigen Emporkömmlinge an der Wall Street. London war zusammengeschrumpft auf das Finanzzentrum Großbritanniens und einer immer kleiner werdenden Zahl von Überseegebieten und ehemaligen Kolonien, die so konservativ waren, dass sie sich an den Sterling klammerten. Das machte keinen Spaß.
Wer heute die Schluchten aus glitzerndem Glas und Stahl sieht oder in der Abenddämmerung zwischen dem Heer der Pendler über die London Bridge geht, kann sich kaum vorstellen, dass London als Finanzzentrum beinahe vor die Hunde gegangen wäre. Aber in den Fünfziger- und Sechzigerjahren kam die City in nationalen Angelegenheiten tatsächlich kaum noch vor. Sozialgeschichten der Swinging Sixties gehen mit keinem Wort darauf ein, was in dem alten römischen Handelslager passierte, was umso seltsamer ist, als sich etwas Bedeutsames zusammenbraute – etwas, das die Welt weit mehr verändern sollte als die Beatles, Alan Sillitoe oder David Hockney, und das die vornehme Zurückhaltung des Systems von Bretton Woods über den Haufen werfen sollte. Hier öffnete sich der Tunnel von Moneyland zum ersten Mal, und die ersten Menschen erkannten, dass am Ende dieses Tunnels eine Menge Geld zu verdienen war.
Als Ian Fleming seinen Roman Goldfinger veröffentlichte, hatten die vermeintlich sicheren Tanks des Öltankers der Weltwirtschaft bereits erste Lecks bekommen. Nicht alle Länder vertrauten darauf, dass die Vereinigten Staaten ihre Selbstverpflichtung ernst nehmen und den Dollar als unparteiische internationale Währung respektieren würden, denn Washington verhielt sich nicht immer wie ein unparteiischer Schiedsrichter. In den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten die Goldreserven des kommunistischen Jugoslawien beschlagnahmt, woraufhin die Länder des Ostblocks ihre Dollars in europäischen Banken hinterlegten, und nicht mehr in New York. Der Weltwährungsfonds, der seinen Sitz in Washington hatte und sich am Gängelband seines größten Anteilseigners befand, weigerte sich, den Wiederaufbau des kommunistischen Polen zu unterstützen. Und als Großbritannien und Frankreich 1956 die Kontrolle über den Suezkanal zurückgewinnen wollten, fror Washington, das den Einsatz ablehnte, ihre Dollarguthaben ein, und damit war die gesamte Aktion beendet. Ein neutraler Schiedsrichter verhält sich anders.
Großbritannien stolperte von einer Krise in die nächste. 1957 hob es seine Zinsen an und verknappte das Pfund, um seine Währung zu stützen (das waren die von Colonel Smithers erwähnte »Währungskrise und die hohen Zinsen«). Weil den Banken der City das Pfund ausging, stiegen sie auf Dollars um; die bekamen sie aus der Sowjetunion, die sie in London und Paris lagerte, um sich vor dem Druck der Vereinigten Staaten zu schützen. Das erwies sich als profitables Geschäft. In den Vereinigten Staaten waren die Zinsen für Dollarkredite gedeckelt, nicht so in London. In den Vereinigten Staaten mussten die Banken einen Teil ihrer Dollars als Reserve vorhalten, nicht so in London. Die Banken hatten ein Loch in den Tanks des Öltankers von Bretton Woods entdeckt: Wenn sie den Dollar außerhalb der Vereinigten Staaten verwendeten, dann hatten die amerikanischen Währungshüter keinen Zugriff, und den britischen Währungshütern war es egal. Diese staatenlosen Dollars – die als »Eurodollar« bezeichnet wurden, vielleicht wegen der »Euro«-Telexadresse, die eine der sowjetischen Banken verwendete – konnten ganz wie früher ungehindert zwischen den Ländern hin und her fließen. Und das Gesetz konnte ihnen nicht folgen.
Die Behörden der Vereinigten Staaten versuchten, dem einen Riegel vorzuschieben. Die Bankenaufsicht eröffnete ein festes Büro in London, um ein Auge auf die britischen Niederlassungen der amerikanischen Banken zu haben. Doch auf der anderen Seite des Atlantiks waren sie zahnlos, denn sie bekamen keine Unterstützung von den Einheimischen. Jim Keogh von der Bank von England, der für die Aufsicht der ausländischen Banken zuständig war, sagte: »Mir ist es egal, ob die Citibank in London amerikanische Regeln umgeht. Das interessiert mich nicht. Wenn die Amerikaner meinen, dass die ihre Gesetze hier in London durchsetzen können, dann wünsche ich ihnen viel Glück.« Einen ausländischen Banker ließ er wissen, er könne in London tun und lassen, was er wolle – »aber nicht auf der Straße und nur, wenn er die Pferde nicht scheu macht«. Im Vergleich zu dem, was die amerikanischen Banken in New York bewegten, waren die Beträge in London überschaubar, doch sie wuchsen jedes Jahr um ein Drittel, und London hatte endlich eine neue Einnahmequelle gefunden.
Etwa zur selben Zeit (wobei kein Zusammenhang besteht, außer vielleicht dass damals die Rebellion in der Luft lag) bekam das britische Publikum einige neue Radiosender zu hören. Damals war die BBC der einzige in Großbritannien zugelassene Sender, und wenn es um Musik ging, war sie hoffnungslos vorgestrig. Die Jugendlichen wollten Nero, Gladiators oder B. Bumble & the Stingers hören und fanden das Programm der BBC öde. Hier sahen einfallsreiche Schiffseigner ihre Chance. Sie gingen außerhalb der britischen Hoheitsgewässer vor Anker, richteten einen Sender ein und übertrugen Popmusik auf die Insel.
Diese Radiostationen wurden bald als »Piratensender« bekannt. Manche nannten sie auch »Offshore-Sender«, was zwar weniger aufregend klingt, dafür aber korrekter ist. Diese Schiffe befanden sich gerade weit genug von der Küste entfernt, um nicht mehr unter die britische Gesetzgebung zu fallen. In den Radioapparaten waren sie zwar genauso anwesend wie die BBC, weil man ihre Sendungen problemlos hören konnte, doch juristisch waren sie abwesend und schwer zu fassen.
Diese Vorstellung von »offshore« – physisch anwesend, aber juristisch abwesend – erwies sich als nützlich, und schon bald wurde der Begriff auch auf Finanztransaktionen angewendet. Die Banken, die mit den unbeaufsichtigten Eurodollars handelten, hatten zwei Arten von Konten. Die einen für die üblichen langweiligen Transaktionen in Pfund, die sich streng an die Regeln hielten – die Onshore- oder Inlandskonten. Und die anderen für den aufregenden neuen Piratenmarkt in Eurodollar, das Öl, das aus den Tanks gelaufen war und nun im Kielraum des Bretton-Woods-Tankers herumschwappte. Diese bezeichnete man als Offshore-Transaktionen, so als fänden sie außerhalb des britischen Hoheitsgebiets statt und als hätten die britischen Gesetze hier keine Gültigkeit. Die beiden Transaktionen wurden zwar an demselben physischen Ort durchgeführt, nämlich in der Londoner City, doch aus juristischer Sicht fand eine an einem Ort statt, an dem die Regeln keine Gültigkeit hatten. Und dieser Gedanke, das »Offshore«-Konzept, demzufolge ein Vermögen zwar physisch anwesend, aber juristisch nicht greifbar ist, steht im Mittelpunkt unserer Geschichte. Denn ohne Offshore gäbe es Moneyland nicht.
Die Offshore-Geschäfte mit den Eurodollars hauchten der Londoner City Ende der Fünfzigerjahre ein wenig frisches Leben ein, aber nicht viel. Die großen Geschäfte wurde immer noch in New York abgewickelt, und das war unerfreulich. Besonders ärgerlich war, dass viele der Kreditnehmer und -geber Europäer waren, dass aber die amerikanischen Banken die fetten Kommissionen für die Geschäfte einstrichen. Europäische Regierungen und Unternehmen brauchten Geld für den Wiederaufbau nach dem Krieg, die Volkswirtschaften wuchsen rasant, und die Londoner Banker sahen nicht ein, warum die Europäer keinen Teil vom Kuchen abbekommen sollten. Ein Banker, der sich ganz besonders ärgerte, war Siegmund Warburg.
Warburg war in der behaglichen Welt der Londoner City ein Außenseiter. Zum einen stammte er aus Deutschland. Und zum anderen hatte er den Gedanken nicht aufgegeben, dass sich Banker aktiv um Geschäfte bemühen sollten. Er hatte kein Interesse daran, sich zurückzulehnen und sein Plätzchen im Kartell der großen Banken der City einzunehmen – er lebte fürs Geschäft. Weil ihm ein Mittagessen nicht ausreichte, um seine Beziehungen zu knüpfen, aß er oft zweimal mit unterschiedlichen Gästen zu Mittag. Er war es auch, der die Idee der feindlichen Übernahme von Unternehmen nach Großbritannien brachte, worüber das feine Establishment pikiert die Nase rümpfte. Warburg reiste viel und webte unermüdlich an seinem Netzwerk. Im Jahr 1963 erfuhr er von einem Freund bei der Weltbank, dass rund 3 Milliarden Dollar außerhalb der Vereinigten Staaten zirkulierten und nur darauf warteten, genutzt zu werden. Davon wollte Warburg eine Scheibe abhaben. In den Zwanzigerjahren hatte er in Deutschland mit Schuldverschreibungen in Fremdwährungen gehandelt – warum sollte er das nicht wieder tun?
Schuldverschreibungen sind langfristige Anleihen, bei denen ein Kreditnehmer Geld zu einem festen Zinssatz aufnimmt und am Ende eines vereinbarten Zeitraums zurückzahlt. Für Unternehmen und Staaten sind sie ein wichtiges Finanzierungsinstrument. Wenn ein Unternehmen eine Anleihe in Dollar aufnehmen wollte, musste es dies in New York tun. Warburg wusste jedoch, wo sich ein erheblicher Teil dieser 3 Milliarden Dollar befand, nämlich in der Schweiz. Nun fragte er sich, ob er nicht einen Weg finden konnte, um dieses Geld für sich arbeiten zu lassen.
Damals lag viel Geld in der Schweiz. Seit den Zwanzigerjahren, als Frankreich seinen Spitzensteuersatz auf 72 Prozent anhob, machten die Schweizer gute Geschäfte damit, Bargeld und Anlagen von Ausländern aufzunehmen, die ihr Vermögen vor dem Zugriff durch das Finanzamt ihres Landes schützen wollten. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte sich die Summe verzehnfacht, bis schließlich 2,5 Prozent des gesamten Privatvermögens der Kontinentaleuropäer in der Schweiz lag. Die Kunden kamen überwiegend aus Frankreich und Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die guten Zeiten weiter, und Anfang der Siebzigerjahre lagen bereits 5 Prozent des Privatvermögens der Europäer auf Schweizer Konten. Man packte sein Bargeld in den Kofferraum, fuhr nach Zürich oder Genf, übergab die Scheine einem diskreten Kassierer und fuhr wieder nach Hause. »Für reiche Europäer, die Steuern hinterziehen wollten, war die Situation dieselbe wie in den Zwanzigerjahren: Das Land, das den Schutz eines Bankgeheimnisses bot, war die Schweiz«, schrieb der französische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman 2015 in seinem Buch Steueroasen, das die Rolle der Schweiz bei der Geburt von Moneyland beleuchtet.
Das war kein Geheimnis. Im Tim-und-Struppi-Band Flug 714 nach Sydney aus dem Jahr 1968 entführt der Erzbösewicht Roberto Rastapopoulos einen Millionär, um ihm Einzelheiten zu seinem Schweizer Geheimkonto abzupressen: »Ich kenne den Namen der Bank. Ich kenne den Namen, auf den das Konto läuft. Ich habe ein paar großartige Muster der falschen Unterschrift, die Sie benutzen«, sagt Rastapopoulos zu dem Entführten. »Nur die Kontonummer kenne ich nicht, und die werden Sie mir jetzt verraten.« Es folgt das vielleicht verrückteste Abenteuer von Tim und Struppi, an dem unter anderem ein Wahrheitsserum, ein Vulkanausbruch, Außerirdische und Telepathie beteiligt sind. Es ist kein Zufall, dass inmitten des Irrsinns die Kontonummer geheim bleibt. Damit hätte die Geschichte ja auch jede Glaubwürdigkeit verloren: Es handelte sich schließlich um die Schweiz, die das Bankgeheimnis seit 1934 gesetzlich garantierte. Das Geheimnis der Schweizer Nummernkonten war so gut gehütet, dass nur drei Personen die Eigentümer kannten: zwei Bankangestellte und der Eigentümer selbst. Wenn es schon zu Comicautoren durchgedrungen war, dass Steuerhinterzieher in der Schweiz gewaltige Mengen an Bargeld horteten, dann hatten ehrgeizige Londoner Banker erst recht davon gehört.
»Die Reichen und die Berühmten, die Bösen und die Hässlichen, Geheimagenten und Mafiosi nutzten die Nummernkonten, um Geld vor Frauen, Ehemännern und Geschäftspartnern zu verbergen, kleine Kriege zu führen und Drogenkartelle zu finanzieren«, schrieb Bradley Birkenfeld, ein ehemaliger Schweizer Banker, von dem noch mehr zu hören sein wird. »Dass man den Schweizern für das Privileg, ein Nummernkonto zu besitzen, eine Pauschalgebühr bezahlen musste und auf das Geld keinen Cent Zinsen erhielt, war Nebensache. Das Guthaben war ganz allein den Träumen der Kontoinhaber vorbehalten, sicher verstaut unter Schweizer Stahlmatratzen.«
Für einen Londoner Banker der frühen Sechziger war das verlockend: In der Schweiz lag dieses ganze Geld herum und tat nicht viel, und genau das brauchte man, um wieder Anleihen verkaufen zu können. Wenn Warburg an dieses Geld herankommen, es verpacken und verleihen konnte, dann war er im Geschäft. Diese Leute bezahlten Schweizer Banker, damit sie auf ihr Geld aufpassten – es konnte doch nicht schwer sein, sie davon zu überzeugen, dass sie es vermehren konnten, indem sie seine Anleihen kauften? Zumal dieses Einkommen steuerfrei wäre. Und es konnte doch nicht so schwer sein, europäische Unternehmen davon zu überzeugen, sich Geld bei ihm zu leihen, statt die teuren Gebühren zu zahlen, die in New York fällig wurden?
Es gab allerdings ein Hindernis: das Nachkriegssystem, der Öltanker mit seinen separaten Tanks, die verhindern sollten, dass Geld zu Spekulationszwecken von einem europäischen Land ins andere floss. Wie konnte Warburg dieses Geld aus der Schweiz zu seinen Kunden in anderen Ländern bringen? Mit dieser Aufgabe beauftragte er zwei seiner besten Männer.
Sie nahmen die Verhandlungen im Oktober 1962 auf. Im selben Monat sprangen die Beatles mit ihrer ersten Single »Love Me Do« in den britischen Charts auf Platz 17 – für ein Debüt ganz nett, aber nicht spektakulär. Die Banker unterzeichneten den Vertrag am 1. Juli des folgenden Jahres, dem Tag, an dem die Pilzköpfe ihre Single »She Loves You« aufnahmen und die weltweite Beatlemania ihren Anfang nahm. In diesen außergewöhnlichen neun Monaten wurde nicht nur die Popmusik auf den Kopf gestellt, sondern auch die Weltpolitik, denn in diese Zeit fiel die Kubakrise und John F. Kennedys Ausspruch »Ich bin ein Berliner«. Unter diesen Umständen ist es verzeihlich, wenn niemand mitbekam, dass nebenbei auch in der internationalen Finanzwelt ein neues Zeitalter angebrochen war.
Warburgs neue Anleihen – die Eurobonds, wie sie in Anlehnung an die Eurodollars hießen – wurden unter Leitung von Ian Fraser ausgegeben, einem schottischen Kriegshelden, der erst Journalist, dann Banker geworden war. In seiner lesenswerten Autobiografie The High Road to England legt er in bemerkenswerten Einzelheiten dar, wie viele bürokratische Hürden er zu überwinden hatte, um die Vision seines Chefs zu verwirklichen. Er und sein Kollege Peter Spira mussten Möglichkeiten finden, den Steuern und Kontrollen den Zahn zu ziehen, die verhindern sollten, dass heißes Geld über die Grenzen floss. Außerdem mussten sie für ihr Produkt geschickt verschiedene Aspekte nationaler Regelwerke miteinander verbinden.
Da bei einer Ausgabe der Anleihen in Großbritannien eine Steuer von vier Prozent fällig geworden wäre, gab Fraser die Papiere formell im Amsterdamer Flughafen Schiphol aus. Wenn die Zinsen in Großbritannien ausgezahlt worden wären, dann wäre ebenfalls Steuer fällig geworden, weshalb Fraser dafür sorgte, dass sie in Luxemburg gezahlt wurden. Obwohl die Anleihen in Großbritannien weder ausgegeben noch ausgezahlt wurden, brachte er die Londoner Börse dazu, sie zuzulassen. Er beschwatzte die Zentralbanken Frankreichs, der Niederlande, Schwedens, Dänemarks und Großbritanniens, die die Auswirkungen der Eurobonds auf die Währungskontrolle zu Recht mit Sorge betrachteten. Und schließlich tat er so, als sei der Kreditnehmer die staatliche italienische Autobahngesellschaft Autostrade, obwohl es sich in Wirklichkeit um die staatliche Beteiligungsgesellschaft IRI handelte. IRI hätte als Kreditnehmer eine Quellensteuer abführen müssen, Autostrade dagegen nicht.*
Mit seinen juristischen Taschenspielereien schuf Fraser eine Anleihe, die gute Zinsen abwarf, auf die keine Steuern fällig wurden und die sich überall wieder zu Geld machen ließen. Das war Offshore in höchster Vollendung. »Das Geheimnis war, dass die Anleihen anonym waren, dass keine Steuern fällig wurden, und dass sie nach Fälligkeit ausgezahlt wurden, ohne dass jemand Fragen stellte«, schrieb er. Es handelte sich um sogenannte Inhaberschuldverschreibungen, das heißt, es war nicht auf einen Namen ausgestellt. Wer das Papier hatte, dem gehörte es, und der Eigentümer wurde nirgends namentlich registriert. Frasers Eurobonds waren reine Zauberei. Vor ihrer Erfindung konnte man mit den Guthaben auf Schweizer Nummernkonten nicht viel anfangen. Nun konnte man diese fantastischen Anleihen kaufen, und verdiente Geld, ohne Steuern dafür zahlen zu müssen.
Ein derart ehrgeiziges Projekt hatte die Londoner City seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen, und einen Moment lang sah es so aus, als würde es an einer Lappalie scheitern: Niemand erinnerte sich, wie die komplizierten Platten gestochen wurden, mit denen Inhaberschuldverschreibungen gedruckt wurden. Zum Glück konnte man zwei Tschechen auftreiben, die das noch wussten, und dann mussten die Papiere nur noch von den Direktoren der Bank unterschrieben werden. »In Brüssel gab es eine Signiermaschine mit zwölf Federhaltern, mit der man zwölf Zertifikate auf einmal unterzeichnen konnte«, erinnerte sich Spira später. »Aber die Bank musste drei oder vier Leute eine Woche lang nach Luxemburg schicken, um die Papiere zu unterzeichnen. Da sehen Sie mal, wie bescheuert die Bürokratie damals war.«
Und wer kaufte Frasers magische Erfindung? Das war ein Geheimnis, denn die Verkäufe wurden vor allem von Schweizer Banken abgewickelt, die die Namen ihrer Kunden nicht preisgaben. Fraser hatte jedoch eine ungefähre Vorstellung. »Die wichtigsten Käufer waren Einzelpersonen, vor allem aus Osteuropa, aber auch aus Lateinamerika, die einen Teil ihres Vermögens in transportabler Form anlegen wollten. Für den Fall, dass sie eilig wegmussten, wollten sie die Scheine in einem Köfferchen mitnehmen können«, schrieb er. »Damals wollten noch immer viele der überlebenden Juden aus Osteuropa nach Israel und in den Westen auswandern. Dazu kamen die üblichen gestürzten südamerikanischen Diktatoren. Sie alle hatten ihr Geld in der Schweiz.«
Spätere Historiker versuchten, Frasers Darstellungen die Spitze zu nehmen, und behaupteten, die »gestürzten südamerikanischen Diktatoren« hätten lediglich ein knappes Fünftel der ersten Anleihen gekauft. Doch Fraser selbst hatte seine Darstellung schon verharmlost; die gestürzten Diktatoren mochten in Südamerika leben, doch das war nicht unbedingt ihre Heimat. Anfang der Sechzigerjahre lebten in Südamerika noch viele Menschen, die sich während des Zweiten Weltkriegs an der Plünderung Europas beteiligt, ihre Beute in der Schweiz versteckt und sich dann nach Argentinien abgeseilt hatten. Für die nationalsozialistischen Kriegsverbrecher muss es schon frustrierend gewesen sein, ihr Raubgut in der Schweiz zu haben und keine Zinsen dafür zu bekommen. Dank Ian Fraser hatten sie nun die Möglichkeit, ihr Geld risikolos und steuerfrei für sich arbeiten zu lassen.
Die verbleibenden vier Fünftel der Schuldverschreibungen wurden von den üblichen Steuerhinterziehern gekauft – den »belgischen Zahnärzten«, wie die Banker sie nannten: gut verdienende Freiberufler, die einen Teil ihres Einkommens nach Luxemburg oder Genf gebracht hatten und sich über diese hübsche Anlagemöglichkeit freuten. Fraser konnte nicht so tun, als verwundere ihn das. In seinen Memoiren erinnerte er sich daran, wie »Onkel Eric« – Eric Korner, einer von Warburgs leitenden Bankern – einen Broker in Zürich hatte, den er immer anrief, wenn ein Unternehmen bessere Nachrichten zu verkünden hatte als erwartet. Korner stieg ein, ehe der Rest des Marktes davon erfuhr, verdiente auf Kosten seiner Klienten steuerfreies Schwarzgeld und vergrößerte zugleich den Schweizer Topf, mit dem neue Anleihen gekauft werden konnten.
Das ist der Eingang zum Tunnel von Moneyland. Das Spiel geht so: Erst beschafft man Geld (ob gestohlen, unversteuert oder einfach nur verdient), dann versteckt man es, dann gibt man es aus. Früher waren nur zwei dieser drei Schritte möglich, aber nicht alle drei: Man konnte Geld beschaffen und ausgeben, doch das war riskant. Man konnte Geld beschaffen und verstecken, aber dann lag es in der Schweiz fest und man hatte nichts davon. Moneyland setzt das Vermögen frei, und es spielt keine Rolle, woher es kommt: Man kann es bis in alle Ewigkeit stehlen, verstecken und ausgeben. Das ist das schmutzige Geheimnis der Eurobonds. Möglich wurde das Ganze durch die moderne Kommunikation: erst das Telegramm, dann das Telefon, schließlich Telex und Fax, und heute E-Mail. Das ist die Schattenseite der Revolution der Nützlichkeit, die wir als Globalisierung bezeichnen.
Das heißt nicht, dass es nicht Menschen mit einem berechtigten Wunsch nach Anonymität gibt. Wie Fraser klarmacht, waren unter den ersten Kunden auch europäische Juden, die ihr Vermögen vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht hatten und nun eine Möglichkeit sahen, ein paar Zinsen damit zu verdienen. Doch die Anonymität und Übertragbarkeit war nicht nur für Holocaust-Überlebende attraktiv, sondern auch für Zahnärzte in Antwerpen, Insiderhändler in London und Altnazis in Buenos Aires. In der Schweiz kam das rechtmäßige scheue Geld in einen Topf mit dem dreisten Schwarzgeld und mit dem kriminellen Raubgut. Die Eurobonds waren eine bequeme Geldanlage für alle, die Geld verstecken wollten, egal woher es kam.
Damit war der Zaubergarten von Moneyland eröffnet. Clevere Londoner Banker hatten ein virtuelles Land für Reiche geschaffen, in dem die Gesetze keine Gültigkeit hatten, egal woher man kam, und egal woher das Geld kam. Gewöhnlichen Belgiern zog der Staat die Steuern gleich vom Monatsgehalt ab, aber Zahnärzte mit einem Schweizer Nummernkonto konnten diese Steuern nicht nur umgehen, sondern das gesparte Geld auch noch verzinsen. Die geplünderten Osteuropäer mussten schuften, um ihr Land wiederaufzubauen, während die Altnazis nicht nur das Raubgut behielten, sondern auch noch ein hübsches Sümmchen damit verdienten.
Die Tatsache, dass Steuersünder der Ersten und Kleptokraten der Dritten Welt gemeinsam in Moneyland leben, macht es besonders schwer, dagegen vorzugehen, wie wir noch sehen werden. Das haben wir Ian Fraser und seinen Kollegen bei Warburg zu verdanken.
Die erste Ausgabe der Schuldverschreibungen belief sich auf lediglich 15 Millionen Dollar. Aber sobald klar war, wie man die Hindernisse auf dem Weg des Offshore-Geldes umgehen konnte, war der Weg frei für neue Anleihen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1963 wurden Eurobonds in Höhe von 35 Millionen Dollar verkauft. 1964 waren es 510 Millionen, 1967 überstieg der Betrag erstmals die Milliarde, und heute ist es einer der größten Märkte der Welt. Selbst amerikanische Unternehmen kehrten New York mit seinen lästigen Regeln den Rücken und gaben Eurobonds aus, auch wenn sie sich dazu neue Tricks ausdenken mussten, um staatliche Bemühungen zur Eindämmung des heißen Geldes zu umgehen. Ein günstiges Steuerabkommen zwischen den Niederlanden und den Vereinigten Staaten erlaubte es amerikanischen Unternehmen, durch ausschließlich zu diesem Zweck eingerichtete Niederlassungen auf den Niederländischen Antillen in der Karibik Kredite aufzunehmen, sodass sie keine Steuern zahlen mussten.
Aber was bedeutete das für die sauber getrennten Tanks des Öltankers von Bretton Woods? Es war so, als hätten die Eigentümer des Öls ihre eigenen Pumpen eingerichtet und könnten nun ohne Erlaubnis und Wissen des Kapitäns das Öl von einem Tank zum anderen pumpen. Doch hier versagt die Metapher, denn Geld ist nicht gleich Öl. Die Dollars entkamen nach Offshore, wo sie der Aufsicht und Besteuerung durch die Regierung der Vereinigten Staaten entgingen. Aber es waren immer noch Dollars, und 35 Dollar waren immer noch eine Unze Gold wert. Die Probleme, die in der Folge aufkamen, hingen damit zusammen, dass sich Dollars nicht wie Öl verhalten. Wenn man das Öl nicht verwendet, ist es einfach da und macht nichts. Aber Dollars vermehren sich.
Wenn ich einen Dollar auf die Bank bringe, dann verwendet ihn die Bank als Sicherheit für einen Dollar, den sie an jemand anderen verleiht, das heißt, aus einem Dollar werden zwei. Und wenn der Kreditnehmer seinen Dollar auf eine andere Bank bringt, verwendet diese ihn als Sicherheit für neue Kredite, und das Geld vermehrt sich weiter. Aber da jeder Dollar eine feste Menge an Gold wert war, hätten die Vereinigten Staaten immer mehr Gold kaufen müssen, um die wachsende Dollarmenge zu decken. Aber dieses Gold hätten sie wieder mit Dollars bezahlen müssen, das heißt, sie hätten noch mehr Dollars in Umlauf gebracht, die sich wieder vermehrten, weshalb die Vereinigten Staaten wieder mehr Gold kaufen müssten, und so weiter, bis das System schließlich zusammenbrechen würde. Die Bemühungen waren fruchtlos: Mit dem Offshore-Banking konnte es nicht mithalten. Das ist so, als würde das Öl im Tanker nicht nur heimlich von einem Tank in den anderen gepumpt, sondern als würde sich das Volumen dabei jedes Mal verdoppeln.
Vielleicht ahnen Sie schon, was das bedeutet. Ausländische Regierungen hatten das Recht, Gold zu 35 Dollar pro Unze zu kaufen, doch die Dollarmenge wurde immer größer, während die Goldmenge konstant blieb. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage musste früher oder später ein Schwarzmarkt entstehen, so wie es in jeder Diktatur, die den Wechselkurs kontrollieren will, einen schwarzen Währungsmarkt gibt. Eine ausländische Regierung konnte Gold für 35 Dollar pro Unze kaufen, und es dann auf dem freien Markt für Eurodollars weiterverkaufen. Mit diesen Eurodollars konnte es neues Gold kaufen und auf dem freien Markt mit Gewinn verkaufen, und so weiter. Es war die Goldfinger-Masche, nur ohne Rolls-Royce und Golfspielen mit 007. Wie viel man damit verdienen konnte, hing davon ab, wie viel Washington zu verlieren bereit war. Der Betrug wurde nur verhindert, weil die Beteiligten bereit waren, nicht von einem derart offensichtlich fehlerbehafteten System zu profitieren.
Die Regierung der Vereinigten Staaten versuchte, den Goldpreis zu schützen, doch mit jeder Einschränkung des Dollarflusses wurde es lohnender, seine Dollars in London anzulegen, was zur Folge hatte, dass immer mehr Geld offshore gelangte und der Druck auf den Goldpreis immer größer wurde. Die Banker folgten dem Dollar. Für amerikanische Banker spielte London bald eine ähnliche Rolle wie China für die amerikanischen Fabrikanten von heute. In der City waren die Regeln lockerer und die Politiker entgegenkommender als an der Wall Street, und das gefiel den Banken. 1964 hatten elf amerikanische Banken ihre Filialen in der Londoner City. 1975 waren es 58. Inzwischen hatte sich Washington längst in das Unvermeidliche gefügt und war nicht mehr bereit, die Unze Gold für 35 Dollar herauszugeben. Es war der erste Schritt auf dem Weg zur allmählichen Demontage der Sicherheitsvorrichtungen von Bretton Woods.
Die philosophische Frage, wem das Geld gehörte – demjenigen, der es verdiente, oder dem Land, das es druckte –, war damit beantwortet. Dank der freundlichen Banker in London und der Schweiz konnten die Besitzer des Geldes damit anstellen, was sie wollten, und kein Staat der Welt konnte sie daran hindern. Wenn sie es versuchten, machten sie die Situation nur schlimmer. Das Geld floss weiter offshore, sosehr die Behörden auch versuchten, es zu stoppen. So lange ein Land die Offshore-Finanz duldete, so wie Großbritannien, so lange waren die Bemühungen aller anderen aussichtslos. (Wenn sie nur auf Keynes gehört und in Bretton Woods eine internationale Währung geschaffen hätten, dann wäre das alles nicht passiert.)
Damit begann die unvermeidliche Spannung zwischen Geld ohne Grenzen und Staaten mit Grenzen. Wenn die Aufsicht an der Landesgrenze endet, das Geld aber überall hinfließen kann, dann können die Besitzer jedem Aufseher ein Schnippchen schlagen. Wenn ein Boxer im Ring bleiben muss, der andere aber nach draußen springen und unentdeckt aus jeder Richtung und ohne Warnung wieder einsteigen kann, dann ist klar, auf welchen der beiden das intelligente Geld setzt.
Es blieb jedoch nicht bei einfachen Eurobonds. Das Muster ließ sich beliebig übertragen. Man wählte ein lukratives Betätigungsfeld, suchte nach einem Land, dessen Gesetz dem entgegenkam – Liechtenstein, die Cookinseln, Jersey –, und richtete dort seine nominelle Zentrale ein. Wenn man kein Land mit passender Gesetzgebung fand, drohte oder schmeichelte man so lange, bis jemand die Regeln in der gewünschten Weise änderte. Warburg machte es vor, als er der Bank von England drohte, wenn sie nicht die Regeln änderte und die Steuern senkte, dann werde er mit seiner Bank eben umziehen, zum Beispiel nach Luxemburg. Und schon wurden die Regeln geändert, und die Abgaben – in diesem Fall eine Kapitalertragssteuer auf Inhaberschuldverschreibungen – wurden abgeschafft.
In aller Welt verliefen die Reaktionen nach vorhersehbarem Muster. Wieder und wieder haben Länder versucht, Unternehmen zurückzuholen, die nach offshore abgewandert waren (so schafften die Vereinigten Staaten zum Beispiel die Kontrollen ab, die Banken umgehen wollten, indem sie nach London zogen), womit das Inland immer größere Ähnlichkeit mit der von Warburg geschaffenen Welt der Offshore-Piraten bekam. Die Politik wurde entgegenkommender, sie senkte Steuern und lockerte Regeln, nur damit sich das rastlose Geld in ihrem Land niederließ und nicht anderswo. Sobald ein Land die Regelungen lockerte, zogen die anderen eilig nach. So läuft das Spiel von Moneyland, die Regeln für die Reichen mit Geld in der Tasche werden immer lascher, nie strenger.
•
Moneyland hat keine Armee, keine Flagge, keine Grenzen und keine der sonstigen Eigenschaften eines Staates. Doch es hat eine Sprache: Es ist die Sprache des Euphemismus. Wenn Sie sich mit den Anwälten und Buchhaltern unterhalten, die Moneyland verwalten, hören Sie Begriffe wie »Nachfolgeplanung«, »Steuerneutralität«, »Kommissionen« und »Beschleunigungszahlungen«. Irgendwann sprechen Sie selbst so.
Aber wie viel Geld verbirgt sich hinter diesen beschönigenden Formeln? Das ist schwer zu sagen: Geld ist unsichtbar und hoch dotierte, fantasiebegabte und intelligente Menschen sorgen dafür, dass das auch so bleibt. Wie die Dunkle Materie lässt es sich nur indirekt durch seine Auswirkungen auf die sichtbare Welt erforschen.
Der französische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman hat das Schweizer Bankwesen untersucht und sich an einer Schätzung versucht. Durch eine Auswertung der statistischen Anomalien, die das Bankgeheimnis bewirkt, schätzt er, dass sich 2014 etwa 8 Prozent des Geldvermögens der Welt in Steueroasen befand: 7,6 Billionen von 95,5 Billionen Dollar. Ein Drittel davon befand sich in der Schweiz, der Rest in Singapur, Hongkong, den Bahamas, Jersey, Luxemburg und einigen anderen Ländern. Nicht eingerechnet sind andere Werte, die sich offshore befinden, zum Beispiel Kunstwerke, Jachten, Immobilien und Schmuck im Wert von weiteren 2 Billionen Dollar. (Dieses Vermögen befindet sich nicht unbedingt in der Schweiz, in Hongkong oder auf den Bahamas. Sie unterstehen lediglich der Rechtsprechung dieser Länder, befinden sich aber räumlich anderswo. Wenn Sie nicht gerade eine Vorliebe für Fudge haben, finden Sie auf Jersey nicht viel, was sich zu kaufen lohnt.)
Als ich Zucman im Berkeley besuchte, wo er unterrichtet, erklärte er mir, diese Anomalien hingen damit zusammen, dass sich Länder gern damit brüsten, wenn ausländisches Geld angelegt wird – Häuser in London, Apartments in New York City, Villen an der Riviera –, dass sie aber nur widerwillig berichten, wenn Geld abfließt. Das heißt, es gibt eine Differenz zwischen der Summe, die kommt, und der Summe, die geht. »Unser Planet als Ganzer hat Nettoschulden, was natürlich unmöglich ist«, erklärte er mir. Wenn man die Ein- und Ausgänge aller Länder der Welt addiert, müsste null herauskommen, denn die Ausgaben des einen sind schließlich die Einnahmen des anderen. Aber am Ende steht keine Null. In der Bilanz fehlt ein Land. Alphabetisch könnte man Moneyland zwischen Monaco und der Mongolei einfügen.
Zucman ist nicht der Einzige, der versucht, Moneyland zu erforschen. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler James Henry veranschlagt das dunkle Geldvermögen deutlich höher, nämlich auf 21–32 Billionen Dollar im Jahr 2010. Um die Komplexität seiner Aufgabe zu beschreiben, greift er gern zu Vergleichen aus der Astronomie: »Das System, das wir messen wollen, ist die wirtschaftliche Entsprechung eines Schwarzen Lochs in der Astrophysik. Wie ein Schwarzes Loch ist es unsichtbar und gefährlich für alle, die sich zu nah heranwagen«, schrieb er 2012 in einem Artikel zum Thema. »Wir haben es mit einer der am besten verbarrikadierten Interessengruppen der Gesellschaft zu tun. Keine Interessengruppe ist schließlich so reich und so mächtig wie die Reichen und Mächtigen.«
Auf jedes Land hat Moneyland andere Auswirkungen. Die Reichen der wohlhabenden Länder Nordamerikas und Europas besitzen den größten Teil des Offshore-Geldvermögens, doch da diese Länder gleichzeitig ein großes Bruttoinlandsprodukt haben, macht es hier nur einen relativ kleinen Anteil am nationalen Gesamtvermögen aus. In den Vereinigten Staaten schätzt Zucman den Anteil auf 4 Prozent, in Westeuropa auf 10 Prozent. In Russland befinden sich dagegen geschätzte 52 Prozent des Vermögens offshore und außer Reichweite des Staates. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent beträgt der Anteil etwa 30 Prozent, in den Golfstaaten jedoch atemberaubende 57 Prozent. »Für Oligarchen in nicht-demokratischen Entwicklungsländern ist es recht einfach, ihr Vermögen zu verbergen. Damit haben sie einen gewaltigen Anreiz, ihr Land zu plündern, und es gibt keine Aufsicht«, so Zucman.
So also entstand Moneyland. Die sorgfältig aufgerichteten Schutzwälle wurden niedergerissen, und es konnte sich in aller Welt breitmachen. Nun sehen wir uns einige der Türhüter an.
* Die Londoner Banker hatten bald ein derartiges Geschick entwickelt, verschiedene nationale Rechtssysteme gegeneinander auszuspielen, dass sie zwei Jahre später das belgische Finanzamt davon überzeugten, bei einer Vertragsunterzeichnung handele es sich lediglich um eine Formalie. Damit mussten sie nicht mehr nach Luxemburg fahren, um ihre Verträge zu unterzeichnen, sondern konnten ihre Abschlüsse in Brüssel feiern. Der Grund: Luxemburg war seinerzeit eine gastronomische Wüste, während die Restaurants in Brüssel nach dem Geschmack der Banker waren.