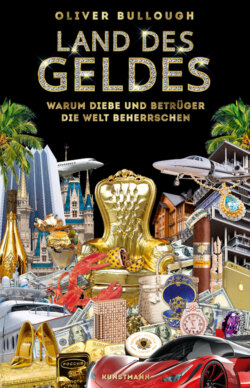Читать книгу Land des Geldes - Oliver Bullough - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3 DIE KÖNIGIN DER KARIBIK
ОглавлениеNEVIS IST NICHT VIEL MEHR als ein bewaldeter, in Nebel gehüllter Gipfel, der aus dem Meer ragt, wo der Atlantik auf die Karibik trifft. Die Insel ist kaum größer als Manhattan, hat aber gerade einmal 11.000 Einwohner. Als die Briten sie 1983 als Juniorpartner von St. Kitts und Nevis in die Unabhängigkeit entließen, schien sie einer trüben wirtschaftlichen Zukunft entgegenzugehen.
Damals war Simeon Daniel Regierungschef von Nevis, und seine Aufgabe war es, für die Inselbewohner zu sorgen. Die Speisekammer war leer. »Es gab nicht viele Möglichkeiten, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen«, erinnerte er sich später. Doch er hatte noch ein Ass im Ärmel.
Während der Verhandlungen um die Unabhängigkeit hatte er die größtmögliche Autonomie für Nevis herausgeschlagen. So klein die Insel war, ließ ihr die föderale Verfassung weitgehende Kontrolle über ihre Angelegenheiten. Ein Coup in Liberia eröffnete eine aussichtsreiche Chance. Amerikanische Schiffseigner zahlen hübsche Sümmchen für eine Flagge, unter der sie die heimischen Aufsichtsbehörden umschiffen können, und nach dem Sturz der Regierung in Liberia fürchteten sie, dass sie ihre Schiffe nun nicht mehr dort anmelden konnten.
Ein amerikanischer Anwalt namens Bill Barnard schlug Daniel vor, in diese Lücke zu stoßen. »Mr. Barnard und sein Team haben die ganze Infrastruktur aufgebaut«, erinnert sich Daniel. »Sie haben die Gesetzestexte entworfen, und wir haben sie dem Parlament von Nevis vorgelegt.«
Nachdem Barnard sah, wie entgegenkommend die Inselregierung war, entwarf er ehrgeizigere Ziele für Nevis. Warum sollte man nur den Schiffseignern helfen, die Regeln zu umgehen, wenn man allen helfen konnte? Barnard führte Nevis in das Geschäft mit der Verschwiegenheit ein. Sein Unternehmen, das er später Morning Star nannte, sicherte sich das Monopol für die Produkte des Landes. Barnard holte amerikanische Anwälte auf die Insel, die ein Buffet von finanziellen Leckerbissen zusammenstellten, und Nevis übernahm sie willig in seine juristische Speisekarte. Auf meine Anrufe und E-Mails hat Barnard nicht geantwortet, doch es macht ganz den Eindruck, als hätte sich sein Team das erste Fundament vor allem aus den Gesetzbüchern des amerikanischen Bundesstaats Delaware abgeschaut. Die neuen Gesetze traten 1984 in Kraft, ein Jahr später wurde das Bankgeheimnis eingeführt, und die Insel konnte loslegen. Doch das war erst der Anfang.
David Neufeld ist einer der vielen amerikanischen Anwälte, die an der Absicherung des Finanzsystems der Insel mitgewirkt haben. 1994 entwarf er ein Gesetz zur Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Dazu bediente er sich beim Vorbild des US-Bundesstaats Wyoming und fügte noch einige andere hübsche Aspekte hinzu, von denen er glaubte, dass sie seinen Kunden gefallen könnten. »Wir haben uns die Rosinen herausgepickt«, sagte er mir. »Ich will ja nicht angeben, aber es war ein bisschen so, als hätten wir Gott gespielt. Natürlich war meine Schöpfung nicht ganz so ehrgeizig. Und ich habe am siebten Tag auch nicht geruht. Das ist der Unterschied zwischen mir und Gott: Gott arbeitet schneller.«
Die Gesetze, die Neufeld und andere nach Nevis gebracht haben, machten aus der Insel eine Festung für alle, die ihr Vermögen in Sicherheit bringen wollen. Nevis erkennt keine ausländischen Gerichtsurteile an, sodass Gerichtsstand immer Nevis sein muss. Aber um einen Prozess anzustrengen, muss man vorab als Zeichen des guten Willens 100.000 Dollar hinterlegen. Liegt der Fall mehr als ein Jahr zurück, wird er automatisch abgewiesen. Und selbst wenn man durchkommt, stehen die Erfolgsaussichten schlecht: Die Unternehmen von Nevis müssen keine Unterlagen über ihre Finanztransaktionen vorhalten, und Bilanzvorschriften, Wirtschaftsprüfung oder Buchhaltung sind auf der Insel unbekannt. Ein ausländisches Unternehmen kann jederzeit nach Nevis umziehen, und ein Unternehmen von Nevis kann die Insel jederzeit verlassen. Es muss die Behörden der Insel nicht darüber informieren, wer der wahre Eigentümer ist: Das wissen nur die Aktionäre und der gesetzliche Vertreter, und um es herauszufinden, ist eine gerichtliche Verfügung erforderlich.
Die Anwälte haben mit dem Aufbau dieser juristischen Festung eine hübsche Stange Geld verdient und sind stolz auf ihre Erfindung. »Wir haben ein Team von gut zehn Leuten aus den gesamten Vereinigten Staaten zusammengestellt und uns alle zwei Wochen anderthalb Stunden getroffen. Wir haben das Gesetzbuch auf der ersten Seite aufgeschlaggen und sind es Wort für Wort durchgegangen«, erklärte mir Shawn Snyder, ein Treuhandexperte aus Florida, der die letzte Aktualisierung der Inselgesetze leitete. »Ich sage meinen Klienten immer, es gibt eine neue goldene Regel zum Anlagenschutz: Wer das Gold hat, gewinnt.«
Lobbyarbeit gibt es überall, doch auf Nevis wurde sie auf ihren nackten Kern reduziert. Amerikanische Anwälte schreiben die Gesetze, und das Parlament von Nevis winkt sie durch, damit die Anwälte Geld verdienen und Nevis Gebühren kassieren kann. Es ist eine reine Transaktionsbeziehung. Selbstverständlich verlangt Nevis keine Steuern von den hier ansässigen Unternehmen (es sei denn, man wünscht es; das kann unter Umständen sogar seine Vorteile haben), doch die Insel ist mehr als ein Steuerparadies. Sie ist ein Schutzraum für alles und einer von einigen Dutzend staatlichen Handlangern von Moneyland, die das Vermögen all jener schützen, die sich die Gebühren leisten können.
Heute stehen rund 18.000 Unternehmen im Handelsregister von Nevis – mehr als anderthalb für jeden Einwohner der Insel. Sie bringen jedes Jahr 5 Millionen Dollar an Einnahmen und weitere 5 Millionen Dollar an Gebühren für den Staat. Dazu kommen die Steuern, die Anwälte, Buchhalter und andere Mitarbeiter der Branche zahlen. Das klingt bescheiden, doch für eine Insel, die nicht mehr Bewohner als eine Kleinstadt hat, ist es ganz ordentlich. Kein Wunder, dass der ehemalige Premierminister Daniel stolz ist auf die Saat, die er gelegt hat. »Die Finanzdienstleister haben die wirtschaftlichen Ressourcen gebracht, die den Menschen auf Nevis Wohlstand bringen«, schrieb er.
Nevis verdient sein Geld mit der Verpachtung seiner Souveränität an Reiche, die fürchten, dass die Vereinigten Staaten zu prozessfreudig sind, Frauen bei Scheidungen zu viel Geld bekommen und überall Neider mit ihren Anwälten auf die Erfolgreichen lauern. Diese Sorgen sind unter Reichen verbreitet, und Moneyland gibt ihnen die Mittel an die Hand, sich dagegen zu wappnen.
Wenn wohlhabende Amerikaner früher glaubten, dass sie von den Gesetzen benachteiligt wurden, dann versuchten sie Einfluss auf die politischen Parteien zu nehmen, um diese Gesetze zu ändern. Wenn sie glaubten, dass ihre Frauen bei einer Scheidung zu großzügig abgefunden wurden, dann verlangten sie Gesetze, um das zu ändern. Das war langwierig und das Ergebnis war nicht perfekt, aber so funktioniert eben die Demokratie.
An die Stelle dieses unschönen Hin und Her tritt heute der Vermögensschutz. Die Reichen versuchen gar nicht mehr, auf Gesetze Einfluss zu nehmen, sondern sie entziehen sich ihnen ganz einfach. Normalbürger müssen immer noch mit Prozessen und teuren Scheidungen rechnen, wie sie das Gesetz ihres Landes vorsieht. Aber wer genug Geld hat, kann die heimische Rechtsprechung umgehen und sich nach Moneyland durchgraben, wo er sein Geld vor dem Rest der Welt verbergen kann.
»Das Wort ›verbergen‹ gefällt mir nicht. Es ist geschützt, nicht verborgen. Sehen Sie es sich mal andersherum an. Viele Frauen sind nur auf Geld aus. Sie heiraten einen Mann, den sie nicht lieben, nur weil er Geld hat. Diese Leute suchen einfach nach Möglichkeiten, ihr Vermögen zu schützen«, erklärt mir Laurie Lawrence, Finanzberater der Regierung von Nevis und zuvor zwei Jahrzehnte lang Finanzminister der Insel. »Wenn Sie als Arzt in den Vereinigten Staaten wegen eines Behandlungsfehlers verklagt werden, dann kann das Ihr finanzieller Ruin sein. Deswegen ergreifen Sie Maßnahmen, und wenn etwas passiert, dann führt das nicht zu Ihrem Bankrott.«
Die Anwälte, die die Gesetze von Nevis entworfen haben, sind begeistert von ihrer Arbeit, doch den anderen, die sich dem Bollwerk der Insel gegenübersehen, gefällt sie weniger. Im Jahr 2013 gewann eine Russin das bis dahin teuerste Scheidungsverfahren der britischen Geschichte (53 Millionen Pfund), nachdem es ihren Anwälten gelungen war, das komplizierte Geflecht der Offshore-Strukturen zu entwirren, das ihr Ehemann geknüpft hatte, um ihr den Zugang zu dem in siebzehn Ehejahren gescheffelten Vermögen zu verwehren.
Wie in Zivilprozessen in Großbritannien üblich, blieben die Namen des Paars vertraulich, doch die Einzelheiten des Offshore-Geflechts des Mannes drangen an die Öffentlichkeit. Unter anderem hatte er vier teure Immobilien in drei auf Nevis registrierten Unternehmen verborgen. »Der Fall war ein fantastisches Versteckspiel mit dem Ehemann und einem zwielichtigen Strippenzieher im Hintergrund. Zu märchenhaften Gebühren (bislang 1,4 Millionen Pfund) flogen die Anwälte der Frau rund um den Globus, um das Vermögen des Mannes aufzuspüren«, schrieb Richterin Eleanor King in ihrem Urteil. Am Ende gewann die Frau, aber kann man wirklich von Gerechtigkeit sprechen, wenn man dafür 1,4 Millionen Pfund hinblättern muss?
Noch teurer war eine Scheidung zwischen dem in Finnland geborenen Tech-Millionär Robert Oesterlund und seiner aus Wales stammenden Frau Sarah Pursglove, die 2017 in einem langen Artikel in der New York Times beschrieben wurde. Offenbar hatte Oesterlund einen großen Teil seines Vermögens in einem »weltumspannenden Finanzsystem verborgen, das seine Dienste ausschließlich den Reichen offeriert und nur einem einzigen Zweck dient: den Eindruck zu erwecken, als seien die Reichsten der Welt in Wirklichkeit arm«. Zum Glück für Pursglove verpflichtete sie den gewieften Scheidungsanwalt Jeffrey Fisher, der Oesterlunds Festung aus einer Richtung angriff, die nur ihm einfallen konnte. Der Artikel ist ein faszinierender Ausflug in die Realität des Vermögensschutzes, und natürlich spielten auch Briefkastenfirmen auf Nevis eine Rolle.
»Das hat vor gut zwölf Jahren angefangen, etwa 2005«, sagte er mir, als ich ihn anrief. »Ich mache das jetzt schon lange. Früher war ich Staatsanwalt, deswegen weiß ich, wie die Leute ihr Geld verstecken. Um an das Geld eines Vermögensschutzunternehmens wie einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Nevis heranzukommen, fahren Sie natürlich nicht nach Nevis, das wäre nicht besonders geschickt. Die haben ihre Gesetze so strukturiert, dass wir da gar nichts erreichen, dass es Jahre dauert und möglichst teuer wird. Wir müssen kreativer vorgehen, damit sie das Geld ausspucken.«
Aber wer sich keinen Jeffrey Fisher leisten kann, der zu den besten Scheidungsanwälten in den Vereinigten Staaten zählt, der hat keine Chance. »Wenn man sich nicht auskennt, hat man schon verloren. Und wenn man nicht die Mittel hat, um die fiesen Strukturen zu knacken, dann hat man auch schon verloren«, erklärte er mir. »Sie müssen sich klarmachen, dass es beim Vermögensschutz nicht um Milliarden geht, sondern um Billionen. Im Grunde geht es darum, zu verhindern, dass rechtmäßige Gläubiger an ihr Geld kommen. Das ist das Geschäft dieser Leute, aber so nennen sie es natürlich nicht.«
Das alles wäre noch hinnehmbar, wenn die Kunden von Nevis ausschließlich reiche Amerikaner wären, die ihr Vermögen vor ihren Mitbürgern verbergen wollen. Aber wie Warburgs Eurobonds ist die Insel mit ihrem sonderbaren Geschäftsmodell ein Magnet für Ganoven und Tyrannen aus aller Welt. Wie immer mischen sich hier dreistes und böses Geld. Egal um welchen Betrug es geht – wenn er komplex und international ist, wird irgendwo auch der Name Nevis auftauchen.
Navinder Sarao, der britische Börsenhändler, der den Flash Crash des Jahres 2016 verursachte (damals stürzte der Dow Jones innerhalb weniger Minuten um 600 Punkte ab, weil Sarao falsche Verkaufsaufträge aufgab und damit kurzfristig Kursverluste in Billionenhöhe verursachte), überwies seine Gewinne an zwei auf Nevis gemeldete Unternehmen, von denen er einen NAV Sarao Milking Markets Fund (Sarao Marktmelkfonds) nannte. Im größten Betrugsfall der britischen Geschichte verdienten Abzocker 100 Millionen Pfund, indem sie Prominenten Anteile eines nicht existierenden Umweltunternehmens aufschwatzten. Das Geld floss durch Firmen, die auf Nevis registriert waren. »Der Fall zeichnet sich durch seine kriminelle Energie, raffinierte Planung und beispiellose Gier aus«, so der Richter in der Urteilsbegründung Ende 2017. »Die Dauer der Ermittlungen ist allein der Raffinesse und Komplexität des Betrugs geschuldet.«
An einem Versicherungsbetrug, der 2015 in New York verhandelt wurde, waren auf Nevis firmierende Unternehmen genauso beteiligt wie an einem Börsenschwindel in New Jersey zwei Jahre später. Ein besonders dreister Kredithai, der bis zu 700 Prozent Zinsen kassierte, knöpfte 620.000 sozial schwachen Amerikanern insgesamt 161 Millionen Dollar ab und versteckte sie zeitweilig auf Nevis. »Das vermeintliche Offshore-Unternehmen von Hydra Lenders bestand aus einem Dienst, der Post von Adressen auf Nevis und Neuseeland in ein Büro in Kansas City weiterleitete«, so der Staatsanwalt.
Wenn Sie auf der Website des Justizministeriums der Vereinigten Staaten das Stichwort »Nevis« eingeben, spuckt diese eine ganze Liste aus. Darunter befindet sich zum Beispiel ein Unternehmen, das nur dazu da war, 250 Millionen Dollar aus Kursmanipulationen der New Yorker Börse zu waschen. Oder ein nigerianischer Unternehmer, der 100 Millionen Dollar hinterzog und sich für 80 Millionen eine Jacht mit dem Namen Galactica Star kaufte; mithilfe von Unternehmen auf Nevis verschleierte er den Besitz seines Privatflugzeugs (zurzeit ist er in Nigeria angeklagt, 1,7 Milliarden Dollar gestohlen zu haben). Oder eine Briefkastenfirma, mit der die Familie des ehemaligen Präsidenten von Taiwan Bestechungsgelder wusch und ein Apartment in Manhattan und eine Villa in Virginia kaufte.
Die Strafverfolger anderer Länder hängen ihre Erfolge weniger an die große Glocke, doch Nachrichtenarchive berichten von ähnlichen Prozessen in aller Welt. Dank der Akten, die Revolutionäre 2014 aus dem Dnjepr fischten, wissen wir zum Beispiel, dass der ehemalige ukrainische Präsident Janukowytsch Unternehmen auf Nevis verwendete, um zu verschleiern, dass er sich in den Besitz von Kohlegruben des Landes gebracht hatte. Das Geld, das korrupte russische Polizisten aus der Staatskasse gestohlen hatten, landete auf Konten in Litauen, die wiederum einem Unternehmen auf Nevis gehörten; der Rechtsanwalt und Korruptionsbekämpfer Sergei Magnitski, der das Verbrechen aufdeckte, starb später im Gefängnis, weil man ihm ärztliche Behandlung verweigerte. Angehörige des Präsidenten von Aserbaidschan besaßen Mobilfunkanbieter und Goldförderunternehmen zum Teil über Nevis. Kein Wunder, dass Gegner von Emmanuel Macron den französischen Präsidentschaftskandidaten vor den Wahlen des Jahres 2017 in den Schmutz ziehen wollten, indem sie ihm ein Unternehmen auf Nevis andichteten – die Providence LLC, benannt nach der Schule, die er besuchte – und behaupteten, dass er hier Reichtümer hortete. Das war zwar erfunden, wirkte jedoch glaubwürdig, denn korrupte Politiker haben nun mal Briefkastenunternehmen auf Nevis.
Jack Blum ist erfahrener Korruptionsermittler, der vierzehn Jahre lang Anwalt des Korruptionsausschusses des amerikanischen Senats war und bestens mit der Insel vertraut ist. »Die Direktoren und Beamte haben keine treuhänderische Verantwortung, das Gesetz verlangt nicht einmal die Aufbewahrung minimaler Unterlagen am Unternehmenssitz. Wenn jemand gegen ein auf Nevis registriertes Unternehmen ermittelt und dort hinfährt, dann könnte niemand Auskunft geben, nicht einmal unter Folter«, sagte er mir, als wir uns in seinem Wohnort Annapolis in Maryland zum Kaffee trafen. »Wer da hinfährt, vergeudet nur seine Zeit. Da gibt es nichts zu finden. Gar nichts.«
Eine der Vorzüge des Daseins als freier Autor ist, dass ich niemandem darüber Rechenschaft ablegen muss, wie ich meine Zeit vergeude. Und weil ich Herausforderungen liebe, flog ich nach Nevis. Vielleicht würde ich ja etwas entdecken, was andere übersehen hatten?
In drei Stunden ist man von Miami in St. Kitts, und dann braucht man noch einmal zehn Minuten mit dem Taxi vom Flughafen in die Hauptstadt. Basseterre ist ein gemütliches Städtchen, in dem die Nachbarn über die Straße hinweg miteinander plauschen, Hühner auf der Straße picken und Händler Bob-Marley-T-Shirts und geschältes Zuckerrohr an die Kreuzfahrttouristen verkaufen. Von hier geht es mit der Fähre zur Südküste hinunter. Auf dem kurzen Stück zwischen den beiden Inseln rollen die Wellen ungebrochen vom Atlantik heran, sodass das Bootchen kräftig schaukelt, bis man den Schatten von Nevis erreicht.
Vom Meer aus gesehen ist Nevis ein tropisches Paradies, die Hänge steigen gemächlich aus den Wellen und werden immer steiler, bis sie in den Wolken verschwinden. Es sieht aus, als liege auf dem Gipfel Schnee, weshalb die ersten Spanier die Insel Nuestra Señora de las Nieves (Unsere liebe Frau des Schnees) nannten; die Engländer verballhornten den Namen und machten daraus Nevis.
Im 18. Jahrhundert nutzten die Briten Nevis als Umschlagplatz für Zucker und Sklaven. Hier kam auch Alexander Hamilton zur Welt, einer der Väter der Verfassung der Vereinigten Staaten, der es hier erstaunlicherweise zu einer Art Popikone gebracht hat. Während des 19. Jahrhunderts gewannen Kolonien mit mehr Einwohnern und besseren Transportverbindungen die Oberhand, und Nevis verlor gegenüber St. Kitts an Bedeutung. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit war Nevis nicht einmal mehr ein verschlafenes Nest, und man muss es Barnard und seinen Offshore-Anwälten hoch anrechnen, dass sie die Insel überhaupt gefunden haben. Nördlich von Charlestown, der Miniaturhauptstadt von Nevis, befindet sich das Luxushotel Four Seasons, das 1990 eröffnet wurde und Nevis zu einem annehmbaren Urlaubsziel für die Superreichen machte. Nicht von ungefähr ist die Schnittmenge zwischen den betuchten Hotelgästen und den Kunden der Vermögensschutzdienstleister groß.
Für jeden, der sich ein wenig mit den Geschäften der Insel beschäftigt hat, ist ein Rundgang durch Charlestown ein sonderbares Erlebnis, denn hier drängen sich die nominellen Zentralen der an diesen Geschäften beteiligten Firmen. Der Briefkasten des Unternehmens, mit dem die Präsidentenfamilie von Aserbaidschan ihre Beteiligung an den Gold- und Mobilfunkunternehmen des Landes tarnt, befindet sich direkt gegenüber der Anlegestelle der Fähre. Zehn Meter weiter steht das Edith L. Solomon Building, dessen Schriftzug einige Buchstaben abhandengekommen sind: Hier hat ein skandalgebeutelter Kredithai aus Idaho seine Anschrift. In dreißig Meter Entfernung folgt das Büro von Morning Star, nomineller Sitz von Unternehmen, die allein in Großbritannien insgesamt 36 Immobilien besitzen, darunter ein Nobelobjekt im Londoner Stadtteil Mayfair mit Blick auf den Hyde Park. Insgesamt befinden sich mehr als dreihundert Immobilien in England und Wales in Besitz von Unternehmen, die als ihren Sitz eine Adresse in einem fußballplatzgroßen Areal auf Nevis angeben.
Besonders interessierten mich zwei Unternehmen, die demselben Geflecht angehörten wie zwei Konten in Litauen, mit deren Hilfe einige Milliarden Dollar aus Russland gewaschen worden waren. Journalisten, die die Operation 2014 aufdeckten, gaben ihr den Spitznamen »russischer Waschsalon«. Das Unternehmen gab als seine Anschrift Hamilton Development, Suite B in Charlestown an, genau wie die Nevis International Trust Company (NITC). Aber in der ganzen Stadt schien niemand zu wissen, wo sich dieses Gebäude befand. Daher erkundigte ich mich im Büro der Finanzaufsicht, und die Empfangsdame schickte mich den Berg hinauf.
So kam es, dass ich mich den Hang des erloschenen Vulkans hinaufschleppte. Die einzige Abwechslung auf dem einstündigen Fußmarsch waren ein paar Affen, die mich neugierig anglotzten. Als ich endlich an dem Ort ankam, den mir die Empfangsdame genannt hatte, hatte niemand eine Ahnung, wovon ich redete. Ich müsse wieder hinunter an die Küste, teilte man mir mit. Hamilton Development befinde sich an der Küstenstraße hinter dem Four Seasons. Aber auch dort hatte ich keinen Erfolg. Eine weitere Empfangsdame war so freundlich, die NITC in den Gelben Seiten nachzuschlagen und anzurufen. Die Angestellte, die ans Telefon ging, weigerte sich, mir die Adresse der NITC zu verraten oder mir Auskunft über die Unternehmen zu geben, nach denen ich sie fragte.
»Ich bin kein Einbrecher«, sagte ich schließlich.
»Das kann ja jeder sagen«, erwiderte sie. Und damit war das Gespräch beendet.
Auf der Suche nach Antworten auf allgemeinere Fragen verabredete ich mich mit Heidi-Lynn Sutton, oberste Finanzaufseherin von Nevis. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur der Insel nicht von Kriminellen, korrupten Politikern und Steuerflüchtlingen missbraucht wird – keine unwichtige Aufgabe. Sie kam in Begleitung dreier Kollegen. Zu viert saßen sie mir an einem Konferenztisch gegenüber wie bei einem Vorstellungsgespräch.
Ich fragte, warum das Außenministerium der Vereinigten Staaten Nevis zuletzt so kritisch beurteilt habe. Das Amt für Internationalen Drogenhandel und Gesetzesvollzug gibt jedes Jahr einen Bericht zum Stand des internationalen Kampfs gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität heraus. Der Bericht des Jahres 2017 beschrieb Nevis als »attraktiven Standort für Kriminelle, die ihre Einnahmen verbergen wollen«. Konkret kritisierte er die anonymen Konten und das Bankgeheimnis der Insel sowie Gesetze, mit denen sich die wahren Eigentümer der dort registrierten Firmen verschleiern lassen.
Sutton klang wie eine Lehrerin, die nur mit Mühe ihre Verachtung für einen besonders unterbelichteten Schüler verbergen kann. Die Informationen der amerikanischen Regierung seien veraltet, klärte sie mich auf. Das verwunderte mich, denn ich hatte den Eindruck, es sei allgemein bekannt, dass die Eigentümerschaft auf Nevis nicht transparent war. Um das zu unterstreichen, berichtete ich ihr von meinem Abenteuer auf der Suche nach den Unternehmen, die am russischen Waschsalon beteiligt waren. Sie schien amüsiert, dass ich derartige Mühen auf mich genommen hatte, nur um ein Bürogebäude zu finden. »Wozu brauchen Sie die Information?«, fragte sie mich. Als ich die gewaschenen Milliarden erwähnte, lachte sie mich aus. »Dazu kann ich nichts sagen. Dazu kann ich wirklich nichts sagen.«
Während der nächsten halben Stunde wies Sutton pauschal jede Kritik an Nevis zurück, die ich referierte. Die Beschwerden der amerikanischen Anwälte, es sei zwecklos, in Nevis einen Prozess anstrengen zu wollen, schien sie nicht nachvollziehen zu können. »Aber amerikanische Anwälte haben uns doch bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung unterstützt. Das wundert mich jetzt sehr.«
Aber verhinderten einige der gesetzlichen Vorkehrungen nicht, dass Frauen im Falle einer Scheidung einen gerechten Anteil am gemeinsamen Vermögen erhielten? Oder dass Opfer von medizinischen Behandlungsfehlern angemessen entschädigt wurden?, fragte ich weiter. Fand sie es nicht unverhältnismäßig, dass Kläger 100.000 Dollar hinterlegen mussten, um überhaupt Klage einreichen zu können?
»In einigen Ländern sind die Leute extrem prozessfreudig. Wenn man sich bei McDonald’s ein bisschen verbrennt, weil man sich Kaffee über die Hand geschüttet hat, dann rennt man gleich vor Gericht. Wir sorgen nur dafür, dass die Leute beschützt werden und dass unsere Gerichte nicht mit überflüssigen Verfahren überflutet werden«, erklärte sie mir. Ich sah, wie ein Kollege einem anderen unter dem Tisch ein Zettelchen gab.
Ihre Gleichgültigkeit ärgerte mich. Also fragte ich Sutton, ob sie sich bewusst war, dass korrupte ausländische Politiker die Infrastruktur von Nevis missbraucht hatten (»Das behaupten Sie, aber das heißt nicht, dass das auch stimmt«). Ich nannte konkrete Beispiele: die Präsidentenfamilie Taiwans (»Das ist eine Behauptung«); der gestürzte Präsident der Ukraine (»Dazu kann ich Ihnen nichts sagen«); der russische Waschsalon (»Gibt es dazu ein Ermittlungsverfahren?«). Sie schien sich nicht dafür zu interessieren, dass wenige Meter von ihrem Büro entfernte Unternehmen an Diebstahl in beispiellosen Dimensionen beteiligt waren. Allmählich hatte ich das Gefühl, ich würde den Verstand verlieren.
»Das können Sie Nevis nicht anhängen. Das passiert doch überall auf der Welt«, erwiderte sie selbstbewusst. »Ich kann Ihre Behauptung nicht nachvollziehen, dass unsere Infrastruktur dazu verwendet worden sein soll, um irgendetwas zu ermöglichen. Das kann ich nicht akzeptieren. Dazu kann ich nichts sagen.«
Wenn hier alles so wunderbar ist, fragte ich, warum haben dann Leute dem französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ein Unternehmen auf Nevis angehängt, um ihn wie einen Kriminellen dastehen zu lassen? »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann den Leuten ja nicht in die Köpfe schauen«, erwiderte sie. »Die Leute erfinden dauernd irgendwas.«
Ich hatte im Laufe der Jahre mit vielen Aufsichtsbeamten und Ermittlern gesprochen, aber jemand wie Heidi-Lynn Sutton war mir noch nie untergekommen. Meine früheren Gesprächspartner hatten zumindest ein gewisses höfliches Interesse an meinem Anliegen geheuchelt, und manchmal hatten sie es sogar geteilt. Sutton lachte mich dagegen aus. Obwohl alles gegen sie sprach, erklärte sie mir standhaft, die Behörden der Insel seien streng, die Aufsicht funktioniere zuverlässig und entspreche in jeder Hinsicht den internationalen Anforderungen. »Sobald man ein internationales Finanzzentrum ist und bestimmte Dienstleistungen anbietet, wird man zur Zielscheibe. Das heißt aber nicht, dass die Anschuldigungen auch wahr sind.«
Möglicherweise hatte sie ja recht und bei den Beispielen, die ich ihr genannt hatte, handelte es sich um Einzelfälle. Wir haben keine unabhängige Beurteilung der Kompetenz der Aufsichtsbehörde von Nevis und wissen nicht, inwieweit die Unternehmen, die ihrer Kontrolle unterstehen, von kriminellen Aktivitäten durchdrungen sind. Es ist durchaus möglich, dass die winzige Polizei von Nevis ausreichend kompetent ist, Finanzkriminalität zu verfolgen und den beteiligten Firmen das Handwerk zu legen, statt es zu ignorieren, um mehr Geld anzulocken. Es wäre schön, wenn es so wäre.
Wenn die Erfahrungen eines anderen Finanzzentrums als Vergleich dienen können, dann sollten wir uns allerdings keine allzu großen Hoffnungen machen.
•
Jersey ist eine Insel im Ärmelkanal. Obwohl sie nur wenige Kilometer von der französischen Küste entfernt ist, gehört sie zu Großbritannien, zumindest mehr oder weniger. In den Sechzigerjahren nutzte sie ihre Autonomie zum Aufbau eines Offshore-Bankwesens, in dem die Briten ihr Geld verstecken konnten, und schon bald wurde daraus ein eigenständiges Finanzzentrum. Das Muster dürfte Ihnen inzwischen vertraut vorkommen. Jersey hat zehnmal so viele Einwohner wie Nevis, ist reicher, und das Offshore-Zentrum ist einige Jahrzehnte älter. Als Außenstehende begannen, den Geheimnissen der Insel auf den Grund zu gehen, waren sie entsetzt.
Jerseys besondere Spezialität sind Treuhandgesellschaften. Die Ursprünge dieser Rechtsform reichen zurück bis ins Mittelalter, als Ritter zu den Kreuzzügen ins Heilige Land aufbrachen und ihr Vermögen für ihre Frauen und Kinder absichern wollten. Dazu gaben sie es in die Hände eines Verwalters, mit dem Auftrag, alle Erträge an die Kinder auszuzahlen. In Ländern mit angelsächsischem Recht hat die Treuhandgesellschaft verschiedene Anwendungen, darunter auch jene Offshore-Tricks, da es den juristischen Besitz und seine Erträge trennt. Ein Apartment kann sich in New York befinden und Sie können darin wohnen, aber es gehört Ihnen nicht. Es gehört vielmehr einer Treuhandgesellschaft auf Jersey, die rechtlich dazu verpflichtet ist, es nach Ihrem Ableben an Ihre Enkel zu übergeben. Die Vorteile für die Bewohner von Moneyland liegen auf der Hand: Was ihnen nicht gehört, darauf zahlen sie keine Steuer; lediglich das Einkommen, das es abwirft, ist steuerpflichtig. Treuhandgesellschaften spielen eine wichtige Rolle bei der »Nachfolgeplanung« – ein Euphemismus für die Umgehung der Erbschaftssteuer –, und Anwälte auf Jersey sind Experten bei deren Gründung.
Wie Nevis ist Jersey bemüht, sich gegenüber der Konkurrenz Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, indem es Neuerungen aus anderen Ländern kopiert. Abgeordnete des Parlaments haben seit jeher ein offenes Ohr für die Wünsche der Anwälte, um sie auf der Insel zu halten. Oder um es mit den Worten eines Abgeordneten zu sagen: »Wenn wir das Geld nicht nehmen, dann gibt es viele andere, die es mit Kusshand nehmen. Ohne die Finanzdienstleister gäbe es hier keine sozialen Dienstleistungen.«
Aus Jerseys Sicht ist das verständlich, wirft jedoch die Frage auf, wer eigentlich das Sagen hat: das Parlament oder die Anwälte und Finanzdienstleister, die drohen, die Insel zu verlassen, wenn die Politik nicht nach ihrer Pfeife tanzt.
Diese Frage bereitete John Christensen Kopfzerbrechen. Christensen war Wirtschaftsprüfer aus Jersey, der 1987 eine Stelle beim Staat annahm. Er hatte in Großbritannien Wirtschaft studiert und war danach auf die Insel zurückgekehrt, um hier eine Familie zu gründen. »Die Finanzlobby war so stark, dass sich alles darum drehte, wie man den Finanzsektor ausbauen konnte«, so Christensen. Das war für ihn ein Problem, denn dazu sah man auf der Insel über einige höchst verdächtige Verhaltensweisen hinweg.
1996, nach einem guten Jahrzehnt in seiner Position, erhielt Christensen einen Anruf von einem Reporter des Wall Street Journal, der ihn nach einem Börsenhändler mit Sitz auf Jersey fragte. Eine Gruppe überwiegend amerikanischer Anleger warf einem Mann namens Robert Young vor, er habe 27 Millionen Dollar von ihrem Geld verzockt, aber fälschlich Gewinne ausgewiesen; die Behörden von Jersey weigerten sich, etwas dagegen zu unternehmen. Young hatte bei der Privatbank Cantrade gearbeitet, die zur UBS gehörte.
Christensen stellte eigene Nachforschungen an. Dabei erfuhr er, dass der Vorsitzende des Ausschusses, der die Beschwerden ignoriert hatte, vier Jahre lang Direktor von Cantrade gewesen war. Der Regierungschef der Insel war Seniorpartner der Anwaltskanzlei von Cantrade gewesen. Und die Prüfer von Cantrade selbst hatten den Auftrag bekommen, zu ermitteln, ob sich die Bank etwas zuschulden hatte kommen lassen. Diese kamen zu dem überraschenden Schluss, dass alles seine Ordnung hatte. Das sah nicht gut aus. Als Ermittler schließlich einen Durchsuchungsbefehl für Youngs Haus bekamen, fanden sie vierzig Taschen von Gucci und fünf Armbanduhren von Rolex. Allein im Dezember 1993 wies seine Kreditkartenabrechnung Ausgaben in Höhe von 144.000 Dollar aus.
Young und sein Wirtschaftsprüfer wurden 1998 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, und Cantrade zahlte außergerichtlich eine beträchtliche Summe an die hintergangenen Anleger. Doch ausländischen Beobachtern reichte das nicht. John Moscow, der damalige Bezirksstaatsanwalt von New York, erklärte gegenüber Journalisten, er sei bei seinen Ermittlungen jedes Mal frustriert über die mangelnde Kooperationsbereitschaft von Jersey. »Es ist unerhört, dass diese britischen Dependancen als Schutzgebiete für Transaktionen dienen, die nicht einmal vom Schweizer Bankgeheimnis geschützt würden«, zürnte er.
Genau über diesen Fall sprach Christensen mit dem Reporter des Wall Street Journal. Nach seiner Meinung zu den Gesetzen der Insel gefragt, bat er den Journalisten, ihn nicht namentlich zu nennen. »Ich habe das Gefühl, sie sind hoffnungslos überfordert.« Es dauerte nicht lange, bis man auf Jersey dahinterkam, wer der Informant des Wall Street Journal war. Es war unverzeihlich. Christensen musste die Insel verlassen und aufs Festland ziehen, wo er beim Aufbau des Tax Justice Network beitrug, einer NGO, die gegen Steuerparadiese kämpft. Zwanzig Jahre später behauptet man auf Jersey immer noch, Christensen habe sich rächen wollen, weil er bei einer Beförderung übergangen wurde. »Das hat er bis heute nicht verkraftet, das wurmt ihn immer noch«, erklärte mir der Leiter der Bankaufsicht von Jersey.
Jersey hat knapp über 100.000 Einwohner und neigt wie jeder kleine Ort zu Klatsch. Die Saga um Christensen, das Wall Street Journal und Cantrade mag wie eine Provinzposse erscheinen, bis man sich die Zusammenhänge vor Augen führt. Wenn die Banker gleichzeitig die Politik, die Justiz und die Aufsichtsbehörden lenken, dann sind Insidergeschäfte vorprogrammiert. Die Autonomie der Insel wird zum Feigenblatt für die Gaunereien der Reichen auf der Insel und darüber hinaus. Der Rechtsstaat verkommt zum Witz. Wie zwei ehemals leitende Polizeibeamte erklären, die nach langen Berufsjahren von Großbritannien auf die Insel gewechselt waren, gelten die Gesetze von Jersey nicht für Menschen, die reich genug sind, sie zu ignorieren.
Aufgescheucht durch kritische Berichte, ernannte die Polizei von Jersey im Jahr 2000 einen Schotten namens Graham Power zum Polizeidirektor der Insel. Mit seiner Ernennung und der seines Stellvertreters Lenny Harper aus Nordirland sollte die Polizei von Jersey professionalisiert und ihr Image aufpoliert werden. Das Gegenteil trat ein, denn die beiden brachten die Probleme ans Licht, die sich im Cantrade-Skandal bereits abgezeichnet hatten.
Nach Ermittlungen in einem Fall von Kindesmissbrauch, der Jersey in die Schlagzeilen gebracht hatte, wurde Power 2008 vom Dienst suspendiert. Seine Beamten hatten Hinweise auf sexuellen Missbrauch in einem Kinderheim und einem Segelverein für Jugendliche gefunden, und einer der Angeklagten war ein Mann, der trotz früherer Sexualstraftaten als ehrenamtlicher Polizist tätig sein durfte. Power und Harper mussten weg. Doch es war kein leiser Abgang: Mit ihren Aussagen bei nachfolgenden Anhörungen machten sie deutlich, wie schwierig ihre Arbeit in dieser kleinen und reichen Gemeinde gewesen war. Power beschrieb etwas, das er als »Jersey-Methode« bezeichnete, inzestuöse Gepflogenheiten mit Hinterzimmer-Deals, die verhinderten, das unangenehme Themen an die Öffentlichkeit kamen.
»Die Praxis der gegenseitigen Gefälligkeiten war tief verwurzelt«, schrieb er in einer Stellungnahme. »Die Elite von Jersey rotiert durch einflussreiche Positionen. In der Kultur herrscht eine tiefe Abneigung dagegen, Staub aufzuwirbeln.« Als seine Beamten den Missbrauchsvorwürfen gegen geschätzte Angehörige der Gemeinschaft nachgingen, verlangten Politiker, die Ermittlungen einzustellen, weil sie den Ruf der Insel beschädigten. »Man geht davon aus, dass Regeln und Pflichten nur für die übrigen Inselbewohner gelten, nicht für die Mächtigen«, schrieb Power.
Die Zähigkeit der Elite von Jersey ist bekannt (Jersey ist vermutlich der einzige Ort in Europa, der vor, während und nach der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg dieselbe Regierung hatte), sie war nur noch nie von einem Kriminalermittler beschrieben worden. Powers Stellvertreter Harper, der die Ermittlungen im Missbrauchsskandal leitete, fand noch schärfere Worte. Er kam 2002 nach Jersey, nachdem er zuvor jahrelang in einigen der härtesten Polizeibezirke Großbritanniens gearbeitet hatte. »Es ist surreal. Ich habe an der Falls Road gearbeitet, in den Vernehmungszentren von Belfast, und in einigen der übelsten Gegenden von London und Glasgow«, sagte er mir am Telefon. »Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was ich auf Jersey erlebt habe.«
Er erzählte mir, die ehrenamtliche Polizei (die einer unabhängigen Leitung unterstand) habe ihn bedrängt, die Ermittlungen einzustellen. Er sei nicht in der Lage gewesen, korrupte Mitarbeiter zu entlassen. Daneben habe er einiges erlebt, was man an einem scheinbar so adretten Ort wie Jersey nicht erwarten würde. »Ich klinge jetzt wie ein Kommunist, aber ich bin keiner«, sagte er zu mir. »Diese Clique auf Jersey hat kein Interesse an neutralen Gesetzeshütern. Das ist das Letzte, was die wollen. Sie wollen, dass das Gesetz so durchgesetzt wird, wie es ihnen passt.«
Die Geringschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit. Politiker von Jersey ließen kein gutes Haar an Harper und Power. Aber wenn man sich die Reaktion der Inselbewohner auf den Missbrauchsskandal ansieht, dann muss man der Einschätzung der Polizeibeamten zustimmen, dass die Elite von Jersey die Öffentlichkeit scheut. Der neue Polizeichef geißelte die Medien, weil sie über den Fall berichteten. »Der eigentliche Skandal ist die ungerechtfertigte und gnadenlose Schmierenkampagne gegen Jersey und seine Bewohner«, sagte Justizminister Philip Bailhache bei einer Feier zum Jahrestag der Befreiung von den Nationalsozialisten. Seine Worte kamen von Herzen, aber wenn Sie im nächsten Kapitel erfahren, wie Jersey russischen Politikern bei der Plünderung ihres Landes half, dann stimmen Sie ihm vielleicht nicht mehr zu.