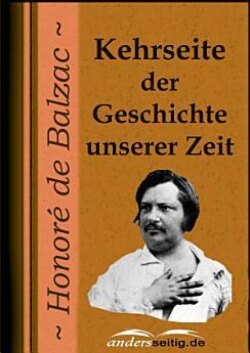Читать книгу Kehrseite der Geschichte unserer Zeit - Оноре де Бальзак, Оноре де'Бальзак, Balzac - Страница 3
Frau des la Chanterie
ОглавлениеAn einem schönen Septemberabend des Jahres 1836 stand ein Mann von ungefähr dreißig Jahren an die Brüstung gelehnt auf dem Quai, von dem man die Seine gleichzeitig stromauf vom Botanischen Garten bis zu Notre-Dame und stromabwärts über das weite Ufergelände bis zum Louvre überblickt. Es gibt keinen zweiten solchen Punkt in der Hauptstadt des Geistes. Man befindet sich hier wie auf dem Heck eines gigantischen Schiffes. Die Geschichte von Paris steigt vor Einem auf von den Römern bis zu den Franken, von den Normannen bis zu den Burgundern, das Mittelalter, die Valois, Heinrich IV., Ludwig XIV., Napoleon und Louis Philipp. Jede Herrschaft hat irgendeine Spur hinterlassen oder Monumente, die an sie erinnern. Sainte-Geneviève überragt mit ihrer Kuppel das Quartier latin. Hinter einem erhebt sich der herrliche Chor der Kathedrale. Das Hôtel de Ville erzählt von allen Revolutionen, das Krankenhaus von allem Elend der Stadt Paris. Wenn man die Herrlichkeiten des Louvre betrachtet hat, kann man ein paar Schritte davon die zerfallenen Häuserreste zwischen dem Quai de la Tournelle und dem Hôtel de Ville sehen, die die modernen Schöffen der Stadt jetzt verschwinden lassen.
Im Jahre 1835 besaß dieses wundervolle Bild noch eine Besonderheit mehr: zwischen dem an die Brüstung gelehnten Pariser und der Kathedrale war das Terrain, wie der alte Name dieser einsamen Gegend lautete, noch mit den Ruinen des erzbischöflichen Palais bedeckt. Angesichts so vieler Bilder, die die Phantasie anregen, wo der Geist Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Paris umfasst, scheint die Religion hier eine Stätte gefunden zu haben, von der aus sie beide Hände über die Schmerzen beider Ufer des Flusses ausbreitet und den Raum vom Faubourg Saint-Antoine bis zum Faubourg Saint-Marceau umfasst. Wir wollen hoffen, dass eine so erhabene Harmonie durch die Errichtung eines erzbischöflichen Palais in gotischem Stil vervollkommnet wird, das an die Stelle des baufälligen, charakterlosen Gebäudes zwischen dem Terrain, der Rue d'Arcole, der Kathedrale und dem Quai de la Cité tritt.
Dieser Punkt, das Herz des alten Paris, ist zugleich seine einsamste und melancholischste Stelle. Die Wogen der Seine prallen hier geräuschvoll an, die Kathedrale wirft bei Sonnenuntergang ihren Schatten darüber hin. Man versteht, dass hier bei einem Manne, der an einer seelischen Krankheit litt, ernste Gedanken lebendig wurden. Wahrscheinlich gefesselt von dem Einklang zwischen seinen momentanen Gedanken und denen, die der Anblick so verschiedener Bilder in ihm wachrief, blieb der Spaziergänger, die Hände auf die Brüstung gestützt, stehen, versunken in die zwiefache Betrachtung von Paris und von sich selbst! Die Schatten wuchsen länger, Lichter wurden in der Ferne angezündet, er aber ging nicht weiter, versunken in tiefes Nachdenken über die Zukunft, die das Überdenken der Vergangenheit so ernst macht. In diesem Augenblick hörte er, wie zwei Personen sich näherten, deren Stimmen er schon von der steinernen Brücke her vernommen hatte, die die Cité-Insel mit dem Quai de la Tournelle verbindet. Die beiden Personen glaubten ohne Zweifel, dass sie allein seien und sprachen daher lauter, als sie es an besuchten Orten oder in Gegenwart eines Fremden getan hätten. Von der Brücke her ließen die Stimmen erkennen, wie aus einigen an das Ohr des unfreiwilligen Zeugen der Szene gelangten Worten hervorging, dass es sich um eine Bitte, Geld zu borgen, handelte. Als sie in die Nähe des Spaziergängers gelangt waren, trennte sich der, der wie ein Arbeiter gekleidet war, von dem andern mit einer verzweifelten Gebärde. Der andere wandte sich um, rief den Arbeiter zurück und sagte zu ihm: »Sie haben ja keinen Sou Brückengeld. Hier,« fuhr er fort und gab ihm ein Geldstück, »und denken Sie daran, dass es Gott selbst ist, der zu uns spricht, wenn wir einen guten Gedanken haben.«
Diese letzten Worte ließen den Träumer erzittern. Der Mann, der sie gesprochen hatte, ahnte nicht, dass er, um einen sprichwörtlichen Ausdruck zu gebrauchen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlug, und dass er sie an ein zweifaches Elend gerichtet hatte: an einen verzweifelten Arbeiter und an eine kranke Seele ohne Kompass; ein Opfer dessen, was die Hämmel Panurgs »Fortschritt« nennen und die Franzosen »Gleichheit«. Die an sich so einfachen Worte erhielten eine gewisse Größe durch den Ton dessen, der sie gesprochen hatte und durch seine reizvolle Stimme. Gibt es nicht solche sanften, süßen Stimmen, die auf uns wie der Anblick des Ultramarins wirken?
An der Kleidung erkannte der Pariser einen Priester und erblickte bei dem letzten Licht der Dämmerung ein bleiches, erhabenes, aber abgezehrtes Antlitz.
Der Anblick eines Priesters, der in Wien aus dem schönen Stephansdom heraustrat, um einem Sterbenden die letzte Wegzehrung zu bringen, bestimmte den berühmten Dramatiker Werner, katholisch zu werden. Fast ebenso ging es dem Pariser beim Anblick des Mannes, der ihm eben, ohne es zu ahnen, Trost gebracht hatte; an dem mit dunklen Wolken drohenden Horizont seiner Zukunft erblickte er einen langen hellen Streifen, in dem das Blau des Äthers hindurchschien, und er ging diesem Lichte nach wie die Hirten des Evangeliums der Stimme, die ihnen von oben her zurief: »Der Heiland ist geboren!« Der Mann, der das heilbringende Wort gesprochen hatte, ging an der Kathedrale entlang und lenkte seine Schritte, dem Zufall gehorchend, der manchmal so planvoll ist, der Straße zu, aus der der Spaziergänger gekommen war, und in die ihn die Fehler, die er in seinem bisherigen Leben begangen hatte, zurückführten.
Dieser Spaziergänger hatte den Namen Gottfried. Der Leser dieser Geschichte wird verstehen, aus welchen Gründen nur die Vornamen der vorkommenden Personen genannt werden. Es soll nun berichtet werden, warum Gottfried, der in dem Viertel der Chaussée d'Antin wohnte, sich um diese Stunde am Chor von Notre-Dame befand.
Sohn eines Detailhändlers, der durch Sparsamkeit ein ziemliches Vermögen zusammengebracht hatte, konzentrierte sich der ganze Ehrgeiz von Vater und Mutter auf ihn, die ihn als Pariser Notar zu sehen hofften. Er wurde daher mit sieben Jahren in dem Institut des Abbé Liautard untergebracht, zusammen mit Kindern vieler vornehmer Familien, die unter der Regierung des Kaisers aus Anhänglichkeit an die Religion, die in den Lyzeen ein wenig vernachlässigt wurde, ihre Söhne in dieser Schule erziehen ließen. Die sozialen Unterschiede konnten sich unter den Kameraden noch nicht geltend machen; aber im Jahre 1821 musste Gottfried, der nach Vollendung seiner Studien bei einem Notar in Stellung getreten war, sehr bald gewahr werden, welcher Abstand ihn von denjenigen trennte, mit denen er bisher so vertraut zusammengelebt hatte.
Als er sein Rechtsstudium begann, gehörte er zu der Masse von Bürgersöhnen, die ohne Vermögen und ohne vornehme Herkunft alles nur von ihrer persönlichen Fähigkeit oder ihrem hartnäckigen Fleiß zu erwarten haben. Die Erwartungen, welche Vater und Mutter, die sich inzwischen vom Geschäft zurückgezogen hatten, auf ihn setzten, spornten seine Eigenliebe an, ohne ihm doch den nötigen Ernst zu verleihen. Die Eltern lebten nach holländischer Weise sehr bescheiden und verbrauchten nur den vierten Teil ihrer Rente von zwölftausend Franken; ihre Ersparnisse und die Hälfte ihres Kapitals hatten sie zum Ankauf eines Notariats für ihren Sohn bestimmt. Da er sich selbst in dieses sparsame häusliche Leben fügen musste, hielt er ein solches Dasein den Zukunftshoffnungen seiner Eltern und seinem eigenen für so wenig entsprechend, dass er verzagte. Bei schwachen Naturen entsteht aus solchem Kleinmut Neid. Während andere, bei denen die harte Notwendigkeit, der Wille und die Einsicht die Begabung ersetzen, geradeaus und entschlossen den Weg verfolgen, der den ehrgeizigen Ansprüchen des Bürgertums vorgezeichnet ist, empörte sich Gottfried dagegen; er wollte glänzen, erschien überall, wo es hoch herging und fühlte sich dann verletzt.
Er versuchte emporzukommen, aber alle seine Anstrengungen ließen ihn nur seine Ohnmacht erkennen. Als ihm endlich das Missverhältnis zwischen seinen Ansprüchen und dem, was er erreicht hatte, klar wurde, ergriff ihn ein Hass gegen die sozialen Vorrechte, er wurde ein Liberaler und versuchte, sich durch ein Buch berühmt zu machen; aber der Erfolg war nur, dass er das wirkliche Talent mit denselben Augen ansah wie den Adel. Da seine Versuche mit dem Notariat, der Anwaltschaft, der Literatur nacheinander gescheitert waren, wollte er Beamter werden.
Da starb sein Vater. Weil die alte Mutter mit einer Rente von zweitausend Franken auskommen konnte, so überließ sie ihm fast das ganze Vermögen. Mit fünfundzwanzig Jahren im Besitz einer Rente von zehntausend Franken hielt er sich für reich und war es auch im Vergleich mit seinen bisherigen Verhältnissen. Bis dahin war sein Leben von einem Handeln ohne Energie, von ohnmächtigen Ansprüchen erfüllt; um mit seiner Zeit mitzugehen, um zu handeln und eine Rolle zu spielen, versuchte er es jetzt, in irgendeinen Gesellschaftskreis mit Hilfe seines Vermögens hineinzugelangen. Er stieß zuerst auf den Journalismus, der ja stets seine Arme dem ersten besten Kapital, das sich ihm nähert, entgegenstreckt. Besitzer einer Zeitung sein, das bedeutet, dass man eine Persönlichkeit geworden ist: man beutet die Intelligenz der andern aus und genießt die Annehmlichkeiten ihrer Stellung, ohne ihre Arbeit verrichten zu müssen. Nichts ist für untergeordnete Köpfe verlockender, als so, auf die Fähigkeiten anderer gestützt, emporzukommen. Paris hat mehrere solcher Parvenüs erlebt, deren Erfolg eine Schande für ihre Zeit und für diejenigen ist, die sich zu solchen Diensten hergegeben haben.
In dieser Sphäre wurde Gottfried von dem groben Machiavellismus der einen oder der Verschwendung der andern, von reichen ehrgeizigen Kapitalisten oder geistvollen Redakteuren in den Schatten gestellt; er wurde aber bald in das ungebundene Leben, zu dem die Beschäftigung mit der Literatur und der Politik Anlass gibt, hineingezogen, in das Treiben der Kritiker hinter den Kulissen und in die Zerstreuungen, die stark beschäftigte geistige Arbeiter brauchen. Er bewegte sich also in schlechter Gesellschaft, wo man ihm übrigens klar machte, dass er ein unbedeutendes Gesicht habe und dass eine seiner Schultern sichtlich höher sei als die andere, ohne dass dieses Missverhältnis durch Bosheit oder durch Herzensgüte wettgemacht würde. Mit dem schlechten Ton machen sich die Künstler im voraus bezahlt, wenn sie die Wahrheit sagen. Klein, schlecht gewachsen, ohne Geist und ohne klares Ziel – damit war einem jungen Mann das Urteil gesprochen in einer Zeit, wo in jeder Karriere der Erfolg selbst bei höchsten Fähigkeiten noch vom Glück abhängig ist oder von der Hartnäckigkeit, die das Glück herbeiruft.
Die Revolution von 1830 war Balsam für Gottfrieds Wunden, und er fasste wieder den Mut zu hoffen, der dem Mut der Verzweiflung gleichkommt; er ließ sich, wie so viele unbekannte Journalisten, einen Posten in der Verwaltung übertragen, auf dem ihn seine liberalen Anschauungen, die in Widerspruch zu den Anforderungen der neuen Regierung gerieten, zu einem widerspenstigen Instrument machten. Vom Liberalismus durchdrungen, verstand er nicht, wie verschiedene hervorragende Männer, sich für die Partei zu entscheiden. Den Ministern gehorchen, das hieß für ihn, seine Ansichten wechseln. Außerdem schien ihm die Regierung den Prinzipien, auf Grund deren sie ans Ruder gekommen war, nicht zu entsprechen. Gottfried bekannte sich als Anhänger des »Fortschritts«, als es darauf ankam, diesen aufzuhalten, und er kehrte fast arm, aber den Doktrinen der Opposition getreu, nach Paris zurück.
Erschreckt durch die Übergriffe der Presse und noch mehr erschreckt durch die Attentate der republikanischen Partei, zog er sich in das Dasein zurück, das allein für den passt, dessen Begabung mangelhaft ist, der keine Kraft fühlt, um den starken Stürmen des politischen Lebens standzuhalten, dessen Leiden und Kämpfe sich geräuschlos abspielen, der durch das Scheitern seiner Pläne ermattet ist, der keine Freunde hat, weil Freundschaft hervorragende Vorzüge oder Mängel verlangt und der ein mehr unklares als tiefes Empfinden besitzt. War das nicht das einzige, was einem jungen Menschen übrigblieb, den die Erwartung von Freuden schon mehrfach getäuscht hatte und den die Berührung mit einer ebenso unruhigen wie beunruhigenden Gesellschaft bereits hatte altern lassen?
Seine Mutter, deren Leben in dem friedlichen Dorfe Auteuil zu Ende ging, rief ihren Sohn zu sich, einerseits um ihn bei sich zu haben, dann aber auch, um ihm einen Weg zu weisen, auf dem er das gleichmäßige harmlose Glück finden konnte, das für solche Seelen angemessen ist. Sie hatte schließlich Gottfrieds Wesen richtig erkannt, da sie sah, wie er mit achtundzwanzig Jahren so viel Vermögen eingebüßt hatte, dass seine Rente nur noch viertausend Franken betrug, wie seine Wünsche kraftlos geworden, seine angeblichen Fähigkeiten erschöpft, seine Arbeitskraft erloschen, sein Ehrgeiz gedemütigt und sein Hass gegen alles, was berechtigterweise emporkam, durch seine getäuschten Hoffnungen nur noch verstärkt war. Sie versuchte, Gottfried mit einem jungen Mädchen, der einzigen Tochter eines Kaufmannsehepaars, das sich vom Geschäft zurückgezogen hatte, zu verheiraten, die sollte der kranken Seele ihres Sohnes Hilfe bringen; aber der Vater besaß jenen nüchtern rechnenden Verstand, der einen früheren Kaufmann bei der Festsetzung von Ehekontrakten nicht im Stiche lässt, und nachdem Gottfried ein Jahr lang als Nachbar sich um das Mädchen bemüht hatte, wurde sein Antrag abgelehnt. Nach der Ansicht dieser eingefleischten Bourgeois' musste der Bewerber in Anbetracht seines früheren Lebens ein durchaus unmoralischer Mensch sein; außerdem hatte er im Verlaufe dieses Jahres noch mehr von seinem Kapital verbraucht, weil er den Eltern zu imponieren und der Tochter zu gefallen wünschte. Diese, übrigens sehr verzeihliche Prunksucht gab den Ausschlag für die Ablehnung von Seiten einer Familie, bei der eine solche Verschwendung Schrecken erregte, nachdem sie erfahren hatte, dass Gottfried in sechs Jahren hundertfünfzigtausend Franken von seinem Vermögen verlorengegangen waren.
Dieser Schlag traf sein schon so schwer verwundetes Herz um so stärker, als das junge Mädchen durchaus keine Schönheit war. Gottfried hatte aber, von seiner Mutter darauf hingewiesen, an seiner Zukünftigen ein ernsthaftes Wesen und den großen Vorzug eines gesunden Verstandes schätzen gelernt; er hatte sich an ihr Gesicht gewöhnt und sich in seinen Ausdruck vertieft, er liebte den Klang ihrer Stimme, ihr Gebaren und ihren Blick. Diese Neigung war sein letzter Einsatz für seine Lebensaussichten gewesen; um so bitterer war seine Enttäuschung. Als die Mutter nun starb, sah er, dessen Bedürfnisse sich dem steigenden Luxus angepasst hatten, sich im Besitze von fünftausend Franken Rente als ganzem Einkommen und der Gewissheit, niemals irgendeinen Verlust wieder gutmachen zu können, da er sich unfähig fühlte, den Fleiß zu entwickeln, den das furchtbare Wort: »Geldverdienen« erfordert.
Eine solche ungeduldige und grämliche Schwachmütigkeit kann sich nicht entschließen, sogleich klein beizugeben. Daher versuchte Gottfried während seiner Trauerzeit in Paris sein Glück: er speiste an der Table d'hôtel, ließ sich in unvorsichtiger Weise mit Fremden ein, verkehrte in der Gesellschaft und fand nur Gelegenheiten, Geld auszugeben. Wenn er auf den Boulevards spazierenging, litt er innerlich so sehr, dass schon der Anblick einer von einer heiratsfähigen Tochter begleiteten Mutter ihm die gleiche schmerzhafte Empfindung verursachte wie der eines jungen Mannes, der ins Bois ritt, oder eines Parvenüs in einer eleganten Equipage oder eines ordengeschmückten Beamten. Das Bewusstsein seiner Ohnmacht sagte ihm, dass er weder auf eine anständige Stellung zweiten Ranges noch auf irgendeinen unschwer auszufüllenden Platz hoffen dürfte; und er besaß ein genügendes Feingefühl, um dadurch beständig verletzt zu werden, und genug Geist, um Trauerlieder voller Galle darüber anzustimmen.
Unfähig zum Kampfe mit den Dingen und sich bewusst, dass er wohl eine höhere Begabung besitze, aber nicht die Willenskraft, sie in Tätigkeit umzusetzen, in dem Gefühl dieser Unvollkommenheit ohne Kraft, etwas Großes zu unternehmen, wie ohne Widerstand gegen die Ansprüche, die er von seinem früheren Leben, seiner Erziehung und seiner Sorglosigkeit her beibehalten hatte, wurde er von mehreren krankhaften Zuständen aufgezehrt, von denen ein einziger genügt hätte, einem jungen Manne, der den religiösen Glauben verloren hatte, das Dasein zu vergällen. Und so zeigte Gottfried jenes Gesicht, das man bei so vielen Männern findet, dass es für den Pariser typisch geworden ist; man liest auf ihm getäuschten oder erloschenen Ehrgeiz, durch das tägliche Schauspiel des Pariser öffentlichen Lebens genügend beschäftigten und dadurch abgestumpften Hass, eine Blasiertheit, die nach Anreiz verlangt, ein Sichbeklagen ohne Berechtigung, eine Grimasse der Kraftanstrengung, eine von früheren Misserfolgen vergiftete Gesinnung, die dazu antreibt, sich über alles zu mokieren, alles, was aufwärts strebt, zu verhöhnen, die unumgänglichsten gesetzlichen Vorschriften zu missachten, sich zu freuen, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen, und keine Gesellschaftsordnung anzuerkennen. Dieses Pariser Laster bedeutet für die tatkräftige, andauernde Verschwörung der Leute mit Energie dasselbe wie der Splint für den Saft des Baumes: es behütet sie, es unterstützt sie, und es hält sie geheim.
Seiner selbst überdrüssig, wollte Gottfried eines Morgens ein neues Leben beginnen, nachdem er einem Kameraden begegnet war, der die Rolle der Schildkröte in Lafontaines Fabel gespielt hatte, während er selbst der Hase gewesen war. Während sich zwischen ihnen eine Unterhaltung entspann, wie sie unter Schulkameraden, die sich wieder begegnen, vor sich zu gehen pflegt, und sie in der Sonne auf dem Boulevard des Italiens auf und ab gingen, war er betroffen, zu vernehmen, dass der andere, der anscheinend weniger begabt und weniger wohlhabend als er war, seinen Weg gemacht hatte, weil er an jedem Morgen noch dasselbe wie am Abend vorher gewollt hatte. Der Bedrückte beschloss daher, dieses einfache Tun nachzuahmen.
»Das soziale Leben ist wie die Erde,« hatte sein Kamerad zu ihm gesagt, »sie bringt uns um so mehr Früchte, je mehr wir sie bearbeiten.«
Gottfried hatte bereits Schulden gemacht. Als erste Strafe, als erste Buße hatte er sich auferlegt, bescheiden im verborgenen zu leben und von seinem Einkommen seine Schulden zu bezahlen. Für einen Mann, der gewöhnt war, sechstausend Franken auszugeben, wenn er nur fünftausend einnahm, war es kein kleines Unternehmen, seinen Unterhalt mit zweitausend Franken bestreiten zu wollen. Er las alle Morgen die »Kleinen Anzeigen , weil er hoffte, darin ein Asyl zu finden, wo er seine Ausgaben begrenzen und die Einsamkeit finden könnte, die für einen Menschen erforderlich waren, der sich sammeln, sich prüfen und einen andern Weg für sich finden wollte. Das Leben in den bürgerlichen Pensionen des Quartier latin verletzte seine Empfindlichkeit, die Sanatorien hielt er für ungesund, und er verfiel bereits wieder in die fatale Unschlüssigkeit der Leute ohne festen Willen, als sein Auge von folgender Anzeige gefesselt wurde:
»Kleines Logis für siebzig Franken monatlich, für einen Geistlichen geeignet. Es wird ein ruhiger Mieter gewünscht; er kann Verpflegung und Möblierung der Wohnung zu mäßigen Preisen nach Übereinkunft erhalten.
Man wende sich an den Kolonialwarenhändler Millet, Rue Chanoinesse, in der Nähe der Notre-Dame- Kirche, der alle erforderlichen Auskünfte erteilt.«
Angezogen von der biederen Form dieser Anzeige und der bürgerlichen Atmosphäre, die sie verriet, war Gottfried gegen vier Uhr bei dem Kolonialwarenhändler erschienen, der ihm sagte, dass Frau de la Chanterie jetzt bei Tisch sei und niemanden empfangen könne. Die Dame sei abends nach sieben Uhr und morgens von zehn bis zwölf Uhr zu sprechen. Während er das sagte, warf Herr Millet prüfende Blicke auf Gottfried und stellte, wie der amtliche Ausdruck lautet, eine erste Vernehmung mit ihm an. »Ist der Herr Junggeselle? Die gnädige Frau möchte jemanden haben, der ein regelmäßiges Leben führt: das Haus wird spätestens um elf Uhr geschlossen. Der Herr scheint übrigens«, sagte er schließlich, »in den Jahren zu sein, wie es Frau de la Chanterie wünscht.«
»Für wie alt halten Sie mich denn?« fragte Gottfried. »So etwa um vierzig«, erwiderte der Kaufmann. diese naive Antwort verursachte bei Gottfried einen Anfall von Menschenhass und Trübsinn. Er speiste am Quai de la Tournelle und kehrte dann zurück, um Notre-Dame zu betrachten in dem Moment, wo die Strahlen der untergehenden Sonne sich an den vielen Strebebögen des Chors brachen und sie mit ihrem Licht übergossen. Der Quai liegt schon im Schatten, wenn die Türme noch vom Glänze umstrahlt sind, und dieser Gegensatz ergriff Gottfried, der noch unter dem bitteren Eindruck der grausamen naiven Äußerung des Kolonialwarenhändlers stand.
Der junge Mann schwankte noch zwischen verzweifelten Entschlüssen und den zu Herzen gehenden frommen harmonischen Klängen der Kirchenglocken, als er mitten in der Dunkelheit, der Stille und beim Schein des Mondes die Worte des Priesters vernahm. Obgleich wenig gläubig, wie die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, empfand er doch ein Gefühl der Rührung und kehrte wieder in die Rue Chanoinesse, wohin er eigentlich nicht mehr hatte gehen wollen, zurück.
Der Priester und Gottfried waren gleicherweise erstaunt, als sie beide in die Rue Massillon, gegenüber dem kleinen Portal der Kathedrale, und dann zusammen in die Rue Chanoinesse einbogen, dort, wo sie, in der Gegend der Rue de la Colombe, Rue des Marmousets heißt. Als Gottfried vor der rundbogigen Tür des Hauses, in dem Frau de la Chanterie wohnte, stillhielt, wandte sich der Priester nach ihm um und betrachtete ihn beim Schein einer Laterne, die zweifellos eine der letzten sein wird, die im Herzen des alten Paris verschwindet.
»Wollen Sie zu Frau de la Chanterie, mein Herr? fragte der Priester.
»Jawohl«, erwiderte Gottfried. »Die Worte, die ich Sie eben an den Arbeiter richten hörte, haben mich überzeugt, dass dieses Haus, wenn Sie darin wohnen, für meinen Seelenfrieden heilbringend sein muss.«
»Sie waren also Zeuge meines Misserfolges?« sagte der Priester und erhob den Türklopfer; »ich habe ja nichts erreicht.«
»Es schien mir im Gegenteil, dass es der Arbeiter war, der ziemlich energisch Geld von Ihnen verlangte.«
»Ach«, antwortete der Priester, »es gehört mit zu dem schlimmsten Unglück, das die Revolutionen über Frankreich gebracht haben, dass jede von ihnen eine neue Prämie für den Ehrgeiz der unteren Klassen gestiftet hat. Um sich aus seinem Stande herauszuarbeiten und ein Vermögen zu erlangen, was man heute als die einzige Sicherheit in sozialer Beziehung betrachtet, gibt sich dieser Arbeiter mit ungeheuerlichen Plänen ab, die, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt sind, ihn nebst seinen Spekulationen in Konflikt mit der menschlichen Gerechtigkeit bringen müssen. Das kommt manchmal bei einem Liebesdienst heraus.«
Der Pförtner öffnete eine schwere Tür, und der Priester sagte zu Gottfried: »Kommen Sie vielleicht wegen der kleinen Wohnung?«
»Jawohl, mein Herr.«
Der Priester und Gottfried durchschritten nun einen ziemlich großen Hof, in dessen Hintergrund sich im Dunkeln ein hohes Haus abzeichnete, neben dem sich ein viereckiger, sichtlich sehr alter Turm noch über die Dächer erhob. Wer die Geschichte der Stadt Paris kennt, weiß, dass hier das Terrain vor und rings um die Kathedrale sich so erhöht hat, dass keine Spur mehr von den zwölf Stufen vorhanden ist, über die man einstmals zu ihr hinaufstieg. Heute befindet sich die Basis der Säulen der Vorhalle in gleicher Höhe mit dem Pflaster. Das ursprüngliche Erdgeschoß des Hauses stellte daher jetzt den Keller dar. Vor dem Eingang zum Turm befand sich eine Freitreppe, von der man zu einer Wendeltreppe gelangte, die um einen Stamm in Form einer Rebe hinaufführte. Der Stil erinnerte an den Ludwigs XII. bei den Treppen im Schlosse Blois und geht ins vierzehnte Jahrhundert zurück. Von diesen unzähligen Zeichen des Altertums gefesselt, konnte sich Gottfried nicht enthalten, lächelnd zu dem Priester zu sagen: »Von gestern stammt der Turm nicht her.«
»Er hat, wie es heißt, dem Angriff der Normannen widerstanden und soll einen Teil des ersten Königspalastes in Paris gebildet haben; nach der Tradition war er aber wahrscheinlicher die Wohnung des berühmten Domherrn Fulbert, des Oheims der Héloise.«
Während er so sprach, öffnete der Priester die Tür der Wohnung, die das Erdgeschoß zu sein schien und die sich, nach dem ersten und zweiten Hof zu – denn es war daselbst noch ein kleiner innerer Hof–, im ersten Stock befand.
Im ersten Zimmer arbeitete bei einer kleinen Lampe ein Dienstmädchen mit einer Batisthaube, die mit getollten Falten als einzigem Schmuck besetzt war; sie steckte die eine Nadel ins Haar und behielt ihr Strickzeug in der Hand, während sie sich erhob, um die Tür eines nach dem inneren Hof zu gelegenen Salons zu öffnen. Ihre Kleidung glich der der Grauen Schwestern.
»Gnädige Frau, ich bringe Ihnen einen Mieter«, sagte der Priester und führte Gottfried in das Zimmer, wo drei Personen auf Sesseln neben Frau de la Chanterie saßen.
Diese drei und auch die Hausherrin erhoben sich; als der Priester dann einen Sessel für Gottfried herangeschoben und der künftige Mieter auf ein Zeichen der Frau de la Chanterie und ihre altmodische Äußerung: »Lassen Sie sich nieder!« Platz genommen hatte, glaubte sich der Pariser meilenfern von Paris, in der südlichen Bretagne oder in Hinterkanada.
Die Stille hat wohl verschiedene Grade. Gottfried, schon unter dem Eindruck der Stille in den Rues Massillon und Chanoinesse, durch die nicht zwei Wagen im Monat fahren, und der Stille im Hofe und im Turme, musste sich wie im Mittelpunkte des Schweigens in diesem Salon fühlen, der von so viel alten Straßen, alten Höfen und alten Mauern beschirmt war.
Dieser Teil der Seineinsel, Le Cloître genannt, hat seinen allen Klöstern eigenen Charakter bewahrt; er erscheint feucht und kalt und verharrt auch in den lärmendsten Tagesstunden im tiefsten mönchischen Schweigen. Es muss auch erwähnt werden, dass dieser ganze Teil der Cité, der zwischen der Seitenfront von Notre-Dame und dem Fluss eingeklemmt ist, nach Norden zu und im Schatten der Kathedrale liegt. Der Wind weht hier, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, und die Seinenebel werden gewissermaßen von den schwarzen Seitenwänden der alten Metropolitankirche festgehalten. Daher wird sich niemand wundern, dass Gottfried in diesen alten Räumen in Gegenwart der vier schweigenden Personen, die ebenso feierlich wie ihre Umgebung wirkten, ein eigenartiges Gefühl empfand. Er blickte nicht um sich, weil sich seine Neugier auf Frau de la Chanterie konzentrierte, deren Namen ihm schon zu denken gegeben hatte. Diese Dame stammte augenscheinlich aus einem andern Jahrhundert, um nicht zu sagen, aus einer andern Welt. Ihr Gesicht hatte einen milden Ausdruck, einen matten kühlen Teint, eine Adlernase, eine Stirn, auf der Güte thronte, braune Augen und ein Doppelkinn: das Ganze umrahmt von silbernen Locken. Ihr Kleid hätte man als Futteral bezeichnen können, so eng lag es an, entsprechend der Mode des achtzehnten Jahrhunderts. Der Stoff, karmeliterbraune Seide mit dichten schmalen grünen Streifen, schien ebenfalls noch aus dieser Zeit herzustammen. Der obere Teil, mit dem unteren aus einem Stück geschnitten, war unter einem Umhang aus matter, mit Spitzen garnierter Seide verborgen, der über der Brust von einer Nadel mit einem Miniaturbilde zusammengehalten wurde. Die Füße in schwarzsamtenen Hausschuhen ruhten auf einem kleinen Kissen. Ebenso wie ihre Dienerin strickte Frau de la Chanterie Strümpfe und hatte unter ihrer Spitzenhaube eine Nadel in ihre gekräuselten Locken gesteckt.
»Haben Sie mit Herrn Millet gesprochen? sagte sie zu Gottfried mit einer Kopfstimme, wie sie den alten Herzoginnen eigen war, um den fast stumm Gewordenen zum Sprechen zu veranlassen.
»Jawohl, gnädige Frau.«
»Ich fürchte, dass Ihnen die Wohnung nicht zusagen wird«, fuhr sie fort und warf einen Blick auf den eleganten, neuen, frischen Anzug ihres zukünftigen Mieters.
Gottfried trug Lackstiefel, gelbe Handschuhe, wertvolle Hemdknöpfe und eine schöne Uhrkette auf feiner schwarzseidenen blaugeblümten Weste. Frau de la Chanterie zog eine kleine silberne Pfeife aus der Tasche. Auf ihren Pfiff trat das Dienstmädchen herein.
»Manon, mein Kind, zeig dem Herrn die Wohnung. Wollen Sie den Herrn begleiten, mein lieber Vikar?« wandte sie sich an den Priester. »Wenn die Zimmer,« sagte sie, indem sie sich wieder erhob und Gottfried ansah, »Ihnen doch gefallen sollten, können wir ja über die Bedingungen reden.«
Gottfried verbeugte sich und ging hinaus. Er vernahm das Klappern von Schlüsseln, die Manon aus einer Schublade hervorholte, und sah, wie sie die Kerze in einem großen Handleuchter aus gelbem Kupfer anzündete. Ohne ein Wort zu sagen, ging Manon voraus. Als Gottfried sie auf der Treppe einholte und in die oberen Stockwerke hinaufstieg, kamen ihm Zweifel, ob er in der Wirklichkeit lebe; er träumte im Wachen, er betrachtete die Welt um sich wie einen der phantastischen Romane, die er in müßigen Stunden gelesen hatte. Jeder Pariser, der wie er aus einem der neuen Viertel, aus luxuriös möblierten Häusern, aus eleganten Restaurants und Theatern, aus dem bewegten Treiben der inneren Stadt hierher gekommen wäre, hätte ebenso empfunden. Der Leuchter in der Hand des Dienstmädchens erhellte nur schwach die Wendeltreppe, über die Spinnen ihre verstaubten Netze gezogen hatten. Manon trug einen weiten faltigen Rock aus grobem Wollstoff; ihre Taille war vorn und hinten viereckig, ihr ganzes Kleid aus einem Stück geschnitten. Als sie im dritten Stock, der als der zweite galt, angelangt waren, hielt Manon still, schloss ein altes Türschloss auf und öffnete eine Tür, deren Anstrich in plumper Weise astiges Mahagoniholz imitierte.
»Hier«, sagte sie und trat zuerst hinein.
War es ein Geizhals oder ein verhungerter Maler oder ein Zyniker, der sich um die Welt nicht bekümmerte, oder irgendein Geistlicher, der ganz zurückgezogen lebte, gewesen, der diese Räume bewohnt hatte? Man musste sich solche Fragen vorlegen, wenn man die Atmosphäre des Elends einatmete, die Fettflecke an den verräucherten Tapeten, die geschwärzte Decke, die Fenster mit den kleinen staubigen Scheiben, die dunkel gewordenen Steine des Fußbodens und die Holzteile mit ihrem klebrigen Überzug betrachtete. Eine feuchte Kälte entströmte den Kaminen mit gemalten Skulpturen, deren Spiegel aus dem siebzehnten Jahrhundert flammten. Die Wohnung umfasste, wie das Haus, rechtwinklig den inneren Hof, den Gottfried, da es Nacht war, nicht erkennen konnte.
»Wer hat denn hier gewohnt?« fragte Gottfried den Priester.
»Ein früherer Parlamentsrat, ein Großonkel der gnädigen Frau, ein Herr von Boisfrelon. Kindisch geworden zur Zeit der Revolution, ist der alte Mann 1832 im Alter von sechsundneunzig Jahren gestorben, und die Hausherrin konnte sich nicht gleich entschließen, einen Fremden hier einziehen zu lassen; sie kann aber nicht länger den Mietzins entbehren.
»Oh, die gnädige Frau wird die Wohnung reinigen lassen und so möblieren; dass der Herr zufrieden sein wird«, bemerkte Manon.
»Es wird darauf ankommen, was Sie mit ihr vereinbaren«, sagte der Priester. »Es ließe sich hier ein hübsches Sprechzimmer, ein großes Schlafzimmer und ein Kabinett einrichten, die rückwärts nach dem Hof gelegenen beiden kleinen Räume könnten gut als Arbeitszimmer dienen. So ist meine Wohnung, die unter dieser liegt, eingerichtet und ebenso die darüber gelegene.
» Ja,« sagte Manon, »Herrn Alains Wohnung ist dieselbe wie die Ihrige, aber sie hat die Aussicht auf den Turm.«
»Ich meine, man müsste die Wohnung und das Haus noch einmal am Tage ansehen ...«, sagte Gottfried ängstlich.
»Das kann geschehen«, erwiderte Manon.
Der Priester und Gottfried gingen wieder hinab, während die Dienerin die Türen schloss und dann nachkam, um ihnen zu leuchten. Als Gottfried in den Salon zurückgekehrt war, konnte er, da er sich an die Umgebung gewöhnt hatte, während er sich mit Frau de la Chanterie unterhielt, die Personen und die Sachen um ihn herum einer Prüfung unterziehen.
Der Salon hatte alte rote Fenstervorhänge, die mit seidenen Schnüren zurückgenommen waren. Rote Fliesen waren rings um einen alten gewebten Teppich sichtbar, der den Fußboden nicht völlig bedeckte. Die Holztäfelung war grau angestrichen. Die Decke wurde durch einen mächtigen Balken in zwei Teile geteilt, der vom Kamin ausging und eine dem Luxusbedürfnis nachträglich gemachte Konzession zu sein schien. Die Sessel aus weiß gestrichenem Holz waren mit Stickereien bezogen. Eine elende Uhr zwischen zwei Leuchtern aus vergoldetem Kupfer war der Kaminschmuck. Neben Frau de la Chanterie stand ein alter Tisch mit Kirschfüßen, auf dem Wollknäuel in einem Weidenkorbe lagen. Eine hydrostatische Lampe erleuchtete den Raum.
Die vier Männer, die steif, unbeweglich und schweigend wie Bronzefiguren dasaßen, hatten, ebensowie Frau de la Chanterie, offenbar ihr Gespräch abgebrochen, als sie den Fremden zurückkommen hörten. Alle zeigten kalte, verschwiegene Gesichter, die in Einklang mit dem Salon, dem Hause und dem Stadtviertel standen. Frau de la Chanterie hielt die Bemerkungen Gottfrieds für gerechtfertigt und erwiderte ihm, dass sie nichts machen lassen würde, bevor sie nicht die Wünsche ihres Mieters oder besser gesagt ihres Pensionärs erfahren hätte. Wenn der Mieter sich den Gewohnheiten des Hauses anpassen wolle, könne er ihr Pensionär werden, aber diese Gewohnheiten seien von den in Paris üblichen so sehr verschieden! Man lebe in der Rue Chanoinesse wie in der Provinz: Um zehn Uhr müssten alle zu Hause sein; man dulde keinen Lärm; weder Frauen noch Kinder dürften hier verkehren, die die hier übliche Lebensweise stören würden. Frau de la Chanterie wünschte vor allem einen Mieter, der ein bescheidenes, bedürfnisloses Leben führe; sie könne die Wohnung nur mit dem unbedingt Notwendigen möblieren. Herr Alain (sie wies dabei auf einen der vier Herren) sei übrigens damit zufrieden, und sie würde ihren neuen Mieter ebenso wie die alten behandeln.
»Ich glaube nicht,« sagte jetzt der Priester, »dass der Herr bereit ist, Mitglied unserer Klostergemeinde zu werden.
»Ei, warum denn nicht?« fragte Herr Alain; »wir befinden uns hier wohl, es geht uns doch durchaus nicht schlecht.«
»Gnädige Frau,« erklärte Gottfried und erhob sich, »ich werde mir die Ehre geben, Sie morgen wieder aufzusuchen.«
Obwohl er ein junger Mann war, erhoben sich auch die vier alten Herren und ebenso Frau de la Chanterie, und der Vikar begleitete ihn bis auf die Freitreppe. Ein Pfiff ertönte. Auf dieses Zeichen erschien der Pförtner mit einer Laterne, nahm Gottfried in Empfang, führte ihn auf die Straße und schloss dann die riesige gelbliche, schwere, gefängnisartige Tür, die mit Schlössern in Arabesken, die aus einer schwer zu bestimmenden Zeit herrührten, versehen war.
Als Gottfried in seinem Kabriolett nach den belebten, hellen, erwärmten Teilen von Paris gelangte, erschien ihm alles, was er gesehen hatte, wie ein Traum, und seine Eindrücke hatten, als er auf dem Boulevard des Italiens promenierte, bereits die Form einer Erinnerung an weit Entferntes angenommen. Er fragte sich: »Werde ich morgen wieder zu diesen Leuten hingehen?«
Als er am andern Morgen inmitten der Raffiniertheiten des modernen Luxus und des englischen Komforts erwachte, erinnerte sich Gottfried an alle Einzelheiten seines Besuchs im Kloster Notre-Dame, und machte sich die Bedeutung der Dinge, die er gesehen hatte, klar. Die vier Unbekannten, deren Kleidung, Haltung und Schweigsamkeit noch jetzt auf ihn wirkten, mussten ebenso wie der Priester Pensionäre sein. Das feierliche Wesen der Frau de la Chanterie erschien ihm als die schweigende Würde, mit der sie ein großes Unglück ertrug. Aber trotzdem er sich das so erklärte, konnte Gottfried sich doch nicht enthalten, hinter diesen verschwiegenen Gesichtern irgendetwas Geheimnisvolles zu vermuten. Ermusterte seine Möbel, um festzustellen, welche er behalten wollte, welche ihm unentbehrlich waren; aber wenn er sie im Geiste in die abscheuliche Wohnung in der Rue Chanoinesse versetzte, musste er bei der Vorstellung, wie merkwürdig sie sich dort ausnehmen würden, lachen, und er beschloss, alles zu verkaufen, schon um Schulden zu bezahlen, und sich von Frau de la Chanterie einrichten zu lassen. Er musste ein neues Leben beginnen, und alle Gegenstände, die ihn an seine frühere Lage erinnern könnten, würden ihm einen unangenehmen Anblick gewähren. In seinem Verlangen nach Umgestaltung, denn er gehörte zu den Leuten, die sich gleich mit dem ersten Sprung weit vorwärts in eine neue Situation stürzen, anstatt wie andere Schritt für Schritt vorzurücken, kam er während des Frühstücks auf neue Gedanken: Er wollte sein Vermögen flüssig machen, seine Schulden bezahlen und den Rest seines Kapitals bei dem Bankhause anlegen, mit dem schon sein Vater in Verbindung gestanden hatte.
Dieses Haus war die Firma Mongenod und Kompanie, gegründet im Jahre 1816 oder 1817, deren ehrenhaftes Renommee inmitten der kaufmännischen Verderbtheit, in die mehr oder weniger gewisse Pariser Firmen verfallen waren, niemals auch nur im geringsten angezweifelt worden war. Daher wurden, trotz ihres ungeheuren Reichtums, die Firmen Nucingen und Du Tillet, die Gebrüder Keller, Palma und Kompanie heimlich oder, wenn man will, von Mund zu Mund beredet, verachtet. Mit den übelsten Mitteln hatten sie so glänzende Resultate erreicht, und ihre politischen Erfolge, ihre dynastischen Grundsätze verhüllten ihre unsaubere Herkunft so gut, dass im Jahre 1834 niemand mehr an den Schmutz dachte, in dem diese majestätischen Stämme, diese Stützen des Staates, wurzelten. Und trotzdem gab es unter diesen Bankiers keinen einzigen, für den der lobenswerte Ruf des Hauses Mongenod nicht eine brennende Wunde war. Gleich den englischen Bankiers entfaltete das Haus Mongenod keinerlei äußeren Luxus; alles vollzog sich dort geräuschlos, man begnügte sich damit, Bankgeschäfte mit kluger Vorsicht und einer Ehrlichkeit zu machen, die den Operationen von einem Ende der Welt bis zum andern Sicherheit gewährten.
Der gegenwärtige Chef, Friedrich Mongenod, war der Schwager des Vicomte von Fontaine. Dessen zahlreiche Familie war auch durch den Baron von Fontaine mit dem Herrn Grossetête, dem Generalsteuereinnehmer, dem Bruder des Inhabers der Firma Grossetête und Kompanie in Limoges, mit Vandenesse und Planat de Baudry, dem anderen Generalsteuereinnehmer, verbunden. Diese Verwandtschaft, die dem verstorbenen alten Mongenod von großem Nutzen bei seinen Finanzoperationen unter der Restauration gewesen war, hatte ihm das Vertrauen der vornehmsten alten Adelsfamilien eingetragen, deren Kapitalien und ungeheuren Ersparnisse in seiner Bank angelegt wurden. Fern davon, nach der Pairschaft zu streben, wie die Kellers, die Nucingens und die Du Tillets, hielten sich die Mongenods von der Politik fern und wussten von ihr nicht mehr, als ein Bankhaus wissen muss.
Die Firma Mongenod war in einem prächtigen Hause in der Rue de la Victoire zwischen Hof und Garten untergebracht, wo auch die alte Frau Mongenod und ihre beiden Söhne, alle drei Geschäftsteilhaber, wohnten. Die Vicomtesse von Fontaine war beim Tode des alten Mongenod im Jahre 1827 ausbezahlt worden. Friedrich Mongenod, ein schöner junger Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, von kühlem, schweigsamem Wesen, zurückhaltend wie ein Genfer, gepflegt wie ein Engländer, hatte sich bei seinem Vater alle für seinen schwierigen Beruf erforderlichen Eigenschaften angeeignet. Besser gebildet als die meisten anderen Bankiers, hatte ihn seine Erziehung mit den umfassenden Kenntnissen, die der polytechnische Unterricht verleiht, ausgerüstet; wie viele Bankiers hatte er eine Liebhaberei außerhalb seines Berufs, eine Vorliebe für Mechanik und Chemie. Der zweite Mongenod, um zehn Jahre jünger als Friedrich, arbeitete bei seinem älteren Bruder wie der erste Gehilfe eines Notars oder eines Anwalts; Friedrich bildete ihn, wie ihn selbst sein Vater ausgebildet hatte, in allen Fächern des richtigen Bankiers aus, der für das Geld dasselbe bedeutet wie der Schriftsteller für die Ideen: Der eine wie der andere muss über alles Einschlägige unterrichtet sein. Als er seinen Familiennamen nannte, merkte Gottfried, welche Achtung sein Vater hier genossen hatte, denn er durfte durch die Büros hindurch sich bis an das Arbeitszimmer Mongenods begeben. Dieses Zimmer hatte nur Glastüren, so dass Gottfried, der nicht die Absicht hatte, zu horchen, das Gespräch, das drinnen geführt wurde, mit anhören musste.
»Gnädige Frau, Ihre Abrechnung beläuft sich in Einnahme und Ausgabe auf eine Million sechshunderttausend Franken, sagte der jüngere Mongenod. »Ich kenne die Absichten meines Bruders nicht, er allein kann beurteilen, ob ein Vorschuss von hunderttausend Franken möglich sein wird ... Sie waren nicht vorsichtig ... Man steckt doch nicht eine Million sechshunderttausend Franken in Handelsgeschäfte ...«
»Nicht so laut, Louis, sagte eine weibliche Stimme, »dein Bruder hat dir doch angeraten, immer nur leise zu sprechen. Es kann doch jemand in dem kleinen Salon nebenan sein.«
In diesem Augenblick öffnete Friedrich Mongenod die Verbindungstür zwischen seiner Wohnung und seinem Arbeitszimmer, bemerkte Gottfried und durchschritt das Arbeitszimmer, während er die Person, mit der sein Bruder sprach, respektvoll grüßte. »Mit wem habe ich die Ehre ...?« sagte er zu Gottfried und ließ ihn vorangehen.
Als Gottfried seinen Namen genannt hatte, ließ ihn Friedrich Platz nehmen, und während der Bankier seinen Schreibtisch öffnete, erhoben sich Louis Mongenod und eine Dame, die niemand anders als Frau de la Chanterie war, und gingen auf Friedrich zu. Alle drei traten in eine Fensternische und sprachen leise mit Frau Mongenod, der alle Geschäftsangelegenheiten unterbreitet wurden. Diese Frau hatte seit dreißig Jahren ihrem Gatten wie ihren Söhnen so viele Beweise ihrer Fähigkeiten gegeben, dass sie tätiger Geschäftsteilhaber mit dem Recht, die Firma zu zeichnen, geworden war. In einem Kasten sah Gottfried Akten mit der Aufschrift: »Konto de la Chanterie« mit den Nummern 1 bis 7. Als die Besprechung mit der Aufforderung des Bankiers an seinen Bruder: » Also geh zur Kasse« beendet war, wandte sich Frau de la Chanterie um, erblickte Gottfried, konnte noch eine Gebärde des Erstaunens zurückhalten und richtete mit leiser Stimme Fragen an Mongenod, auf die er mit wenigen Worten ebenso leise antwortete.
Frau de la Chanterie trug kleine dunkelblaue Schuhe und grauseidene Strümpfe, dasselbe Kleid wie am Abend vorher und darüber eine Art venezianischen Umhang, der wieder in Mode gekommen war, ferner einen Kapotthut »bonne femme« aus grüner Seide, der mit weißer Seide gefüttert war. Sie hielt sich sehr gerade, und ihre Haltung verriet, wenn nicht eine vornehme Abstammung, so doch, dass sie gewohnt war, in aristokratischer Umgebung zu leben. Ohne ihre außergewöhnliche Liebenswürdigkeit würde sie wohl als unnahbar erschienen sein. Jedenfalls machte sie einen imponierenden Eindruck.
»Es ist weniger ein Zufall, als ein Wink der Vorsehung, der uns hier zusammenführt, mein Herr«, sagte sie zu Gottfried; »ich war schon fast entschlossen, einen Pensionär abzulehnen, dessen Lebensgewohnheiten zu denen meines Hauses nicht zu passen schienen; aber Herr Mongenod hat mir eben Auskünfte über Ihre Familie gegeben, die mich ...«
»Oh, gnädige Frau ... Mein Herr,« sagte Gottfried, indem er sich gleichzeitig an Frau de la Chanterie und an den Bankier wandte, » ich habe keine Familie mehr; ich kam nur her, um den früheren Bankier meines Vaters um Rat zu fragen, mit welcher neuen Lebensweise ich mich meinen Vermögensverhältnissen anpassen müsste.«
Und mit wenigen Worten erzählte Gottfried von seinem bisherigen Leben und äußerte den Wunsch, ein anderes anzufangen.
»Früher« , sagte er, »wäre ein Mann in meiner Lage ins Kloster gegangen; aber wir haben ja keine Mönchsorden mehr ...«
» Ziehen Sie nur zu der gnädigen Frau, wenn sie Sie als Pensionär aufnehmen will,« sagte Friedrich Mongenod, nachdem er mit Frau de la Chanterie einen Blick gewechselt hatte; »verkaufen Sie Ihre Rentenpapiere nicht, sondern lassen Sie sie mir. Geben Sie mir ein genaues Verzeichnis Ihrer Verpflichtungen, ich werde die Zahlungsfristen mit Ihren Gläubigern vereinbaren, Sie werden dann ungefähr hundertfünfzig Franken monatliches Einkommen haben. Zwei Jahre dauert es, bis Ihre Angelegenheiten geordnet sein werden. Während dieser zwei Jahre werden Sie an Ihrem neuen Aufenthaltsorte genügend Muße haben, an einen anderen Beruf zu denken, vor allem im Zusammenleben mit Persönlichkeiten, die Ihnen gute Ratschläge geben können.«
Louis Mongenod brachte jetzt hundert Banknoten zu tausend Franken und übergab sie Frau de la Chanterie. Dann reichte Gottfried seiner zukünftigen Wirtin den Arm und führte sie zu ihrem Wagen.
»Also auf baldiges Wiedersehn«, sagte sie in freundlichem Tone. »Um welche Zeit treffe ich Sie zu Hause, gnädige Frau?« fragte Gottfried.
»In zwei Stunden«.
» Dann habe ich Spielraum, meine Möbel inzwischen zu verkaufen« , sagte er und empfahl sich.
Während der kurzen Zeit, wo er Arm in Arm mit Frau de la Chanterie gegangen war, sah Gottfried sie immer mit der Glorie umstrahlt, die die Worte Louis Mongenods: »Ihr Saldo beträgt eine Million sechshunderttausend Franken« über diese Frau ausgegossen hatten, deren Leben sich in der Verborgenheit des Klosters Notre-Dame abspielte. Der Gedanke: sie muss reich sein! ließ sie ihn mit völlig andern Augen betrachten. ›Wie alt mag sie wohl sein?‹ fragte er sich. Und vor seinem Geiste spielte sich schon ein Roman während seines Aufenthaltes in der Rue Chanoinesse ab. ›Sie hat ein so vornehmes Auftreten! Sollte sie Bankgeschäfte machen?‹ sagte er sich.
In unserer Zeit würden von tausend jungen Männern in Gottfrieds Lage neunhundertneunundneunzig auf den Gedanken gekommen sein, diese Frau zu heiraten.
Ein Möbelhändler, der auch ein wenig Tapezierer und hauptsächlich Vermieter möblierter Zimmer war, gab Gottfried ungefähr dreitausend Franken für alles, was er verkaufen wollte, und überließ ihm die Möbel noch für die Tage, während deren die hässliche Wohnung in der Rue Chanoinesse in Ordnung gebracht wurde, in die sich der Gemütsleidende nun sofort begab. Er ließ einen Maler, dessen Adresse ihm Frau de la Chanterie nannte, kommen, der es übernahm, binnen einer Woche die Decke weiß anzustreichen, die Fenster zu säubern und das Holzwerk und den Fußboden neu zu malen. Gottfried maß die Zimmer aus, um sie vollständig mit billigem grünem Teppichstoff ausschlagen zu lassen. Er wünschte seine Zellen mit schlichtester Einförmigkeit auszustatten. Frau de la Chanterie stimmte dem zu. Sie berechnete mit Manons Hilfe, wieviel Schirting für die Fenstervorhänge und für die eines bescheidenen eisernen Bettes erforderlich war; dann übernahm sie die Anschaffung und Herstellung für einen Preis, dessen Billigkeit Gottfried überraschte. Mit den mitgebrachten Möbeln kostete ihn die Ausstattung seiner Wohnung nicht mehr als sechshundert Franken.
»Ich werde also ungefähr tausend Herrn Mongenod übergeben können.«
»Wir führen hier«, sagte Frau de la Chanterie, »ein christliches Leben, das, wie Sie wissen, sich mit dem vielen überflüssigen Luxus, an dem Sie noch zu sehr hängen, schlecht verträgt.«
Während sie ihrem zukünftigen Pensionär Ratschläge gab, betrachtete sie einen Diamanten, der in dem Ring funkelte, mit dem Gottfrieds blaue Krawatte zusammengehalten wurde.
»Ich spreche mit Ihnen nur davon,« fuhr sie fort, »weil ich sehe, dass Sie die Absicht haben, mit dem Leben der Zerstreuungen, über das Sie sich gegen Herrn Mongenod beklagt haben, zu brechen.«
Gottfried betrachtete Frau de la Chanterie, während er sich an dem Wohlklang ihrer klaren Stimme erfreute; er prüfte ihr ganz weißes Gesicht, das einem jener ernsten kalten holländischen ähnelte, die der Pinsel der Flämischen Schule so gut wiedergegeben hat und auf denen man sich keine Runzeln denken kann.
›Sie ist weiß und rund!‹ sagte er sich, als er fortging; ›aber sie hat sehr viel weiße Haare ...‹
Wie alle schwachen Naturen hatte sich Gottfried schnell damit ausgesöhnt, ein neues Leben, das er für ein glückliches erachtete, zu führen, und so wollte er seinen Umzug nach der Rue Chanoinesse beschleunigen; dennoch konnte er sich der Vorsicht oder, wenn man will, des Misstrauens nicht ganz entschlagen. Zwei Tage vor seinem Umzug begab er sich wieder zu Herrn Mongenod, um noch einige Erkundigungen über das Haus, in dem er seinen Aufenthalt nehmen wollte, einzuziehen. Während der kurzen Augenblicke, die er in seiner künftigen Wohnung verweilt hatte, um die Umgestaltungen nachzuprüfen, hatte er ein Kommen und Gehen mehrerer Personen beobachtet, deren Wesen und Haltung, wenn auch nicht etwas Geheimnisvolles, so doch die Ausübung irgendeines Berufes, irgendeiner heimlichen Tätigkeit der Hausbewohner vermuten ließ. Es war zu dieser Zeit viel die Rede von Versuchen der älteren Linie des Hauses Bourbon, wieder auf den Thron zu gelangen, und Gottfried glaubte an irgendeine Verschwörung. Als er in dem Arbeitszimmer des Bankiers und unter dessen forschendem Blick seine Fragen stellte, schämte er sich seiner selbst, da er ein sardonisches Lächeln die Lippen Friedrich Mongenods umspielen sah.
»Frau Baronin de la Chanterie«, antwortete dieser, »ist eine der unbekanntesten, aber zugleich eine der ehrenhaftesten Persönlichkeiten von Paris. Haben sie einen bestimmten Grund, um sich bei mir über sie zu erkundigen?«
Gottfried beschränkte sich auf eine banale Antwort: Er solle für lange Zeit mit Fremden zusammenleben, man müsse doch wissen, mit wem man in so enge Verbindung trete, usw. Aber das Lächeln des Bankiers wurde immer ironischer, und Gottfried, der mehr und mehr in Verlegenheit geriet, schämte sich seines Schrittes, der von keinerlei Erfolg begleitet war, denn er wagte keine Fragen mehr zu stellen, weder in Bezug auf Frau de la Chanterie noch auf ihre Hausgenossen.
Zwei Tage danach, an einem Montagabend, nachdem er zum letztenmal im Cafe Anglais gespeist und die beiden ersten Stücke im Théâtre des Variétés gesehen hatte, erschien er um zehn Uhr in der Rue Chanoinesse und wurde von Manon in seine Wohnung geführt. Die Einsamkeit hat Reize, die mit denen des Lebens in der Wildnis verglichen werden können, die jeder Europäer, der einmal dort weilte, empfunden hat. Das mag seltsam erscheinen in einer Zeit, wo jeder so sehr für den andern lebt, dass sich einer über den andern den Kopf zerbricht und ein Privatleben bald nicht mehr existieren wird, so keck und so wissbegierig dringen die Augen der Zeitung, dieses modernen Argus, in es ein; trotzdem wird diese Ansicht durch die Autorität der ersten sechs Jahrhunderte des Christentums gestützt, in denen kein Einsiedler in das gesellige Leben zurückkehrte. Es gibt wenige Seelenwunden, die die Einsamkeit nicht zu heilen vermag. So wurde auch Gottfried zuerst von der tiefen Ruhe und der vollkommenen Stille seiner neuen Wohnung gefangen genommen, ganz wie ein müder Reisender sich in einem Bade ausruht.
Am Tage, nachdem er sich bei Frau de la Chanterie in Pension gegeben hatte, sah er sich zu einer Selbstprüfung genötigt, da er sich von allem Bisherigen getrennt fühlte, selbst von Paris, obwohl er sich noch im Schatten der Kathedrale befand. Aller weltlichen Eitelkeiten beraubt, sollte er für sein Handeln keine andern Zeugen mehr haben als sein Gewissen und die Hausgenossen der Frau de la Chanterie. Das hieß, die breite Straße des Weltlebens verlassen und einen unbekannten Weg betreten; aber wohin würde ihn dieser Weg führen? Was für eine Tätigkeit sollte er aufnehmen?
Seit zwei Stunden hatte er sich diesen Überlegungen hingegeben, als Manon, die einzige Dienerin des Hauses, an seine Tür klopfte und ihm sagte, dass das zweite Frühstück aufgetragen sei und man ihn erwarte. Es schlug zwölf Uhr. Der neue Pensionär ging sofort hinab, voll Verlangen, die fünf Personen, unter denen sich von jetzt ab sein Leben abspielen sollte, näher kennenzulernen. Als er den Salon betrat, fand er dort alle Bewohner des Hauses stehend und ebenso gekleidet vor, wie an dem Tage, als er hier seine ersten Erkundigungen eingezogen hatte.
»Haben Sie gut geschlafen?« fragte ihn Frau de la Chanterie.
»Ich bin erst um zehn Uhr aufgewacht«, antwortete Gottfried und verbeugte sich vor den vier Hausgenossen, die alle seinen Gruß ernst erwiderten.
»Das haben wir uns gedacht«, sagte lächelnd der Alte, der den Namen Alain trug.
»Manon hat mich zum zweiten Frühstück gerufen,« fuhr Gottfried fort, »mir scheint, dass ich ohne Absicht gegen die Hausordnung gefehlt habe ... Wann pflegen Sie aufzustehen?«
»Wir stehen nicht ganz so früh auf, wie die ehemaligen Mönche,« erwiderte Frau de la Chanterie liebenswürdig, »aber so früh wie die Arbeiter ... im Winter um sechs, im Sommer um einhalb vier Uhr. Und wir gehen auch mit der Sonne zu Bett. Wir schlafen im Winter stets um neun, im Sommer um elf Uhr. Morgens nehmen wir alle ein wenig Milch, die von unserm Pachtgut kommt, zu uns, nachdem wir gebetet haben, mit Ausnahme des Herrn Abbé de Vèze, der im Sommer um sechs, im Winter um sieben Uhr die erste Messe in Notre-Dame liest, die diese Herren täglich hören, ebenso wie Ihre ergebenste Dienerin.«
Frau de la Chanterie beendete diese Auseinandersetzung bei Tisch, nachdem die fünf Teilnehmer Platz genommen hatten.
Das Speisezimmer, ganz in Grau gemalt und mit Holztäfelung im Stil Ludwigs XIV. versehen, stieß an den vorzimmerartigen Raum, in dem sich Manon aufhielt, und war dem Zimmer der Frau de la Chanterie parallel gelegen, das seinerseits jedenfalls mit dem Salon verbunden war. Das Esszimmer hatte keinen andern Schmuck als alte Wandborde. Das Mobiliar bestand aus sechs Stühlen mit ovaler Rücklehne, deren Stickereien offenbar von Frau de la Chanterie verfertigt waren, zwei Büfetts und einem Mahagonitisch, auf den Marion zum Frühstück kein Tischtuch auflegte. Das Frühstück, von klösterlicher Einfachheit, bestand aus einer kleinen Steinbutte mit weißer Soße und Kartoffeln, Salat und vier Schüsseln mit Früchten: Pfirsiche, Weintrauben, Erdbeeren und grünen Mandeln; als Vorgericht Honig in der Wabe, wie in der Schweiz, Butter, Radieschen, Gurken und Sardinen. Aufgetragen wurde es auf Porzellan, das mit Kornblumen und kleinen grünen Blättern verziert war und unter Ludwig XVI. sicher als sehr luxuriös galt, das aber die erhöhten Ansprüche des modernen Lebens sehr gewöhnlich gemacht haben.
»Wir haben Fastenessen«, sagte Herr Alain. »Da wir jeden Morgen die Messe hören, werden Sie begreifen, dass wir blindlings alle, selbst die strengsten Vorschriften der Kirche befolgen.«
»Und Sie werden damit beginnen, es ebenso zu machen«, sagte Frau de la Chanterie und warf einen Seitenblick auf Gottfried, den sie neben sich gesetzt hatte.
Von den fünf Tischgenossen kannte Gottfried bereits die Namen der Frau de la Chanterie, des Abbé de Vèze und des Herrn Alain; es blieb ihm also noch übrig, die Namen der beiden letzten Personen zu erfahren. Diese verhielten sich schweigend und aßen mit der Aufmerksamkeit, die Geistliche auch den geringsten Einzelheiten ihrer Mahlzeiten zuzuwenden pflegen.
»Kommen diese schönen Früchte auch von Ihrem Pachtgut, gnädige Frau?« sagte Gottfried. »Jawohl«, erwiderte sie. »Wir haben, ganz wie die Regierung, unser kleines Mustergut, dort ist unser Landhaus; es liegt drei Meilen von hier an der Straße nach Süden, nahe bei Villeneuve-Saint-Georges.
»Es ist eine Besitzung, die uns allen gehört, und die auf den letzten Überlebenden von uns übergeht«, sagte der biedere Alain.
»Oh, es hat keinen erheblichen Wert«, fügte Frau de la Chanterie hinzu, die zu fürchten schien, dass Gottfried diese Erklärung für einen Köder halten könnte.
»Es sind«, sagte der eine der beiden Unbekannten, »dreißig Morgen Ackerland, sechs Morgen Wiesen und vier eingefriedigte Morgen um unser Haus, vor dem das Pächterhaus liegt.«
»Aber ein solches Gut«, entgegnete Gottfried, »muss einen Wert von mehr als hunderttausend Franken haben.«
» Oh, wir haben nicht viel anderes davon als unsern Bedarf an Lebensmitteln«, antwortete dieselbe Persönlichkeit.
Es war ein großer, hagerer, würdevoller Mann. Auf den ersten Anblick schien er ein früherer Soldat zu sein, seine weißen Haare verkündeten deutlich genug, dass er die Sechzig überschritten hatte, und sein Gesicht trug die Spuren schweren Kummers, der von der Religion gemildert war.
Der andere Unbekannte, der gleichzeitig einem Gymnasialprofessor und einem Geschäftsmann ähnelte, war von mittlerem Wuchs, dick, aber trotzdem beweglich; sein Gesicht trug den Stempel von Gemütlichkeit, wie ihn die Pariser Notare und Anwälte zur Schau tragen.
Die Kleidung der vier Männer zeigte die Sauberkeit, die durch peinliche Sorgsamkeit erreicht wird. Man erkannte Manons Hand an den kleinsten Einzelheiten. Die Anzüge waren vielleicht zehn Jahre alt und geschont, wie sich die Kleidungsstücke der Pfarrer durch die heimliche Kunst der Dienerin bei ständigem Gebrauch erhalten. Diese Männer trugen sozusagen die Livree einer systematisch geordneten Lebensweise, sie gehorchten alle demselben Gedanken, in ihren Blicken ließ sich dieselbe Anschauung lesen, ihr Gesichtsausdruck verkündete stille Ergebung und eine sich den andern mitteilende Seelenruhe.
»Wäre es indiskret, gnädige Frau,« sagte Gottfried, »nach dem Namen der Herren zu fragen? Ich bin bereit, ihnen die Geschichte meines Lebens mitzuteilen; kann ich nicht auch von dem ihrigen so viel erfahren, wie ich schicklicherweise wissen darf? »Dieser Herr«, erwiderte Frau de la Chanterie und wies auf den großen hageren Mann, »heißt Herr Nikolaus; er ist pensionierter Gendarmerieoberst mit dem Range eines Brigadegenerals. – Dieser Herr«, fuhr sie fort und zeigte auf den kleinen dicken Mann, »ist ein ehemaliger Rat am obersten Pariser Gerichtshof, der sein Amt im Jahre 1850 aufgegeben hat; er heißt Herr Joseph. Obgleich Sie erst seit gestern bei uns sind, will ich Ihnen doch mitteilen, dass Herr Nikolaus in der Gesellschaft den Namen Marquis de Montauran trug, und Herr Joseph den Namen Lecamus, Baron de Tresnes; aber für uns wie für jeden andern existieren diese Namen nicht mehr, die Herren besitzen keine Erben; sie haben die Vergessenheit, in die ihre Familien geraten werden, vorweggenommen und sind ganz einfach Herr Nikolaus und Herr Joseph geworden, wie Sie Herr Gottfried sein werden.«
Als er die beiden Namen nennen hörte, den einen in den Annalen des Royalismus durch die Katastrophe, die den Aufstand der Chouans zu Beginn des Konsulats beendete, so berühmt geworden, den andern in den Annalen des alten Pariser Parlaments mit solcher Verehrung genannt, konnte Gottfried ein Erzittern nicht unterdrücken; aber als er diese zwei Reste der beiden stärksten Stützen der zusammengebrochenen Monarchie, des Adels und des Richterstandes, betrachtete, bemerkte er keinerlei Bewegung in ihren Gesichtszügen, keinerlei Veränderung des Ausdrucks, der einen weltlichen Gedanken verriet. Die beiden Männer erinnerten sich nicht mehr oder wollten sich nicht mehr an das erinnern, was sie einstmals gewesen waren. Das war eine erste Lektion für Gottfried.
»Jeder dieser Namen, meine Herren, enthält eine ganze Geschichte«, sagte er respektvoll.
»Die Geschichte unserer Zeit,« antwortete Herr Joseph, »die Geschichte von Ruinen.«
»Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft«, bemerkte Herr Alain lächelnd.
Dieser Mann kann mit zwei Worten beschrieben werden: er war ein Pariser Kleinbürger, ein gutmütiger Bürger mit einem runden, von weißen Haaren umrahmten Gesicht, das infolge eines beständigen Lächelns etwas fade wirkte.
Was den Priester, den Abbé de Vèze anlangt, so sagte sein Stand alles. Einen Priester, der seinen Beruf ausfüllt, erkennt man auf den ersten Blick, den er Einem oder den man ihm zuwirft.
Was Gottfried gleich anfangs auffiel, das war die tiefe Verehrung, die die vier Pensionäre der Frau de la Chanterie bezeigten; sie schienen sich alle, selbst der Priester, trotz der erhabenen Position, die ihm sein Amt verlieh, in Gegenwart einer Königin zu befinden. Gottfried fiel auch die Mäßigkeit aller Tischgenossen auf. Jeder aß nur so viel, wie das Nahrungsbedürfnis erforderte. Frau de la Chanterie nahm, wie fast alle andern, nur einen einzigen Pfirsich und eine halbe Weintraube; aber sie sagte zu ihrem neuen Pensionär, er solle diese Zurückhaltung nicht nachahmen, und bot ihm nacheinander von jedem Gerichte an.
Durch diesen Beginn des Zusammenlebens wurde Gottfrieds Neugier aufs äußerste erregt. Als man nach dem Frühstück in den Salon zurückkehrte, ließ man ihn allein, und Frau de la Chanterie hielt in einer Fensternische eine kleine geheime Besprechung mit den vier Freunden ab, diese Konferenz währte ohne jede Erregung beinahe eine halbe Stunde. Man sprach mit leiser Stimme und wechselte Worte, die jeder wohlüberlegt zu haben schien. Von Zeit zu Zeit blätterten Herr Alain und Herr Joseph in einem Notizbuche.
»Gehen Sie in den Faubourg«, sagte Frau de la Chanterie zu Herrn Joseph, der sich entfernte.
Das war das erste Wort, das Gottfried verstehen konnte.
»Und Sie in das Viertel Saint-Marceau«, fuhr sie fort und wandte sich an Herrn Nikolaus. »Bearbeiten Sie den Faubourg Saint-Germain und versuchen Sie, dort das, was wir brauchen, zu finden ... fuhr sie, den Abbé de Vèze ansehend, fort, der sich sogleich entfernte.
»Und Sie, mein lieber Alain,« sagte sie lächelnd zu dem letzten, »machen Sie sich an die Zusammenstellung... So, jetzt ist die Arbeit für heute verteilt «, sagte sie und begab sich wieder zu Gottfried. Sie setzte sich in ihren Sessel, nahm von einem kleinen Tisch von ihr zurechtgeschnittene Wäsche und begann zu nähen, als ob sie ein Pensum zu erledigen hätte.
Gottfried in sein Grübeln versunken und eine royalistische Verschwörung vermutend, hielt die Worte seiner Wirtin für eine Einleitung und unterwarf sie einer Beobachtung, indem er sich neben sie setzte. Er war erstaunt über die besondere Geschicklichkeit, mit der diese Frau, bei der alles die vornehme Dame verriet, ihre Arbeit ausführte; sie besaß die Gewandtheit einer Arbeiterin, denn jeder vermag an gewissen Handgriffen das Tun eines Handwerkers und das eines Dilettanten zu erkennen.
»Sie arbeiten,« sagte Gottfried, »als ob Sie das Handwerk verstünden!«
»Ach,« antwortete sie, ohne den Kopf zu erheben, »ich habe es einstmals gezwungen ausüben müssen...
Zwei dicke Tränen perlten in den Augen der alten Dame, rannen an ihren Wangen hinab und fielen auf das Wäschestück, das sie in der Hand hielt.
»Oh, verzeihen Sie mir, gnädige Frau«, rief Gottfried.
Frau de la Chanterie sah ihren neuen Pensionär an und las auf seinem Gesicht ein so tiefes Bedauern, dass sie ihm freundlich zunickte. Nachdem sie sich die Augen getrocknet hatte, nahm ihr Antlitz sofort wieder den Ausdruck seiner gewohnten Ruhe an; es war weniger kalt als kühl.
»Sie befinden sich hier, Herr Gottfried – Sie wissen ja bereits, dass wir Sie nur mit ihrem Vornamen nennen werden –, mitten unter den Trümmern eines großen Zusammenbruchs. Wir alle sind schwer verwundet in unserm Herzen, unsern Familienangelegenheiten und unserm Vermögen durch den vierzig Jahre dauernden Orkan, der das Königtum und die Religion gestürzt und die Grundlagen des alten Frankreichs vernichtet hat. Scheinbar gleichgültige Worte können uns alle verletzen, das ist der Grund der Schweigsamkeit, die hier herrscht. Wir sprechen selten von uns selbst; wir sind für uns in Vergessenheit geraten und haben das Mittel gefunden, an Stelle unseres früheren Lebens ein anderes zu setzen. Das ist der Grund, warum ich nach Ihren Bekenntnissen bei Mongenod an eine Übereinstimmung zwischen Ihrer und unserer Situation geglaubt und meine vier Freunde dazu bestimmt habe, Sie in unsern Kreis aufzunehmen; wir brauchen außerdem noch einen Mönch mehr für unser Kloster. Aber was werden Sie nun beginnen? Man kann sich nicht in die Einsamkeit zurückziehen ohne moralischen Fonds.«
»Ich wäre nach solchen Worten sehr glücklich; gnädige Frau, wenn Sie über meine Zukunft bestimmen wollten.«
»Sie sprechen wie ein Weltmann,« entgegnete sie, »Sie versuchen, mir zu schmeicheln, mir, einer Frau von sechzig Jahren!... Mein liebes Kind,« fuhr sie fort, »Sie müssen wissen, dass Sie sich unter Leuten befinden, die streng gottesgläubig sind, die seine Hand verspürt und die sich ihm fast ganz so wie Trappisten hingegeben haben. Haben Sie auf das ungeheure Sicherheitsgefühl der echten Priester geachtet, die sich dem Herrn ganz hingegeben haben, seine Stimme vernehmen und sich bemühen, ein gelehriges Instrument in der Hand der Vorsehung zu sein? ... Sie kennen keine Eitelkeit, keine Selbstliebe, nichts von dem, was den Weltleuten beständig Wunden beibringt; sie besitzen die Ruhe des Fatalisten, ihre Ergebung lässt sie alles ertragen. Der echte Priester, ein solcher wie der Abbé de Vèze, lebt dann wie ein Kind bei seiner Mutter, denn die Kirche, mein lieber Herr, ist eine gute Mutter. Nun, man kann auch ein Priester werden ohne Tonsur, nicht alle Priester gehören zu einem Orden. Sich dem Guten angeloben, das heißt, es dem echten Priester gleichtun, das heißt, Gott gehorchen! Ich predige Ihnen nicht, ich will Sie nicht bekehren, ich will Ihnen nur unser Leben erklären.«
»Belehren Sie mich, gnädige Frau,« sagte Gottfried hingerissen, »damit ich Ihre Vorschriften in keinem Punkte übertrete.«
»Damit hätten Sie zuviel zu tun, das werden Sie von Stufe zu Stufe lernen, vor allem sprechen Sie hier niemals von Ihrem Unglück, das eine Kinderei ist im Vergleich mit den schrecklichen Katastrophen, die Gott über die, mit denen Sie jetzt zusammenleben, hat hereinbrechen lassen ...«
Während sie so sprach, hatte Frau de la Chanterie immerfort ihre Stiche mit verzweifelter Regelmäßigkeit gemacht; jetzt aber erhob sie das Haupt und sah Gottfried an, auf den die bezaubernde Süße ihrer Stimme, die, wie man sagen muss, eine himmlische Milde besaß, einen tiefen Eindruck machte. Der gemütskranke junge Mann betrachtete voller Verehrung die wahrhaft ungewöhnliche Erscheinung dieser Frau, deren Antlitz leuchtete. Ein rosiger Hauch hatte sich über ihre wachsbleichen Wangen ergossen, ihr Auge strahlte, ein jugendlicher Geist belebte ihre leichten Runzeln, die ihr einen eigenen Reiz verliehen, und alles an ihr forderte liebevolle Zuneigung heraus. Gottfried ermaß in diesem Moment die Tiefe des Abgrunds, der diese Frau von niedrigen Empfindungen trennte; er sah, dass sie den unzugänglichen Gipfel erreicht hatte, auf den sie von der Religion geführt war, und er war noch zu weltlich gesinnt, als dass er davon nicht stark betroffen worden wäre und nicht gewünscht hätte, in den Graben hinabzusteigen und die schmale Höhe zu erklimmen, auf der Frau de la Chanterie stand, um sich neben sie zu stellen. Während er diese Frau einer eingehenden Prüfung unterwarf, erzählte er ihr von den Enttäuschungen seines Lebens und von allem, was er bei Mongenod nicht hatte sagen können, wo seine Bekenntnisse sich auf die Darlegung seiner Lage beschränkt hatten.
»Armes Kind!...«
Dieser mütterliche Ausruf, der den Lippen der Frau de la Chanterie entschlüpfte, legte sich wie Balsam auf das Herz des jungen Mannes.
»Was kann ich an die Stelle so vieler getäuschter Hoffnungen, so vieler verratener Liebe setzen?« fragte er endlich und sah seine Wirtin an, die nachdenklich geworden war.
»Ich bin hierher gekommen, um nachzudenken und einen Entschluss zu fassen. Ich habe meine Mutter verloren, treten Sie an ihre Stelle ...«
»Werden Sie auch wie ein Sohn gehorchen?...« sagte sie.
»Ja, wenn Sie mir die volle Zuneigung entgegenbringen, der man so gern gehorcht.«
»Also, wir wollen es versuchen«, versetzte sie.
Gottfried streckte die Hand aus, um die Hand seiner Wirtin zu ergreifen, die sie ihm, seine Absicht ahnend, reichte, und führte sie respektvoll an seine Lippen. Frau de la Chanteries Hände waren von wunderbarer Schönheit, ohne Runzeln, weder fett noch mager, so weiß, dass sie den Neid einer jungen Frau erregen konnten, und von einer Form, dass sie ein Bildhauer hätte abbilden mögen. Gottfried bewunderte die Hand, und fand, dass sie zu dem Reiz der Stimme und der himmlischen Bläue der Augen passte.
»Bleiben Sie!« sagte Frau de la Chanterie, erhob sich und ging in ihr Zimmer.
Gottfried empfand eine heftige Erregung und wusste nicht, was er von ihrem Fortgehen denken sollte; aber sein Erstaunen dauerte nicht lange, denn sie kam mit einem Buch in der Hand zurück.
»Hier, mein liebes Kind , sagte sie, »haben Sie die Vorschriften eines großen Seelenarztes. Wenn die Verhältnisse des alltäglichen Lebens uns das Glück, das wir erwarteten, nicht zuteil werden ließen, dann muss man das Glück in dem höheren Leben suchen, und hier haben Sie den Schlüssel zu dieser neuen Welt. Lesen Sie jeden Abend und jeden Morgen ein Kapitel dieses Buches; aber lesen Sie es mit vollster Aufmerksamkeit, studieren Sie die Worte, als ob es sich um eine fremde Sprache handele ... Nach Verlauf eines Monats werden Sie ein anderer Mensch sein. Seit zwanzig Jahren lese ich täglich ein Kapitel, und meine drei Freunde, die Herren Nikolaus, Alain und Joseph, versäumen das ebensowenig wie das Schlafengehen und Aufstehen; machen Sie es ebenso aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu mir«. Sie sprach mit himmlischer Freudigkeit und erhabenem Vertrauen.
Gottfried wandte das Buch um und las auf dem Rücken in Goldbuchstaben: »Die Nachahmung Christi«. Die Einfachheit dieser Frau, ihre kindliche Reinheit, ihre Überzeugung, dass sie ihm eine Wohltat erwiesen habe, verwirrten den Exdandy. Die Haltung und die Freude der Frau de la Chanterie glich vollständig denen einer Frau, die einem Kaufmann, der im Begriff ist, Konkurs anzumelden, hunderttausend Franken darbietet.
»Ich habe mich seiner seit zwanzig Jahren bedient. Gebe Gott, dass das Buch ansteckend wirke! Gehen Sie nun, und kaufen Sie mir ein anderes; es ist jetzt die Zeit, wo Leute zu mir kommen, die nicht gesehen werden dürfen.«
Gottfried empfahl sich der Frau de la Chanterie und ging in sein Zimmer hinauf, wo er das Buch auf den Tisch warf und ausrief: »O die arme gute Frau!...« Das Buch hatte sich wie alle oft gelesenen Bücher an einer Stelle aufgeklappt. Gottfried setzte sich, um sich zu sammeln, denn er hatte an diesem Vormittag mehr Aufregung empfunden als während der bewegtesten Monate seines Lebens, und besonders seine Neugierde war noch niemals so angestachelt worden. Als er seine Blicke planlos herumschweifen ließ, wie es Leute tun, die in Nachdenken versunken sind, betrachtete er mechanisch die beiden aufgeschlagenen Seiten des Buches und las, ohne es zu wollen, die Überschrift:
»Kapitel XII.
Von dem erhabenen Wege des heiligen Kreuzes.«
Er nahm das Buch auf. Und wie eine Flammenschrift fesselte ein Satz dieses herrlichen Kapitels seinen Blick:
»Er ist vor euch gewandelt mit seinem Kreuz beladen, und er ist für euch gestorben, damit auch ihr euer Kreuz traget und verlanget, an ihm zu sterben. Gehet, wohin ihr wollt, suchet, soviel ihr möget, ihr werdet keinen erhabeneren und keinen sichereren Weg finden, als ›den Weg des heiligen Kreuzes‹.
Machet und ordnet alles, wie es eurem Verlangen und eurer Einsicht entspricht, und ihr werdet stets aufgerufen werden, Mühsal zu erleiden, ob ihr nun wollet oder nicht, und immer werdet ihr auf das Kreuz stoßen; denn ihr werdet die Schmerzen des Körpers fühlen und die Qualen der Seele erdulden. Wenn ihr von Gott verlassen seid, werden euch die Menschen zu schaffen machen. Und noch mehr: ihr werdet euch oft selbst zur Last sein, und keine Hilfe wird euch gebracht, kein Trost euch zuteil werden; bis es Gott gefallen wird, dem ein Ende zu machen, werdet ihr leiden müssen, denn Gott will, dass ihr leiden lernet ohne Trost, damit ihr euch rückhaltlos seinem Willen unterwerfet, und damit ihr unter der Last der Drangsale demütiger werdet.
»Was für ein Buch!« sagte er und blätterte weiter in dem Kapitel.
Und sein Auge fiel auf die Worte:
»Wenn ihr soweit gekommen seid, die Trübsal als süß zu empfinden und sie zu begehren aus Liebe zu Jesus Christus, dann werdet ihr euch glücklich fühlen, denn dann habt ihr das Paradies in dieser Welt gefunden.«
Betroffen über diese einfachen Worte, die darum gerade so stark wirkten, und ärgerlich, dass er sich von diesem Buche geschlagen fühlte, schloss er es; aber noch auf dem grünen Maroquinleder des Einbands las er in Goldbuchstaben die Mahnung:
»Trachtet nur nach dem, was ewig ist!«
»Und haben sie das hier gefunden?...« fragte er sich. Er brach auf, um ein schönes Exemplar der »Nachahmung Christi« zu besorgen, da er daran dachte, dass Frau de la Chanterie abends ein Kapitel daraus zu lesen pflegte, ging hinunter und trat auf die Straße hinaus. Einige Augenblicke blieb er wenige Schritte vor der Tür stehen, unschlüssig, welchen Weg er nehmen, und überlegend, wo und in welcher Buchhandlung er das Buch kaufen solle; da vernahm er das dumpfe Geräusch des schweren Haustors, das geschlossen wurde.
Wenn man den Charakter dieses alten Hauses recht begriffen hat, wird man verstehen, worin sich die alten Häuser von andern unterscheiden. Als Manon Gottfried am Morgen herunterholen kam, hatte sie ihn, deutlich lächelnd, gefragt, wie er die erste Nacht im Hause de la Chanterie geschlafen habe. Zwei Männer verließen das Haus de la Chanterie. Gottfried folgte, ohne irgendwie spionieren zu wollen, den beiden Männern, die ihn für einen Passanten hielten und in dieser stillen Gegend so laut sprachen, dass er ihrer Unterhaltung folgen konnte. Die beiden Unbekannten gingen die Rue Massillon entlang, an Notre-Dame vorbei und quer über den Platz.
»Na, mein Alter, du siehst, dass es ziemlich leicht war, Geld von ihnen herauszuholen... man muss ihnen zum Munde reden... das ist alles.«
»Aber wir schulden es doch.«
»Wem?«
»Nun, der Dame.«
»Das möchte ich sehen, ob mich die alte Schachtel verklagen würde, ich würde ihr...«
»Du würdest ihr... du würdest ihr zurückzahlen...«
»Du hast recht, denn wenn ich es ihr zurückzahle, würde ich später mehr als heute bekommen...«
»Wäre es nicht besser, wenn wir ihren Rat befolgten und ein Geschäft anfingen?«
»Ach, Unsinn!«
»Sie würde uns doch stille Teilhaber verschaffen, hat sie gesagt.«
»Dann müsste man auch ein anderes Leben anfangen...«
»Das jetzige habe ich bis hierher, man ist doch kein Mensch mehr; wenn man immer benebelt herumläuft...«
»Jawohl; aber der Abbé hat doch neulich den alten Marin im Stiche gelassen und ihm alles abgeschlagen.«
»Ach, der alte Marin wollte eine knifflige Sache unternehmen, wie sie nur Millionäre durchsetzen können.«
In diesem Moment wandten sich die beiden Männer, ihrem Äußern nach Werkmeister, um nach der Place Maubert über den Pont de l'Hôtel-Dieu zu gehen; Gottfried trat beiseite, aber als sie bemerkten, dass er so dicht hinter ihnen war, wechselten sie einen misstrauischen Blick, und ihr Gesicht verriet, dass sie bedauerten, laut gesprochen zu haben.
In Gedanken hierüber ging er zu einem Buchhändler in der Rue Saint-Jacques und kehrte mit einem sehr kostbaren Exemplar der neusten Ausgabe der »Nachahmung Christi«, die in Frankreich erschienen war, zurück. Als er langsamen Schrittes heimging, um pünktlich zur Essensstunde einzutreffen, rief er sich noch einmal die Empfindungen, die er an diesem Vormittage verspürt hatte, ins Gedächtnis zurück und fühlte sich innerlich aufs köstlichste erquickt. Er war von einer heißen Neugier geplagt, aber seine Neugierde trat zurück vor einem unerklärlichen Verlangen, das ihn zu Frau de la Chanterie hinzog; er empfand ein heftiges Begehren, sich an sie anzuschließen, sich für sie aufzuopfern, ihr zu gefallen, sich ihr Lob zu verdienen; er war von einer platonischen Liebe ergriffen, er ahnte bei ihr eine unerhörte Seelengröße, er wollte ihr Inneres ganz kennenlernen. Er brannte darauf, in die Geheimnisse der Existenz dieser Katholiken von reiner Frömmigkeit einzudringen. Und innerhalb dieses kleinen Kreises der Getreuen verband sich die Erhabenheit des frommen Handelns so vortrefflich mit dem, was die Französin Hohes besitzen kann, dass er beschloss, alles zu tun, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Solche Gefühle wären bei einem beschäftigten Pariser sehr flüchtige gewesen; aber Gottfried war, wie man gesehen hat, in der Lage des Schiffbrüchigen, der sich an die gebrechlichsten Planken anklammert, weil er sie für tragfähig hält, und seine Seele war durchfurcht und bereit, jeden Samen in sich aufzunehmen.
Er traf die vier Freunde im Salon, überreichte das Buch Frau de la Chanterie und sagte:
»Ich wollte Sie Ihrer Lektüre heute Abend nicht berauben ...«
»Gebe Gott,« erwiderte sie, während sie den prächtigen Band betrachtete, »dass das Ihre letzte verschwenderische Handlung gewesen sein möge!«
Da er sah, dass bei den vier Personen die Kleidung bis ins geringste auf Sauberkeit und Zweckmäßigkeit beschränkt, und dass dieser Grundsatz im Hause auch bis in die kleinsten Einzelheiten durchgeführt war, begriff Gottfried die Bedeutung des so liebenswürdig ausgedrückten Vorwurfs.
»Gnädige Frau,« sagte er, »die Leute, denen Sie heute morgen Ihre Unterstützung gewährt haben, sind schlechte Kerle; ohne es zu wollen, habe ich mit angehört, was sie für Dinge planten, als sie von hier fortgingen; was sie sagten, zeugte von der schwärzesten Undankbarkeit...«
»Das sind die beiden Schlosser aus der Rue Mouffetard,« sagte Frau de la Chanterie zu Herrn Nikolaus, »das gehört in Ihr Ressort...«
»Der Fisch entschlüpft mehr als einmal, bevor er sich fangen lässt«, entgegnete lächelnd Herr Alain. Die völlige Unempfindlichkeit der Frau de la Chanterie bei der Nachricht der sofortigen Undankbarkeit der Leute, denen sie sicher Geld gegeben hatte, setzte Gottfried in Erstaunen und ließ ihn nachdenklich werden.
Das Essen verlief heiter, dank Herrn Alain und dem ehemaligen Gerichtsrat; aber der alte Soldat blieb ernst, traurig und kühl, sein Gesicht trug den unverwischbaren Ausdruck bitteren Kummers und unvertilgbaren Schmerzes. Frau de la Chanterie war gegen alle gleich aufmerksam. Gottfried fühlte sich beobachtet von diesen Leuten, deren Vorsicht ihrer Frömmigkeit gleichkam; seine Eitelkeit ließ ihn ihre Zurückhaltung nachahmen, und er achtete sehr auf seine Worte.
Dieser erste Tag sollte viel bewegter sein als die folgenden. Gottfried, der sich von allen wichtigen Besprechungen ausgeschlossen sah, war genötigt, während mehrerer Morgen- und Abendstunden, die er allein in seiner Wohnung verbrachte, die »Nachahmung Christi« aufzuschlagen, und er studierte das Buch schließlich, wie man ein Buch studiert, wenn man nur ein einziges besitzt und sich in Gefangenschaft befindet. Es geht Einem dann mit einem solchen Buche wie mit einer Frau, mit der man sich zusammen in der Einsamkeit befindet; ebenso wie man dann die Frau hassen oder lieben muss, ebenso lässt man sich entweder ganz von dem Geiste des Verfassers durchdringen, oder man liest keine zehn Zeilen von ihm.
Nun ist es unmöglich, dass man von der »Nachahmung Christi« nicht gepackt werde, die für die Glaubenslehre dasselbe ist wie die Ausführung für den Gedanken. Der Katholizismus lebt, bewegt sich, zittert darin und setzt sich mit dem menschlichen Leben selbst auseinander. Das Buch ist ein zuverlässiger Freund. Es spricht über alle Leidenschaften, alle Schwierigkeiten, selbst die der Weltleute; es besiegt alle Einwände, es ist beredter als alle Prediger; denn seine Sprache ist deine Sprache, es wächst aus deinem Herzen empor und redet zu deiner Seele. Es ist das übertragene Evangelium, angepasst allen Zeiten, angewandt auf alle Lebenslagen. Es ist merkwürdig, dass die Kirche Gerson nicht heiliggesprochen hat, denn der Heilige Geist hat ihm sicherlich die Feder geführt.
Für Gottfried barg das Haus de la Chanterie außer dem Buche auch eine Frau, und er verliebte sich mit jedem Tage mehr in diese Frau; er entdeckte bei ihr unter dem Schnee des Winters vergrabene Blüten, er empfand die Seligkeit einer solchen geheiligten Liebe, die die Religion gestattet, der die Engel zulächeln, die schon die fünf Menschen untereinander verband, und bei der kein schlechter Gedanke aufkommen konnte. Es gibt ein Empfinden, das über allen andern steht, eine geistige Liebe, jenen Blumen ähnlich, die auf den höchsten Gipfeln der Erde wachsen, eine Liebe, von der ein oder zwei Beispiele alle Jahrhunderte einmal der Menschheit geschenkt werden, in der sich seltsame Liebende vereinigen, und die Beweise für eine Liebestreue gibt, die im gewöhnlichen Leben unerklärlich wäre. Das ist eine Liebe ohne Irrungen, ohne Zwiste, ohne Eitelkeiten, ohne Kämpfe, selbst ohne jede Gegensätzlichkeit, so sehr fließt das geistige Empfinden beider in eins zusammen. Die Seligkeit dieses tiefen, grenzenlosen Gefühls, das in der katholischen Nächstenliebe wurzelt – Gottfried ahnte sie. Manchmal vermochte er an das Schauspiel, das er vor Augen hatte, nicht zu glauben und suchte nach Gründen für die erhabene Freundschaft dieser fünf Menschen, die zu seinem Staunen echte Katholiken waren, Christen aus den ersten Zeiten der Kirche, mitten in dem Paris von 1835
Acht Tage nach seinem Einzug war Gottfried schon Zeuge eines so großen Zustroms von Leuten und hatte Bruchstücke von Gesprächen aufgefangen, bei denen es sich umso schwerwiegende Dinge handelte, dass er merkte, welche ungeheure Tätigkeit die fünf Personen entfalteten. Er nahm wahr, dass keine von ihnen mehr als sechs Stunden schlief.
Alle hatten gewissermaßen schon eine erste Tagesarbeit vor dem zweiten Frühstück hinter sich. Fremde brachten oder holten Geldbeträge, die zuweilen sehr erheblich waren. Häufig kam der Kassenbote Mongenods, und zwar immer ganz früh, so dass sein Dienst unter diesen Gängen nicht litt, die vor den Bankkunden ausgeführt wurden.
Herr Mongenod erschien selbst eines Abends, und Gottfried fiel dabei eine gewisse familiäre Vertraulichkeit auf, die er im Verein mit tiefem Respekt Herrn Alain ebenso wie den drei andern Pensionären der Frau de la Chanterie bezeigte.
An diesem Abend richtete der Bankier nur einige gleichgültige Fragen an Gottfried: Ob er sich hier wohl fühle, ob er bleiben wolle usw., wobei er ihm empfahl, bei seinem Entschlusse zu verharren.
»Mir fehlt nur eins, um mich glücklich zu fühlen«, sagte Gottfried.
»Und das wäre?« fragte der Bankier.
»Eine Beschäftigung.«
»Eine Beschäftigung?« bemerkte der Abbé de Vèze.
»Sie haben also Ihre Absichten geändert? Sie sind doch in unser Kloster gekommen, um hier Ruhe zu suchen?«
»Ruhe ohne die Gebete, die die Klöster beleben, ohne die Meditationen, die die Thebais erfüllte, macht krank,« sagte Herr Joseph belehrend.
»Lernen Sie doch Buchführung«, sagte Herr Mongenod lächelnd, »Sie könnten sich dann in einigen Monaten meinen Freunden sehr nützlich machen...«
»Oh, mit großem Vergnügen,« rief Gottfried.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Frau de la Chanterie wünschte, dass ihr Pensionär sie in das Hochamt begleite.
»Das ist der einzige Zwang, den ich Ihnen aufzuerlegen wünsche,« sagte sie. »Schon manchmal habe ich im Verlauf dieser Woche mit Ihnen von Ihrem Seelenheil sprechen wollen, aber ich hielt den Augenblick dafür noch nicht gekommen. Sie würden sehr in Anspruch genommen werden, wenn Sie an unserer Glaubensbetätigung teilnähmen, denn Sie würden dann auch an unsern Arbeiten teilnehmen.
Bei der Messe fiel Gottfried die Inbrunst der Herren Nikolaus, Joseph und Alain auf; und da er sich während der wenigen Tage ihres Zusammenseins von der Überlegenheit, dem Scharfsinn, der umfassenden Kenntnis und dem bedeutenden Geist der Herren hatte überzeugen können, so kam ihm der Gedanke, dass, wenn sie sich so demütigten, die katholische Religion Geheimnisse in sich bergen müsse, die ihm bisher entgangen waren.
»Schließlich«, sagte er sich, »ist es ja doch die Religion Bossuets, Pascals, Racines, des heiligen Ludwig, Raffaels, Michelangelos, Ximenes', Bayards, du Guesclins, und ich Armseliger kann mich mit diesen Geistern, diesen Staatsmännern, Künstlern, Heerführern doch nicht vergleichen.«
Wenn diese kleinen Einzelheiten nicht wichtige Fingerzeige gäben, wäre es töricht, sich heutzutage damit aufzuhalten; aber sie sind für diese Erzählung unentbehrlich, der unser jetziges Publikum schon schwer genug Glauben schenken wird, und die mit einer fast lächerlich erscheinenden Tatsache beginnt: mit der Herrschaft einer sechzigjährigen Frau über einen jungen, von allem enttäuschten Mann.
»Sie haben nicht gebetet,« sagte Frau de la Chanterie zu Gottfried an der Tür von Notre-Dame, »für niemanden, nicht einmal für die Seelenruhe Ihrer Mutter.«
Gottfried errötete und schwieg.
»Tun Sie mir die Liebe«, sagte Frau de la Chanterie, »gehen Sie in Ihre Wohnung und kommen Sie erst in einer Stunde in den Salon. Wenn Sie mich liebhaben,« fügte sie hinzu, »so werden Sie über ein Kapitel der ›Nachahmung Christi‹ nachdenken, das erste des dritten Buches, das betitelt ist ›Von dem Gespräch mit sich selbst‹.«
Gottfried empfahl sich kühl und ging in seine Wohnung hinauf.
›Der Teufel soll mich holen!‹ sagte er sich, ernstlich in Wut geratend. ›Was wollen sie denn hier von mir? Was für Machenschaften haben sie vor?... Alle Weiber, selbst die frommen, sind gleich schlau; und wenn die gnädige Frau,‹ meinte er, indem er seine Wirtin so nannte, wie die übrigen Pensionäre es taten, ›mich jetzt nicht haben will, so ist das, weil etwas gegen mich angezettelt werden soll.‹
In solchen Gedanken versuchte er, durch sein Fenster in den Salon zu sehen, aber die örtliche Lage gestattete ihm nicht, etwas zu erkennen. Er stieg eine Etage hinab, kehrte aber schnell wieder zurück, denn er überlegte, dass bei den strengen Grundsätzen der Hausbewohner ein Akt der Spionage ihm sofort die Verabschiedung eintragen würde. Die Achtung der fünf Personen einzubüßen, schien ihm ebenso unerträglich, wie wenn er sich öffentlich entehrt sehen würde. Er wartete etwa drei Viertelstunden und beschloss dann, Frau de la Chanterie zu überraschen, indem er vor der angegebenen Zeit erschien. Er erfand eine Lüge, um sich zu rechtfertigen: er wollte sagen, dass seine Uhr nicht richtig gehe, und stellte sie zwanzig Minuten vor. Dann ging er, ohne das leiseste Geräusch zu machen, hinunter. Er gelangte so bis an die Tür des Salons und öffnete sie plötzlich.
Hier sah er einen noch jungen, ziemlich berühmten Mann, einen Dichter, den er häufig in Gesellschaften getroffen hatte, Victor de Vernisset, vor sich, auf ein Knie vor Frau de la Chanterie gesunken und den Saum ihres Kleides küssend. Wäre der Himmel aus Kristall, wie die Alten glaubten, und wäre dieser Himmel krachend zusammengebrochen, so wäre Gottfried davon weniger überrascht worden als von dem Schauspiel, das sich ihm hier bot. Die hässlichsten Gedanken stiegen in ihm auf, und er empfand einen noch fürchterlicheren Stoß, als er bei der ersten sarkastischen Bemerkung, die sich ihm auf die Lippen drängte, Herrn Alain in einer Ecke des Salons wahrnahm, der damit beschäftigt war, Tausendfrankenscheine zu zählen.
Im nächsten Augenblick war Vernisset auf den Beinen, und der gute Alain hielt verdutzt inne. Frau de la Chanterie warf Gottfried einen Blick zu, der ihn erstarren ließ; denn der zweideutige Ausdruck auf dem Gesichte des neuen Gastes war ihm nicht entgangen.
»Der Herr«, sagte sie zu dem jungen Dichter und zeigte auf Gottfried, »gehört zu den Unsrigen ...« »Sie sind sehr glücklich, mein lieber Herr,« sagte Vernisset, »Sie sind gerettet! Gnädige Frau,« wandte er sich dann an Frau de la Chanterie, »und wenn ganz Paris mich so gesehen hätte, so wäre ich glücklich darüber gewesen, nichts kann meine Dankbarkeit gegen Sie wettmachen!... Ich bin Ihnen für alle Zeiten verpflichtet! Ich gehöre Ihnen ganz und gar. Befehlen Sie mir, was es auch sei, und ich werde gehorchen! Meine Erkenntlichkeit wird unbegrenzt sein. Ich verdanke Ihnen das Leben, es gehört Ihnen ...«
»Na, na,« sagte der gute Alain, »seien Sie vernünftig, junger Mann, arbeiten Sie nur, und vor allem greifen Sie in Ihren Werken niemals die Religion an. Und endlich denken Sie daran, dass Sie eine Schuld übernommen haben!
Und er reichte ihm einen mit den Bankbilletten, die er gezählt hatte, gefüllten Umschlag. Victor de Vernisset hatte die Augen voller Tränen, küsste ehrfurchtsvoll Frau de la Chanterie die Hand und entfernte sich, nachdem er Herrn Alain und Gottfried die Hand gedrückt hatte.
»Sie sind ungehorsam gegen die gnädige Frau gewesen, sagte der Biedermann feierlich mit einem so traurigen Gesicht, wie es Gottfried noch nie bei ihm gesehen hatte, »das ist ein schweres Vergehen; noch ein solches, und wir sind geschiedene Leute... Das wird sehr hart für Sie sein, da wir Sie unseres Vertrauens für würdig gehalten haben ...«
»Mein lieber Alain,« sagte Frau de la Chanterie, »erweisen Sie mir die Freundlichkeit, über diese Unbesonnenheit zu schweigen ... Man muss nicht zuviel von einem Neuling verlangen, der großes Unglück durchgemacht hat, der keine Religion besitzt, dessen ganzes Sinnen in einer außerordentlich starken Neugierde besteht und der noch kein Vertrauen zu uns hat.«
»Verzeihen Sie mir, gnädige Frau«, erwiderte Gottfried, »von nun ab will ich mich Ihrer würdig erweisen; ich unterwerfe mich jeder Prüfung, die Sie für nötig erachten, bevor Sie mich in die Geheimnisse Ihrer Tätigkeit einweihen, und wenn der Herr Abbé de Vèze es auf sich nehmen will, mich zu erleuchten, so werde ich mich ihm mit Geist und Herz hingeben.«
Diese Worte machten Frau de la Chanterie so glücklich, dass ihre Wangen sich mit einer zarten Röte bedeckten; sie drückte Gottfried die Hand und sagte mit merkwürdiger Erregung: »Es ist gut.«
Abends nach dem Essen sah Gottfried einen Generalvikar der Pariser Diözese, zwei Domherren, zwei ehemalige Pariser Bürgermeister und eine Barmherzige Schwester erscheinen. Es wurde nicht gespielt, die allgemeine Unterhaltung war heiter, ohne oberflächlich zu sein.
Ein Besuch, der Gottfried sehr überraschte, war der der Gräfin Cinq-Cygne, einer Dame der höchsten Aristokratie, deren Salon der Bourgeoisie und den Parvenüs verschlossen war. Die Anwesenheit dieser vornehmen Dame im Salon der Frau de la Chanterie war an sich schon sehr merkwürdig; aber die Art, mit der die beiden Damen sich begrüßten und sich gegeneinander benahmen, war für Gottfried unerklärlich; denn sie bekundete eine Vertraulichkeit und einen ständigen Verkehr, die Frau de la Chanterie eine ungeheure Bedeutung verliehen. Frau de Cinq-Cygne war liebenswürdig und freundschaftlich gegen die vier Freunde ihrer Freundin und respektvoll gegen Herrn Nikolaus. Man sieht, dass Gottfried noch von der gesellschaftlichen Eitelkeit beherrscht war; denn der bis dahin noch immer Unschlüssige beschloss nun, mit oder ohne Überzeugung, alles zu tun, was Frau de la Chanterie und ihre Freunde von ihm verlangen würden, um in ihren Orden aufgenommen oder in ihre Geheimnisse eingeweiht zu werden, wobei er sich nur noch die definitive Entscheidung vorbehielt.