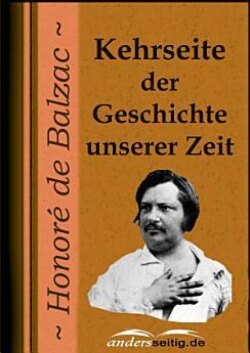Читать книгу Kehrseite der Geschichte unserer Zeit - Оноре де Бальзак, Оноре де'Бальзак, Balzac - Страница 4
ОглавлениеAm andern Morgen begab er sich zu einem Buchhalter, den ihm Frau de la Chanterie bezeichnet hatte, vereinbarte mit ihm die Stunden, in denen sie zusammen arbeiten wollten, und hatte nun seine Zeit vollkommen ausgefüllt; denn der Abbé de Vèze unterrichtete ihn vormittags, zwei Stunden täglich verbrachte er bei dem Buchhalter, und zwischen dem zweiten Frühstück und dem Mittagessen arbeitete er an fingierten Geschäftsbüchern, die sein Lehrer ihn führen ließ.
So vergingen mehrere Tage, bei deren Verlauf Gottfried den Reiz einer Lebensführung empfand, bei der jede Stunde in bestimmter Weise ausgefüllt ist. Die zu festgesetzter Zeit regelmäßig wiederkehrende bekannte Arbeit erklärt das Glück vieler Existenzen und beweist, wie tief die Gründer religiöser Orden über das Wesen des Menschen nachgedacht haben. Gottfried, der sich vorgenommen hatte, den Abbé de Vèze anzuhören, empfand schon Besorgnisse wegen seines künftigen Lebens und fing an zu erkennen, dass er nichts von der schwerwiegenden Bedeutung der religiösen Fragen wusste. Dazu ließ Frau de la Chanterie, bei der er ungefähr eine Stunde nach dem zweiten Frühstück zu verweilen pflegte, ihn täglich neue Schätze ihres Innern entdecken; niemals hatte er eine so vollkommene und so umfassende Güte für möglich gehalten. Eine Frau in dem Alter, das Frau de la Chanterie zu haben schien, besitzt keine der Schwächen junger Frauen mehr; sie ist eine Freundin, die einem alle weibliche Zartheit entgegenbringt, die die Grazie und Feinheit entfaltet, welche die Natur der Frau für den Mann mitgegeben hat, und die sie nicht mehr verkauft: sie ist abscheulich oder vollkommen; denn alles Verlangen schlummert unter ihrer Oberfläche oder ist abgestorben; und Frau de la Chanterie gehörte zu den Vollkommenen. Sie schien niemals jung gewesen zu sein, ihr Blick erzählte nichts von einer Vergangenheit. Fern davon, Gottfrieds Neugierde zu befriedigen, verdoppelten die immer genauere Bekanntschaft mit diesem erhabenen Charakter und die täglich neuen Entdeckungen sein Verlangen, das frühere Leben dieser Frau kennenzulernen, die ihm wie eine Heilige erschien. Hatte sie jemals geliebt? War sie verheiratet gewesen? War sie Mutter gewesen? Nichts an ihr verriet die alte Jungfer, sie entfaltete alle Reize der Frau von vornehmer Geburt, und man musste aus ihrer robusten Gesundheit, aus der eigentümlichen Art ihrer Unterhaltung auf ein heiliges Leben und auf eine Unkenntnis des Weltgetriebes schließen. Ausgenommen den heiteren Alain, hatten alle diese Menschen Leiden erfahren; aber selbst Herr Nikolaus schien die Palme des Martyriums Frau de la Chanterie zu reichen, und trotzdem wurde die Erinnerung an ihr Unglück so vollkommen von der katholischen Ergebung und ihrer geheimnisvollen Tätigkeit zurückgedrängt, dass sie immer glücklich zu sein schien.
»Sie bedeuten«, sagte Gottfried eines Tages zu ihr, »das Leben für Ihre Freunde, Sie sind das Band, das sie umschlingt, Sie sind sozusagen die häusliche Leiterin eines großen Werkes; und da wir alle sterblich sind, so frage ich mich, was aus ihrer Vereinigung einmal werden soll ohne Sie ...«
»Das macht ihnen auch Sorge; aber die Vorsehung, der wir auch unsern Buchführer zu verdanken haben, sagte sie lächelnd, »wird schon helfen. Übrigens werde ich mich nach Ersatz umsehen.
»Wird Ihr Buchführer bald seinen Dienst in Ihrem Geschäftshause antreten?« fragte Gottfried lachend.
»Das hängt von ihm ab«, entgegnete sie lächelnd. »Er muss erst wahrhaft gläubig und fromm geworden sein, keinerlei Eigenliebe mehr besitzen, sich nicht um die Reichtümer unseres Hauses bekümmern und daran denken, sich über die kleinlichen gesellschaftlichen Bedenken zu erheben mit den beiden Flügeln, die Gott uns gegeben hat ...«
»Welche sind das ...?«
»Die Einfalt und die Reinheit«, erwiderte Frau de la Chanterie. »Ihre Unkenntnis verrät mir deutlich genug, dass Sie die Lektüre unseres Buches vernachlässigt haben, fuhr sie fort, über die harmlose List lächelnd, mit der sie in Erfahrung gebracht hatte, ob Gottfried in der›Nachahmung Christi‹ las. »Dann aber machen Sie sich die Epistel des heiligen Paulus über die Nächstenliebe zu eigen. Nicht Sie werden uns dienen, sagte sie mit erhabenem Ausdruck, »sondern wir werden Ihnen dienen, und es wird Ihnen erlaubt sein, viel gewaltigere Reichtümer zu sammeln, als je ein König besessen hat; Sie werden sie genießen, wie wir sie genießen; und lassen Sie mich Ihnen sagen, dass die Schätze Aladins, wenn Sie sich an ›Tausendundeine Nacht‹ erinnern, nichts sind im Vergleich mit dem, was wir besitzen ... Daher wissen wir auch seit einem Jahre nicht mehr, wie wir es machen sollen, wir sind nicht ausreichend dafür, wir müssen einen Buchführer haben ...«
Während sie so sprach, beobachtete sie Gottfrieds Gesicht, der nicht wusste, was er von dieser merkwürdigen Eröffnung halten solle; da er sich aber häufig an die Szene erinnerte, die sich zwischen Frau de la Chanterie und der alten Frau Mongenod abgespielt hatte, so verharrte er zwischen Zweifel und Vertrauen.
»Oh, Sie werden sehr glücklich sein«, sagte sie.
Gottfried wurde dermaßen von Neugier verzehrt, dass er sofort beschloss, die Zurückhaltung der vier Freunde zu besiegen und sie über sie selbst auszufragen. Nun war von allen Hausgenossen der Frau de la Chanterie derjenige, zu dem sich Gottfried am meisten hingezogen fühlte, und der am meisten die Sympathie der Leute jeder Klasse zu gewinnen schien, der gute, heitere, harmlose Alain. In welcher Absicht mochte die Vorsehung dieses treuherzige Wesen in dieses Kloster ohne Gelübdezwang geführt haben, dessen Mönche sich einer festgesetzten Regel unterwarfen, mitten in Paris, ganz freiwillig, aber so, als ob sie den strengsten Oberen hätten? Welches Drama, welches Ereignis hatte sie von ihrem weltlichen Wege hinweggeführt, um mitten durch das Elend der Hauptstadt diesen Pfad zu wandeln?
Eines Abends wollte Gottfried seinem Nachbar einen Besuch machen, mit der Absicht, seine Neugierde zu befriedigen, die durch die Unmöglichkeit irgendwelcher Umwälzung in dieser Existenz mehr erregt wurde als durch die gespannte Erwartung bei der Erzählung einer furchtbaren Episode aus dem Leben eines Seeräubers. Bei dem Worte: Herein!, das auf sein diskretes Anklopfen erfolgte, drehte Gottfried den Schlüssel, der immer im Schloss stak, herum und fand Herrn Alain am Feuer sitzend und vor dem Schlafengehen ein Kapitel in der »Nachahmung Christi« lesend, beim Lichte zweier Kerzen, jede mit einem grünen beweglichen Lampenschirm, wie ihn die Whistspieler benutzen, versehen.
Der Biedermann trug ein langes Beinkleid und einen Schlafrock von hellgrauem Flanell und hatte die Füße am Kamin auf einem Kissen, das ebenso wie seine Pantoffeln von Frau de la Chanterie gestickt war. Sein schönes greises Haupt, wie das eines Mönchs mit feinen weißen Haaren schön umkränzt, hob sich scharf von dem dunklen Hintergrunde des Überzugs seines riesigen Lehnsessels ab.
Herr Alain legte behutsam sein an allen vier Ecken stark abgenutztes Buch auf einen kleinen Tisch mit gedrehten Säulen, wies mit der anderen Hand auf einen andern Sessel für seinen jungen Freund und nahm seine Brille ab, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht war.
»Sind Sie leidend, dass Sie zu dieser Stunde Ihre Wohnung verlassen?« fragte er Gottfried.
»Verehrter Herr Alain,« erwiderte Gottfried freimütig, »ich bin von einer Neugierde geplagt, die ein einziges Wort von Ihnen sehr unschuldig oder sehr indiskret erscheinen lassen kann; und damit werden Sie genügend beurteilen können, in welchem Sinne ich eine Frage an Sie richten will.«
»Und was ist das für eine Frage? sagte Alain und sah den jungen Mann beinahe boshaft an.
»Was für ein Ereignis hat Sie bestimmt, das Leben, das Sie hier führen, zu wählen? Denn um sich zu einem solchen Verzicht auf jedes Interesse zu entschließen, muss Einem das weltliche Leben zum Ekel geworden sein, oder man muss in ihm eine Wunde empfangen oder vielleicht einen andern verwundet haben.«
»Wie denn, mein Kind,« entgegnete der Greis und verzog seine breiten Lippen zu einem Lächeln, das seinen roten Mund so liebenswürdig machte, wie das nur ein Malergenie erdenken kann, »kann man nicht vom tiefsten Mitleid ergriffen werden beim Anblick des Elends, das die Mauern von Paris umschließen? Bedurfte der heilige Vincent a Paula des Stachels von Gewissensbissen oder verletzter Eitelkeit, um sich der ausgesetzten Kinder zu erbarmen?«
»Das verschließt mir um so mehr den Mund, als wenn jemals ein Geist dem dieses christlichen Helden ähnlich war, dies sicherlich der Ihrige ist«, antwortete Gottfried.
Trotz der Unempfindlichkeit, die das Alter seiner gelblichen, runzeligen Gesichtshaut verliehen hatte, überzog eine tiefe Röte das Antlitz des Greises; denn es sah aus, als ob er dieses Lob provoziert hätte, woran er bei seiner allen bekannten Bescheidenheit nicht gedacht haben konnte. Gottfried wusste recht gut, dass die Hausgenossen der Frau de la Chanterie keinerlei Gefallen an solchem Weihrauch fanden. Trotzdem war die außergewöhnliche Bescheidenheit des guten Alain von diesem Skrupel mehr beunruhigt als ein junges Mädchen von irgendeinem schlimmen Gedanken.
»Wenn ich auch noch sehr weit hinter seiner moralischen Höhe zurückstehe«, bemerkte Herr Alain, »so bin ich ihm wenigstens in meinem äußern ähnlich ...«
Gottfried wollte etwas erwidern, aber er wurde daran durch eine Bewegung des Alten gehindert, dessen Nase in der Tat so knollig wie die des Heiligen war, und dessen Antlitz, ähnlich dem eines alten Weinbergsarbeiters, wie ein Duplikat des gewöhnlichen runden Gesichts des Begründers der Findelhäuser aussah.
»Was mich anlangt, so haben Sie recht,« fuhr er fort; »meine Berufung zu unserm Werke wurde entschieden durch ein Gefühl der Reue, aus Anlass eines Abenteuers ...«
»Sie, und ein Abenteuer?« rief Gottfried leise aus, den dieses Wort das, was er dem Alten zuerst antworten wollte, vergessen ließ.
»Oh, wahrhaftig, was ich Ihnen erzählen werde, wird Ihnen gewiss als eine Kleinigkeit, als etwas Unerhebliches erscheinen; aber vor dem Richterstuhl des Gewissens steht es anders damit. Wenn Sie bei Ihrem Wunsche, an unserer Arbeit teilzunehmen, verharren werden, nachdem Sie mich angehört haben, dann werden Sie begreifen, dass das Gefühl im Verhältnis zu der Seelenstärke steht, und dass ein Geschehnis, das einen starken Geist nicht beunruhigt, sehr wohl das Gewissen eines schwachen Christen bedrücken kann.«
Man kann sich schwer vorstellen, welchen Grad die Neugierde des Neophyten nach dieser Art von Vorrede erreicht hatte. Was konnte das Verbrechen dieses Biedermanns sein, den Frau de la Chanterie ihr »Osterlamm« nannte? Das musste ebenso interessant sein wie ein Buch mit dem Titel: »Die Verbrechen eines Lammes.« Vielleicht sind die Lämmer grausam gegen die Kräuter und Blumen? Nach der Meinung eines der gemäßigtsten Republikaner dieser unserer Zeit ist auch der beste Mensch immer noch grausam gegen irgend etwas. Aber der gute Alain! Er, der, wie der Onkel Tobias Sternes, eine Fliege, die ihn zwanzigmal gestochen hatte, nicht töten konnte. Und diese edle Seele war von Reue gefoltert!
Diese Überlegung füllte die Pause aus, die der Greis nach den Worten: »Hören Sie mich an!« machte, während er sein Kissen Gottfried unter die Füße schob, damit er es mit ihm teile.
»Ich war damals etwas über dreißig Jahre alt«, sagte er, »es war im Jahre 98, wie mir erinnerlich ist, eine Zeit, wo junge Leute die Erfahrung Sechzigjähriger haben mussten. Eines Morgens um neun Uhr, kurz vor meinem Frühstück, meldet mir meine alte Wirtschafterin einen der wenigen Freunde, die ich mir inmitten der Revolutionsstürme noch erhalten hatte. Mein erstes Wort war daher, ihn zum Frühstück einzuladen. Mein Freund, er hieß Mongenod, ein junger Mann von achtundzwanzig Jahren, nahm an, aber sichtlich bedrückt; ich hatte ihn seit dem Jahre 1793 nicht gesehen ...«
»Mongenod? ...« rief Gottfried aus, »der ...«
»Wenn Sie das Ende vor dem Anfang erfahren wollen,« bemerkte der Alte lächelnd, »wie soll ich Ihnen dann meine Geschichte erzählen?«
Gottfried machte ein Zeichen, das absolutes Stillschweigen versprach.
»Als Mongenod sich gesetzt hatte,« fuhr der gute Alain fort, »bemerkte ich, dass seine Schuhe furchtbar abgenutzt waren. Seine getüpfelten Strümpfe waren so oft gewaschen worden, dass ich sie nur mit Mühe als seidene erkennen konnte. Sein aprikosenfarbenes Kaschmirbeinkleid, das jede Frische verloren hatte, zeigte, wie lange es getragen war, was noch durch die verblichene Farbe an den am meisten gefährdeten Stellen bezeugt wurde, und die Schnallen schienen mir, statt von Stahl, von gewöhnlichem Eisen zu sein; die der Schuhe zeigten das gleiche Metall. Seine weiße geblümte Weste, die vom Tragen gelb geworden, wie sein Hemd, dessen steifes Jabot zerknittert war, verrieten ein schreckliches, aber verheimlichtes Elend. Das Aussehen seiner Huppelande (so nannte man damals einen Überzieher mit nur einem Kragen, nach Art eines Mantels à la Crispin) vollendete bei mir den Eindruck, dass mein Freund ins Unglück geraten war. Dieser außerordentlich schäbige Mantel von nussbraunem Tuch, der aufs peinlichste abgebürstet war, hatte einen von Pomade oder Puder befleckten Kragen und rot gewordene Metallknöpfe. Der ganze schäbige Anzug war so jammervoll, dass ich ihn nicht länger zu betrachten wagte. Sein Klapphut, eine Art halbrunder Filz, den man damals nicht auf dem Kopf, sondern unter dem Arm zu tragen pflegte, musste schon mehrere Regierungen erlebt haben. Trotzdem musste mein Freund eben einige Sous bei einem Barbier ausgegeben haben, denn er war frisch rasiert. Und sein Haar, hinten zusammengenommen, mit einem Kamm festgehalten und stark gepudert, roch nach Pomade. Ich nahm auch zwei parallele Uhrketten aus matt gewordenem Stahl an seiner Hose wahr, aber keine Spur einer Taschenuhr an seiner Westentasche. Es war Winter, und Mongenod besaß keinen warmen Mantel, denn mehrere dicke Tropfen von geschmolzenem und von den Dächern, an denen er entlang gegangen sein musste, herabgefallenem Schnee rannen von dem Kragen seiner Huppelande herunter. Als er seine Handschuhe von Kaninchenfell auszog, sah ich au seiner rechten Hand die Spuren von Arbeit, aber von mühseliger Arbeit. Sein Vater, Advokat beim Großen Rat, hatte ihm einiges Vermögen hinterlassen, das ihm eine Rente von fünf bis sechstausend Franken abwarf. Ich begriff sofort, dass Mongenod gekommen war, um mich anzuborgen. Ich besaß in einem Versteck zweihundert Louisdor, eine für die damalige Zeit enorme Summe, denn sie betrug ich weiß nicht wie viele hunderttausend Franken Assignaten. Mongenod und ich hatten dieselbe Schule besucht, bei den Grassins, und uns dann bei demselben Anwalt wiedergefunden, einem ehrenwerten Manne, dem guten Bordin. Wenn man seine Jugend mit einem Kameraden zusammen verbracht und die gleichen Jugendtorheiten gemacht hat, so entsteht eine nahe, fast geheiligte Sympathie zwischen ihm und uns, seine Stimme, sein Blick schlagen gewisse Saiten in unserm Herzen an, die nur unter dem Eindruck der dabei wiedererwachenden Erinnerungen erklingen. Wenn man auch Grund zur Klage über einen solchen Kameraden hat, so sind damit doch noch nicht alle Freundschaftsrechte verjährt. Aber es hatte zwischen uns auch nicht die geringste Entzweiung stattgefunden. Beim Tode seines Vaters im Jahre 1787 war Mongenod reicher als ich; wenn ich auch nie etwas von ihm geliehen hatte; so hatte ich ihm doch gewisse Annehmlichkeiten zu verdanken, die die väterliche Strenge mir versagte. Ohne meinen freigebigen Kameraden hätte ich die erste Vorstellung von ›Figaros Hochzeit‹ nicht sehen können. Mongenod war damals, was man einen scharmanten Kavalier nannte, er hatte auch galante Abenteuer; ich hatte an ihm zu tadeln, dass er zu leicht Freundschaft schloss und zu entgegenkommend war; seine Börse stand andern zu leicht offen, er lebte auf großem Fuße, er hätte jedem als Sekundant gedient, den er nur zweimal gesehen hatte ... – Ach, Sie haben mich da auf die Wege meiner Jugend zurückgelockt«, rief der gute Alain aus, sah Gottfried lustig lächelnd an und machte eine Pause.
»Sind sie mir deshalb böse?« sagte Gottfried.
»Ach nein! Aber an der Ausführlichkeit meiner Erzählung können Sie sehen, welche Rolle dieses Ereignis in meinem Leben gespielt hat ... Mongenod, ein vortreffliches Herz und ein mutiger Mann, ein wenig Voltairianer, war geschaffen, als vornehmer Herr aufzutreten«, fuhr Alain in seiner Erzählung fort; »seine Erziehung bei den Grassins, wo er mit adligen Kameraden zusammen aufwuchs, und seine galanten Beziehungen hatten ihm das abgeschliffene Auftreten der Leute, die man damals Aristokraten nannte, beigebracht. Sie können sich daher vorstellen, wie groß meine Überraschung war, als ich nun bei ihm alle Anzeichen eines Elends wahrnahm, die den jungen eleganten Mongenod von 1787 so verändert erscheinen ließen, sobald meine Blicke sich von seinem Gesicht auf seine Kleidung richteten. Da aber in dieser unseligen Zeit manche schlauen Menschen äußerlich elend auftraten und genügend Gründe für andere vorlagen, sich zu verkleiden, so erwartete ich eine Aufklärung, die ich direkt erbat. ›Wie siehst du denn aus, mein bester Mongenod?‹ sagte ich und nahm eine Prise Tabak, die er mir in einer Tabaksdose aus nachgemachtem Gold anbot. ›Sehr traurig‹, erwiderte er. ›Es ist mir nur noch ein Freund geblieben ... und dieser Freund bist du. Ich habe alles versucht, um diesen Schritt zu vermeiden, aber ich komme jetzt, um hundert Louisdor von dir zu verlangen. Das ist eine große Summe‹, sagte er, als er mein Erstaunen bemerkte; ›aber wenn du mir nur fünfzig geben würdest, so wäre ich außerstande, sie dir jemals zurückzugeben, während, wenn mir das, was ich vorhabe, missglückt, mir immer noch fünfzig Louisdor bleiben, um mein Glück auf einem andern Wege zu versuchen; ich weiß augenblicklich noch nicht, was die Verzweiflung mir dann anraten wird.‹ ›Du hast nichts mehr?‹ fragte ich. ›Ich besitze noch‹, bemerkte er, indem er eine Träne zurückdrängte, ›fünf Sous, die ich auf mein letztes Geldstück herausbekommen habe. Um bei dir erscheinen zu können, habe ich mir die Stiefel putzen und mich frisieren lassen. Ich besitze nur das, was ich an mir trage. Aber‹, fuhr er fort und machte eine Bewegung, ›ich schulde meiner Wirtin tausend Taler Assignaten, und unser Garkoch gibt mir seit gestern keinen Kredit mehr. Ich bin also ohne jedes Hilfsmittel.‹ ›Und was gedenkst du zu tun?‹ sagte ich, mich schon in Dinge einmischend, die er allein zu entscheiden hatte. ›Mich als Soldat anwerben zu lassen, wenn du mir meine Bitte abschlägst.‹ ›Du Soldat, du, Mongenod?‹ ›Ich werde fallen oder der General Mongenod werden.‹ – ›Nun‹, sagte ich tiefbewegt, ›frühstücke in Ruhe mit mir, ich bin im Besitze von hundert Louisdor ...‹ Ich hielt es hierbei«, sagte der Biedermann mit einem schlauen Blick auf Gottfried, »für nötig, als Darleiher ein bisschen zu lügen.«
›Das ist alles, was ich auf der Welt besitze‹, sagte ich zu Mongenod, ›ich wartete auf den Moment, wo die Staatsanleihen so tief als möglich ständen, um dieses Geld darin anzulegen; aber ich will es dir übergeben, und du wirst mich als deinen Sozius ansehen, ich überlasse es deiner Rechtschaffenheit, wann und wo du mir das Ganze zurückgeben wirst. Das Gewissen eines Ehrenmannes‹, fuhr ich fort, ›ist das sicherste Staatsschuldenbuch.‹ Mongenod sah mich bei diesen Worten starr an und schien sie in sein Herz einzugraben. Er streckte seine rechte Hand aus, ich legte meine Linke hinein, und wir drückten uns die Hände, ich tiefbewegt, er, ohne diesmal zwei dicke Tränen zurückzuhalten, die an seinen abgezehrten Wangen herabrannen. Der Anblick dieser Tränen zerriss mir das Herz. Ich wurde noch mehr ergriffen, als Mongenod in diesem Augenblick, alles vergessend, ein schlechtes, ganz zerrissenes indisches Taschentuch herauszog, um sich die Augen abzutrocknen. – ›Bleib hier‹, sagte ich zu ihm und ging eilig zu meinem Versteck, so tiefbewegt, als ob ich eine Frau mir ihre Liebe hätte gestehen hören. Und ich kam zurück mit zwei Goldrollen, jede zu fünfzig Louisdor. – ›Hier, zähl sie nach ...‹ Er wollte sie nicht zählen und blickte um sich, um ein Schreibzeug zu suchen und mir, wie er sagte, eine Quittung auszustellen. Ich weigerte mich rundweg, irgendein Schriftstück an mich zunehmen. – ›Wenn ich sterben sollte‹, sagte ich zu ihm, ›würden meine Erben dich drängen. Das muss unter uns bleiben.‹ Als er sah, was er für einen Freund an mir besaß, verschwand der Ausdruck von Kummer und Angst auf Mongenods Gesicht, und er wurde heiter. Meine Wirtschafterin servierte uns Austern, Weißwein, eine Omelette, geröstete Nieren, den Rest einer Pastete aus Chartres, die meine alte Mutter mir geschickt hatte, dann den Nachtisch, Kaffee und Inselliköre. Mongenod, der seit zwei Tagen nichts gegessen hatte, lebte wieder auf. Wir sprachen über unser Leben vor der Revolution und blieben bis drei Uhr nachmittags bei Tische als die besten Freunde von der Welt sitzen. Mongenod erzählte mir, wie er sein Vermögen verloren hatte. Zuerst hatte ihm die Verkürzung der städtischen Renten zwei Drittel seines Einkommens genommen, denn sein Vater hatte den größten Teil seines Vermögens in Stadtanleihen angelegt; dann, nachdem er sein Haus in der Rue de Savoie verkauft hatte, war er gezwungen worden, den Preis in Assignaten entgegenzunehmen; er hatte sich damals in den Kopf gesetzt, eine Zeitung herauszugeben, ›Die Schildwache‹, nach deren sechsmonatigem Erscheinen er genötigt war, zu fliehen. Jetzt setzte er seine ganze Hoffnung auf eine komische Oper, betitelt ›Die Peruaner‹. Dieses letzte Bekenntnis ließ mich erzittern. Mongenod als Theaterdichter, der vorher sein Geld in seiner ›Schildwache‹ begraben hatte und jetzt sicherlich beim Theater lebte, in Beziehungen zu den Sängern des Theaters Feydeau, mit Musikern und der eigenartigen Gesellschaft, die sich hinter dem Vorhang verbirgt, fehlen mir nicht mehr derselbe Mongenod zu sein. Ich empfand ein leichtes Frösteln. Aber wie sollte ich meine hundert Louisdor wieder zurücknehmen? Ich sah die beiden Rollen in jeder Tasche seiner Hose stecken wie zwei Pistolenläufe. Mongenod entfernte sich. Als ich mich allein sah, nicht mehr vor dem Bilde dieses bitteren, furchtbaren Elends, musste ich gegen meinen Willen Erwägungen anstellen, indem ich nüchtern wurde: ›Mongenod‹, dachte ich jetzt, ›ist sicher tief verdorben, er hat mir eine Komödie vorgespielt.‹ Seine Fröhlichkeit, als er gesehen hatte, wie ich ihm gutmütig eine so riesige Summe gab, schien mir der Freude der Diener im Lustspiel zu gleichen, die irgendeinen Geronte erwischt haben. Ich endete damit, womit ich hätte anfangen sollen, ich beschloss, Erkundigungen über meinen Freund Mongenod einzuziehen, der mir seine Adresse auf die Rückseite einer Spielkarte geschrieben hatte. Aus Zartgefühl wollte ich ihn nicht schon am nächsten Tage aufziehen; er hätte in meiner Eile ein Zeichen von Misstrauen sehen können. Zwei Tage später nahmen andere Sorgen mich völlig in Anspruch, und erst nach vierzehn Tagen begab ich mich, da ich Mongenod nicht mehr zu sehen bekommen hatte, eines Morgens aus dem Croix-Rouge, wo ich wohnte, nach seiner Wohnung in der Rue des Moineaux. Mongenod hauste in einem möblierten Hause unterster Sorte, dessen Vermieterin eine sehr anständige Frau war, die Witwe eines Generalpächters, der auf dem Schafott geendet hatte, die, vollständig ruiniert, mit einigen Louisdor sich dem aussichtsreichen Gewerbe einer Zimmermieterin zugewendet hatte. Sie hat seitdem sieben Häuser im Viertel Saint-Roch innegehabt und ein Vermögen erworben. – ›Der Bürger Mongenod ist nicht anwesend,‹ sagte mir die Dame, ›aber es sind Leute bei ihm oben‹. Diese Äußerung erregte meine Neugierde. Ich stieg in das fünfte Stockwerk hinauf. Eine reizende Person öffnete mir die Tür ... Oh, eine junge Person von wunderbarster Schönheit, die ziemlich argwöhnisch auf der Schwelle der halb geöffneten Tür verharrte. ›Ich bin Alain, Mongenods Freund,‹ sagte ich. Sogleich öffnet sich die Tür völlig, und ich trete in eine abscheuliche Bodenkammer ein, die aber trotzdem von der jungen Person sehr sauber gehalten war. Sie schiebt mir einen Stuhl vor einen Kamin voller Asche, aber ohne Feuer, in dessen Winkel ich eine gewöhnliche irdene Wärmpfanne erblicke. Es war eisig kalt. ›Ich bin sehr glücklich, mein Herr‹, sagte sie, ergriff meine Hand und drückte sie liebevoll, ›dass ich Ihnen meine Dankbarkeit bezeugen kann, denn Sie sind unser Retter. Ohne Sie hätte ich Mongenod vielleicht nie wiedergesehen ... Er hätte sich ... ach!... ins Wasser gestürzt. Er war in Verzweiflung, als er Sie aufsuchen ging ...‹ Als ich die junge Person genauer betrachtete, war ich ziemlich erstaunt darüber, dass sie rings um den Kopf einen Schal trug und dass am Hinterkopf und an den Schläfen ein dunkler Schatten erschien; als ich näher hinsah, entdeckte ich, dass ihr Haupt geschoren war. ›Sind Sie leidend?‹ fragte ich mit Bezug auf dieses seltsame Aussehen. ›Jawohl‹ bemerkte sie hastig, ›ich hatte furchtbare Kopfschmerzen, und war genötigt, mein schönes Haar, das mir bis auf die Hacken reichte, abzuschneiden.‹ ›Habe ich die Ehre, mit Frau Mongenod zu sprechen?‹ fragte ich. ›Jawohl, mein Herr‹, erwiderte sie und warf mir einen wahren Engelsblick zu. Ich empfahl mich der armen kleinen Frau und ging hinunter, um die Hauswirtin auszuforschen, aber diese war weggegangen. Ich hatte den Eindruck, dass die junge Frau ihr Haar hatte verkaufen müssen, um Brot anzuschaffen. Stehenden Fußes ging ich zu einem Holzhändler und schickte ihr eine halbe Klafter Holz, wobei ich den Träger und die Holzschneider bat, der kleinen Frau eine quittierte, auf den Namen des Bürgers Mongenod ausgestellte Quittung zu übergeben. –