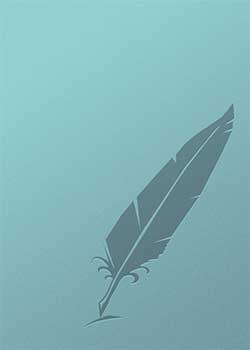Читать книгу Tante Lisbeth - Оноре де Бальзак - Страница 3
I
ОглавлениеEs war um die Mitte des Juli im Jahre 1838. Ein dicker Herr mittlerer Größe in der Uniform eines Hauptmanns der Bürgerwehr fuhr in einer der damals unlängst in Paris Mode gewordenen Droschken, die man »Mylords« nannte, durch die Rue de l'Université.
Unter den angeblich so geistreichen Parisern gibt es Männer, die sich in Uniform unsagbar besser gefallen als in ihrer gewöhnlichen Tracht. Dabei trauen sie den Frauen einen so schlechten Geschmack zu, dass sie sich einbilden, der Anblick eines Waffenrocks und einer Bärenmütze mache einen unwiderstehlichen Eindruck auf sie.
Die Mienen des Hauptmanns – er war von der zweiten Legion – strahlten vor Selbstzufriedenheit. Seine rote Gesichtsfarbe und seine Pausbacken leuchteten mit. Angesichts dieses Glorienscheines – einer Eigentümlichkeit reichgewordener Krämer, die sich zur Ruhe gesetzt haben – wusste man sofort, dass man einen der Auserwählten von Paris, zum mindesten einen gewesenen Stadtrat vor sich hatte. Auch fehlte das Bändchen der Ehrenlegion auf dieser preußisch-schneidigen Heldenbrust nicht. In hochmütiger Haltung lehnte der Ordensträger in der Ecke seines »Mylord« und ließ den Blick über die Leute auf der Straße hingleiten. In Paris empfängt man so oft ein freundliches Lächeln, das fernen schönen Augen gilt.
Der Wagen hielt zwischen der Rue de Bellechasse und der Rue de Bourgogne vor dem Tor eines großen neuerbauten Hauses. Es stand auf einem Teil eines alten Gartengrundstücks. Das alte Gebäude selbst hatte man verschont; bescheiden wie es war, fristete es sein Dasein im Hintergrunde des nunmehr um die Hälfte geschmälerten Hofes.
Schon an der Art und Weise, wie der Hauptmann beim Aussteigen die Hilfeleistung des Kutschers in Anspruch nahm, konnte man den Fünfziger erkennen. Es gibt gewisse Gebärden, deren unverhohlene Schwerfälligkeit ganz so indiskret ist wie ein Geburtsschein. Der Hauptmann zog seinen rechten gelben Handschuh wieder an und betrat, ohne sich um den Pförtner zu kümmern, die kleine Freitreppe vor dem Hause mit dem Gebaren des Eigentümers. Die Pariser Portiers haben feine Nasen; es fällt ihnen nicht ein, mit Orden und in Uniform einherstolzierende Leute anzuhalten. Kurz, sie kennen den Reichen.
Das ganze Erdgeschoss des Hauses bewohnte der Baron Hulot von Ervy. Während der Republik war er Oberkriegskommissar gewesen, dann Generalintendant der Armee, schließlich war er Chef einer der wichtigsten Abteilungen im Kriegsministerium geworden, Staatsrat, Großoffizier der Ehrenlegion und anderes mehr. Dieser Baron Hulot hatte seinem Namen das »von Ervy« – er stammte aus Ervy – eigenmächtig hinzugesetzt, um sich von seinem Bruder zu unterscheiden, dem berühmten General Hulot, ehemaligem Obersten der Kaiserlichen Gardegrenadiere, den Seine Majestät nach dem Feldzuge von 1809 zum Grafen von Pforzheim ernannt hatte. Der ältere Bruder, der Graf, der bei seinem jüngeren Bruder den Vater vertreten musste, hatte ihn fürsorglich bei der Heeresverwaltung untergebracht. Des Bruders sowie seiner eigenen Verdienste wegen war Hektor von Hulot Baron und Günstling Napoleons geworden und 1807 – wie gesagt – Generalintendant der Armee in Spanien.
Nach dem Läuten strich sich der Bürgergardist mit peinlicher Sorgfalt seinen Waffenrock glatt, der sich dem stattlichen Bäuchlein zuliebe hinten wie vorn wellenförmig hinaufgeschoben hatte. Sobald ihn der Diener in Livree wahrnahm, ward er eingelassen. Der gewichtig-wichtige Mann folgte dem Lakaien, der ihn beim öffnen der Salontür meldete:
»Herr Crevel!«
Beim Hören dieses Namens, der ins Deutsche übersetzt etwa »Bäuchling« lauten würde, also wundervoll zu der äußeren Erscheinung seines Trägers passte, schien die große blonde, noch vorzüglich aussehende Dame, die im Salon saß, einen elektrischen Schlag zu erhalten. Sie fuhr auf.
»Hortense! Kindchen! Geh mit Tante Lisbeth in den Garten!«
Diese lebhaft gesprochenen Worte galten ihrer Tochter, die unweit von ihr saß und stickte. Fräulein Hortense von Hulot grüßte den Eintretenden anmutig und entfernte sich durch die Glastür, begleitet von einer alten Jungfer, die viel älter aussah als die Baronin, obgleich sie fünf Jahre jünger war.
»Man bespricht deine Heiratsangelegenheit!« flüsterte Tante Lisbeth ihrer jungen Verwandten ins Ohr, anscheinend durchaus nicht gekränkt von der Art, mit der die Baronin beide hinausgeschickt hatte, wobei sie nur nebenbei erwähnt worden war. Aber schon die Kleidung der »Tante Lisbeth« erklärte diese Nichtachtung. Das altjüngferliche Mädchen trug ein rotbraunes Wollkleid von altmodischem Schnitt und Ausputz, eine gestickte Halskrause, die drei Francs gekostet haben mochte, und einen Strohhut mit blauen strohgeränderten Atlasschleifen besetzt, wie ihn die Marktweiber tragen. Ihre grobledernen Schuhe, deren Form auf den gewöhnlichsten Schuster schließen ließ, hätten keinen Fremden auf den Einfall gebracht, in dieser Tante Lisbeth eine Verwandte des Hauses zu erblicken. Sie sah ganz und gar aus wie eine Nähmamsell auf Tagelohn. Trotzdem verließ die alte Jungfer das Zimmer nicht, ohne dem dicken Crevel leichthin einen zärtlichen Gruß zuzuwerfen, der mit einem verständnisvollen Nicken erwidert ward.
»Sie kommen doch morgen, Fräulein Fischer?«
»Wird sonst noch jemand da sein?« antwortete Tante Lisbeth. »Meine Kinder und Sie! Weiter niemand«, entgegnete der Besucher.
»Gut! Dann rechnen Sie auf mich.«
»Gehorsamst zur Stelle, gnädige Frau!« begann der Hauptmann von der Bürgerwehr, indem er sich nochmals vor der Baronin Hulot verbeugte und ihr einen Blick zuwarf wie Tartüff der Elmira auf irgendeiner Provinzbühne.
»Wenn Sie mir dorthinein folgen wollen, Herr Crevel, werden wir die Angelegenheit besser besprechen können als hier im Salon«, sagte Frau von Hulot, indem sie nach dem benachbarten Gemach wies, dem Spielzimmer.
Dieser Raum war nur durch eine dünne Wand vom Damenzimmer getrennt, dessen Fenster nach dem Garten hinausging. Die Baronin ließ Crevel einen Augenblick allein. Es schien ihr angebracht, im Damenzimmer Tür und Fenster zu schließen, damit dort niemand horchen könne. Aus gleicher Vorsicht schloss sie die Glastür im großen Salon, wobei sie ihrer Tochter und der Tante zuwinkte, die sie in einer verwilderten Laube im Garten sitzen sah. Die Tür zwischen Salon und Spielzimmer ließ sie offen, um zu hören, wenn jemand den Salon betrat.
Wie die Baronin unbeobachtet so hin und her ging, spiegelten sich alle ihre Gedanken in ihren Mienen. Wer sie beobachtet hätte, wäre vor ihrer Erregtheit erschrocken. Als sie jedoch wieder in der Tür des Spielzimmers erschien, hüllte sich ihr Gesicht in jene undurchdringliche Selbstbeherrschung, über die alle Frauen, selbst die offenherzigsten, wie auf Befehl verfügen.
Während dieser zum mindesten sonderbaren Vorbereitungen musterte Crevel die Einrichtung des kleinen Salons, in dem er sich befand. Er besah sich die seidenen Vorhänge, die, einstmals rot, unter dem Einflusse des Sonnenlichts violett und durch den langen Gebrauch in den Falten fadenscheinig geworden waren. Die Farben des Teppichs waren verschossen, die Vergoldung der Möbel blind, der Atlas der Bezüge fleckig und an den Kanten durchgescheuert. Geringschätzigkeit, Zufriedenheit und Hoffnung offenbarten sich bei dieser Besichtigung nacheinander auf dem naiven Alltagsgesichte des Kaufmanns und Emporkömmlings. Gerade betrachtete er sich im Spiegel über einer alten Standuhr im Empirestil und musterte sich selber, als das Rascheln seidener Röcke die Wiederkehr der Baronin verkündete. Alsbald rückte sich Crevel zurecht.
Frau von Hulot ließ sich auf einem kleinen Sofa nieder, das vor dreißig Jahren zweifellos wunderschön gewesen sein musste. Mit der Geste, sich zu setzen, bot sie Crevel einen Stuhl an, dessen Armlehnen in Sphinxköpfe ausliefen; die Bronzierung daran war stellenweise abgeblättert, und das Holz schimmerte durch.
»Ihre Vorsichtsmaßregeln, gnädige Frau, könnten das beste Vorzeichen sein für einen ...«
»Für einen Verliebten!« vervollständigte die Baronin, indem sie den Bürgergardisten unterbrach.
»Das Wort besagt zu wenig!« beteuerte dieser, wobei er seine rechte Hand aufs Herz drückte und die Augen hochrollte. Wohl jede Frau, die diese Mimik kalten Sinnes zu sehen bekommt, lacht. »Verliebt? Verliebt!« fuhr Crevel fort. »Sagen Sie: Verzaubert!«
»Passen Sie einmal auf!« sagte die Baronin, zu ernst, um lachen zu können. »Sie sind fünfzig Jahre alt, folglich zehn Jahre jünger als mein Mann. Ich weiß das wohl. Aber wenn eine Frau in meinen Jahren noch Torheiten begeht, so muss sich das rechtfertigen durch Jugend oder Schönheit oder Berühmtheit oder Macht oder durch irgendeine Aureole, in deren Glanz und Sonne man sogar seine Jahre vergisst. Wenn Sie fünfzigtausend Francs Jahreseinkommen haben, so macht dies Ihr Alter wett. Im übrigen aber besitzen Sie nichts von dem, was eine Frau verlangt.«
»Meine Liebe?« fragte der Bürgergardist, indem er aufstand und sich der Baronin näherte. »Meine Liebe, die ...«
»Nein, nein, Herr Crevel, das ist eine beharrliche Einbildung von Ihnen!« unterbrach sie ihn, um dem lächerlichen Auftritt Einhalt zu tun.
»Jawohl, ganz recht: beharrliche Liebe!« rief er aus, »und mehr noch: auch eine berechtigte ...«
»Berechtigt?« fuhr die Baronin auf. Ihre Entrüstung, ihr Stolz, ihre Verachtung verliehen ihr etwas Großartiges. »Wenn es in diesem Tone weitergehen soll, werden wir niemals zu Ende gelangen. Ich habe Sie nicht hergebeten, damit wir über Dinge reden, die trotz der Verbindung unsrer beiden Familien zu vermeiden sind ...«
»Ich dachte ...«
»Nochmals«, fuhr sie fort, »Herr Crevel, erkennen Sie denn nicht aus der freimütigen und offenen Art, mit der ich mich mit Ihnen über Liebe und Liebhaber unterhalte – über die gefährlichsten Themen, die es für Frauen gibt –, erkennen Sie daran nicht, dass ich mich in meiner Ehrbarkeit ganz und gar sicher fühle? Ich fürchte nichts; nicht einmal, um meinen guten Ruf zu kommen, indem ich mich zusammen mit Ihnen einsperre! Benehme ich mich denn wie ein schwaches Weib? Sie wissen doch wohl, warum ich Sie hergebeten habe?«
»Nein, gnädige Frau«, gab Crevel zur Antwort, indem er ein gleichgültiges Gesicht zog. Er biss sich auf die Lippen und saß steif da. Die Baronin betrachtete ihn.
»So! Um das für beide Teile peinliche Gespräch abzukürzen, will ich mich kurz fassen.«
Crevel machte eine ironische Verbeugung, an der ein Fachmann das verbindliche Getue des ehemaligen Commis voyageur wiedererkannt hätte.
»Unser Sohn ist der Mann Ihrer Tochter ...«, begann die Baronin.
»Leider Gottes!« seufzte Crevel.
»Diese Ehe würde ein zweites Mal nicht zustande kommen«, fuhr Frau von Hulot lebhaft fort, »das ist mir völlig klar. Trotzdem brauchen Sie sich nicht zu beklagen. Mein Sohn ist einer der ersten Pariser Rechtsanwälte, dazu seit einem Jahre Abgeordneter. Sein erstes Auftreten in der Kammer war glänzend genug, um hoffen zu können, dass er in nicht zu langer Zeit einmal Minister werden wird. Viktor ist zweimal zum Referenten bei der Einbringung wichtiger Gesetze gewählt worden. Wenn er es wollte, könnte er bereits Generalanwalt am Kassationshofe sein. Da Sie mir dennoch zu verstehen geben, Sie hätten einen Schwiegersohn ohne Vermögen ...«
»Ein Schwiegersohn«, unterbrach sie Crevel, »den ich unterhalten muss, das dünkt mich eine üble Sache, gnädige Frau. Von der halben Million, die meine Tochter als Mitgift bekommen hat, sind zweimalhunderttausend Francs Gott weiß wohin! Die Schulden Ihres Herrn Sohnes sind davon bezahlt worden, die Prachteinrichtung seines Hauses, eines Hauses, das eine halbe Million wert ist, aber keine fünfzehntausend Francs Zinsen bringt, weil er den schönsten Teil darin selber bewohnt, obgleich zweihundertsechzigtausend Francs Hypotheken darauf stehen. Der Mietertrag deckt knapp die Hypothekenzinsen. In diesem Jahre gebe ich meiner Tochter so an die zwanzigtausend Francs, damit die ganze Karre nicht im Dreck steckenbleibt. Mein Schwiegersohn, der wirklich seine dreißigtausend Francs im Jahre verdienen könnte, vernachlässigt seine Tätigkeit an den Gerichtshöfen zugunsten seiner Beschäftigung als Abgeordneter ...«
»Herr Crevel, wir halten uns immer noch bei der Vorrede auf und kommen so nicht zur Sache. Machen wir Schluss damit! Mein Sohn wird Minister, Sie sind durch ihn Ritter der Ehrenlegion geworden und Stadtrat von Paris. Als ehemaliger Parfümerienhändler können Sie sich also wirklich nicht beklagen!«
»Darauf geht's also hinaus, gnädige Frau! Ich bin ein privatisierender Krämer, Tütendreher, Verkäufer von Hautsalbe, Kopfwasser und Haaröl. Muss mich hochgeehrt fühlen, dass ich meine einzige Tochter an den Sohn des Herrn Baron Hulot von Ervy verheiratet habe, dass sie Baronin geworden ist! Aber leben wir denn in der Zeit der Regentschaft oder unter Ludwig XV.? Rokokofaxen! Was geht mich das an? Ich liebe Cölestine, wie man seine eigene Tochter eben liebt. Ich liebe sie dermaßen, dass ich ihr zuliebe, um ihr keine Geschwister in die Welt zu setzen, all die Unbequemlichkeiten, in Paris Witwer zu sein, auf mich geladen habe, und das in meinen besten Jahren, gnädige Frau! Aber glauben Sie mir: trotz dieser sinnlosen Liebe zu meiner Tochter werde ich mein Vermögen nicht für Ihren Sohn verpulvern. Sein Aufwand scheint mir, dem ehemaligen Kaufmann, einer sauberen Rechnung zu entbehren.«
»Herr Crevel, wir haben gerade jetzt auf dem Posten des Handelsministers einen ehemaligen Parfümerienhändler aus der Rue des Lombards: Herrn Popinot ...«
»Mein Freund Popinot!« rief Crevel aus. »Gnädige Frau, ich, Cölestin Crevel, ich war doch einmal erster Kommis beim alten Cäsar Birotteau. Von besagtem Birotteau, Popinots Schwiegervater, habe ich mein Geschäft gekauft. Popinot war damals auch bloß einfacher Verkäufer bei dieser Firma. Er ist es, der mich immer an all das erinnert, denn eingebildet ist er nicht – das muss man ihm lassen! –, das heißt wohlhabenden Leuten gegenüber, Leuten, die sechzigtausend Francs im Jahre zu verzehren haben ...«
»Sehen Sie, Herr Crevel, jene Kulturwelt, die Sie eben mit dem Worte Regentschaft charakterisiert haben, hat wirklich nichts gemein mit einer Zeit, wo man die Menschen nach ihrem persönlichen Werte schätzt. Und das haben Sie doch getan, als Sie Ihre Tochter meinem Sohne zur Frau gaben ...«
»Ach, Sie wissen nicht, wie diese Heirat zustande gekommen ist«, unterbrach Crevel sie heftig. »Dieses verdammte Junggesellenleben! Ohne meine Weibergeschichten wäre meine Cölestine heute die Vicomtesse Popinot!«
»Ich sage Ihnen zum letzten Male, machen wir uns keine gegenseitigen Vorwürfe in Dingen, die nun einmal geschehen sind!« sagte die Baronin festen Tones, »Reden wir einmal über die bedauerliche Tatsache Ihres sonderbaren Verhaltens. Meine Tochter Hortense hätte sich verheiraten können. Das hing lediglich von Ihnen ab. Ich habe Ihnen Edelmut zugetraut, ich habe geglaubt, Sie würden eine Frau in Frieden lassen, deren Herz ihrem Gatten immerdar treu geblieben ist. Ich habe geglaubt, Sie würden einsehen, dass es eine Unmöglichkeit für mich ist, jemanden zu empfangen, der imstande ist, mich bloßzustellen. Und ich habe geglaubt, Sie würden es sich auf das eifrigste angelegen sein lassen, die Verbindung Hortenses mit dem Regierungsrat Lebas zu fördern – der Familie zu Ehren, mit der auch Sie verwandt sind. Nichts von alledem, Herr Crevel! Sie haben diese Heirat hintertrieben.«
»Gnädige Frau«, gab der ehemalige Parfümerienhändler zur Antwort, »ich habe durchaus ehrlich gehandelt. Man hat sich bei mir erkundigt, ob die zweihunderttausend Francs, die Fräulein Hortense mitbekommen soll, bar vorhanden seien. Meine Antwort hat wörtlich wie folgt gelautet: ›Ich kann nicht dafür bürgen. Mein Schwiegersohn, dem die gleiche Summe bei seiner Verheiratung zur Verfügung stehen sollte, war verschuldet, und ich glaube, wenn Herr Hulot von Ervy morgen stürbe, wäre seine Witwe mittellos.‹ Das war meine Auskunft, Verehrteste!«
Die Baronin sah Crevel scharf an.
»Hätte Ihre Auskunft ebenso gelautet, wenn ich Ihnen zuliebe pflichtvergessen wäre?«
»Dann hätte ich kein Recht gehabt, so zu reden!« bemerkte der sonderbare Verliebte. »Die Mitgift würde Ihnen aus meiner Brieftasche zur Verfügung gestanden haben.«
Wie zum Beweise seiner Worte sank der dicke Crevel vor der Baronin auf die Knie und küsste ihr die Hand. Seine Rede hatte sie in wortlose Angst versetzt. Er bemerkte die Wirkung, hielt es aber für Unschlüssigkeit.
»Ich soll das Glück meiner Tochter erkaufen um den Preis ...? Nein, Herr Crevel! Stehen Sie auf, oder ich alarmiere das Haus!«
Der ehemalige Kaufmann erhob sich wieder, was ihm nicht leicht fiel. Seine Unbeholfenheit versetzte ihn in Wut. Er nahm seine »Attitüde« an. Fast alle Männer haben eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Haltung, wobei sie sich einbilden, sie präsentierten damit alle ihre Vorzüge gleichsam auf einem Brette. Diese Attitüde bestand bei Crevel darin, dass er die Arme verschränkte – wie Napoleon Bonaparte –, den Kopf drei Viertel zur Seite drehte und den Blick gen Himmel warf. So hatte er sich auch einmal malen lassen. Mit gut gespieltem Zorn rief er aus:
»Einem Roué treu bleiben ...«
»Einem Gatten, Herr Crevel«, unterbrach ihn die Baronin, »einem Gatten, der es wert ist!« Sie wollte nicht hören, was Crevel im nächsten Augenblick gesagt hätte.
»Gut, gnädige Frau!« begann Crevel von neuem. »Sie haben mir geschrieben, ich solle kommen. Sie wollen die Gründe meines Verhaltens wissen. Sie reizen mich bis aufs Blut mit Ihrer Unnahbarkeit, Ihrer Geringschätzung, Ihrem Hohn! Bin ich denn ein Scheusal? Ich sage es Ihnen nochmals: Glauben Sie mir, ich habe ein Recht dazu, Ihnen ... einen Antrag zu machen ... weil ... Nein, nein! Ich liebe Sie, und darum will ich schweigen.«
»Sprechen Sie sich nur aus, Herr Crevel! Ich werde in ein paar Tagen achtundvierzig Jahre alt. Ich bin nicht albernprüde. Ich kann alles hören.«
»Gut! Schwören Sie mir bei Ihrer Frauenehre, bei Ihrer Frauenehre, die mein Unglück ist! Schwören Sie mir, mich nie zu verraten, niemandem zu sagen, dass ich Ihnen dieses Geheimnis anvertraut habe!«
»Wenn es sein muss, so schwöre ich Ihnen, niemandem zu sagen, selbst meinem Mann nicht, von wem ich das Unerhörte erfahren habe, das Sie mir anvertrauen werden!«
»Ich glaube es Ihnen schon, denn es handelt sich lediglich um Sie und um ihn.«
Frau von Hulot wurde blass.
»Ja, wenn Sie Ihren Mann noch lieben, dürfte es Ihnen schmerzlich sein! Soll ich also lieber nichts sagen?«
»Sprechen Sie, Herr Crevel! Handelt es sich doch darum, wie Sie sagen, den merkwürdigen Antrag zu rechtfertigen, den Sie mir gemacht haben – die Beharrlichkeit, mit der Sie mich alte Frau verfolgen, mich, die ich meine Tochter verheiraten und dann in Frieden sterben möchte!«
»Sie sind eine unglückliche Frau!«
»Ich?«
»Ja, schönes, edles Wesen, du hast nur allzuviel zu leiden ...«
»Herr Crevel! Schweigen Sie! Gehen Sie oder reden Sie in anständiger Weise!«
»Wissen Sie, gnädige Frau, wie Ihr Mann und ich miteinander bekannt geworden sind? ... Bei unsern Mätressen!«
»Herr Crevel!«
»Bei unsern Mätressen!« wiederholte Crevel in melodramatischem Tone. Dabei gab er seine Attitüde auf, indem er mit der rechten Hand eine beteuernde Geste machte.
»Und?« fragte die Baronin kühl.
Crevel war verblüfft. Verführer mit kleinen Motiven verstehen die großen Seelen nie.
»Was mich anbelangt, der ich seit fünf Jahren Witwer bin«, fuhr er fort, indem er redete, als erzähle er eine Geschichte, »ich wollte mich nicht wieder verheiraten, im Interesse meiner Tochter, die ich vergöttere. Auch wollte ich in meinem Hause mein freier Herr bleiben. Ich hätte ja aus meinem Kontor ein sehr hübsches Frauenzimmer haben können. Aber nein, ich hielt mir, wie man zu sagen pflegt, ein kleines Mädel aus, eine Fünfzehnjährige, ein wunderschönes Ding. Ich gestehe, ich war in sie verliebt bis über die Ohren. Infolgedessen ließ ich aus meiner Heimat eine Tante von mir kommen, die Schwester meiner Mutter; die musste mit dem entzückenden Geschöpf zusammen wohnen und achtgeben, damit es möglichst brav bliebe in dieser – wie soll ich sagen? – heiklen ... illegitimen Situation. Die Kleine war sichtlich musikalisch. Ich ließ sie unterrichten und ausbilden. Eine Beschäftigung musste sie doch sowieso haben. Dabei wollte ich gleichzeitig ihr Vater, ihr Wohltäter und – offen gesagt – ihr Liebhaber sein. Ich wollte sozusagen zwei Fliegen mit einem Schlage fangen: ein gutes Werk tun und mir eine treue Freundin erwerben. Fünf Jahre war ich glücklich! Die Kleine hatte eine Stimme, mit der sie auf der Bühne ihr Glück machen musste. Wie soll ich mich ausdrücken? Sie singt wie eine Nachtigall. Sie hat mich jährlich zweitausend Francs gekostet, das heißt lediglich ihre musikalische Ausbildung. Sie hat mich zum Musiknarren gemacht. Ich habe für mich und meine Tochter eine Loge in der Italienischen Oper abonniert, und abwechselnd benutze ich diese Loge mit Cölestine oder mit Josepha ...«
»Der berühmten Sängerin?«
»Jawohl, gnädige Frau«, gab Crevel selbstbewusst zur Antwort, »diese vielgenannte Josepha hat mir alles zu verdanken! Als sie ein kleines Ding von zwanzig Jahren war, Anno 1834, da bildete ich mir ein, sie würde nie von mir lassen. Ich tat ihr alles zu Gefallen. Sie sollte sich auch ein bisschen amüsieren, und da gestattete ich ihr den Verkehr mit einer hübschen jungen Schauspielerin, Jenny Cadine, einer Art Schicksalsgefährtin von ihr. Die beiden wurden sehr bald gute Freundinnen. Auch sie hatte alles einem Gönner zu verdanken, der sie auf Händen trug. Dieser Gönner war der Baron Hulot ...«
»Das ist mir bekannt«, unterbrach ihn die Baronin ruhigen Tones und ohne die geringste Erregung.
»So?« rief Crevel aus. Seine Verwunderung fand keine Grenzen. »Was? Sie wissen, dass Ihr Mann, dieser unglaubliche Mensch, die Jenny Cadine seit ihrem dreizehnten Jahre unterhält?«
»Weiter!« warf die Baronin hin.
Der ehemalige Geschäftsmann fuhr fort:
»Als Jenny Cadine zwanzig Jahre alt war – so alt wie Josepha –, als sich die beiden kennenlernten, da hatte der Baron die Rolle Ludwigs XV. bei Fräulein von Romans bereits acht Jahre gespielt. Also seit 1826! Damals waren Sie zwölf Jahre jünger als heute ...«
»Herr Crevel, ich hatte meine Gründe, meinem Manne seine Freiheit zu lassen.«
»Gnädige Frau, das ist eine Lüge, die zweifellos dermaleinst alle Sünden Ihres ganzen Lebens aufwiegt und Ihnen die Pforte des Paradieses öffnen wird!«
Die Baronin wurde rot.
»Erzählen Sie das anderen Leuten«, fuhr er fort, »Sie herrliche, angebetete Frau, nur mir nicht! Wissen Sie, ich habe mit Ihrem schurkischen Gatten zu häufig Feste zu vieren gefeiert, um nicht zu wissen, was für eine Frau Sie sind. Bisweilen bekam er in der Weinstimmung Gewissensbisse, und dann rühmte er mir Ihre Vorzüge bis ins einzelne. Sie sind ein himmlisches Geschöpf! Ein junges Mädel von zwanzig Jahren oder Sie! Nur ein Wüstling könnte da unschlüssig sein! Ich zögere nicht!«
»Herr Crevel!«
»Gut! Ich sage nichts weiter. Aber seien Sie überzeugt, anbetungswürdige, werte Frau: bezechte Ehemänner plaudern so mancherlei von ihren Frauen bei ihren Mätressen aus ... und die halten sich den Bauch vor Lachen!«
Tränen der Scham flössen der Baronin aus den Augen. Der Bürgergardist hielt plötzlich ein und vergaß seine Attitüde.
»Kurz und gut«, fuhr er dann fort, »der Baron und ich wurden durch unsere Weiber Freunde. Wie alle Lebemänner ist er liebenswürdig und im Grunde wirklich ein guter Kerl. Er gefiel mir. Ein so lustiger Gesellschafter! Mitunter hatte er Einfälle ... Doch genüg von diesen Erinnerungen! Wir wurden wie Brüder zueinander. Durch und durch Roué, versuchte er mich zu verderben, mir in puncto Frauen seine Herrenmoral zu predigen, seine Ideen vom Grandseigneur usw. Mir, der ich meine Kleine am liebsten geheiratet hätte! Nur vor dem Kinderkriegen hatte ich Angst ... Väter und Freunde, wie wir also beide waren, ist es da ein Wunder, dass wir eines schönen Tages auf den Gedanken kamen, unsere Kinder miteinander zu verheiraten? Ein Vierteljahr nach der Hochzeit seines Sohnes mit meiner Cölestine hat mir Hulot, dieser – wie soll ich ihn nennen, den gemeinen Kerl, der uns beide betrogen hat, Sie, gnädige Frau, wie mich! –, da hat er mir meine kleine Josepha ausgespannt. Seine Jenny Cadine, die alle Tage berühmter wurde, war ihm mit einem jungen Diplomaten und einem Künstler durch die Lappen gegangen, und da nahm er mir meine Geliebte, das herzige Ding. Sie haben sie gewiss in der Italienischen Oper singen hören. Er hat sie da durch seine Beziehungen untergebracht. Ihr Mann ist eben nicht so vorsichtig wie ich, nicht so genau wie ich. Die Jenny Cadine hatte ihm gehörig gekostet, etwa dreißigtausend Francs das Jahr. Na, ich sage Ihnen, mit der Josepha richtet er sich nun gänzlich zugrunde. Gnädige Frau, Josepha ist Jüdin, ein Findelkind, aus Deutschland gebürtig. Nach den Nachforschungen, die ich habe anstellen lassen, ist sie die natürliche Tochter eines großen jüdischen Geldmannes. Die Theaterluft und besonders die trefflichen Rezepte der Jenny Cadine und anderer Kolleginnen, wie man alte Kerle ausbeutelt, haben in dem kleinen Mädel, das ich in änständiger und ziemlich bescheidener Bahn hielt, den uralten semitischen Instinkt nach Gold und Geschmeide wachgerufen, die Gier nach dem goldenen Kalbe. Nachdem sie einmal Blut geleckt hat, diese berühmte Sängerin, will sie reich, steinreich werden. Sie geizt mit dem, was andere ihretwegen verschwenden. Den Hulot rupft sie ordentlich. Rupfen, ach was, sie zieht ihm das Fell über die Ohren! Nachdem dieser Unglücksmensch die Konkurrenz des Herrn Keller und des Marquis von Esgrignon hatte aushalten müssen – die beiden waren in Josepha vernarrt; die Schar der unbekannten Anbeter wollen wir beiseite lassen –, da ward er von einem maßlos reichen Mäzen aus dem Sattel gehoben, dem Herzog von Hérouville. Dieser hohe Herr besitzt die Anmaßung, Josepha völlig für sich allein haben zu wollen. Die ganze Halbwelt spricht davon; nur der Baron weiß es nicht. Wie das immer so ist, er sitzt in Wolkenkuckucksheim. Bei Liebschaften ist es ganz so wie in den Ehen. Der Betroffene erfährt immer alles zuletzt ... Begreifen Sie nun meine Rechte? Ihr Mann, Verehrteste, hat mir mein Glück gestohlen, das einzige bisschen Freude, das ich gehabt habe, seit ich Witwer bin. Sehen Sie, wenn ich nicht das Unglück gehabt hätte, diesen alten Bock kennenzulernen, besäße ich meine Josepha noch heute, denn ich hätte sie in meinem ganzen Leben nicht ans Theater gelassen. Sie wäre mein eigen geblieben, unbekannt und bescheiden. Ach, Sie hätten sie einmal vor acht Jahren sehen sollen! Wie war sie schlank und frisch! Eine Haut hatte sie, goldbraun wie eine Andalusierin. Ihr schwarzes Haar schimmerte wie Seide. Augen mit langen dunklen Wimpern und voller Feuer. Ein Benehmen wie eine Fürstin. Und doch so bescheiden wie eine Bettlerin. Ehrsam-graziös. Flink wie ein Reh in der Wildnis ... Dank dem Baron Hulot sind alle die schönen Eigenschaften Speck für die Mäuse geworden und das Mädel selber eine Königin im Reiche der Lüste! Das harmlose kleine Schäfchen von ehedem ist heute das gerissenste Weibsstück ...«
Der alte Parfümerienhändler wischte sich die tränenfeuchten Augen. Die Ehrlichkeit seines Schmerzes machte Eindruck auf die Baronin. Sie riss sich aus den Grübeleien, in die sie versunken war.
»Sagen Sie, gnädige Frau«, fuhr Crevel fort, »kann man mit zweiundfünfzig Jahren einen solchen Schatz wiederfinden? In einem Alter, wo die Liebe jährlich dreißigtausend Francs kostet! Ich sehe das an Ihrem Herrn Gemahl. Aber ich liebe meine Tochter zu zärtlich, um sie zu ruinieren ... Als ich Sie kennenlernte, bei jenem ersten Diner, zu dem Sie mich eingeladen hatten, da begriff ich nicht, warum Ihr Mann, der Schurke, eine Jenny Cadine aushielt. Sie sahen wie eine Kaiserin aus. Sie waren noch nicht dreißig Jahre. Sie waren jung und schön! Auf Ehre, an dem Tage war ich tief erschüttert. Ich sagte mir: Hätte ich nicht meine Josepha, so wäre diese von ihrem Gatten verlassene Frau meine richtige Handschuhnummer ... Verzeihung! Das ist so eine Redensart von früher her! Der Parfümerienfritze kommt ab und zu wieder zum Vorschein! Es ist Zeit, dass ich Abgeordneter werde! – Also, nachdem mich der Baron so niederträchtig betrogen hatte – unter alten Kameraden, die wir waren, muss einem die Geliebte des Freundes heilig sein! –, da hab ich mir geschworen, ihm seine Frau zu rauben. Das wäre Vergeltung! Der Baron könnte gar nichts dagegen tun. Wir würden sicher straflos ausgehen. Und doch jagen Sie mich von Ihrer Schwelle wie einen räudigen Hund – bei dem ersten Wort, mit dem ich Ihnen den Zustand meines Herzens andeute. Damit haben Sie meine Liebe, meine Beharrlichkeit – wie Sie sagen – verdoppelt. Sie sind mir verfallen!«
»Wieso?«
»Das weiß ich nicht, aber es ist so. Sehen Sie, gnädige Frau, ein dummer Kerl wie ich, ein Kaufmann, der kein Geschäft mehr hat, wenn der sich einmal einen Gedanken in den Kopf gesetzt hat, so ist er tausendmal halsstarriger als ein Gelehrter, der tausend Ideen im Gehirn hat. Ich bin in Sie vernarrt. Sie verkörpern meine Rache. Das ist gleichsam eine doppelte Leidenschaft! Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich weiß, was ich will. Und wenn Sie mir auch sagen, Sie würden nie die Meine, so rede ich doch kaltlächelnd mit Ihnen weiter. Wie das Sprichwort sagt: Ich spiele mit offenen Karten. Und ich sage Ihnen: Eines Tages gehören Sie mir! Und sollte ich warten, bis Sie fünfzig Jahre alt sind: meine Geliebte werden Sie doch! Es muss so kommen! Dafür wird Ihr Gatte sorgen!«
Die Baronin warf dem Vorausrechner einen Blick zu, dessen grenzenlose Angst ihm halb verrückt vorkam. Crevel lenkte ein.
»Sie haben es so gewollt! Sie haben mich mit Ihrer Geringschätzigkeit überschüttet. Sie haben mich verachtet. Ich musste reden.«
Damit wollte er notgedrungen seine letzten zügellosen Worte mildern.
»Meine arme Tochter, meine arme Tochter!« lispelte die Baronin vor sich hin. Es war ihr, als ob sie sterben sollte.
»Was geht mich das an!« erwiderte Crevel. »Damals, als mir Josepha untreu wurde, war ich wie eine Löwin, der man ihre Jungen weggenommen hat ... Kurz und gut, mir war zumute wie Ihnen in dieser Stunde. Ihre Tochter! Gerade sie ist mir das Mittel zum Zweck, um Sie zu erringen! Ich bin daran schuld, ich und kein anderer, dass die Heirat Ihrer Tochter nicht zustande gekommen ist, und ohne meine Beihilfe wird sie nie und nimmer zustande kommen! Mag Fräulein Hortense noch so schön sein, eine Mitgift braucht sie!«
»Leider!« Die Baronin wischte sich die Augen.
»Na – und bitten Sie Ihren Mann bloß einmal um zehntausend Francs! Versuchen Sie es nur!« meinte Crevel, indem er sich in Positur setzte. Dann schwieg er eine Weile wie ein Schauspieler, der auf sein Stichwort wartet. »Und wenn er die zehntausend hätte, würde er sie der Nachfolgerin von Josepha geben.« Crevel brüllte beinahe. »Er ist unverbesserlich. Er kann die Weiber nicht lassen. Sie sind sein Element sozusagen. Und die liebe Eitelkeit kommt auch noch dazu. Ein netter Familienvater! Wenn er nur sein Vergnügen hat! Ihr könnt alle zusammen auf Stroh liegen. Viel fehlt übrigens nicht, und der Ruin ist da. Solange ich in diesem Hause verkehre, hat sich die Einrichtung Ihres Salons nicht verändert. Die Armut guckt aus allen Ecken und Enden hervor. Den Schwiegersohn können Sie sich malen, der angesichts dieses Elends nicht kehrtmacht. Und das Elend der vornehmen Leute ist das allerschlimmste. Ich bin Kaufmann gewesen. Mir macht keiner was vor. Ein Pariser Kaufmann hat gute Augen. Unsereiner erkennt den Unterschied zwischen echtem und falschem Prunk sofort. Sie haben keinen roten Heller!« Er begann leise zu sprechen. »Das sieht man an allem. Sogar an der Livree Ihres Dieners. Soll ich Ihnen einmal ein paar hässliche Geheimnisse offenbaren?«
»Herr Crevel!« Frau von Hulot weinte in ihr Taschentuch hinein. »Es ist genug!«
»Ach was! Mein Schwiegersohn schiebt seinem Vater Geld zu. Das wollte ich Ihnen zunächst von dem Benehmen Ihres Sohnes berichten. Aber ich werde die Interessen meiner Tochter zu wahren wissen. Darauf können Sie sich verlassen!«
»Ach, ich möchte meine Tochter verheiratet sehen und dann sterben!« rief die Baronin. Sie war todunglücklich.
»Das liegt ja ganz in Ihrer Hand«, meinte der ehemalige Parfümerienhändler.
Frau von Hulot sah Crevel mit einem Ausdrucke voll Hoffnung an. Das veränderte ihr Gesicht so plötzlich, dass allein dieser Wandel den Mann da vor ihr hätte rühren und von seinem lächerlichen Vorhaben abbringen müssen.
»Noch in zehn Jahren werden Sie schön sein!« beteuerte er, indem er sich in seine Attitüde rückte. »Seien Sie lieb zu mir, und Fräulein Hortense ist verheiratet! Ihr Mann hat mich bevollmächtigt, kann ich Ihnen sagen, die Sache ohne Zimperlichkeit ins Lot zu bringen. Er wird sich nicht weiter betrüben. Seit drei Jahren verbrauche ich nicht einmal meine Zinsen mehr. Ich mache keine großen Dummheiten. Abgesehen von meinem eigentlichen Vermögen habe ich dreihunderttausend Francs Ersparnisse ...«
»Gehen Sie fort, Herr Crevel!« unterbrach ihn die Baronin. »Gehen Sie und lassen Sie sich nie wieder vor mir blicken! Wenn es nicht hätte sein müssen, wenn ich nicht hätte wissen müssen, warum Sie sich in der Angelegenheit von Hortenses Heiratsplan so niederträchtig benommen haben .... Jawohl, niederträchtig!« wiederholte sie auf eine abwehrende Gebärde Crevels. »Wie könnten Sie sonst einen derartigen Hass auf ein armes Mädchen häufen, auf ein schönes unschuldiges Geschöpf! Wenn es nicht hätte sein müssen, aus mütterlicher Herzensnot, hätte ich nie wieder ein Wort mit Ihnen gesprochen, hätte ich Sie nie wieder zu mir vorgelassen! Zweiunddreißig Jahre bin ich eine anständige und treue Frau geblieben. Meine Frauenehre soll auch vor dem Ansturm eines Herrn Crevel nicht zuschanden werden ...«
»... ehemaligen Parfümerienhändlers, Nachfolgers in Firma Cäsar Birotteau ›Zur Rosenkönigin‹, Rue Saint-Honore«, ergänzte Crevel spöttisch, »Stadtrats, Hauptmanns der Bürgerwehr, Ritters der Ehrenlegion ...«
»Herr Crevel«, unterbrach ihn die Baronin, »wenn mein Mann nach zwanzigjähriger Treue seine Frau satt bekommen hat, so geht das niemanden etwas an außer mir! Wie sehr er seine Untreue zu verheimlichen verstanden hat, das sehen Sie daraus, dass ich nicht gewusst habe, dass er das Herz von Fräulein Josepha nach Ihnen besessen hat ...«
»Jawohl, und mit Gold erkauft, gnädige Frau!« fuhr Crevel auf. »Der Racker hat ihm in diesen zwei Jahren bare einhunderttausend Francs gekostet. Sie werden noch so manches erleben ...«
»Lassen wir das, Herr Crevel! Ich werde Ihnen zuliebe nicht auf das Glücksgefühl verzichten, das eine Mutter empfindet, wenn sie ihre Kinder reinen Herzens an sich drückt, verehrt und geliebt von den Ihren! Mein letztes Stündlein soll mir als einer Schuldlosen schlagen!«
»Amen!« höhnte Crevel in jener verteufelten Bitterkeit, die eingebildete Menschen ergreift, wenn sie in ein und derselben Sache wiederholt keinen Erfolg haben. »Was wissen Sie von der letzten Neige des Elends, von Schmach und Schande! Ich habe den Versuch gemacht, Ihnen die Augen zu öffnen. Ich wollte Sie retten, Sie und Ihre Tochter. Sie werden den Becher des Unglücks bis auf den letzten Tropfen auskosten ... Ihre Tränen und Ihr Stolz rühren mich. Eine geliebte Frau weinen zu sehen, ist schrecklich!«
Indem er das sagte, setzte er sich. Dann fuhr er fort:
»Ich kann Ihnen weiter nichts versprechen, meine liebe Adeline, als dass ich nichts gegen Sie unternehmen will und nichts gegen Ihren Mann. Aber berufen Sie sich nie auf mich! Mehr vermag ich nicht zu tun.«
»Wie soll das enden?« rief Frau von Hulot aus.
Bis jetzt hatte die Baronin tapfer die dreifache Qual erduldet, die diese Unterredung ihrem Herzen bereitete. Sie litt als Weib, als Mutter, als Gattin. Solange ihr der Schwiegervater ihres Sohnes in so roher Weise zugesetzt hatte, war sie stark genug gewesen, dieser Brutalität Widerstand zu bieten. Gegenüber der Gutmütigkeit jedoch, die der verschmähte Verliebte, dieser gedemütigte Nationalgardist zu guter Letzt bei aller Wut verriet, versagten ihre überreizten Nerven. Sie rang die Hände und brach in Tränen aus. So überkam sie eine derartige Niedergeschlagenheit, dass sie sich von Crevel, der vor ihr niedergesunken war, ohne Abwehr die Hände küssen ließ.
»Mein Gott, wie wird das enden?« wiederholte sie, indem sie sich die Augen trocknete. »Soll eine Mutter kaltblütig zusehen, wie ihre Tochter vor ihren Augen hinsiecht? Was wird aus einem so prächtigen Geschöpf, einem von der Natur so bevorzugten Wesen, selbst wenn es stark und rein ist, wie ihre Mutter? An manchen Tagen wandelt sie trübsinnig im Garten einher, ohne dass sie recht weiß, warum. Oft finde ich sie mit verweinten Augen ....«
»Sie ist einundzwanzig«, meinte Crevel.
»Soll ich sie ins Kloster stecken?« fragte die Baronin. »In solchen Krisen unterliegt selbst die Frömmigkeit oft der Natur. Die ehrbarst erzogenen Mädchen verlieren ihren Verstand .... Aber stehen Sie doch auf, Herr Crevel! Fühlen Sie denn nicht, dass zwischen uns nun alles aus ist? dass ich Angst vor Ihnen habe? Sie haben die letzte Hoffnung einer Mutter vernichtet.« »Wenn ich sie wieder aufleben ließe?« sagte Crevel.
Die Baronin blickte ihn mit einer Miene der Hoffnungslosigkeit an, die ihn rührte. Aber die Worte: »Ich habe Angst vor Ihnen!« bewogen ihn, das Mitleid seines Herzens wieder zu unterdrücken. Die Ehrbarkeit ist allzu steifnackig; sie vermag sich nicht durch Hintertüren zu ducken, um auf Schleichwegen zum Ziele zu gelangen.
»Ohne Mitgift verheiratet man heutzutage keine Tochter, auch wenn sie so schön wie Hortense ist«, bemerkte Crevel, wobei er wieder geziert wurde. »Ihre Tochter ist eine Beauté, die niemand Lust hat zu heiraten, gewissermaßen ein Luxuspferd, das allzuviel kostspielige Pflege verlangt, um leicht Käufer zu finden. Wenn man mit einer solchen Frau am Arm spazierengeht, schaut einen alle Welt an und läuft einem nach. Jeden gelüstet nach dieser Frau. Solche Erfolge sind aber nicht jedermanns Geschmack. Mancher schießt sich nicht gern. Mehr als einen kann man auch nicht auf einmal niederknallen. Kurz und gut, wie die Verhältnisse liegen, können Sie Ihre Tochter nur auf drei Arten an den Mann bringen. Erstens: mit meiner Beihilfe. Das wollen Sie ja nicht. Zweitens: Sie verschachern Sie an einen Sechzigjährigen, etwa an einen reichen Witwer, ohne Kinder, der sie haben möchte. Das ist zwar auch nicht so einfach, aber es lässt sich machen. Finden sich doch alte Kerle genug, die junge Weiber wie die Josepha oder die Jenny Cadine aushalten. Warum sollte man nicht mal einen finden, der dieselbe Dummheit in legitimer Weise begeht? Wenn ich meine Cölestine nicht hätte und meine beiden Enkelchen, heiratete ich Hortense. Na und drittens: das ist die allerleichteste Art und Weise...«
Frau von Hulot sah angsterfüllt auf Crevel.
»Paris ist eine Stadt, in die alle tatkräftigen Menschen zusammenströmen. Und die schießen in Frankreich wie die Pilze aus der Erde. In Paris wimmelt es von Talenten, die nicht Haus und Herd haben, aber mutig und zu allem fähig sind, selbst dazu, ihr Glück zu machen. Ich meine, Menschen wie... na, ich selber war mal so einer, und ich kenne ihrer eine ganze Menge. Was besaß Tillet, was Popinot vor zwanzig Jahren? Sie ramschten beide in Papa Birotteaus Laden mit keinem andern Kapital als dem Drange, emporkommen zu wollen. Ich versichere Ihnen, das ist soviel wert wie das beste Kapital! Kapital kann zum Teufel gehen, Mannesmut nicht... Was besaß ich? Den Drang nach vorwärts und meinen Mut! Tillet ist heute einer der gewichtigsten Leute. Und der kleine Popinot, der reichste Drogist in der Rue des Lombards, ist Abgeordneter geworden, jetzt Minister... Kurz und gut, so ein Kondottiere der Elle, der Feder oder des Pinsels, aber nur ein solcher, kann in Paris ein schönes Mädel ohne einen roten Heller heiraten. Die Sorte hat auch dazu Mut. Popinot hat Fräulein Birotteau ohne Aussicht auf die geringste Aussteuer genommen. Solche Kerle sind Narren! Sie glauben an die Liebe, wie sie an ihr Glück und ihr Können glauben. Suchen Sie einen Mann von Energie! Wenn er sich in Ihre Tochter verliebt, heiratet er sie ohne Bedenken. Sie werden mir zugeben, dass ich – als Feind – immerhin großmütig bin, denn mit diesem guten Rate arbeite ich gegen mich selber.«
»Ach, Herr Crevel, wenn Sie nur mein Freund sein und Ihre lächerlichen Hirngespinste lassen wollten!«
»Lächerliche Hirngespinste? Gnädige Frau, schädigen Sie sich doch nicht selber! Sehen Sie: ich liebe Sie, und Sie müssen zu mir halten! Eines schönes Tages will ich zu Hulot sagen: ›Du hast mir Josepha genommen, ich dir deine Frau!‹ Die alte Geschichte von der Vergeltung! Ich werde mein Ziel weiter verfolgen, es sei denn – Sie würden grundhässlich! Und ich komme zum Ziele, und zwar aus dem Grunde« – er blickte die Baronin selbstbewusst an –, »aus dem Grunde«, fuhr er nach einer Pause fort, »weil Sie weder einen alten Mummelgreis noch einen verliebten Draufgänger erwischen werden. Weil Sie Ihre Tochter viel zu sehr lieben, als dass Sie sie einem alten Roué in die Hände geben. Und weil Sie viel zu stolz sind, Sie, die Baronin Hulot, Sie, die Schwägerin eines napoleonischen Generals, der die Alte Garde geführt hat, viel zu stolz, sage ich, als dass Sie einen jener Draufgänger nähmen, wo Sie ihn finden. Zum Beispiel, einen einfachen Arbeiter? So mancher Millionär war vor zehn Jahren simpler Maschinist, Vorarbeiter oder Werkführer. Und dann: wenn Sie glauben, Ihre Tochter könne Ihnen in einer schwachen Stunde Schande bereiten, müssen Sie sich da nicht sagen: ›Nein, nein! Lieber ich als sie! Crevel wird mein Geheimnis wahren, und ich erringe die Mitgift meiner Tochter. Zweihunderttausend Francs gegen zehn Jahre Freundschaft mit diesem ehemaligen Handschuhmacher, dem alten Crevel!‹ Ich belästige Sie, und was ich da sage, ist höchst unmoralisch, nicht? Wenn Sie von wilder Leidenschaft zu mir ergriffen wären, dann fänden Sie wie alle liebenden Frauen tausend Gründe zur Rechtfertigung Ihrer Sünden! Ich sage Ihnen: Hortenses Glück wird Ihr Gewissen zur Kapitulation zwingen!«
»Hortense hat noch einen Onkel.«
»Wen? Wohl den Vater Fischer? Na, der ist mit seinem Gelde fertig, und zwar dank dem Herrn Baron, der alle Kassen ausräumt, die in seinem Bereiche liegen.«
»Graf Hulot ....«
»So? Die Ersparnisse des alten Generalleutnants wird Ihr Mann wohl längst klein gekriegt haben. Mit dem, was er von ihm bekommen hat, ist das Haus seiner Sängerin eingerichtet. Genug! Wollen Sie mich wirklich ganz ohne Hoffnung von dannen gehen lassen?«
»Leben Sie wohl, Herr Crevel! Die Genesung von der Leidenschaft zu einer Frau in meinen Jahren ist leicht. Sie werden christlich denken. Gott schützt die Unglücklichen.«
Die Baronin erhob sich, um den Bürgerwehrhauptmann zum Gehen zu zwingen. Sie manövrierte ihn in den großen Salon hinüber.
»Soll die schöne Frau von Hulot inmitten des alten Gerümpels leben?« bemerkte er, sich umblickend, wobei er auf eine altmodische Lampe, auf einen ehedem vergoldeten Kronleuchter, auf einen fadenscheinigen Teppich deutete, die Reste vom Prunke dieses Salons in Weiß, Gold und Rot, die toten Überbleibsel kaiserlichen Glanzes.
»Herr Crevel, über alledem leuchtet die Ehrbarkeit! Ich verspüre kein Verlangen nach einer luxuriösen Einrichtung. Aus den schönen Dingen, die Sie mir borgen würden, könnte Speck für die Mäuse werden!«
Crevel biss sich auf die Lippen. Er erkannte seine eigenen Ausdrücke wieder, mit denen er vorhin Josephas Habgier gebrandmarkt hatte.
»Für wen die Treue?« warf er hin.
In dem Augenblick waren beide an der Salontür angelangt.
»Für einen Wüstling!« knirschte er mit der Grimasse des Moralisten und Millionärs.
»Wenn Sie recht hätten, Herr Crevel, wäre meine Treue um so verdienstvoller!«
Sie grüßte den Bürgergardisten, wie man grüßt, um sich einen lästigen Menschen vom Leibe zu halten. Dann wandte sie sich rasch ab, ohne ihn ein letztes Mal in seiner Attitüde zu sehen. Sie schloss die Tür wieder auf, die sie vor der Unterredung verschlossen hatte, und so entging ihr die drohende Gebärde, mit der Crevel schied. Stolz und edel schritt sie hin wie eine Märtyrerin in der Arena des Kolosseums. Immerhin waren ihre Kräfte erschöpft. Halbkrank sank sie auf den Diwan ihres blauen Zimmers. Ihre Blicke suchten die verfallene Laube draußen, in der ihre Tochter mit Tante Lisbeth plauderte.
Seit ihrem Hochzeitstage bis zu dieser Stunde hatte die Baronin ihren Gatten geliebt wie Josephine ihren Napoleon, in bewundernder Liebe, in mütterlich-sorglicher Liebe, in feiger Liebe. Wenn sie auch die Einzelheiten, die ihr Crevel eben hinterbracht, nicht gewusst hatte, so war sie trotzdem überzeugt gewesen, dass der Baron sie seit zwanzig Jahren hinterging. Aber ganz klar hatte sie gar nicht sehen wollen. Heimlich hatte sie oft geweint, aber nie war ihr ein Wort des Vorwurfs entschlüpft. Als Dank für diese engelhafte Zartheit hatte sie die Ehrfurcht ihres Mannes geerntet. Er behandelte sie wie ein höheres Wesen. Die Zuneigung, die eine Frau für ihren Mann äußert, die Achtung, mit der sie ihn ehrt, wirkt vorbildlich auf die ganze Familie. Hortense hielt ihren Vater für das Muster eines liebevollen Ehemannes, und der junge Baron Hulot, von Kindheit an ein Bewunderer seines Vaters, in dem er einen der Paladine des großen Kaisers sah, war überzeugt, dass er seine eigene Stellung dem Namen, dem Range und dem Ansehen des Vaters zu verdanken hatte. Überdies pflegen Jugendeindrücke lange nachzuwirken. Er hatte die Ehrfurcht vor seinem Vater noch nicht verloren, und selbst wenn er die von Crevel enthüllten Seitensprünge geahnt hätte, würde er sie ehrerbietig übersehen und vom herkömmlichen Standpunkte der Männer in derlei Dingen entschuldigt haben.
Die außergewöhnliche Anhänglichkeit der Baronin, dieser vornehmen schönen Frau, erklärt sich von selbst aus ihrer Lebensgeschichte.
Im äußersten Lothringen, zu Füßen der Vogesen, waren zur Zeit der Aushebungen der jungen französischen Republik (1792) drei Brüder namens Fischer, alle drei einfache Landleute, zur sogenannten Rhein-Armee ausgehoben worden. Im Jahre 1799 vertraute der zweitälteste, Andreas, der verwitwete Vater der nachmaligen Baronin Hulot, sein Kind der Fürsorge seines ältesten Bruders Peter an, der im Jahre 1797 infolge einer Verwundung invalid geworden war. Andreas zeichnete sich bei einem besonders wichtigen Nachschubunternehmen aus und erwarb sich die Gunst des Armee-Intendanten Hulot von Ervy. Wie das ganz natürlich ist, lernte dieser bei einem Aufenthalt in Straßburg die Familie Fischer kennen. Adelines Vater und sein jüngster Bruder waren zu der Zeit Inspektoren am Verpflegungsamt im Elsass.
Adeline war damals sechzehn Jahre alt. Man konnte sie mit der berühmten Madame Dubarry vergleichen, die ja auch Lothringerin war. Sie war wirklich eine blendende Schönheit vom Schlage der Frau Tallien, ein Sonntagskind der Schöpfung. Vornehmes Wesen, edler Sinn, Anmut, Verstand, Eleganz, alles das war ihr in der geheimnisvollen Werkstatt der Natur in einem wundervollen Körper zuteil geworden. Gewisse Frauen gleichen sich wie Schwestern. Man denke an Bianca Capella, deren Bildnis eins der Meisterwerke Bronzinos ist, oder an die Venus des Jean Goujon, deren Urbild die berühmte Diana von Poitiers war, an Signora Olympia, deren Porträt in der Galerie Doria hängt, oder an Ninon de Lenclos, Madame Dubarry, Madame Tallien, Mademoiselle Georges, Madame Récamier, kurz an alle die Frauen, die trotz ihrer Jahre, ihrer Leidenschaften und ihrer Abenteuer schön geblieben sind. Sie haben in ihrer Gestalt, ihrem Bau, dem Typus ihrer Schönheit überraschende Ähnlichkeiten. Man möchte glauben, es flösse im Ozean der Generationen ein venusinischer Strom, aus dem die Aphroditen der Weltgeschichte geboren werden, Töchter ein und derselben Salzflut. Adeline Fischer war eine der Zierden dieses Göttergeschlechts.
Der Armee-Intendant verliebte sich auf der Stelle in diese blonde Eva und machte sie, sobald sie so alt war, wie es das Gesetz vorschreibt, zu seiner Frau, zur größten Überraschung der Familie Fischer, die in ihren Vorgesetzten höhere Wesen zu sehen gewohnt war. Der älteste Fischer, Peter, der beim Sturm auf die Stellung bei Weißenburg schwer verwundet worden war, vergötterte den Kaiser und alles, was mit der Großen Armee zusammenhing. Andreas und Hans sprachen nur voller Ehrfurcht vom Armee-Intendanten Hulot, dem Günstling Napoleons. Überdies war er der Schöpfer ihres Glücks; denn Hulot, der ihre Klugheit und Rechtschaffenheit erkannte, hatte sie in die Verwaltung gebracht. Während des Feldzugs von 1804 hatten sie, wie bereits gesagt, gute Dienste geleistet. In der folgenden Friedenszeit hatte ihnen Hulot jenen Posten im Elsass verschafft, ohne zu ahnen, dass er später selber nach Straßburg befehligt werden würde, um dort den Feldzug von 1806 vorzubereiten.
Der jungen Landtochter kam ihre Heirat wie ein Einzug ins Paradies vor. Ohne Übergänge wurde sie aus der Enge ihrer bäuerlichen Heimat in den Glanz des Kaiserhofes versetzt. Gerade um die Zeit wurde der Intendant, einer der tüchtigsten und eifrigsten Arbeiter in seinem Fache, zum Baron erhoben und durch Zuteilung zur Kaiserlichen Garde in die unmittelbare Nähe des Kaisers gezogen. Die junge Dorfschöne, die in ihren Gatten toll verliebt war, unterwarf sich aus Liebe zu ihm mutig einer neuen Erziehung.
Hektor von Hulot war übrigens als Mann das wahre Seitenstück zu der Frau, die Adeline war. Er war wirklich ein schöner Mann. Groß und wohlgebaut, die dunklen Augen voller Leben und unwiderstehlichem Feuer, eine elegante Erscheinung, ragte er selbst unter den Dandys der Umgebung des Kaisers hervor. Obwohl wie alle rechten Männer ein Eroberer und den Frauen gegenüber ganz ein Kind seiner Zeit, ward sein galantes Leben durch seine junge Ehe auf recht lange Zeit unterbrochen.
Für Adeline war der Baron somit von Anfang an gewissermaßen ein höheres unfehlbares Wesen. Sie verdankte ihm alles: Vermögen, einen vornehmen Haushalt, ein Palais, den ganzen Luxus jener Tage. Dabei hatte sie das Glück, allgemein beliebt zu sein. Sie war Baronin; sie war berühmt: man nannte sie »die schöne Madame Hulot«. Selbst der Kaiser huldigte ihr und verehrte ihr ein Diadem mit Brillanten. Er zeichnete sie allenthalben aus, und von Zeit zu Zeit stellte er die Frage: »Was macht die schöne Frau Hulot? Immer noch unnahbar?« Er war der Mann danach, jeden seine Rache fühlen zu lassen, der dort triumphiert hätte, wo er selbst nichts erreicht hatte.
Nach alledem ist es sehr leicht verständlich, dass sich die Liebe dieser Frau bei ihrer schlichten und geraden Natur bis zur Überschwänglichkeit steigern musste. Überzeugt, dass ihr Mann ihr gegenüber niemals im Unrecht sein könne, ward sie in ihrer Häuslichkeit die demütige, blind ergebene Dienerin ihres Herrn und Meisters. Ihre tüchtige Erziehung stützte ihr reichlicher gesunder Menschenverstand, der Mutterwitz des Kindes aus dem Volke. In großer Gesellschaft pflegte sie wenig zu sprechen; sie klatschte nicht, und nie suchte sie zu glänzen. Aber über alles machte sie sich ihre Gedanken. Sie verstand zu hören und zu beobachten, und so übernahm sie die Kultur der vornehmsten und ehrbarsten Damen.
Im Jahre 1815 ahmte Hulot in seinem politischen Verhalten das Beispiel des Fürsten von Weißenburg nach, eines seiner vertrautesten Freunde. So wurde er einer der Schöpfer jener aus der Erde gestampften Armee, deren Niederlage bei Waterloo der Ära Napoleons ein Ende setzte. 1816 war er ein gefürchteter Gegner des Ministeriums Feltre. Erst im Jahre 1823, als man ihn im Spanischen Krieg brauchte, ließ er sich von neuem im Kriegsministerium anstellen. Im Jahre 1830, als Louis-Philippe unter den Bonapartisten Umschau hielt, gelangte er abermals zu einem der höchsten Posten der Heeresverwaltung. Als dann die jüngere Linie des Hauses Bourbon auf den Thron kam, ward er die erste Stütze des Kriegsministers. Den Marschallstab konnte er nicht erringen, aber noch Minister oder Pair werden.
In seiner berufslosen Zeit, in den Jahren 1818 bis 1823, begann sich Hektor von Hulot von neuem eifrig dem Minnedienste zu widmen. Adeline nahm die erste Untreue ihres Mannes wie zum großen Finale der Kaiserzeit gehörig hin. Zwölf Jahre lang war sie Alleinherrscherin gewesen. Fortan erfreute sie sich jener gewohnheitsmäßigen Zuneigung, die Ehemänner für ihre Frauen hegen, wenn sie sich mit der Rolle der gütigen, ehrsamen Kameradin begnügen. Sie wusste, dass sie nur ein einziges Wort zu sagen brauchte, und keine ihrer Rivalinnen hätte sich auch nur noch zwei Stunden halten können; aber sie schloss Augen und Ohren. Sie wollte die Lebensweise ihres Mannes außerhalb des Hauses nicht kennen. Schließlich behandelte sie ihn wie eine Mutter ihr Lieblingssöhnchen. Drei Jahre vor der eben stattgehabten Unterredung hatte Hortense einmal im Varieté den Vater in der Gesellschaft von Jenny Cadine in einer der Orchesterlogen zu erkennen vermeint.
»Da sitzt Papa!« hatte sie gerufen. »Du irrst dich, Herzchen!« hatte die Mutter abgewehrt. »Papa ist beim Onkel Marschall.«
Gleichwohl war Jenny Cadine von der Baronin erkannt worden; aber anstatt dass Adeline angesichts dieser schönen Dirne einen Stich durchs Herz empfunden hätte, sagte sie sich: Was hat Hektor, dieser Schlingel, für ein Glück! Und doch litt sie. Heimlich unterlag sie den grässlichsten Wutanfällen; aber sobald sie ihren Hektor wiedersah, traten ihr immer zugleich die zwölf Jahre ihres ungetrübten Glückes vor Augen, und sie fand nicht die Kraft, sich auch nur ein einziges Mal zu beklagen. Am liebsten hätte sie es gehabt, wenn ihr Mann sie zur Vertrauten gemacht hätte; aber sie besaß aus Achtung vor ihm nicht den Mut, ihm je zu verstehen zu geben, dass sie seine Abenteuer kannte. Diese übermäßige Rücksicht findet sich nur bei Frauen aus dem Volke, die Schläge hinnehmen, ohne sie zu erwidern. Es steckt noch ein Rest von Leibeigenschaft in ihrem Blute. Hochgeborene Frauen hingegen, die sich ihrem Manne gleichgestellt fühlen, sind instinktive Tyranninnen, und wo sie etwas nachsehen, markieren sie das doch, wie man beim Billardspiel die Pointe markiert. Etwas Teuflisches zwingt sie dazu, sich eine gewisse Überlegenheit, das Recht auf Rache, zu wahren.
Einen leidenschaftlichen Verehrer hatte die Baronin in ihrem Schwager, dem Generalleutnant Grafen Hulot, dem berühmten Kommandeur der Kaiserlichen Gardegrenadiere zu Fuß, der in seinen alten Tagen Marschall geworden war. Nachdem er von 1830 bis 1834 Divisionär der bretonischen Regimenter – also auf dem Schauplatze seiner Heldentaten von 1799 bis 1800 – gewesen, hatte er sich in Paris zur Ruhe gesetzt und führte nur noch ein leichtes Amt im Landesverteidigungsrat. Sein altes Soldatenherz schlug mit dem seiner Schwägerin, die er als Ausbund ihres Geschlechts bewunderte. Er war unverheiratet geblieben, weil er eine zweite Adeline hatte finden wollen, aber während seiner Fahrten und Feldzüge in aller Herren Länder vergebens danach gesucht hatte. Napoleon hatte von ihm gesagt: »Der tapfere Hulot ist durch und durch Republikaner, aber verraten wird er mich niemals!« Um der Achtung dieses Ritters ohne Furcht und ohne Tadel nicht verlustig zu gehen, hätte Adeline noch viel grausamere Leiden ertragen als die, die soeben auf sie eingestürmt waren. Aber der Zweiundsiebzigjährige, der in dreißig Feldzügen ergraut und bei Waterloo zum siebenundzwanzigsten Male verwundet worden war, war ihr ein Abgott, jedoch kein Beschützer. Neben anderen Gebrechen musste er sich übrigens eines Hörrohres bedienen.
Solange der Baron Hulot von Ervy ein schöner Mann war, kosteten ihn seine Liebschaften nichts; aber mit fünfzig Jahren verlassen einen die Grazien, und bei alternden Männern wird Lieben ein Laster. Sie werden dabei sinnlos eitel. Auch Adeline beobachtete an ihrem Manne, dass er in seiner Toilette unglaublich umständlich wurde. Er färbte sich Haare und Bart, trug Gürtel und Korsett; kurzum, er wollte um jeden Preis »der schöne Mann« bleiben. Diese Pflege seines Äußern, die er ehedem an andern verhöhnt hätte, trieb er, bis ins Kleinlichste. Dazu machte die Baronin die Wahrnehmung, dass der Geldstrom, der seinen Kurtisanen zufloss, seine Quelle schließlich gar bei ihr suchte. Seit acht Jahren war ein beträchtliches Vermögen verschwendet worden, und zwar so gründlich, dass ihr der Baron vor nunmehr zwei Jahren gelegentlich der Niederlassung seines Sohnes als Rechtsanwalt notgedrungen das Geständnis gemacht hatte, seine Mittel beständen nur noch aus seinem Gehalt.
»Wohin soll das führen?« hatte Adeline gefragt. »Mache dir keine Sorgen«, war seine Antwort gewesen. »Ich lasse euch die Einkünfte meiner hohen Stellung. Hortenses Ausstattung und unsere Zukunft werde ich durch Spekulationen sichern.«
Der feste Glaube dieser Frau an die Macht und die starke Kraft, an die Fähigkeiten und den Charakter ihres Gatten hatte ihre flüchtige Unruhe wieder verscheucht. Seit zwei Jahren sah sich die arme Frau vor einem tiefen Abgrunde, doch glaubte sie, nur sie allein sähe ihn. Sie wusste nicht, wie die Heirat ihres Sohnes zustande gekommen war; sie ahnte nichts von dem Verhältnisse Hektors mit der habsüchtigen Josepha. Kurzum, sie hoffte, dass kein Mensch auf Erden ihr Leid kenne. Wenn nun Crevel allerorts so rücksichtslos vom Leichtsinn ihres Mannes redete, so musste Hektor ja sein öffentliches Ansehen verlieren. Aus den hässlichen Reden dieses aufgebrachten ehemaligen Parfümerienhändlers trat ihr die abscheuliche Kumpanei entgegen, der die Heirat des jungen Advokaten zu verdanken war. Zwei Dirnen waren die Schutzgöttinnen dieser Ehe gewesen, die bei irgendeinem Bacchanal zwischen würdelosen Intimitäten von zwei angetrunkenen alten Lebemännern abgekartet worden war!
Er kümmert sich somit auch nicht um Hortense, sagte sie sich, obwohl er sie alle Tage sieht. Er wird ihr eines Tages einen Gatten im Kreise seiner liederlichen Frauenzimmer suchen!
Das sagte sie lediglich als Mutter, und die regte sich jetzt stärker in ihr als die Gattin; denn sie hörte grade das Lachen von Hortense und Tante Lisbeth, das närrische Lachen der sorglosen Jugend. Es kam ihr vor, als sei dieses nervöse Lachen ein ebenso bedenkliches Anzeichen wie das verträumte einsame Wandeln durch den Garten mit Tränen in den Augen.
Hortense glich ihrer Mutter, nur hatte sie goldnes, natürlich gelocktes und erstaunlich volles Haar. Etwas wie Perlmutterglanz leuchtete darauf. Auf den ersten Blick erkannte man in ihr das Kind einer ehrsamen Ehe und einer durch und durch edlen und reinen Liebe. Im Gesicht des jungen Mädchens lagen Temperament und Frohsinn. Ihre jugendliche Lebhaftigkeit, ihre volle Frische und die strotzende Gesundheit wirkten wie von ihr ausgehende elektrische Ströme. Hortense zog aller Blicke an. Wenn ihre unschuldigen Augen, blau wie das Meer, im Vorübergleiten auf jemandem haftenblieben, so erzitterte der Betreffende unwillkürlich. Ihren reinen Teint entstellten keine Sommersprossen, mit denen die Goldblondinen doch sonst meist ihre helle weiße Gesichtsfarbe bezahlen müssen. Sie verdiente die Bezeichnung »Göttin«, mit der altmodische Dichter so verschwenderisch umgehen. Denn sie war groß und üppig, ohne stark zu sein, und von demselben rassigen Wuchs wie ihre Mutter. So konnte sich denn auf der Straße keiner, der ihr begegnete, des Ausrufes enthalten: »Gott, was für ein Prachtmädel!« Dabei war sie so unverdorben, dass sie, zu Hause angekommen, sagte: »Mutter, was haben sie nur alle, wenn du mit mir gehst, zu schreien: ›Das Prachtmädel!‹ Bist du denn nicht viel schöner als ich?«
Und in der Tat konnte die Baronin, obwohl sie das siebenundvierzigste Jahr hinter sich hatte, von Verehrern der untergehenden Sonne sehr wohl ihrer Tochter vorgezogen werden, denn sie hatte, wie man sagt, noch nichts von ihren Reizen eingebüßt. Eine wunderbare Ausnahme, zumal in Paris, wo die Ninon de Lenclos Aufsehen erregt hat, die dem 17. Jahrhundert seinen Ruf rauben wollte, an hässlichen Frauen reich zu sein.
Die Gedanken der Baronin sprangen von ihrer Tochter auf den Vater zurück. Sie sah im Geiste, wie er von Tag zu Tag, von Stufe zu Stufe bis in den Schmutz der Gesellschaft hinabsank, um vielleicht eines Tages seines Amtes im Kriegsministerium enthoben zu werden. Der armen Frau war der Gedanke an den Sturz ihres vergötterten Mannes und die unklare Vorahnung des Unglücks, das Crevel prophezeit hatte, eine solche Qual, dass sie wie eine Seherin ohnmächtig wurde.
Tante Lisbeth plauderte mit Hortense, wobei sie von Zeit zu Zeit nachsehen ging, ob sie wieder in den Salon zurückkommen könnten. In dem Augenblick jedoch, als die Baronin die Tür, die zugleich Fenster war, wieder öffnete, ward Lisbeth von ihrer jungen Verwandten so mit Fragen bestürmt, dass sie dies nicht wahrnahm.
Lisbeth Fischer, die Tochter des Ältesten der Gebrüder Fischer, war fünf Jahre jünger als Frau von Hulot. Nicht annähernd so hübsch wie ihre Kusine, war sie denn auch außerordentlich eifersüchtig auf Adeline. Der Neid bildete das Grundelement dieses höchst exzentrischen Charakters. Ein Vogeser Bauernkind im wahrsten Sinne des Wortes, mager, braun, mit glänzend schwarzem Haar, dichten buschigen Augenbrauen, langen knochigen Armen, plumpen Füßen und einigen Warzen im länglichen Affengesicht, das ist die Porträtskizze dieser alten Jungfer.
In der gemeinsam lebenden großen Familie wurde das hübsche Mädchen dem hässlichen vorgezogen, so wie man die farbenprächtige Blüte der herben Frucht vorzieht. Lisbeth musste auf dem Felde arbeiten, während ihre Kusine verhätschelt wurde. So geschah es eines Tages, dass sie, allein mit Adeline, ihr die Nase abbeißen wollte, eine echt griechische Nase, das Entzücken der alten Frauen. Trotz Schläge zerriss und beschmutzte Lisbeth die Kleider und die Halskrausen dieses Lieblings der andern.
Angesichts der märchenhaften Heirat ihrer Kusine beugte sich Lisbeth vor dieser Schickung, wie die Brüder und Schwestern Napoleons sich vor seinem Purpurglanz und seiner Herrschermacht gebeugt hatten. Denn in Paris erinnerte sich Adeline, die außerordentlich gutherzig und sanft war, an Lisbeth und ließ sie im Jahre 1809 zu sich kommen. Sie wollte sie dem Elend entreißen und gut unterbringen. Als man aber die Unmöglichkeit einsah, dieses Mädchen mit den dunklen Augen und den kohlschwarzen Brauen, das obendrein weder schreiben noch lesen konnte, ohne weiteres unter die Haube zu bekommen, was Adeline am liebsten getan hätte, verschaffte ihr der Baron fürs erste eine Stellung als Lehrmädchen in der Kaiserlichen Hofstickerei, bei der berühmten Firma Gebrüder Pons.
So wurde die Kusine, die man »Tante Lisbeth« zu nennen pflegte, Gold- und Silberstickerin. Energisch wie alle Bergbewohner, hatte sie den Mut, noch lesen, rechnen und schreiben zu lernen. Ihr Vetter, der Baron, hatte ihr klargemacht, dass diese Kenntnisse notwendig seien, um später ein Stickereigeschäft selbständig leiten zu können.
Lisbeth wollte auf jeden Fall reich werden, und so wandelte sie sich in zwei Jahren durch und durch. Um 1811 war aus dem Landmädchen bereits eine ganz nette und recht geschickte und kluge Vorstickerin geworden.
In dieser Industrie, der Gold- und Silberstickerei, wurden die Epauletten, Portepees, Achselschnuren und all die Unmenge von glänzenden Dingen verfertigt, die auf den prunkenden Uniformen der französischen Armee und Beamtenschaft blinkten. Als Italiener war der Kaiser ein großer Freund prächtiger Tracht. Er hatte sämtliche Nähte an den Röcken seiner Staatsdiener mit Gold und Silber bespickt – und sein Reich zählte 133 Departements! Diese Zutaten wurden gewöhnlich an die reichen und soliden Schneiderfirmen geliefert oder auch unmittelbar an die Würdenträger. Diese Fabrikation war ein sicheres Geschäft.
In dem Augenblick, als Tante Lisbeth, die geschickteste Arbeiterin im Hause Pons, die Leiterin der Manufaktur, sich hätte selbständig machen können, kam es zum Sturze des Kaiserreichs. Die Friedenspalme in der Bourbonen Hand schreckte Lisbeth ab; sie fürchtete einen Niedergang in ihrem Handelszweig, da nur noch 86 Departements an Stelle von 133 mit Goldstickereien zu versehen waren, abgesehen von der bedeutenden Verminderung des Heeres. Kurz und gut, das wechselnde Glück in der Industrie verblüffte sie derartig, dass sie das Angebot des Barons zurückwies. Er hielt sie daraufhin für verrückt und ward darin bestärkt, denn sie überwarf sich mit Rivet, dem Erwerber der Firma Pons, mit dem der Baron sie hatte assoziieren wollen. So wurde sie wieder einfache Arbeiterin, und die Familie Fischer sank in die unsichere Lage zurück, der sie dereinst durch den Baron Hulot enthoben worden war.
Durch die Katastrophe von Fontainebleau zugrunde gerichtet, traten die drei Brüder aus lauter Verzweiflung in die Freischaren von 1815 ein. Der älteste, Lisbeths Vater, fiel. Adelines Vater, von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt, flüchtete nach Deutschland und starb im Jahre 1820 in Trier. Der jüngste, Hans, kam nach Paris und warf sich der »Königin der Familie« zu Füßen, die angeblich in Gold und Silber schwamm und auf den Bällen die ihr vom Kaiser geschenkten Brillanten trug, die so groß waren wie Haselnüsse. Damals dreiundvierzig Jahre alt, bekam Hans Fischer vom Baron Hulot zehntausend Francs ausgezahlt, um in Versailles einen kleinen Getreidehandel anzufangen, der vom Kriegsministerium durch den heimlichen Einfluss von Freunden, die der ehemalige Generalintendant dort immer noch hatte, unterstützt wurde.
Die Schicksalsschläge in ihrer Familie und die Gewissheit, in jenem großen Wirrwarr von Menschen, Interessen und Geschäften, das Paris ebenso zu einer Hölle wie zu einem Paradiese gestaltet, nur eine Null zu sein, machten Lisbeth zahm. Die unverheiratet Gebliebene verlor alle Lust, um Gleichberechtigung mit ihrer Kusine zu kämpfen, hatte sie doch deren Überlegenheit in verschiedentlichster Hinsicht gespürt. Aber im Grunde ihres Herzens lauerte auch weiterhin der Neid gleichwie ein Pestbazillus, der jeden Augenblick wirken und eine ganze Stadt verwüsten kann, wenn man den verhängnisvollen Wollballen öffnet, in dem er nistet. Von Zeit zu Zeit sagte sie sich: Adeline und ich, wir sind Blutsverwandte; unsere Väter waren Brüder. Sie wohnt in einem Palast und ich in einem Dachstübchen!
Alljährlich erhielt Tante Lisbeth zu ihrem Namenstage und zum Neujahrsfest von der Baronin und dem Baron Geschenke. Der Baron bezahlte ihr auch gnädigst das Brennholz für den Winter. Der alte General Hulot empfing sie regelmäßig einmal in der Woche zu Tisch, und im Hause ihrer Kusine lag stets für sie ein Gedeck bereit. Man machte sich oftmals über sie lustig, niemals aber schämte man sich ihrer. So lebte sie schließlich in Paris leidlich selbständig und nach ihrer Weise.
Lisbeth fürchtete jedwedes Joch. Wenn die Kusine ihr anbot, bei ihr im Hause zu wohnen, fühlte sie sich sofort geknechtet. Verschiedene Male wäre dem Baron die schwierige Aufgabe, sie zu verheiraten, doch noch geglückt. Zunächst ließ sie sich jedesmal bestechen; doch bald schlug sie die Bewerbung aus, weil sie vor dem Gedanken zurückschauderte, man könne ihr alsbald ihre mangelhafte Erziehung, ihre Unwissenheit und ihre Vermögenslosigkeit vorwerfen. Selbst den Vorschlag der Baronin, bei ihrem Onkel zu leben und ihm an Stelle einer sehr kostspieligen Hausdame die Wirtschaft zu führen, lehnte sie ab. Sie begründete das damit, dass sie sich dann gleich gar nicht verheiraten werde.
In ihren Ideen zeigte Tante Lisbeth gewisse Sonderlichkeiten, die man bei allen spät entwickelten Naturen beobachtet, auch bei einsamen Menschen, die viel denken und wenig sprechen. Ihr Bauernverstand hatte übrigens durch die Unterhaltungen in den Werkstätten und durch den Umgang mit den Handarbeitern und Arbeiterinnen pariserische Schärfe bekommen. Ihr Charakter hatte ungemein viel Korsisches an sich; ihr starker Betätigungsdrang sehnte sich nach Befriedigung. Und so hätte sie sich am liebsten zur Beschützerin eines schwächlichen Mannes gemacht. Gebunden an die Großstadt, unterlag ihr äußeres Leben ihren Einflüssen. Ihre mürbe gewordene Seele nahm den matten Pariser Glanz an. Stark empfindlich wie alle wirklich Ehelosen wäre sie wegen ihrer Verbissenheit in jeder andern Stellung zu fürchten gewesen; böse, wie sie war, hätte sie den festesten Familienkreis zerstört.
Während der ersten Zeit, als sie noch gewisse Aussichten hatte, in die sie jedoch niemanden einweihte, hatte sie sich dazu verstanden, modische Kleider und Korsetts zu tragen. Damals erlebte sie eine kurze Zeit des Glanzes, während der man ihre Verheiratung für möglich hielt. Lisbeth war da die pikante Brünette aus dem alten französischen Roman. Ihre lebhaften Augen, ihr olivenfarbener Teint, ihr straffer Körper hätten wohl einen älteren Beamten oder Pensionär reizen können; aber sie begnügte sich damit, wie sie lächelnd zu sagen pflegte, sich selber zu bewundern. Im Grunde war sie mit ihrem Leben auch ganz leidlich zufrieden. Wirtschaftliche Sorgen hatte sie keine mehr, und wenn sie auch mit Tagesanbruch zu arbeiten anfing, so ging sie doch regelmäßig zur Hauptmahlzeit in die Stadt. Sie hatte nur für das Frühstück und ihre Miete zu sorgen. Im übrigen versah man sie sowohl mit Kleidern als auch mit allen möglichen Vorräten wie Zucker, Kaffee, Wein und dergleichen.
Im Jahre 1837, nachdem sie siebenunundzwanzig Jahre zur Hälfte von der Gnade der Familie Hulot und ihres Onkels Fischer gelebt hatte, verzichtete Tante Lisbeth darauf, irgend etwas vorzustellen. Sie ließ sich nunmehr sehr leicht behandeln. Zu den großen Gesellschaften kam sie von selber nicht; sie zog die trauliche Geselligkeit vor, die ihr gestattete, zur Geltung zu kommen, und ihr Kränkungen der Eigenliebe ersparte. Überall gehörte sie zum Hause: beim General Hulot, bei Crevel, bei den jungen Hulots, bei Rivet, Pons' Nachfolger, mit dem sie sich wieder versöhnt hatte und von dem sie verwöhnt wurde, sowie bei der Baronin. Auch wusste sie sich überall bei den Dienstboten beliebt zu machen, indem sie ihnen von Zeit zu Zeit ein kleines Trinkgeld in die Hand drückte und immer ein Weilchen mit ihnen plauderte, ehe sie in die Zimmer trat. Diese Vertraulichkeit, durch die sie sich mit diesen Leuten auf eine Stufe stellte, verschaffte ihr deren Gewogenheit und Dienstbarkeit, etwas sehr Wichtiges für Schmarotzer, und das war sie doch nun einmal. »Sie ist eine alte gute Haut!« hieß es ganz allgemein. Ihre, besonders da, wo man sie gar nicht beanspruchte, oft grenzenlose Gefälligkeit war ebenso wie ihre scheinbare Gutmütigkeit eine natürliche Folge ihrer abhängigen Stellung. Kurzum, sie fand sich mit dem Leben ab, da sie sah, dass sie doch von aller Welt abhing. Sie hielt es mit allen. Mit den jungen Leuten war sie vergnügt; man fand sie nett und fiel allgemein auf ihre schmeichlerische Art hinein. Sie erriet und förderte alle Wünsche; sie machte sich zur Vermittlerin und spielte überall die gute Helferin. Ein Recht, selber etwas zu wollen, hatte sie ja nicht. Ihre unbedingte Verschwiegenheit schaffte ihr auch das Vertrauen von Menschen reiferen Alters; sie besaß nämlich gewisse männliche Eigenschaften. Meistenteils richten sich die Vertraulichkeiten des Menschen eher nach unten als nach oben. In geheimen Angelegenheiten werden Tieferstehende viel öfter zu Vertrauten erwählt als Höherstehende; sie werden zu Mitwissern unserer geheimsten Gedanken und zu Ratgebern bei unsern wichtigsten Überlegungen. Die arme alte Jungfer galt für so abhängig von aller Welt, dass sie wie zu ewiger Stummheit verdammt schien. Sie nannte sich selbst den »Beichtstuhl der Familie«. Nur die Baronin blieb misstrauisch. Sie konnte gewisse Schlechtigkeiten nicht vergessen, die ihr die Kusine in der gemeinsamen Kinderzeit angetan hatte. Auch aus Schamhaftigkeit mochte Adeline ihren häuslichen Kummer nur Gott allein anvertrauen.
Für Tante Lisbeth hatte das Haus der Baronin seinen alten Glanz bewahrt. Sie stutzte nicht, wie der emporgekommene Crevel, vor dem Elend, das auf den abgenutzten Stuhlpolstern, auf den altersschwachen Vorhängen und der zerschlissenen Seide deutlich geschrieben stand. Es geht einem mit den Möbeln, mit denen man lebt, gerade wie mit einem selbst. Man macht es schließlich wie der Baron. Man schaut sich täglich an und hält sich für ewig jung und unverändert, während die andern längst bemerken, wie sich auf unserem Haupte das Haar chinchillaartig verfärbt, wie sich auf unserer Stirn die Krähenfüße mehren und unser Schmerbauch dick wird wie ein Kürbis. Die Hulotsche Einrichtung leuchtete für Lisbeth für immerdar im bengalischen Feuer der kaiserlichen Glorie.
Mit der Zeit hatte Tante Lisbeth mancherlei recht altjüngferliche Gewohnheiten angenommen. So wollte sie sich der Mode nicht unterwerfen, sondern meinte, die Mode müsse sich nach ihren Angewohnheiten und ihrem veralteten Geschmack richten. Wenn ihr die Baronin einen hübschen neuen Hut oder ein Kleid neueren Schnitts schenkte, so hatte sie nichts Eiligeres zu tun; als alles nach ihrer Art bei sich zu Hause umzuarbeiten; so verdarb sie jedes Kleid, indem sie daraus ein Kostüm aus der Kaiserzeit oder ein Stück altlothringischer Landestracht modelte. Hüte, die dreißig Franken gekostet hatten, wurden unter ihrer Hand zu Ungetümen. In dieser Beziehung war Lisbeth geradezu bockbeinig. Nur sich selbst gefallen wollte sie, und sie fand sich wirklich reizend. Diese Manie, alles ihrer Altjüngferlichkeit anzupassen, so einheitlich es auch durchgeführt sein mochte, machte sie so lächerlich, dass man es beim besten Willen nicht fertigbrachte, sie zu größeren Festlichkeiten einzuladen.
Der Widerspruchsgeist, das launenhafte eigenbrötlerische Wesen und die wunderliche Wildheit dieses Mädchens, das dank der Vorsorge des Barons viermal eine gute Partie hätte machen können – es traten nacheinander einer seiner Verwaltungsbeamten, ein Major, ein Geschäftsunternehmer und ein Hauptmann a. D. als Bewerber auf –, und das auch einem Posamentenhändler einen Korb gegeben hatte, der dann sehr reich wurde, gaben die Veranlassung zu dem Spitznamen »Wildkatze«, den ihr der Baron im Scherz anhängte. Dieser Spitzname sollte sich zwar nur auf Lisbeths äußerliche Eigenheiten beziehen, aber dieses Mädchen war und blieb für den schärferen Beobachter doch die Verkörperung der bäuerischen Wildheit. Wie sie als Kind der Kusine die Nase hatte abbeißen wollen, so hätte die Gealterte in Anfällen von Eifersucht sie am liebsten gemordet. Nur durch ihre Welt- und Gesetzeskenntnis zähmte Lisbeth die natürliche Wildheit, mit der Bauern wie Wilde rasch vom Gefühl zur Tat übergehen.
Vielleicht besteht allein hierin der Unterschied zwischen dem Natur- und dem Kulturmenschen. Der Barbar hegt nur Gefühle, der zivilisierte Mensch Gefühle und Gedanken. Darum empfängt das Gehirn des Wilden sozusagen nur schwache Eindrücke von außen; er unterliegt völlig den Gefühlen, die in ihm herrschen, während das Herz des zivilisierten Menschen von der Überlegung beeinflusst und verändert wird. Hier wirken tausend Interessen und vielerlei Empfindungen in einer Menschennatur vereint; im Wilden dagegen gedeiht nur ein einziger Gedanke auf einmal. Tante Lisbeth, im Grunde hinterlistig und eine echte wilde Lothringerin, gehörte zu diesem Schlage von Charakteren, die man unter dem Volke häufiger findet, als man denkt, und die uns das Verhalten der Massen in Revolutionszeiten verständlich machen können.
Zu der Zeit, wo unsere Geschichte beginnt, wäre Tante Lisbeth salonfähig und annehmbar gewesen, wenn sie sich modischer hätte kleiden lassen und sich wie die Pariserinnen daran gewöhnt hätte, nur immer das Allerneueste zu tragen. Graziös war sie allerdings nie und nimmermehr. Und in Paris ist eine Frau ohne Grazie überhaupt keine Frau. Ihr schwarzes Haar, ihre schönen ernsten Augen, die scharfen Gesichtszüge, ihre matte dunkle südländische Hautfarbe, die sie mit den Frauengestalten auf den Bildern Giottos gemein hatte und die sich eine wahre Pariserin gar wohl zunutze gemacht hätte, und vor allen Dingen ihr sonderbarer Anputz verliehen ihr ein so wunderliches Aussehen, dass sie manchmal an jene Äffchen in Frauenkleidern erinnerte, die die kleinen Savoyarden mit sich führen. Da man sie jedoch in allen dem Hause befreundeten und verwandten Familien gut kannte, und da sie ihren gesellschaftlichen Verkehr auf diesen Kreis beschränkte und am allerliebsten bei sich zu Hause blieb, so störten ihre Eigentümlichkeiten niemanden mehr. Außer dem Hause verschwand sie im Riesentrubel des Pariser Straßenlebens, wo man nur die hübschen Frauen anblickt.
Hortenses Lachen in jenem Augenblicke hatte seine Veranlassung in einem Triumphe, den sie eben über Tante Lisbeths Starrsinn davongetragen hatte. Sie hatte ihr ein Geständnis entlockt, das sie ihr drei Jahre lang nicht hatte entringen können.
Mag ein älteres Mädchen noch so verstockt sein, es gibt doch eine Eigenschaft, die ihr Schweigen zu brechen imstande ist: die Eitelkeit. Hortense, seit drei Jahren in gewissen Dingen außerordentlich neugierig geworden, bestürmte ihre Verwandte andauernd mit allerlei Fragen, die übrigens völliger Unschuld entsprangen. Sie wollte wissen, warum sie sich nicht verheiratet hatte. Sie kannte die Geschichte von den fünf abgewiesenen Freiern. Daraus hatte sie sich einen kleinen Roman zurechtgemacht und meinte, Tante Lisbeth müsse eine heimliche Liebe haben. Das gab ihnen fortwährend Anlass zu übermütigen Streitereien. Hortense pflegte zu sagen: »Wir jungen Mädchen!«, wenn sie von sich selbst und ihrer Tante redete, und Lisbeth hatte wiederholt in scherzendem Tone geantwortet: »Weißt du denn, ob ich nicht einen Verehrer habe?« So war der wahre oder der erdichtete Liebhaber Tante Lisbeths zum Gegenstande harmloser kleiner Neckereien geworden. Schließlich aber hatte Lisbeth nach zweijährigem Scheinkampf auf Hortenses Nachfrage: »Na, wie geht es denn deinem Schatze?« doch einmal geantwortet:
»Ach, er ist ein wenig leidend, der arme junge Mann.«
»So? Er ist wohl sehr zarter Natur?« hatte sich die Baronin lächelnd in die Unterhaltung gemengt.
»Ja, ja! Wie die Blonden nun einmal sind! Ein schwarzes Mädel wie ich kann doch nur einen blonden Mann lieben, einen mondscheinblassen!«
»Na, was ist er denn eigentlich? Was macht er?« war Hortenses Frage. »Er ist gewiss ein Fürst?«
»Ein Fürst in seinem Handwerk, so wie ich eine Königin der Nadel bin. Wie sollte ich armes Mädchen von einem reichen Manne, der ein Haus und Staatsrenten hat, oder von einem Herzog und Standesherrn geliebt werden! Oder gar von einem Prinzen Gnadenreich aus deinen Märchenbüchern?«
»Oh, ich möchte ihn zu gerne einmal sehen!« rief Hortense lachend.
»Wohl um zu wissen, wie der beschaffen sein mag, der sogar die alte Wildkatze lieben kann?« war Tante Lisbeths Antwort.
»Gewiss ist es ein alter Beamter mit einem Ziegenbart!«
»Wenn ihr euch nur nicht täuscht!«
»Also du hast einen Liebhaber?« fragte Hortense mit triumphierender Miene.
»So gewiss wie du keinen hast!« erwiderte die Tante pikiert.
»Aber, wenn du einen Liebhaber hast, Lisbeth, warum heiratest du ihn denn nicht?« fragte die Baronin. »Seit drei Jahren ist von ihm die Rede. Du hast Zeit genug gehabt, ihn gründlich kennenzulernen, und wenn er dir wirklich treu geblieben ist, so solltest du ihn nicht länger schmachten lassen. Das bist du ihm schuldig. Und schließlich, falls er jung ist, wäre es für dich Zeit, dir eine Stütze für deine alten Tage zu sichern.«
Tante Lisbeth hatte die Baronin scharf beobachtet, und als sie sie lachen sah, gab sie zur Antwort:
»Das hieße Hunger und Durst miteinander verheiraten! Er ist Handwerker, ich bin Arbeiterin. Wenn wir Kinder bekämen, müssten sie auch Handarbeiter werden... . Nein, nein, nur unsere Seelen lieben sich. Das ist nicht so kostspielig!«
»Warum versteckst du ihn vor uns?« fragte Hortense.
»Weil er keinen Rock hat!« lautete die lachende Antwort der alten Jungfer.
»Liebst du ihn?« fragte die Baronin.
»Ich denke doch. Ich liebe ihn um seiner selbst willen. Er ist mein Ideal. Jetzt sind es bereits vier Jahre her, dass ich ihn in meinem Herzen trage.«
»Schön! Wenn du ihn um seiner selbst willen liebst«, meinte die Baronin ernst, »und wenn er wirklich existiert, dann bist du sehr grausam ihm gegenüber! Du weißt nicht, was es heißt, wahrhaft lieben.«
»Das wissen wir Frauen doch von Geburt an!«
»Nein, denn es gibt Frauen, die lieben und dabei doch Egoisten bleiben. So eine bist du!«
Lisbeth senkte den Kopf über ihre Stickerei, und wenn jemand ihren Blick gesehen hätte, wäre er zweifellos erschrocken.
»Wenn du uns deinen angeblichen Liebhaber vorstellen wolltest, so könnte ihm Hektor eine Stellung verschaffen und ihm behilflich sein, sein Glück zu machen.«
»Das ist unmöglich.«
»Warum denn?«
»Weil er eine Art Flüchtling ist, ein Pole.«
»Ein Verschwörer?« rief Hortense. »Hast du ein Glück! Da hat er wohl viele Abenteuer bestanden?«
»Er hat für Polen gekämpft. Er war Lehrer an einer Hochschule, deren Schüler am Aufruhr beteiligt waren, und da er durch die Gunst des Großfürsten Konstantin dort angestellt war, darf er nicht auf Gnade hoffen.«
»Lehrer? Was lehrte er denn?«
»Zeichnen und Malen.«
»Und nach der Niederlage seiner Partei ist er nach Paris gekommen?«
»Im Jahre 1833 hat er zu Fuß Deutschland durchwandert... .«
»Der Ärmste! Und wie alt ist er?«
»Zur Zeit des Aufstandes war er kaum vierundzwanzig. Heute ist er neunundzwanzig.«
»Fünfzehn Jahre jünger als du«, warf die Baronin ein,
»Wovon lebt er?« fügte Hortense hinzu.
»Von seinem Talent.«
»Ach so, von seiner Lehrtätigkeit?«
»Nein. Jetzt werden ihm Lehren erteilt, und zwar recht harte«, erwiderte Tante Lisbeth.
»Hat er einen netten Vornamen?«
»Stanislaus!«
»Was für eine lebhafte Einbildung doch so ein altes Fräulein hat!« bemerkte die Baronin. »Wenn man dich so reden hört, könnte man dir wirklich glauben, Lisbeth.«
»Ja, siehst du, Mutter, er ist eben ein Pole und an die Knute gewöhnt. Lisbeth erinnerte ihn an diese kleine Annehmlichkeit seines Vaterlandes.«
Darüber hatten alle drei lachen müssen. Hortense sang nach der Melodie »O schöne Adelheid ...«: »Geliebter Stanislaus ...« Für einige Minuten war Waffenstillstand eingetreten.
»Ihr jungen Dinger glaubt«, begann Lisbeth wieder mit einem Blick auf das junge Mädchen, »die Männer könnten sich nur in euch verlieben.«
Als sie dann mit Tante Lisbeth allein war, sagte Hortense: »Beweise mir, dass dein Stanislaus keine bloße Erfindung von dir ist, und du bekommst meinen gelben Kaschmirschal!«
»Er ist sogar ein Graf!«
»Das sind alle Polen!«
»Eigentlich ist er Livländer... .«
»Aber wie heißt er denn?«
»Wenn ich wüsste, dass du ein Geheimnis bewahren könntest... .«
»Tante, ich will stumm sein... .«
»Wie ein Fisch?«
»Ja, wie ein Fisch!«
»Schwörst du mir das bei deinem Seelenheil?«
»Bei meinem Seelenheil!«
»Nein, lieber bei deinem Glück hienieden!«
»Ja.«
»Na, er heißt Stanislaus Graf Steinbock!«
»Ein stolzer Name!«
»Ja, einer der Generale Karls des Zwölften hieß auch so. Das war sein Großonkel. Nach dem Tode des Königs von Schweden ließ sich sein Vater in Polen nieder. Während des Feldzugs von 1812 verlor er sein Vermögen, und als er starb, hinterließ er seinen achtjährigen Sohn völlig mittellos. Wegen des Namens Steinbock nahm sich der Großfürst Konstantin seiner an und schickte ihn auf die Schule... .«
»Ich halte mein Wort!« wiederholte Hortense. »Beweise mir, dass er leibhaftig existiert, und du bekommst meinen gelben Schal. Dieses Gelb steht einer Brünetten wundervoll!«
»Und du wirst mein Geheimnis wahren?«
»Ich vertraue dir dafür meine eigenen an.«
»Gut! Wenn ich das nächstemal komme, erbringe ich dir den Beweis.«
»Aber der Beweis ist dein Verehrer in Person!« forderte Hortense.
Seit ihrer Ankunft in Paris hatte Tante Lisbeth im Banne des Kaschmirschals gestanden, und so war sie selig bei dem Gedanken, diesen gelben Schal besitzen zu sollen. Der Baron hatte ihn 1808 der Baronin geschenkt, und wie das in manchen Familien so üblich, war dieses Schmuckstück 1830 von der Mutter auf die Tochter übergegangen. Seit zehn Jahren sah es zwar etwas abgetragen aus; aber das kostbare Gewebe, das immer in einem Sandelholzkasten lag, kam der alten Jungfer, wie überhaupt der ganze Besitz der Baronin, immer noch neu vor.
Beim nächsten Besuche brachte Tante Lisbeth in ihrem Arbeitsbeutel ein Geschenk mit, das sie der Baronin zu ihrem Geburtstag überreichen wollte. Damit glaubte sie die Existenz ihres so unwahrscheinlichen Verehrers genugsam zu beweisen.
Dieses Geschenk war ein silbernes Petschaft: drei aneinandergelehnte laubumrankte Gestalten trugen den Erdball. Diese drei Gestalten stellten Glaube, Liebe und Hoffnung vor. Ihre Füße stemmten sich gegen Ungeheuer, die sich untereinander bekämpften und aus denen heraus sich die symbolische Schlange wand. Heute, im Jahre 1846, würde dieses Meisterwerk niemanden mehr in Erstaunen setzen, nachdem Fräulein von Fauveau, Wagner, Jeanest, Froment-Meurice, der Holzbildhauer Liénard und andere die Kunst des Benvenuto Cellini von neuem so mächtig vorwärtsgebracht haben. Aber damals musste ein junges Mädchen, das sich auf Kunstgegenstände verstand, in höchster Verwunderung vor diesem Petschaft stehen, als es Tante Lisbeth mit den Worten vorwies:
»Nun, wie gefällt dir das?«
Die Linienführung, die Behandlung der Gewänder und der Rhythmus der Gestalten deuteten auf die Schule Raffaels hin, aber in der Ausführung erinnerten sie an die Florentiner Bronzekünstler, an Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto Cellini, Giovanni da Bologna usw. Selbst in den Werken der französischen Renaissance finden sich fabelhaftere Ungeheuer nicht als die, die hier die Laster verkörperten. Die Palmen, Farne, Binsen und das Schilf um die Tugenden war stilistisch wie technisch bewunderswert. Um die Häupter schlang sich ein Band, auf dem man in den drei Zwischenräumen zwischen den Köpfen ein W, einen Steinbock und das Wort fecit las.
»Wer hat das geschaffen?« fragte Hortense.
»Mein Verehrer«, erwiderte Tante Lisbeth. »In dem Ding stecken sechs Monate Arbeit. Ich mit meiner Goldstickerei verdiene mehr. Er hat mir erklärt, Steinbock sei ein deutsches Wort und bedeute »Gemse« oder so was. Von nun an will er alle seine Werke so signieren. Genug! Jetzt bekomme ich deinen Schal!«
»Wieso?«
»Kann ich mir ein solches Kleinod kaufen oder machen lassen? Das ist doch ausgeschlossen. Also habe ich es geschenkt bekommen. Und wer macht einem solche Geschenke? Ein Verehrer!«
Mit einer Verstellung, die Lisbeth Fischer entsetzt haben würde, wenn sie sie erkannt hätte, hütete sich Hortense, ihre große Bewunderung merken zu lassen, obwohl ihre Seele im Innersten ergriffen war, wie das allen für Schönheit empfänglichen Menschen so geht, wenn sie unverhofft vor einem vollendeten Meisterwerke stehen.
»Gewiss«, sagte sie, »das ist recht hübsch.«
»Ja, ja, es ist hübsch«, wiederholte die alte Jungfer, »aber ein gelber Kaschmirschal ist mir lieber. Siehst du, Kindchen, damit verbringt mein Verehrer seine Zeit. Seit seiner Ankunft in Paris hat er drei oder vier solche Sächelchen verfertigt, und das ist nun die Frucht von vier Studien- und Arbeitsjahren. Er hat bei Formern, Gießern und Goldschmieden gelernt. Was weiß ich? Hunderte und Tausende sind dabei draufgegangen. Nun bildet sich das Kerlchen ein, in ein paar Monaten berühmt und reich zu werden.«
»Aber du siehst ihn doch?«
»Glaubst du denn immer noch, es sei Fabel? Ich habe dir lachend die Wahrheit gesagt!«
»Und er liebt dich?« fragte Hortense lebhaft.
»Er betet mich an!« antwortete die Tante und setzte eine ernsthafte Miene auf. »Siehst du, Kindchen, bis jetzt hat er nur blasse und fade Frauen gekannt, wie sie da oben im Norden alle sind. Ich, braun, schlank, jung, ich habe ihm das Herz entflammt. Aber schweigen! Ich habe dein Wort.«
»Dem Ärmsten wird es wohl nicht anders ergehen als den fünf andern!« neckte das junge Mädchen die Tante, indem sie das Petschaft weiter betrachtete.
»Sechs, bitte! Du vergisst den, der in Lothringen auf mich wartet, und der noch heute für mich den Mond vom Himmel holen würde.«
»Der hier tut etwas Besseres«, erwiderte Hortense, »er bringt dir die Sonne!«
»Leider kann man Sonnengold nicht prägen lassen«, meinte Tante Lisbeth. »Man braucht Erde, ehe man sich sonnen kann!«
Diese Scherzreden folgten sich Schlag auf Schlag und erregten jenes übermütige Lachen, das die Baronin so ängstigte, weil es sie zwang, die voraussichtliche Zukunft ihrer Tochter mit dem frohen Heute zu vergleichen, wo sie sich all der Fröhlichkeit ihrer Jugend noch hingeben durfte.
»Er muss dir gegenüber doch große Verpflichtungen haben, wenn er dir ein Werk schenkt, an dem er sechs Monate lang gearbeitet hat?« fragte Hortense, die das Petschaft sehr nachdenklich gestimmt hatte.
»Du willst aber auch gar zu viel auf einmal wissen«, wehrte Tante Lisbeth ab. »Pass mal auf! Ich will dich in eine Verschwörung einweihen.«
»Handelt es sich um deinen Verehrer?«
»Du möchtest ihn sehen! Aber du wirst doch billigen, dass eine alte Jungfer wie eure Tante Lisbeth, die ihren Liebsten viele Jahre lang so fein verheimlicht hat, ihn nun nicht gleich zeigt. Lass mich damit also in Frieden! Siehst du, ich habe keinen Kater, keinen Kanarienvogel, keinen Hund, auch keinen Papagei; aber etwas fürs Herz muss doch auch eine alte Wildkatze wie ich haben, und darum halte ich mir einen Polen.«
»Hat er einen Schnurrbart?«
»So lang!« machte Lisbeth, indem sie ein langes Stück Goldfaden von der Rolle abwickelte.
Sie brachte sich stets Arbeit mit und beschäftigte sich damit, bis man zu Tisch ging.
»Wenn du immer nur fragst, erfährst du gar nichts mehr!« fuhr sie fort. »Du bist erst zweiundzwanzig Jahre alt und dabei geschwätziger als ich mit meinen zweiundvierzig oder vielmehr dreiundvierzig.«
»Ich will mucksmäuschenstill zuhören!«
»Mein Verehrer hat eine zehn Zoll hohe Bronzegruppe gemacht«, begann Tante Lisbeth. »Simson, wie er einen Löwen erwürgt. Er hat sie eingegraben, damit sie Rost ansetzt. Sie soll so antik aussehen wie Simson selber. Dies Meisterwerk ist nun bei einem Raritätenhändler ausgestellt, der seinen Laden auf der Place du Carrousel hat, nahe meinem Hause. Dein Vater, der mit Popinot, dem Minister des Handels und der Landwirtschaft, und mit dem Grafen Rastignac bekannt ist, sollte die beiden gelegentlich auf die Gruppe aufmerksam machen: sie sei ein schönes antikes Werk, das er zufällig im Vorbeigehen gesehen habe. Die großen Herren von heute scheinen mehr Interesse für solche Artikel zu haben als für unsere schönen Goldstickereien. Mein Schatz könnte sein Glück machen, wenn einer dies alte Kupferding kaufen oder auch nur mal ansehen möchte. Der arme Kerl meint, man könne das Zeug für wirklich alt halten und teuer bezahlen. Wenn einer der Minister die Gruppe kaufte, würde er sich ihm dann vorstellen und ihm beweisen, dass er sie gemacht hat. Dann wird er angestaunt werden. Ja, er bildet sich wahrhaftig ein, er sei schon auf dem Gipfel seines Künstlertums. Das Kerlchen ist eingebildet wie ein neubackener Kommerzienrat.«
»Also ein neuer Michelangelo! Für einen Verliebten hat er seine sieben Gedanken noch ganz leidlich beisammen«, meinte Hortense. »Und wieviel verlangt er dafür?«
»Fünfzehnhundert Francs! Der Händler soll die Bronze nicht billiger hergeben.«
»Augenblicklich ist Papa Beauftragter von Majestät«, sagte Hortense. »Er trifft die beiden Minister täglich in der Kammer. Er muss sich der Sache annehmen. Lass mich es nur machen! Sie werden reich sein, Frau Gräfin Steinbock!«
»Nein, dazu ist mein Mann zu gemächlich. Wochenlang tut er nichts als rotes Wachs kneten – und nichts wird fertig. Was sag ich? Ganze Tage verträumt er im Louvre und in der Bibliothek, wo er alte Stiche anguckt und abzeichnet. Er ist ein Tagedieb.«
Die beiden fuhren fort zu scherzen. Hortense lachte aber nicht mehr natürlich, denn sie stand mit einem Male im Banne einer Liebe, wie sie alle jungen Mädchen einmal erleben: der Liebe zu dem Unbekannten, einer vagen Liebe, bei der sich die Gedanken um eine vom Zufall heraufbeschworene Gestalt kristallisieren wie die Blumen des Raureifs um den Halm, den der Wind zufällig an ein Fenster gedrückt hat. Seit zehn Monaten ahnte sie etwas vom Vorhandensein dieses phantastischen Liebhabers der Tante Lisbeth, an deren ewige Ehelosigkeit sie ebenso fest wie ihre Mutter glaubte, und vor acht Tagen hatte sich ihnen diese imaginäre Gestalt zu einem Grafen Stanislaus Steinbock verkörpert. Der Traum war damit zur Wirklichkeit geworden, und der nebelhafte Schatten hatte die leibhafte Gestalt eines jungen dreißigjährigen Mannes angenommen. Das Petschaft, das Hortense in der Hand hielt, wirkte zauberkräftig wie eine Verkündigung, in der sich ihr ein Genie offenbarte, wie ein Talisman. Hortense fühlte sich so glücklich, dass sie beinahe an der Wahrheit dieses wunderschönen Märchens zweifeln mochte. Ihr Blut fieberte; sie lachte wie närrisch.
»Die Tür zum Salon ist offen, wie mir scheint«, bemerkte Tante Lisbeth. »Lass uns nachsehen, ob Herr Crevel wieder fort ist!«
»Mutter ist seit zwei Tagen so traurig. Sicherlich hat sich die Partie, um die es sich handelte, zerschlagen.«
»Unsinn! Das wird sich schon wieder einrenken. Es handelt sich – soviel kann ich dir sagen – um einen Königlichen Regierungsrat. Möchtest du gern Frau Regierungsrätin werden? Wenn es von Herrn Crevel abhängt, dann erzählt er mir gewiss etwas davon. Morgen werde ich wissen, ob Aussicht ...«
»Tantchen, lass mir das Petschaft!« bat Hortense. »Ich zeig es niemandem! In vier Wochen ist Mutters Geburtstag; an dem Tage gebe ich es dir früh zurück.«
»Nein, gib es mir gleich wieder! Es fehlt das Kästchen dazu.«
»Ich möchte es nämlich gern Papa zeigen, damit er dem Minister gut unterrichtet davon erzählen kann.«
»Nun gut, aber zeige es deiner Mutter nicht! Weiter verlange ich nichts. Wenn sie wüsste, dass ich wirklich einen Schatz habe, würde sie mich auslachen.«
»Ich verspreche es dir.«
Die beiden gelangten gerade in dem Augenblick an die Tür des Damenzimmers, als die Baronin ohnmächtig wurde; aber der Schrei, den Hortense darüber ausstieß, genügte, um Adeline wieder zu sich zu bringen. Lisbeth lief nach Riechsalz. Als sie damit zurückkam, fand sie die Tochter in den Armen der Mutter. Die Baronin suchte sie mit den Worten zu beruhigen: »Es ist nichts; es sind nur die Nerven. Da kommt dein Vater«, fügte sie hinzu. Sie hatte ihn an seiner Art zu klingeln erkannt. »Sag ihm ja nichts davon!«
Adeline erhob sich, um ihrem Gatten entgegenzugehen und ihn in den Garten zu führen, wo sie ihm noch vor Tisch von dem vereitelten Heiratsplan berichten, ihn über seine Zukunftspläne befragen und ihm einige Ratschläge geben wollte.
Der Baron von Hulot bewahrte noch immer seine parlamentarische napoleonische Haltung. Man kann die »Kaiserlichen« leicht erkennen an ihrem soldatischen Wesen, an ihrer Art, sich zu kleiden, an der Gewohnheit, den Rock bis oben zuzuknöpfen, an den schwarzen Seidenkrawatten und an dem ganzen selbstbewussten Auftreten, dem man unbedingtes Herrentum ansieht, das sich die Umgebung des Kaisers in den so häufigen und wechselvollen Lagen angeeignet hatte. Nichts verriet das hohe Alter des Barons. Seine Augen waren noch so scharf, dass er ohne Glas las; sein hübsches ovales Gesicht, das ein vielleicht allzu dunkler Bart schmückte, war von frischer roter Farbe infolge von vielen kleinen Äderchen in der Haut. Sein durch einen Gürtel gehaltener Bauch vermehrte, wie Brillat-Savarin sagt, seine Würde. Sein uraristokratisches und höchst leutseliges Wesen nahmen jeden sogleich für diesen alten Schwerenöter ein, mit dem Crevel so manchen lustigen Abend verlebt hatte. Er war einer von den Männern, deren Augen beim Anblick einer hübschen Frau aufleuchten, die jeder Schönen zulächeln, selbst denen, die nur vorübergehen und nie wiederkehren.
»Hast du eine Rede gehalten, lieber Hektor?« fragte Adeline, als sie seine sorgenvolle Stirn bemerkte.
»Nein«, antwortete Hektor, »aber ich bin todmüde. Stundenlange Reden, ohne dass es zur Abstimmung gekommen wäre. Nichts als Wortgeplänkel! Wie Kavallerieattacken, die nicht durchstoßen! Man hat das Wort an die Stelle der Tat gesetzt, und die Leute, die an Taten gewöhnt sind, haben wenig Freude daran. Ich habe das auch zum Marschall beim Abschied gesagt. Na, man hat sich lange genug am Regierungstische gelangweilt; hier wollen wir vergnügt sein ... Aha, die Wildkatze! Guten Tag, Wildkatze!«
Dann umarmte und küsste er seine Tochter, neckte sie und zog sie auf seine Knie, indem er ihren Kopf auf seine Schulter legte, um ihr schönes goldiges Haar an seinem Gesichte zu fühlen.
Er ist müde und verstimmt, dachte Frau Hulot, und nun muss ich ihm die Laune gleich noch mehr verderben.
»Bleibst du heute Abend bei uns?« fragte sie.
»Nein, Kinder. Nach Tisch Verlass ich euch wieder. Wenn der Tag nicht meinem Bruder, meinen Kindern und der Wildkatze gehörte, so hättet ihr mich überhaupt nicht zu sehen bekommen.«
Die Baronin nahm die Zeitung, überflog den Theaterplan und legte das Blatt wieder hin. Unter der Opernrubrik hatte sie »Robert der Teufel« gelesen. Josepha, die seit einem halben Jahre die Italienische mit der Französischen Oper vertauscht hatte, sang die Alice. Dieses stumme Spiel entging dem Baron nicht; er sah seine Frau scharf an. Adeline senkte den Blick und trat hinaus in den Garten, wohin er ihr folgte.
»Na, was hast du, Adeline?« fragte er, indem er sie um die Taille fasste und fest an sich drückte. »Weißt du nicht, dass ich dich mehr liebe als ...?«
»Mehr als Jenny Cadine und Josepha?« unterbrach sie ihn mutig.
»Wer hat dir denn das gesagt?« fragte der Baron, indem er seine Frau losließ und unwillkürlich einige Schritte zurückprallte.
»Ich habe einen anonymen Brief bekommen, den ich verbrannt habe. Darin stand, dass Hortenses Heirat an der Lage, in der wir uns befänden, gescheitert sei. Mein lieber Hektor, als deine Frau hätte ich nie etwas gesagt. Ich kannte dein Verhältnis mit Jenny Cadine. Habe ich mich je darüber beklagt? Aber als Hortenses Mutter bin ich dir Offenheit schuldig.«
Nach einem Augenblick des peinlichsten Schweigens, während dem man die Herzen schlagen hören konnte, breitete Hulot die Arme aus, drückte seine Frau an sich, küsste sie auf die Stirn und sagte mit der ganzen Übertreibung momentaner Begeisterung: »Adeline, du bist ein Engel, und ich bin ein schlechter Mensch!«
»Nein, nein!« rief die Baronin und legte ihm rasch die Hand auf den Mund, um zu hindern, schlecht von sich selbst zu sprechen.
»Na ja. In diesem Augenblick könnte ich Hortense keinen Pfennig mitgeben. Ich bin sehr unglücklich. Aber da du mir dein Herz geöffnet hast, kann ich dir auch die Sorgen beichten, die mich fast erdrücken. dass dein Onkel Fischer in Geldverlegenheiten ist, das ist auch meine Schuld; er hat mir nämlich eine Wechselbürgschaft von fünfundzwanzigtausend Francs geleistet! Eines Weibes wegen, das mich betrügt, das in meiner Abwesenheit über mich lacht, mich einen angestrichenen alten Kater nennt! – Ach, es ist entsetzlich, dass es mehr Geld kostet, einem Laster zu frönen als eine Familie zu ernähren! Und doch kann man nicht widerstehen. Ich könnte dir in diesem Augenblick versprechen, niemals wieder zu dieser abscheulichen Jüdin zurückzukehren; aber wenn sie mir nur zwei Zeilen schreibt, so eile ich doch wieder hin, wie man unter dem Kaiser ins Gefecht ging.«
»Quäle dich nicht, Hektor!« sagte die arme verzweifelte Frau und vergaß ihre Tochter über den Tränen in ihres Mannes Augen. »Siehst du, ich habe noch meine Brillanten. Rette damit vor allem meinen Onkel!«
»Deine Brillanten sind heute kaum zwanzigtausend Francs wert. Das würde Vater Fischer gar nichts nützen. Behalte sie darum für Hortense! Morgen rede ich mit dem Marschall!«
»Armer Freund!« rief die Baronin, ergriff ihres Mannes Hände und küsste sie.
Das war die ganze Auseinandersetzung! Adeline bot ihm ihre Brillanten an, und er schenkte sie Hortense. Dieser Verzicht schien ihr erhaben, und nun war sie ganz widerstandslos.
Er ist der Herr. Er könnte mir alles nehmen. Aber er lässt mir meine Brillanten. Er ist ein Gott! So dachte diese Frau, die sicherlich mit ihrer Sanftmut mehr erreicht hatte als eine andere durch Zorn und Eifersucht.
Der Menschenkenner weiß, dass wohlerzogene, aber lasterhafte Menschen gewöhnlich viel liebenswürdiger sind als Tugendbolde. Da sie immer ein schlechtes Gewissen haben, so nehmen sie gleichsam einen Vorschuss auf die Nachsicht der andern; sie sind gegen die Fehler ihrer Richter duldsam, und so gelten sie für prächtige Menschen. Natürlich gibt es auch unter den Tugendsamen reizende Leute; aber meist dünkt sich die Tugend an sich schon vollkommen genug und spart sich jeden Aufwand von Liebenswürdigkeit. Übrigens sind alle tugendhaften Leute – von den Heuchlern spreche ich hier nicht – ein wenig argwöhnisch; sie kommen sich auf dem großen Markte des Lebens gleichsam übervorteilt vor und machen gern spitze Bemerkungen nach der Art der unverstandenen Seelen.
Der Baron, der sich den Ruin seiner Familie vorzuwerfen hatte, nahm seine Zuflucht zu all den reichen Hilfsquellen seines Geistes und seiner verführerischen Urbanität gegenüber seiner Frau, den Kindern und der Tante Lisbeth. Als er seinen Sohn und Cölestine mit dem kleinen Hulot kommen sah, überschüttete er seine Schwiegertochter mit den artigsten Schmeicheleien. Daran war die eitle Cölestine nicht sonderlich gewöhnt; sie war zwar ein reiches, aber höchst unbedeutendes Wesen von recht alltäglichem Aussehen. Der Großvater nahm den kleinen Kerl, küsste ihn und fand ihn süß und entzückend. Er unterhielt sich mit ihm in der Kleinkindersprache und weissagte, dass diese Krabbe einmal größer sein Großvater werden würde; auch seinem Sohne sagte er ein paar angenehme Worte und gab dann das Kind wieder der Kinderfrau, einer dicken Bäuerin aus der Normandie. Cölestine wechselte mit der Baronin einen Blick, der deutlich ausdrückte: Was für ein herrlicher Mensch! Es war klar, dass ihn Cölestine fortan gegen ihres eigenen Vaters Angriffe in Schutz nahm.
Nachdem der Baron den liebenswürdigen Schwiegervater und den gemütlichen Großpapa gespielt hatte, ging er mit seinem Sohn in den Garten, wo er ihm in einigen erfahrungsreichen Bemerkungen vor Augen führte, wie man sich in der Kammer in einem so schwierigen Fall, wie zum Beispiel dem von heute morgen, verhalten müsse. Der junge Anwalt bewunderte seines Vaters Scharfblick und war von seinem kameradschaftlichen Ton gerührt, besonders aber von der sichtlichen Achtung, mit der er ihn wie seinesgleichen behandelte. Hulot der Jüngere war einer der jungen Männer, wie sie die Revolution von 1830 hervorgebracht hat: den Kopf voll Politik, erfüllt von seinen Plänen und Hoffnungen, die er hinter der Maske der Würde verbarg, und sehr eifersüchtig auf alle bereits Berühmten. Er warf mit Phrasen um sich, aber nicht mit den blitzenden Bonmonts, den Brillanten der französischen Plauderkunst. Seine Haltung war gut, aber von einer steifen Zurückhaltung, die Vornehmheit ausdrücken sollte. Solche Leute sind wie wandelnde Mumien, in denen ein Franzose der guten alten Zeit einbalsamiert liegt. Manchmal regt sich der alte Gallier wieder und möchte die englische Tünche abwerfen, aber die Eitelkeit duckt ihn immer wieder, bis er zu guter Letzt gottergeben seinen Geist aufgibt. Solche wandelnden Mumien stecken immer in tadellosen schwarzen Röcken.
»Ah, da kommt mein Bruder!« sagte der Baron und eilte zur Tür des Salons, ihm entgegen.
Nachdem Hektor den wahrscheinlichen Nachfolger des eben verstorbenen Marschalls Montcornet umarmt hatte, führte er ihn herein, wobei er ihm mit sichtlicher Liebe und Verehrung den Arm reichte. Dieser Pair von Frankreich, den die Taubheit vom Besuch der Sitzungen abhielt, hatte einen herrlichen Kopf mit vom Alter gebleichtem Haar, das aber immer noch voll genug war, um da, wo der Hut gesessen hatte, einen Eindruck zu zeigen. Klein, untersetzt und mager, trug der Graf ein frisches Greisentum fröhlich zur Schau. Im Besitz einer außergewöhnlichen geistigen Regsamkeit, die sich ungern zur Ruhe verurteilt sah, vertrieb er sich die Zeit mit Lesen und Spazierengehen. In seinem blassen Gesicht, seiner edlen Haltung, seiner Natürlichkeit beim Sprechen – wobei er sehr witzig sein konnte – spiegelte sich seine innere Feinheit. Nie erzählte er vom Krieg und den Feldzügen, die er mitgemacht hatte; er war zu sehr wirklicher Held, als dass er mit dem Heldentum paradiert hätte. Im Salon sah er seine ständige Aufgabe darin, die leisesten Wünsche der Frauen zu erfüllen.
»Ihr seid alle so lustig!« meinte er, als er die gute Laune bemerkte, die der Baron in diesem kleinen Familienkreis hervorgerufen hatte, »... obgleich aus Hortenses Heirat nichts geworden ist«, setzte er hinzu, als er auf dem Gesicht der Schwägerin einen Schatten von Trauer wahrnahm.
»Das kommt immer noch früh genug«, rief ihm Tante Lisbeth mit Donnerstimme ins Ohr.
»Ach, da bist du ja auch, du Baum, der keine Früchte tragen wollte!« meinte er lachend.
Der Held von Pforzheim mochte Lisbeth gern, weil sie sich beide in manchem ähnlich waren. Auch er war aus dem Volke hervorgegangen, hatte keine besondere Erziehung genossen und verdankte sein Soldatenglück einzig seinem persönlichen Mute, und der gesunde Menschenverstand ersetzte bei ihm den geistigen Drill. Mit reinen Händen und ruhmgekrönt feierte er den Abend eines schönen Lebens im Kreise einer Familie, der alle seine Liebe gehörte, ohne dass er seines Bruders Irrungen und Wirrungen ahnte. Keiner genoss wie er das schöne Schauspiel dieser Einigkeit, wo nie der geringste Streit ausbrach, wo sich alle wie Brüder und Schwestern liebten; auch Cölestine war sofort als zur Familie gehörig betrachtet worden. So erkundigte sich denn der biedere Graf mehrere Male, warum Vater Crevel nicht käme.
»Mein Vater ist auf dem Lande«, rief ihm Cölestine zu. Man berichtete ihm, Crevel sei verreist.
Diese schöne Familieneintracht stimmte Frau Hulot nachdenklich: Das ist doch mein sicherstes Glück! Wer könnte mir das rauben?
Als der General sah, wie seinem Liebling Adeline von ihrem Manne der Hof gemacht wurde, neckte er den Baron, so dass dieser aus Furcht vor der Lächerlichkeit seine Galanterie von neuem seiner Schwiegertochter zuwandte, die bei diesen Familienmahlzeiten immer den Gegenstand seiner Schmeicheleien und Aufmerksamkeiten bildete. Durch sie hoffte er nämlich den Vater Crevel umzustimmen und ihn von seinem Hasse abzubringen.
Schwerlich konnte man beim Anblick dieses Familienbildes glauben, dass der Vater vor dem Ruin stand, dass die Mutter in Verzweiflung war, dass der Sohn in größter Besorgnis um seines Vaters Zukunft schwebte und dass die Tochter im Begriffe war, ihrer Tante den Geliebten abspenstig zu machen.
Um sieben Uhr, als er seinen Bruder, seinen Sohn, die Baronin und Hortense am Whisttische sah, ging der Baron fort, um seine Geliebte in der Oper zu bewundern, und nahm Tante Lisbeth, die in der Rue du Doyenné wohnte, mit in seine Droschke. Unter dem Vorwande, dass es in ihrer Gegend so einsam sei, pflegte sich Lisbeth stets sofort nach dem Essen zu empfehlen. Diese Maßregel des alten Fräuleins war sehr vernünftig.
dass das alte Häuserviertel längs des Louvre noch immer besteht, ist einer der Widersprüche gegen den gesunden Menschenverstand, die sich die Franzosen so gerne leisten, damit sich Europa zu seiner Beruhigung überzeugen kann, dass der Fortschritt nicht so schlimm ist, wie er aussieht. Vielleicht verfolgt man damit unbewusst eine große politische Idee. Sicherlich ist es aber keine überflüssige Arbeit, diesen Winkel des modernen Paris zu beschreiben; denn später wird man sich so etwas gar nicht mehr vorstellen können. Unsere Enkel, die zweifellos das Louvre vollendet sehen, werden nicht glauben wollen, dass es so lange in der schändlichsten Umgebung gestanden hat, im Herzen von Paris, dieser Palast, in dem drei Dynastien in einem Zeiträume von sechsunddreißig Jahren die Blüte Frankreichs und Europas empfangen haben.
Von dem Portal aus, das nach dem Pont du Carrousel und der Rue de Musée führt, fällt einem ein Dutzend Häuser mit zerfallenen Vorderseiten auf, die von den unbekümmerten Besitzern nicht mehr ausgebessert werden. Man steht vor den Überbleibseln eines alten Viertels, das zerstört wurde, als Napoleon den Plan fasste, das Louvre zu vollenden. Die Rue du Doyenné mit ihrer Sackgasse dringt einzig und allein in dieses düstere und einsame Häuserviertel ein, dessen Bewohner einem wie Gespenster vorkommen; denn eigentlich sieht man dort keinen Menschen. Das Pflaster, viel tiefer als das der Rue du Musée, liegt ungefähr in einer Höhe mit dem der Rue Froidmanteau. Schon durch die Erhöhung des Platzes erscheinen diese Häuser wie verschüttet; dazu kommt noch, dass sie von dem undurchdringlichen Schatten umhüllt sind, den die hohen, an dieser Seite vom Nordwind geschwärzten Galerien des Louvre werfen. Dunkelheit, Stille, eiskalte Luft und die Kellertiefe machen diese Häuser gewissermaßen zu Grüften, zu lebendigen Gräbern. Wenn man im Wagen an diesem toten Viertel entlangfährt, gruselt es einen, und man fragt sich, wer wohl da wohnen könne und wer am Abend hier zu gehen wage, zu der Zeit, wo sich dies Gässchen in eine Räuberhöhle verwandelt, wo alle Laster von Paris unter dem Deckmantel der Nacht aufwachen. Dieser an sich schon beunruhigende Gedanke beängstigt einen geradezu, wenn man sieht, dass diese sogenannten Häuser nach der Rue de Richelieu hin an lange Moräste grenzen, nach der Tuilerienstraße an ein wahres Meer von Pflastersteinhaufen, nach den Galerien an kleine Gärten und unheimliche Baracken und nach der Seite des alten Louvre an Felder von Abbruchsteinen. Heinrich III. und seine Lieblinge, die ihre Hosen, und Königin Margaretes Liebhaber, die ihre Köpfe suchen, mögen bei Mondenschein ihre Menuetts tanzen in diesen Wüsteneien, die überragt werden von der Kuppel einer alten Kapelle, die noch dort steht, als wolle sie beweisen, dass der in Frankreich nimmermüde Katholizismus alles überdauert. Seit fast vierzig Jahren schreit das Louvre aus all den aufgerissenen Mäulern dieser geborstenen Mauern, aus all diesen gähnenden Fensterhöhlen: »Entfernt diese Schandflecke aus meinem Gesichtskreis!« Zweifellos sieht man aber in dieser Mördergrube eine Art Symbol und hält es für nützlich, damit im Herzen von Paris die nahe Verwandtschaft von Elend und Glanz, die Merkmale dieser Königin der Weltstädte, zu zeigen. Und wer weiß, ob diese kahlen Ruinen, diese verruchten Baracken der Rue du Musée mit ihren Reihen von Holzbuden nicht ein längeres und glücklicheres Dasein haben als die drei Herrscherhäuser.
Seit 1823 war der Mietzins in diesen dem Verfall geweihten Häusern sehr niedrig, was Tante Lisbeth bewogen hatte, dort zu mieten, obwohl sie sich beim Anblick des Viertels sofort sagte, dass man hier nach Einbruch der Nacht nicht mehr außer dem Hause weilen dürfe. Diese Notwendigkeit passte übrigens zu ihrer ländlichen Gewohnheit, der sie treu geblieben war: mit der Sonne aufzustehen und mit den Hühnern schlafen zu gehen; man spart damit beträchtlich an Licht und Heizung. Lisbeth bewohnte also eins jener Häuser, denen die Niederlegung des berühmten Hauses, in dem Cambacérès gewohnt, die freie Aussicht über den Platz verschaffte.
In dem Augenblick, als sich der Baron an der Tür dieses Hauses von Lisbeth mit den Worten verabschiedete: »Auf Wiedersehen, Tante Lisbeth!«, ging eine junge Frau an der Droschke vorbei, um gleichfalls das Haus zu betreten. Sie war klein, schlank, hübsch, sehr elegant gekleidet und duftete nach einem erlesenen Parfüm. Ohne etwas anderes damit zu bezwecken, als sich den Verwandten ihrer Nachbarin anzusehen, wechselte diese Dame einen Blick mit dem Baron; aber den alten Lebemann durchzuckte es dabei lebhaft wie alle Pariser, wenn sie einer jungen Frau begegnen, die, wie der Fachmann sich ausdrückt, ihren Geschmack verkörpert. Ehe er wieder in den Wagen stieg, zog er langsam und bedächtig einen seiner Handschuhe an, um sein Zögern zu begründen und der jungen Frau mit den Blicken folgen zu können. Ihr Kleid verriet gefällige Formen und nicht nur die abscheulichen betrügerischen Krinolinenunterröcke.
Das ist ja eine reizende kleine Frau! sagte er sich. Mit der wäre man glücklich.
Als nun die Unbekannte im Hausflur die Wendung zur Treppe machte, spähte sie nochmals nach dem Baron, wobei sie sich ja nicht umzudrehen brauchte. Da sah sie, dass der Baron, starr vor Bewunderung und von Begehrlichkeit und Neugier gepackt, noch am selben Platze stand. Bewunderung ist eine Blume, deren Duft alle Pariserinnen mit Wonne einatmen, wenn sie sie an ihrem Wege finden. Sogar pflichttreue und tugendsame hübsche Frauen kommen ziemlich verdrießlich heim, wenn sie auf ihrem Spaziergange nicht ihr kleines Sträußchen Bewunderung gepflückt haben.
Schnell stieg die junge Frau die Treppe hinauf. Bald darauf wurde im zweiten Stock ein Fenster geöffnet, an dem sie erschien, aber in Gesellschaft eines Herrn, dessen kahler Schädel und ein klein wenig grimmiger Blick den Ehemann verrieten.
Wie schlau und klug! dachte der Baron. Auf diese Weise zeigt sie mir, wo sie wohnt. Nur ein bisschen zuviel Tempo! Und dann dies Viertel hier! Also Vorsicht!
Der Rat hob den Kopf, als er in die Droschke gestiegen war, und im Nu zogen sich Mann und Frau zurück, als habe das Gesicht des Barons die sagenhafte Wirkung des Medusenhauptes auf sie ausgeübt.
Fast möchte man glauben, sie kennen mich, dachte der Baron. Dann wäre ja alles klar.
Und wirklich, als der Wagen wieder der Rue du Musée zufuhr und Hulot sich noch einmal nach der Unbekannten umwandte, sah er, dass sie wieder am Fenster stand. Sich schämend, dabei ertappt worden zu sein, dass sie ihrem Anbeter nachschaute, fuhr die junge Frau rasch zurück.
Durch die Wildkatze werde ich erfahren, wer sie ist, dachte der Baron.
Der Anblick des Staatsrates hatte einen tiefen Eindruck auf das Ehepaar gemacht.
»Aber das ist ja der Baron Hulot, der Vorstand meiner Abteilung!« rief der Mann und trat von der Fensterbrüstung zurück.
»Und denke dir, Paul, die alte Jungfer, die im dritten Stock nach dem Hof hinaus wohnt und mit dem jungen Menschen zusammenlebt, die muss eine nahe Verwandte von ihm sein! Wie sonderbar, dass wir das erst heute und so zufällig erfahren!«
»Fräulein Fischer lebt mit einem jungen Menschen zusammen?« rief der Beamte. »Ach was, das ist Altweiberklatsch! Wir wollen nicht so leichthin von der Verwandten eines Staatsrates sprechen, von dem im Ministerium Regen und Sonnenschein abhängt. Komm! Essen wir! Ich warte seit vier Stunden auf dich!«
Die sehr hübsche Frau Marneffe, eine uneheliche Tochter des Grafen Montcornet, eines der gefeiertsten napoleonischen Offiziere, hatte man mit einer Mitgift von zwanzigtausend Francs an einen unteren Beamten im Kriegsministerium verheiratet. Durch den Einfluss des berühmten Generals, der während der letzten sechs Monate seines Lebens Marschall von Frankreich gewesen, war diese Schreiberseele ganz unverhofft in die Stelle eines Kanzleiassistenten aufgerückt. Aber gerade als er Kanzleisekretär werden sollte, hatte der Tod des Marschalls den Hoffnungen des Ehepaares ein Ende bereitet. Die Kärglichkeit ihres Einkommens zwang das Ehepaar Marneffe, an der Miete zu sparen; denn die Mitgift von Fräulein Valerie Fortin war draufgegangen, teils um Marneffes Schulden zu bezahlen, teils durch die nötigen Anschaffungen bei der Errichtung ihres Heims, besonders aber durch die Bedürfnisse der hübschen Frau, die bei ihrer Mutter an Genüsse gewöhnt worden war, auf die sie nicht mehr verzichten wollte. Die Lage der Rue du Doyenné, nahe dem Kriegsministerium und der City von Paris, gefiel Herrn und Frau Marneffe, die nun seit ungefähr vier Jahren mit Fräulein Fischer in einem Hause wohnten.
Jean Paul Marneffe gehörte zu der Kategorie von Beamten, die dem völligen moralischen Untergang nur durch jene gewisse Widerstandskraft entgehen, die die Entartung zeitigt. Dieser kleine hagere Mann mit dünnem Haupt- und Barthaar und blassem Gesicht, mit mehr Spuren des Verbrauchtseins als des Alters, mit bebrillten Augen und leicht geröteten Lidern, dieser Mann von unsicherem Benehmen und noch unsicherer Haltung hatte den Typ eines Sittlichkeitsverbrechers.
Die Räume, die das Ehepaar bewohnte, boten den üblichen Anblick so vieler Pariser Wohnungen, in denen unechter Luxus vorherrscht. Im Salon standen Möbel mit abgenutzten Bezügen aus Baumwollsamt; Gipsfiguren sollten Florentiner Bronzen vorstellen; der schlecht entworfene bronzierte Kronleuchter trug Lichthalter aus gepresstem Glas, und der billige Preis des Teppichs fand nachträglich eine Erklärung in der Menge eingewebter Baumwolle, die man bereits mit bloßem Auge erkennen konnte. Alles bis auf die Vorhänge, an denen man so recht sehen konnte, dass Wolldamast keine drei Jahre lang gut aussieht, alles das rief laut das Mitleid des Betrachters an wie ein zerlumpter Bettler vor der Kirchentür. Das Esszimmer, von einem einzigen Dienstmädchen nur schlecht instand gehalten, machte denselben widrigen Eindruck wie die Speisesäle in kleinstädtischen Gasthöfen: alles schmutzig und vernachlässigt.
Das Herrenzimmer – von einer Studentenbude nicht allzu verschieden – mit dem Junggesellenbett und sonstigem Junggesellenmobiliar sah verwohnt aus und so verbraucht wie sein Herr. Nur einmal wöchentlich ward es gesäubert. Und dies gräuliche Zimmer, wo alles umherlag, wo alte Socken über den Polsterstühlen hingen, auf deren dunklen Bezügen sich staubumränderte Blumen abzeichneten, ließ darauf schließen, dass diesem Manne sein Haushalt gleichgültig war, dass er sein Leben draußen verbrachte, beim Spiel, im Kaffeehaus und Gott weiß wo noch.
Nur das Zimmer der Dame des Hauses bildete eine Ausnahme in der allgemeinen Unordnung dieser Beamtenwohnung, in der alle Vorhänge von Rauch und Staub grau geworden waren und in der das Kind, augenscheinlich sich selbst überlassen, sein Spielzeug überall umherliegen ließ.
Das Haus, in der Hauptsache nach der Straße zu gelegen, hatte einen Seitenflügel, durch den es mit dem Hinterhaus zusammenhing. In diesem Flügel lagen das Schlafgemach und das Ankleidezimmer von Frau Valerie. Beide Räume, mit persischen Wandbehängen, Möbeln aus Palisanderholz und einem Brüsseler Teppich ausgeschmückt, verrieten die hübsche Frau und – die Frau, die einen reichen Liebhaber hat.
Auf dem samtbedeckten Kaminsims tickte eine jener Standuhren, die damals allgemein beliebt waren. Sonst standen noch eine Etagere mit allerhand Nippsachen herum und ein paar Blumenschalen aus wertvollem chinesischem Porzellan. Bett, Toilettentisch, Spiegelschrank, das kleine Ecksofa und alle die unvermeidlichen Kleinigkeiten verrieten den spielerischen Prunk der Zeit.
Das alles war zweifellos nur ein schwacher Abglanz von Reichtum und Eleganz und obendrein um drei Jahre in der Mode zurück. Dabei hatte dieser Luxus den Beigeschmack der Spießbürgerlichkeit. Jenes künstlerische Etwas fehlte völlig, das dort entsteht, wo guter Geschmack jeden einzelnen Gegenstand zum Besitzer passend aussucht. Ein Kenner des sozialen Lebens des Landes hätte aus gewissen nebensächlichen, aber wertvolleren Gegenständen sofort auf den Liebhaber, den bei einer verheirateten Frau stets abwesenden und doch immerdar anwesenden Halbgott, geschlossen.
Das Mittagessen, das Mann, Frau und Kind gemeinsam einnahmen, diese um vier Stunden verzögerte Mahlzeit, verriet die Geldnot, in der sich die Familie befand. Der Mittagstisch ist der sicherste Vermögensmesser in den Pariser Familien. Eine Kräutersuppe, Kalbfleisch mit Kartoffeln, das in einer rötlichen Brühe schwamm, die Bouillon vorstellen sollte, eine Schüssel Bohnen, Kirschen minderwertiger Sorte, alles auf arg beschädigten Tellern und Schüsseln, dazu leichte ärmliche Neusilberbestecke. Das war kein Tisch für eine hübsche junge Frau! Das zu sehen, hätte den Baron zu Tränen gerührt. Die trüben Karaffen verbargen nicht genug die abscheuliche Farbe des Weins, der literweise vom Weinhändler an der nächsten Ecke geholt wurde. Die Mundtücher waren seit acht Tagen im Gebrauch. Kurzum, alles verriet eine würdelose Armut und mangelnden Sinn für Gemütlichkeit bei Mann und Frau. Selbst der oberflächlichste Beobachter hätte erkannt, dass diese beiden Menschen an jenem verhängnisvollen Punkt angelangt waren, wo der Druck des Lebens Betrug und Selbstbetrug heranruft.
Nach den ersten Worten, die der Verzögerung des Mittagessens galten, berichtete Valerie: »Samamon will deinen Wechsel nur zu fünfzig Prozent annehmen. Außerdem verlangt er als Sicherheit eine Abtretung deines Gehaltes.«
Das allgemeine Beamtenelend!
»Was soll nun aus uns werden?« fragte Marneffe. »Der Hauswirt wird uns morgen kündigen. Zu dumm, dass dein Vater es fertiggebracht hat, ohne Testament zu sterben! Na ja, diese alten Leute aus der Kaiserzeit bilden sich alle miteinander ein, sie seien unsterblich wie ihr Kaiser.«
»Mein armer Vater!« sagte Valerie. »Ich war sein einziges Kind. Er hing so an mir! Die Gräfin muss das Testament vernichtet haben! Wie hätte er mich vergessen können, wo er uns so manches Mal drei oder vier Tausendfrancsscheine auf einmal brachte!«
»Frau, wir sind vier Raten der Miete schuldig; das macht fünfzehnhundert Francs. Ist unser Mobiliar so viel wert? Das ist die Frage! sagte schon Shakespeare.«
»Auf Wiedersehen, Alter!« sagte Valerie, die nur ein paar Bissen von dem Fleisch gegessen hatte, aus dem die Köchin vorher eine gute Bouillon für einen tapferen Vaterlandsverteidiger, der eben aus Algier heimgekehrt war, gekocht hatte. »Hier kann nur noch ein Radikalmittel helfen!«
»Wohin, Valerie?« rief Marneffe und vertrat seiner Frau den Weg zur Tür.
»Ich will einmal mit unserem Wirt sprechen!« antwortete sie und ordnete ihre Locken unter dem hübschen Hut. »Und du solltest versuchen, dich mit der alten Jungfer da oben gut zu stellen, wenn sie wirklich eine nahe Verwandte deines Chefs ist.«
Die Unwissenheit der einzelnen Mieter ein und desselben Hauses über sich und ihre gegenseitige gesellschaftliche Lage zeigt am deutlichsten, mit welch rasender Schnelligkeit sich das Pariser Leben abspielt. Zudem ist es leicht verständlich, dass ein Beamter, der jeden Tag frühzeitig in seine Kanzlei geht, mittags nur zum Essen heimkommt und abends wieder ausgeht, und ebenso, dass eine Frau, die den Vergnügungen von Paris nachläuft, nichts vom Dasein einer alten Jungfer wissen können, die im dritten Stock nach dem Hof hinaus wohnt, besonders wenn diese alte Jungfer eine Lebensweise führt wie Fräulein Fischer.
Als erste im ganzen Hause und ohne mit irgendwem zu sprechen, pflegte Tante Lisbeth jeden Morgen auszugehen, um Milch, Brot und Kohlen einzuholen. Abends ging sie mit Sonnenuntergang zu Bett; nie empfing sie Briefe oder Besuche. Sie führte eine jener anonymen sich einspinnenden Existenzen, wie man sie in manchen Häusern findet, wo man beispielsweise erst nach Jahren zufällig erfährt, dass oben im vierten Stock ein alter Herr wohnt, der noch Voltaire, Pilâtre de Rozier, Beaujon, Marcel, Molé, Sophie Arnould, Franklin und Robespierre gekannt hat.
Was Herr und Frau Marneffe eben über Lisbeth Fischer gesagt, hatten sie aus der Einsamkeit dieses Pariser Viertels erfahren und durch ihre aus Verzweiflung angeknüpften Beziehungen zu den Hausmannsleuten, auf deren Wohlwollen das Ehepaar allzusehr angewiesen war. Sie waren deshalb ängstlich bemüht, es sich zu erhalten.
Der Stolz, die Schweigsamkeit und das zurückgezogene Wesen der alten Jungfer hatten bei den Pförtnersleuten einen gewissen übertriebenen Respekt zur Folge gehabt, andrerseits aber auch jenes Übelwollen, das ein untrügliches Zeichen für das – wenn auch uneingestandene – Missvergnügen des Tieferstehenden ist. Im übrigen hielten sie sich für ebensoviel wie eine Mieterin, die nur zweihundertundfünfzig Francs Miete zahlte.
Die vertraulichen Mitteilungen, die Tante Lisbeth ihrer jungen Verwandten gemacht hatte, entsprachen der Wirklichkeit. Aber was die Pförtnersfrau dem Ehepaar Marneffe hinterbracht hatte, war, ohne dass sie es selber merkte, mehr regelrechte Verleumdung.
Als die alte Jungfer ihren Leuchter aus den Händen dieser ehrbaren Frau Olivier empfangen hatte, schaute sie zu den Dachfenstern über ihrer Wohnung hinauf, um zu sehen, ob dort Licht sei. Um diese Zeit war es selbst im Juli nach dem Hofe hinaus schon so dunkel, dass man Licht nötig hatte.
»Sie können ruhig sein. Herr Steinbock ist zu Hause; er ist gar nicht fort gewesen«, bemerkte die Hausmannsfrau spöttisch zu Fräulein Fischer.
Sie erwiderte nichts. Darin war sie Bäuerin geblieben, dass sie sich ganz und gar nichts aus dem Gerede Gleichgültiger machte. Genauso wie der Bauer nur sein eigenes Dorf kennt, lag ihr nur an der Meinung des kleinen Kreises, in dem sie verkehrte. Festen Ganges stieg sie an ihrer eigenen Wohnung vorbei, zur Mansarde hinauf. Das hatte einen harmlosen Grund. Beim Nachtisch hatte sie sich Früchte und Konfekt für ihren Liebsten in ihr Arbeitskörbchen gesteckt. Das wollte sie ihm jetzt geben, just wie andere alten Jungfern ihrem Hunde einen Leckerbissen mitbringen.
Sie fand den blassen blonden jungen Mann, den Helden von Hortenses Träumen, beim Schein einer kleinen Lampe, deren Leuchtkraft durch eine davorgehängte, mit Wasser gefüllte Glaskugel gesteigert wurde, eine sogenannte Schusterkugel. Er saß an einem Arbeitstisch, auf dem verschiedene Werkzeuge des Ziseleurs ausgebreitet waren: rotes Wachs, Bossierhölzer, Roharbeiten und Kupfermodelle. Er trug eine Arbeiterbluse und hielt ein kleines Wachsgruppenmodell in der Hand, das er mit der ganzen Aufmerksamkeit eines schaffenden Künstlers betrachtete.
»Da, Stanislaus, sieh, was ich dir mitgebracht habe!« sagte Lisbeth und breitete ihr Taschentuch auf eine Ecke des Tisches. Dann holte sie aus ihrem geflochtenen Körbchen vorsichtig die Näschereien und Früchte heraus.
»Wie gut du bist!« antwortete der arme Flüchtling mit trauriger Stimme.
»Das wird dich erfrischen, armer Junge! Du bist ganz heiß bei deiner Arbeit geworden! Für solch grobe Schufterei bist du nicht geschaffen.«
Stanislaus sah das alte Fräulein erstaunt an.
»Aber so iss doch, statt mich anzustarren wie eine deiner Figuren, wenn sie dir gefällt!«
Angesichts dieses rauen Rüffels legte sich des jungen Mannes Erstaunen. Nun erkannte er seinen alten Hausdrachen wieder. Anwandlungen von Zärtlichkeit wunderten ihn immer; die Grobheit war er gewöhnt. Obgleich Steinbock neunundzwanzig Jahre alt war, sah er, wie dies bei blonden Menschen häufig der Fall ist, um fünf bis sechs Jahre jünger aus. Wenn man seine unter dem Elend und den Plagen der Verbannung allerdings etwas welk gewordene Jugendfrische neben dem vertrockneten derben Gesicht Lisbeths sah, konnte man auf den Gedanken kommen, die Natur habe hier das Geschlecht verwechselt.
Stanislaus verließ seine Arbeit, warf sich in einen alten Lehnsessel im Stil Louis XV., der mit gelbem Utrechter Samt bezogen war, und schien sich ausruhen zu wollen. Die alte Jungfer nahm eine Reineclaude und reichte sie ihrem Freunde mit gütiger Bewegung.
»Danke!« sagte er und nahm sie.
»Bist du müde?« fragte sie, indem sie ihm eine zweite Frucht reichte.
»Nicht müde vom Schaffen, aber müde vom Leben«, antwortete er.
»Was sind das für Gedanken!« meinte sie ärgerlich. »Hast du nicht eine gute Fee, die für dich sorgt?« Und damit reichte sie ihm die Süßigkeiten, die er zu ihrem Vergnügen alle aufaß.
»Siehst du«, fuhr sie fort, »bei Tisch bei meiner Nichte habe ich deiner gedacht und ...«
Er sah Lisbeth mit einem zärtlichen und zugleich betrübten Blicke an: »Ich weiß wohl, dass ich ohne dich schon längst nicht mehr lebte, aber, liebe Freundin, ein Künstler braucht Zerstreuung ...«
»Aha, daher weht der Wind!« unterbrach sie ihn, indem sie die Hände in die Hüften stemmte und große Augen machte. »Du willst dir deine Gesundheit wohl gar im Sündenpfuhl von Paris ruinieren wie so viele andere, die dann im Spittel enden! Nein, nein, erarbeite dir erst ein Vermögen, und wenn du dermaleinst von deinen Zinsen leben kannst, dann amüsiere dich, mein Sohn! Denn dann kannst du die Sünde und auch die Doktorrechnungen bezahlen, du Leichtfuß du!«
Stanislaus Steinbock senkte den Kopf unter ihren scharfen Blicken, die wie ein magnetischer Strom durch seinen Körper drangen.
Selbst das ärgste Lästermaul hätte beim Anblick dieser Szene erkannt, wie falsch die Verleumdungen waren, die das Ehepaar Olivier gegen Lisbeth Fischer ausgesprochen hatte. Alles, Sprechweise, Bewegungen und Blicke der beiden bezeugten die Reinheit ihrer Beziehungen. Das alternde Mädchen äußerte die Zärtlichkeit einer zwar derben, aber aufrichtigen Mütterlichkeit, und der junge Mann ertrug wie ein gehorsamer Sohn die mütterliche Tyrannei.
Diese seltsame Freundschaft beruhte darauf, dass hier ein kräftiger Wille unaufhörlich auf einen schwachen Charakter einwirkte, auf jene dem Slawen eigentümliche Haltlosigkeit, die zwar im Kriege wahrem Heldenmut weicht, sich im übrigen aber in einer unglaublichen Zerrissenheit äußert, deren Untersuchung wirklich einmal die Physiologen beschäftigen sollte. Die Physiologen sind für die soziale Wissenschaft, was die Insektenkenner für die Landwirtschaft sind.
»Wenn ich aber nun sterbe, ehe ich reich geworden bin?« fragte Stanislaus schwermütig.
»Sterben?« rief das alte Fräulein. »Aber ich lasse dich einfach nicht sterben! Ich habe Lebenskraft für zwei, und ich gäbe mein Blut für dich, wenn es nötig wäre.«
Bei diesem stürmischen und so naiven Ausruf füllten sich Steinbocks Augen mit Tränen.
»Nicht Trübsal blasen, Stanislauschen!« tröstete Lisbeth gerührt. »Hör mich einmal an! Ich glaube, dein Petschaft hat meiner Nichte Hortense sehr gefallen. Pass auf, ich bring es auch noch dahin, dass du deine Bronzegruppe verkaufst! Dann bist du deiner Schuld gegen mich ledig und kannst tun und lassen, was du willst. Dann bist du frei! Aber nun sei vergnügt!«
»Ich werde stets in deiner Schuld bleiben«, entgegnete der arme Verbannte.
»Wieso?« fragte die Tochter der Vogesen. Zugunsten des jungen Polen ergriff sie gegen sich selbst Partei.
»Weil ich dir nicht nur Kost, Wohnung und Pflege im Elend verdanke, sondern weil du mir zu alledem auch noch Kraft geschenkt hast! Du hast mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Zwar warst du oft hart zu mir, du hast mir oft weh getan ...«
»Ich?« sagte sie. »Nun fangen deine Phantastereien von Poesie und Kunst wohl wieder an? Du verrenkst dir die Finger auf der Suche nach deinem Schönheitsideal und anderem nordischen Blödsinn! Schönheit ist nicht so viel wert wie die Wirklichkeit, und die Wirklichkeit bin ich! Du hast den Kopf voller Ideen? Das ist was Rechtes! Ich habe auch welche. Wozu nützt denn das, was man in sich hat, wenn man es nicht verwerten kann? Diejenigen, die Ideen haben, bringen es in der Welt nicht so weit wie die, die keine haben. Man muss sich nur ordentlich rühren. Arbeiten solltest du, statt dich in Träumereien zu verlieren! Was hast du zum Beispiel heute fertiggebracht, während ich fort war?«
»Was hat deine hübsche Nichte gesagt?« lenkte er ab.
»Wer hat dir gesagt, dass sie hübsch ist?« fuhr Lisbeth auf, in einem Tone, in dem die Eifersucht einer Tigerin grollte.
»Du selber!«
»Dann habe ich das nur gesagt, um zu sehen, was für ein Gesicht du dazu machst! Willst du denn ein Schürzenjäger werden? Du liebst die Frauen: gut, schaffe dir welche! Lass deine Sehnsucht in Bronze erstehen! Du wirst dich wohl noch eine Weile ohne Liebschaften behelfen müssen und besonders ohne meine Nichte, mein lieber Freund. Die ist nichts für dich. Die braucht einen Mann mit sechzigtausend Francs Jahreseinkommen – und so einer hat sich auch bereits gefunden ... Donnerwetter, dein Bett ist noch gar nicht gemacht, armer Junge! Das hab ich ganz vergessen.«
Sogleich legte das kräftige Mädchen Handschuhe, Mantel und Hut ab und richtete wie eine Magd geschickt und rasch das kleine Bett her, in dem der Künstler schlief. Die Mischung von Derbheit, ja Härte, und von Güte in ihr erklärt die Macht, die Lisbeth über den jungen Mann gewonnen hatte, den sie gewissermaßen als ihr Eigentum betrachtete. Das Leben fesselt uns nun einmal durch seinen Wechsel von Gut und Böse. Wäre dem jungen Polen an Lisbeths Stelle eine Frau Marneffe begegnet, so hätte er in dieser Beschützerin nur eine Führerin in Schmutz und Schande gefunden. Er wäre endlich verdorben. Gearbeitet hätte er dann gewiss nicht, und niemals wäre der Künstler in ihm erwacht. Obwohl er zuweilen unter der herrischen Zuneigung des alten Mädchens geradezu litt, so sagte ihm doch sein Verstand, dass er diese eiserne Zucht dem faulen und verderblichen Leben vorziehen müsse, das so mancher der polnischen Flüchtlinge in Paris führte.
Das merkwürdige Zusammenleben dieser energischen Frau mit diesem männlichen Schwächling war folgendermaßen entstanden:
Man schrieb das Jahr 1833. Fräulein Fischer arbeitete zuweilen, wenn sie gerade sehr viel zu tun hatte, bis tief in die Nacht hinein. Einmal gegen ein Uhr nachts nahm sie einen starken Kohlengasgeruch wahr und hörte Stöhnen wie von einem Sterbenden. Der Geruch und das Röcheln kamen aus der Dachwohnung über ihren beiden Zimmern. Blitzschnell erstand ihr der Gedanke, dass der junge Mann da oben, der kürzlich in die seit drei Jahren leerstehende Mansarde gezogen war, offenbar einen Selbstmordversuch begangen habe. Rasch eilte sie hinauf, drückte die Tür mit der ganzen Kraft einer stämmigen Lothringerin ein und erblickte den jungen Mann, der auf einem Gurtbett im Todeskampf lag. Sie erstickte die Kohlenglut, stieß das Fenster auf, so dass frische Luft hereinströmte – und der Verbannte war gerettet.
Nachdem Lisbeth den jungen Mann wie einen Kranken gebettet hatte und er eingeschlafen war, schaute sie sich in der Stube um. Also Armut war die Ursache zum Selbstmord gewesen! Das sah sie an der völligen Kahlheit der Dachkammer, in der nichts stand als ein elender Tisch, das Gurtbett und zwei Stühle.
Auf dem Tisch lag ein Blatt Papier. Sie las:
»Man soll bei niemandem die Schuld an meinem Tode suchen; die Erklärung für meinen Selbstmord liegt in Kosciuszkos Ausruf: Finis Poloniae! Als Großneffe eines ruhmvollen Generals Karls XII. wollte ich nicht betteln gehen. Meine schwache Gesundheit verbietet mir den Dienst in der Armee. Gestern sind die hundert Taler, mit denen ich von Dresden nach Paris gekommen bin, zu Ende gegangen. Fünfundzwanzig Francs liegen im Tischkasten für die Miete, die ich dem Wirt schulde. Da ich keine Eltern mehr habe, gibt es niemanden, der an meinem Tode Anteil nehmen könnte. Ich bitte meine Landsleute, der französischen Regierung keine Vorwürfe zu machen. Ich habe mich nicht als Verbannter zu erkennen gegeben. Ich habe um nichts gebeten und habe mit keinem andern Verbannten verkehrt. Niemand in Paris weiß von meiner Existenz. Mit mir stirbt der Letzte derer von Steinbock. Ich bin geboren zu Preli in Livland.
Stanislaus Graf Steinbock.«
Lisbeth war tiefgerührt von der Ehrlichkeit des Lebensmüden, der noch daran gedacht hatte, seine Miete zu bezahlen. Sie öffnete den Tischkasten; drin lagen wirklich fünf Fünffrancsstücke.
»Armer junger Mensch!« rief sie aus. »Niemand ist auf der Welt, der sich seiner annähme!«
Sie stieg in ihre Wohnung hinunter und kam gleich darauf wieder mit ihrer Arbeit zurück, die sie in der Dachkammer fortsetzte, wobei sie beständig ein wachsames Auge auf den schlafenden livländischen Edelmann hatte.
Man kann sich leicht vorstellen, wie erstaunt dieser war, als er beim Erwachen eine Frau an seinem Bette sitzen sah. Er glaubte zu träumen. Während die alte Jungfer so dasaß und an einer goldenen Achselschnur für eine Uniform arbeitete, hatte sie sich fest vorgenommen, sich dieses schlafenden jungen Mannes, der ihr gefiel, anzunehmen. Als der junge Graf wach geworden war, sprach ihm Lisbeth Mut zu und fragte ihn aus, um dadurch zu erfahren, womit er wohl seinen Lebensunterhalt verdienen könne. Stanislaus erzählte seinen Lebenslauf und fügte hinzu, er habe ehedem seine Anstellung seinen anerkannten künstlerischen Fähigkeiten zu verdanken gehabt. Zur Bildhauerkunst hätte er von jeher eine Neigung, aber die Studienzeit wäre für einen mittellosen Menschen allzulang. Auch sei er augenblicklich viel zu schwach zur Ausübung eines Handwerks oder gar der Bildhauerkunst im großen Stile. Das alles war unverständlich für Lisbeth Fischer. Sie erwiderte dem Unglücklichen, Paris habe so viel Hilfsquellen, dass sich ein Mensch mit einigem guten Willen hier unbedingt durchschlagen müsse. Tatkräftige Menschen gingen hier nie unter, wenn sie nur einen gewissen Grundstock von Ausdauer mitbrächten.
»Ich bin nur ein armes Mädel vom Lande«, sagte sie zum Schluss, »aber trotzdem habe ich mir hier eine gewisse Unabhängigkeit geschaffen. Hören Sie mich an! Wenn Sie ernstlich arbeiten wollen: ich habe einige Ersparnisse und will Ihnen jeden Monat das zum Leben nötige Geld borgen, aber zu einem geregelten Leben, nicht zum Bummeln und Liederlichsein. Man kann in Paris für einen Franc zu Mittag essen, und Ihr Frühstück bereite ich Ihnen jeden Morgen mit dem meinen zusammen. Auch will ich Ihr Zimmer einrichten und Ihnen die Studiengelder bezahlen, soweit Sie es für nötig erachten. Sie geben mir einen regelrechten Schuldschein über die Summe, die ich Ihnen leihe, und wenn Sie reich geworden sind, zahlen Sie mir alles zurück. Wenn Sie aber nicht arbeiten, dann betrachte ich mich als zu nichts verpflichtet und lasse Sie im Stich!«
»Ach«, rief der Unglückliche, der die Schauer des Todes noch in sich fühlte, »wie recht haben die Verbannten aller Länder, wenn sie sich nach Frankreich sehnen wie die im Fegefeuer schmachtenden Seelen nach dem Paradiese! Man zeige mir ein anderes Land, wo sich solche Hilfsbereitschaft, ein solcher Edelmut der Herzen überall findet, selbst in einer Dachkammer wie hier! Meine gütige Wohltäterin, Sie werden alles, alles für mich sein! Ich bin Ihr Sklave! Seien Sie meine Freundin!«
Er sagte das in jener innigen Überschwänglichkeit, die den Slawen eigentümlich ist und ihnen mit Unrecht als unterwürfige Falschheit ausgelegt wird.
»Nein, nein, dazu bin ich zu eifersüchtig, ich würde Sie nur unglücklich machen. Aber ein guter Kamerad will ich Ihnen sein!« erwiderte Lisbeth.
»Oh, wenn Sie wüssten, wie ich mich nach einem Wesen, das sich um mich kümmert – und sei es auch ein Tyrann –, gesehnt habe, wenn ich einsam durch dieses weite Paris irrte!« sagte der Pole. »Sibirien erschien mir begehrenswerter, das Land, wohin mich der Zar geschickt hätte, wenn ich zurückgekehrt wäre ... Seien Sie mein guter Stern! Ich will arbeiten. Ich will mich bessern. Ich bin ja kein schlechter Mensch!«
»Wollen Sie alles tun, was ich verlangen werde?« fragte Lisbeth.
»Ja!«
»Gut, so nehme ich Sie an Kindes Statt an!« erklärte sie heiter. »Da hätte ich nun einen Jungen, der eben vom Tode auferstanden ist. Fangen wir an! Ich gehe jetzt, meine kleinen Einkäufe zu machen. Während dieser Zeit ziehen Sie sich an, und wenn ich mit dem Besenstiel an die Decke klopfe, kommen Sie herunter, und wir werden dann zusammen frühstücken!«
Am andern Tage erkundigte sich Lisbeth Fischer bei den Fabrikanten, für die sie arbeitete, über den Bildhauerberuf. Nach umständlichen Erkundigungen fand sie schließlich das Atelier von Florent & Chanor, ein Spezialhaus, wo man kostbare Bronzen und silbernes Luxusgerät herstellte. Dorthin brachte sie Steinbock mit der Bitte, ihn als Lehrling anzunehmen. Man fand diese Anforderung sonderbar und erklärte ihr, dass bei Florent & Chanor nur nach den Entwürfen berühmter Künstler gearbeitet, dass dort aber nicht gelehrt werde. Trotzdem gelang es der Ausdauer und der Hartnäckigkeit der alten Jungfer, ihren Schützling daselbst als Ornamentzeichner unterzubringen. Bald konnte Steinbock Ornamente modellieren und erfand neue dazu. Die nötige Begabung dafür hatte er. Nach fünf Monaten Lehrzeit als Ziseleur machte er die Bekanntschaft des berühmten Stidmann, des ersten Künstlers des Hauses Florent. Nach anderthalb Jahren übertraf Stanislaus seinen Lehrer; aber wiederum ein Jahr später waren die Ersparnisse, die das alte Fräulein in sechzehn Jahren Franc um Franc zurückgelegt hatte, vollkommen verbraucht. Zweitausendfünfhundert Francs in Gold, für die sie sich eine Leibrente hatte kaufen wollen! Und was hatte sie dafür? Den Wechsel eines Polen. Es blieb ihr jetzt nichts anderes übrig, als wieder so zu arbeiten wie in ihren jüngeren Jahren, um die Ausgaben ihres Schützlings weiterhin zu bestreiten. Da sie aber an Stelle ihrer Goldstücke nur noch ein bloßes Stück Papier in den Händen hatte, verlor sie doch den Kopf und wandte sich an Rivet, der seit fünfzehn Jahren der Berater und Freund seiner ersten und geschicktesten Arbeiterin war. Als Herr und Frau Rivet von diesem Abenteuer erfuhren, kanzelten sie die arme Lisbeth gehörig ab, nannten sie verrückt und schimpften auf die polnischen Verbannten, deren unnütze Umtriebe, von neuem ein unabhängiges Volk zu werden, nur dem Handel schadeten. Sie brachten Lisbeth am Ende so weit, dass sie – wie man kaufmännisch sagt – eine Sicherheit haben wollte.
»Die einzige Sicherheit, die der Kerl Ihnen bieten könnte, ist seine eigene Person!« meinte Herr Rivet.
Achill Rivet war nämlich Handelsrichter.
»Und das ist kein Spaß für einen Ausländer«, fuhr er fort. »Ein Franzose sitzt fünf Jahre im Schuldgefängnis; dann lässt man ihn laufen, allerdings ohne dass er seine Schulden bezahlt. Dann gibt es eben keinen weiteren Zwang als sein Gewissen. Na, und das schläft meistens. Aber ein Ausländer bleibt lebenslänglich in Haft. Geben Sie mir Ihren Wechsel. Wir übertragen diesen pro forma auf meinen Buchhalter. Der klagt ihn ein und setzt sich in Besitz eines Haftbefehls gegen Steinbock. Diese Urkunde wird dann auf Ihren Namen umgeschrieben, und so haben Sie immer eine Waffe gegen Ihren Polen in den Händen.«
Das alte Fräulein ließ die Gesetze walten und sagte ihrem Schützling, er solle sich wegen dieses Schrittes keine Sorge machen; sie habe das nur getan, um einen Wucherer, der ihnen eine Summe Geldes vorgestreckt habe, zufriedenzustellen. Dieser Vorwand entstammte wiederum dem erfinderischen Geiste des Handelsrichters. Der rechtsunkundige Künstler, in blindem Vertrauen zu seiner Wohltäterin, steckte sich mit der gerichtlichen Zustellung seine Pfeife an. Er war Raucher wie alle Leute, die ihre Sorgen oder ihre Tatenlust einschläfern wollen.
Eines schönen Tages zeigte Rivet Fräulein Fischer ein Schriftstück und sagte zu ihr: »So, nun haben Sie Ihren Steinbock an der Strippe und können ihn binnen vierundzwanzig Stunden für den Rest seines Lebens in Clichy einquartieren!«
Der hochehrbare Handelsrichter empfand an diesem Tage die Befriedigung einer schlimm-guten Tat. Die Wohltätigkeit hat in Paris so viele Erscheinungsformen, dass dieser merkwürdige Ausdruck wirklich auf eine ihrer Spielarten passt. Nachdem der Pole im Netze dieses kaufmännischen Verfahrens verstrickt war, handelte es sich um das Eintreiben des Geldes. Der Biedermann hielt Steinbock nämlich für einen Gauner. Mitleid, Ehrlichkeit, Poesie waren in den Augen dieses Geschäftsmannes dummes Zeug.
Im Interesse des armen alten Fräuleins, das, wie er sich ausdrückte, von dem Polen gehörig hineingelegt worden war, suchte nun Rivet die reichen Fabrikbesitzer auf, bei denen der Künstler gearbeitet hatte. Bekanntlich hat Stidmann unter der Beihilfe hervorragender Pariser Goldschmiede die französische Kleinkunst zu der hohen Vollendung gebracht, in der sie jetzt steht und die es ihr erlaubt, mit den Florentinern und den Künstlern der Renaissance zu wetteifern. Stidmann befand sich gerade in Chanors Privatkontor, als Rivet eintrat, um sich nach einem polnischen Flüchtling, einen »gewissen Steinbock«, zu erkundigen.
»Einen gewissen Steinbock? Wen meinen Sie damit?« spottete Stidmann. »Vielleicht den jungen Polen, der bei mir gelernt hat? Wissen Sie, das ist ein großer Künstler! Man sagt von mir, ich sei ein Teufelskerl. Aber dieser arme Junge weiß noch gar nicht, dass Götterkraft in ihm steckt!«
»So!« meinte Rivet befriedigt und sagte dann: »Obwohl Sie nicht besonders höflich zu einem Manne sprechen, der die Ehre hat, Handelsrichter zu sein, so ...«
»Verzeihen Sie gütigst, Herr Handelsrichter!« unterbrach ihn Stidmann, indem er militärisch grüßte.
»... so bin ich doch sehr erfreut über das, was Sie mir da sagen«, fuhr der Richter fort. »Sie meinen also, der junge Mann könnte Geld verdienen?«
»Na und ob«, meinte der alte Chanor, »aber arbeiten muss er. Wäre er bei uns geblieben, so hätte er schon einen ganzen Haufen verdient. Aber, wie Sie wissen, verabscheuen die Künstler das Gebundensein.«
»Sie sind sich ihres Wertes und ihrer Würde bewusst«, meinte Stidmann. »Ich kann es dem jungen Steinbock nicht verdenken, dass er versucht, sich auf eigene Faust einen Namen zu machen und ein berühmter Mann zu werden. Das ist sein gutes Recht! Allerdings habe ich durch seinen Weggang viel Schaden.«
»Da haben wir den Dünkel der jungen Leute!« rief Rivet. »Sie können nichts erwarten! Sie sollten sich erst ein Vermögen erwerben und dann dem Ruhme nachstreben.«
»Man verdirbt sich beim Zusammenscharren der Taler die Hände«, bemerkte Stidmann. »Der Ruhm ist des Künstlers Glück!«
»Ja, ja«, meinte Chanor zu Rivet, »man kann sie nicht anbinden ...«
»Sie würden den Strick zerreißen!« lachte Stidmann.
»Ach was«, sagte Chanor, indem er Stidmann ansah, »alle diese Menschen haben ebenso viele Launen wie Begabung. Entsetzliche Verschwender! Sie halten sich Weiber, werfen das Geld zum Fenster hinaus und haben dann keine Zeit zum Arbeiten. Sie vernachlässigen ihre Aufträge, und wir müssen uns an Handwerker wenden, die zwar nicht soviel können, aber doch dabei reich werden. Dann kommen jene und jammern über die schlechten Zeiten. Wenn sie fleißig wären, besäßen sie Berge von Gold.«
»Alter Schlaumeier!« scherzte Stidmann. »Sie kommen mir vor wie jener Buchhändler vor der Revolution, der einmal gesagt hat: ›Ja, ja, wenn ich die Herren Montesquieu, Voltaire und Rousseau, diese alten Faulenzer, in meinen Dachkammern einlogieren und ihre Hosen in meinen Kleiderschrank einschließen könnte, was für nette kleine Bücher würden mir die Kerle schreiben und wie steinreich könnte ich werden!‹ Wenn man Kunstwerke wie Nägel schmieden könnte, dann würden die Dienstmänner welche machen. Geben Sie mir rasch tausend Taler, und seien Sie dann still!«
Der gute Rivet war entzückt. Fräulein Fischer pflegte jeden Montag bei ihm Mittag zu essen. Als er nach Hause kam, war sie bereits da.
»Wenn Sie Ihren Polen dazu bringen, ordentlich zu arbeiten«, berichtete er ihr, »dann haben Sie mehr Glück als Verstand in dieser Angelegenheit; dann wird er Ihnen alles, Zinsen, Unkosten und Kapital zurückzahlen. Der Mann hat Talent und kann sich seinen Lebensunterhalt schon verdienen. Aber schließen Sie seine Pantalons und seine Schuhe ein und lassen Sie ihn ja nicht den Frauenzimmern in die Hände fallen! Halten Sie ihn kurz! Ohne diese Vorsichtsmaßregeln wird Ihr Künstler bummeln gehen – und wenn Sie wüssten, was so ein Künstler unter Bummeln versteht! Schauderhaft, höchst schauderhaft! Man hat mir soeben erzählt: einen Tausendtalerschein verhaut so ein Individuum an einem Tag!«
Dieser Zwischenfall übte auf das häusliche Leben Steinbocks und Lisbeths schreckliche Wirkung aus. Die Wohltäterin tauchte das tägliche Brot des armen Verbannten in den bitteren Wermut ihrer Vorhaltungen. Aus der guten Mutter wurde eine böse Stiefmutter, die das arme Kind schulmeisterte, quälte und ihm vorwarf, nicht rasch genug zu arbeiten und sich überhaupt viel zu Schwieriges vorgenommen zu haben. Sie vermochte an den Wert der Modelle aus rotem Wachs, dieser Figürchen, Ornamententwürfe und Skizzen nicht zu glauben. Mitunter aber bereute sie wieder ihre Härte und suchte deren Spuren durch doppelte Sorgfalt, Zärtlichkeit und kleine Aufmerksamkeiten zu verwischen. Wenn der junge Mann eben über seine Abhängigkeit von dieser Megäre gestöhnt und über die Herrschaft dieser Bäuerin aus den Vogesen gejammert hatte, war er dann wieder beglückt von Lisbeths Schmeicheleien und ihrer mütterlichen Fürsorge, die sich freilich nur mit seinem körperlichen und materiellen Wohl beschäftigte. Er war wie eine Frau, die sich von ihrem Manne für die Liebkosungen einer vorübergehenden Versöhnung eine ganze Woche lang schlecht behandeln lässt. Lisbeth vergewaltigte seine Seele vollständig. Die Herrschsucht, die bisher nur als Keim im Herzen der alten Jungfer geruht hatte, entwickelte sich alsbald rasend schnell. Jetzt konnte sie ihrem Hochmut und ihrem Tätigkeitstriebe Genüge tun, denn jetzt gehörte ihr ein Geschöpf, das sie schelten, leiten, liebkosen und beglückwünschen konnte, ohne irgendwelche Nebenbuhlerschaft fürchten zu müssen. So kam das Gute wie das Böse ihrer Natur zur Geltung. Wenn sie den beklagenswerten Künstler manchmal peinigte, so hatte sie dann wieder etwas unendlich Zartes, das man der Anmut einer Feldblume vergleichen konnte. Sie freute sich, dass er nichts entbehrte, und hätte ihr Leben gern für ihn hingegeben. Wie alle Romantiker übersah der arme Junge das Unrecht und die Fehler des alten Fräuleins. Übrigens hatte ihm Lisbeth zur Entschuldigung ihrer Schroffheit ihren Lebenslauf erzählt. So gedachte er nur immer ihrer Wohltaten.
Eines Tages war Lisbeth außer sich darüber, dass Stanislaus statt zu arbeiten bummeln gegangen war, und machte ihm eine Szene.
»Du gehörst mir«, sagte sie zu ihm, »und wenn du ein anständiger Mensch bist, solltest du versuchen, das, was du mir schuldest, so bald als möglich abzuzahlen.«
Der Edelmann wurde bleich.
»Bei Gott«, fuhr sie fort, »bald bleiben uns zum Leben nur noch die fünfzehn Groschen, die ich armes Mädchen täglich verdiene.«
Die beiden armen Menschen erhitzten sich im Wortgefecht und standen einander feindselig gegenüber. Zum erstenmal machte der arme Künstler seiner Wohltäterin Vorwürfe, dass sie ihn vom Tode errettet habe, um ihm ein Sträflingsleben zu bereiten, das schlimmer sei als das ewige Nichts, in dem man wenigstens seinen Frieden habe. Das Wort »Flucht« entschlüpfte ihm.
»Fliehen!« schrie die alte Jungfer. »So hat Rivet also doch recht gehabt!«
Und kategorisch erklärte sie dem Polen, wie man ihn binnen vierundzwanzig Stunden für den Rest seiner Tage ins Gefängnis sperren könne. Das war ein Faustschlag. Steinbock verfiel in den düstersten Trübsinn und in vollkommene Schweigsamkeit.
In der nächsten Nacht hörte Lisbeth abermals Selbstmordvorbereitungen. Schnell stieg sie die Treppe zu ihres Schützlings Wohnung hinauf und lieferte ihm den Haftbefehl und eine rechtsgültige Quittung aus.
»Ach, mein Sohn, verzeihe mir!« bat sie mit feuchten Augen. »Werde glücklich! Verlasse mich! Ich quäle dich zu sehr. Aber versprich mir wenigstens, dass du manchmal an das arme Ding zurückdenken wirst, das dich dem Leben wiedergewonnen hat! Ach, du bist ja selber die Ursache all meiner Abscheulichkeit. Ich könnte sterben: was würde dann aus dir ohne mich? Das ist es ja, warum ich es nicht erwarten kann, dich in der Lage zu sehen, leicht verkäufliche Gegenstände herzustellen. Für mich will ich mein Geld doch nicht zurückhaben. Ich habe nur Angst vor deiner Trägheit, die du Träumerei nennst, und vor deinen Plänen, denen du in den Himmel starrend stundenlang nachhängst. Ich will doch nur, dass du dich an eine regelmäßige Tätigkeit gewöhnst.«
Sie sagte das in einem Tone und mit einem Blicke, die im ! Verein mit ihrer Haltung einer Flut von Tränen den hochgesinnten Künstler aufs tiefste rührten. Er drückte seine Wohltäterin ans Herz und küsste sie auf die Stirn.
»Behalte deine Schriftstücke nur!« meinte er beinahe heiter. »Warum willst du mich erst nach Clichy bringen? Bin ich hier nicht ebenso gefangen durch die Dankbarkeit?«
Dieser Zwischenfall in ihrem gemeinsamen Leben hatte im Laufe eines halben Jahres in dreifacher Weise auf Steinbocks Schaffen gewirkt. Er hatte das Petschaft gemacht, das sich in Hortenses Händen befand, dann die Gruppe; die der Antiquitätenhändler ausstellte, und endlich eine wundervolle Standuhr, die bis auf die äußere Herrichtung vollendet war. Diese Uhr verkörperte die zwölf Stunden wundervoll durch zwölf Frauengestalten, die in einem so rasend tollen Kreistanz dahinwirbelten, dass drei kleine Amoretten, über Blumen und Früchte nachstürmend, gerade nur noch die letzte, die Mitternachtsstunde, erhaschten. Ihr Gewand zerriss in den Händen des kecksten der kleinen Wichte. Die Uhr ruhte auf einem runden Postament mit feiner Ornamentik, die allerhand phantastische Tiere zeigte. Das Zifferblatt lag in dem gähnenden Rachen eines Ungeheuers. Jede Frauengestalt trug ein Sinnbild, das sehr glücklich auf die Beschäftigung der einzelnen Stunde hindeutete.
Die seltsame Zuneigung Lisbeths zu ihrem Livländer war leicht begreiflich; sie wollte ihn wirklich glücklich machen. Aber er welkte und siechte in seiner Dachkammer dahin. Die Lothringerin bewachte ihren Schützling mit der Zärtlichkeit einer Mutter, der Eifersucht einer Gattin und der Schlauheit eines Drachen. Es gelang ihr, ihm jegliche Torheit, jegliche Zerstreuung unmöglich zu machen, indem sie ihn stets ohne Geldmittel ließ. Sie wollte ihr Opfer, ihren Gefährten ganz für sich allein und erzwungen treu haben. Sie sah nicht ein, wie grausam und unvernünftig das war, denn sie selber war an das Ertragen jedweder Art ven Enthaltsamkeit gewöhnt. Sie liebte ihn so ideal, dass sie auf seine leibliche Liebe verzichtete, und doch dabei so egoistisch, dass sie ihn keiner andern Frau gönnte. Sie vermochte sich nicht damit zu begnügen, ihm nur die Mutter zu sein, und doch hielt sie sich selber für verrückt, wenn sie mitunter an eine andere Möglichkeit dachte.
Dieser Zwiespalt, die wilde Eifersucht und das Glück, einen Menschen ihr eigen zu nennen, dies alles erschütterte ihr ganzes Wesen bis in die Tiefen. Seit vier Jahren wirklich verliebt, nährte sie die törichte Hoffnung, der widerspruchsvolle und aussichtslose Zustand könne von Dauer sein. Ihr Starrsinn musste den Untergang dessen herbeiführen, den sie ihren Sohn nannte. Der Kampf in ihr zwischen Gefühl und Verstand machte sie ungerecht und herrisch. Sie rächte sich an dem jungen Manne dafür, dass sie weder jung, schön noch reich war. Jedesmal freilich, wenn sie sich so gerächt hatte, sah sie ihr Unrecht ein und war dann von unendlicher Demut und Zärtlichkeit. Sie erkannte immer erst dann, dass es ihre Pflicht war, ihrem Idol ein Opfer zu bringen, wenn sie ihm ihre Macht durch Folterungen hatte fühlen lassen. In den Augen dieses unglücklichen jungen Träumers, der so hochfliegende Pläne hegte und so sehr zum Müßiggange neigte, konnte man lesen, wie öde und leer ihm sein Leben durch die Schuld seiner Beschützerin geworden war. Wähnt man nicht auch in den Augen der Löwen hinter den Gittern im Zoologischen Garten eine Wüstenlandschaft zu sehen? Die Zwangsarbeit, die Lisbeth von ihm verlangte, befriedigte seine Künstlersehnsucht nicht. Seine Missstimmung wandelte sich in körperliche Krankheit, und er siechte dahin. Er wusste nicht, wie er sich das Geld zu den ihm notwendigen Dummheiten verschaffen könne. Manchmal, wenn die Energie in ihm wach wurde und das Bewusstsein seines Elends seine Verzweiflung noch erhöhte, stand er Lisbeth gegenüber wie etwa der verschmachtende Wanderer in wasserarmer Gegend vor einem Salzwasserquell. Sie aber genoss die bitteren Früchte der Armut und Zurückgezogenheit wie Freuden. Mit Angst dachte sie daran, dass ihr die erste beste Leidenschaft ihren Sklaven entführen könne. Manchmal bereute sie sogar, diesen Träumer durch Tyrannei und Vorwürfe gezwungen zu haben, ein großer Meister der Kleinkunst zu werden, und ihm damit den Weg gezeigt zu haben, wie er einmal ohne sie weiterkommen könne.
Als der Staatsrat das Opernhaus betreten wollte, fand er zu seinem Erstaunen den Musentempel in der Rue le Peletier unerleuchtet. Nirgends waren Schutzleute, Bediente usw. zu erblicken; nirgends das sonst andrängende Publikum. Er sah sich nach einem Anschlag um und las auf dem weißen Zettel:
»Wegen Unpässlichkeit von Mademoiselle Josepha Mira fällt die heutige Vorstellung aus.«
Sofort stürzte er zu Josepha, die wie alle Mitglieder der Oper in der Nähe, in der Rue Chauchat, wohnte.
»Zu wem wollen Sie, mein Herr?« fragte der Pförtner zu Hulots großem Erstaunen.
»Kennen Sie mich denn nicht mehr?« fragte der Baron. Er fing an, unruhig zu werden.
»Im Gegenteil, gerade weil ich die Ehre habe, den Herrn Baron zu kennen, erlaube ich mir die Frage.«
Den Baron durchzuckte es eiskalt.
»Was ist geschehen?« fragte er.
»Wenn der Herr Baron in Fräulein Miras Wohnung hinaufginge, so würde er daselbst Fräulein Heloise Brisetout antreffen, Herrn Bixiou, Herrn Leon von Lora, Herrn Lousteau, Herrn von Vernisset, Herrn Stidmann und mehrere nach Patschuli duf- tende Damen. Man hält Einzugsschmaus ...«
»So? Aber wo ist denn ...?«
»Fräulein Mira, Herr Baron? Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen darf.«
Der Baron drückte dem Manne einen Taler in die Hand.
»Hm! Sie wohnt jetzt in der Rue de la Ville-l'Evêque, in einem Haus, das ihr der Herzog von Hérouville eingerichtet hat«, berichtete der Portier im Flüstertone.
Nachdem er sich noch nach der Nummer dieses Hauses erkundigt hatte, nahm der Baron eine Droschke und war alsbald vor einem jener hübschen neumodischen Häuser angelangt, die bis in die Einzelheiten den höchsten Luxus offenbaren.
Der Baron wurde in seinem blauen Rocke, der weißen Krawatte, der weißen Weste, seinem Nanking-Beinkleid, den Lackstiefeln und dem steif gestärkten Hemd von dem Hüter dieses neu geschaffenen Paradieses für einen verspäteten Gast gehalten. Sein vornehmes Äußere, sein Gang, alles rechtfertigte diese Annahme. Auf das Läuten des Pförtners erschien ein Diener im Treppenhaus. Selbiger, ebenso neu wie das Haus, ließ den Baron eintreten, da dieser ihm im Befehlstone und mit einer Imperatorengeste auftrug: »Diese Karte Fräulein Josepha!«
Unwillkürlich, in Armesünderstimmung, blickte sich Hulot um und stellte fest, dass die Ausstattung dieses über und über mit teuren Blumen geschmückten Empfangszimmers gut viertausend Taler gekostet haben mochte. Der Diener kam zurück und bat ihn, einstweilen Platz zu nehmen; die Herrschaften würden sogleich vom Tische aufstehen und den Kaffee hier einnehmen.
Der Baron hatte den Luxus des Empire miterlebt, der gewiss verschwenderisch war und dessen Schöpfungen, so kurz ihre Zeit auch bemessen war, doch fabelhafte Summen gekostet hatten. Trotzdem stand er wie geblendet vor diesem Salon, dessen drei Fenster nach einem wahren Feengarten zu lagen. Dabei bewunderte er nicht nur das Seltene, die Goldpracht, die kostbaren Skulpturen im Stile der Pompadour und die wundervollen Stoffe – das alles konnte ja schließlich auch der erste beste Kommerzienrat für Berge von Gold bestellen und besitzen –, sondern noch etwas anderes, etwas, was nur Fürsten finden, aussuchen, bezahlen und schenken können: zwei Gemälde von Greuze, zwei von Watteau, zwei Porträts von van Dyck, zwei Landschaften von Ruisdael, zwei von Guaspre, einen Rembrandt und einen Holbein, einen Murillo und einen Tizian, zwei Teniers und zwei Metsu, einen van Huysum und einen Abraham-Mignon, zusammen also eine Galerie im Werte von vielleicht zweihunderttausend Francs. Die Rahmen standen den Bildern nicht nach.
»Schau, schau! Du kapierst also, Kerlchen!« hörte er plötzlich Josepha hinter sich sagen.
Sie war auf den Fußspitzen durch eine Tapetentür auf den dicken Persern herangekommen und ertappte nun ihren Verehrer in der höchsten Verwirrung. Ihm rauschte es in den Ohren. Er hörte die Totenglocke des Unglücks.
Josepha, in Weiß und Gelb gekleidet, hatte sich für dieses Fest so geschmückt, dass sie selbst inmitten dieses unsinnigen Luxus wie die Perle im Golde glänzte.
»Famose Bilder, nicht?« lachte sie. »Ja, darin steckt des Herzogs ganzer Gewinn aus Aktien, die er in einem günstigen Moment verkauft hat. Er ist nicht dumm, mein kleiner Herzog! Siehst du, die großen Herren aus der guten alten Zeit machen jetzt aus Kohle Gold. Vor Tische brachte mir der Notar den Kaufvertrag von all dem Klimbim zum Unterschreiben; die Quittung lag gleich dabei. Es gibt noch Gentlemen! Das ist dein Pech! Na, Alterchen, du bist hiermit eingeladen, aber nur unter der Bedingung, dass du auf der Stelle zwei Flaschen Schampus trinkst. Damit kommst du so ungefähr auf das augenblickliche Niveau der andern da drüben. Siehst du, Freundchen, wir sind hier alle sehr in Anspruch genommen. Darum musste es in der Oper schon ein ›Wegen Unpässlichkeit fällt die heutige Vorstellung aus‹ geben. Der Direktor ist total beschwipst. Er quakt bereits ...«
»Josepha!« stöhnte der Baron.
»Eine Auseinandersetzung? Ach, das ist fad!« unterbrach sie ihn übermütig. »Siehst du, die sechshunderttausend Francs, die dieses Haus mit der Einrichtung gekostet hat, die besitzt du nun einmal nicht. Und eine Verschreibung auf dreißigtausend Francs pro Jahr, wie sie mir neulich der Herzog in einer Bonbonniere mitgebracht hat, die kannst du mir auch nicht stiften! Übrigens war das eine sehr nette Idee!«
»Du bist in den Grund und Boden verdorben!« knirschte der Staatsrat, der in diesem Augenblicke seiner Wut die Brillanten seiner Frau durch Simili ersetzt hätte, nur um noch vierundzwanzig Stunden an der Stelle des Herzogs von Hérouville sein zu dürfen.
»Das Verdorbensein, das ist doch mein Metier!« spottete sie. »Mensch, nimm die Sache nur nicht tragisch! Warum hast du die Aktien nicht gehabt? Armer lieber angestrichener Kater! Du solltest mir dankbar sein, dass ich dich aus dem Garne lasse, ehe du die Zukunft deiner Frau und die Mitgift deiner Tochter mit mir verschwendest! Großer Gott, du weinst! Der König stirbt! Es lebe der König!«
Indem sie mit einer theatralischen Gebärde deklamierte: »Meine Laura geht vorüber, meine Laura kennt mich nicht!« wandte sie sich weg.
Durch die halboffene Tür drang in diesem Augenblicke die strahlende Lichtflut, das Crescendo des Lärms und die Stimmung eines raffinierten Bacchanals.
Die Sängerin blickte sich in der Tür noch einmal nach Hulot um, und als sie ihn wie angewurzelt stehen sah, trat sie nochmals zu ihm und sagte:
»Baron, den Plunder in der Rue Chauchat habe ich der kleinen Brisetout vermacht. Falls Sie Ihre Hausmütze, Ihren Stiefelknecht, Ihre Leibbinde und ihre Bartwichse dort abholen wollen – ich habe den Befehl gegeben, sie Ihnen auszuhändigen.«
Dieser abscheuliche Hohn hatte die Wirkung, dass der Baron aus dem Salon stürzte, wie es Lot aus Gomorra getan haben mag, aber ohne sich – wie Lots Weib es tat – noch einmal umzusehen. Auf dem Heimwege rannte er wie ein Besessener und redete vor sich hin. Zu Hause traf er seine Familie noch genauso friedlich beim Whist um die Groschen wie vor seinem Weggange.
Als Adeline ihren Mann erblickte, ahnte sie sofort ein schreckliches Unglück, irgend etwas Unehrenhaftes. Sie reichte Hortense ihre Karten hin und zog Hektor in den kleinen Salon, in dem ihr Crevel vor kurzem Schmach und Unglück vorhergesagt hatte.
»Was hast du?« fragte sie erschreckt.
»Verzeih mir; ich muss dir diese Gemeinheit erzählen.«
Zehn Minuten lang ließ er seinem Zorn freien Lauf.
»Ja, mein Freund«, sagte die arme Frau heldenmütig, »solche Geschöpfe kennen die Liebe nicht, die reine und hingebende Liebe, wie du sie verdienst. Wie konntest du nur hoffen, wo du doch sonst so scharfsinnig bist, gegen Millionen anzukämpfen?«
»Geliebte Adeline!« rief der Baron aus, indem er seine Frau umarmte und ans Herz drückte. Sie träufelte ihm Balsam in die offene Wunde seiner Eitelkeit. »Wenn der Herzog von Hérouville sein Vermögen verlöre, würde sich Josephas Wahl zwischen ihm und mir ganz gewiss nicht für ihn entscheiden«, sagte der Baron.
»Lieber Freund«, begann Adeline, indem sie nochmals ihre letzte Kraft zusammennahm, »wenn du unbedingt eine Geliebte haben musst, warum hältst du dir dann nicht wie Crevel solche, die nicht teuer sind, aus einem Stande, wo sie mit wenigem zufrieden sind? Das wäre nur unser aller Vorteil. Ich verstehe dein Bedürfnis, nur deine Eitelkeit begreife ich nicht!«
»Was bist du für eine vortreffliche Frau!« rief er aus. »Ich bin ein alter Narr und verdiene nicht, einen Engel wie dich zur Gefährtin zu haben.«
»Ich bin einfach die Josephine meines Napoleons«, erwiderte sie in leiser Melancholie.
»Josephine reichte nicht an dich heran!« erklärte er. »Komm, ich will mit meinem Bruder und meinen Kindern Whist spielen. Ich werde mich meiner Vaterpflichten erinnern und meine Hortense verheiraten. Ich will brav werden!«
Die arme Adeline war so gerührt von dieser Güte, dass sie sagte: »Dies Geschöpf muss einen recht schlechten Geschmack haben, wenn sie einen anderen, wer es auch sei, meinem Hektor vorzieht. Ich würde nicht für alles Gold der Erde auf dich verzichten! Wie kann man dich lassen, wenn man das Glück hat, von dir geliebt zu werden!«
Der Blick, mit dem der Baron für die Schwärmerei seiner Frau dankte, bestärkte sie in ihrem Glauben, dass Sanftmut und Ergebenheit die mächtigsten Waffen der Frau seien. Hierin täuschte sie sich. Wenn edle Gefühle übertrieben werden, können sie die gleiche Wirkung wie die größten Laster haben. Bonaparte ist Kaiser geworden, weil er auf das Volk schießen ließ, zwei Schritt von dem Platze entfernt, wo Ludwig der Sechzehnte Thron und Kopf verlor, weil er das Blut eines Herrn Sauce nicht vergießen wollte.
Nachdem Hortense mit Steinbocks Petschaft unter ihrem Kopfkissen geschlafen hatte, um sich auch nachts nicht davon zu trennen, stand sie am folgenden Tage frühzeitig zum Ausgehen angekleidet da und ließ ihren Vater bitten, zu ihr in den Garten zu kommen, sobald er seine Toilette beendet habe. Es war gegen halb zehn Uhr, als Vater und Tochter Arm in Arm das Seineufer entlang über den Pont-Royal nach der Place du Carrousel gingen.
»Wir wollen so tun, als gingen wir spazieren, Vater!« schlug Hortense vor, als sie durch das Tor auf den Riesenplatz kamen.
»Spazierengehen? Hier?« fragte der Vater spöttisch.
»Man kann ja glauben, wir gingen ins Museum. Siehst du dort hinten ...«, dabei zeigte sie auf die Holzbuden, die sich an den Häusern hinzogen, die rechtwinklig zur Rue du Doyenné lagen, »dort hinten sind Raritäten- und Bilderläden!«
»Deine Tante Lisbeth wohnt dort.«
»Ich weiß wohl; aber sie darf uns nicht sehen.«
»Was hast du eigentlich vor?« fragte der Baron, als sie noch ungefähr dreißig Schritte von den Fenstern der Frau Marneffe entfernt waren, an die er sich plötzlich erinnerte.
Hortense hatte ihren Vater vor die Auslage eines der Läden an der Ecke des Häuservierecks geführt, das sich längs der Galerien des alten Louvre ausbreitet und dem Hotel de Nantes gegenüberliegt. Der Baron blieb draußen und vertrieb sich die Zeit damit, nach den Fenstern der hübschen kleinen Frau hinüberzuschauen, die tags zuvor ihr Bild in das Herz des alten Lebemannes eingeschmuggelt hatte, just um die Wunde zu heilen, die er so bald darauf empfangen sollte. Er war somit auf dem besten Wege, den Rat seiner Frau zu befolgen.
Halten wir es fortan mit den kleinen Bürgerfrauen! sagte er zu sich selbst, indem er Frau Marneffes Reize vor seiner erregten Phantasie erstehen ließ. Diese Frau wird mich die habgierige Josepha schnell vergessen lassen.
Während er nach den Fenstern seines neuen Liebchens spähte, erkannte er auf einmal Herrn Marneffe, der seinen Überzieher selbst abbürstete und augenscheinlich Ausschau hielt und jemanden vom Platze her zu erwarten schien. Der verliebte Baron fürchtete bemerkt zu werden (was später auch geschehen sollte) und drehte der Rue du Doyenné den Rücken zu, aber nur so weit, dass er von Zeit zu Zeit noch einen Blick nach den Fenstern werfen konnte. Durch diese Wendung sah er sich aber plötzlich Auge in Auge mit Frau Marneffe, die, von den Kais herkommend, um die vorgelagerten Häuser herum zu ihrem Hause ging. Valerie zuckte zusammen, als sie den erstaunten Blick des Barons auffing. Ihre Augen antworteten verschämt-kokett.
»Welch hübsche Frau«, sprach der Baron wie vor sich hin, »wie geschaffen, um Torheiten zu begehen!«
»Ach, mein Herr«, antwortete sie, indem sie sich mit einer Bewegung, als fasse sie einen plötzlichen Entschluss, ihm zuwandte, »Sie sind der Herr Baron Hulot, nicht wahr?«
Erstaunt bejahte er es.
»Da der Zufall unsere Blicke einander zum zweiten Male begegnen lässt und da es scheint, dass ich das Glück habe, Sie zu interessieren oder neugierig gemacht zu haben, so will ich Ihnen sagen: machen Sie keine Torheiten, sondern üben Sie lieber Gerechtigkeit! Meines Mannes Geschick liegt in Ihrer Hand.«
»Wie meinen Sie das, Gnädigste?« fragte der Baron galant.
»Mein Mann arbeitet unter Ihrer Oberleitung im Kriegsministerium in der Abteilung des Herrn Lebrun, unter Herrn Coquet«, erwiderte sie, ihn anlächelnd.
»Ich wäre wohl geneigt, Frau ... Frau ...?«
»Frau Marneffe!«
»Meine liebe Frau Marneffe – geneigt, wollte ich sagen, eine Ungerechtigkeit um Ihrer schönen Augen willen zu begehen. Eine Kusine von mir wohnt in Ihrem Hause; ich werde sie dieser Tage, so bald wie möglich, besuchen. Legen Sie mir Ihr Gesuch dort vor!«
»Verzeihen Sie meine Kühnheit, Herr Baron! Aber Sie werden verstehen, warum ich es wagte, so zu reden. Wir haben nämlich gar keine Protektion.«
»Soso!«
»Herr Baron, Sie missverstehen mich!« sagte sie und schlug die Augen nieder.
Dem Baron kam es vor, als ginge damit die Sonne unter.
»Ich bin in Verzweiflung, aber ich bin eine anständige Frau«, fuhr sie fort. »Vor einem halben Jahre habe ich meinen einzigen Beschützer verloren, den Marschall Montcornet.«
»Sind Sie nicht seine Tochter?«
»Jawohl, Herr Baron, aber er hat mich nie als solche anerkannt.«
»Aber er hat Ihnen doch einen Teil seines Vermögens hinterlassen?«
»Er hat mir nichts hinterlassen, Herr Baron, weil sich kein Testament vorgefunden hat.«
»Armes Kind! Ja, ja, der Marschall ist an einem Schlaganfall gestorben. Verzagen Sie nur nicht! Mut! Man wird nicht vergessen, was man der Tochter eines Bayard des Kaiserreichs schuldet!«