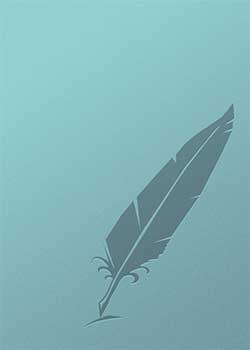Читать книгу Tante Lisbeth - Оноре де Бальзак - Страница 4
ОглавлениеFrau Marneffe grüßte graziös. Sie war ebenso stolz auf ihren Erfolg wie der Baron auf den seinen.
Zum Teufel, wo mag sie zu so früher Stunde herkommen? fragte er sich, indem er den Wellenbewegungen ihres Kleides nachblickte, das sie mit einer etwas übertriebenen Koketterie trug. Um vom Baden zu kommen, sieht sie zu ermüdet aus. Ihr Mann erwartet sie. Das ist rätselhaft und gibt zu denken.
Nachdem Frau Marneffe in ihrem Hause verschwunden war, entschloss sich der Baron, nachzusehen, was seine Tochter drinnen im Laden mache. Er trat ein, und da er noch immer nach Frau Marneffes Fenster hinblickte, hätte er beinahe einen jungen Menschen mit blassem Gesicht und leuchtenden grauen Augen umgerannt, der einen schwarzwollenen Sommerüberzieher, ein grobes Leinwandbeinkleid und gelblederne Halbschuhe trug. Er stürzte wie ein Hühnerhund aus der Tür und lief auf Frau Marneffes Haus zu, in dem er auch verschwand.
Als Hortense den Laden betrat, hatte sie sofort die bewusste Gruppe erkannt, die in der Nähe der Tür auf einem Tische zur Schau gestellt wurde. Selbst ohne Kenntnis ihrer Entstehungsgeschichte hätte die Gruppe wahrscheinlich das junge Mädchen durch das ergriffen, was man das Brio, das heilige Feuer des Meisterwerks, nennt. Nicht alle Werke selbst genialer Künstler haben in gleichem Maße jenen gewissen Glanz, das Weithinstrahlende, das selbst dem ungeübten Auge auffällt. So erregen einige Bilder Raffaels, zum Beispiel die berühmte Verklärung Christi in der Vatikanischen Galerie, die Madonna di Foligno ebenda oder die Fresken in den Stanzen nicht die augenblickliche Bewunderung wie der Violinspieler aus der Galerie Sciarra, die Porträts des Angelo und der Maddalena Doni in Florenz, die Vision Ezechiels im Palazzo Pitti, die Grablegung Christi der Galerie Borghese und die Vermählung Mariä in der Brera. Der Johannes der Täufer in der Tribuna und der heilige Lukas, die Madonna malend, in der Accademia di San Luca zu Rom üben nicht denselben Zauber aus wie das Porträt Leos des Zehnten und die Sixtinische Madonna. Trotzdem sind das alles gleich hohe Werke. Ja, mehr noch: die Stanzen, die Verklärung Christi, die Loggien und die Tafelbilder des Vatikans stellen das Höchste dar in Erhabenheit und Vollendung. Aber diese Meisterwerke verlangen selbst von geschulten Bewunderern eine Art Anspannung, ein Studium, um in allen Teilen erfasst zu werden, während der Violinspieler, die Vermählung der Jungfrau, die Vision Ezechiels von selber durch die Doppeltür der Augen ins Herz dringen und sich darin einen Platz erobern. Welche Freude, das Schöne so mühelos zu empfangen! Vielleicht ist das nicht der Gipfel der Kunst, sicherlich aber ihre höchste Wonne. Diese Tatsache beweist, dass in den Familien der Kunstwerke derselbe Zufall eine Rolle spielt wie in den Familien der Menschen, wo es auch Sonntagskinder gibt, die umsonst zur Welt kommen und ohne ihren Müttern wehe zu tun, denen alles zulächelt und alles gelingt. So treibt das Genie des Künstlers gerade wie die Liebe der Menschen verschiedenartige Blüten.
Das Brio (ein italienisches Wort, das sich nicht gut übersetzen lässt, das Stendhal bei uns eingebürgert hat) zeichnet besonders Frühwerke aus. Es ist die Frucht des Ungetüms und des kühnen Schwunges des jugendlichen Genies, einer Begeisterung, die sich bei späteren Werken nur noch zu besonders glücklicher Stunde äußern kann. Aber dann kommt das Brio nicht mehr aus dem vollen Herzen des Künstlers, und anstatt seine Werke vulkanartig zu überfluten, quillt es nur spärlich und aus von außen erregten Quellen: der Liebe, der Eifersucht, oft auch dem Hasse und noch öfter der Sehnsucht nach dem alten Feuer, dem der Künstler seinen Ruhm verdankt.
Steinbocks Gruppe verhielt sich zu seinen übrigen späteren Werken wie die Vermählung Mariä zu dem Gesamtwerke Raffaels. Es war seine erste Tat, geschaffen in der vollen unnachahmlichen Grazie, im Sturm und Drang und im wundervollsten Reichtum der Jugend.
Hortense unterdrückte ihre Bewunderung, indem sie die Ersparnisse ihrer Kinderjahre im Geiste überschlug. Mit gleichgültiger Miene fragte sie den Händler: »Wie teuer ist dies da?«
»Eintausendfünfhundert Francs«, erwiderte er ihr und blickte rasch nach dem jungen Manne hin, der auf einem Schemel in einer Ecke saß.
Dieser junge Mann war hingerissen von dem lebendigen Meisterwerke, das er in dem jungen Mädchen erschaute. Durch des Händlers Blick aufmerksam geworden, erkannte Hortense sofort in ihm den Künstler. Die Röte, die sein bleiches leidendes Gesicht plötzlich färbte, und das Feuer, das ihre Frage in seinen grauen Augen entzündet hatte, verrieten ihn ihr. Sie betrachtete dieses hagere längliche Gesicht, das ihr wie das eines Asketen erschien. Sie bewunderte diese festgeformten roten Lippen, das feinlinige Kinn und das kastanienbraune Haar mit dem slawischen Seidenglanzschimmer.
»Bei einem Preise von zwölfhundert Francs bitte ich um die Zusendung«, erklärte sie.
»Eine echte Antike, gnädiges Fräulein«, wandte der Händler ein, der sich wie alle Leute seines Gewerbes einbildete, mit Reden wunder was zu sagen.
»Verzeihen Sie, bester Herr, das ist in diesem Jahre entstanden«, entgegnete sie ganz bescheiden, »und ich möchte sie insbesondere bitten, falls es bei der gebotenen Summe bleibt, uns den Künstler persönlich zuzuschicken. Wir könnten ihm vielleicht immerhin ansehnliche Aufträge verschaffen.«
»Wenn er zwölfhundert Francs bekommen soll, was bliebe dann für mich? Ich will verdienen«, meinte der Händler.
»Natürlich!« erwiderte das junge Mädchen nicht ohne einen Anflug von Geringschätzung.
»Ach, gnädiges Fräulein, nehmen Sie das Werk!« rief der Pole aufgeregt dazwischen. »Mit dem Händler werde ich mich schon einigen.« Bezaubert von der hohen Schönheit Hortenses und der in ihren Augen widergespiegelten Liebe zur Kunst, fügte er hinzu: »Ich bin der Schöpfer dieser Gruppe. Seit vierzehn Tagen komme ich dreimal den Tag her, um nachzusehen, ob jemand ihren Wert erkennt und sie kaufen will. Sie sind meine erste Bewunderin. Nehmen Sie sie!«
»Wollen Sie uns in einer Stunde zusammen mit dem Händler besuchen? Hier ist die Karte meines Vaters!« sagte Hortense.
Während der Händler in den Nebenraum ging, um die Gruppe zu verpacken, setzte sie ganz leise hinzu, zum größten Erstaunen des Künstlers, der zu träumen glaubte:
»Zum Vorteile Ihrer Zukunft, Herr Steinbock, zeigen Sie Fräulein Fischer diese Karte nicht, noch sagen Sie ihr den Namen des Käufers. Sie ist unsere Tante.«
Die Worte »unsere Tante« versetzten den Künstler in einen Rausch. Es war ihm, als gehe er in das Paradies ein, und Eva stände vor ihm. Lisbeth hatte ihm soviel von ihrer schönen Nichte erzählt. Und er hatte ebenso von Hortense geträumt wie sie von dem Geliebten ihrer Tante.
Die Blicke, die beide nun in Wirklichkeit tauschten, kann man sich vorstellen. Es waren Flammenblicke. Tugendhafte Verliebte kennen keine Verstellung.
»Donnerwetter, was machst du so lange hier drinnen?« fragte der Vater seine Tochter.
»Ich habe eben meine ersparten zwölf hundert Francs verausgabt, Vater. Komm, wir wollen gehen!«
Sie hängte sich bei ihrem Vater ein. Er wiederholte:
»Zwölfhundert Francs!«
»Sogar dreizehnhundert! Das Fehlende wirst du mir doch leihen!«
»Und wofür hast du diese Summe ausgegeben? In dem Laden da?«
»Ja, ja, dort«, entgegnete sie glücklich. »Wenn ich dabei einen Mann gefunden habe, so ist das doch nicht zuviel, nicht?«
»Einen Mann, Hortense? In dem Laden da?«
»Höre zu, Väterchen! Würdest du mir verbieten, einen großen Künstler zu heiraten?«
»Gewiss nicht, Kindchen«, erwiderte er. »Große Künstler sind heutzutage ungekrönte Fürsten. Ruhm und Geld, das sind die beiden sozialen Angelpunkte ... das heißt, nach der Ehre«, fügte er mit ein wenig Heuchelei hinzu.
»Nun ja«, meinte Hortense, »und wie denkst du über die plastische Kunst?«
»Die Bildhauerei ist so eine Sache!« gab er kopfschüttelnd zur Antwort. »Man braucht da große Protektion, ganz abgesehen von einem großen Können, denn die Regierung ist die alleinige Abnehmerin. Das ist eine Kunst ohne Absatzmöglichkeit, in unserer Zeit, wo es keine Monumentalität mehr gibt. Man kauft nur kleine Gemälde, kleine Skulpturen. Es gibt dementsprechend nur Kleinkünste.«
»Sollte das ein großer Künstler nicht überwinden?« warf Hortense ein.
»Das wäre des Rätsels Lösung, gewiss!«
»Ein Künstler, der unterstützt würde?«
»Desto besser!«
»Ein Edelmann?«
»Ist er das?«
»Er ist Graf!«
»Dabei Bildhauer?«
»Ja. Er hat kein Vermögen.«
»Rechnet er etwa auf das von Fräulein Hulot?« fragte der Baron scherzend, wobei er einen forschenden Blick in die Augen seiner Tochter warf.
»Dieser große Künstler, Graf und Bildhauer hat Ihre Tochter, Herr Baron, soeben zum ersten Male in seinem Leben gesehen, und zwar ganze fünf Minuten lang!« erwiderte Hortense mit ruhigster Miene. »Weißt du, Väterchen, während du gestern im Abgeordnetenhause warst, hatte Mutter einen Ohnmachtsanfall. Dieser Anfall, den sie auf ihre schwachen Nerven schiebt, hatte seine Ursache in ihrer Sorge darüber, dass ich noch nicht verheiratet bin. Sie hat mir nämlich gesagt: um mich an den Mann zu bringen.«
»Diesen Ausdruck hat sie in ihrer Liebe zu dir unmöglich gebraucht!« unterbrach sie ihr Vater.
»Ein bisschen parlamentarischer hat sie sich schon ausgedrückt, gewiss!« entgegnete Hortense vergnügt. »Das Wort hat sie nicht angewandt, nein, nein! Aber ich weiß sehr wohl, dass eine heiratsfähige Tochter, die sich nicht verheiratet, ein schweres Kreuz für brave Eltern ist. Mutter glaubt: wenn ein Mann mit Energie und Talent käme, dem dreißigtausend Francs Mitgift genügten, dass wir dann alle miteinander glücklich wären. Kurzum, sie hat es für angebracht gehalten, mich mit meinen bescheidenen Zukunftsaussichten vertraut zu machen, damit ich mich nicht zu sehr in goldenen Träumen wiege.«
»Deine Mutter ist eine gute, edle und ausgezeichnete Frau!« sagte der Baron tieftraurig und doch recht glücklich über das Vertrauen seines Kindes.
»Mutter hat mir gestern erzählt«, fuhr Hortense fort, »dass sie dich beauftragt habe, ihre Brillanten zu verkaufen, um mir eine Mitgift zu verschaffen; aber ich möchte lieber, sie behielte ihren Schmuck. Ich werde schon einen Mann finden. Ich glaube, ich habe ihn bereits gefunden, den Bräutigam, der dem Wunsche Mamas entspricht ...«
»Hier? In den paar Minuten?«
»Gewiss, Vater. Sieh, das Gute liegt so nah!« sagte sie schelmisch.
»Gut, mein Kindchen, wir werden ja sehen. Verheimliche mir nur nichts!« Unter einem scherzhaften Tone verbarg er seine innere Unruhe.
Unter dem Siegel der Verschwiegenheit berichtete ihm nun Hortense das Ergebnis gewisser Gespräche mit Tante Lisbeth. Zu Hause angekommen, zeigte sie ihrem Vater das berühmte Petschaft als Beweis von der Richtigkeit ihrer Vermutungen. Der Vater bewunderte insgeheim die große instinktive Mädchenklugheit, indem er sich die Einfachheit des Planes vergegenwärtigte, den die Liebe diesem unschuldigen Mädchen eingegeben hatte.
»Du wirst das Meisterwerk, das ich erworben habe, sogleich sehen. Man wird es jeden Augenblick bringen, und mein lieber Stanislaus wird in Begleitung des Händlers mitkommen. Der Schöpfer eines solchen Werkes muss sein Glück machen! Verschaffe ihm durch deinen Einfluss den Auftrag zu einem Denkmal und dann eine Wohnung in der Akademie!«
»Was du nicht alles willst!« scherzte der Baron. »Wenn du so machen könntest, was du wolltest, wärt ihr nach den gesetzlich vorgeschriebenen elf Tagen miteinander verheiratet.«
»Elf Tage muss man warten?« Hortense lachte. »Wo ich ihn nach fünf Minuten geliebt habe, so wie du Mutter geliebt hast, als du sie zum ersten Male sahst! Und er liebt mich, als ob wir uns schon zwei Jahre lang kennten. Jawohl!« setzte sie mit einer Gebärde der Beteuerung hinzu. »Seine Augen sagen mir mehr als zehn Bände. Er wird euch schon recht sein, dir und Mutter, wenn er bewiesen haben wird, dass er ein Genie ist! Die Plastik ist die höchste von allen Künsten!« Sie klatschte vor Freude in die Hände. »Halt!« sagte sie auf einmal. »Was ich noch sagen wollte ...«
»Du hast also noch etwas auf dem Herzen?« fragte der Baron lächelnd. Ihre unschuldsvolle Beichte beruhigte ihn.
»Ein letztes wichtiges Geständnis!« sagte sie. »Ich liebte ihn, ehe ich ihn persönlich kannte, aber seit einer Stunde, da ich ihn nun kenne, bin ich vernarrt in ihn!«
»Und nicht zu knapp!« meinte der Baron, den die naive Liebesgeschichte belustigte.
»Tadle meine Vertrauensseligkeit nicht!« bat sie. »Gibt es etwas Herrlicheres als einem Vaterherzen zu gestehen: ›Ich liebe! Ich bin in meiner Liebe glücklich!‹ Du wirst meinen Stanislaus sehen. Seinen melancholischen Kopf! Seine grauen Augen mit dem Sonnenschein des Genies! Und wie vornehm er aussieht! Weißt du auch, woher er stammt? Ist Livland ein schönes Land? – Tante Lisbeth wollte den jungen Mann heiraten! Sie könnte seine Mutter sein. Das wäre ein Verbrechen! Ich bin riesig eifersüchtig auf sie, weil sie für ihn etwas hat tun können. Ich bilde mir ein, sie wird meine Heirat scheel ansehen.«
»Wir wollen Mutter nur nichts verheimlichen, mein Engel.«
»Ich müsste ihr dieses Petschaft zeigen; aber ich habe versprochen, Tante Lisbeth nicht zu verraten. Sie hat Angst vor Mutters Spott.«
»Du hast Bedenken hinsichtlich eines Petschafts, aber du stiehlst der Tante Lisbeth den Geliebten!«
»Hinsichtlich des Petschafts habe ich etwas versprochen; hinsichtlich des Künstlers habe ich nichts versprochen!«
Diese altmodische Romantik passte ausgezeichnet in die geheime Geschichte dieser Familie. Deshalb fügte der Baron dem Lobe ihrer Klugheit hinzu, sie solle sich wenigstens weiterhin auf die Umsicht ihrer Eltern verlassen.
»Du verstehst, mein liebes Kind«, sagte er, »es kommt dir nicht zu, dich zu erkundigen, ob dein Auserwählter wirklich Graf ist, ob seine Papiere in Ordnung sind und ob sein Vorleben Sicherheit bietet. Was nun Tante Lisbeth betrifft: sie hat die Gelegenheit zu heiraten fünfmal ausgeschlagen, als sie zwanzig Jahre jünger war. Die wäre also kein Hindernis. Das nehme ich auf mich.«
»Höre, Vater. Wenn du mich verheiratet sehen willst, so sprich, bitte, nicht eher mit Tante Lisbeth von unserm Freunde als in dem Augenblick, wo mein Ehevertrag unterzeichnet wird. Seit einem halben Jahr bestürmte ich sie mit Fragen. Ach, es steckt etwas Rätselhaftes in ihr ...«
»Wieso?« fragte der Baron betroffen.
»Schon ihr Blick war falsch, wenn ich zuviel von ihrer Liebesgeschichte wissen wollte.« Hortense lachte. »Ziehe deine Erkundigungen ein, gut! Aber mein Schiffchen lass mich selber steuern! Mein Gottvertrauen muss auch euch beruhigen.«
»Christus hat gesagt: ›Lasset die Kindlein zu mir kommen!‹ Du bist eins der Kinder, die da kommen ...«, meinte der Baron nicht ohne leisen Spott.
Nach dem Frühstück meldete man den Kunsthändler, den Künstler und sein Werk. Die Baronin beobachtete, wie ihre Tochter plötzlich rot wurde. Das machte sie unruhig und neugierig. Hortenses Aufgeregtheit, ihre flammenden Augen verrieten ihr das ganze Geheimnis ihres jungen, so wenig verschlossenen Herzens.
Graf Steinbock machte in seinem schwarzen Rock den Eindruck eines vornehmen jungen Mannes.
»Könnten Sie den Auftrag für eine Statue in Bronze übernehmen?« fragte ihn der Baron, indem er die Gruppe in die Hände nahm.
Nachdem er sie verständnisvoll betrachtet hatte, reichte er sie seiner Frau. Sie verstand nichts von Plastik.
»Nicht wahr, Mutter, das ist schön?« flüsterte Hortense der Mutter leise zu.
Der Künstler beantwortete die Frage des Barons:
»Ach, Herr Baron, eine Statue ist kein so schweres Werk wie beispielsweise die Standuhr, die der Herr da gütigst mitgebracht hat.«
Der Händler packte das Wachsmodell aus: »Amoretten versuchen die zwölfte Stunde aufzuhalten« und stellte es auf das Büfett im Esszimmer.
»Lassen Sie mir die Uhr da!« erklärte der Baron, von der Schönheit des Werkes entzückt. »Ich will sie den Ministern des Innern und des Handels vorführen.«
»Wer ist der junge Mann, der dich so außerordentlich interessiert?« fragte die Baronin ihre Tochter.
Der Kunsthändler, der das Einverständnis zwischen der jungen Dame und dem Bildhauer erkannt hatte, nahm eine geheimnisvolle Kennermiene an und erwiderte: »Ein Künstler, der die pekuniären Mittel dazu hätte, könnte hiermit einhunderttausend Francs verdienen. Man braucht nur zwanzig Exemplare jedes zum Preise von achttausend Francs zu verkaufen. Jedes Stück würde etwa dreitausend Francs Herstellungskosten verursachen. Wenn man die Exemplare nummerierte und die Form zerstörte, fänden sich schon die zwanzig Liebhaber, die ihre Freude daran hätten, zur kleinen Schar der Besitzer dieses Werkes zu gehören.«
»Hunderttausend Francs!« rief Steinbock aus, indem er erst den Händler, dann den Baron und schließlich Hortense anschaute.