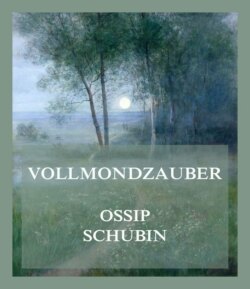Читать книгу Vollmondzauber - Ossip Schubin - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel.
ОглавлениеDer Oberst des 32. Dragonerregiments, Baron Stahl, war soeben von einer Inspektion nach Breznitz zurückgekehrt. Die Inspektion hatte in Zdibitz stattgefunden, einem Städtchen, das von Breznitz volle anderthalb Reitstunden entfernt lag, und in dem die vierte Eskadron dieses Regiments garnisoniert war.
Es war ein kalter, windiger Oktobernachmittag. Die Sonne schien zwar hell, aber sie wärmte nicht, und auf den Straßen lag ein dicker, brauner Brei, in dem die Pferde bis über die Hufe versanken. Der lange Ritt hatte nicht zu den erquicklichsten gehört. Der Oberst fühlte sich, wenn auch nicht müde – welcher flotte Reitersmann würde so etwas zugestehen? – doch immerhin froh, unter Dach zu kommen. Er forderte die ihn begleitenden Offiziere auf, eine Tasse Thee bei ihm zu trinken.
In seiner Wohnung fand er alles genau, wie es sein sollte: die Öfen geheizt, die Lampen angezündet. Er hieß seinen Diener das Theezeug in das Rauchzimmer bringen und sprach die Hoffnung aus, daß seine Gäste sich recht zu Hause bei ihm fühlen möchten. Dies schien ihnen nicht schwer zu fallen, und da nun einer nach dem andern dem Obersten die Behaglichkeit seines Heims rühmte, bemerkte er triumphierend: „Nicht wahr, meine Herren, der Mangel einer Hausfrau macht sich entschieden nicht – unangenehm fühlbar?“ Das „Nicht“ betonte er mit der Verbissenheit eines alten Junggesellen, dem einmal etwas quer gegangen ist.
Die meisten Herren lachten über das „Nicht“ und die Kunstpause wie über einen sehr guten Witz. Über die Witze des Obersten lachen seine Offiziere immer.
„Nicht … unangenehm … nein, nicht … unangenehm fühlbar macht sich der Hausfrauenmangel,“ wiederholte einer nach dem andern, und dann setzten sie hinzu: „Freilich, wenn der Hausherr so vorzüglich ist!“
Nur ein Oberstlieutenant Baron Drewinsky brummte: „Laß gut sein, alter Kamerad, es ist sehr gemütlich bei dir – aber schade ist’s doch!“
Der Oberst fand diesen Ausspruch taktlos und ärgerte sich darüber. Eben wollte er dem Waffenbruder etwas recht Übellauniges erwidern, da bemerkte er einen Brief, der knapp neben dem Fuß der Lampe in der Mitte eines Tisches lag. Die Schrift einer Dame mußte es sein, das war klar; undiszipliniert und kühn, großmächtig und steil füllte sie fast die ganze Fläche des Umschlags aus, obwohl die Adresse sich, alle offiziellen Floskeln weglassend, knapp auf Titel und Namen des Obersten beschränkte. Postmarke und Stempel fehlten, der Brief mochte persönlich abgegeben worden sein.
„Wo kommt der Brief her?“ fragte der Oberst etwas unwirsch seinen Diener, der soeben frisch gestopfte Tschibuks für die Herren hereintrug.
„Ich bitte, Herr Oberst, der Herr Graf Swoyschin haben den Brief gebracht.“
Dem Obersten sagte der Name nichts, er schüttelte den Kopf, stierte ärgerlich vor sich hin, bis einer seiner Majore ihm ins Gedächtnis zu rufen wagte: „Der neue Oberlieutenant.“
„Ach richtig … der, der von den Windischgrätz-Dragonern herversetzt worden ist,“ murmelte der Oberst. „Den hatte ich ganz vergessen. Ja, ja, er sollte heute eintreffen – der Wind hatte mir ihn aus dem Kopf geblasen. Aber was fällt denn dem ein, mir gleich mit so einer Epistel ins Haus zu fallen?“
„Hm, der Brief enthält gewiß eine warme Empfehlung des jungen Mannes von einer nahen Anverwandten,“ bemerkte der Oberstlieutenant von Drewinsky, derselbe, der soeben das Junggesellentum des Hausherrn bedauert hatte. Er war ein famoser Soldat, schneidiger Reiter, vorzüglicher Kamerad und hatte nur eine unangenehme Eigenschaft: er fühlte sich bei jeder halbwegs möglichen Gelegenheit verpflichtet, den Demokraten herauszukehren, obzwar er es eigentlich nicht nötig gehabt hätte, da er aus einer sehr anständigen Militäradelsfamilie stammte. Im Herzen hatte er eigentlich nichts gegen die Aristokraten, er that nur so, vielleicht um den Strebern eine Lektion zu geben, von denen sich einige unter die Zweiunddreißiger verirrt hatten. Diese Streber haßte er nämlich wirklich.
„Unsre Hocharistokraten,“ fuhr er fort, „sind meistens so verwöhnte Muttersöhnlein, daß ihr Eintritt ins Regiment immer mit einem halben Dutzend um Schonung bittender Petitionen einbegleitet wird, damit man sie beileibe nicht zu hart anfaßt.“
„Ich glaube nicht, daß Swoyschin darum zu thun sein wird, sich besonders zart anfassen zu lassen,“ bemerkte einer der jüngeren Offiziere, ein Rittmeister Gerhart, der infolge einer Erkrankung des Adjutanten zeitweilig dessen Stelle vertrat.
„Kennst du ihn?“ fragte der Oberst. Er nannte den Rittmeister „du“, und dieser ihn auch – natürlich „du, Herr Oberst“, des Respekts wegen.
„Ja,“ erwiderte der Rittmeister, „er ist ein famoser Mensch! Er wird dir gefallen, Herr Oberst. Das ganze Regiment wird stolz auf ihn sein!“
„Na, ’s ist immerhin gut, wenn wir wieder ein paar junge Leute von Familie ins Regiment bekommen,“ sagte, sich mit gezierter Vorsichtigkeit nach unbefugten Zuhörern umsehend, ein Oberlieutenant. Er hieß Hermann von Märzfeld, war der Sohn eines neugeadelten Ofenfabrikaten. „Ganz gut, daß wir ein paar Leute von Familie ins Regiment bekommen, wir haben uns letzterer Zeit ohnehin zu stark demokratisiert!“ Einer verjährten Mode gemäß näselte er wie der Graf im Lustspiel auf einer Provinzbühne – der wohlbekannte junge Graf mit der strohgelben Perücke, der immer ein Trottel sein muß. „Da rühm’ ich mir die preußischen Einrichtungen,“ näselte er weiter, „nicht ein Bürgerlicher in einem anständigen Offizierscorps! Haben doch was für sich – sehr viel für sich – die wirklich vornehmen Leute!“
„Haben gewöhnlich das eine vor den minder vornehmen voraus,“ unterbrach ihn Drewinsky, „daß sie es nicht nötig haben, vornehm zu thun!“
Das war scharf, aber es prallte an dem Hochmut des Einfaltspinsels ab, denn während die andern Herren sich vielsagend ansahen, ließ er nur nachlässig die Enden seines Schnurrbarts durch die Finger gleiten und versicherte: „Sehr gut, Herr Oberstlieutenant – famos!“ Und dann setzte er hinzu: „Es gibt so viele Swoyschins, was für eine Geborene ist denn die Mutter dieses Swoyschin?“
„Eine Sensenheim,“ erwiderte ihm ein lustiger Lieutenant – Graf Bärenburg –, und halblaut, so daß die neben ihm sitzenden Kameraden es hören konnten, murmelte er vor sich hin: „Den Kerl kauf’ ich mir noch einmal – der Kerl muß ’raus!“
Damit meinte er: heraus aus dem Offizierscorps, und die Kameraden gaben ihm im stillen recht.
Indessen fragte Märzfeld, der sich trotz all seiner aristokratischen Prätensionen im „Gotha“ nicht auskannte: „Eine – Komtesse Sensenheim?“
„Ja, entschiedene Komtesse … Komtesse Theres Sensenheim – kannst dich beruhigen!“ versicherte Bärenburg. „Mutter eine Donnersberg … Ich sollt’s wissen, da sie und meine Mama Schwestern sind.“
Theres Sensenheim! Bei dem Namen zuckte der Oberst zusammen. Wieder griff er nach dem Brief und hielt ihn diesmal etwas näher an sein Gesicht. Ein schwacher, aber sehr eigenartiger Wohlgeruch entströmte dem dicken Papier. Die Schrift kannte der alte Reitersmann nicht, aber den Duft. Mit einemmal war’s ihm, als ob der Herbstwind den Weg ins Zimmer gefunden hätte durch unsichtbare Ritzen in der Wand.
„Hm! Weshalb hat er sich eigentlich von den Windischgrätzern versetzen lassen? Bei den Kaiserhusaren war er auch schon,“ brummte der dicke Major Falb.
„Schulden!“ mutmaßte lakonisch Drewinsky.
„Zdenko und Schulden!“ rief halb lachend, halb empört der Vetter des Besprochenen, Graf Bärenburg, „nicht einen Kreuzer! Zdenko weiß, daß sein Alter die Schulden bezahlen müßte, und das thäte ihm leid.“
„Also, warum dieser Wankelmut?“ fragte mit seiner krächzenden Stimme der Major. „Einen Grund muß es doch haben, daß ein Mensch von vierundzwanzig Jahren schon zum zweitenmal das Regiment wechselt. Ist er unverträglich?“
„Der beste Kerl von der Welt,“ beteuerte Bärenburg.
Und der Rittmeister Gerhart fügte hinzu: „Ein famoser Kamerad.“
„Also, wo hapert’s?“ fragte jetzt aus seinem langen Schweigen heraus der Oberst.
„Du wirst schon selber darauf kommen, Herr Oberst,“ erwiderte mit einem diskreten Lächeln Rittmeister Gerhart.
Worauf der Oberst etwas heiser: „Wenn er seiner Mutter ähnlich sieht, muß es ein hübscher Mensch sein!“ Und fragend setzte er hinzu: „Weiber?“
Bärenburg und der Rittmeister sahen einander an.
„Na, das kommt mir aber verflucht ungelegen,“ ereiferte sich der Oberst. „Jemand, den ich nicht mit Namen nennen will“ – mit einem Blick auf Bärenburg –, „gibt mir nach der Richtung hin gerade genug zu thun! Ein zweiter Don Juan im Regiment paßt mir gar nicht.“
Bärenburg kratzte sich hinter dem Ohr, und der Rittmeister rief: „O! das ist etwas ganz andres – eine sehr komplizierte Abart des Urtypus. Bei Swoyschin fängt es gewöhnlich mit Gutmütigkeit an.“
„So, und hört auch mit Gutmütigkeit auf?“ fragte der Oberst kurz. Bärenburg und der Rittmeister lächelten.
„Hol ihn der Teufel!“ grollte der Oberst.
„Wenn du ihn einmal kennen gelernt hast, wirst du’s nicht mehr sagen, Herr Oberst!“ behauptete der Rittmeister Gerhart.
Der Oberst verfiel von neuem in tiefes Schweigen. Er hatte eine Falte zwischen den Augenbrauen, hielt den Tschibuk auf Armeslänge von sich gestreckt, ohne zu rauchen, und schien über etwas nachzudenken.
Mit der Gemütlichkeit war’s vorbei, die Konversation erlosch. Die Konversation ist wie ein Kaminfeuer, sie stirbt, wenn man nicht von Zeit zu Zeit ein neues Scheit Holz nachlegt. Der Oberst hatte vergessen, nachzulegen, in weniger als einer Viertelstunde war das Zimmer leer. –
Jetzt saß er allein neben der Lampe mit dem roten Schirm. Theres! Theres Sensenheim! … Er hatte sie geliebt – und hatte vor sechsundzwanzig Jahren einen Korb von ihr bekommen! Aus dem Grunde war er Junggeselle geblieben. Kennen gelernt hatte er sie in dem Schloß ihrer Eltern, das an der mährisch-ungarischen Grenze, gerade dort gelegen war, wo die Karpathen ihren Wald- und Wasserzauber am malerischsten ausbreiten.
Mit seinem Zug in dem Dorf einquartiert, wohnte er im Schloß. Die Sensenheims bewiesen ihm große Freundlichkeiten, besonders die Komtesse Theres. Ehe zwei Tage vergangen waren, hatte er sich über Hals und Kopf in sie verliebt.
Machte es ihrer Eitelkeit Spaß, rührte es sie, kokettierte sie einfach mit ihm, that er ihr leid oder – gefiel er ihr wirklich? Er war sich nicht klar geworden darüber, und vielleicht mochte sie’s selber nicht gewußt haben! … Jedenfalls munterte ihn ihr Wesen zu den unsinnigsten Hoffnungen auf.
Wenn er jetzt daran zurückdachte, sagte er sich, daß er sich damals nicht nur als Grünspecht, sondern als Gimpel gezeigt, indem er sich eingebildet hatte, die Komtesse Theres Sensenheim könnte sich entschließen, so einen armen Freiherrn und schlecht besoldeten Lieutenant, wie er es war, zu heiraten. Aber mit dreiundzwanzig Jahren glaubt man an Wunder.
Später sagte er sich oft, daß hinter all ihrer berückenden Lieblichkeit nicht viel Tiefes gesteckt habe; aber er gestand sich’s ungern und fand immer noch beschönigende Entschuldigungen für sie. Sie hatte ihm den Korb, den sie ihm geben mußte, mit Thränen in den Augen gegeben. Das vergaß er ihr nie!
Am Allerseelentag verließ er das Schloß, ritt fort an der Spitze seines Zuges über die kotdurchweichten Straßen. Es war ein kalter, neblichter Morgen, durch die scharfe, graue Luft wehten die roten und gelben Herbstblätter, und schwarze Krähenzüge flatterten krächzend über die frisch geackerten Felder.
Am östlichen Horizont arbeitete sich eine müde, schwache Sonne aus den kalten Windwolken heraus. Er sagte sich, daß es seine Lebenssonne war, die da am Horizont aufstrebte, – eine Sonne, die weder Glanz noch Wärme mehr gab, nur ein wenig Licht – Licht genug, um ihm die eigene Thorheit zu zeigen!
Den Obersten überkam’s noch immer, wenn er an jenen Morgen dachte.
Na, er hatte es überstanden, aber die Krankheit war schwer und lang gewesen, und etwas von der Kratzbürstigkeit, die ihn neben allen seinen wirklich vorzüglichen Eigenschaften auszeichnete, verdankte er jener Krankheit. Die Kratzbürstigkeit war nämlich eine Defensiveigenschaft, die er sich angearbeitet hatte, um sich nicht ein zweites Mal zum besten haben zu lassen.
Es gibt Menschen, die Dornenzweige auf ihre Blumenbeete legen, damit ihnen Hunde und Katzen nicht darüber laufen. Zu denen gehörte der Oberst. Er war froh, die traurige und demütigende Geschichte vergessen zu haben. Der Brief, der sie ihm ins Gedächtnis zurückrief, machte ihm wenig Vergnügen. Er öffnete ihn widerwillig, vorsichtig, als ob er Angst gehabt hätte, ein Skorpion könne herauskriechen – ein Skorpion mit Thränen in den Augen –, aber es sprang nichts heraus.
Alles, was der Umschlag enthielt, war der Brief einer gutmütigen, etwas albernen Frau, die dem ehemaligen Anbeter im festen Vertrauen an seine unerschütterliche Anhänglichkeit ihren Sohn ans Herz legte.
Offenbar war sie davon überzeugt, daß er sie heute noch liebe. Und bis dahin war allerdings etwas von der alten Neigung in ihm übrig geblieben – das Gefühl einer großen Kränkung, das Gefühl eines schrecklichen Verlustes. Der Brief riß auch noch das Letzte mit sich fort – er bewies dem Obersten schonungslos, daß er nichts verloren hatte!
Von einem Augenblick zum andern wurde sein Herz leer, ganz leer, aber es war an die Last, die es jahrelang mit sich herumgetragen hatte, dermaßen gewöhnt, daß ihm nun die Last fehlte. Es sehnte sich nach den Gespenstern, die es gepeingt und ihm dazwischen alte Märchen erzählt hatten. Das nüchterne Tageslicht war in das Herz gedrungen und hatte sie verscheucht!