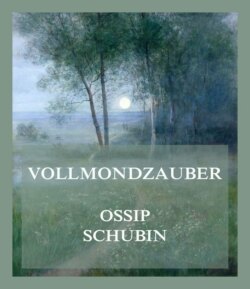Читать книгу Vollmondzauber - Ossip Schubin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Zweites Kapitel.
Die Nacht schlief der Oberst schlecht. Er ärgerte sich im voraus über den neuen Oberlieutenant. „Hm! hm! Wird ganz seiner Mutter nachgeraten sein,“ murmelte er vor sich hin, „bei der fing es auch immer mit Gutmütigkeit an!“
Trotz der freundlichen Dinge, die Bärenburg und der Rittmeister Gerhart über ihn geäußert hatten, brachte der Oberst dem neuen Offizier ein großes Mißtrauen entgegen. Seine feindseligen Gefühle wuchsen von einer Viertelstunde zur andern und hatten sich bereits zu einer Art Haß gesteigert, als am nächsten Tag gegen zwölf Uhr der Diener meldete: „Der Herr Graf Swoyschin!“
„Ich lasse bitten!“
Die Thür öffnete sich – der junge Mann trat ein. Der Oberst fuhr zusammen – er machte eine krampfhafte Anstrengung, um seinen entfliehenden Mißmut festzuhalten – aber vergebens. Der Anblick des jungen Offiziers hatte ihn verscheucht! Die alten Erinnerungen tauchten von neuem in der Seele des Obersten auf, und zwar im schönsten, verklärtesten Lichte! Wie er ihr ähnlich sah – so ähnlich als ein Mann einer Frau überhaupt ähnlich sehen kann! Dieselbe hoch aufgeschossene Gestalt, dasselbe schmale Gesicht, dieselben leuchtenden dunklen Augen, dieselbe kurze, gerade Nase, derselbe volle, schöne Mund mit klassisch geschnittener Oberlippe.
Zdenko Swoyschin kam damals, wie schon erwähnt, von den Windischgrätz-Dragonern und hatte nicht Zeit gehabt, sich den Schnurrbart wachsen zu lassen. Die Windischgrätz-Dragoner sehen immer entweder aus wie die Kammerdiener oder wie die Engel – und Swoyschin sah entschieden nicht wie ein Kammerdiener aus.
Die Schönheit seiner Erscheinung gewann noch sehr durch den liebenswürdigen Freimut des Ausdrucks, durch die sympathische Natürlichkeit des ganzen Auftretens. Es war die einschmeichelnde Natürlichkeit eines verwöhnten Kindes, das nie dazu gekommen ist, sich zu fürchten, und es nie nötig gehabt hat, sich zu verstellen, – eine spezifische Eigenschaft des jungen österreichischen Aristokraten, wenn er einschlägt.
Ehe der Oberst von dem neuen Oberlieutenant schied, hatte er ihn aufgefordert, noch denselben Nachmittag mit ihm spazieren zu reiten; er wollte ihm die Honneurs der Gegend machen. –
Das Wetter hatte sich indessen geändert. Die Luft war feucht-weich, fast warm. Der Sonnenschein kämpfte mit dem Nebel. In den weiten Breznitzer Wäldern glitzerte und flimmerte alles von Tau, und ein schillernder bläulicher Dunst verwischte die Fernen. Gegen den Dunst hoben sich die Bäume in ungewöhnlich tiefen, satten Farben ab. Die Birken mit grellweißen Stämmen und goldig schimmerndem Laub, mit schwermütig-launiger Anmut dem Tod entgegenschauernd, mischten sich zwischen den großartigen Ernst der hohen alten Kiefern, die, unverändert schwarzgrün, sich von dem Wechsel der Jahreszeit nichts anhaben ließen. Die Eichen, von bronzefarbigen Blättern verhüllt, streckten ihre knorrigen Äste in den Himmel, dann plötzlich sah man’s hinter ihnen wie eine Feuersbrunst aufglühen. Es waren die Zweige eines Ahornbaumes. Das Moos, teilweise vom Nebel verwischt, leuchtete an andern Stellen smaragdgrün. Die rötlich verschwimmenden Strahlen der tiefstehenden Nachmittagssonne breiteten sich lang über den Boden aus, malten leuchtende Regenbogenfarben in die schleichenden Nebelschleier und verkrochen sich wohlig in das feuchte Moos. Es machte den Eindruck, als ob das Moos aus einem goldigen Untergrund herauswüchse.
Swoyschin, der offenbar ein empfängliches, angenehmen und unangenehmen Empfindungen gleichermaßen zugängliches Gemüt besaß, lobte die Schönheiten der Landschaft, und der Oberst freute sich daran, als ob ihm die Wälder von Breznitz gehört hätten. Anfangs hatte sich das Gespräch der beiden Männer nur um die edle Reitkunst gedreht; der Oberst bewunderte die Geschicklichkeit, zugleich auch den diplomatischen Takt, mit dem der junge Mann sein ungewöhnlich feuriges Pferd ritt. Er erteilte dem Oberlieutenant erst Lob, dann – ein Oberst muß doch etwas an Erfahrung voraus haben – gute Ratschläge. Für beides schien der jüngere Offizier gleich dankbar.
Sie ritten einen lustigen, gestreckten Galopp über die breiten Rasenstreifen, die sich die Waldränder entlang an der Straße hinziehen. Der Duft der Nadelbäume würzte die Luft, die Sonne wärmte liebkosend, ohne zu brennen, die Pferdehufe versanken weich im Gras.
„Es ist herrlich, wunderschönes Terrain, eine prachtvolle Luft und allem Anscheine nach“ – Swoyschin legte die Hand an die Mütze – „ein eminent liebenswürdiger Oberst; ich wüßte nicht, was ich mir noch mehr wünschen sollte!“ Dabei parierte er, dem Beispiel des Obersten folgend, sein Pferd.
Der Oberst lächelte gutmütig. Er war ein sympathisch aussehender Mann von fünfzig Jahren, dem seine romantische Jugendschwärmerei noch immer aus den grauen Augen herausglänzte. „Freut mich, daß es Ihnen bei uns gefällt, ’s ist wirklich nicht übel,“ sagte er, „und über den Obersten sollen Sie sich auch nicht zu beklagen haben! Das können Sie,“ fuhr er mit einem etwas maliziösen Lächeln fort, „Ihrer Frau Mutter versichern, die Sie mir so warm ans Herz gelegt hat.“
Swoyschin wurde feuerrot.
„Ach, Herr Oberst!“ rief er, „wenn Sie wüßten, wie ungern ich den Empfehlungsbrief abgab! Aber ich konnte es meiner Mutter doch nicht gut abschlagen.“
„Ihre Mutter hatte ganz recht, mir zu schreiben,“ erklärte der Oberst, der sich gar nicht mehr zu erinnern schien, wie sehr ihn der Brief gestern geärgert hatte. „Ihre Mutter wußte, daß ich allezeit bereit sein würde, ihren Wünschen entgegenzukommen. Ich … hm! … ich war einmal ein großer Verehrer Ihrer Mutter.“
Der junge Mann lächelte zutraulich. „Das weiß ich, Herr Oberst,“ versicherte er, „meine Mutter hat mir davon erzählt. Sie sagte mir gleich: wenn der Oberst gehalten hat, was der Lieutenant versprach, würde ich einen Freund an Ihnen haben im Regiment.“
„Ah! … Und hat Sie das ein wenig bestimmt, bei uns einzutreten?“ fragte lächelnd der Oberst.
„Vielleicht … ein wenig,“ gestand Swoyschin, – „aber … Sie dürfen nicht fürchten, daß ich irgendwie daran dachte, auf Ihre Nachsicht zu sündigen oder Ihr Wohlwollen auszunützen.“
„Hüten Sie sich!“ Der Oberst drohte ihm mit dem Finger. „Sie werden keine überschüssige Nachsicht finden. Im Gegenteil, – ich nehme mir vor, sehr streng gegen Sie zu sein, so streng, wie vernünftige Väter nur gegen die Söhne sind, von denen sie viel halten und infolgedessen viel verlangen können.“
Sie lachten beide – sie waren sehr zufrieden miteinander. Das Gespärch nahm einen immer vertraulicheren Charakter an. Es schien Swoyschin Vergnügen zu machen, ungeniert von seinen Verhältnissen reden zu können. Sein Vater lebte noch, war aber seit zehn Jahren gelähmt. Zdenko war der zweite Sohn. Der Älteste, dem nach des Vaters Ableben das Majorat zufallen sollte, war ein Verschwender. Kaum hatte Swoyschin das harte Wort fallen lassen, so nahm er es schon wieder zurück. Er schien sehr an dem Bruder zu hängen, verteidigte ihn gegen seine harte Anschuldigung.
Verschwender war nicht das richtige Wort – Konrad war eigentlich kein Verschwender, er brauchte für sich verhältnismäßig wenig, hatte nur ein zu gutes Herz, und – die Mama konnte nicht sparen. Ach, das Sparen sei eine so schauderhaft unästhetische Sache, klagte er. Wenn man überhaupt keine Bedürfnisse und einen angeborenen Ordnungssinn besitze wie er, Zdenko, da ergab sich ja das Sparen von selbst, – aber von einer so verwöhnten Frau, wie seine Mutter es war, konnte man das nicht verlangen. Nur war leider das Majorat infolgedessen sehr verschuldet. Swoyschin hatte eigentlich Diplomat werden sollen – dazu langte es nun nicht. Er sprach von der Knappheit seiner Geldverhältnisse mit einem Freimut, den nur die jüngeren Söhne böhmischer Fideikommißbesitzer kennen.
So habe er sich denn die Gelüste aus dem Kopf geschlagen und sei Offizier geworden. Glücklicherweise sei der militärische Beruf auch seiner Natur angemessener, und dazu reiche seine Zulage prachtvoll. Bei der Armee, in den Nestern, in denen die Kavallerieregimenter gewöhnlich stationiert sind, da brauche man rein gar nichts. Für den armen Papa sei’s wirklich von Wichtigkeit, daß er zum wenigsten einen Sohn habe, der nichts brauche, – denn jetzt stand es mit den Finanzen zu Hause recht schlecht. Ja, wenn der Papa den Prozeß gewinnen sollte, den großen Familienprozeß, – der Herr Oberst habe ja wohl davon gehört.
Der Oberst hatte von nichts gehört. … Wie es schien, handelte es sich um einen Erbschaftsprozeß mit einem Vetter – dem Rimitzer Swoyschin. Der Papa müsse ihn gewinnen, wenn es noch eine Gerechtigkeit gäbe in Österreich, nun, dann hätte alle Not ein Ende. Hier in der Gegend müsse auch eines von den Schlössern gelegen sein, das zu der bestrittenen Erbschaft gehöre – Zdibitz heiße es.
„Man sieht die Fassade von hier aus; bei der nächsten Lichtung zeig’ ich sie Ihnen,“ bemerkte der Oberst.
Und in der That, als sie die nächste Lichtung erreichten, zeigte der Oberst seinem jungen Begleiter ein weißes Schloß, das einen fernen Hügel krönte.
Wieder legte Swoyschin lustig salutierend die Hand an die Mütze. Dann gönnten sich die Herren noch einen schneidigen Galopp und ließen hierauf die Pferde verschnaufen, ritten ruhig nebeneinander, behaglich träg. Obzwar sie sich erst seit einigen Stunden kannten, fühlten sie sich als gute alte Freunde und benahmen sich als solche. Wenn ihnen nichts mehr zu sagen einfiel, schwiegen sie.
Es war nichts zu hören als das leise Versinken der Pferdehufe in dem weichen, kurzen Rasen, das leise Knistern des Herbstes in den Wäldern – ringsum nur ein großes, dem Schlaf entgegenträumendes Schweigen in Wald und Flur, – goldene Blätter fielen von den Zweigen der Linden, wiegten sich einen letzten Augenblick wie frühlingstrunkene Schmetterlinge in der von Nebelgewinden durchschwebten Luft und sanken dann still zu Boden. Plötzlich veränderte sich das etwas eintönige landschaftliche Bild dadurch, daß die Hauptstraße von einer schmäleren Nebenallee durchquert wurde. Zwischen vielfarbigen, von dem schwärzlichen Grün der Kiefern unterbrochenen Laubbogen sah man in einen geheimnisvoll schillernden Dunst.
Auf der Erde lag zwischen den tief in die Straße hineinwachsenden Rasenrändern der Sonnenschein wie ein langsam in Licht zerfließender Goldklumpen.
Plötzlich, in die beklommene Herbststille hinein, langgezogen und schauerlich drangen die Töne von Trauerposaunen. Man hörte die unrhythmischen Schritte einer großen, nicht disziplinierten Menschenmenge. Aus einem der Seitenwege des Waldes trat ein Begräbnis. Voran der Priester im Trauerornat mit seinen Ministranten, mit Weihrauchfässern und Kreuzen und einem Muttergottesfähnlein. Dann die Musikanten mit ihren schrill jammernden Trompeten und endlich, von sechs Burschen getragen, mit Kränzen bedeckt, der Sarg. Vor dem Sarg hinschreitend ein weiß gekleidetes Mädchen, das einen Myrtenkranz auf weißem Seidenkissen trug, – hinter dem Sarg ein zweites Mädchen, welches jedoch schwarz gekleidet, dazu vom Kopf bis zu den Füßen schwarz verschleiert war. Dieses trug ein schwarzes Kissen, auf dem eine gebrochene Kerze ruhte – wahrscheinlich das gebrochene Lebenslicht symbolisierend; hinterher noch viele Menschen, Männer und Frauen mit brennenden Wachskerzen in der Hand.
Der dunkle Zug, aus dem geheimnisvollen Nebeldunst auftauchend und langsam zwischen den goldenen Herbstbäumen weiterschreitend, machte einen schauerlichen, gespenstischen Eindruck. Die Musik tönte laut – traurig! Der Geruch des Weihrauchs und der Wachskerzen verband sich mit dem süßen und wehmütigen Herbstduft der Wälder.
Die beiden Reiter hielten ihre Pferde an; ehrerbietig salutierend ließen sie den Zug vorbei. Er bog in den nächsten, gegenüberliegenden Querweg ein. Der Nebel zog sich hinter ihm zusammen, die gelben Blätter fielen dich, – man sah ihn nicht mehr.
Der Oberst blickte jetzt nach seinem Begleiter hin. Swoyschin war totenblaß geworden und zitterte wie im Fieber.
„Ja, was ist Ihnen denn?“ fragte der Oberst.
„Ich kann den Geruch nicht vertragen – den Leichengeruch!“
„Der hat doch nicht bis zu Ihnen dringen können durch all den Weihrauch und Wachskerzenduft aus dem geschlossenen Sarg!“ rief der Oberst.
„Doch, Herr Oberst, – es war entsetzlich! Ich spür’ ihn immer, wenn ein Begräbnis an mir vorüberkommt.“
Der Oberst starrte ihn an. „Mensch! wie wird denn das werden! Was werden Sie machen in der Schlacht, wenn Ihnen dermaßen vor Leichen graut?“
Ein Lächeln zog über Swoyschins blasses Gesicht. „Fürchten Sie nichts, Herr Oberst,“ gab er dem Vorgesetzten zur Antwort, „in der Schlacht hoff’ ich meinen Mann zu stellen.“ Und leise fügte er hinzu: „Es ist nur vor Mädchenleichen, daß mir so graut!“