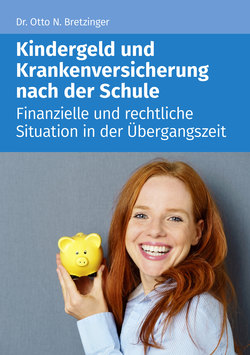Читать книгу Kindergeld und Versicherung nach der Schule - Otto Bretzinger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKindergeld und Krankenversicherung nach der Schule - Finanzielle und rechtliche Situation in der Übergangszeit
1 Vorwort
Regelmäßig schließt sich für Jugendliche an die Beendigung der Schulzeit eine Berufsausbildung oder ein Studium an. Das muss allerdings nicht zwangsläufig der Fall sein. Denn den richtigen Weg für eine berufliche Zukunft zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Und das gilt auch, wenn es darum geht, die eigenen Stärken und Schwächen richtig einzuschätzen.
Wenn das Kind vor einer großen Herausforderung steht, ist die Unterstützung der Eltern gefragt. Sie können beratend zur Seite stehen. Vor allem wenn das Kind nach der Schule sich nicht unmittelbar für eine Berufsausbildung oder ein Studium entscheidet, ist Hilfestellung angesagt. Und dabei geht es nicht nur darum aufzuzeigen, welche alternativen Möglichkeiten es für eine Übergangszeit gibt. Vielmehr gilt es auch, die eigenen rechtlichen und finanziellen Folgen der verschiedenen Alternativen und die Konsequenzen für das Kind zu berücksichtigen.
Dieser Ratgeber will zunächst einen Überblick geben, welche Möglichkeiten es gibt, wenn ein Jugendlicher nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule nicht unmittelbar mit einer Berufsausbildung oder einem Studium beginnen möchte. So kann sich etwa der Jugendliche zunächst ehrenamtlich im Rahmen eines Freiwilligendienstes engagieren oder die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten (z.B. durch ein Praktikum oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen). Viele Jugendliche wollen nach Beendigung der Schulzeit zunächst einmal eine Pause machen und Geld verdienen, bevor sie ihre Ausbildung fortsetzen, etwa um einen längeren Urlaub oder größere Investitionen finanzieren zu können. Andere Jugendliche wollen im Rahmen eines Nebenjobs etwas dazuverdienen. Und selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, nach Beendigung der Schulzeit zunächst eine längere Auszeit zu nehmen. Die Pause kann beispielsweise dazu dienen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sich selbst zu finden und zu orientieren, zu reisen oder im Ausland Sprachen zu lernen. Andere Jugendliche müssen unter Umständen zwangsweise pausieren, weil sie keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden.
Egal, aus welchen Gründen sich eine Berufsausbildung oder ein Studium nicht unmittelbar an das Ende der Schulzeit anschließt, damit verbunden sind teilweise gravierende rechtliche und finanzielle Folgen. Und diese Konsequenzen – für den Jugendlichen selbst und seine Eltern – werden ausführlich vorgestellt. Sie betreffen u.a. den Anspruch der Eltern auf das Kindergeld und den Kinderzuschlag, die steuerliche Entlastung der Eltern durch Steuerfreibeträge und die Möglichkeit des Jugendlichen, sich über die Familienversicherung beitragsfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung der Eltern mitzuversichern. Dargestellt werden diese Konsequenzen unter Bezugnahme auf die jeweilige Situation (z.B. Freiwilligendienst, Erwerbstätigkeit oder Sprachaufenthalt des Jugendlichen im Ausland). Erläutert wird dabei insbesondere auch, unter welchen Voraussetzungen die einzelnen Leistungen und steuerlichen Vorteile auch dann in Anspruch genommen werden können, wenn die Ausbildung unterbrochen wird, wenn sich also an den Abschluss der allgemeinbildenden Schule nicht unmittelbar eine Berufsausbildung oder ein Studium anschließt.
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich dieser Ratgeber auf die wichtigsten allgemeinen Sachverhalte und Fallgestaltungen beschränken muss. Im Einzelfall müssen dagegen jedoch noch jeweils die konkreten Umstände berücksichtigt werden. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen Stellen, etwa der Krankenkasse, der Familienkasse oder der Agentur für Arbeit aufzunehmen.
Dr. iur. Otto N. Bretzinger
2 Überblick über die Möglichkeiten für die Übergangszeit zwischen Schule und Berufsausbildung bzw. Studium
Wer nach der schulischen Ausbildung nicht unmittelbar eine Berufsausbildung aufnehmen oder mit einem Studium beginnen will, hat mehrere Möglichkeiten.
Im Rahmen eines Freiwilligendienstes besteht die Möglichkeit, sich ehrenamtlich für die Gesellschaft zu engagieren.
Es bestehen verschiedene Gelegenheiten, sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten (z.B. Praktikum, betriebliche Einstiegsqualifizierung).
Um die Zeit bis zu einer Berufsausbildung oder einem Studium zu überbrücken, kann man vorübergehend jobben und Geld verdienen. Neben einem "normalen" Arbeitsverhältnis kommt insbesondere ein sogenannter 450-Euro-Job in Betracht.
Probleme gibt es, wenn die Ausbildung unterbrochen wird, weil der Jugendliche nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule keinen Ausbildungsplatz findet oder arbeitslos ist.
Und selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, nach Beendigung der Schulzeit zunächst eine längere Auszeit zu nehmen. Die Pause kann beispielsweise dazu dienen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sich selbst zu finden und zu orientieren, zu reisen oder im Ausland Sprachen zu lernen. Wenn sich junge Menschen über längere Zeit »ausklinken«, spricht man von einem Gap Year (Lücken- oder Brückenjahr), also von einer bewusst eingelegten Pause zwischen zwei Lebensabschnitten.
2.1 Freiwilligendienst leisten
Jugendliche, die sich sozial, politisch oder kulturell engagieren wollen, können einen Freiwilligendienst leisten, und so die Zeit nach Beendigung der Schulausbildung bis zum Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums sinnvoll nutzen, um anderen zu helfen. Das Engagement erfolgt ehrenamtlich, es ist zeitlich befristet und zum Teil gesetzlich geregelt.
Zu den bekanntesten Freiwilligendiensten gehören
der Bundesfreiwilligendienst,
die Jugendfreiwilligendienste (freiwilliges soziales Jahr und freiwilliges ökologisches Jahr),
der Europäische Freiwilligendienst und
der Internationale Jugendfreiwilligendienst.
Im Folgenden werden die wichtigsten Freiwilligendienste im Rahmen eines Überblicks vorgestellt. Weitere Einzelheiten unter 3.
2.1.1 Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst trat 2011 an die Stelle des Zivildienstes. Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und Katastrophenschutzes. Der Dienst steht Personen jeden Alters offen, wenn sie ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Auch Ausländer können am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen; Voraussetzung hierfür ist, dass sie über einen Aufenthaltstitel verfügen, der sie zur Erwerbstätigkeit berechtigt. Der Bundesfreiwilligendienst dauert mindestens sechs Monate und höchstens 18 Monate. Ausnahmsweise kann er bis zu einer Dauer von 24 Monaten verlängert werden, wenn dies im Rahmen eines besonderen pädagogischen Konzeptes begründet werden kann. In der Regel wird der Bundesfreiwilligendienst für zwölf zusammenhängende Monate geleistet.
Der Bundesfreiwilligendienst, der nicht außerhalb von Deutschland durchgeführt werden kann, wird als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet, insbesondere in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung und Jugendarbeit, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Kultur- und Denkmalpflege, des Sports, der Integration, des Zivil- und Katastrophenschutzes und in Einrichtungen, die im Bereich des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Bildung zu Nachhaltigkeit tätig sind.
Weitere Einzelheiten zum Bundesfreiwilligendienst unter 3.1.1.
2.1.2 Jugendfreiwilligendienste
Jugendfreiwilligendienste sind das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr.
Freiwilliges soziales Jahr
In einem freiwilligen sozialen Jahr können sich junge Menschen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in einer sozialen Einrichtung engagieren. Die Schulausbildung ist unerheblich. Das freiwillige soziale Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen, insbesondere in Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung und Einrichtungen für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Gesundheitspflege, der Kultur und Denkmalpflege und in Einrichtungen des Sports geleistet. Träger im Inland sind insbesondere die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Religionsgemeinschaften und die Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden). Als Einsatzbereiche kommen u.a. in Betracht
Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime,
ambulante Sozialdienste,
Rettungsdienste,
Sportvereine und Sportverbände,
Kindergärten,
Kirchengemeinden,
Kulturvereine,
Förderschulen,
psychiatrische Einrichtungen.
Das freiwillige soziale Jahr kann auch im Ausland geleistet werden. Und es kann als kombinierter Jugendfreiwilligendienst abschnittsweise sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden.
Das freiwillige soziale Jahr dauert mindestens sechs und höchstens 18 Monate. Der Dienst kann ausnahmsweise bis zu einer Dauer von 24 Monaten geleistet werden, wenn dies im Rahmen eines besonderen pädagogischen Konzepts begründet ist. Ist ein freiwilliges soziales Jahr zunächst auf weniger als 18 Monate abgeschlossen, kann (bei einem Einsatz im Inland) eine Verlängerung auf 15 Monate im Einverständnis mit dem Träger des freiwilligen sozialen Jahres erfolgen.
Weitere Einzelheiten zum freiwilligen sozialen Jahr unter 3.1.2.
Freiwilliges ökologisches Jahr
Ein freiwilliges ökologisches Jahr ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das die Möglichkeit bietet, sich für die Umwelt zu engagieren und das Wissen über ökologische Zusammenhänge zu erweitern. Es werden überwiegend praktische Hilfstätigkeiten geleistet. Gestärkt werden soll insbesondere der nachhaltige Umgang mit Natur und Umwelt. Das freiwillige ökologische Jahr setzt voraus, dass der Teilnehmer die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Unerheblich ist, welche Schulausbildung vorliegt.
Im freiwilligen ökologischen Jahr kann man sich u.a. engagieren
im praktischen Arten- und Biotopschutz (z.B. Anlage und Pflege von Biotopen, Gewässern oder Streuobstwiesen),
in der ökologischen Land- und Forstwirtschaft,
in der ökologischen Garten- und Landarbeit (z.B. auch in sozialen Einrichtungen mit behinderten Menschen),
im technischen Umweltschutz (z.B. Wind- und Sonnenenergie),
in der umweltorientierten Öffentlichkeitsarbeit bei Umweltorganisationen und Umweltbehörden,
in der Umweltbildung und -pädagogik.
Träger des freiwilligen ökologischen Jahrs sind häufig Jugendorganisationen von Kirchen und Umweltschutzverbänden. Diesen obliegen die Betreuung der Teilnehmer und die Auswahl der Einsatzstellen.
Wie das freiwillige soziale Jahr kann auch das freiwillige ökologische Jahr nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland oder als kombinierter Jugendfreiwilligendienst abschnittsweise sowohl im Inland als auch im Ausland geleistet werden.
Auch das freiwillige ökologische Jahr dauert in der Regel zwölf Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens 18 Monate in Vollzeit. In Ausnahmefällen kann es auf bis zu 24 Monate verlängert werden.
Weitere Einzelheiten zum freiwilligen ökologischen Jahr unter 3.1.2.
2.1.3 Europäischer Freiwilligendienst
Der Europäische Freiwilligendienst ist ein Bestandteil des EU-Bildungsprogramms Erasmus+. Ziel des Programms ist es, Solidarität und Verständnis der EU-Bürger im Verhältnis zu ihren europäischen Nachbarn zu fördern. Mit dem Europäischen Freiwilligendienst können sich junge Menschen im europäischen Ausland engagieren. Freiwillige verpflichten sich, für eine Organisation im Ausland zu arbeiten. Einsatzorte sind die Länder der Europäischen Union. Gelegentlich werden auch Projekte in an die EU angrenzenden Ländern (z.B. Türkei) oder in Partnerländern (z.B. Israel, Ägypten) angeboten. Als Einsatzbereiche kommen insbesondere Projekte in folgenden Bereichen in Betracht:
Sozialarbeit,
Gesundheit,
Chancengleichheit,
Behinderung,
Jugendförderung,
Medien und Kommunikation,
Umweltschutz,
Kunst und
Kultur.
Wer am Europäischen Freiwilligendienst teilnehmen will, muss seinen Wohnsitz in der Europäischen Union oder einem Partnerland (z.B. in der Schweiz) haben. Der Bewerber muss mindestens 16 und darf höchstens 30 Jahre alt sein. Freiwillige, die bei anderen Jugendfreiwilligendiensten keine oder nur geringe Teilnahmechancen haben, sollen im Bewerbungsverfahren bevorzugt werden. Das sind Bewerber ohne Schulabschluss oder mit Haupt- und Realschulabschluss, mit Migrationshintergrund oder mit erhöhtem Förderungsbedarf. Sprachkenntnisse sind keine Bedingung für eine Aufnahme in das Programm.
Projekte des Europäischen Freiwilligendienstes dauern zwischen zwei und zwölf Monaten. Unter Umständen kommt auch ein Kurzzeitdienst (mindestens zwei Wochen) in Betracht, etwa wenn eine Behinderung des Bewerbers einen längeren Auslandsaufenthalt nicht zulässt.
Weitere Einzelheiten zum Europäischen Freiwilligendienst unter 3.1.3.
2.1.4 Internationaler Jugendfreiwilligendienst
Der Internationaler Jugendfreiwilligendienst ermöglicht jungen Menschen, einen freiwilligen Dienst im Ausland zu leisten und dadurch interkulturelle, gesellschaftspolitische und persönliche Erfahrungen in einer anderen Kultur zu sammeln.
Der Dienst dient auch der beruflichen Orientierung. Die Freiwilligen gewinnen einen Überblick in einen von ihnen gewählten Tätigkeitsbereich. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst kann dem Grunde nach in jedem Land der Welt geleistet werden. Unterkunft und Verpflegung werden den Freiwilligen bei ihrem Auslandsaufenthalt kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Einsatzstellen sind gemeinwohlorientierte Einrichtungen, insbesondere
in den sozialen Einsatzbereichen, das heißt insbesondere die Arbeit mit alten, kranken und behinderten Menschen, mit Kindern und Jugendlichen,
in der Kultur, im Sport, in der Denkmalpflege,
im ökologischen Bereich, insbesondere im Naturschutz, in umweltbildenden Einrichtungen oder in der nachhaltigen Entwicklung,
im Bildungswesen sowie
in der Friedens- und Versöhnungsarbeit sowie Demokratieförderung.
Die Teilnahme am Programm des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes ist nur über einen der circa 130 Träger möglich. Eine nach Bundesländern geordnete Trägerliste ist unter www.auslandsfreiwilligendienst.de veröffentlicht.
Der Internationale Jugendfreiwilligendienst richtet sich an Jugendliche im Alter von 18 bis 26 Jahren. Dabei kommt es nicht darauf an, welche Schullaufbahn eingeschlagen wurde und abgeschlossen ist. Der Dienst dauert zwischen sechs und 18 Monaten.
Weitere Einzelheiten zum Internationalen Freiwilligendienst unter 3.1.4.
2.2 Auf Berufsausbildung oder Studium vorbereiten
Manchmal ist es gar nicht so leicht, sich für ein bestimmtes Studium oder eine Ausbildung zu entscheiden oder einen Studienplatz oder eine Ausbildungsstelle zu finden. In diesem Fall sollte man nicht gleich »die Flinte ins Korn werfen«, sondern die Zeit nutzen, sich gezielt auf das vorgesehene Studium oder die geplante Berufsausbildung vorzubereiten. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die zum Teil von der Agentur für Arbeit unterstützt werden. In Betracht kommen insbesondere
1 Praktika,
2 berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen,
3 die betriebliche Einstiegsqualifizierung und
4 das Berufsvorbereitungsjahr.
Im Folgenden werden die wichtigsten berufsvorbereitenden Maßnahmen im Rahmen eines Überblicks vorgestellt. Einzelheiten erfahren Sie unter 4.
2.2.1 Praktikum
Nach dem Schulabschluss kann die Zeit bis zum Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums dazu genutzt werden, ein Praktikum zu absolvieren. In diesem Zusammenhang können nützliche Informationen gesammelt werden, die der späteren Ausbildungsplatzsuche oder dem späteren Studium zugutekommen können. Insbesondere kann herausgefunden werden, ob die angestrebte Ausbildung oder das in Aussicht genommene Studium wirklich passt. Bereits die Praktikumssuche hilft nämlich, ein genaueres Bild über den angestrebten Job zu bekommen. Und selbst wenn sich am Ende des Praktikums herausstellt, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden, kann man daraus wertvolle Erfahrungen für die spätere Berufswahl gewinnen. Schließlich ist es auch wichtig zu wissen, was man nicht will.
Aber Praktikum ist nicht gleich Praktikum. Denn Praktika gibt es in verschiedenen Varianten: Pflichtpraktika und freiwillige Praktika.
Pflichtpraktika sind durch das Schul- und Hochschulrecht zur Ergänzung der theoretischen Ausbildung vorgeschrieben. Das Praktikum ist in der Regel vollständig in den Ausbildungsgang integriert, etwa als Praxissemester oder als Vorpraktikum vor dem eigentlichen Studienbeginn oder auch während der Semesterferien.
Freiwillige Praktika werden meist in Schul- oder Semesterferien, aber auch vor, während oder nach Abschluss einer Ausbildung absolviert, um beispielsweise vor, neben oder nach der Ausbildung bereits vorhandene theoretische Kenntnisse um praktische Kompetenzen zu erweitern. Ein freiwilliges Praktikum können Schüler und Schülerinnen aller Schulformen während der schulfreien Zeit in einem Unternehmen absolvieren. Das Praktikum gibt den Schülern und Schülerinnen die Gelegenheit, erste praktische Eindrücke von einem Beruf oder einer Branche zu sammeln. Nach Abschluss der Schulausbildung kann ein freiwilliges Praktikum bei der Orientierung für eine Berufsausbildung oder für ein Studium helfen.
Achtung: Zwischen den verschiedenen Praktikumsformen muss deshalb unterschieden werden, weil jeweils unterschiedliche gesetzliche Regelungen gelten. Auch unterscheiden sich je nach Praktikumsform die Rechte und Pflichten aus dem Praktikantenverhältnis. Wegen der Einzelheiten vgl. 4.1.
2.2.2 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
Im Rahmen der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen wird in erster Linie die Vorbereitung und Eingliederung in eine Ausbildung angestrebt. Den Teilnehmern soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen hinsichtlich einer möglichen Berufswahl zu überprüfen und zu beurteilen, sich anhand geeigneter Berufe zu orientieren und zu entscheiden. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sollen also den Übergang von der Schulzeit ins Berufsleben erleichtern.
Es werden die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung (unter Umständen auch durch den Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses) oder – sofern dies (noch) nicht möglich ist – für die Aufnahme einer Beschäftigung vermittelt. Die Maßnahme wendet sich an Jugendliche, die die Schulpflicht erfüllt, aber noch keine Ausbildungsstelle gefunden oder diese wieder verloren haben.
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen werden durch die Agentur für Arbeit gefördert. Dem Teilnehmer entstehen keine Kosten. Auch die Fahrtkosten werden von der Arbeitsagentur übernommen. Für einen nachträglichen Schulabschluss beträgt die Regelförderdauer zwölf Monate. Andere berufsvorbereitende Maßnahmen dauern je nach Maßnahme ebenfalls bis zu einem Jahr und können auf maximal 18 Monate verlängert werden.
Träger, die im Auftrag der Agentur für Arbeit berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen durchführen, sind regionale oder überregionale, kommerzielle, private, gemeinnützige oder öffentliche Bildungseinrichtungen und Wohlfahrtsverbände (z. B. Internationaler Bund, Kolpingwerk).
Weitere Einzelheiten zu berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen unter 4.2.
2.2.3 Betriebliche Einstiegsqualifizierung
Die betriebliche Einstiegsqualifizierung dient der Vorbereitung einer betrieblichen Ausbildung. Im Betrieb werden die Jugendlichen an die entsprechenden Ausbildungsinhalte herangeführt. Durch eine Kombination von Arbeiten und Lernen können sie in einem Tätigkeitsfeld eines Ausbildungsberufs in das Berufsleben starten. Die Tätigkeiten und Inhalte der Einstiegsqualifizierung sind stets Bestandteile staatlich anerkannter Ausbildungsberufe. Die Jugendlichen lernen den Betrieb und das Berufsleben kennen. Dadurch ist der Übergang in eine Ausbildung oder Beschäftigung jederzeit möglich. Eine an die betriebliche Einstiegsqualifizierung anschließende Ausbildung kann um bis zu sechs Monate verkürzt werden. Die erfolgreiche Teilnahme an einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung wird durch das betriebliche Zeugnis und ein IHK-Zertifikat bestätigt.
Die Einstiegsqualifizierung selbst ist allerdings keine anerkannte Berufsausbildung, sondern ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum. Ein solches Praktikum dauert zwischen sechs und zwölf Monaten. Die Teilnehmer bekommen vom Betrieb eine Vergütung. Diese kann von der Agentur für Arbeit bezuschusst werden.
Die betriebliche Einstiegsqualifizierung kommt insbesondere für Jugendliche mit individuell eingeschränkten Vermittlungsperspektiven in Betracht, die auch nach dem 30. September im Anschluss an die bundesweiten Nachvermittlungsaktionen von Kammern und der Agentur für Arbeit keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, ferner für Ausbildungssuchende, die noch nicht in vollem Umfang über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen sowie lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Ausbildungssuchende.
Weitere Einzelheiten zur betrieblichen Einstiegsqualifizierung unter 4.3.
2.2.4 Berufsvorbereitungsjahr
Das Berufsvorbereitungsjahr ist eine einjährige schulische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit. Das Berufsvorbereitungsjahr gibt es in den meisten Bundesländern. Dort, wo es nicht angeboten wird, gibt es ähnliche Angebote, beispielsweise das Berufsorientierungsjahr oder das Berufsgrundbildungsjahr.
Das Berufsvorbereitungsjahr bereitet auf die Berufsausbildung oder eine Arbeit vor. Es richtet sich an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche ohne oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss; auch Absolventen von Förderschulen kommen in Betracht. Es werden die beruflichen Kenntnisse aus verschiedenen Berufen vermittelt (z.B. Bautechnik, Metalltechnik, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Pflege). Ferner kann der Hauptschulabschluss oder ein vergleichbarer Abschluss erworben werden. Eine Ausbildungsvergütung wird nicht gezahlt.
Die Teilnehmer am Berufsvorbereitungsjahr besuchen üblicherweise eine berufsbildende Schule (Berufsschule oder Berufsfachschule). Dort erhalten sie ganztägig Unterricht in den von ihnen gewählten Berufsfeldern und in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Religion, Sport, Sozialkunde oder Wirtschaftslehre. Daneben vermitteln Betriebspraktika Eindrücke von der praktischen Seite des Arbeitslebens.
Das Berufsvorbereitungsjahr endet mit einer Abschlussprüfung in allgemeinbildenden und berufsbezogenen Fächern. Um den Hauptschulabschluss (bzw. einen gleichgestellten Abschluss) zu erwerben, sind in der Regel zusätzliche Prüfungen (z.B. in Deutsch und Mathematik) zu bestehen.
Weitere Einzelheiten zum Berufsvorbereitungsjahr unter 4.4.
2.3 Jobben und Geld verdienen
Jugendliche, die nach Beendigung der Schulzeit die Zeit bis zu einer Ausbildung oder einem Studium überbrücken wollen oder die Geld für einen längeren Urlaub oder eine größere Investition verdienen wollen, können sich einen Job suchen. Wichtig ist allerdings, dass das Ziel, eine Berufsausbildung zu beginnen oder ein Studium zu absolvieren, nicht aus den Augen verloren wird.
Die vorübergehende Beschäftigung kann im Rahmen eines »normalen« Arbeitsverhältnisses oder als sogenannte geringfügige Beschäftigung ausgeübt werden. Unabhängig von der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses wird der Jugendliche, der für eine Übergangszeit jobben will, Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts. Für ihn gelten neben den Regelungen des Arbeitsvertrags und den gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsrechts auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten gelten, wenn das Arbeitsverhältnis als Minijob ausgestaltet wird (Näheres dazu unter 5.).
2.3.1 Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer wird im Regelfall durch den Arbeitsvertrag begründet. Darin regeln die Vertragsparteien ihre gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen im Arbeitsverhältnis.
Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag kommt wie jeder Vertrag durch den Antrag und dessen Annahme zustande. Dabei ist unerheblich, wer den Antrag unterbreitet und wer diesen annimmt. Der Arbeitsvertrag bedarf grundsätzlich zu seiner Wirksamkeit keiner bestimmten Form. Er kann mündlich, schriftlich, ausdrücklich oder schlüssig durch eine entsprechende Arbeitsaufnahme abgeschlossen werden.
Ausnahmen von der Formfreiheit beim Abschluss des Arbeitsvertrags können gesetzlich geregelt sein. So bedürfen in einem befristeten Arbeitsvertrag Befristungsabreden der Schriftform (vgl. dazu unten). Weitere Schriftformerfordernisse können sich aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen ergeben.
Zwar bedarf der Arbeitsvertrag grundsätzlich keiner besonderen Form, gleichwohl hat der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass ihm der Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Niederschrift über die wesentlichen Vertragsbedingungen aushändigt. Diesen Anspruch haben alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt sind.
In die Niederschrift muss der Arbeitgeber mindestens aufnehmen:
Name und Anschrift der Vertragsparteien,
den Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,
den Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, einen Hinweis darauf, dass er an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann,
eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,
die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,
die vereinbarte Arbeitszeit,
die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.
!
Tipp: Wenn der Arbeitgeber seiner Verpflichtung, die wesentlichen Vertragsbedingungen in einer Niederschrift festzulegen und diese dem Arbeitnehmer auszuhändigen nicht entspricht, ist das Arbeitsverhältnis gleichwohl wirksam zustande gekommen. Der Arbeitnehmer kann auf die Erfüllung der Niederlegungs- und Aushändigungspflicht bestehen und diese gerichtlich durchsetzen.
Ein Jugendlicher, der noch nicht 18 Jahre alt ist, braucht für den Abschluss eines Arbeitsvertrags die Zustimmung der Eltern. Und mit Jugendlichen unter 15 Jahren kann in der Regel überhaupt kein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
Dauer des Arbeitsverhältnisses
Jedes zweite Arbeitsverhältnis wird mittlerweile befristet abgeschlossen. Im Gegensatz zum auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Arbeitsverhältnis endet das befristete Arbeitsverhältnis mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit automatisch. Es bedarf also keiner Kündigung.
Achtung: Die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der Befristung ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer ausgeschlossen, es sei denn, dass dies im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist allerdings zulässig.
Grundsätzlich ist die Befristung des Arbeitsverhältnisses nur zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund für die Befristung des Arbeitsverhältnisses liegt u.a. vor, wenn der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht (z.B. Beschäftigung eines Verkäufers für die Dauer des Weihnachtsgeschäfts) oder der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird (in Betracht kommt die Vertretung kranker, beurlaubter oder aus anderen Gründen an der Arbeitsleistung verhinderter Arbeitnehmer). Auch wenn kein sachlicher Grund vorliegt, kann ein Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von zwei Jahren befristet werden. Und bis zu der Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung des Arbeitsvertrags zulässig.
Achtung: Der Gesetzgeber möchte die Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen gesetzlich einschränken. Es muss also demnächst mit einer entsprechenden Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gerechnet werden.
!
Tipp: Die rechtsunwirksame Befristung des Arbeitsverhältnisses hat zur Folge, dass der Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen gilt. Allerdings geschieht dies nicht automatisch, sondern muss vom Arbeitnehmer durch Klage vor dem Arbeitsgericht geltend gemacht werden. Die Klage muss innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des Arbeitsverhältnisses beim Gericht eingereicht werden. Andernfalls endet das Arbeitsverhältnis trotz der Unwirksamkeit der Befristung.
Die Befristung eines Arbeitsvertrags ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wird. Es muss allerdings nicht der gesamte Vertrag schriftlich abgeschlossen sein, vielmehr ist es ausreichend, dass die Befristungsabrede schriftlich abgefasst und von den Vertragsparteien unterzeichnet ist.
Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnissen dürfen gegenüber unbefristet beschäftigten Arbeitnehmern nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.
Weitere Einzelheiten zum Jobben in einem »normalen« Arbeitsverhältnis unter 5.1.
2.3.2 Geringfügige Beschäftigung
Geringfügige Beschäftigungen spielen in der Arbeitswelt eine große Rolle. Dabei handelt es sich um Beschäftigungsverhältnisse, bei denen das Arbeitsentgelt eine bestimmte Grenze nicht überschreitet oder die nur kurz andauern. Daraus ergeben sich verschiedene sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Besonderheiten. Im Zusammenhang mit der geringfügigen Beschäftigung spricht man auch von einem Minijob oder 450-Euro-Job.
Formen
Eine geringfügige Beschäftigung kann in folgenden Formen erfolgen:
1 Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450,– € nicht übersteigt (sogenannte Minijobs). Zum Arbeitsentgelt gehören alle laufenden und einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden und ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. Zum regelmäßigen Arbeitsentgelt zählen auch anteilig Sonderzahlungen wie zum Beispiel Weihnachtsgratifikationen oder Urlaubsgeld. Ausgenommen sind Zuschläge während Feiertagsarbeit oder Nachtarbeit sowie Mitarbeiterrabatte und Trinkgelder. Weil diese Zuschläge als steuerfrei gelten, wird das Minijob-Gehalt durch sie nicht erhöht.
2 Um eine zeitlich geringfügige Beschäftigung handelt es sich auch dann, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage (bis 31.12.2018: drei Monate oder 70 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird (sogenannte kurzfristige Beschäftigung). Berufsmäßigkeit ist im Regelfall gegeben, wenn die Tätigkeit – und sei es mit Unterbrechungen – mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufgenommen, also häufig und voraussehbar aufgenommen wird. Auf den Verdienst kommt es bei kurzfristigen Beschäftigungen nicht an.
3 Die oben genannten Regelungen gelten auch, wenn die Beschäftigung ausschließlich in Privathaushalten ausgeübt wird. Eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor, wenn diese durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird (z.B. Zubereiten von Mahlzeiten, Reinigung der Wohnung, Versorgung und Betreuung von Kindern).
Achtung: Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen werden zusammengerechnet, ebenso geringfügige Beschäftigungen im gewerblichen Bereich mit geringfügigen Beschäftigungen im Privathaushalt. Wird die Geringfügigkeitsgrenze von 450,– € überschritten, tritt vom Tag des Überschreitens an neben der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung auch Versicherungspflicht in den anderen Zweigen der Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung ein.
Diskriminierungsverbot
Bei den geringfügig Beschäftigten handelt es sich arbeitsrechtlich regelmäßig um Teilzeitbeschäftigte. Deshalb gelten die gleichen arbeitsrechtlichen Grundsätze und Bestimmungen wie für Arbeitnehmer in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Geringfügig Beschäftigte haben demnach Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen, Sonderleistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Auch das allgemeine und besondere Kündigungsschutzrecht findet auf geringfügig Beschäftigte in vollem Umfang Anwendung.
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Seit dem 1.1.2013 sind geringfügig Beschäftigte bei Neueinstellungen Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern sie sich nicht durch Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen. Bleibt der Arbeitnehmer Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung, beläuft sich der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag auf 3,6 % (bzw. 13,6 % bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 % bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen im gewerblichen Bereich bzw. 5 % bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 18,6 %.
Lässt sich der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht befreien, zahlt nur der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung von 15 %. Als Folge erwirbt der Arbeitnehmer aber auch keine vollen Leistungsansprüche aus der Rentenversicherung. Die Befreiung kann nur für die Zukunft und im Falle der Ausübung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen nur einheitlich für alle Beschäftigungen erklärt werden.
Weitere Einzelheiten zum Jobben im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung unter 5.2.
2.4 Auszeit nehmen
Nicht selten haben Jugendliche nach dem Schulabschluss keinen Plan, keinen Ausbildungsplatz oder Studienplatz erhalten oder Sie wollen einfach eine Pause einlegen und eine Auszeit nehmen.
Viele Jugendliche nutzen diese Auszeit auch, um die Welt kennenzulernen. Wer das nötige Kleingeld unterwegs verdienen will, für den ist Work & Travel genau das Richtige. So kann die Reisekasse mit Gelegenheitsjobs vor Ort aufgebessert werden. Mit einem Sprachkurs können Kenntnisse einer Fremdsprache vertieft oder eine neue Fremdsprache erlernt werden. Das kann für die spätere Berufsausbildung oder das Studium wichtig sein. Als Au-pair kann man für eine bestimmte Zeit im Ausland bei einer Familie leben und deren Kinder betreuen.
Weitere Einzelheiten zur Auszeit unter 6.
3 Überblick über die rechtlichen und finanziellen Folgen
3.1 Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
Familienangehörige des Versicherten sind unter bestimmten Voraussetzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversichert. Dies ist u. a. vom Alter und dem Einkommen des Angehörigen abhängig. Die kostenfreie Familienversicherung besteht neben der gesetzlichen Krankenversicherung auch bei der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Die Familienversicherung besteht für