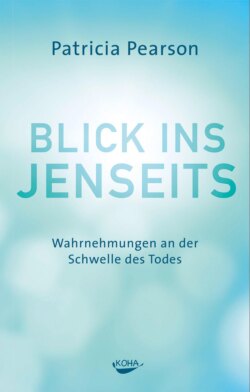Читать книгу Blick ins Jenseits - Patricia Pearson - Страница 6
Оглавление1
Eine erstaunliche Vision
Mein Vater starb in seinem blau gestreiften Schlafanzug in einem weichen Bett in einem stillen Haus. Er war nicht krank. Irgendwann gegen drei bis vier Uhr morgens seufzte er so vernehmlich, dass meine Mutter aufwachte. Ein Seufzen, ein Stöhnen, ein letzter Atemzug. Noch halb schlafend nahm meine Mutter an, er hätte einen schweren Traum, lehnte sich hinüber, um ihm über den Rücken zu streichen, und zog sich dann wieder in die Geborgenheit ihres unbewussten Dämmerzustands zurück. Als einige Stunden später das blasse Licht eines nördlichen Märzmorgens heraufzog, erhob sie sich und ging um den ausgestreckten Körper des Mannes, mit dem sie seit 54 Jahren verheiratet war, herum ins Badezimmer.
Sie stieg die Treppe hinab und widmete sich den üblichen Küchenritualen. Kaffee aufsetzen, die Muffinhälften in den Toaster stecken, Radio hören. Ich wurde gerade zu einem nagelneuen Buch interviewt. Da war also das jüngste ihrer fünf Kinder im Radio und plauderte mit eindrucksvoller Autorität über das Gerichtsverfahren eines Mannes, der eine tote Fliege in seiner Wasserflasche gefunden und deshalb einen unermesslich hohen psychologischen Schaden davongetragen hatte.
»War es berechtigt?«, fragte mich der Moderator. War es möglich, dass der Anblick einer toten Fliege ein ganzes Leben erschüttern konnte?
Meine Mutter strich sich Marmelade auf ihren Muffin und dachte über den kommenden Tag nach. Ein paar Verabredungen, ein Mittagessen, ein Bummel mit ihrer Enkelin Rachel, die die Frühjahrsferien bei ihr verbrachte. Sie fragte sich nicht, warum Geoffrey, mein Vater, noch im Bett lag. Es gab keinen Grund zur Sorge um diesen gesunden Mann, der gerade 80 geworden war.
Familien neigen dazu, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Krisen hin auszurichten, und im Frühjahr 2008 waren wir alle auf meine Schwester Katharine fokussiert. Sie war es, der das Sterben drohte, nicht mein Vater. Die quicklebendige Katharine, eine ungewöhnlich liebenswerte Frau, Mutter, Schwester und Geliebte, litt unter den sich wild ausbreitenden Brandherden eines metastasierenden Brustkrebses. Katharines Schicksal war für unsere Familie zu der »extremen Wirklichkeit« geworden, wie Virginia Woolf es mal bezeichnete.
Mein Vater spielte seine Rolle ganz unvermutet.
»Rachel«, sagte meine Mutter und schüttelte sanft die Schulter ihrer Enkelin, die in dem Gästezimmer im Dachgeschoss schlief. »Rachel.« Meine Nichte öffnete blinzelnd die Augen, doch der Ausdruck meiner Mutter – rohe, unverstellte Verletzlichkeit im Gesicht der Matriarchin – machte sie sofort hellwach.
»Opa wird nicht mehr aufwachen.«
An jenem Morgen erhielten wir alle den Anruf mit der Was-um-Himmels-willen-redest-du-da-Neuigkeit, die meine Mutter mit Unterstützung einer noch ganz verwirrten Rachel in der Familie verbreitete. Doch meine 160 Kilometer östlich von meinen Eltern lebende Schwester Katharine nahm die Nachricht anders auf.
»In der Nacht, in der mein Vater starb«, erzählte sie ein paar Wochen später auf der Trauerfeier, »hatte ich eine außergewöhnliche spirituelle Erfahrung.« Dazu muss man wissen, dass meine Schwester keine Neigung zu spirituellen Erfahrungen hatte. Als alleinerziehende Mutter zweier jugendlicher Söhne war sie mit Stress vertraut, sie lachte gerne, und sie war äußerst sportlich. Sie verfügte über einen fantastischen Intellekt und beherrschte drei Sprachen fließend. Doch auf Gott hatte sie bei alldem eher wenig geachtet.
»Es war am frühen Morgen, ungefähr um halb fünf«, berichtete sie den Trauergästen, »und ich konnte mal wieder nicht schlafen, als ich plötzlich anfing, diese erstaunliche spirituelle Erfahrung zu machen. Zwei Stunden lang spürte ich nichts als Freude und Heilung.« Während sie dies erzählte, war sie von einer Art Licht umhüllt, einem Strahlen, und die Melodie ihrer Stimme berührte alle, die in der Kirche saßen, Gläubige, Atheisten und Agnostiker. Sie hielt sich am Podium fest, entschlossen, trotz der Gleichgewichtsstörungen durch ihre unheilbare Krankheit die Schönheit des Augenblicks zu wahren. »Ich spürte Hände auf meinem Kopf und erlebte in einer Vision nach der anderen eine glückliche Zukunft.«
Als sie ihren älteren Sohn an jenem Morgen noch vor dem Telefonanruf zur Schule fuhr, hatte sie ihm von dieser merkwürdigen, wundervollen Erfahrung in den frühen Morgenstunden erzählt. In ihrem Tagebuch hatte sie geschrieben: »Ich dachte, vielleicht kommt es daher, dass Menschen für mich beten? Und dann dachte ich an Dad, wie er seine Augenbraue hochzieht und mich wegen meiner Überheblichkeit aufzieht.« Erst am nächsten Vormittag begriff sie, was es mit dieser machtvollen Welle der Energie und Freude auf sich gehabt hatte.
»Ich weiß jetzt, dass es mein Vater war«, sprach sie zu den Trauergästen. Sie sagte es einfach so, ohne die üblichen Demutsbezeugungen in Richtung Wissenschaft und Vernunft, ohne Floskeln wie: »Sie mögen mich vielleicht für verrückt halten, aber …« – nichts davon. »Ich fühle mich voller Demut, zutiefst gesegnet und geliebt«, ergänzte sie schlicht und setzte sich. Ein astraler Vater. Da und doch nicht da. Liebe aus dem Unsichtbaren. Eine Art segensreicher Begleiter, dessen lichtvolle Zuwendung zutiefst bewegt.
Geistererfahrungen sind in unserer Familie nicht üblich. Als ich am 19. März, am Tag nach dem Tod meines Vaters, im Haus meiner Eltern ankam und von Katharines Vision hörte, brach ich in dem mit Teppich ausgelegten Flur zusammen. Mit einem hysterischen Lachanfall kämpfend, kroch ich an der Garderobe vorbei. Meine Reaktion war nicht verächtlich, sondern eher ein Ausdruck meiner kompletten Hingabe an das Unglaubliche. Die Wirklichkeit befand sich in Schwingung, sie oszillierte und schien kurz vor dem Zerbersten.
»Dad ist tot, Dad ist tot«, hatte ich mir seit vierundzwanzig Stunden vorgesagt. Wie ein Kind, das sich eifrig bemüht, neue Anweisungen über die Art, wie die Dinge sind, auswendig zu lernen, war ich in dem vereisten Park neben meinem Haus auf und ab gegangen. Dad ist tot.
Und jetzt hatte Katharine eine Vision gehabt.
Es traf uns wie eine Art Nachbeben. Doch gleichzeitig erschien es sofort zutiefst sinnvoll, wie ein perfekt passendes Puzzlestück. Ohne darüber zu sprechen, waren wir als Familie überzeugt, dass er da etwas von höchster emotionaler Eleganz bewerkstelligt hatte. Er war für seine Tochter gestorben. Oder er war unwissentlich gestorben und hatte dann eine geheimnisvolle Gelegenheit ergriffen, sie in ihrem Schlafzimmer in Montreal zu besuchen und sie liebevoll zu trösten, bevor er sich weiter auf den Weg machte.
Später erfuhr ich, dass solche Erfahrungen nach dem Tod eines Menschen nicht selten, sondern erstaunlich häufig sind. Doch das Wissen darum wird von den Familien als etwas Kostbares bewahrt und vor achtlosen Fremden verborgen.
Ich sollte in dem folgenden Jahr noch viel über diese verborgene Welt um mich herum lernen, doch zu jenem Zeitpunkt begriff ich nur: Für Katharine war es ein unglaubliches Geschenk. In den vorhergehenden zwölf Monaten hatte Aufwachen mitten in der Nacht immer bedeutet, sich wieder an ihre quälende Situation zu erinnern, in deren Schrecken sie in der Dunkelheit zu ertrinken drohte. Wie eingeschränkt ist doch unsere euphemistische Sprache geworden, wenn wir davon sprechen, dass jemand mit dem Krebs »kämpft«, ohne ihm oder ihr die Shakespeare-hafte, ungeheure Verletzlichkeit einer Ophelia oder eines Lear zuzugestehen, als könnten diese Menschen einfach pragmatisch und distanziert ihre Truppen befehligen.
Ich kannte meine Schwester besser als irgendeinen anderen Menschen in meinem Leben, außer vielleicht meinen Kindern. Sie war nicht mehr und nicht weniger tapfer als Jesus, als er rief: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« An dem Abend jenes Tages, an dem ihr der Arzt in der Notaufnahme trocken erklärt hatte, sie hätte Hirnläsionen, stand sie laut klagend unter der Dusche und flehte ein abstraktes Universum an, ihr noch zehn Jahre zu geben, bis ihre Söhne mit der Ausbildung fertig und verheiratet seien.
Und dann plötzlich, als unser Vater starb – ohne zu wissen, dass er gestorben war –, dieses überraschende Gefühl der Gelassenheit, der Geborgenheit und der Freude. Eine ganze Weile lang – sie konnte nicht sagen, ob es Minuten oder Stunden waren – sah Katharine sich selbst – als schaue sie in den Spiegel der Zukunft oder tauche darin ein? –, wie sie mit ihrer noch nicht geborenen Enkelin auf dem Fußboden ihres Schlafzimmers spielte. Ihr war irgendwie klar, dass es das Kind ihres Sohns Graeme war, ein fünf Monate altes Baby namens Katie. Ein kleines, wackliges Wesen, das sich abmühte, aufrecht zu sitzen. In ihrer Vision half ihm Katharine, indem sie ihm den Rücken hielt. Sie war von der niedlichen Kleinen mit ihrer lustigen winzigen Schleife im Haar völlig hingerissen.
»Sie war so schön«, erzählte sie Graeme über sein zukünftiges Elfenkind, als sie ihn an jenem Morgen zu seiner Schule fuhr. Alles wird gut, in jeder Hinsicht.
Als sie wieder zu Hause war, klingelte das Telefon, und meine Mutter erzählte, dass unser Vater gestorben war.
Anfang April flog ich nach Arizona, um den Grand Canyon zu besuchen. Ein Scan hatte offenbart, dass Katharines Krebs sich auf die Knochen und die Leber verbreitet hatte. »Das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen«, hatte der Dichter Rainer Maria Rilke geschrieben. Ich las es eine Weile später und dachte: Ach ja.
Fliegen umschwirrten die Ohren der Maultiere, die den Bright Angel Trail am Südrand des Canyons entlang hinabstiegen und deren Hufe ein paar Hundert Meter vor uns lebhaft den steilen Pfad meisterten. Mein Mann und ich lehnten uns instinktiv in Richtung Felswand, während wir den Maultierreitern hinterherwanderten, in ehrfürchtigem Schrecken vor der abgründigen Leere, die uns fast hinabzuziehen schien, als wolle sie uns einladen, kopfüber kilometerweit in die Tiefe und in unser Verderben zu stürzen.
Ob nur Touristen diesen steinigen Pfad hinunterkletterten, fragte ich mich, oder auch Pilger? In der Absicht, sich am Felsen entlanghangelnd in Demut zu üben, im Bewusstsein, wirklich gar nichts über das Unermessliche zu wissen, was sie umgibt, und doch verlockt durch dessen Einladung? Als im 16. Jahrhundert ein Spähtrupp der Konquistadoren den Canyon zum ersten Mal erblickte, trauten sie ihren Augen und hielten den Colorado River in der Tiefe für einen Bach, der den Pferden bis knapp ans Knie reichen und den man leicht in einer Viertelstunde durchqueren könnte. Sie begriffen nicht, dass der Abgrund von Rand zu Rand 16 Kilometer misst und der Fluss in der Tiefe bis zu anderthalb Kilometer breit ist.
Wir begreifen es heute auch nur, weil es in den Reiseführern steht. Wir stellen unseren Blick entsprechend ein und schätzen die Tiefe anhand dessen, was wir über den Fluss wissen: Wenn dieses blaue Band da unten anderthalb Kilometer breit ist, dann ist diese Höhe atemberaubend. Wir kauern uns in den Supai-Sandstein. Wie wissen wir, was unendlich ist und was nicht? Wem trauen wir: unseren Augen oder unseren Instinkten, unserem Reiseführer oder unserem Bauchgefühl?
Der Tod meiner Schwester stand kurz bevor, vielleicht in einem Monat. Ich spürte das, obwohl ihr keine Prognose gegeben worden war – sie wollte es nicht – und sie immer noch zum Sport ging. Die Leute um sie herum nannten sie schon »Lance Armstrong von Montreal«, und so elegant, sportlich und stark, wie sie war, passte diese Rolle gut zu ihr. Ich war mir ihres Sterbens so schmerzlich bewusst, dass es gefährlich schien zu atmen, denn jeder Atemzug markierte das Verstreichen der Zeit. Ich spürte, wie die Uhr ständig tickte, wie sie mich hinterging, mich im Stich ließ, wie jeder Atem, der mir entwich, mir das Herz brach.
»Doch nicht so bald, oder?«, fragte mein neben mir wandernder Mann mit unsicherer Stimme, wissend, wie sehr ich das Klingeln meines Handys fürchtete. Doch ja, so bald. Ich hatte recherchiert. Die durchschnittliche Lebenserwartung nach Metastasen im Gehirn bei entzündlichem Brustkrebs: drei Monate. Doch ich war allein mit diesem Wissen, denn Katharines Onkologe sprach nur in Kriegsmetaphern. Derzeit setzte er die »schwere Artillerie« ein, wie er es nannte. In den regenverhangenen Schützengräben explodierten die Granaten.
Meine Uhr tickte innerlich und intuitiv. Was tun, wenn die Welt anders gelesen werden muss, wenn die gewöhnlichen Informationskanäle versperrt sind?
Nach etwa einem halben Kilometer bergab machten wir Rast. Mein Mann zog los, um Naturgeräusche aufzunehmen, eine Leidenschaft von ihm, und ich kauerte mich in den schmalen Schatten eines überhängenden Felsens, der aus dem Hang ragte. Rückwärtig bot sich mir ein anderer Ausblick, da türmte sich der Felsen über mir. Vor meinem nach hinten gedrehten Kopf erhob sich eine riesige Felswand, so hoch wie ein Wolkenkratzer. In der schimmernden Luft zog hoch über mir ein Rotschwanzbussard seine Kreise.
Alles, was ich sah, bezeichnete ich unwillkürlich: ein Raubvogel, eine Felswand, die raschen, vorsichtigen Bewegungen eines Erdhörnchens. Ein paar französische und deutsche Touristen schleppten sich vorüber, atemlos, mit grell-blauen Rucksäcken. Jemandes Hund trottete vor sich hin, die Fliegen, der Dung der Maultiere. Weit weg das Brummen eines Hubschraubers.
Wie wäre es wohl, wenn ich vor etlichen Jahrhunderten als Hualapai-Frau hier Rast gemacht hätte? Hätte ich den Ausblick auch in seine Bestandteile zerlegt? Oder wäre mir die Landschaft einfach voller bedeutungsvoller spiritueller Kraft erschienen, und der Vogel wäre nicht einfach Vogel, sondern ein Lied gewesen?
»Keiner hat die Welt wirklich gesehen«, schrieb der Metaphysiker Gaston Bachelard, »wenn er nicht geträumt hat, was er sieht.« Vater tot und Schwester sterbend. Zeit, Bedeutung und Spiritualität willkommen zu heißen, auch wenn sich der Arzt gerade über die Wirksamkeit der letzten Chemo-Runde auslässt.
Wir kletterten wieder aus dem Canyon, oft innehaltend, um aus den transparenten Plastikschläuchen unserer neumodischen Rucksäcke Wasser zu trinken. Als wir den Rand des Canyons erreichten, sah ich einen Regenbogen. Mitten im Wüstenhimmel hing ein perfekter, strahlender kleiner Regenbogen, als hätte ein Kind einen Aufkleber an einem Fenster angebracht. Angesichts des trockenen Klimas schien das so merkwürdig, dass ich bewusst auf die Uhr schaute. Kurz vor Mittag.
Am Abend versank die Sonne mit einem atemberaubenden, alles überströmenden Licht im Canyon. Von meinem Liegestuhl auf der Veranda der El Tovar Lodge aus rief ich Katharine in Montreal an. Keine Antwort.
»Kitta-Kat«, sprach ich auf den Anrufbeantworter, »ich sitze hier am Rand des Grand Canyons.« Am Ende der Welt, im Zusammenströmen von Schönheit und Schrecken, hier für dich, hier ohne dich. »Ich denke die ganze Zeit an dich.«
Sie antwortete nicht, meine Schwester. In der Stunde, in der ich am Wüstenhimmel den Regenbogen gesehen hatte, kurz vor Mittag, war sie mit akuter Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, und die Ärzte hatten sie gedrängt, eine Patientenverfügung zu kritzeln.
Eine Woche später lag ich innig verschränkt mit ihr auf ihrem schmalen Krankenhausbett in Montreals Royal Victoria Hospital und sah in ihrer kleinen, mit einem Vorhang abgetrennten Nische mit ihr zusammen fern. Glatzköpfig aus ihrem Klinikhemdchen hervorschauend, schlürfte sie durch einen Strohhalm Pepsi, die Hand voller blauer Flecke von all den IV-Zugängen, die Beine zu blass und dünn. Mein Gesicht war noch von der Sonne Arizonas gebräunt, während meine schöne Schwester von Steroiden aufgequollen und von der langsam zurückgehenden Blutinfektion gerötet neben mir lag. Sie bekam endlich Morphium, und zum ersten Mal, seit sie hier war, zeigte sich in ihren Mundwinkeln ein kleines Lächeln. Sie hatte die ganze Woche unter Wellen heftigster Kopfschmerzen gelitten. In der Klinik hatten sie ihr nichts als Tylenol angeboten, weil sie sie auf die Infektion hin therapierten und es keine Kommunikation mit dem Team gab, welches sie gegen den Krebs behandelte. Aufgrund von Katharines üblicher Anmut und Gefasstheit hatten die Ärzte und Schwestern auf ihrer Station nicht gemerkt, wie sehr sie litt, bis ich um drei Uhr morgens schließlich einen tasmanischen Teufels-Wutanfall hinlegte und drohte – ich bin nicht stolz darauf –, der Stationsschwester das Bein abzusägen und ihr dann Tylenol anzubieten, wenn sie nicht aufhörte, dies als das Einzige zu bezeichnen, was für Mrs. Pearson »erlaubt« sei.
Da waren wir also, meine Schwester und ich, Händchen haltend auf ihrem Bett, und schauten uns Berichte über die amerikanischen Vorwahlen an, als ihr Onkologe hereinkam, der endlich mitbekommen hatte, dass sie auf dieser Station lag und auf Blutvergiftung behandelt wurde. Er verkündete, sie würde nun in die Palliativ-Abteilung verlegt. Keine Chemo mehr. Keine Bestrahlung. Die Waffen sollten ruhen. Jetzt ginge es, seinen Worten gemäß, darum, »die Symptome unter Kontrolle zu behalten«.
Am 14. Mai 2008 kam Katharine ins Hospiz. Der Arzt der Palliativ-Abteilung meinte, es könne sich höchstens noch um Wochen handeln, aber niemand sagte es ihr. Sie konnte sich weiter einen endlosen Horizont vorstellen, fern oder nah, hell oder dunkel. Sie fragte nicht. Sie wurde stattdessen zu einer friedvollen Königin, die ihrem Hofstaat von fünfzig oder mehr Freunden, Verwandten und Kollegen vorsaß, die alle für ein letztes Gespräch, einen letzten Kuss vorbeikamen. Über den kurzen Flur des Hospizes ergoss sich ein Strom von weinenden Managern in schicken Anzügen und gut betuchten Frauen mit rot geränderten Augen und Veuve-Clicquot-Flaschen im Arm. Nur noch einmal anstoßen, noch einmal miteinander lachen.
Die Hospiz-Schwestern erzählten mir später, wie sie das beeindruckt hatte. Sie waren mehr an kleine Familiengruppen gewöhnt, die in Stille ab und an ältere Patienten besuchten. Sie sahen uns Champagnerflaschen köpfen, während wir Katharines Lieblingssongs spielten und sie sich tanzend in ihrem Bett wiegte. Wir brachten ihr alle Nahrungsmittel, nach denen sie ein flüchtiges Verlangen äußerte, und Maiglöckchen, um ihre Nase in ihnen zu versenken. Nie habe ich Menschen erlebt, die so herrlich emotional aufeinander eingeschwungen waren wie wir damals im Mai, als meine Schwester im Sterben lag. Wenn sie mehr Energie wollte, drehten wir auf, wenn sie weniger wollte, schraubten wir die Energie runter. Die Abstimmung war so fein, dass wir Besucher, die wohlmeinend, aber in der unpassenden Energie hereinkamen, wie eine Rugbymannschaft aus dem Feld drängten. Bitte raus, raus! Ihr seid zu plapperig/zu traurig/zu dominant/zu sehr im Machbarkeitswahn.
Wenn ich meine Schwester auf die Wange küsste, küsste sie mich zurück und betrachtete mich auf so liebevolle Art, dass es mich verblüffte. Großzügige Liebe, freigesetzt durch Bedürftigkeit. Oft saßen wir wortlos beisammen, während sie schlief – meine anderen beiden Schwestern, mein Bruder und ich. Manchmal massierten wir ihr die Hände mit Creme und sangen leise für sie. Ihr Liebster, Joel, spielte auf seiner Gitarre. Meine von zwei Trauerwellen erschütterte Mutter las ihr die Liebesgedichte vor, die unser Vater Anfang der 1950er für sie verfasst hatte.
Eines Nachmittags kam Katharines Exmann mit einem riesigen Strauß Frühlingsblumen, die, wie er erklärte, anonym auf ihrer ehemals gemeinsamen Türschwelle hinterlegt worden seien. »Alle aus der Nachbarschaft lieben dich, Katharine«, erklärte er mit ernstem Nachdruck.
»Es gibt bestimmt auch jemanden, der mich nicht liebt«, erwiderte sie trocken-amüsiert. Sie sprach nur noch wenig in jenen letzten zehn Tagen ihres Lebens. Hier und da ein paar Sätze, oft nur ein, zwei Worte. Doch aus allem, was sie sagte, ging hervor, dass sie präsent war und alles mitbekam. Deshalb fanden wir es umso bemerkenswerter, dass sie so zufrieden schien. Sie genoss unsere Gesellschaft und die Musik, die wir spielten, und betrachtete bewundernd den Garten hinter ihrem Fenster und das Lichtspiel in den Vorhängen.
»Wow, das war seltsam«, sagte sie einmal, als sie mit einem entzückten Lächeln erwachte. »Ich habe geträumt, ganz von Blumen eingehüllt zu sein.«
Alles erschien ihr interessant – interessant und zusagend, als befände sie sich in einem unbekannten, angenehmen Abenteuer. Sie sah großartig aus, als würde sie von innen leuchten. Manchmal unterhielt sie sich flüsternd mit Personen, die ich nicht sehen konnte. Zu anderen Zeiten starrte sie an die Zimmerdecke und zeigte eine Fülle von Ausdrücken im Gesicht – verwirrt, amüsiert, skeptisch, überrascht, beruhigt – wie eine Zuschauerin, die in einem Planetarium eine himmlische Lichtshow genießt.
Ich betrachtete sie sehnsüchtig fragend, aber sie konnte es mir nicht übersetzen. Meine Schwester, mit der ich jedes Geheimnis geteilt hatte, befand sich bereits jenseits der Worte. »Es ist so interessant«, begann sie eines Morgens und fand dann keine Worte mehr.
»Es muss echt frustrierend sein, es nicht ausdrücken zu können«, sagte ich leise, und sie nickte. Wir legten die Stirn aneinander.
Ich konnte nur anhand der Berichte anderer raten oder ahnen, was sie erlebte, anderer, die ihre Stimme wiedergefunden hatten. Später las ich beispielsweise, was der Schweizer Genealoge Albert Heim 1892 geschrieben hatte, nachdem er von einem Berg gestürzt war: »Da war kein Kummer, auch keine lähmende Furcht. Keine Sorge, keine Spur von Verzweiflung oder Schmerz. Eher ein ruhiger Ernst, tiefe Akzeptanz und eine deutliche geistige Lebendigkeit.«
Wir könnten sagen: Nun, sie hat vielleicht vergessen, dass sie stirbt. Aber dem war nicht so.
»Ist mit Mum alles in Ordnung?«, fragte sie mich manchmal besorgt. Oder: »Ich glaube, ihr löst euch noch schneller auf als ich.«
Und das war auch so. Mein Gehirn war ein zusammenbrechender Computer, ein Auto im Leerlauf, ein alter, rauschender Schwarz-Weiß-Fernseher. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, denn ich konnte meine eigene Auflösung nicht mehr intellektuell beobachten. Ich war verloren, aber Katharine war es nicht. Sie wusste sehr wohl, dass sie im Sterben lag, und sie wusste noch mehr. Achtundvierzig Stunden vor ihrem Tod sagte sie uns, sie sei jetzt auf dem Weg. Ganz wörtlich, im Sinne von: »Ich gehe jetzt.« Wie wusste sie das? Die Zeit im Hospiz hätte zwei Monate, sechs Monate oder zwei Jahre dauern können. Schon allein die Hoffnung hätte sie zu solch einer Sicht bewegen können; die ersten elf Monate ihrer Krankheit hatte sie von Hoffnung gelebt.
Einer Harvard-Studie zufolge überschätzen 63 Prozent der Ärzte die restliche Lebenszeit ihrer unheilbar kranken Patienten erheblich. Die Patienten selbst werden zum Ende hin oft äußert präzise. Manche wissen den Zeitpunkt ihres Ablebens bis auf die Stunde genau.
Eines Morgens wachte Katharine auf und sagte mit klarer Stimme ratlos zu Joel, der zerzaust neben ihr auf dem Krankenbett lag: »Ich weiß nicht, wie ich gehen kann.« Als wolle sie etwas Schwieriges lernen, wie Wasserski fahren oder Brotteig herstellen. Offenbar fühlte sie nicht mehr wie wir in unserer hungrigen, begeisterten Freude, sie noch lebendig anzutreffen, wenn wir jeden Tag an ihre Seite eilten. Sie zog Joel damit auf, er sähe in seiner hohläugigen Aufgewühltheit aus wie ein Drogenabhängiger. Sie blieb präsent, aber sie war auch woanders. Katharine hatte sich auf eine neue Ebene des Bewusstseins begeben, auf die wir ihr nicht mehr folgen konnten.
An jenem Nachmittag schaute sie lange durch die Terrassentüren, mit einem Blick, der mir, die ich neben ihr saß und ihre Hand streichelte, etwas entnervt erschien. Verärgert.
»Was siehst du?«, fragte ich sie.
Sie hob schwach den Arm und wies in Richtung des Gartens: »Nutzlose Flugbegleiter.«
Wir lachten alle überrascht. In diesem Moment kam eine Hospiz-Helferin mit einem Wagen mit Kaffeegebäck herein.
Katharine wandte sich aufmerksam der neuen Besucherin zu und fragte: »Wie ist die Lage?«
Die Helferin antwortete mit fröhlicher Stimme: »Nun, die Lage ist so, dass wir Zitronentörtchen, Schokocreme-Schnitten und Haferkekse haben. Alles selbst gebacken.« Sie schien mit ihrem Angebot zufrieden.
Meine Schwester sah sie an, als sei sie übergeschnappt.
»Ich meine«, Katharine räusperte sich, denn ihre Lungen fingen an, sich mit Wasser zu füllen, »wann gehe ich?«
Joel unterdrückte meisterhaft seinen rasenden Schmerz darüber, nach nur drei gemeinsamen Jahren die Liebe seines Lebens zu verlieren, und antwortete mit indischem Akzent (sie hatten sich in Neu-Delhi kennengelernt) und wackelndem Kopf: »Das entscheidet ihr, du und Gott.«
Katharine ging in der darauffolgenden Nacht, in Stille und bei Kerzenlicht, während meine Wange auf ihrer Brust und meine Hand auf ihrem Herzen lagen. Ich spürte, wie ihr Atem langsamer wurde und nachließ wie die Wellen der auslaufenden Gezeiten. Joel saß auf der einen Seite des Bettes, meine Schwester Annie auf der anderen. Die Schwester kam barfuß und mit Taschenlampe herein, um den Tod mit einem wortlosen Nicken zu bestätigen, und wir salbten Katharines Körper mit Öl und wickelten sie in Seide. Die Hospiz-Mitarbeiter stellten eine brennende Kerze ins Fenster.
Meine Mutter und Katharines Patin Robin im fast 5000 Kilometer westlich gelegenen Vancouver erwachten aus dem Schlaf, als hätte die Zeit plötzlich einen anderen Klang. Die ganze Welt sollte um den Verlust solch eines wundervollen Mädchens trauern, ging es Robin noch halb im Traum durch den Sinn, als die Vorhänge im ersten Morgenlicht raschelten.
Ich erinnere mich daran, wie ich mein Gesicht in den Wind hielt nach Katharines Tod, wie ich die Luft spürte, die Kälte und die Flüchtigkeit, die Dringlichkeit. Jeden Tag Wind im Gesicht, meine Aufmerksamkeit auf völlig neue Weise wiederfindend. Ich war mir des Atems bewusst, dessen, was die alten Griechen Pneuma nannten, einer beseelten Welt. Ich schlang die Luft in mich hinein.
»Willkommen in unserer Gemeinschaft«, sagte in jenem Sommer jemand mit freundlicher Ironie zu mir und bezog sich damit auf diesen verrückten Perspektivwechsel, der mit der Trauer einhergeht, und genauso fühlte es sich an. Plötzlich waren da Menschen, die verstanden, wie man sich fühlt, wenn man ständig nach Luft schnappt. Es stellte eine unglaublich starke Verbindung her; selbst wenn wir nichts anderes gemeinsam hatten, war uns jetzt der Tod gemeinsam. Ich kann mir gut vorstellen, wie dies vor zwei- oder fünfhundert Jahren, als der Tod und seine Rituale eine Gemeinschaftsangelegenheit waren, eine Grundlage für Stammeszugehörigkeit bildete. Heute scheint es in so vieler Hinsicht tabuisiert. Die Erfahrung der Trauer ist gesellschaftlich zerbrochen. Wir können einander keine allgemein stimmigen Beileidsbezeugungen wie »Dein Vater und deine Schwester sind jetzt bei Gott« anbieten. Die Leute fühlen sich verunsichert und unwohl um einen herum, und jene, die wissen, wie unsere Welt aus den Angeln gehoben wurde, sagen Dinge wie: »Ja, meine Liebe, ich weiß.« Alles fühlt sich seltsam an. Wir reagieren auf andere Zeitklänge, wir ringen um Luft.
Denn eine Untereinheit – ungefähr die Hälfte der Mitglieder dieses Volkes – ist noch durch ein weiteres, noch leiseres, fast unsichtbares Element miteinander verbunden: das Gefühl, einem fundamentalen Mysterium begegnet zu sein. Wir haben von den Sterbenden gelernt, dass es Kommunikationskanäle gibt, derer wir uns vorher nicht bewusst waren, unbekannte oder lang vergessene Pfade, über die wir Dinge auf geheimnisvolle Weise wissen und uns auf geheimnisvolle Weise miteinander verbinden können, auch mit den Sterbenden und Toten.
Der Eindruck, die Toten könnten uns eine Tür öffnen, die irgendwo hinführt, entstand zunächst durch leise anvertraute Geschichten. Im Sommer und Herbst 2008 begannen die Leute, mir Dinge zu erzählen – Freunde und Bekannte, die ich seit Jahren kannte, aber auch Fremde, die im Flugzeug neben mir saßen oder mit denen ich in einer Bar ins Gespräch kam. Wenn ich ihnen erzählte, was ich mit meinem Vater und meiner Schwester erlebt hatte, antworteten sie mit eigenen Erfahrungen. Meistens begannen sie mit Bemerkungen wie: »Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber …«, oder: »Wir haben da immer nur in der Familie drüber gesprochen, aber wenn Sie das Thema erforschen möchten …«, worauf außergewöhnliche Geschichten über Visionen auf dem Sterbebett, Nahtoderfahrungen und plötzliche Erscheinungen von Sterbenden oder nahestehenden Menschen in Gefahr folgten. Es waren alles kluge, vernünftige Menschen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es überall um mich herum diese unterirdische Welt gab.
Der Direktor eines großen Musikunternehmens fuhr mich eines Abends nach einem Geschäftsessen nach Hause. Als ich ihm erzählte, ich würde erwägen, über die Dinge zu schreiben, die in meiner Familie vorgefallen waren, parkte er den Wagen vor meinem Haus, ohne Anstalten zu machen, sich zu verabschieden. Er erzählte mir, er sei als Junge eines Morgens zum Frühstück heruntergekommen und habe seinen Vater wie immer am Frühstückstisch sitzen sehen. Als ihm seine Mutter dann mitteilte, sein Vater sei in der Nacht verstorben, fragte er sich kurz, ob sie verrückt geworden sei. »Er sitzt doch da«, hatte er gesagt. Es war der erstaunlichste und beunruhigendste Moment seines Lebens gewesen.
An einem heißen Sommernachmittag stand ich auf einem Gehweg in Pittsburgh und plauderte mit einer Frau. Wir befanden uns auf einem Wochenendausflug zu den Carnegie- und Warhol-Museen und warteten auf unsere Mitreisenden. Ich erzählte, was mir wiederfahren war, und sie nickte und berichtete von ihrer Schwester, die eines Nachts mit dem Gefühl erwachte, überall auf ihrem Bett sei zersplittertes Glas, als wäre das Schlafzimmerfenster nach innen zerborsten. Unter dem Eindruck des Adrenalinschubs sprang sie aus dem Bett und tastete vorsichtig nach den Glasscherben, die sie auf ihrer Bettdecke vermutete, doch da war nichts. Das Fenster war intakt, alles war still. Am nächsten Tag erfuhr sie, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt hatte, bei dem die Windschutzscheibe zertrümmert worden war. Wir sprachen noch ein wenig, auch über einen anderen Todesfall in ihrer Familie, und als die anderen Touristen zu uns stießen, standen ihr die Tränen in den Augen. Es berührt mich immer wieder, wie stark und unmittelbar unsere Erfahrungen mit dem Tod sind, wie sorgfältig wir sie verborgen halten und wie dicht unter der Oberfläche sie doch liegen.
Ende der 1990er-Jahre stellte der Palliativ-Mediziner Michael Barbato einen Fragebogen für die Angehörigen von Sterbepatienten zusammen. Er hatte erkannt, dass weder in seiner Klinik noch in den meisten anderen Hospiz-Einrichtungen je wirklich untersucht worden war, wie verbreitet solche Erfahrungen sind. Zu seiner Überraschung berichteten 49 Prozent der Befragten von ungewöhnlichen Erfahrungen, die sich nicht so einfach wegdiskutieren ließen. »Selbst wenn wir nicht verstehen, wie diese Phänomene entstehen«, schrieb er in seinem Artikel darüber, »legt die Fülle der Berichte doch nahe, dass wir sie nicht länger ignorieren können.« Und ganz sicher kann man sie nicht ignorieren, wenn sie einem selbst widerfahren.
Verluste tun weh. Und in unserer Kultur kommt dann noch der Schmerz des Schweigens dazu, aus Angst, abgewiesen oder lächerlich gemacht zu werden, wenn mit dem Verlust etwas unerwartet Wundersames einherging. Erzählen Sie jemandem, Ihre Schwester habe in der Nacht, als Ihr Vater starb, eine Erscheinung gehabt, und sofort erhalten Sie Erklärungen. Halluzinationen. Wunschdenken. Zufall. Und dahinter das Urteil: Na ja, Sie sind ja ganz schön leichtgläubig.
Auf einer Weihnachtsfeier mit alten Studienfreunden unterhielt ich mich mit einem Mann, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte und der jetzt in der IT-Abteilung einer Bank arbeitete. Ich erzählte ihm von dem Verlust von Katharine und meinem Vater und ein bisschen von dem, was dabei geschah, worauf er freundlich erwiderte: »Ich will dir nicht zu nahe treten, aber deine Schwester hat sich das mit Sicherheit einfach eingebildet.«
Auf dem Heimweg fragte ich mich, warum ihm wohl wichtig war, das zu sagen. Soweit ich wusste, hatte er sich nie ernsthaft mit Psychologie beschäftigt, ganz zu schweigen von Sterbebegleitung, und doch maßte er sich die Autorität an, beurteilen zu können, was Sterbende sehen. Genauer gesagt, hatte er einem der heiligsten Momente von Katharines Leben den Sinn abgesprochen. Einfach so. Wäre dieser IT-Spezialist einer Bank wohl aufgesprungen, als meine Schwester bei der Trauerfeier meines Vater sprach, um zu sagen: »Entschuldigen Sie bitte! Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber …«?
Als meine Wut nachließ, fragte ich mich, wie er sich wohl seine Tage wegerklärte. Wir sind sinnsuchende Wesen. Wir leben inmitten von Geschichten und Mythen, und es bekommt uns nicht gut, an ein materialistisches Weltbild gekettet zu sein und obendrein als Narren hingestellt zu werden, wenn wir trauern.
Ich liebe dich, flüstert der Bräutigam seiner Braut vor dem Altar zu. Eine Wissenschaftlerin springt auf und fordert: Beweise es! Beweise, dass du deine Frau liebst! Hast du ein MRT?
Beweise deinen Ärger, beweise dein Mitgefühl, beweise deinen Humor – keiner fordert von uns, diese Dinge zu beweisen, denn Liebe, Ärger, Mitgefühl und Humor gelten allgemein als Teile des menschlichen Wesens, selbst wenn sie abgesehen von gewissen neuronalen Verortungen nicht weiter messbar sind.
Einst galt auch Spiritualität als selbstverständlicher Bestandteil der menschlichen Erfahrung, doch heutzutage gilt sie als besonderer Zustand, der besondere Beweise erfordert. Warum? Es hat nichts damit zu tun, was sich beweisen oder nicht beweisen lässt.
Von den 1979 in einer Studie befragten über 1000 US-amerikanischen College-Professoren erklärten 55 Prozent der Naturwissenschaftler, 66 Prozent der Sozialwissenschaftler und 77 Prozent der Geisteswissenschaftler, gewisse Formen übersinnlicher Wahrnehmung entweder als Tatsache oder zumindest als ziemlich wahrscheinlich zu betrachten. Nur 2 Prozent hielten es für absolut unmöglich. Dies war jedoch vor dem Aufschwung der biologischen Psychiatrie in den 1990er- und 2000er-Jahren, in dem sich die Annahme vertiefte, jede menschliche Erfahrung könne durch Gehirnfunktionen erklärt werden.
Der Psychologe Charles Tart betrieb 1999 eine Internetseite namens »Archives of Scientists’ Transcendent Experiences«, um Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, ihre ungewöhnlichen oder spirituellen Erfahrungen anonym mitteilen zu können, ohne um ihre Karriere fürchten zu müssen. Tart bezeichnete es tatsächlich als einen »geschützten Raum«, als ginge es darum, Alkoholexzesse oder das heimliche Tragen von Damenunterwäsche zuzugeben. Ingenieure, Chemiker, Mathematiker, Biologen – alle Fakultäten posteten Beiträge. Diese und viele andere Wissenschaftler straften die gängige Meinung Lügen, nur leichtgläubige, sentimentale Menschen hätten Erscheinungen. Eine neuere Studie des British Journal of Psychology1 wies nach, dass sich die intellektuelle Kapazität von jenen, die ungewöhnliche Erfahrungen machen, und jenen, die sich als Skeptiker bezeichnen, nicht unterscheidet; andere Studien bestätigen das.
Der Princeton-Physiker Freeman Dyson schrieb 2007:
Jeder, der wie ich glaubt, dass es außersinnliche Wahrnehmungen gibt, die nicht wissenschaftlich erfassbar sind, muss die Möglichkeiten der Wissenschaft für begrenzt halten. Ich stelle die Arbeitshypothese auf, dass außersinnliche Wahrnehmungen real sind, jedoch zu einem mentalen Universum gehören, welches für die rigiden Strukturen wissenschaftlicher Beweisführungen zu fließend und zu flüchtig ist.
Die Instrumente, mit denen wir das Genom kartiert und die Wachstumsfaktoren von Weizen bestimmt haben, sind hier nicht anwendbar. Die paranormale oder spirituelle Erfahrung entsteht unaufgefordert. Wir könnten meine Schwester nicht in ein Labor stecken, und mein Vater könnte nicht wiederholt sterben.
Dyson bekam für sein Vorpreschen viel Prügel, doch wie viele von uns kannte er unerklärliche Phänomene aus seiner eigenen Familie. Seine Großmutter sei eine »notorische und erfolgreiche Gesundbeterin« gewesen, schreibt er. Und einer seiner Cousins war lange Herausgeber des Journal for the Society of Psychical Research. Skeptiker warnen, solche Menschen seien Meistertäuscher oder deren leichtgläubige Opfer, und wahrscheinlich trifft das auch auf ein paar von ihnen zu. Doch wenn man Menschen kennt, deren Intelligenz und Vernunft man schätzt; wenn man merkt, wie sie selbst damit ringen, auf so ungewöhnliche Weise Dinge zu erleben, dann sind solche Schubladen untauglich. Wie Dyson über seinen Cousin und seine Großmutter sagt: »Sie waren beide keine Narren.« Auch all die Menschen, die sich mir anvertrauten, waren keine Narren. Auch meine Schwester nicht.
Solche persönlichen Momente der Bekehrung – von der Annahme eines bestimmten Regelwerks, auf welchem die Welt beruht, zu der Vermutung, es könnten noch ganz andere Kräfte am Werk sein – können Menschen »wie ein Schock« treffen, wie es Elizabeth Lloyd Mayer, Psychiaterin an der University of California, nach einer Erfahrung beschrieb, in der unbekannte Sinneseindrücke mitspielten. In ihrem Fall entstand dieser Schock durch Hellsehen, das heißt durch die Fähigkeit, über Entfernungen hinweg Informationen zu gewinnen. 1991 war die seltene und kostbare Harfe von Mayers Tochter gestohlen worden, und keine öffentlichen Aufrufe oder polizeilichen Ermittlungen ergaben irgendwelche Hinweise. Nach einigen Monaten schlug ihr eine Freundin vor, einen Rutengänger zu konsultieren – sie habe ja schließlich nichts zu verlieren. »Verlorene Gegenstände mit gegabelten Stöcken wiederfinden?« Mayer war höchst skeptisch. Doch ihre Freundin gab ihr die Telefonnummer des Vorsitzenden der Amerikanischen Rutengänger-Gesellschaft, eines Mannes namens Harold McCoy aus Arkansas.
»Ich rief ihn noch am selben Tag an. Harold ging direkt dran – freundlich, fröhlich, starker Arkansas-Akzent.« Sie erklärte ihm, sie suche in Oakland, Kalifornien, nach einer gestohlenen Harfe, und fragte zweifelnd, ob er ihr helfen könne, sie wiederzufinden. »Warten Sie einen Moment«, sagte er, »ich sage Ihnen gleich, ob sie noch in Oakland ist.« Er hielt kurz inne und meinte dann: »Nun, sie ist noch da. Schicken Sie mir eine Straßenkarte von Oakland, dann kann ich die Harfe für Sie lokalisieren.« Mayer schickte ihm die Karte per Eilboten. Zwei Tage später rief McCoy sie an und sagte ihr genau, in welchem Haus die Harfe ihrer Tochter sei.
Unsicher, ob sie nun komplett verrückt sei, hängte Mayer in einem Radius von zwei Blocks um dieses Haus herum Flyer aus. Die Gegend war ihr völlig unbekannt. Kurz darauf erhielt sie einen Anruf von jemandem, der die Harfe gesehen hatte und sie Mayer zurückgeben könne. »Als ich mit der Harfe im Auto wieder in unsere Einfahrt bog, ging mir der Gedanke durch den Sinn: ›Das verändert alles‹«, schrieb sie später.
Mayer musste ihr gesamtes Weltbild überarbeiten. Nach dem Tod meines Vaters und meiner Schwester ging es mir ähnlich. Ich wollte wissen, was über diese kontroversen Wahrnehmungen begreifbar und was noch unklar und unerforscht ist. Als Journalistin reichte es mir nicht, einfach die offizielle Weisheit zu akzeptieren. Als ihre Schwester konnte ich Katharines Intelligenz und Vernunft nicht ignorieren. Sie hatte auf der Trauerfeier unseres Vaters so viel gewagt, auf die Gefahr hin, dass irgendein IT-Typ einfach behauptet, sie habe sich diesen Quatsch nur ausgedacht.
Nein, für mich stand zu viel auf dem Spiel, sowohl was Katharines Integrität als auch was den Respekt für unsere kollektive Erfahrung betrifft.
Also versuchte ich, diesen Fragen nachzugehen. Warum hatte meine Schwester in der unvermuteten Todesstunde unseres Vaters eine so starke spirituelle Erfahrung? Wie konnte sie die Präsenz in ihrem Schlafzimmer und die zärtlichen Hände auf ihrem Kopf spüren? Warum begann sie ihr eigenes Sterben voller Furcht und wurde dann immer freudvoller? Was hatte sie gesehen, was hatte sie gelernt, was hätte sie mir gesagt, wenn sie noch gekonnt hätte?
In den folgenden paar Jahren erfuhr ich weit mehr und weit Geheimnisvolleres, als ich je geahnt hatte. Ich erzähle Ihnen davon in der Hoffnung, Ihnen ebenfalls eine Tür zu öffnen.