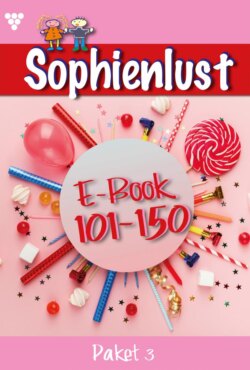Читать книгу Sophienlust Paket 3 – Familienroman - Patricia Vandenberg - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Regine, du hast bei deinen enthusiastischen Berichten über Sophienlust wirklich nicht übertrieben. Wenn Frau von Schoenecker nichts dagegen hätte, würde ich gern noch den Rest meines Urlaubes hierbleiben.«
Renate Hagen, fünfundzwanzig Jahre alt, mit auffallend schönen braunen Augen und dunklen Haaren, wandte sich ihrer langjährigen Freundin zu, die hier nach dem Tod ihres Mannes und ihrer kleinen Tochter Elke eine zweite Heimat gefunden hatte. »Nun kann ich auch verstehen, weshalb du nicht am Leben verzweifelt bist«, fügte sie nach einer Weile leiser hinzu.
»Am meisten hat mir Frau von Schoenecker geholfen. Ohne sie hätte ich nicht die Kraft aufgebracht, weiterzuleben. Es ist eine lohnende Aufgabe, für Kinder zu sorgen«, erklärte Schwester Regine.
»Die Kinder hier sind ganz anders als anderswo. Bisher ist noch keines in meiner Gegenwart ausfallend geworden. Als Krankenschwester komme ich mit vielen Menschen zusammen und auch mit unzähligen Kindern. Leider habe ich die bittere Erfahrung gemacht, dass gerade Kinder einem das Leben vergällen können.«
»Wenn Kinder so sind, dann liegt es nur an ihrer Umgebung«, meinte die Kinderschwester von Sophienlust. »Kein Kind ist von Natur aus wirklich böse. Jedes Kind sehnt sich nach Liebe und Verständnis.«
»Beides wird den Kindern hier zuteil«, stellte Schwester Renate fest. Dabei steckte sie ihr volles dunkles Haar vor dem Spiegel auf. »Hier in Sophienlust wäre ich ganz gern Kinderschwester geworden.« Sie warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. »Ich glaube, ich habe hier schon zugenommen«, erklärte sie mit einem Seufzer. »Eure Köchin kocht viel zu gut. Ab heute muss ich mich mit dem Essen ein wenig zurückhalten. Ich neige nun mal dazu, schnell zuzunehmen.«
»Als du in Sophienlust ankamst, sahst du sehr elend aus, Renate. Im übrigen bist du keineswegs zu dick«, bemerkte Schwester Regine fröhlich. »Und außerdem wirst du die überflüssigen Kilos bei deinem anstrengenden Beruf schnell wieder verlieren.«
»Wenn ich noch hierbleiben darf, dann liegen noch herrliche Wochen vor mir. Ich werde Nicks Angebot, reiten zu lernen, doch akzeptieren.«
»Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Nun müssen wir aber nach unten gehen. Es gongt bereits das zweitemal zum Abendessen.«
Schwester Regine fuhr sich noch einmal ordnend durch ihr blondes Haar und verließ dann zusammen mit ihrer Freundin Renate das hübsche Gastzimmer.
Die Kinder saßen bereits an den Tischen, als die beiden den Speisesaal betraten. Das Hausmädchen Ulla und die alte Lena servierten eben das Abendbrot. Es gab Hammelragout mit grünen Bohnen, ein Gericht, das bei den Kindern sehr beliebt war.
Auch Dominik von Wellentin-Schoenecker, genannt Nick, der zukünftige Besitzer von Sophienlust, nahm an diesem Abendessen teil. Ebenso sein siebenjähriger Bruder Henrik, das Nesthäkchen der Familie von Schoenecker. Während Nick vorhatte, auch in Sophienlust zu übernachten, sollte Henrik nach dem Abendessen mit seiner Mutter, Denise von Schoenecker, nach Schoeneich zurückfahren. Doch darüber war der Junge gar nicht erfreut. Er beneidete Nick glühend um das Zimmer, das er hier hatte, und wünschte sich sehnlichst, in Sophienlust ebenfalls ein Zimmer zu bekommen. Doch davon wollten seine Eltern nichts wissen.
Lustlos stocherte Henrik in seinem Essen herum.
»Ich fahre heute ganz einfach nicht nach Hause«, rief er entschlossen.
»Dann fahre ich mit deiner Mutti mit«, erwiderte die vierjährige Heidi Holsten sofort erfreut. »Bestimmt nimmt mich Tante Isi mit.«
»Das glaube ich kaum.« Henrik funkelte das kleine Mädchen an. »Mutti wird nicht mit dem Tausch einverstanden sein«, fügte er eifersüchtig hinzu.
Schwester Regine lachte. »Henrik, du bist mir einer. Du möchtest über Nacht in Sophienlust bleiben, aber dass Heidi an deiner Stelle deine Mutti nach Schoeneich begleitet, das passt dir auch nicht.«
»Heidi könnte dir doch ihr Bett überlassen«, schlug Pünktchen, ein reizendes zwölfjähriges Mädchen, fröhlich vor. »Und Heidi schläft dafür in deinem Bett in Schoeneich.«
»Dann fahre ich lieber mit«, erklärte der siebenjährige Henrik kategorisch. »Ich …«
Ein ohrenbetäubender Knall unterbrach ihn. Einen Moment hatten alle das Gefühl, in einem schwankenden Boot zu sitzen. Ein Krachen und Bersten ertönte, Fensterscheiben zersplitterten. Die Kinder schrien und sprangen auf. Die Erwachsenen aber waren alle bleich geworden. Mit angehaltenem Atem lauschten sie.
Nick fand als erster die Sprache wieder. »Irgendwo hier ganz in der Nähe ist etwas explodiert. Es war ganz bestimmt eine Explosion.«
Heidi weinte laut, während Henrik angstvoll die Hand seines großen Bruders umklammerte. Die größeren Kinder versuchten die kleineren zu beruhigen, denn die Kleinen stimmten nun in Heidis Weinen ein.
»Ihr bleibt auf alle Fälle im Haus«, bestimmte Frau Rennert, die Heimleiterin. Sie war nach dem Knall sofort in den Speisesaal gekommen.
»Ich muss aber hinaus!«, erklärte Nick. »Nein, Pünktchen, du nicht!«, rief er seiner kleinen Freundin zu.
Aber die großen Kinder ließen sich durch nichts zurückhalten. Sie drängten trotz der Ermahnungen der Heimleiterin zur Tür hinaus. Auch Schwester Renate war dabei. Als Krankenschwester wollte sie ihre Hilfe anbieten, falls es Verletzte geben sollte.
Schwester Regine hatte Mühe, die kleineren Kinder im Haus zu halten. Frau Rennert und die Köchin Magda unterstützten sie dabei. Mit vereinten Kräften gelang es den Erwachsenen schließlich, die aufgeregten Kinder zu beruhigen.
Währenddessen standen einige Erwachsene und die großen Kinder aufgeregt vor der Freitreppe des Herrenhauses von Sophienlust. Es war noch taghell. Alle rätselten herum, was geschehen sein könnte, als der alte Justus außer Atem angelaufen kam. Er musste erst mehrmals nach Luft schnappen, bevor er reden konnte. »Ein Flugzeug ist abgestürzt. Ganz in der Nähe. Auf der Wiese zwischen Wildmoos und Bachenau. Ich glaube, keiner hat das Unglück überlebt.« Er fuhr sich mit seinem großen grünen Taschentuch über die schweißnasse Stirn.
»Entsetzlich«, flüsterte Nick. »Das Flugzeug hätte auch auf Sophienlust oder Schoeneich fallen können.«
»Oder auf eines der Häuser in Wildmoos. Wäre es direkt über Wildmoos abgestürzt, wäre noch mehr geschehen«, überlegte Irmela Groote, ein vierzehnjähriges Mädchen.
»Nicht auszudenken, was dann geschehen wäre«, pflichtete Pünktchen ihr bei. Dabei fasste sie wie hilfesuchend nach Nicks Hand.
Alle liefen nun zu der großen Wiese.
Kurz darauf trafen auch Denise und Alexander von Schoenecker am Unfallort ein.
Denise wurde totenblass beim Anblick der Flugzeugtrümmer, die weit verstreut herumlagen.
»Alexander, das ist doch kein Anblick für die Kinder«, sagte sie erregt. »Schick sie nach Hause. Ich kann es nicht.«
»Ich bin der Meinung, dass sie dableiben sollten, Denise. Es sind ja nur die großen Kinder hier. Vielleicht können sie irgendwie helfen.«
»Pünktchen ist doch erst zwölf. Mein Gott, die armen Menschen!«, rief Denise erschüttert.
»Da kommen die ersten Rettungswagen. Und auch die Polizei. Ich bin fast sicher, dass niemand das Unglück überlebt hat«, meinte Alexander leise.
Pünktchen begann laut zu schreien, als sie einen der toten Passagiere erblickte. Denise war froh, dass sie nun einen plausiblen Grund hatte, den schaurigen Platz zu verlassen. »Sei ruhig, mein Kleines, ganz ruhig«, redete sie dem Mädchen zu.
Alexander hielt es nun doch für besser, alle Kinder nach Hause zu schicken. Sie folgten Denise und Pünktchen ohne Widerspruch. Nur Nick blieb noch da. Ebenso Renate Hagen. Sie hoffte, dass doch einige Passagiere das Unglück überlebt hatten. Obwohl sie als Krankenschwester abgehärtet war, drehte sich ihr fast der Magen um, als sie mit den Rettungsmannschaften nach Überlebenden suchte. Leichenteile wurden auf die bereitstehenden Bahren gelegt.
»Es wird schwer sein, die Verunglückten zu identifizieren«, erklärte Frau Dr. Frey, die ganz grün im Gesicht war. »So etwas habe ich noch niemals …«
»Kommen Sie schnell!«, rief Schwester Renate in diesem Augenblick aufgeregt. »Hier ist eine Überlebende. Kommen Sie schnell!« Sie blickte wie gebannt auf eine junge rothaarige Frau, die halb unter einem Wrackteil lag und laut stöhnte. »Help me! Help me!«, rief sie dann.
Kurz darauf lag die Verunglückte auf einer Trage. Sie wurde in Eile zu einem Rettungswagen getragen und dort von Frau Dr. Anja Frey versorgt.
Renates Hoffnung, noch weitere Überlebende zu finden, wuchs. Sie hatte ihren Schwächeanfall nun überwunden und dachte nur noch daran, dass hilflose Menschen ihre Hilfe benötigten. Als sie Frau Dr. Frey sagte, sie sei Krankenschwester, war diese ihr unendlich dankbar für die fachmännische Hilfe.
Tapfer stieg Renate über Wrackteile und zerfetzte Gepäckstücke, über Handtaschen und Kleidungsstücke und über ein totes kleines Mädchen hinweg, das einen großen Teddybären im Arm hielt. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie die großen dunklen Kinderaugen zudrückte. »Schlaf gut, mein Kleines«, flüsterte sie ergriffen und ging schnell weiter, weil sie wusste, dass man sie brauchte.
Bis in die Nacht hinein suchte man mit Scheinwerfern nach Überlebenden. Nick und sein Stiefvater Alexander von Schoenecker blieben bis zuletzt da, genau wie Renate Hagen.
Als die Uhren von den Kirchtürmen der Umgebung Mitternacht schlugen, hatte man zwanzig Schwerverletzte gerettet. Erschöpft fuhr sich Renate über die Stirn. Sie taumelte ein wenig, als sie, geführt von Alexander von Schoenecker, zum Wagen ging. »Ich habe das Gefühl, einen wüsten Traum zu haben«, flüsterte sie und überließ sich dann ihren Tränen.
»Man hat nur ein Kind gefunden. Die Chartermaschine war hauptsächlich von Frauen besetzt. Es war ein Ferienflug nach dem Engadin. Es sollen Mütter aus dem gleichen Ort gewesen sein«, erzählte Nick.
»Mein Gott, wie furchtbar. Wie viele Familien werden davon betroffen sein?« Renate trocknete ihre brennenden Lider. »Wie viele Kinder werden ihre Mütter, wie viele Männer ihre Frau verloren haben?« Sie schluchzte auf.
»Vati, ein Teil unserer Bäume wurden wie Streichhölzer geknickt«, fuhr Nick fort. Auch er konnte nur schwer seine große Erregung verbergen. Er hatte das Gefühl, diesen entsetzlichen Anblick sein Leben lang nicht mehr vergessen zu können. Besonders nicht das tote kleine Mädchen mit dem großen Teddybären im Arm.
Alexander war froh, als sie Sophienlust erreichten. Die Kinder schliefen schon, aber keiner der Erwachsenen hatte es über sich gebracht, zu Bett zu gehen. Sie hatten sich in der Halle versammelt und sprachen dort über das Unglück.
Als Denise Nicks graues Gesicht sah, ging sie ihm entgegen und legte ihren Arm um seine Schultern. »Komm, mein Junge, du musst schleunigst ins Bett.«
Nick sah sie dankbar an. Es wurde ihm kaum bewusst, dass seine Mutter ihn die Treppe hinaufführte.
»Mutti, es war entsetzlich«, flüsterte er, als sie ihm beim Ausziehen half. Zu jeder anderen Zeit hätte er sich geweigert, sich von ihr helfen zu lassen. In diesem Moment war er froh, dass sie bei ihm war. Und dann hatte er plötzlich einen merkwürdigen Druck im Hals und spürte ein Ziehen im ganzen Körper.
Denise war auf seinen Nervenzusammenbruch gefasst gewesen. Als er zu schluchzen anfing, nahm sie ihn ganz fest in die Arme.
Es dauerte lange, bis Nick ruhiger wurde. »Nicht wahr, Mutti, du sagst keinem, dass ich plötzlich wie ein kleines Kind weinen musste«, bat er später. »Auch Vati soll es nicht wissen.«
»Ich verspreche es dir, mein Junge. Aber du brauchst dich deiner Tränen nicht zu schämen. Auch Männer weinen noch. Ich bin gleich wieder da«, sagte sie leise.
Nick lag in seinem Bett und blickte zur Decke empor, auf der nun die grausigen Bilder wieder lebendig wurden. Er schlug die Hände vor die Augen, aber die Bilder blieben. Sie schienen sich mehr und mehr in seinem Kopf auszubreiten. Verzweifelt warf er sich hin und her und vergrub sein Gesicht im Kopfkissen.
»So, Nick, das wird dir guttun«, sagte Denise zärtlich und strich ihm über das schwarze Haar. »Da, nimm die beiden Tabletten. Danach wirst du wie ein Murmeltier schlafen.«
»Danke, Mutti.« Nick setzte sich auf. »Ich könnte sonst bestimmt nicht schlafen.« Er nahm die Tabletten ein. Dann fuhr er fort: »Aber ich habe helfen können. Ich wünsche mir nur noch, dass alle Verletzten durchkommen.«
»Das hoffe ich auch, Nick. Soll ich noch bei dir bleiben?«
»Das wäre nett, Mutti. Wo ist Henrik?«
»Er schläft bei Heidi im Zimmer. Auf diese Weise kann er mal eine Nacht in Sophienlust übernachten.«
»Mutti, ich …« Nick konnte nicht weitersprechen. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass seine Zunge ihm nicht mehr gehorchte. Er spürte noch, dass sich seine inneren Verkrampfungen lösten. Dann war er fest eingeschlafen.
Denises Lächeln verschwand, als sie das Licht ausknipste. Sie fühlte sich plötzlich so erschöpft, wie eine uralte Frau. Als sie die Treppe hinuntertapste, kam ihr Alexander entgegen. »Es ist höchste Zeit für dich, ins Bett zu gehen«, erklärte er in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Denise fügte sich seinen Worten nur zu gern. Wie in Trance verabschiedete sie sich von den Sophienlustern.
Renate Hagen war ebenfalls am Ende ihrer Kräfte. Wie ein kleines Kind ließ sie sich von Schwester Regine zu Bett bringen und schluckte gehorsam eine Schlaftablette. Als sie dann alleine war, tat sie etwas, was sie seit Jahren nicht mehr getan hatte. Sie faltete die Hände und betete. Inständigst flehte sie Gott an, alle Verletzten durchkommen zu lassen.
*
Daisy war ein Kind, das selten weinte. Aber als sie jetzt durch die Wiesen heimwärts wanderte, stolperte sie mehrmals, weil ihr die Tränen immer wieder in die Augen schossen. Zum erstenmal hatte ihre Mutter ihren Daddy, Jeremy und sie allein gelassen.
Daisy wusste, ihr Daddy war auch traurig. Aber er hatte gesagt, dass ihre Mummy einmal Ferien machen müsse. »Du bist doch mit deinen acht Jahren schon ein großes Mädchen und kannst mir im Haushalt helfen«, hatte er gemeint.
Damit hatte er natürlich recht, überlegte Daisy und wischte ihre Tränen fort. Aber das Haus war ohne Mummy doch sehr leer.
Wieder schossen Daisy Tränen in die Augen. Als sie aber das große Hoftor erreicht hatte, versiegten ihre Tränen schnell. Nun konnte sie sogar wieder lächeln. Mit einer anmutigen Bewegung warf sie den Kopf zurück, sodass ihr langes blondes Haar, das über der Stirn zu einer Ponyfrisur geschnitten war, nach hinten flog.
Der Irish-Terrier Tommy erhob sich von seinem Sonnenplatz neben der Haustür und kam Daisy entgegengelaufen. Voller Freude begrüßte er sie.
»Daisy, endlich bist du da!«, rief Jeremy, ein dunkelhaariger vierjähriger Junge mit großen braunen Augen und lebhaftem Naturell. »Daddy hat schon mehrere Male nach dir gefragt. Du sollst ihm doch in der Küche helfen. Morgen wird dann die alte Barbara zu uns kommen und für uns kochen. Dann braucht Daddy keine Küchenarbeiten mehr zu machen. Sag, Daisy, sind vier Wochen eine lange Zeit? Ich meine, weil doch unsere Mummy so lange fortbleiben will.«
»Vier Wochen sind sehr lang, Jeremy.« Tapfer schluckte das Mädchen seine Tränen hinunter. Schließlich musste es dem kleinen Bruder doch mit gutem Beispiel vorangehen.
»Ich habe vergessen, wie der Ort heißt, zu dem Mummy geflogen ist«, sagte der Junge weinerlich.
»Sie ist ins Engadin geflogen. Das ist eine Tallandschaft in Graubünden. Und Graubünden liegt in der Schweiz.«
»Ach so.«
»Daisy, wo warst du denn so lange?«, fragte in diesem Moment Roy Bennet von der Tür her. »Du weißt doch besser als ich, wo in der Küche die Sachen sind.«
Daisy nickte. Sie kam sich dabei sehr erwachsen vor. Sie hatte ihrer Mutter ganz fest versprochen, sie zu vertreten. Und ein Versprechen musste man unbedingt halten.
»Daddy, ich war nur ein bisschen spazieren. Ich habe nachdenken müssen. Nun bin ich aber gar nicht mehr traurig. Vier Wochen vergehen auch«, fügte sie altklug hinzu.
»So ist es, mein Schatz.« Roy Bennet sah seine Tochter an. Er ahnte, was sie hinausgetrieben hatte. Er litt unter der Trennung von seiner Frau ebenso wie die Kinder unter der Trennung von der Mutter. Aber er hatte eingesehen, dass Mary dringend Erholung brauchte. Sie musste einmal heraus aus dem Alltag. Deshalb hatte er seiner Frau unter Opfern den Ferienaufenthalt im Engadin ermöglicht.
Obwohl das Mittagessen nicht ganz so gut schmeckte wie sonst, griffen die Kinder doch tüchtig zu. Nach dem Essen lief Jeremy wieder hinaus auf den Hof, begleitet von Tommy. Roy und seine Tochter wuschen das Geschirr ab.
»Daddy, nun ist Mummy schon einen ganzen Tag fort. Sie ist gestern Mittag von London abgeflogen. Ich werde täglich einen Tag im Kalender ausstreichen, damit die Zeit schneller vergeht«, erklärte Daisy und stellte die Teller in den Küchenschrank.
»Ich muss am Nachmittag nach Alvery fahren, um Hühnerfutter zu kaufen. Nicht wahr, du passt gut auf Jeremy auf? Er ist doch noch so sehr klein.«
»Keine Sorge, Daddy, ich lasse ihn bestimmt nicht aus den Augen. Kommt die alte Barbara wirklich morgen zu uns?«
»Nur tagsüber, Daisy, damit unser Haushalt besser klappt.«
»Sie kann so schöne Geschichten von Wales erzählen. Auch Mummy kennt viele Legenden, Daddy.«
»Ich weiß. Sie ist eine echte Waliserin. Du weißt ja, dass diese kleine Farm früher ihren Eltern gehörte.«
»Aber du bist in Bristol geboren, nicht wahr, Daddy?«
»Ja, mein Schatz. Ich bin ein echter Städter gewesen. Nun aber liebe ich das Landleben sehr.«
»Weil du Mummy liebhast, Daddy?«
»So ist es, Daisy.«
»Ein Leben ohne unsere Mummy wäre auf die Dauer nicht schön«, meinte das Mädchen altklug.
»Es wäre unvorstellbar. So, nun laufe hinaus zu Jeremy. Ich fahre gleich los.«
Roy ging ins Schlafzimmer, um sich umzukleiden. Er war ein gutaussehender Mann mit leuchtend blauen Augen und mittelblonden Haaren. Sein Teint war tief gebräunt. Man sah ihm an, dass er den ganzen Tag in der frischen Luft verbrachte.
Als Roy sich rasierte, dachte er plötzlich an seine Eltern. Sein Vater war Beamter in Bristol gewesen, seine Mutter hatte eine Halbtagsstellung in einem Modegeschäft gehabt, um noch etwas dazuzuverdienen. Er und sein Bruder Jeremy hatten immer zur See gehen wollen. Sein Bruder hatte das schließlich auch getan. Er selbst aber hatte Mary kennengelernt. Bis zu dem Tag, als sie ihn auf die Farm mitgenommen hatte, hätte er nie geglaubt, dass er eines Tages den Wunsch haben würde, für immer auf dem Lande zu leben. Aber Mary hatte die Farm, die seit Generationen im Besitz ihrer Familie war, geerbt und erklärt, sie könne nur einen Mann heiraten, der Interesse für diese Farm habe.
Roy hatte keine Sekunde gezögert, sondern versichert, er liebe das Landleben. Keine Stunde hatte er seitdem bereut, seine Pläne aufgegeben zu haben.
Mit einem Lächeln auf den Lippen verließ Roy das Haus. Bevor er ins Auto einstieg, umfasste sein Blick das hübsche Landhaus mit dem tiefgezogenen Dach und den hellbraunen Fensterläden. Daisy und Jeremy saßen auf der kleinen Treppe vor der Veranda und winkten ihm nach, als er abfuhr. Der Irish-Terrier Tommy lief noch ein Stückchen hinter dem Wagen her. Einige Hühner flatterten erschrocken auf, dann versperrte ihm eine Schar Gänse den Weg. Lachend hupte er mehrmals und fuhr dann weiter. Die Straße schlängelte sich durch grüne Hügel, auf denen Schafe weideten. Weiter unten, in den geschützten Tälern, wo Obstgärten und Felder das Landschaftbild bestimmten, lag Alvery. Er machte an diesem Tag einen Umweg nach dem Ort, um den herrlichen Blick von der Küstenstraße aus zu genießen. Genau wie sein Bruder Jeremy liebte er die Weite des Meeres. Er wäre zweifellos ebenfalls Seemann geworden, wäre er nicht Mary begegnet. Mary war sein Schicksal geworden. Er liebte sie mehr als alles andere auf der Welt.
Als Roy die Straße nach Alvery entlangfuhr, sah er deutlich das feine schmale Gesicht seiner Frau mit den verträumten braunen Augen und der kleinen geraden Nase vor sich. Mary hatte volle Lippen und wunderschöne Zähne. Ihr dichtes dunkles Haar war leicht gelockt und schwer zu frisieren. Aber er liebte es, wenn sich widerspenstige Löckchen aus ihrer Frisur lösten und sich an ihre Schläfen und ihren schmalen Hals schmiegten. Er fasste auch leidenschaftlich gern in ihre Haarfülle, um das leise Knistern zwischen seinen Fingern zu spüren.
»Mary, kleine Mary«, flüsterte er zärtlich. Dabei wurde ihm plötzlich sonderbar schwer ums Herz. Nun bereute er doch, dass er ihr erlaubt hatte, in die Schweiz zu fliegen. Aber Mary hatte sich von ihrer Freundin Rose zu dem Flug überreden lassen.
Roy kehrte mit seinen Gedanken in die Wirklichkeit zurück, aber die Unruhe in ihm blieb. Nachdem er seine Besorgungen erledigt hatte, kehrte er noch ins Gasthaus ein, um etwas zu trinken. Sofort fiel ihm die gedrückte Stimmung in der Gaststube auf. Als er die Männer, die er fast alle kannte, begrüßte, bekam er kaum eine Antwort. »Was ist denn mit euch los?«, fragte er, als er sich am Stammtisch niederließ.
»Ja, weißt du denn noch nichts von dem Flugzeugunglück? Eine Chartermaschine ist irgendwo in Mitteldeutschland abgestürzt. Nur zwanzig von den hundert Passagieren sollen das Unglück überlebt haben. Die meisten Frauen waren aus Alvery«, antwortete einer der Männer bedrückt.
»Abgestürzt? Eine Chartermaschine?«, fragte Roy erschüttert. Zugleich sagte er sich, dass es bestimmt nicht das Flugzeug gewesen sei, mit dem Mary geflogen war. Die meisten Frauen an Bord der Maschine sollen aber von hier gewesen sein, überlegte er danach mit Entsetzen.
Irgendjemand schob ihm die Tageszeitung über den Tisch zu. Als Roy den Artikel über die Flugzeugkatastrophe gelesen hatte, bestand für ihn kein Zweifel mehr, dass es die Chartermaschine gewesen war, mit der Mary in die Schweiz geflogen war.
»Das kann doch nicht wahr sein«, sagte er tonlos und sah sich wie hilfesuchend um. Sein Gesicht verfiel zusehends. »Nein, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht!«
»Roy, zwanzig Personen sind gerettet. Sie sind zwar verletzt, aber sie werden durchkommen. Ganz bestimmt. An diese Hoffnung klammern sich fast alle Ehemänner bei uns. Du musst das auch tun, Roy«, redete sein Freund Ben Miles auf ihn ein.
»Du hast recht, Ben. Mary kann gar nicht tot sein. Sie ist gewiss nicht tot«, erwiderte Roy automatisch und verließ fast fluchtartig das Gasthaus.
Als er zu seinem Auto ging, schien hell die Sonne. Geblendet schloss er die Augen. Er hatte das Gefühl, sich in einem Labyrinth zu befinden, aus dem es keinen Ausweg gab. Alles um ihn herum schien seltsam verzerrt zu sein. Ich muss träumen, sagte er sich. Es ist nur ein Traum. Ein furchtbarer Albtraum.
Roy fuhr ganz langsam und zwang sich zur Ruhe. Seine Blicke wanderten über das Land, in dem Mary aufgewachsen war. Wieder sah er sie vor sich. So deutlich, dass er glaubte, sie müsste jeden Augenblick vor ihm auf der Straße auftauchen und ihm zuwinken.
Roy ließ den Wagen am Straßenrand ausrollen und stieg aus. Er hörte aus der Ferne Glocken läuten. Eine eisige Hand schien nach seinem Herzen zu greifen. Mary ist in dem Flugzeug gewesen, konnte er nur noch denken. Ob sie den Absturz wohl überlebt hatte?
Wieder hörte er die Glocken läuten. Dann erblickte er die Kapelle auf dem felsigen Hügel. Gewaltsam zog es ihn dort hinauf.
Möwen umkreisten das Kirchlein. Es war so alt und verwittert, dass es wie ein Teil des Felsens aussah.
Roy betrat die Kapelle. Zögernd schritt er zwischen den Holzbänken zum Altar hin, der mit Blumen geschmückt war. Dort kniete er nieder. »Herrgott im Himmel, du darfst nicht so grausam sein und mir das Liebste auf der Welt nehmen«, betete er inbrünstig.
Wie lange Roy auf den kalten Steinen gekniet hatte, wusste er später nicht zu sagen. Als er die Kapelle verließ und zu seinem Wagen zurückging, versank die Sonne bereits hinter den Hügeln. Die Zwiesprache mit Gott hatte ihm geholfen. Seine Zuversicht war gestärkt. Fast heiter stieg er vor seinem Haus aus dem Wagen.
Die alte Barbara trat aus dem Haus, gefolgt von den Kindern.
»Daddy, endlich!«, rief Daisy erleichtert. »Du bist so lange fortgeblieben. Sieh doch, die Sonne geht schon unter. Barbara ist schon am Nachmittag gekommen. Sie wollte mit dir sprechen.«
»Ja, das wollte ich, Roy«, erklärte die alte Frau. »Aber ich muss dich allein sprechen.«
Roy zuckte zusammen. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, den Kopf in den Sand zu stecken und der Wirklichkeit aus dem Weg zu gehen. »Daisy, sei doch so lieb und hole die Sachen aus dem Auto«, bat er bedrückt. »Jeremy wird dir helfen.«
»Ja, Daddy. Nicht wahr, du erzählst mir nachher, was Barbara dir gesagt hat?«, raunte sie ihm noch schnell zu. »Ich bin doch deine Große.«
Liebevoll fuhr er seiner Tochter über das blonde Haar. »Ja, Daisy«, erwiderte er und folgte dann der alten Barbara ins Haus.
Dort erfuhr er das, was er schon wusste.
»Ich habe von dem Unglück bereits in Alvery gehört«, entgegnete er erregt. »Aber ich habe mir gesagt, es hat keinen Sinn, sich verrückt zu machen, solange man nichts Genaues weiß.«
»Ich habe den ganzen Nachmittag gebetet und Gott angefleht, unsere Mary …« Die Stimme der alten Frau brach.
»Mary lebt. Ich spüre, dass sie lebt. Aber ich fliege mit der nächsten Maschine nach Deutschland. Nicht wahr, Barbara, du kümmerst dich um die Kinder?«
»Selbstverständlich tue ich das. Ich habe mein Bündel schon mitgebracht, weil ich mir dachte, dass ich gebraucht werde. Sollen wir es den Kindern sagen?«
»Noch nicht, Barbara. Ich …«
»Daddy, ich habe gelauscht!«, rief Daisy von der Tür her. »Ich möchte mitfliegen.«
»Daisy, das ist unmöglich.«
»Daddy, ich möchte aber zu Mummy. Sie liegt bestimmt in einem Krankenhaus und wartet auf uns. Bitte, nimm mich mit!« Flehend hob das Mädchen die Hände.
»Ich möchte auch mit.« Jeremy wusste zwar nicht, worum es ging, aber er wollte auf keinen Fall allein zu Hause bleiben.
»Vielleicht ist es sogar gut, wenn du die Kinder mitnimmst. Mary wird sich nach ihnen sehnen.«
Roy telefonierte mit dem Flughafen in London. Er bekam Plätze in der Frühmaschine des nächsten Tages. Am Abend erhielt er dann ein Telegramm von der Fluggesellschaft, der die Chartermaschine gehörte, mit der Bitte, zum Unfallort zu kommen, um die Schwerverletzten und Toten zu identifizieren.
Daisy las das Telegramm ebenfalls. Erst dadurch kam ihr die Tragweite des Unglücks voll und ganz zu Bewusstsein. Auch bemerkte sie die Tränen in den Augen ihres Vaters. Sie umfasste seine Hand und sagte: »Mummy ist bestimmt nicht tot.«
»Ich hoffe, dass du recht hast. Ich hoffe es von ganzem Herzen.« Roy wandte sich hastig ab, weil er seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.
Barbara hatte Jeremy schon zu Bett gebracht und packte nun einen Koffer für die drei. »Du musst jetzt auch ins Bett gehen, Daisy«, sagte sie. »Ihr müsst morgen in aller Frühe aufstehen.«
Daisy nickte und sagte dann gute Nacht. Als Barbara mit ihr kommen wollte, bat sie: »Bleib lieber bei Daddy. Er braucht dich, Barbara. Ich gehe immer allein zu Bett.«
Dann stieg Daisy die Treppe hinauf. Seit einem Jahr hatte sie ihr eigenes Zimmer. Es war eine Kammer mit einer Schrägwand. Vor dem kleinen Fenster hingen geblümte Gardinen. Aus demselben Stoff war auch die Tagesdecke über ihrem Bett. Als Daisy sie zurückschlug, dachte sie daran, dass das bisher ihre Mummy jeden Abend getan hatte.
»Mummy, du bist bestimmt nicht tot«, flüsterte Daisy. Sie zitterte vor Müdigkeit, als sie sich im Bett ausstreckte. Wie gebannt blickte sie auf das vom Mondlicht erhellte Fensterviereck.
Plötzlich hörte sie ein leises Kratzen an ihrer Kammertür. »Tommy!«, rief sie leise. »Ich mach dir schon auf.« Sie stieg wieder aus dem Bett und öffnete die Tür.
Mit eingezogenem Schwanz schlüpfte der Hund ins Zimmer.
»Tommy, armer Tommy, ich habe dich vergessen«, flüsterte Daisy und umarmte den Hund. »Aber ich mache mir solche Sorgen um Mummy. Nicht wahr, Mummy lebt?« Daisy begann nun zu weinen. Langsam und schwer tropften die Tränen aus ihren Augen.
Tommy leckte ihr über die Hände und drückte dann seine kalte Schnauze an ihr Gesicht. Eine Träne tropfte darauf, sodass er niesen musste.
Daisy hörte zu weinen auf. »Komm zu mir, Tommy«, bat sie und schlüpfte wieder unter die Bettdecke. Das ließ sich der Hund natürlich nicht zweimal sagen. Daisy schlang einen Arm um seinen Rücken. Bald darauf waren beide eingeschlafen.
Roy, der noch einmal in die Kammer hineinblickte, lächelte, als er die beiden sah. An und für sich gefiel es ihm nicht, dass der Hund im Bett der Kinder schlief. Aber diesmal ließ er es zu. Fast beneidete er seine Tochter auch um die tröstende Nähe des Hundes.
Roy sehnte mit aller Macht den Morgen herbei. Die nächtliche Stille brachte ihn fast an den Rand des Wahnsinns.
*
Roy Bennet und seine beiden Kinder trafen um die Mittagszeit in Frankfurt ein. Jeremys Mund stand keinen Augenblick still, als die drei durch die große Halle gingen. Roy war ihm dankbar für sein harmloses Geplapper, das ihn ein wenig von seiner furchtbaren Angst ablenkte. Daisy dagegen war auffallend still. Immer wieder strich sie ihrem Daddy über den Handrücken.
Roy mietete in Frankfurt einen Leihwagen. Ausführlich hatte man ihm den Weg zu der Unglücksstelle beschrieben. Auch hatte er erfahren, dass die Verletzten im Krankenhaus von Maibach lagen.
Stumm saß er dann am Steuer. Bald fuhr er immer schneller, weil er endlich wissen wollte, woran er war. Er wollte Mary sehen, wollte sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass sie noch lebte.
»Daddy, bitte, fahr nicht so schnell«, bat Daisy ängstlich.
Roy riss sich zusammen. Er drosselte das Tempo. »Ich glaube, dort ist die Abzweigung nach diesem Maibach«, sagte er. Dabei hämmerte sein Herz laut und schmerzhaft gegen seine Rippen.
»Ob Mummy sich sehr freuen wird über unseren Besuch?«, fragte Jeremy plötzlich. »Ich freue mich sehr auf sie, Daddy.«
»Ich auch, Daddy.« Daisy schloss mit kindlicher Zuversicht die Möglichkeit aus, dass ihre Mutter tödlich verunglückt sein könnte. Und Jeremy konnte mit seinen vier Jahren überhaupt noch nicht verstehen, dass er möglicherweise seine Mutter verloren hatte.
Roy bemerkte nichts von der zauberhaften Umgebung Maibachs. Gleich am Anfang des Ortes ließ er sich den Weg zum Kreiskrankenhaus beschreiben. Mit seinen deutschen Sprachkenntnissen war es nicht weit her. Aber trotz dieser Schwierigkeiten erreichte er das Krankenhaus.
»Ihr bleibt am besten erst einmal im Auto sitzen«, sagte er zu den Kindern. »Wenn Mummy noch sehr krank ist, darf sie bestimmt keinen Besuch empfangen. Nicht wahr, Daisy, ich kann mich auf dich verlassen?«
Eifrig nickte das Mädchen, obwohl es am liebsten sogleich mit seinem Vater ins Krankenhaus hineingegangen wäre. Aber dann dachte Daisy an ihre Mutter, auf die sie Rücksicht nehmen musste.
Still saßen die Kinder nebeneinander, als ihr Vater zögernd durch das Portal ging. Daisy faltete ihre Hände und bat Jeremy, das ebenfalls zu tun. »Wenn wir jetzt den lieben Gott bitten, unsere Mummy gesund zu machen, dann wird er es ganz bestimmt tun«, erklärte sie ernst.
Jeremy nickte. Doch dabei dachte er an Tommy, der sicher sehr traurig sein würde ohne sie alle. Barbara hatte den Hund zu sich genommen. Sie würde auch die Hühner und Gänse füttern. Die Leute von der Nachbarsfarm hatten versprochen, die Kühe zu melken.
»Jeremy, du betest ja gar nicht«, warf Daisy dem Bruder vor.
»Ich bete ja schon. Nicht wahr, Daisy, es ist komisch, dass die Leute hier alle so anders sprechen«, meinte er leise. »Was sie sagen, kann ich überhaupt nicht verstehen.«
»Ich auch nicht, Jeremy. Also, sag jetzt, lieber Gott, bitte, mach unsere Mummy wieder ganz gesund.«
*
Während Jeremy ihr die Worte feierlich nachsprach, saß Roy auf einer Bank in der Halle des Krankenhauses. Eine junge Krankenschwester blickte voller Mitleid auf seinen blonden Scheitel. Er war nicht der erste unglückliche Ehemann, dem sie hatte sagen müssen, dass sich seine Frau nicht unter den Überlebenden der Flugzeugkatastrophe befand. Und auch nicht zum erstenmal hörte sie die Frage: »Ist es möglich, dass meine Frau irgendwo anders liegt oder unverletzt geblieben ist?«
»Die Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Sie müssen sich am besten an die Fluggesellschaft wenden«, antwortete die Schwester.
Roy erhob sich. Er hatte Mühe, seine Beine zu bewegen. Seine hölzernen Bewegungen trieben der Krankenschwester die Tränen in die Augen. »Armer Mann«, flüsterte sie, als sie langsam die Treppe hinaufstieg.
Roy blieb am Portal stehen. Sein Blick suchte das Auto, in dem seine Kinder saßen. Seine Hoffnung, dass Mary das Unglück überlebt hatte, war erloschen. Aber der Gedanke, sie nie mehr wiederzusehen, wollte nicht in seinen Kopf. Alles in ihm wehrte sich dagegen.
Man hatte ihm gesagt, dass die Toten in der Kirche von Wildmoos aufgebahrt seien und dass die Leichen teilweise bis zur Unkenntlichkeit entstellt seien. Aber auch dieser Gedanke hatte ganz einfach keinen Platz in seinem Kopf. Marys makelloser Körper und ihr engelhaft schönes Gesicht sollte … Roy schlug die Hände vors Gesicht. Er presste die Augen ganz fest zusammen, weil er hoffte, das dadurch die schaurigen Bilder verschwinden würden.
Daisy hatte ihren Daddy durch das Glas der Tür entdeckt. Warum blieb er dort nur stehen?, fragte sie sich. »Jeremy, bleib sitzen«, bat sie ihren Bruder leise. »Ich lauf mal schnell zu Daddy.«
»Ich will aber zu Mummy!«, rief der Junge.
»Bleib sitzen!«, befahl Daisy streng. »Ich bin gleich wieder da.« Sie stieg aus und lief dann eilig auf das Haus zu.
Roy ließ die Hände von seinem Gesicht sinken und stellte fast erstaunt fest, dass die Handflächen feucht waren. Dann erblickte er seine kleine Tochter. Er nahm sich zusammen und verließ das Krankenhaus.
»Daddy, ist Mummy da?« Die großen blauen Kinderaugen richteten sich voll Angst auf ihn.
»Sie ist nicht da, Daisy.« Wie merkwürdig seine Stimme klingt, dachte er dabei. Wie zersprungenes Glas.
»Wo ist sie denn, Daddy?«
»Ich wünschte, ich könnte Jeremy irgendwo zurücklassen, Daisy. Aber wir müssen ihn mitnehmen.«
»Wohin, Daddy?«
»In die Kirche, Daisy. Du musst jetzt sehr tapfer sein, mein Kleines. Wir haben keine Mummy mehr.« Roy umfasste die zuckende Hand seiner Tochter. »Sie ist tot.«
»Daddy, das glaube ich nicht!«, rief Daisy. »Mummy kann gar nicht tot sein.«
»Daisy, ich wünschte, du hättest recht.«
»Ich habe recht, Daddy.« Daisy warf den Kopf in den Nacken. »Wir werden sie suchen, Daddy.«
Roy ließ seiner Tochter die Hoffnung, weil er nicht mehr die Kraft hatte, etwas zu sagen.
Daisy setzte sich neben ihren Daddy. Jeremy fragte verwundert: »Darfst du das denn, Daisy? Mummy hat doch immer gesagt, Kinder müssen im Auto hinten sitzen. Ich will zu Mummy!«
»Wir fahren zu Mummy.« Daisy nickte ihm aufmunternd zu.
»Bald sehen wir unsere Mummy wieder.« Es erging ihr ebenso wie ihrem Vater. Sie wollte einfach nicht wahrhaben, dass ihre Mutter tot war.
Roy fuhr nicht sofort zur Wildmooser Kirche, sondern schlug den Weg zum Unfallort ein. Als sie an Pferdekoppeln vorbeikamen, richtete sich Jeremy auf und sagte begeistert: »Schau doch, Daddy, dort sind Ponys. Viele Ponys. Solche haben wir auch daheim.«
Roy antwortete nicht. Als er die Unfallstelle erreicht hatte, an der noch einige Wrackteile herumlagen, bremste er ab. »Kommt«, bat er. »Steigt aus.«
Stumm schritten die beiden dann neben ihm her, als er über das Gelände ging. Plötzlich riss sich Jeremy von seiner Hand los. »Schau doch, Daddy, da ist ein Teddybär. Ob den ein Kind verloren hat?«
»Lass den Teddy liegen«, rief Roy barsch. »Komm sofort hierher.«
Der seltsame Ton in der Stimme seines Vaters erschreckte den Jungen so sehr, dass er zu weinen anfing.
Roy hob Jeremy hoch und drückte ihn an sich. »Schon gut, Jeremy«, sagte er und presste sein Gesicht an das Kind. Ein hartes Schluchzen stieg ihm in die Kehle.
Als er den Jungen wieder auf seine Beine stellte, hatte er von neuem das Gefühl, nur einen schlimmen Traum zu haben. Ich werde noch wahnsinnig, dachte er. Seine Schultern sackten wie unter einer schweren Last leicht nach vorn.
Daisy weinte leise vor sich hin. Jeremy aber hatte sich schon wieder beruhigt und starrte auf die Wrackteile.
»Daddy, schau doch, da ist ein großes Rad!«, rief er begeistert.
Roy achtete nicht auf die Worte seines Sohnes. Er umschloss die Hand des Jungen fester und verließ dann mit seinen beiden Kindern den Unfallort, um zur Wildmooser Kirche zu fahren.
*
Seit dem furchtbaren Unglück vor zwei Tagen zog es Renate Hagen immer wieder zu der Unglücksstelle. Sie konnte das kleine Mädchen, dem sie die Augen zugedrückt hatte, nicht vergessen. Inzwischen hatte sie erfahren, dass auch die Eltern des Kindes ums Leben gekommen waren.
Auch an diesem Tag war Renate wieder zum Unglücksort gekommen. Ihr Blick wurde wie magnetisch angezogen von dem großen blonden Mann in der hellen Tweedjacke. Auch die beiden Kinder interessierten sie. Offensichtlich handelte es sich bei diesen drei Menschen um Angehörige eines Verunglückten. Ob die Kinder ihre Mutter verloren hatten? Und der Mann seine Frau?, überlegte Renate. Alles sprach dafür.
Tiefes Mitleid erfüllte Renates Herz. Irgendetwas zwang sie, dem Mann und den Kindern zur Kirche zu folgen.
Roy betrat die Wildmooser Kirche. Der Anblick der vielen Särge und brennenden Kerzen sowie der Weihrauchduft versetzten ihn von neuem in den Zustand, der ihm das Gefühl gab, das alles nicht wirklich zu erleben. Ein allerletztes Mal erfüllte ihn die wahnwitzige Hoffnung, dass Mary sich nicht unter den Toten befinde, dass sie gerettet sei und sich auf dem Wege nach Wales befinde.
Mit schleppenden Schritten, die Kinder an den Händen, ging Roy von Sarg zu Sarg und las die Namen der Frauen aus Alvery. Daisy entzog ihm plötzlich ihre Hand und ging auf Jeremys anderer Seite weiter. Auch der Junge löste sich nun von seinem Vater und blieb mit seiner Schwester stehen. Seine Mundwinkel zuckten von verhaltenem Weinen. Die unheimliche Stille um ihn herum und die vielen Särge ängstigten ihn. Wie schutzsuchend schmiegte er sich an Daisy.
Roy vergaß seine Kinder. Noch immer hatte er Marys Namen nicht gefunden. Dann aber stockte ihm der Atem. »Mary Bennet«, las er tonlos. »Mary«, wiederholte er lauter. »Mary«, stöhnte er auf. »Nein, nein, das nicht«, schluchzte er und warf sich über den Sarg. Nun, da er die Gewissheit hatte, dass sie wirklich tot war, traf ihn die Last des Schmerzes mit voller Wucht. Sein Schluchzen wurde lauter, endete in dem tonlosen Schrei einer gequälten Kreatur.
Daisy umklammerte die Hand ihres Bruders fester und wich von ihrem Vater zurück. Sie begriff sofort, dass ihre geliebte Mummy dort im Sarg lag, dass sie sie nie mehr wiedersehen würde.
»Daisy, warum ist Daddy so traurig?«, fragte Jeremy mit entsetzten Augen.
»Jeremy, unsere Mummy ist tot. Sie liegt dort im Sarg. Darum weint Daddy so sehr«, klärte sie ihn auf und fing nun auch herzerweichend zu weinen an. »Mummy ist mit dem Flugzeug abgestürzt.«
»Aber Mummy hat mir doch versprochen bald wiederzukommen.« Jeremy sah Daisy erschrocken an. »Sie hat mir doch auch versprochen, mir eine Karte zu schreiben.«
»Jeremy, sie ist gar nicht bis in die Schweiz gekommen. Das Flugzeug ist hier abgestürzt. Auf der Wiese, auf der wir vorhin mit Daddy waren.« Daisy schluchzte lauter.
»Ich will aber nicht, dass Mummy tot ist!«, rief der kleine Junge fast zornig. »Ich habe sie so lieb, meine liebe Mummy.«
»Sie kommt nie wieder zu uns, Jeremy.« Daisy strich ihrem kleinen Bruder mit einer mütterlichen Geste über das dunkle Haar.
Jetzt begriff der Junge, dass er seine Mutter nie mehr wiedersehen würde. In seiner Verzweiflung riss er sich von Daisys Hand los und lief planlos an den Särgen entlang.
Daisy ließ ihn gewähren, weil sie plötzlich so schrecklich weinen musste. Sie sank auf eine Bank und weinte hemmungslos.
Renate Hagen, die den dreien gefolgt war, hatte nichts von der kleinen Szene zwischen den Kindern bemerkt. Noch immer ruhte ihr Blick voll Mitleid auf dem verzweifelten Mann, dessen Schultern vom Weinen bebten. Sie hatte das Bedürfnis, ihn zu trösten. Aber sie fand nicht den Mut, zu ihm zu gehen und ihm tröstend übers Haar zu streichen.
*
Unbemerkt war die kleine Heidi Holsten Renate gefolgt, obwohl sie genau wusste, dass es den kleineren Kindern verboten war, zur Unfallstelle zu gehen. Sie hatte Schwester Renate, wie die Kinder sie nannten, tief in ihr Herz geschlossen und hatte einfach wissen wollen, wohin sie ging. In sicherem Abstand war sie hinter ihr hergelaufen und ihr bis in die Kirche gefolgt. Nun sah sie die beiden Kinder und bemerkte auch, dass Jeremy sich von der Hand des größeren Mädchens losgerissen hatte. Ihr gefiel der Junge. Sie wollte ihn trösten.
Jeremy hatte das kleine blonde Mädchen noch nicht bemerkt. Tränenblind lief er an Heidi vorbei hinaus auf den Vorplatz der Kirche. Heidi eilte hinter ihm her und holte ihn bald ein. »Bleib stehen«, bat sie. »Gleich dort vorn ist die Autostraße.«
Jeremy bohrte seine Hände in die Augen, aber er ging nicht weiter. Dann ließ er die Hände sinken und sah Heidi an. »Mummy!«, rief er. »My dear Mummy ist dead.«
Heidi verstand ihn nicht, aber sie fühlte sich verpflichtet, auf den kleinen Jungen aufzupassen. Sie überlegte, dass er ungefähr so alt sein müsse wie sie. Er war ja nur ein ganz klein wenig größer als sie. Krampfhaft hielt Heidi den Jungen fest, als er wieder davonlaufen wollte.
»Nicht!«, rief sie. »Autos! Dort!« Sie deutete auf den Verkehr auf der Straße.
Jeremy hörte zu weinen auf. Etwas interessierter sah er Heidi an. Dann redete er schnell auf sie ein.
Natürlich verstand Heidi kein Wort. Aber sie nickte und redete ihm nun tröstend zu. Sie erzählte ihm auch, dass sie selbst keine Eltern mehr habe und in Sophienlust lebe. Denn sie war ganz sicher, dass der kleine Junge seine Mutti verloren hatte.
Jeremy spürte Heidis Mitleid, seine Hand stahl sich in die ihre. Heidi war sehr stolz über das Vertrauen des fremden Jungen. Sie nahm an, dass der kleine Junge ebenfalls Engländer sei.
Über die vielen Toten, und dass sie aus England stammten, hatten sie sich in Sophienlust oft unterhalten.
Sophienlust? Ja, Heidi wollte mit dem Jungen nach Sophienlust gehen. Dort würde man ihn verstehen. Tante Isi, Tante Ma und Schwester Regine waren sehr klug und konnten sich mit allen ausländischen Kindern verständigen. Und Nick und Irmela hatten auch schon eine Menge in der Schule gelernt.
»Komm mit«, bat sie.
Jeremy sah sie verständnislos an.
»Wie heißt du?«, fragte Heidi. »Ich bin die Heidi. Ich – Heidi.« Sie tippte sich auf die Brust.
»Heidi«, wiederholte Jeremy langsam. »You are Heidi.«
Eifrig nickte sie. »Und du?« Diesmal tippte sie ihm auf die Brust. »Wie heißt du?«
»Oh, I am Jeremy.«
»I am Jeremy heißt du.«
»Only Jeremy.«
»Only Jeremy«, plapperte Heidi nach.
Jeremy nickte. Widerstandslos ging er neben ihr her und folgte ihr nach Sophienlust.
*
Renate Hagen blickte noch immer wie gebannt auf Roy Bennet. Unbeweglich lag er halb über dem Sarg. Wie unter Zwang ging sie zu ihm. Sie konnte sein Leid nicht mehr mit ansehen.
»Bitte, fassen Sie sich«, sagte sie auf englisch.
Roy reagierte in keiner Weise. Er blieb in der gleichen Haltung wie bisher liegen.
Renate legte nun die Hand auf seine Schulter. Roy zuckte leicht zusammen. Endlich schien die Starre von ihm zu weichen. Doch es dauerte noch geraume Zeit, bis er den Kopf hob.
Sein vom Schmerz gezeichnetes Gesicht wandte sich der Krankenschwester zu. Aber Renate hatte das Gefühl, dass er sie gar nicht wahrnahm.
»Sie müssen sich fassen«, bat sie wieder. »Sie müssen an Ihre Kinder denken.«
Nun erst sah er sie an. »Meine Kinder? Jaja …« Er blickte sich um. »Jeremy? Wo ist Jeremy? Und Daisy?«
»Soeben waren die beiden Kinder noch da«, erwiderte Renate. Sie vergaß, dass auch sie jeden Begriff für Zeit und Raum verloren hatte.
Daisy, die ihren Bruder längst vermisst hatte, hatte inzwischen schon nach ihm gesucht. Nun kehrte sie aufgeregt in die Kirche zurück und lief zu ihrem Vater. »Daddy, Jeremy ist verschwunden. Er ist nicht draußen.« Sie blickte Renate beinahe böse an, weil sie nicht begreifen konnte, dass eine fremde Frau ihren Vater tröstete.
»Wie konnte das nur geschehen?« Roy hatte das Gefühl, keine weitere Aufregung mehr ertragen zu können. Wie hatte er in seinem Schmerz nur die Kinder vergessen können? klagte er sich an.
»Er muss aber draußen sein«, sagte er erregt. »Er kann nicht weit sein.«
»Wir werden ihn schon finden.« Renate nickte ihm begütigend zu.
Daisy schob die Unterlippe vor. Dann begann sie zu weinen.
»Daisy, mein kleines Mädchen, es ist schon gut«, tröstete Roy seine Tochter ungeschickt. Dabei wurde ihm wieder bewusst, dass er nun ganz allein die Verantwortung für seine beiden Kinder zu tragen hatte. Mary, seine geliebte Mary, stand ihm nicht mehr zur Seite. Am liebsten wäre er zum Sarg zurückgegangen und dort geblieben, um bei ihr zu sein. Ohne Mary schien das Leben keinen Sinn mehr für ihn zu haben.
Hartnäckig kehrten seine Gedanken immer wieder zu dem Tag zurück, an dem sie entschieden hatten, dass Mary sich den anderen erholungsbedürftigen Müttern aus Alvery anschließen sollte. Er dachte auch an die fröhlichen Vorbereitungen für diese erste große Reise seiner Frau. Gemeinsam hatten sie den großen Koffer gepackt. Roy hatte Mary zwei neue Kleider gekauft, in denen sie wie eine richtige Lady ausgesehen hatte. Deutlich sah er ihr übermütiges Lachen vor sich, als sie sich vor dem großen Spiegel im Wohnzimmer betrachtet hatte. Er hörte sich auch wieder sagen: »Ich sollte dich nicht fortlassen. Du bist zu schön.«
»Du bist doch nicht eifersüchtig?«, hatte sie lachend gefragt und ihn umarmt.
Und dann erinnerte er sich mit quälender Deutlichkeit an den Augenblick, als der Bus mit den fröhlichen Frauen Alvery verlassen hatte. Ein allerletztesmal hatte er Marys ovales Gesicht mit den sanften dunklen Augen gesehen, in denen Tränen geschimmert hatten. Die Kinder und er hatten dem Bus nachgewinkt.
»Daddy, komm doch!«, rief Daisy jetzt, als Roy nicht weiterging.
Wie ein Erwachender strich er sich über die Augen und sah Renate an. Plötzlich begriff er, dass sie eigentlich eine Fremde für ihn war. Er nannte seinen Namen.
Auch Renate stellte sich vor, während Daisy ihren Vater ungeduldig vorwärts zerrte. »Wir müssen Jeremy suchen, Daddy«, flehte sie. Unaufhaltsam liefen ihr Tränen über die Wangen.
Tröstend strich Renate ihr über
das blonde Haar. Doch Daisy zuckte unter dieser Berührung zurück und sah sie abweisend an. Renate führte das auf ihre furchtbare Erregung zurück.
Am Ausgang der Kirche trafen sie mit einem älteren Mann zusammen. Renate fragte ihn, ob er einen kleinen dunkelhaarigen Jungen gesehen habe.
»Ja, Fräulein, das habe ich«, erwiderte er. »Nicht wahr, er hat hellgraue lange Hosen und eine dunkelblaue Jacke an?«
»Ja, das stimmt. Wissen Sie, wohin er gelaufen ist?«
»Er war mit einem kleinen Mädchen beisammen. Einem blonden ungefähr vierjährigen Mädchen mit Rattenschwänzchen.«
Heidi! Das konnte nur Heidi gewesen sein, überlegte Renate.
»Trug das Mädchen ein rotes Kleidchen mit blauer Stickerei?«
»Genau, Fräulein. Wenn mich nicht alles täuscht, war es ein Kind von Sophienlust.«
»Vielen Dank.« Renate sah ihn erleichtert an. »Jeremy war mit einem Kind von Sophienlust beisammen«, wandte sie sich wieder in englischer Sprache an Roy. »Sophienlust ist ein Kinderheim. Ich bin dort zu Besuch. Ich glaube, Sie brauchen sich keine Sorgen um Ihren Jungen zu machen.«
Roy atmete hörbar auf. Die Sorge um Jeremy hatte ihn wieder daran erinnert, dass er von nun an eine große Verpflichtung hatte.
Daisys Hand stahl sich wieder in Roys Hand. Doch als Renate nach Daisys anderer Hand fassen wollte, versteckte sie diese auf dem Rücken. Schweigend schlugen die drei den Weg nach Sophienlust ein.
*
Der kleine Junge aus England, der mit Daisy nach Sophienlust kam, erregte natürlich Aufsehen. Henrik kam gerade die Freitreppe heruntergelaufen und fragte: »Wer ist denn das?«
»Das ist Only Jeremy«, erwiderte Heidi. Sie war stolz darauf, dass sie Jeremys Namen nicht vergessen hatte. »Er kann aber nicht Deutsch sprechen. Ich glaube, seine Mutter ist unter den Toten. Only Jeremy ist bestimmt ein Engländer.«
Jeremy blickte von dem einen zum anderen. Dass er keins der Kinder verstehen konnte, trieb ihm von neuem Tränen in die Augen. »Mummy!«, rief er. »My dear, Mummy.«
»Weißt du, was Mummy heißt?« Heidi sah Henrik fragend an.
»Weiß nicht. Vielleicht ist er gar kein Engländer. Und wie kannst du wissen, dass er seine Mutter bei dem Flugzeugunglück verloren hat, da du ihn doch nicht verstehen kannst?«
»Ich habe ihn aber verstanden. Er war auch in der Kirche bei den Särgen.«
»Aber er muss doch noch jemanden hier haben. Er ist doch bestimmt nicht allein aus England gekommen«, meinte Henrik.
Jeremy fühlte sich von Minute zu Minute einsamer. Er dachte plötzlich an seinen Vater und an Daisy. Wo waren die beiden nur? Hatten sie ihn ebenfalls allein gelassen? Nun weinte er, so laut, dass einige Kinder, die auf dem Rasen hinter dem Haus gespielt hatten, es hörten und angelaufen kamen.
Nick, der schon so gut Englisch konnte, dass er sich einigermaßen verständigen konnte, fragte den Kleinen, ob er allein hier sei. Doch Jeremy schien ihn entweder nicht zu verstehen, oder er wollte nicht antworten. Jedenfalls blieb er stumm.
»Da kann nur Mutti helfen!«, rief Nick. »Glücklicherweise ist sie im Haus. Komm, Jeremy.« Entschlossen fasste Nick das Kind bei der Hand, das ihn verwundert ansah und dann zu weinen aufhörte.
Denise kam ihnen in der Halle entgegen. »Nanu, wen bringt ihr denn da?«, fragte sie erstaunt. »Wer bist du denn?«
»Mutti, Heidi behauptet, er sei ein Engländer. Aber als ich mit ihm Englisch sprach, schien er nichts verstanden zu haben.«
Denise versuchte nun ihr Heil. Und siehe da, das Kind reagierte sofort auf ihre Fragen.
»Ich heiße Jeremy Bennet und bin mit meinem Daddy und Daisy hierhergekommen, um Mummy zu besuchen«, erwiderte Jeremy lebhaft. Sofort hatte er Vertrauen zu der lieben Dame mit dem schwarzen Haar gefasst. Sie hatte genauso liebe Augen wie seine Mummy.
»Und wo sind dein Daddy und Daisy? Ist Daisy deine Schwester?«
»Ja. Sie ist mit Daddy in der Kirche. Und Daddy ist so traurig. Und Daisy hat gesagt, Mummy sei tot und kommt nie wieder.« Jeremy begann nun wieder zu schluchzen.
»Es ist schon so, wie Heidi sagt. Wo hast du den Jungen denn aufgelesen?«, fragte Denise das kleine Mädchen.
»In der Kirche«, gestand Heidi beschämt. »Ich wollte doch nur hinter Schwester Renate hergehen und …«
»Schon gut, Heidi.« Denise sah ein, dass dies nicht der richtige Augenblick war, Heidi wegen ihres Fortlaufens Vorwürfe zu machen. »Jeremy hat seine Mutter bei dem Flugzeugunglück verloren. Armer kleiner Jeremy.«
»Aber er heißt doch Only Jeremy«, behauptete Heidi.
»Only Jeremy?« Nick schüttelte den Kopf. »Only heißt auf deutsch nur. Aber ich frage ihn noch mal.«
Jeremy erwiderte leise: »Ich heiße Jeremy.« Seine Tränen waren schon wieder versiegt. Die vielen Kinder um ihn herum gefielen ihm. Auch die liebe Dame und die andere Dame mit dem grauen Haar – damit meinte er Frau Rennert – mochte er.
»Mutti, wir werden ihm die Eisenbahn zeigen«, schlug Nick vor.
»Das ist ein guter Einfall, Nick. Ja, geht mit dem Jungen ins Eisenbahnzimmer. Ich werde indessen zur Kirche fahren. Vermutlich wird Jeremy dort schon vermisst werden. Schwester Regine, nicht wahr, Sie kümmern sich um den Jungen?«, bat sie die Kinderschwester, die sich inzwischen zu ihnen gesellt hatte. »Sie können doch auch Englisch?«
Schwester Regine nickte und redete dann auf Jeremy ein, dem es immer besser in Sophienlust gefiel. Er machte sich nun keine allzu großen Gedanken mehr um seinen Vater und seine Schwester. Und die elektrische Eisenbahn verschlug ihm dann den Atem.
Jeremy hatte sich schon lange eine solche Eisenbahn gewünscht. Aber sein Daddy hatte immer gesagt, so eine elektrische Anlage koste zu viel Geld.
»Ist die aber schön!«, rief er begeistert.
Schwester Regine übersetzte seine Worte. Jeremy fragte, ob er mal den Zug fahren lassen dürfe.
Nun waren Nick und Henrik in ihrem Element. Mit leuchtenden Augen zeigten sie Jeremy alle Hebel.
Schwester Regine dolmetschte, soweit es nötig war. Die größeren Kinder, die schon ins Gymnasium gingen, konnten sich aber bereits ganz gut mit dem Kleinen verständigen. Schon nach wenigen Minuten schien es keine Verständigungsschwierigkeiten mehr zu geben.
Denise wollte gerade in ihr Auto einsteigen, als sie Renate Hagen in Begleitung eines großen Mannes und eines kleinen Mädchens erblickte. Sofort erriet sie die Zusammenhänge.
»Ist Jeremy hier?«, fragte Renate aufgeregt.
»Er ist hier. Heidi hat ihn hergebracht.«
Renate wandte sich an Roy. »Jeremy ist hier, wie ich angenommen hatte«, erklärte sie. »Daisy, das ist Sophienlust«, sagte sie dann zu dem Kind.
Daisy sah sie nicht einmal an. Mit gesenktem Kopf stand sie stumm neben ihrem Vater, dessen Hand sie noch immer umklammert hielt.
Renate stellte Roy und das Kind Denise vor. Diese fand sogleich die richtigen Worte, ohne an den schmerzlichen Verlust, den die beiden erlitten hatten, zu rühren. Roy war ihr dankbar dafür. Denn im Augenblick hätte er nicht über Mary sprechen können. Mit Daisy an der Hand folgte er Denise ins Haus.
Erst in der Halle löste sich Daisy von ihrem Vater. Verwundert sah sie sich um und fragte leise: »Ist das hier ein Schloss?«
»Es ist ein Kinderheim«, erwiderte Denise freundlich und öffnete die Tür zum Eisenbahnzimmer.
Im gleichen Augenblick lachte Jeremy glücklich auf. Es war ihm gelungen, den Zug genau vor dem Bahnhof anzuhalten. Vor Begeisterung klatschte er in die Hände und rief: »Oh, das ist wundervoll. Nick, zeig mir doch noch, wie ich die Weichen stellen kann.« Seine dunklen Augen glänzten vor Freude, seine Wangen waren rosig gefärbt. »Schon lange habe ich mir eine solche Eisenbahn gewünscht.«
»Sieh, hier ist der Hebel für die Weichenstellung«, erklärte Nick in einen etwas holprigen Englisch, weil ihm einige Fachausdrücke unbekannt waren.
Jeremy verstand ihn trotzdem. »Lass es mich mal machen«, bat er. »Mache ich es so richtig?«, fragte er dann.
Nick, der ihn sofort verstanden hatte, nickte.
Schwester Regine beobachtete das Kind gerührt. Die Eisenbahn begeisterte Jeremy derart, dass er seinen großen Kummer vergessen hatte.
»So, und nun lassen wir die Lokomotive rückwärts fahren!«, rief Fabian auf deutsch.
Schwester Regine übersetzte seine Worte. Eifrig betätigte Jeremy wieder den Hebel. Als der Zug sich so nach seinem Willen bewegte, lachte er wieder vor Begeisterung auf.
Daisy war fassungslos angesichts der Fröhlichkeit ihres Bruders. Wie versteinert stand sie neben ihrem Vater an der Tür. Dass Jeremy sich so heiter zeigte, wollte ihr nicht in den Kopf. Statt über den Verlust der beliebten Mummy zu weinen, lachte Jeremy übers ganze Gesicht.
Empörung flammte in Daisy auf. Wütend lief sie zu dem Jungen hin und zog ihn hoch. »Wie kannst du nur so fröhlich sein?«, rief sie erregt. »Mummy ist doch gestorben. Sie liegt in einem Sarg in der Kirche.« Sie schluchzte verzweifelt auf. Viel hätte nicht gefehlt, dass sie ihren Bruder geohrfeigt hätte.
Rasch griff Roy ein. »Daisy, nicht«, bat er. »Lass Jeremy in Ruhe.«
»Ich will Mummy wiederhaben!«, schrie das Mädchen unglücklich. »Niemand hat mich mehr lieb.« Sie lief aus dem Zimmer.
Jeremy begann nun ebenfalls laut zu schreien. Als er dann sah, dass sein Daddy ebenfalls fortlief, flüchtete er sich zu Schwester Renate. Diese setzte sich und zog den kleinen Jungen auf ihren Schoß. Beruhigend redete sie in seiner Muttersprache auf ihn ein. Allmählich versiegte Jeremys Tränenstrom. Aber seine Freude am Eisenbahnspiel war vorbei.
Die anderen Kinder und Schwester Regine hatte diese Szene stumm beobachtet. Dann aber flüsterte Pünktchen Nick zu: »Wir müssen uns Jeremys Schwester vornehmen. Nicht wahr, sie heißt Daisy?«
»Ja, Pünktchen. Ihr Vater hat sie so gerufen.«
»Wir müssen ihr klarmachen, dass sie eher froh darüber sein sollte, dass Jeremy nicht so traurig ist.«
»Das wird gewiss ihr Vater schon tun.«
Aber Roy kam allein zurück. »Daisy ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Bisher war sie immer ein sehr liebes Kind.«
»Der Tod ihrer Mutter wird sie so durcheinandergebracht haben, dass sie völlig außer sich ist«, erwiderte Renate leise. Dabei stiegen auch ihr Tränen in die Augen. »Ich werde sie suchen.«
»Ich begleite Sie«, erklärte Roy.
»Weit kann sie nicht sein«, meinte Nick. »Komm, Pünktchen, wir suchen Daisy. Oft laufen Kinder zu den Ställen, wenn sie Kummer haben.«
»Mister Bennet und ich suchen im Park«, schlug Renate vor. »Kinder, ihr sollt euch alle an der Suche beteiligen.«
Jeremy ließ Renates Hand auch dann nicht los, als sie das Haus verließen. Die kleine warme Kinderhand weckte mütterliche Gefühle in Renate. Roy sprach kaum etwas, als sie mit ihm durch den schönen Park ging.
Nick und Pünktchen waren zu den Ställen gelaufen, die um diese Jahreszeit meist leer waren, denn die Pferde, Ponys und Kühe waren Tag und Nacht draußen auf den Wiesen.
»Pst, horch mal«, flüsterte Pünktchen, als sie ein Geräusch hörte. »Es klingt wie unterdrücktes Weinen. Ich glaube, Daisy ist hier.«
»Es scheint fast so. Lauf du dort entlang, und ich suche die Boxen auf der anderen Seite ab«, sagte Nick.
Daisy saß auf einem Heuhaufen in der letzten Box und schluchzte in sich hinein. Pünktchen fand sie und setzte sich neben sie. Sie strich ihr übers Haar, aber Daisy stieß ihre Hand fort.
Leider konnte Pünktchen nur wenig Englisch, und im Augenblick fiel ihr kein einziges Wort ein. »Nick, ich habe sie gefunden!«, rief sie und stand wieder auf.
Daisy blieb sitzen. Sie zog ihre Beine an und presste ihre Stirn auf die Knie. Ihr Weinen wurde lauter.
»Sie ist schrecklich unglücklich«, flüsterte Pünktchen ihrem großen Freund zu. »Und mir fällt kein einziges englisches Wort ein. Sag ihr doch, dass wir ihr helfen wollen.«
Nick versuchte Daisy nun auf seine Weise zu trösten, aber sie wollte sich nicht trösten lassen. Wütend blitzte sie ihn an und rief: »Jeremy ist gemein! Er weint überhaupt nicht um unsere Mummy.«
Sinngemäß verstand Nick ihre Worte. Er übersetzte sie Pünktchen. »Mummy heißt Mutti«, fügte er noch hinzu. »Ich werde ihr jetzt sagen, dass sie Jeremy doch nicht immerzu an den Tod seiner Mutter erinnern soll.«
»Ja, das musst du ihr klarmachen. Jeremy ist doch erst vier. Und seine Mummy wird deshalb auch nicht mehr lebendig.«
Nick redete etwas stockend auf Daisy ein. Er war stolz darauf, dass er von dem kleinen Mädchen tatsächlich verstanden wurde.
»Jeremy ist zum Trauern nicht zu klein«, erwiderte Daisy verstockt. »Ich gehe jetzt zu Daddy und sage ihm, dass wir gehen wollen. Ich mag euch alle nicht!«, rief sie wütend und lief wieder davon.
»Sie ist ein komisches kleines Mädchen«, sagte Nick mit einem tiefen Seufzer zu Pünktchen. »Komm, wir wollen sehen, ob sie den Weg zum Haus zurück auch findet.«
Roy fiel ein Stein vom Herzen, als er seine Tochter unversehrt wiedersah. Er war so erschöpft und mit seinen Nerven am Ende, dass er Denises Einladung, mit seinen Kindern in Sophienlust zu bleiben, bis alle Formalitäten zur Überführung seiner Frau nach England geregelt waren, fast erleichtert annahm.
Renate brachte ihn zu dem Gästezimmer. Bevor sie ihn verließ, versprach sie ihm, sich um seine Kinder zu kümmern.
Roy sah sie dankbar an. Dabei stellte er fest, dass sie liebe Augen hatte und eine beruhigende Wärme ausstrahlte.
Dann war er zum erstenmal seit der furchtbaren Gewissheit vom Tod seiner Frau ganz allein. Erinnerungen an seine glückliche Ehe tauchten wie Schemen vor seinen Augen auf. Er sah Mary und sich am Tag ihrer Hochzeit, zu der fast die ganze Umgebung gekommen war. Mary hatte ein wunderschönes weißes Spitzenkleid mit einem weiten angereihten Rock und einer enganliegenden Taille getragen. Ihre Wangen waren gerötet gewesen, ihre schönen Augen hatten vor Glück geglänzt. Roy hatte ihren schmalen Rücken unter seiner Hand gefühlt, als er sie über den Tanzboden geführt hatte. Federleicht war sie gewesen. Ihre vollen Lippen hatten sich beim Tanz geteilt, sodass er ihre schimmernden Zähne gesehen hatte. »Ich will dich jetzt küssen«, hatte er gesagt.
»Tu es doch!« Sie hatte ihn herausfordernd angelacht. »Es ist doch unser großer Tag.«
Er hatte sie geküsst vor allen. Ein Tusch der Kapelle hatte sie wieder in die Gegenwart zurückgebracht. Die Gäste hatten vor Begeisterung geklatscht.
Dann dachte Roy an den Tag, an dem sie ihm gesagt hatte, dass sie ein Kind bekommen würden. Er war außer sich vor Freude gewesen. Sie hatten Pläne geschmiedet. Eigentlich hatten sie immer Zukunftspläne geschmiedet. Da sie nicht mit großen Gütern gesegnet gewesen waren, hatte Mary die Hausarbeit stets selbst besorgt. Manchmal war die alte Barbara gekommen, um ihr zu helfen. Barbara war in jungen Jahren Witwe geworden und lebte seitdem allein in dem kleinen Haus, das am Rande von Alvery stand. Trotz ihres Alters ging sie oft den weiten Weg bis zu den einzelnen Farmen. Jeder freute sich über ihr Kommen. Mary aber hatte Barbara wie eine Mutter geliebt.
Roy sank aufs Bett. Nun konnte er sich endlich seinem Schmerz hingeben. Er weinte so hemmungslos wie ein kleiner Junge. Noch immer konnte er nicht fassen, dass Mary nie mehr zu ihm zurückkommen würde. Was kümmerte ihn der Rest seines Lebens? Das Licht in seinem Herzen war erloschen. Mary hatte den Glanz der Sonne, den grünen Schimmer der Bäume, den Duft der Wiesen mit sich genommen.
Ein Klopfen an der Tür riss Roy aus seinem Schmerz. Er erhob sich schwerfällig und ging zur Tür. Jeremy stand davor.
»Schwester Renate hat mir gesagt, dass du hier bist, Daddy«, sagte der Junge aufgeregt. »Daddy, Daisy ist so böse zu mir. Sie sagt, ich soll weinen. Aber ich kann doch nicht mehr weinen. Ich möchte gern bei den Kindern bleiben. Alle sind sie so lustig. Daisy hat mich nicht mehr lieb. Ich möchte zu meiner Mummy.«
Roy hob seinen Sohn hoch und küsste ihn liebevoll. »Jeremy, deine Mummy ist jetzt beim lieben Gott im Himmel. Sie schaut aber auf uns beide herunter. Sie möchte auch, dass du wieder fröhlich wirst.«
»Wirst du auch wieder fröhlich sein?« Jeremy fuhr neugierig über die Lider seines Vaters. »Hast du auch geweint, Daddy?«, fragte er jetzt mitfühlend.
»Ja, Jeremy, ich habe auch geweint. Du, Daisy und ich, wir müssen jetzt versuchen, ohne Mummy fertig zu werden.«
»Ja, Daddy. Nicht wahr, ich darf nachher mit dem Mädchen, das so viele Sommersprossen hat, und dem kleinen Mädchen, das ich zuerst kennengelernt habe, zu den Ponys gehen?«
»Das darfst du.«
Daisy stürmte ins Zimmer. »Ich mag es aber nicht, dass wir hierbleiben!«, rief sie. »Ich mag es nicht!«
»Daisy, bitte, schrei nicht so«, bat Roy matt. »Ich habe die Gastfreundschaft von Frau von Schoenecker gern in Anspruch genommen. Es gibt noch viel für mich zu erledigen.«
»Dann soll Jeremy aber nicht mehr zu den anderen Kindern gehen, Daddy. Er soll bei uns bleiben.«
»Aber Daddy hat mir schon erlaubt, mit den Kindern zu den Ponys zu laufen«, trumpfte Jeremy auf. Dass Daisy gar nicht lieb zu ihm war, kränkte ihn schwer.
»Lauf nur, mein Junge. Daisy, bitte, sei vernünftig. Wir bleiben höchstens zwei Tage hier.«
Daisy sah ihn tieftraurig an. Dann ließ sie ihn wieder allein.
Wieder kehrten Roys Gedanken zu Mary zurück. Wieder rief er sich kleine glückliche Episoden aus der Zeit mit ihr ins Gedächtnis zurück.
Daisy lief währenddessen durch das große Parktor auf die Straße hinaus. Sie wollte zu ihrer Mummy. Ohne Schwierigkeiten fand sie den Weg zu der Wildmooser Kirche. Als sie eintrat, achtete sie nicht auf ihre Landsleute, die gekommen waren, um ihre Lieben zu identifizieren. Sie kniete vor dem Sarg ihrer Mutter nieder, faltete die Hände und betete: »Liebe Mummy, ich weiß, dass du jetzt im Himmel und ein Engel bist. Aber es ist furchtbar, dass ich dich nie mehr sehen kann, dass ich nie wieder etwas zu dir sagen kann. Aber vielleicht hörst du mich trotzdem. Jeremy ist noch zu klein, um zu verstehen, dass du für immer von uns fortgegangen bist. Er glaubt bestimmt, dass du wiederkommst. Es tut mir leid, dass ich ihn beschimpft habe. Du hast uns doch beim Abschied am Bus gebeten, sehr lieb zu Jeremy zu sein, weil er noch so klein ist. Mummy, sei mir nicht böse.«
Daisy schluchzte laut auf. Die Kirche hatte sich inzwischen geleert. Niemand hatte es übers Herz gebracht, die stille Trauer des kleinen Mädchens zu stören.
Als Daisy den Kopf hob, waren die Schatten schon länger geworden. Ein letzter Sonnenstrahl fiel durch das bunte Fenster mit den heiligen Figuren.
Dann hörte Daisy ein Geräusch. Sie drehte sich um und erblickte den Pfarrer am Altar. Impulsiv lief sie zu ihm hin und fragte: »Nicht wahr, meine Mummy ist jetzt als Engel im Himmel?«
Der Pfarrer beherrschte die englische Sprache genauso gut wie seine Muttersprache. Er nickte und erwiderte: »Ja, mein Kind, sie ist jetzt im Himmel. Der liebe Gott hat sie zu sich geholt, weil sie zu gut für diese Welt war.«
»Ja, meine Mummy war sehr gut. Das haben alle Leute immer gesagt. Sie hat keinem Menschen und auch keinem Tier etwas zuleide getan. Aber warum können wir Menschen unsere lieben Toten nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihnen sprechen?«
»Mein kleines Mädchen, das können wir doch. Wir müssen uns nur beim Beten ganz auf sie konzentrieren. Dann fühlen wir ihre Nähe.«
»Das will ich tun.« Daisy kam sich sehr erwachsen vor, als sie dem Pfarrer ihre kleine Hand hinstreckte. Mit gesenktem Kopf verließ sie danach die Kirche.
Denise kam ihr entgegen. »Ich habe mir schon gedacht, dass du hier bist«, sagte sie gütig. »Aber wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Und Jeremy hat geweint, weil er dich vermisst hat, Daisy.«
»Ich habe mit Mummy und mit dem Herrn Pfarrer gesprochen«, erwiderte Daisy. Sie wollte diese Dame nicht nett finden, aber sie fand sie eben doch nett. Zugleich nahm sie sich vor, sich von allen Leuten möglichst fernzuhalten. Sie sehnte sich nach Hause. Dort wollte sie dann ihre Mummy vertreten, damit sie sich über sie freute. Sicherlich saß sie den ganzen Tag oben an einem Himmelsfenster und schaute mit einem Fernrohr zur Erde herunter. Aber vielleicht fand sie ihre Farm nicht?
Zu gern hätte Daisy Denise von Schoenecker gefragt, ob das möglich sei, aber sie wollte sich ihr nicht anvertrauen.
*
Daisy und Jeremy waren zusammen in einem Zimmer untergebracht worden. Doch der kleine Junge hätte viel lieber bei Heidi geschlafen, weil seine Schwester ihn so vorwurfsvoll anblickte. Tante Renate, wie er die Krankenschwester nennen durfte, hatte ihm aber zugeredet, bei Daisy zu bleiben. Darum hatte er sich auch gefügt.
Jeremy hatte Tante Renate schrecklich lieb und wäre zu gern bei ihr geblieben. Das flüsterte er ihr auch zu, als sie noch einmal ins Zimmer kam, um Daisy und ihm gute Nacht zu sagen.
»Vielleicht darfst du hier im Kinderheim bleiben«, entgegnete Renate unüberlegt, ohne zu ahnen, was sie damit anrichtete.
»Jeremy kommt mit nach Hause!«, rief Daisy aufgeregt. »Er ist mein Bruder. Er gehört mir ganz allein.«
Renate biss sich auf die Lippen. Anfangs hatte sie sich eingeredet, dass Daisys Benehmen ihr gegenüber nur auf ihre Verzweiflung zurückzuführen sei. Inzwischen aber war ihr klargeworden, dass Daisy ihren Vater und ihren Bruder eifersüchtig vor jedem Menschen abschirmen wollte. Trotzdem blieb Renate freundlich. »Daisy, denk doch ein bisschen an Jeremy«, bat sie. »Er soll doch glücklich sein.«
»Wie kann er glücklich sein, wenn Mummy tot ist?«, rief Daisy. Im Schlafanzug lief sie aus dem Zimmer, um nach ihrem Daddy zu suchen. Als sie ihn nicht in seinem Zimmer fand, eilte sie den Korridor entlang und sprang, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter.
Die größeren Kinder, die nach dem Abendessen noch aufbleiben durften, saßen gerade vor dem Fernsehapparat.
»Ich will zu Daddy!«, rief Daisy. »Wo ist mein Daddy?«
»Dein Daddy ist noch ein bisschen spazierengegangen«, erwiderte Irmela Groote, die als einziges Kind die englische Sprache ganz perfekt beherrschte.
»Ich glaube, er ist noch einmal zur Kirche gegangen«, sagte Frau Rennert. »Daisy, du musst wieder ins Bett.«
»Ich will aber nicht! Ich will nicht!«
Denise war mit ihren Söhnen bereits nach Schoeneich gefahren, sodass sie diesmal nicht einspringen konnte. Dafür versuchte es Schwester Regine. Daisy blieb zwar verstockt, aber sie ließ sich wenigstens ins Bett zurückbringen.
Noch lange blieb die Kinderschwester bei Daisy und sprach tröstend auf sie ein. Als Schwester Regine endlich das Zimmer verließ, war Roy Bennet noch immer nicht da.
Renate Hagen begann sich jetzt ernstlich Sorgen um den Engländer zu machen. Obwohl sie ihn noch nicht einmal einen Tag lang kannte, fühlte sie sich so stark zu ihm hingezogen, dass sie das Haus verließ, um nach ihm zu suchen. Den Schlüssel für das Parktor hatte sie eingesteckt.
Renate ging die Straße entlang nach Wildmoos. Es war Vollmond. Am nachtklaren Himmel standen glitzernd die Sterne.
Erleichtert atmete sie auf, als sie die hohe Gestalt Roy Bennets auf sich zukommen sah. Sie blieb stehen und erwartete ihn.
»Ich habe mir große Sorgen um Sie gemacht, Mister Bennet«, erklärte
sie.
»Ich war noch einmal bei meiner Frau. Ich habe sie noch einmal sehen wollen. Man hat mir den Sarg geöffnet. Ich bin glücklich, dass ich sie noch einmal sehen konnte. Ihr schönes Gesicht war nicht entstellt. Sie hat so glücklich gelächelt, dass auch ich ruhiger geworden bin. Es war mir, als hätte sie noch einmal mit mir gesprochen. Sie hat die Bitternis aus meinem Herzen genommen.«
Zum erstenmal sah Renate ihn lächeln. Ihr Herz flog ihm zu.
»Ich weiß nun, wo mein Weg liegt«, sprach Roy leiser weiter. »Ich muss für die Kinder weiterleben und unsere Farm erhalten. Jeremy wird sie später bekommen. Er soll auch den Familiennamen meiner Frau erhalten, sodass er dann einen Doppelnamen haben wird. Das hatten Mary und ich schon vorgehabt. Denn unsere Farm befindet sich seit vielen Generationen im Besitz von Marys Familie.«
»Das ist schön für Jeremy.«
Roy blieb stehen und sah Renate an. Ihr ovales Gesicht war hell vom Mondlicht erleuchtet. »Warum tun Sie das alles für mich?«, fragte er.
»Was?«
»Dass Sie sich um die Kinder und mich kümmern.«
»Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie Hilfe brauchen.«
»Ich habe sie gebraucht, Fräulein Hagen.«
»Wollen Sie mich nicht Renate nennen? Ich weiß, dass man in England gute Freunde mit dem Vornamen anredet. Und ich möchte Ihnen eine gute Freundin sein.«
»Gern, Renate. Es gefällt mir auch, dass ich mit Ihnen in meiner Sprache reden kann. Deutsch habe ich zwar mal in der Schule gelernt, aber viel ist nicht hängengeblieben.«
Renate lächelte und setzte dann zusammen mit ihm den Weg fort. Vor dem Haus umfasste Roy ihre Hand und drückte sie dankbar. »Sie haben mir sehr geholfen. Ich glaube sogar, dass ich heute Nacht schlafen kann.«
Renate fand dagegen keinen Schlaf. Sie brauchte einen Menschen, mit dem sie reden konnte. Sollte sie Regine noch einmal stören?
Regine Nielsen war noch nicht zu Bett gegangen. Sie saß im Morgenmantel vor ihrem kleinen Schreibtisch und schrieb.
»Störe ich?«, fragte Renate leise von der Tür her.
»Aber nein, ich habe doch auf dich gewartet.« Regine klappte die Schreibmappe zu und erhob sich.
»Du hast auf mich gewartet?«
»Ja, Renate. Ich kenne dich gut und habe deshalb bemerkt, dass du ziemlich durcheinander bist.«
»Das bin ich, bei Gott!«, rief Renate erleichtert aus und setzte sich aufs Sofa. »Stört es dich, wenn ich rauche?«
»Keineswegs. Ich werde mir auch eine genehmigen.« Regine schob Renate das Zigarettendöschen und das Tischfeuerzeug zu. Nachdem sich die Freundin bedient hatte, zündete sie sich ebenfalls eine Zigarette an. Dann fragte sie: »Nicht wahr, dir gefällt Roy Bennet?«
»Mehr als das. Als ich ihn zum erstenmal am Unfallort mit seinen beiden Kinder sah, traf es mich wie ein Blitz. Und heute Abend habe ich begriffen, dass mein Gefühl für ihn Liebe ist. Findest du das nicht schrecklich? Seine Frau liegt noch nicht einmal unter der Erde.«
»Warum soll das schrecklich sein? Gegen die Liebe ist man machtlos, Renate. Ich hoffe nur, dass deine Liebe eines Tages Erfüllung findet.«
»Das wird vermutlich niemals der Fall sein. Regine, ich mache mir darin nichts vor. Morgen oder übermorgen verlässt Roy Bennet mit seinen Kindern Sophienlust. Dann werde ich ihn nie wiedersehen.«
»Du solltest nicht ganz so hoffnungslos in die Zukunft blicken, Renate.«
Noch lange sprachen die beiden Freundinnen über Roy und seine Kinder. Dann fielen ihnen fast die Augen zu. Renate gab Regine einen Gute-nacht-Kuss und kehrte in ihr Zimmer zurück. Sie musste dabei an der Tür von Roys Zimmer vorbei. Unwillkürlich wurden ihre Schritte langsamer. Sie blieb sogar einige Sekunden stehen und lauschte. Aber nichts rührte sich in dem Zimmer. Der heimlich geliebte Mann schien fest zu schlafen.
*
Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass es noch ungefähr drei Tage dauern würde, bis alles zur Überführung der Särge nach Alvery geregelt sein würde. Roy war froh, dass er noch in Sophienlust bleiben durfte. Daisy dagegen weinte vor Verzweiflung, als sie davon erfuhr. Trotz der Bemühungen aller Sophienluster sonderte sie sich ab. Und ihre Eifersucht auf Jeremy war ganz offensichtlich. Sie ertrug es nicht, dass er sich den anderen Kindern anschloss.
Daisy wich deshalb auch nicht von der Seite ihres Vaters und begleitete ihn überallhin. Roy wäre oft lieber allein gefahren, aber er wollte seine verzweifelte Tochter nicht vor den Kopf stoßen. Still hörte er ihr zu, wenn sie sich über Jeremys »Abtrünnigkeit« beklagte. Er wusste, dass er es mit ihr in der nächsten Zeit nicht leicht haben würde, dass er einer schweren Zeit entgegenging. Der Tod ihrer Mutter hatte Daisy vollkommen verändert. Am schlimmsten war, dass sie Jeremy immer wieder anfuhr, ihn mit Vorwürfen überhäufte und sichtlich zufrieden war, wenn er zu weinen anfing und nach seiner Mutter schrie.
Renate, die Roy in allen Dingen treu zur Seite stand, half ihm auch dabei.
»Ich fürchte«, meinte Roy, »dass Daisy auch daheim bei uns in Wales Jeremy immer wieder an den Tod seiner Mutter erinnern wird. Jedenfalls so lange, bis sie sich von dem Schmerz um ihre Mummy erholt hat.«
»Wäre es in diesem Fall nicht besser, wenn Sie Jeremy hierlassen würden?«, schlug Renate sofort vor. Dabei klopfte ihr Herz zum Zerspringen. Würde Jeremy im Kinderheim bleiben, würde sie selbst weiterhin mit Roy Bennet in Verbindung bleiben. Dann könnte sie ihm brieflich über Jeremy berichten.
»Sie meinen, er soll in Sophienlust bleiben? Glauben Sie, dass er gern hierbleiben würde?«
»Ich bin fast sicher, Mister Bennet. Ich selbst habe noch drei Wochen Urlaub und würde mich um Jeremy kümmern.«
»Ihr Vorschlag hat etwas Bestechendes«, erwiderte er. »Auch Mary würde damit einverstanden sein. Sie hat immer wieder gesagt, dass Jeremy ein besonders sensibles Kind sei und man sehr vorsichtig mit seiner Erziehung sein müsse. Alles, was er tat, tat er aus Freude. Das sollte auch so bleiben. Aber Daisy könnte unbewusst seine Seele vergiften. Wird aber Frau von Schoenecker damit einverstanden sein, dass Jeremy hierbleibt?«
»Bestimmt wird sie das. Wir können sie gleich fragen. Sie ist im Augenblick bei Frau Rennert. Wollen wir zu ihr gehen?«
Roy nickte. Zwar konnte er sich eine längere Trennung von seinem Sohn nur schwer vorstellen, doch er fand Renates Vorschlag trotzdem bestechend.
Denise war sofort einverstanden. »Jeremy bleibt bestimmt gern hier«, meinte sie.
»Jeremy ist bei den Ponys«, erklärte Schwester Regine, als man sie nach dem Kind fragte. »Nick hat ihm versprochen, ihn einmal reiten zu lassen.«
»Da wird Jeremy in seinem Element sein. Daheim ist er auch schon auf einen Pferderücken gestiegen zum Entsetzen meiner Frau.« Roy wunderte sich fast, dass er so leicht über Mary sprechen konnte. Es tat ihm sogar gut, immer wieder ihren Namen aussprechen zu können.
Jeremy strahlte, als er erfuhr, dass er für die nächsten Wochen in Sophienlust bleiben sollte. »Nur wegen Tommy bin ich ein ganz klein wenig traurig«, sagte er. »Aber Barri ist auch lieb. Sieh doch, Daddy, er ist immer in meiner Nähe.«
Barri, der Bernhardiner, stupste das Kind liebevoll an. Es war, als hätte er Jeremys Worte verstanden.
Daisy weinte vor Verzweiflung, als sie erfuhr, dass Jeremy in Sophienlust bleiben würde. »Daddy, das geht doch nicht!«, rief sie. »Jeremy muss doch bei Mummys Beerdigung dabeisein.«
Doch Roy erwiderte: »Ich bin sogar froh, dass er nicht dabeisein wird, Daisy.«
»Daddy, er wird uns alle vergessen. Jeremy wird nie wieder zu uns zurückwollen.«
»Das ist doch Unsinn, mein Kind. Alle Kinder kehren nach einiger Zeit mit Freuden nach Hause zurück.«
Daisy wollte das nicht einsehen. Als die Abschiedsstunde schlug, schluchzte sie laut.
»Daisy, du brauchst dir doch keine Sorgen um Jeremy zu machen. Renate ist doch bei ihm.«
»Ich mag sie aber nicht, Daddy, weil sie sich immer zwischen uns drängt.« Daisy wischte ihre Tränen mit dem Taschentuch fort. Sie weigerte sich auch, sich von allen zu verabschieden. Mit verstocktem Gesicht saß sie in dem Leihwagen und wartete ungeduldig darauf, dass ihr Daddy endlich einstieg. Als Roy sich noch einmal von Jeremy und Renate verabschiedete, schaute sie schnell beiseite. Sie drehte sich auch nicht ein einziges Mal um, als der Wagen durch das Parktor fuhr.
Jeremy schmiegte sich an Renate, als das Auto nicht mehr zu sehen war. »Ich habe dich lieb, Tante Renate«, gestand er leise. »Nicht wahr, du fährst später mit mir nach Hause?«
Renate nickte unter Tränen. Die Anhänglichkeit des kleinen Jungen rührte sie. Ein Lächeln erhellte ihre Züge bei dem Gedanken an Roy. Er hatte sie gebeten, ihm so oft wie möglich über Jeremy zu berichten, und sie hatte ihm das mit Freuden versprochen. Gleich morgen würde sie zum erstenmal an ihn schreiben.
»Schwester Renate, nicht wahr, Sie fahren jetzt mit uns zum Tierheim Waldi u. Co?«, fragte Heidi. Sie war selig, dass Jeremy noch in Sophienlust blieb. »Jeremy möchte doch so gern alle Tiere dort kennenlernen. Er glaubt nicht, dass es dort ein ganz winziges Pferdchen gibt.«
»Gut, dann fahren wir sofort los!«, rief Renate munter
*
Fast ganz Alvery war auf den Beinen, als die bei der furchtbaren Flugzeugkatastrophe tödlich verunglückten Frauen zu Grabe getragen wurden.
Die meisten Toten waren Mütter, die ihre Männer mit den Kindern zurückgelassen hatten. Keiner der Männer schämte sich der Tränen, die ihnen bei der Trauerfeier über die Wangen liefen.
Daisy ging neben ihrem Vater direkt hinter dem Sarg ihrer Mummy. Krampfhaft hielt sie die Hand ihres Daddys, der sie jedoch nicht einmal zu bemerken schien.
Roy spürte zwar die Wärme der Kinderhand, aber er fand darin keinen Trost. Wieder hatte er dieses seltsame Gefühl, das alles nicht wirklich zu erleben. Sein Blick hing wie gebannt an dem mit Blumen überladenen Sarg. Auch die anderen Särge waren mit Blumen und Kränzen reich geschmückt.
Keiner der Trauernden bemerkte die tief hängenden Wolken und den feinen Nieselregen, der sich mit ihren Tränen vermischte. Hin und wieder hörte man lautes Schluchzen oder hemmungsloses Kinderweinen. Nur Daisy konnte nicht weinen. Sie war noch immer wütend auf Jeremy, weil er durchaus in diesem Kinderheim hatte bleiben wollen. Sie nahm sich vor, ihm niemals zu verzeihen, dass er seine Mummy auf ihrem letzten Weg nicht begleitete.
Plötzlich blickte Daisy erschrocken ihren Daddy an. Sie hatte einen ganz merkwürdigen Laut von ihm gehört. Nun sah sie, dass ihr Daddy weinte. Jetzt erst lösten sich auch ihre Tränen. Sie fing laut zu schluchzen an.
Als der Pfarrer seine lange Rede hielt, in der er sämtliche Toten mit liebevollen Worten bedachte, goss es in Strömen. Daisy fror plötzlich entsetzlich. Ihre laut klappernden Zähne brachten Roy schließlich in die Wirklichkeit zurück. »Daisy, mein kleines Mädchen, es ist gleich vorbei.«
»Ja, Daddy.« Sie schmiegte sich an ihn. »Nun sind wir beide ganz allein.«
»Ja, nun sind wir allein.« Roy fiel nicht einmal auf, dass Daisy Jeremy aus ihren Gedankengängen ausgeschlossen hatte.
Die Särge wurden in die Grube hinuntergelassen, die Angehörigen, Freunde und Bekannten warfen Erde auf die Särge. Roy warf einen dunkelroten Rosenstrauß auf Marys Sarg. Dann wandte er sich ab und ging mit Daisy an der Hand davon. Er hatte einfach nicht mehr die Kraft, sich von allen die Hand drücken zu lassen. Er wollte allein sein mit seiner unerträglichen Seelenpein.
Völlig durchnässt stiegen Roy und seine Tochter ins Auto. Daisy wickelte sich weinend in die Wolldecke. »Ich möchte auch in den Himmel zu Mummy, Daddy. Ich will bei ihr sein!«, weinte sie laut.
»Daisy, Gott hat es so gewollt«, erwiderte Roy geistesabwesend. Er dachte daran, dass daheim kein Mensch auf sie wartete. Die alte Barbara, die sonst immer zu ihnen gekommen war, lag seit drei Tagen mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus.
Der Regen wurde immer heftiger. Als Roy die Farm erreichte, fiel der Regen so dicht, dass Roy kaum einen Meter weit sehen konnte.
»Du musst sofort ein heißes Bad nehmen, Daisy«, bestimmte er. »Es wäre schlimm, wenn du krank werden würdest. Mein Gott, Tommy, du bist ja auch ganz nass!«, rief er, als der Irish-Terrier angelaufen kam und leise winselte.
Es erging Daisy in diesem Augenblick nicht anders als ihrem Vater. Der Anblick des nassen Hundes riss sie aus ihrer Verzweiflung. Auf einmal war sie voller Tatendrang. Sie überlegte, was Mummy in einem solchen Fall getan hätte und erinnerte sich, dass sie Tommy dann immer mit einem alten ausrangierten Badetuch gründlich abgetrocknet hatte.
Dasselbe tat nun auch Daisy. Tommy leckte ihr dankbar die Hände, als er wieder trocken war. Erst danach zog Daisy das nasse dunkle Mäntelchen und die völlig durchnässten Schuhe aus. Sie lief hinauf ins Badezimmer und ließ warmes Wasser in die Wanne einlaufen.
Das heiße Wasser tat Daisy gut. Als sie sich abseifte, lauschte sie unwillkürlich nach unten. Wenn sie früher gebadet hatte, war ihre Mutter immer heraufgekommen und hatte nach ihr geschaut. Oder Jeremy hatte seinen Kopf ins Badezimmer hereingesteckt und gefragt: »Bist du bald fertig, Daisy?«
Aber diesmal blieb alles im Haus still. Auch ihr Daddy war nicht zu hören. Da wurde es Daisy auf einmal so schwer ums Herz, dass sie wieder zu weinen begann.
Dann war Roy plötzlich bei ihr. Er wickelte sie in ein großes Badetuch ein und trug sie in ihr Zimmer. Dort half er ihr beim Anziehen. Obwohl es Sommer war, zog er ihr einen dicken Pullover über den Kopf.
»So, Daisy, nun komm nach unten«, sagte er. »Ich habe inzwischen Tee aufgebrüht. Starker süßer Tee wird dir guttun.«
Später saßen Vater und Tochter einander stumm am Küchentisch gegenüber. Daisy nahm die Tasse zwischen beide Hände und schlürfte den heißen Tee. Dabei entdeckte sie einige Flecke auf der geblümten Tischdecke. »Daddy, wir müssen eine neue Tischdecke auflegen«, erklärte sie. »Mummy hat niemals erlaubt, dass wir von einer solchen Decke aßen.«
»Gut, Daisy.« Roy war alles gleichgültig. Er war auf einmal unendlich müde und fühlte sich so leer wie ein ausgeschöpfter Brunnen. Er dachte an die vielen täglichen Verpflichtungen, die für Mary eine Selbstverständlichkeit gewesen waren, und irrte durch die Räume des Hauses. Überall fand er Dinge, die ihm zum Bewusstsein brachten, dass Mary sie berührt hatte.
»Mary, geliebte Mary«, flüsterte er mit gebrochener Stimme, als er den Kleiderschrank öffnete und ihre Kleider sah. »Es kann einfach nicht wahr sein, dass du nie mehr zu mir zurückkommst. Es kann wirklich nicht wahr sein …«
Daisy suchte nach ihrem Vater und fand ihn im Schlafzimmer. Dort saß er mit hängenden Schultern auf Mummys Bett. Er bemerkte sie nicht einmal. Dann zog Daisy sich auch wieder still zurück.
An diesem Tag fand Daisy nur Trost bei Tommy. Er schien zu spüren, wie einsam und verlassen sie sich fühlte. Sie saß mit dem Hund auf der Ofenbank in der Küche und blickte hinaus in das triste Wetter. Als es zu dämmern anfing, hörte sie Schritte über sich. Dann vernahm sie das Öffnen einer Tür, und kurz darauf erschien ihr Daddy in der Küche.
»Daisy, du musst etwas essen«, sagte Roy mit rauer Stimme. »Das Leben geht für uns beide weiter.«
»Ja, Daddy. Ich will Mummy vertreten. Wir haben doch jetzt niemanden, der uns hilft. Barbara ist doch so krank.«
»Leider ist es so.« Einen Augenblick dachte Roy an Renate Hagen und die selbstverständliche Art, mit der sie in sein Leben eingegriffen hatte. Er wünschte sich, dass sie jetzt
hier sei. Ihr stilles zurückhaltendes Wesen erinnerte ihn an Mary. In den wenigen Tagen in Sophienlust war er viel mit ihr beisammen gewesen. Dass Jeremy in ihrer Obhut war, beruhigte ihn sehr.
An diesem Abend bereitete Roy für sich und seine Tochter ein Abendessen aus Konservendosen zu. Daisy hatte plötzlich Hunger, um ihr zu gefallen zwang sich Roy ebenfalls zum Essen.
Als Daisy ihn dann bat, bei ihm schlafen zu dürfen, nickte er. Auch Tommy bekam sein Lager im Schlafzimmer. Er blieb aber vor Daisys Bett liegen.
Daisy schlief sofort ein. Roy lag dagegen die halbe Nacht wach. Erst als der Morgen graute, fielen ihm vor Erschöpfung die Augen zu.
*
Nur nach und nach normalisierte sich das Leben in Alvery wieder. Einige Familien, die die Mutter verloren hatten, zogen aus der Gegend fort. Die Kinder gingen inzwischen wieder zur Schule. Auch Daisy wurde jeden Morgen von ihrem Daddy zur Schule gebracht. Sie stellte fest, dass bei den anderen Kindern für die Mutter Schwestern, Tanten oder andere Verwandte einsprangen. Sie aber war immer noch mit ihrem Vater allein.
Die alte Barbara war inzwischen gestorben. Auch das war für Roy ein harter Schlag gewesen. Er hatte im Stillen immer noch gehofft, dass sie wieder gesund werden und ihm im Haushalt helfen würde. Natürlich hätte er sich eine andere Frau für den Haushalt suchen können, aber Daisy wollte davon nichts wissen.
Roys einziger Trost waren die regelmäßigen Briefe von Renate. Sie schilderte das Leben in Sophienlust und Jeremys Begeisterung, dort leben zu können. Ihre lieben, einfühlsamen Worte waren Balsam für sein gequältes Herz. Die Tage, an denen er keinen Brief von ihr erhielt, kamen ihm leer vor.
Daisy bemühte sich rührend, die Stelle ihrer Mutter im Haus zu übernehmen. Obwohl immer wieder kleine Pannen passierten, war sie für ein achtjähriges Mädchen doch erstaunlich tüchtig. Mit verbissenem Ehrgeiz arbeitete sie neben der Schule im Haus. Sie wollte ihrem Vater beweisen, dass sie keine weibliche Hilfe im Haus benötigten.
Aber Roy entging Daisys blasses Aussehen nicht. Außer auf dem Schulweg kam sie kaum noch an die frische Luft. Darum beschloss er sich an einem besonders schwülen Sommertag, eine entscheidende Veränderung in ihrem Leben zu treffen.
Daisy hatte an diesem Tag ein Steak für ihn vorbereitet. Leider waren die Kartoffeln angebrannt. Als Roy das Haus betrat, roch er sofort, was passiert war.
Daisy schluchzte leise vor sich hin, als sie den Topf mit einem Pfannenwender bearbeitete. »Gib her, mein Kleines«, sagte Roy zärtlich. »Die Arbeit wird allmählich zu viel für dich. Hast du denn überhaupt schon deine Schularbeiten gemacht?«
Daisy schneuzte sich und strich Tommy schnell über den Kopf, als er ihr tröstend über die Hand leckte. »Die mache ich nach dem Abendessen, Daddy. Sei nicht böse, dass die Kartoffeln angebrannt sind. Aber ich hatte die Hühner gefüttert und …« Schon wieder schossen ihr Tränen aus den Augen.
»Ich habe heute Lucy Miller getroffen. Sie wäre bereit, als Haushälterin bei uns zu arbeiten. Ich habe ihr gesagt, dass ich zuerst mit dir sprechen will, Daisy.«
»Miss Miller?«, rief Daisy erschrocken. »Ich mag sie nicht. Sie will dich heiraten.«
»Unsinn, Daisy.« Roy unterdrückte einen Seufzer. Es fiel ihm manchmal sehr schwer, Daisy gegenüber geduldig zu bleiben. Schon längst war ihm aufgefallen, dass sie jede Frau ablehnte. Aus diesem Grund hatte er ihr auch nie Renates Briefe vorgelesen. Er wusste, dass Daisy ihr ebenso ablehnend gegenüberstand wie jeder anderen Frau.
»Aber ich will nicht, dass sie hierherkommt, Daddy. Mummy hat sie nicht leiden mögen.« Daisy sprach bewusst die Unwahrheit aus, denn ihre Mutter hatte immer gesagt, dass Lucy Miller besonders lieb sei.
»Das ist mir neu.« Roy setzte sich auf die Ofenbank. »Ich werde eine Scheibe Brot zu dem Steak essen. Was isst du denn?«
»Ich habe keinen Hunger, Daddy.« Diesmal sagte Daisy die Wahrheit. Sie fühlte sich viel zu erschöpft, um noch etwas essen zu können. »Ich trinke ein Glas Milch, Daddy.« Sie wischte sich die Tränen fort. »Nicht wahr, Daddy, du holst Miss Miller nicht zu uns?« Flehend sah sie ihn an.
Roy hielt es für klüger, sich in dieser Beziehung im Moment nicht festzulegen. Gerührt blickte er in das so spitz gewordene Kindergesicht mit den großen ernsten Augen. Seit Mary tot war, hatte er Daisy noch kein einziges Mal lachen sehen. Vielleicht hätte er Jeremy doch mit heimnehmen sollen?, fragte er sich, als er seine Tochter am Herd beobachtete. Geschickt wendete sie das Steak, salzte und pfefferte es dann. Und genauso wie Mary sagte sie, als sie es vor ihn hinstellte: »Ich hoffe, dass das Steak auch zart ist.«
Selbst wenn es steinhart gewesen wäre, hätte Roy es schweigend verzehrt, um dem Kind nicht den Mut zu nehmen. Aber das Steak war butterweich und genau so, wie er es liebte.
Daisy setzte sich zu ihm. Sie nippte nur an ihrem Milchglas. Der Blick ihrer blauen Augen richtete sich mit einem zerquälten Ausdruck auf ihn.
»Hast du irgendetwas?«, fragte Roy.
»Ich habe nur an Mummy gedacht«, erwiderte sie. Es war, als wollte sie ihn immer wieder an Mary erinnern. Bei jeder Gelegenheit sprach sie von ihr. Dass sie heftige Gewissensbisse hatte, ahnte Roy nicht. Denn mit der Nachmittagspost war wieder ein blauer Brief gekommen. Diese nach einem zartem Parfüm duftenden Briefe waren Daisy ein Dorn im Auge. Dass ihr Daddy nie über Renate Hagen sprach, war für sie der sichere Beweis dafür, dass er mit dieser Frau irgendwelche Geheimnisse hatte. Deshalb hatte sie den Brief an sich genommen. Nun lag er in ihrer Kommode zwischen ihrer Wäsche. Sie hatte es nicht gewagt, ihn zu zerreißen.
»Ist heute Post gekommen?«, fragte Roy und sah seine Tochter fragend an.
Daisy wurde dunkelrot und senkte den Kopf. Auf einmal fühlte sie sich sehr schlecht. Sie dachte an ihre Mummy, die sicherlich empört über ihre Handlungsweise gewesen wäre.
Daisy stand auf und lief nach oben. Mit dem Brief in der Hand kam sie kleinlaut in die Küche zurück. Trotzig sah sie ihren Vater an und sagte: »Ich habe … ich wollte … Dieser Brief ist gekommen.«
Roy nahm ihn still entgegen. Es war für ihn nicht schwer zu erraten, was in Daisy vorging. Auch vermutete er, dass sie ihm den Brief hatte unterschlagen wollen. Aber er machte keine Bemerkung über seinen Verdacht.
Daisy räumte das Geschirr ab und spülte es dann ab. Roy las währenddessen Renates Zeilen. Sie schrieb, dass ihr Urlaub jetzt abgelaufen sei und dass sie in den nächsten Tagen nach Ulm zurückfahren müsse, wo sie in einem Krankenhaus angestellt sei. Aber er brauche sich keine Sorgen um Jeremy zu machen. Er fühle sich sehr wohl in Sophienlust, und sie werde jedes freie Wochenende nach Sophienlust fahren, um ihn zu besuchen.
Roy ließ den Brief sinken. »Ich werde Jeremy bald heimholen, Daisy«, sagte er.
»Mag er denn überhaupt noch zu uns nach Hause? Schwester Renate hat ihn bestimmt gegen uns aufgehetzt!«, rief sie mit bebenden Lippen.
»Renate würde so etwas nie tun, Daisy.« Seine Stimme hatte schärfer geklungen, als er gewollt hatte. Daisy zuckte bei seinen Worten zusammen und lief hinaus Roy blieb sitzen. Er rührte sich auch nicht, als er hörte, dass die Haustür laut zugeworfen wurde.
Tommy kratzte bald darauf aufgeregt an der Haustür. Endlich raffte sich Roy auf und erhob sich. Er ließ Tommy hinaus, der sofort Daisy nachlief. Sie saß zusammengekrümmt auf der Bank unter der uralten Eiche und schluchzte hemmungslos. Sie war überzeugt, dass sie keiner mehr lieb habe. Selbst ihr Daddy war jetzt böse auf sie.
Roy räumte zunächst das Geschirr ein. Erst dann suchte er nach seiner Tochter. Daisy ließ sich von ihm willig ins Haus zurückbringen, aber sie war unansprechbar.
»Geh jetzt schlafen, Daisy.«
»Ich muss aber meine Schulaufgaben noch machen!«, rief sie aufsässig.
»Ich schreibe dir einen Entschuldigungszettel, Daisy. Du musst sofort ins Bett.«
»Glaubst du nicht, dass Miss Hunter mich schimpfen wird?« Miss Hunter war ihre Lehrerin.
»Wenn du Angst hast, dann bleib morgen daheim, Daisy.«
Daisys Trotz wich kindlicher Dankbarkeit. »Wirklich, Daddy?«, fragte sie und umarmte ihren Vater.
»Du bist doch mein liebes kleines Mädchen«, sagte er weich. »Ich weiß ja, wie schwer alles für dich ist. Schlaf gut, mein Schatz.«
»Du auch, Daddy. Komm, Tommy!« Daisy rief nach ihrem Hund und stieg die Holztreppe hinauf.
Roy verließ währenddessen das Haus. Gewaltsam zog es ihn zum Friedhof. Dort fand er meist ein wenig Ruhe. Lange stand er vor dem Grab seiner Frau und hielt stumme Zwiesprache mit ihr. Aber diesmal fiel die Unruhe nicht von ihm ab.
Langsam kehrte Roy nach Hause zurück. Über ihm wölbte sich ein sternenklarer Himmel. Die Luft war erfüllt vom Zirpen der Grillen und vom Quaken der Frösche.
»Mary, meine kleine Mary«, flüsterte Roy verzweifelt. Und dann dachte er plötzlich an Renate Hagen. Der Wunsch, mit ihr zu sprechen, ihre liebe weiche Stimme zu hören, in ihre samtbraunen Augen zu blicken, wurde so übermächtig in ihm, dass er aufstöhnte.
Als Roy das Haus von weitem erblickte, sah er Licht im Wohnzimmer. Hatte er es brennen lassen?, fragte er sich. Aber er konnte sich genau entsinnen, dass er es ausgeknipst hatte, bevor er fortgegangen war.
Daisy saß im Ohrensessel, als Roy ins Zimmer trat. Sie hatte das karierte Plaid um sich geschlagen und schlief fest. Nur Tommy erhob sich gähnend und sah ihn mit vorwurfsvollen Augen an.
»Ist schon gut, mein Alter«, sagte Roy lächelnd und fuhr ihm über den Kopf.
Daisy schlug jetzt die Augen auf. »Ich habe so sehr auf dich gewartet, Daddy. Wo warst du denn so lange?«
»Ich war auf dem Friedhof, Daisy.« Roy setzte sich auf die Seitenlehne des Sessels und strich seiner Tochter übers Haar. »Du solltest doch längst schlafen, mein Schatz. Es ist gleich zehn.«
»Daddy, ich wollte dir Gesellschaft leisten, weil du doch so einsam bist ohne Mummy.« Daisy schmiegte sich an ihn. »Ich bin auch einsam.« Sie schluchzte leise auf. »Weil doch Jeremy auch fort ist. Ich wünschte, er wäre hier.«
Zärtlich strich Roy seiner kleinen Tochter eine helle Strähne aus der runden Stirn. »Ich sehne mich auch nach ihm. Ich glaube, wir sollten ihn heimholen. Aber wir müssen damit noch warten, bis die Ernte eingebracht ist.«
»Wie lange dauert das denn noch?«
»Zwei bis drei Wochen.«
Roy hatte plötzlich das Gefühl, dass er in dieser Stunde mit Daisy offen über seine Gefühle für Renate Hagen sprechen könne. Sie schien vernünftiger geworden zu sein. Er stand auf und holte Renates letzten Brief aus der Schreibtischschublade.
»Ich habe auf dem Heimweg nachgedacht, Daisy. Lucy Miller wäre wirklich nicht die richtige Hilfe für uns. Renate Hagen oder Schwester Regine, wir ihr Kinder sie nennt, würde viel besser zu uns passen.«
Daisys Miene verschloss sich. Ein grübelnder Ausdruck verdunkelte ihren Blick. Aber sie sagte nichts.
»Schwester Renate ist ein wertvoller lieber Mensch«, fuhr Roy fort. »In meinen schwersten Stunden, in den Tagen meiner größten Erschütterung hat sie mir sehr geholfen, Daisy. Ohne ihre tröstenden Worte und ihre Nähe wäre ich am Leben verzweifelt. Sieh, mein Kleines, es mag wohl hart in deinen Ohren klingen, wenn ich sage, dass das Leben weitergeht, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir vergessen können.«
»Vergessen? Aber du darfst Mummy doch nicht vergessen!«, fuhr Daisy auf.
»Daisy, du hast mich falsch verstanden. Ich meine damit, dass wir unseren Schmerz eines Tages überwinden und wieder fröhlicher werden können.«
»Ich werde nie mehr fröhlich sein, Daddy. Meine geliebte Mummy ist tot.« Sie blickte auf das Bild ihrer Mutter auf dem Schreibtisch ihres Vaters. »Ich will keine neue Mutter haben. Ich will nicht.«
»Wer spricht denn davon, Daisy? Renate ist für mich eine liebe Freundin. Sie würde …« Er sprach nicht weiter, weil er einsah, dass Daisy doch noch nicht so vernünftig war, wie er gehofft hatte.
*
Fast zur gleichen Zeit saßen Renate Hagen und ihre Freundin Regine Nielsen im Zimmer der Kinderschwester bei einer Flasche Wein. Am nächsten Morgen wollte Renate abreisen.
»Nie hätte ich geglaubt, dass mir der Abschied von hier so schwerfallen würde«, sagte Renate leise. »Besonders die Trennung von Jeremy bekümmert mich.«
»Um den Jungen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Er fühlt sich sehr glücklich bei uns.«
»Die Kinder tun auch alles, um ihn froh zu stimmen, Regine.«
»Und wie schnell er sich allem angepasst hat. Obwohl er nur wenige deutsche Worte kennt, unterhält er sich glänzend mit den Kindern. Selbst die Kleinen tun alles, um sich ihm verständlich zu machen«, stellte Schwester Regine lachend fest.
»Trotzdem scheint der Junge manchmal Heimweh zu haben, was ja auch verständlich ist.« Renate fuhr sich über ihr dunkles Haar. »Mich zieht diesmal nichts nach Ulm«, gestand sie. »Bis jetzt hat mir mein Beruf viel Freude gemacht. Aber auf einmal wünschte ich mir, dass ich nicht mehr ins Krankenhaus zurück müsste.«
»Nicht wahr, du liebst ihn?«, fragte Regine ernst.
»Ihn? Roy Bennet? Ja, ich liebe ihn, Regine. Es ist merkwürdig, wie seltsam das Leben manchmal spielt. Bevor ich nach Sophienlust kam, glaubte ich, in unseren Oberarzt Dr. Jürgen Aigner verliebt zu sein.«
»Und er? Ich meine diesmal den Oberarzt.«
»Dr. Jürgen Aigner mag mich sehr. So etwas spürt man doch. Aber wir sind einander nie nähergekommen. Das habe ich früher bedauert, doch nun bin ich froh darüber. Ich weiß aber auch, dass meine Liebe zu Roy Bennet kaum Widerhall in seinem Herzen finden wird. Er hat seine Frau zu sehr geliebt, Regine.«
»Aber seine Frau ist tot, Renate. Das Leben geht weiter. Auch für ihn. Eines Tages wird er sich nach einer neuen Lebensgefährtin umsehen. Schon wegen der Kinder. Jeremy ist erst vier und Daisy acht.«
»Du denkst doch auch nicht mehr an eine Ehe, Regine.«
»Bei mir ist das etwas anderes, Renate.« Die Stimme der Kinderschwester senkte sich. Tränen standen plötzlich in ihren Augen. »Ich habe auch meine kleine Elke verloren. Wäre sie am Leben geblieben, hätte ich vielleicht versucht, noch einmal ein Glück zu finden. Er muss schon für seine Kinder einen neuen Anfang wagen. Warum solltest du nicht seine zweite Frau werden?«
Renates Brust weitete sich vor Glück. Vielleicht war ihre Liebe gar nicht so aussichtslos? Mit einem glücklichen Lächeln dachte sie an Roys Briefe. Sie waren nicht sehr ausführlich und fast ein wenig kühl, aber es stand vieles zwischen den Zeilen.
»Möchtest du noch ein Glas Wein?«, fragte Regine.
»Lieber nicht, Regine. Du musst morgen in aller Frühe aus den Federn«, erklärte Renate. »Ich lasse dich jetzt allein.« Sie erhob sich und umarmte ihre Freundin. »Es war der beste Einfall deines Lebens, dass du mich nach Sophienlust eingeladen hast«, fügte sie enthusiastisch hinzu.
»Das finde ich auch.« Regine gab ihr einen Kuss.
Renate schlief an diesem Abend sofort ein.
Am Morgen veranlasste sie irgendetwas, heftig zu niesen. Sie schlug die Augen auf und blickte direkt in Jeremys schelmische Augen. Auch entdeckte sie sogleich die Vogelfeder in seiner Hand. »Du Schlingel!«, rief sie auf deutsch.
»Es is spät«, erwiderte er eifrig.
»Sehr gut, mein Junge. Ja, es ist spät. Schon fast acht.«
»Gleich breakfast«, erklärte er.
»Ich beeile mich, Jeremy.«
»Good. I speak good deutsch.«
»Sehr good«, entgegnete sie lachend. Doch dabei zog sich ihr Herz schmerzhaft zusammen. Morgen früh würde sie allein in ihrer kleinen Wohnung in Ulm aufwachen und dann zum Krankenhaus fahren. Jeremy würde hierbleiben.
Als Renate eine gute halbe Stunde später den Speisesaal betrat, saßen die Kinder noch beim Frühstück. Jeremy rutschte sogleich von seinem Stuhl und kam auf sie zugelaufen. »Heidi sagt, dass du heute wegfährst«, stellte er halb fragend in seiner Muttersprache fest. »Aber du sollst nicht fortfahren.«
»Jeremy, ich habe einen Beruf, und mein Urlaub ist leider abgelaufen. Aber ich komme am Wochenende wieder.«
»Dauert es lange bis dorthin?«, fragte Jeremy traurig.
»Ach wo, Jeremy. Dir gefällt es doch hier gut?«
»Natürlich gefällt es ihm!«, rief Irmela Grotte auf englisch. »Jeremy, wenn du nicht mehr bei uns bleiben würdest, könnte Heidi nicht mehr so viele Worte Englisch lernen.«
Jeremy drehte sich um und sah Heidi an. Er hatte das kleine Mädchen sehr lieb. Fast so lieb wie Daisy. »Gut, dann bin ich nicht mehr traurig«. Er lächelte seine kleine Freundin jetzt an.
Heidi fragte Nick, der wieder einmal in Sophienlust übernachtet hatte, leise: »Was heißt denn auf englisch, ich freue mich, dass du dableibst?«
»I am very glad, if you stay here.«
Heidi nickte aufgeregt und rief dann: »I am …« Sie sah Nick fragend an.
»… very glad«, flüsterte er ihr zu.
»… very glad …«
»… if you stay here«, raunte Nick ihr zu.
»… if you here«, plapperte sie ihm nicht ganz richtig nach.
Jeremy hatte sie trotzdem verstanden. »I like to stay here«, antwortete er.
»Wisst ihr, dass Garten garden heißt?«, mischte sich jetzt Vicky ein.
»Na klar!«, rief Pünktchen. »Und Haus heißt house.«
»Und Hand heißt hand!«, rief Fabian.
»Und come heißt kommen«, ergänzte Angelika.
Immer wieder fanden die Kinder Worte, die sich im Deutschen und Englischen auffallend glichen. Amüsiert horchten die Erwachsenen zu. Renate hatte inzwischen ebenfalls gefrühstückt und blickte nun auf ihre Uhr. »Ich muss jetzt gleich fahren«, sagte sie.
»Und wir fahren zum Tierheim«, schlug Nick vor, um Jeremy abzulenken. »Heute dürfen Heidi, Pünktchen, Jeremy und Fabian mitfahren.«
»Und ich werde mit euch anderen zum Waldsee gehen. Es ist heute ein herrlicher Badetag.« Schwester Regine sah sich in der Runde um.
Renate wurde noch von allen zu ihrem kleinen Auto gebracht. Als sie endlich losfuhr, hielten sich Jeremy und Heidi bei den Händen. Der kleine Junge dachte aber schon an das Tierheim. Das Liliput-Pferdchen Billy hatte es ihm besonders angetan. Nachdem nichts mehr von Renates Auto zu sehen war, sagte er: »Heidi, nicht wahr, wir bitten Magda, uns Zuckerstückchen für Billy zu geben? Er mag sie doch so gern. Wenn ich komme, wiehert er immer ganz laut vor Freude.«
Denise, die die fünf Kinder zum Tierheim brachte, sprach noch ein paar Worte mit Schwester Regine, bevor sie in ihren Wagen einstieg. Auch ihr tat es leid, dass Renate Hagen hatte abreisen müssen. Sie war extra an diesem Morgen von Schoeneich herübergekommen, um sich von der reizenden Krankenschwester zu verabschieden und sie einzuladen, jederzeit wiederzukommen.
Nick saß vorn neben seiner Mutter, die vier anderen Kinder drängten sich vergnügt auf dem hinteren Sitz zusammen.
Andrea, die von Frau Rennert auf den Besuch der fünf Kinder gut vorbereitet worden war, erwartete sie schon.
Die Kinder begrüßten die junge Frau und liefen dann zum Tierheim hinüber, wo sie von dem Tierpfleger Helmut Koster in Obhut genommen wurden.
Denise ging mit Andrea ins Haus. Zuerst begrüßte sie ihren kleinen Enkel Peterle, der bei ihrem Anblick fröhlich kreischte.
»Er wird von Tag zu Tag gescheiter«, meinte Denise lachend. »Andrea, wie geht es dir?« Besorgt forschte sie in den Zügen ihrer Stieftochter. »Du siehst ein wenig blass aus.«
»Kein Wunder, Mutti. Im Augenblick ist Hans-Joachim mit Arbeit überlastet. Sein Kollege in Roggendorf hat die Praxis vorübergehend geschlossen. Nun kommen alle zu uns. Und ich helfe Hans-Joachim natürlich, wo ich kann. Ein Glück, dass ich Betti habe. Sie ist eine wirkliche Perle. Ach, da kommt ja Hans-Joachim schon!«, rief sie und blickte ihrem Mann entgegen.
Der junge Tierarzt Dr. Hans-Joachim von Lehn war ein gutaussehender Mann mit blauen Augen und blonden Haaren. Er war ein sehr aufgeschlossener Mensch, der voll und ganz in seinem Beruf aufging und mit Andrea unendlich glücklich war. Stets neckte er sie und freute sich, wenn sie ihm nichts schuldig blieb. Heimlich amüsierte sich Denise über das junge Ehepaar.
Auch an diesem Tag forderte Hans-Joachim seine Frau heraus. »Mutti, findest du nicht auch, dass Andrea dicker geworden ist?«
»Ich bin doch nicht dicker geworden!«, rief sie sogleich mit gespielter Empörung, »schau du lieber in den Spiegel. Du bekommst langsam einen Bauch.« Sie zwinkerte Denise zu, denn Hans-Joachim war groß und schlank und hatte gewiss keine Anlage, Speck anzusetzen.
»Das kommt daher, dass ich nichts zu tun habe und den ganzen Tag Däumchen drehe. Andrea nimmt mir meine Arbeit fort.«
»Tue ich das wirklich?« Sie blinzelte ihn übermütig an.
»Spaß beiseite, Mutti, Andrea mutet sich wirklich zu viel zu. Ich habe nichts dagegen, dass sie in der Praxis hilft. Aber ich mag es nicht, dass sie sich dazu noch so sehr für das Tierheim engagiert. Unser guter Koster würde auch ohne ihre Hilfe die Arbeit dort bewältigen.«
»Aber ich helfe ihm leidenschaftlich gern. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, die Tiere dort zu hegen und zu pflegen. Ja, mich macht diese Arbeit glücklich. Hans-Joachim versteht das, auch wenn er es nicht zugeben will. Wir beide geben uns in unserer Tierliebe nichts nach. Stimmt das, mein Lieber?«
»Es stimmt«, gab er fröhlich zu.
Peterle fühlte sich vernachlässigt und tat das durch wütende Laute kund. Andrea hob ihn aus dem Stubenwagen. »Sei nicht so egoistisch, mein Sohn«, warf sie ihm sanft vor. »Er glaubt nämlich, er sei der Mittelpunkt unserer Familie.«
»Was er ja auch ist.« Denise sah ihren Enkel liebevoll an.
In Peterles braune Augen trat ein sinnender Ausdruck. Dann streckte er die Arme nach Denise aus, sodass Andrea ihn ihrer Mutter gab.
Als der Kleine ihr jauchzend ins Gesicht patschte, rief Denise: »Nicht so grob, Peterle.« Dabei stellte sie aber wieder einmal fest, dass sie sich um die drei gewiss keine Sorgen zu machen brauchte. »Heute früh ist Fräulein Hagen abgereist«, erzählte sie.
»Ich finde sie sehr nett. Weißt du, was ich mir überlegt habe, Mutti?« Andrea strich das Laken in dem Stubenwagen glatt und schüttelte die Kissen auf.
»Was?«
»Dass sie gut zu Roy Bennet passen würde.«
»Ihr beide seid unverbesserlich im Stiften von Ehen!«, rief Hans-Joachim. »Ich gehe in die Praxis. Bleib nur bei deiner Mutter, Andrea. Ich brauche dich im Augenblick nicht.«
Während Denise und Andrea sich unterhielten, bewunderten die Kinder die Tiere im Tierheim. Auch die Kinder, die jedes Tier schon seit langem kannten, taten das gebührend. Denn jedes Mal waren die Tiere für sie ein neues Erlebnis.
Jeremy war nicht von Billy fortzukommen. Und das Liliput-Pferdchen schien sich ebenfalls zu dem kleinen Engländer hingezogen zu fühlen, denn es lief ihm wie ein Hündchen nach.
Helmut Koster, der einmal im Zirkus gearbeitet und auch längere Zeit in England gelebt hatte, unterhielt sich gern mit Jeremy. Der kleine Junge sah bewundernd zu ihm auf. Plötzlich erklärte er: »Wenn ich einmal groß bin, werde ich auch Tierpfleger.«
»Aber du erbst doch die Farm deines Vaters«, meinte Nick.
»Das ist wahr.« Jeremy sah auf einmal ganz traurig aus, und Nick hätte sich ohrfeigen können, weil er den Anstoß dazu gegeben hatte.
»Ich möchte immer hierbleiben«, fuhr Jeremy leise fort. »Weil doch meine Mummy im Himmel ist und Daisy mich nicht mehr mag. Und Daddy ist schrecklich traurig.«
Helmut Koster wollte den Kleinen ablenken. »Ich muss jetzt die Schimpansen füttern«, erklärte er fröhlich. »Und wisst ihr, wer mir heute dabei helfen darf?«
»Jeremy darf das«, sagte Heidi lächelnd. »Damit er nicht mehr so traurig aussieht.«
»Du hast es erraten, Heidi.« Helmut Koster wandte sich nun an den Jungen. »Come on!«, rief er.
Das ließ sich Jeremy nicht zweimal sagen. Mit klopfendem Herzen folgte er dem Tierpfleger in die Box von Luja und Batu. Er war noch nicht lange genug hier, um zu wissen, dass die Schimpansen niemandem etwas zuleide taten. Als Luja neugierig schnatternd auf ihn zugelaufen kam, griff er vorsichtshalber nach der Hand des Tierpflegers.
»Keine Angst, mein Junge«, sagte Helmut Koster auf Deutsch. »Die beiden tun dir nichts.«
»Ich haben verstanden«, erwiderte Jeremy stolz.
Heidi nahm die Gelegenheit wahr, von Nick ein paar englische Brocken zu lernen, die sie nachher Jeremy sagen wollte. Da Jeremy sie zu seiner besonderen Freundin auserkoren hatte, fühlte sie sich verpflichtet, seine Muttersprache zu lernen. Sie lief immerzu hinter den Kindern und Erwachsenen her, die Englisch sprechen konnten, um sie nach allen möglichen Worten zu fragen. Die Folge davon war, dass sie schon einiges gelernt hatte, worauf sie sehr stolz war.
Am Nachmittag brachte Andrea die Kinder wieder nach Sophienlust zurück. Jeremy war so aufgeräumt von dem Besuch im Tierheim, dass er Renate an diesem Abend kaum vermisste. Dafür weinte er am nächsten Morgen umso mehr. Erst jetzt begriff er, dass sie tatsächlich abgereist war.
*
Renate weinte zwar nicht, als sie am gleichen Morgen in ihrem winzigen Appartement in Ulm aufwachte, aber sie fühlte sich einsam und verlassen wie seit langem nicht mehr.
Unlustig stand sie auf und duschte. Danach bereitete sie sich Kaffee zu und rauchte dazu eine Zigarette. Appetit hatte sie keinen. Außerdem bekam sie ein gutes zweites Frühstück in der Klinik. Sie musste immer ein wenig auf ihre Figur achten und aß deshalb zu Hause meist nichts zum Frühstück.
Bevor Renate ihre Wohnung verließ, blätterte sie wieder einmal die Briefe von Roy durch, die sie mit einem hellblauen Seidenband zusammengebunden hatte. Sie bedauerte zutiefst, dass sie kein Bild von ihm besaß. Aber bisher hatte sie es nicht gewagt, ihn in ihrem Brief darum zu bitten.
Nach einem Blick auf die Uhr stellte Renate fest, dass sie sich nun beeilen musste. In niedergedrückter Stimmung verließ sie das Appartement und fuhr mit dem Lift zur Tiefgarage hinunter. Dort traf sie einige Hausbewohner, die sie herzlich begrüßten.
»Waren Sie nicht in der Gegend, in der das furchtbare Unglück geschah?«, fragte eine junge Dame neugierig.
»Ja, das Flugzeug ist ganz in der Nähe von uns abgestürzt.«
»Es muss schrecklich gewesen sein.«
»Es war furchtbar«, erwiderte Renate leise. Sie hatte keine Lust, mehr darüber zu erzählen, und verabschiedete sich hastig.
Eine Viertelstunde später stellte sie ihren Wagen auf dem Parkplatz des Krankenhauses ab. Als sie das große helle Haus betrat, fühlte sie sich schon froher. Von allen Seiten wurde sie mit großer Herzlichkeit begrüßt. Die Oberschwester versicherte ihr, dass alle sie sehr vermisst hätten. Auch sie und das übrige Personal stellten Fragen nach dem Unglück. Und diesmal erzählte Renate ausführlicher davon.
Bei der Morgenvisite begegnete Renate dann dem Oberarzt Dr. Jürgen Aigner. Das Aufleuchten in seinen dunklen Augen versetzte sie in leichte Verlegenheit. Noch vor ihrem Urlaub hätte ihr Herz dabei schneller geschlagen. Nun aber war es ihr eher peinlich, dass er seine Freude über ihr Wiedersehen so offen zeigte.
Nach dem Mittagessen kam eine der Hilfsschwestern zu ihr und sagte: »Der Oberarzt möchte Sie sprechen, Schwester Renate.«
»Danke, Schwester.« Renate ordnete ihr Haar ein wenig vor dem kleinen Spiegel im Schwesternzimmer. Dabei überlegte sie, was der Oberarzt von ihr wollen könne. Fast etwas schüchtern klopfte sie an die Tür seines Zimmers.
Dr. Jürgen Aigner saß hinter seinem Schreibtisch. Als Renate eintrat, nahm er seine Brille ab und steckte sie in die obere Tasche seines weißen Kittels. Lächelnd bot er ihr Platz an.
»Gut sehen Sie aus, Schwester Renate. Ich danke Ihnen für Ihre Ansichtskarte. Dieses Sophienlust scheint in einer idyllischen Gegend zu liegen.«
Renate hatte ganz vergessen, dass sie ihm gleich zu Anfang ihres Aufenthaltes in Sophienlust eine Karte geschrieben hatte. Sie lächelte höflich und erwiderte: »Sophienlust ist das schönste Kinderheim, das ich kenne. Die Leute nennen es ein Paradies für Kinder.«
»Dieses Sophienlust liegt doch bei Wildmoos, nicht wahr? Ich habe den Namen in der Zeitung gelesen.«
»In Verbindung mit der Flugzeugkatastrophe, nicht wahr?«
»So ist es.« Der Arzt spielte mit einem Kugelschreiber und sah Renate sinnend an. Dass sie sich verändert hatte, war auffällig. Irgendetwas
schien vorgefallen zu sein, das sie hatte reifer werden lassen.
»Ich habe bei der Bergung der Verletzten geholfen, Herr Oberarzt. Es war entsetzlich. Wir Krankenschwestern sind an und für sich abgehärtet, aber ich hatte das Gefühl, nicht durchhalten zu können.«
Also das ist es, dachte der Oberarzt erleichtert. Denn der Gedanke, dass sie vielleicht einen Mann kennengelernt hatte, der ihr mehr bedeutete, wäre zu enttäuschend für ihn gewesen. In der Zeit ihrer Abwesenheit war ihm klargeworden, dass er Renate Hagen liebte. Er wollte sie heiraten. Bisher wusste keiner im Krankenhaus, dass er seit vielen Jahren Witwer war und einen Sohn hatte, der in einem Internat am Starnberger See bei München aufwuchs. Jetzt wollte er endlich wieder ein Familienleben führen und Renate Hagen war genau die richtige Frau für ihn. Ihre frauliche Ausstrahlung gefiel ihm. Er konnte sich ein Leben mit ihr gut vorstellen.
Entschlossen legte Dr. Aigner den Kugelschreiber zurück auf seinen Platz und sagte: »Ich wollte Sie fragen, ob Sie mit mir heute Abend in einem netten Lokal zu Abend essen wollen, Schwester Renate.«
Ihr erster Impuls war, seine Einladung auszuschlagen. Doch dann nahm sie sie aus reiner Höflichkeit an. »Gern«, erwiderte sie.
»Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie gegen acht daheim abhole?«
»Wissen Sie denn, wo ich wohne?« Renate spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoß.
»Ich weiß es, Schwester Renate«, entgegnete er fröhlich. »Mehr wollte ich eigentlich nicht von Ihnen.«
Er erhob sich. Auch Renate stand auf. Fest drückte er ihr die Hand, dabei blickte er ihr vielsagend in die Augen.
Sein zärtlich werbender Blick ließ Renate wieder erröten. So etwas wie Bedauern stieg nun doch in ihr hoch. Bei ihm würde sie ein ruhiges Leben führen, wie sie es sich immer erträumt hatte. Hätte sie sich nicht in Roy Bennet verliebt, wäre sie bestimmt die Frau des Oberarztes geworden, wenn er sie darum gebeten hätte. Aber nun konnte sie das nicht mehr. Dabei wusste sie nicht einmal, ob ihre Liebe zu Roy Aussicht auf Erfüllung hatte, ob sie Roy jemals wiedersehen würde.
Diese Gedanken bewegten Renate den Rest des Tages. Erleichtert verließ sie am späten Nachmittag das Krankenhaus, um auf dem schnellsten Weg heimzufahren. Aufgeregt fuhr sie mit dem Fahrstuhl nach oben, denn in ihrem letzten Brief an Roy hatte sie ihm ihre Ulmer Adresse genannt. Vielleicht hatte er ihr schon geschrieben?
Aber der Briefkasten war leer. Enttäuscht ging Renate in ihr Schlafzimmer, um sich umzukleiden. Wäre es nicht besser, sie würde sich Roy aus dem Kopf schlagen?, fragte sie sich, als sie sich auszog und ins Badezimmer ging.
Sehr nachdenklich studierte sie jede Linie ihres ovalen Gesichts in dem Spiegel über dem Waschbecken. Schlecht sah sie gewiss nicht aus, aber sie war auch keine umwerfende Schönheit. Ihre Figur war ganz passabel, aber leider durfte sie niemals so viel essen, wie sie gern gewollt hätte.
»Ich bin eine dumme Gans«, schalt Renate sich laut und fühlte sich danach etwas erleichtert. Doch während sie sich für ihre Verabredung mit Dr. Aigner hübsch machte, dachte sie ununterbrochen an die drei Bennets. Sicherlich würde Jeremy sie sehr vermissen, überlegte sie. Er würde gewiss glücklich sein, wenn sie für immer bei ihnen bleiben würde. Bei Daisy war sie dessen nicht so sicher. Sie war eher davon überzeugt, dass das kleine Mädchen sie ablehnte. Und Roy? Roy hatte seine Frau so geliebt, dass er vorläufig gewiss noch nicht an eine andere Frau dachte.
»Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall«, sagte Renate laut und zuckte leicht zusammen, als es läutete.
Als sie zur Sprechanlage ging, überlegte sie, ob sie Jürgen Aigner auf einen Sprung heraufbitten sollte. Aber dann sagte sie sich, dass sie ihm mit dieser Einladung nur Hoffnungen machen würde, die sie niemals erfüllen konnte. »Ich komme gleich!«, rief sie deshalb, nachdem er seinen Namen genannt hatte.
Nach einem letzten Blick in den Spiegel verließ Renate das Appartement. Dr. Aigner erwartete sie mit einem glücklichen Lächeln vor der Haustür. »Ich freue mich sehr«, sagte er herzlich und hakte sich bei ihr unter, als sie zum Auto gingen.
»Ich auch«, erwiderte Renate gegen ihren Willen. Staunend stellte sie fest, dass die Privatperson Dr. Jürgen Aigner viel jünger wirkte als der Oberarzt. Etwas Jungenhaftes, Strahlendes ging von ihm aus. Er war Ende der Dreißig und ein sportlicher Typ. Sein Schläfenhaar war bereits leicht angegraut, was ihm jedoch sehr gut stand.
»Sie blicken mich an, als würden Sie mich zum erstenmal sehen«, stellte er mit einem kleinen Lachen fest, bevor er losfuhr.
»Tue ich das?« Sie erwiderte sein Lächeln. »Das habe ich gar nicht bemerkt.«
Wieder lachte er. Dann trat er aufs Gaspedal.
Während der Fahrt sprachen sie über belanglose Dinge. »Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier«, sagte er dann, als sie die Stufen zu einem alten Weinlokal hinunterstiegen. »Hier sollen schon die Raubritter ihre Zechgelage abgehalten haben.«
»Dann muss es ja wohl schön sein.« Renate wurde von seiner ausgelassenen Stimmung mitgerissen. Seine männliche Persönlichkeit faszinierte sie. Für ein Weilchen vergaß sie sogar Roy.
Das Essen war ausgezeichnet und der Wein so gut, dass Renate mehr als sonst trank. Auf allen Tischen standen Kerzen. Sonst war das Lokal nur wenig beleuchtet.
Renate stellte fest, dass kaum Gäste da waren. Sie fand das aber nicht verwunderlich, weil es Montag war. Sie begegnete Jürgen Aigners Blick und las darin Liebe und Bewunderung.
»Ich habe Sie sehr vermisst, Schwester Renate«, sagte er und umfasste ihre Hände.
»Es gibt aber tüchtigere Schwestern als mich.« Renate senkte ihren Blick.
»Ich habe Sie auch nicht so sehr beruflich vermisst, Renate.«
»Bitte, Herr Oberarzt …«
»Lassen Sie doch ganz einfach den Oberarzt weg«, bat er. »Ich heiße Jürgen.«
»Ich weiß.« Renate bereute nun, dass sie seine Einladung angenommen hatte. Auf einmal dachte sie so intensiv an Roy, dass sie das Gefühl hatte, ihn vor sich zu sehen.
»Renate, Sie bedeuten mir sehr viel. Und ich habe … ich hatte das Gefühl, dass ich Ihnen auch gefalle. Wissen Sie, warum ich ›hatte‹ sage?«
Stumm sah sie ihn an.
Er ließ ihre Hände los. »Ich glaube, irgendetwas ist inzwischen geschehen. Ist es die Flugzeugkatastrophe, die Sie so seltsam verändert hat?«
»In gewisser Weise ja«, gab sie zu und lächelte matt. Ihr würde nichts anderes übrigbleiben, als offen mit ihm zu sprechen. Wieder bedauerte sie das sehr, denn mehr denn je wurde ihr bewusst, wie gut Jürgen und sie zusammengepasst hätten.
»Renate, bisher habe ich Ihnen verschwiegen, dass ich Witwer bin. Seit zehn Jahren. Meine Frau hatte Leukämie. Ich habe lange nicht überwinden können, dass wir Ärzte ihr nicht helfen konnten. Ich glaubte damals, wahnsinnig zu werden. Es ging über meine Kräfte, meine Frau sterben zu sehen.« Er fuhr sich über die Augen. »Seitdem habe ich eigentlich nie mehr ein wirkliches Interesse für eine Frau gehabt – bis Sie in mein Leben traten. Sie gefielen mir vom ersten Augenblick an, Renate. Ich habe einen Sohn. Er wird bald zehn. Er befindet sich in einem Internat.«
Renate sah ihn mitfühlend an. Hätte er ihr das alles vor ihrem Urlaub erzählt, hätte sie sich bestimmt nichts sehnlicher gewünscht, als sein Kind kennenzulernen. »Das tut mir alles sehr leid für Sie«, entgegnete sie und fühlte, wie banal ihre Worte doch klangen.
»Renate, was ist geschehen?«, fragte er und schluckte seine Enttäuschung gewaltsam herunter.
»Viel, sehr viel, Herr Oberarzt.«
»Ein anderer Mann, nicht wahr?«
»Ja, ein anderer Mann«, wiederholte sie leise. »Er ist Engländer und hat seine Frau bei der Flugzeugkatastrophe verloren. Sein Sohn war in Sophienlust.«
Der Arzt nickte nur und zündete sich dann eine Zigarette an.
»Das heißt, er ist noch dort.« Auf einmal hatte Renate das Bedürfnis, ihm alles zu sagen, mit jemandem über ihre Liebe zu sprechen, die keine Aussicht auf Erwiderung zu haben schien.
Jürgen Aigner hörte ihr verständnisvoll zu. Innerlich atmete er auf. Renate war erst fünfundzwanzig, also fast noch ein junges Mädchen mit großen Illusionen, mit Wachträumen, die nur selten Wirklichkeit wurden. Er aber war Realität und alt genug, um geduldig zu warten. So, wie sie ihm ihre Liebe schilderte, würde sie niemals Erfüllung finden, überlegte er. Mit väterliche Güte redete er auf Renate in dem Bewusstsein ein, dass der Tag nicht mehr fern sein würde, an dem sie begreifen würde, dass sie sich in etwas Sinnloses verrannt hatte.
»Darf ich trotzdem Ihr Freund bleiben, Renate? Ich würde mich auch freuen, wenn Sie mich privat Jürgen nennen würden. Bitte, Renate, sagen Sie es ein einziges Mal.«
Renate war so erleichtert über seine Reaktion, dass sie mit Freuden sagte: »Jürgen, ich danke Ihnen.«
»Ich danke Ihnen auch, Renate.« Er zog ihre Rechte an seine Lippen und küsste sie. »Sie werden in mir immer einen Freund haben.«
»Ich bin sehr froh darüber.« Sie lachte glücklich auf. »Dabei hatte ich richtig Angst, Ihnen alles zu sagen.«
Wie jung sie noch ist, dachte er mit tief empfundener Zärtlichkeit. Sie gehörte zu den Frauen, die in einem Mann unwillkürlich den Beschützerinstinkt wecken.
Als Freunde trennten sich die beiden an diesem Abend. Renate schlief in dieser Nacht besser als in all den Wochen davor. Das Gefühl, einen selbstlosen Freund zu haben, war für sie wie ein Wunder.
*
Am Wochenende fuhr Renate nach Sophienlust. Jeremy brachte sich fast um vor Freude über das Wiedersehen.
Renate hatte ihm einen Teddybären mitgebracht, der viel Ähnlichkeit mit dem Sophienluster Teddy Stupsi hatte. Diesen Teddy hatte Denise für einen besonderen Zweck gekauft. Wenn sie kleine Kinder, die aus irgendeinem Grund untröstlich waren, beruhigen musste, besonders abends beim Schlafengehen, dann war der Teddybär oft ein kleines Zaubermittel.
Jeremy hatte einmal zu Renate gesagt, er möchte auch so einen Stupsi haben, der ihm aber ganz allein gehören müsse. Renate hatte diese kindlichen Worte nicht vergessen. Und nun drückte der kleine Junge das Stofftier jubelnd an sich und schleppte es den ganzen Tag mit sich herum.
Während des Tages kamen Renate und Schwester Regine nicht dazu, sich zu unterhalten. Aber am Abend, als die Kinder im Bett lagen, fand sich endlich eine Möglichkeit dazu. Da es ein sehr schöner Abend war, gingen die beiden Freundinnen hinaus in den Park und setzten sich in die Laube. Dort erzählte Renate Regine von Jürgen Aigner.
»Glaubst du nicht, dass es ein Fehler war, seinen Antrag abzulehnen, Renate?«, fragte Regine.
»Eigentlich hat er mir noch keinen Antrag gemacht.«
»Aber er wollte dir einen machen, und du hast es gar nicht so weit kommen lassen, nicht wahr?«
»Weil ich Roy Bennet liebe!«, rief Renate leidenschaftlich. »Ich höre aus deinem Tonfall heraus, dass du auch von der Aussichtslosigkeit meiner Liebe überzeugt bist, Regine. Trotzdem bleibe ich lieber allein als …«
»Ich habe Sie gesucht«, wurde Renate in diesem Augenblick von dem Hausmädchen Ulla unterbrochen. »Frau Rennert bittet Sie, ins Haus zu kommen. Eine telefonische Voranmeldung aus England ist da.«
Renate presste beide Hände auf ihr wildschlagendes Herz. »Für mich?«, fragte sie fassungslos.
Von da an hatte Renate das Gefühl, zu träumen. Als sie Roys Stimme hörte, brachte sie vor Glück zuerst kein Wort über die Lippen. Doch dann fragte sie endlich: »Ist etwas geschehen, Roy?«
»Eigentlich nichts Besonderes, Renate. Wie geht es Jeremy? Ich habe aufs Geratewohl angerufen, weil Sie doch schrieben, dass Sie am Wochenende wieder in Sophienlust sind.«
»Jeremy geht es gut.«
»Das ist fein. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen, Renate?«
»Auch gut. Wollen Sie Jeremy noch länger hierlassen?«
»Sobald ich mit den Erntearbeiten fertig bin, kommen Daisy und ich, um ihn abzuholen. Werden Sie dann auch dasein, Renate?«
»Natürlich werde ich dasein. Und Daisy? Wie geht es ihr?«
»Das ist es, was mich bedrückt. Sie ist sehr schwierig geworden. Ich …« Roy zögerte. Doch dann fügte er kaum verständlich hinzu: »Sie wird einfach nicht mit dem Schicksalsschlag, der uns getroffen hat, fertig, Renate. Am liebsten würde ich sie nach Sophienlust bringen, aber sie will nicht von hier fort. Ich hoffe, dass wir uns in spätestens einem Monat sehen, Renate.«
»Ich freue mich sehr«, erwiderte sie mit einer ganz kleinen Stimme, weil ihr Herz zum Zerspringen klopfte.
»Auf Wiedersehen, Renate. Grüßen Sie Jeremy herzlich und alle anderen.«
»Und Sie bitte Daisy. Auf Wiedersehen.«
Es knackte in der Leitung, aber noch immer hielt Renate den Hörer in der Hand in der Hoffnung, noch einmal seine geliebte Stimme zu hören. Verklärt legte sie dann auf. Als sie sich umblickte, stellte sie fest, dass sie allein im Büro war. Regine und die Heimleiterin hatten sich taktvoll zurückgezogen. Renate war froh darüber. So konnte sie sich noch einen Augenblick ganz ihrer Freude hingeben.
»Roy, geliebter Roy«, flüsterte sie selig. Dass er sie angerufen hatte, war für sie der Beweis dafür, dass sie ihm doch nicht ganz gleichgültig war.
Renates Gesicht war wie von innen erleuchtet, als sie das Büro verließ und nach Regine suchte. Sie fand sie zusammen mit Frau Rennert vor dem Kamin in der Halle.
Die Heimleiterin erhob sich sogleich und sagte gute Nacht. Dabei entging ihr nicht das Leuchten in Renates Augen. Schon längst hatte sie so etwas geahnt. Sie wünschte vor allem Jeremy, dass er in Renate Hagen eine zweite Mutter finden würde.
Renate unterhielt sich noch ein Weilchen mit ihrer Freundin Regine, aber sie sehnte sich insgeheim nach dem Alleinsein, um sich jedes Wort von Roy noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen zu können. Regine lächelte versteckt und schlug vor, schlafen zu gehen.
»Du wirst mich für unhöflich halten«, sagte Renate, als sie sich trennten. »Aber der Anruf hat mich völlig durcheinander gebracht.«
»Verständlich. Du hast es schon richtig gemacht, Renate.«
»Was denn?« Verwundert sah Renate die Kinderschwester an.
»Dass du den Antrag deines Oberarztes nicht angenommen hast.«
»Ich weiß.« Renate lächelte verklärt.
Endlich war sie allein mit ihren glücklichen Gedanken. Weit öffnete sie die Fensterflügel und blickte hinaus in den Park.
»Roy, geliebter Roy«, flüsterte sie wieder. »Eines Tages werden wir glücklich sein. Ja, eines Tages.«
*
Das Zusammenleben mit Daisy wurde für Roy immer schwieriger. Ihre großen vorwurfsvollen Augen verfolgten ihn bis in seine Träume. Das Schlimme war, dass sie ihm keine Angriffspunkte bot. Still verrichtete sie die Hausarbeiten und vernachlässigte auch die Schule nicht. Doch ihr Gesicht wurde immer spitzer. Außerdem sprach sie immer wieder von ihrer Mummy. Mummy hätte das gesagt, Mummy hätte das so gemacht. Mummy wäre traurig gewesen, dass Jeremy so lange in einem Kinderheim bleiben muss, ohne Mummy ist das Leben nicht schön.
Roy war ein Mann, der von morgens bis abends schwer arbeitete. Am Abend sehnte er sich nach Ruhe und nach einem gemütlichen Heim. Manchmal klagte er sich selbst an, weil seine Trauer um Mary bereits einer stillen Melancholie gewichen war. Noch immer besuchte er täglich ihr Grab, aber er litt nicht mehr so wie in der ersten Zeit. Und immer öfter irrten seine Gedanken zu Renate Hagen ab. Nach wie vor las er ihre Zeilen mit Freude und beantwortete jeden ihrer Briefe. Obwohl er niemals ein guter Briefschreiber gewesen war, gelang es ihm allmählich, seine Gedanken und Empfindungen zu Papier zu bringen. Dann aber geschah etwas, was seine angestauten Gefühle zur Explosion brachte.
Seit Tagen hatte Roy keinen Brief mehr von Renate erhalten. Zufällig traf er dann den Postboten. Impulsiv fragte er ihn, ob er ihm diesmal einen Brief aus Deutschland gebracht habe.
»Ja, Mister Bennet, das habe ich. Vorgestern kamen ja gleich zwei auf einmal«, antwortete der gute Mann.
»Vorgestern? Ach ja.« Roy war wie vor den Kopf geschlagen. War es denn möglich, dass Daisy ihm die Briefe unterschlug? »Auf Wiedersehen«, murmelte er und ging weiter.
Daisy stand mit vom Kochen geröteten Wangen am Herd und rührte in einem Topf herum. »Ach, da bist du ja, Daddy!«, rief sie. »Das Essen ist gleich fertig. Heute gibt es einen Gemüseeintopf. Warum siehst du mich denn so böse an?«
»Wo sind die Briefe?«, fragte er barsch.
»Welche Briefe?«, stotterte sie und schrie leise auf, weil sie sich am Kochtopf verbrannt hatte.
Roy achtete nicht darauf. »Du weißt genau, welche Briefe ich meine. Ich habe den Postboten getroffen.«
»Bitte, Daddy, nicht böse sein.
Ich … Ach …« Daisy schlug die Hände vors Gesicht.
»Wo sind die Briefe?«
»Ich habe sie verbrannt, Daddy«, gestand sie.
»Verbrannt? Bist du denn von Sinnen?« Zum erstenmal in seinem Leben schlug er seine kleine Tochter. Entsetzt sah sie ihn aus übergroßen Augen an und wimmerte dann wie eine gequälte Kreatur.
»Auch den heutigen?«, fragte Roy. Er war selbst erschrocken über seine unbeherrschte Reaktion.
»Auch den heutigen«, flüsterte Daisy. »Du hast mich ja nicht mehr lieb, Daddy. Oh, wie ich sie hasse. Sie hetzt dich gegen mich auf in ihren Briefen. Sie hat mir auch Jeremy fortgenommen. Er will nicht mehr nach Hause. Und nun schlägst du mich. Mummy wäre sehr böse gewesen. Mummy hat es bestimmt gesehen«, schluchzte
sie.
Roy verließ die Küche. Er fühlte sich ausgehöhlt wie ein morscher Baum. Er zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Sein Blick fiel auf das Bild von Mary. Er nahm es zwischen seine Hände und sah seine Frau an. »Mary, was soll ich nur tun?«, fragte er müde. »Ich weiß mir keinen Rat mehr. Mary, warum kannst du nicht antworten?«
Da war ihm, als nicke sie ihm begütigend zu. Dann glaubte er ihre Stimme zu hören. Sie sagte: »Tu das, was dir dein Herz befiehlt, Roy.«
»Mein Herz verlangt nach Ruhe und Verständnis und nach Liebe, Mary. Ich werde dich immer lieben, aber ich muss an die Kinder denken.«
»An dich musst du auch denken«, schien sie ihm zu antworten. »Du bist ein junger kräftiger Mann und hast noch einen langen Weg vor dir. Ich habe nichts dagegen, dass du ein neues Glück suchst, Roy.«
Roy stellte das Bild auf den Schreibtisch zurück. Er wusste genau, diese Antworten hätte ihm auch die lebende Mary gegeben. Sie hatte immer Verständnis für alles gehabt und war niemals wirklich egoistisch gewesen.
»Daddy, ich …«
Roy hörte die zaghafte Stimme seiner kleinen verzweifelten Tochter nicht. Er war noch ganz befangen von seinen Erinnerungen an Mary und den Worten, die er eben zu hören geglaubt hatte.
Daisy zog die Tür ebenso leise, wie sie sie geöffnet hatte, wieder zu. Ganz schlecht war ihr vor Aufregung und dem Gefühl von Verlassenheit. Sie wollte zu Mummy, zu ihrer lieben Mummy.
»Komm, Tommy!«, rief sie ihrem Hund leise zu, als sie das Haus verließ.
So schnell die Füße sie trugen, lief sie über den Hof hinaus auf die Straße.
Der Weg zum Friedhof war weit. Es fing auch schon an dunkel zu werden. Aber daran dachte Daisy nicht. Außerdem fühlte sie sich mit Tommy zusammen ganz sicher. Der Hund würde sie beschützen, überlegte sie, als sie nach ungefähr einer Stunde den Friedhof von Alvery erreichte.
Noch nie war Daisy nachts auf dem Friedhof gewesen. Ob die Toten tatsächlich um Mitternacht aus ihren Gräbern stiegen, wie ihre Schulfreundin Pamela ihr vor kurzem erzählt hatte?, überlegte sie. Würde sie dann vielleicht ihre Mummy wiedersehen?
Ängstlich sah sich Daisy um. Wie still es plötzlich um sie herum war. Nein, dort raschelte etwas. Glühende Augen sahen sie an. Tommys Rückenhaar sträubte sich. Das geschah immer dann, wenn er eine Gefahr witterte. Nun knurrte er auch verhalten.
»Tommy, was ist denn los?«, fragte Daisy.
Tommy machte plötzlich einen Satz auf die glühenden Augen zu. Daisy hörte einen Schrei und das Fauchen einer Katze. Vor Erleichterung schossen ihr Tränen aus den Augen. »Komm, Tommy«, bat sie. »Wir gehen zu Mummy.«
Der Hund folgte ihr mit eingezogenem Schweif.
Dann kniete Daisy vor dem Grab ihrer Mutter nieder. »Mummy, ich bin so schrecklich unglücklich«, klagte sie. »Niemand hat mich noch lieb. Ich möchte zu dir. Liebe Mummy, ich …« Sie unterbrach sich und lauschte auf die Glockenschläge vom nahen Kirchturm.
»… drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht«, zählte sie.
»Tommy, wenn wir unsere Mummy wiedersehen wollen, dann müssen wir noch vier Stunden hierbleiben. Aber ich habe Angst. Du auch?«
Der Hund schmiegte sich an sie. Daisy schloss die Augen und bildete sich ein, daheim in ihrem Zimmer zu sein. Aber ein Windstoß fegte über sie hinweg, und dann begann es zu regnen.
»Tommy, wir müssen irgendwo Schutz suchen«, sagte Daisy und blickte sich furchtsam um.
Nebelschwaden stiegen vom Boden hoch. Daisy bekam es immer mehr mit der Angst zu tun. Impulsiv lief sie zu der kleinen Kapelle hin. Die Tür war nur angelehnt. »Komm, Tommy«, befahl sie dem Hund und betrat die kleine Kirche.
Auf dem Altar brannten Kerzen. Tommy knurrte leise, als Daisy ein Geräusch hörte. Und dann erkannte sie den weißhaarigen Pfarrer, der sich umdrehte und sie verwundert anblickte.
»Daisy, was machst denn du um diese Zeit hier?«, fragte der alte Mann kopfschüttelnd. »Es ist schon nach acht. Ist dein Vater auch da?«
»Nein, Herr Pfarrer. Ich wollte Mummy besuchen und mit ihr sprechen. Pamela hat nämlich gesagt, dass alle Toten um Mitternacht aus ihren Gräbern steigen. Ich wollte bis dahin warten.«
»Pamela hatte schon immer eine lebhafte Phantasie. Komm, kleine Daisy.« Er umfasste ihre eiskalte Hand. »Deine Mummy kommt nie wieder. Ihre Seele ist in den ewigen Frieden eingegangen. Nur ihre sterblichen Überreste sind hier zur Ruhe gebettet worden.«
»Ich bin so unglücklich«, schluchzte die Kleine und klammerte sich an den Pfarrer.
»Ich bringe dich jetzt heim«, erklärte der Geistliche. »Dein Vater wird dich schon vermissen.«
»Daddy hat mich nicht mehr lieb. Daddy mag nur die Deutsche, die mir auch Jeremy fortgenommen hat.« Daisys Weinen wurde lauter, und Tommy winselte.
Der Pfarrer ging mit den beiden zum Pfarrhaus und rief von dort auf Roys Farm an. Als sich niemand meldete, meinte er: »Sicherlich sucht dein Vater dich schon verzweifelt, Daisy.«
»Ich habe etwas ganz Schreckliches getan«, gestand sie ganz erregt. »Daddy will überhaupt nichts mehr von mir wissen.«
»Was für eine Sünde hast du denn begangen, Daisy?« Gerührt blickte der Pfarrer auf den gesenkten blonden Kinderkopf.
»Ich habe … ja, ich habe die Briefe verbrannt, weil ich nicht wollte, dass Daddy die Deutsche wiedersieht. Ich wollte …«
»Das ist allerdings ein schlimmes Vergehen, mein Kind. Aber Gott wird dir verzeihen, und dein Daddy auch«, fügte er lächelnd hinzu.
Daisy weinte nun wieder lauter. Liebevoll strich der Pfarrer ihr übers Haar und bat: »Nun komm, mein Kind. Ich fahre dich und deinen Hund nach Hause.«
Als sie das Pfarrhaus verließen, hielt im gleichen Augenblick ein Wagen vor dem Haus. Roy stieg aus. Aufgeregt ging er den beiden entgegen. »Gott sei Dank!«, rief er, als er seine Tochter und den Hund erblickte. »Ich hatte mir schon gedacht, dass Daisy hierhergelaufen ist. Daisy, höre bitte zu weinen auf.«
»Bist du noch böse auf mich, Daddy?«, fragte sie voller Angst.
»Nein, Daisy, ich bin dir nicht mehr böse.« Er nahm sie einfach auf die Arme und küsste sie. »Vergessen wir das alles. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Ich war schon in größter Sorge um Daisy.«
»Ich wollte die beiden Ausreißer gerade heimbringen.« Die beiden Männer wechselten noch ein paar Worte. Dann stieg Roy wieder in sein Auto ein. Daisy und Tommy saßen schon darin.
Auf der Heimfahrt redete Roy liebevoll auf seine Tochter ein. Er hatte in der Stunde, in der er sie gesucht hatte, über sie nachgedacht und sich vorgenommen, geduldiger mit ihr zu sein. Er wusste, er hätte sie nicht schlagen dürfen. Aber seine Enttäuschung darüber, dass er Renates Briefe nicht hatte lesen können, hatte ihn die Beherrschung verlieren lassen.
Daisy nahm sich in dieser Stunde vor, von nun an noch lieber zu ihrem Daddy zu sein. »Ich werde auch nie wieder einen Brief von ihr zerreißen«, versprach sie ihm.
»Das weiß ich, mein Kleines. Und bald holen wir Jeremy heim.«
»Ja, Daddy. Dann werden wir drei ganz glücklich sein, nicht wahr?«
»Ja, Daisy.« Dabei überlegte Roy, ob er es übers Herz bringen würde, Daisys Hoffnungen zu zerstören und Renate zu bitten, zu ihnen zu kommen. Er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Aber er erhoffte sich viel von seinem Besuch in Sophienlust.
*
Daisy machte sich von diesem Tag an Gedanken über ihren Daddy und Schwester Renate. Es entging ihr nicht, dass ihr Vater ein trauriges Gesicht machte, wenn er am Abend mit ihr zusammen in der Küche beim Essen saß. Sie dachte auch an das, was er über Schwester Renate gesagt hatte. Und plötzlich hatte sie einen Einfall.
Am Sonntagnachmittag, als Daisy mit Tommy allein im Haus war, setzte sie sich in ihrem Zimmer an den kleinen Schreibtisch und schrieb einen langen Brief an Schwester Renate in Sophienlust. Am Montag steckte sie den Brief vor der Schule in den Briefkasten. Als sie den leisen Plumps im Briefkasten hörte, atmete sie erleichtert auf. Von nun an lebte sie in der Erwartung der Dinge, die über ihre und die Zukunft ihres Daddys entscheiden sollten.
*
Renate war zwei Wochen lang nicht mehr in Sophienlust gewesen. Sie hatte anstrengende Tage hinter sich. Am Abend war sie einige Male mit Dr. Aigner ausgegangen. An seinen Reden hatte sie allmählich erkannt, dass er sich noch immer Hoffnungen auf sie machte. Aber sie brachte es nicht über sich, ihm zu sagen, dass er das nicht tun solle, weil sie nun ganz sicher sei, dass Roy Bennet mehr für sie empfinde, als sie bisher geglaubt hatte.
Tat er das wirklich?, fragte sie sich auf dem Weg nach Sophienlust. Maß sie seinem Anruf nicht zu viel Bedeutung bei? Er hatte ihr lange nicht mehr geschrieben. Vielleicht sah er in ihr wirklich nur eine gute Freundin?
Renate sah plötzlich alles mit ganz anderen Augen.
Sie hatte sich Roy aufgedrängt. Ja, das hatte sie getan, denn sie hatte ihm helfen wollen. Aber vielleicht hatte er gar keine Hilfe haben wollen?
Renate litt wie alle Liebenden, die der Liebe ihres Partners noch nicht ganz sicher waren. Als sie von der Autobahn abbog und die Richtung nach Sophienlust einschlug, war ihr Herz zernagt von Zweifeln. Am liebsten wäre sie umgekehrt und nach Ulm zurückgefahren. Sie wollte sich nicht in Roys Leben drängen, was sie ja auch dann tat, wenn sie sich um seinen Sohn bemühte.
Jetzt fuhr Renate durch das offenstehende Tor. Dann hielt sie vor der Freitreppe. Als sie ausstieg, fiel ihr eine ungewöhnliche Stille auf. Keine Kinderstimmen und kein Hundegebell waren zu hören.
Renate stieg die Stufen der Freitreppe hinauf und läutete am Portal. Frau Rennert öffnete ihr. »Ach, Sie sind es, Fräulein Hagen!«, rief die Heimleiterin erfreut. »Wir hatten Sie nicht erwartet. Alle sind fort. Auch Schwester Regine. Ich bin mit Lena, Magda und meinen Enkelkindern Andreas und Alexandra ganz allein.«
»Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Ich hätte anrufen müssen.«
»Aber nein, Sie stören doch nicht, Fräulein Hagen. Ihr Zimmer ist immer bereit für Sie. Kommen Sie nur herein. Die Kinder und ihre Begleiter kommen gegen sechs Uhr nach Hause. Sie sind mit den Bussen nach Frankfurt gefahren. Schon lange haben sie sich gewünscht, einmal den Frankfurter Zoo besuchen zu dürfen. Diesen Wunsch hat ihnen Frau von Schoenecker heute erfüllt. Übrigens ist heute ein Brief für Sie gekommen. Ich hätte ihn am Montag an Sie weitergeschickt, wenn Sie heute nicht gekommen wären.«
»Ein Brief?« Renates Herz schlug schneller.
»Von Daisy Bennet«, erwiderte die Heimleiterin lächelnd.
»Von Daisy?« Sofort befürchtete Renate, dass irgendetwas mit Roy geschehen sei. Aufgeregt folgte sie Frau Rennert ins Büro. Als diese sich noch nach ihrem Befinden erkundigte, stand sie wie auf glühenden Kohlen. Nervös blickte sie immer wieder auf das Kuvert mit der kindlichen Schrift.
Frau Rennert begleitete Renate noch zu ihrem Zimmer und sagte, sie solle sich ruhig Zeit lassen. Sobald sie sich von der Fahrt erfrischt habe, erwarte sie sie im Wintergarten zum Kaffee.
»Vielen Dank, Frau Rennert.« Renate lächelte sie dankbar an. Als sie endlich allein war, riss sie das Kuvert erregt auf und entfaltete mit klopfendem Herzen den Briefbogen. Sie setzte sich auf einen der Sessel und las:
Liebe Tante Renate!
Ich nenne Dich so, weil Jeremy das doch auch tut. Ich wollte Dir schreiben, weil ich sehr böse war. Daddy war sehr traurig über mich. Bei uns ist es nicht mehr so schön. Daddy und ich sind ganz allein. Wir haben nur noch Tommy. Wie geht es Jeremy? Bitte, komm doch zu uns mit Jeremy. Wir haben große Sehnsucht nach ihm und auch nach Dir.
Liebe Tante Renate, Daddy ist immer so schrecklich traurig, weil ich nicht lieb bin. Aber ich will lieb zu ihm sein. Ach ja, ich wollte Dir noch sagen, dass ich drei von Deinen Briefen einfach verbrannt habe, weil ich doch wollte, dass Daddy Dich nicht liebhat. Aber ich glaube, er hat Dich doch lieb. Und weil ich nicht will, dass er immer so traurig ist, will ich Dich auch liebhaben. Daddy weiß nicht, dass ich Dir schreibe.
Ich kann schon kochen. Aber manchmal brennt etwas an. Kochst Du auch so gut wie Mummy? Ich war am Abend mal bei Mummy auf dem Friedhof, weil doch Pamela gesagt hat, dass alle Toten um Mitternacht aus ihren Gräbern kommen und sich treffen. Aber der Herr Pfarrer hat gesagt, das ist nicht wahr. Und er ist doch ein kluger Mann und weiß alles. Er hat gesagt, dass die Seele eines Menschen in den Himmel kommt und er selbst im Grab liegen bleibe.
Liebe Tante Renate, komm doch mit Jeremy zu uns nach Alvery. Du kannst mit dem Flugzeug fliegen. Daddy und ich sind auch geflogen. Ich will auch lieb zu Dir sein. Und ich sage Daddy noch nichts von dem Brief, damit er überrascht wird. Es soll für ihn eine ganz schöne Überraschung werden, weil er doch bald Geburtstag hat. Er wird bald dreiunddreißig. Nicht wahr, Du kommst mit Jeremy? Auch Tommy sehnt sich nach Jeremy.
Wenn Du mit ihm kommst, wird es vielleicht wieder fröhlich bei uns. Du sollst dann für immer bei uns bleiben. Kommst Du auch wirklich?
Liebe Tante Renate, ich verbrenne auch nie wieder Deine Briefe, weil Daddy dann so böse wird. Er hat mir dafür eine Ohrfeige gegeben, und ich habe viel geweint.
Viele Grüße und Küsse von Deiner Daisy.
Grüße auch Jeremy. Und komme bald mit ihm zu uns.
Gerührt ließ Renate den Brief sinken. Was sollte sie nur tun? fragte sie sich erregt. Sollte sie wirklich mit Jeremy überraschend auf Roys Farm eintreffen? Vielleicht würde er dann glauben, sie liefe ihm nach.
Dann aber dachte Renate an Daisy. Aus jedem ihrer Worte sprach die Einsamkeit eines Kindes, das mit dem Leben nicht mehr fertig wurde.
Renate malte sich in Gedanken ihre Ankunft mit Jeremy auf der Farm aus. Sie versuchte sich Roys Reaktion auf das plötzliche Wiedersehen vorzustellen. Aber es gelang ihr nicht.
Voller Ungeduld wartete Renate auf die Rückkehr der Kinder und ihrer Freundin. Zuerst wollte sie mit Regine alles besprechen und sich dann auch noch Rat bei Frau von Schoenecker holen. Wenn diese dafür war, dass sie, ohne sich anzumelden, nach Wales flog, dann wollte sie hinfliegen und sich dazu unbezahlten Urlaub nehmen.
Die Zeit bis zum Eintreffen der beiden Schulbusse wollte nicht vergehen. Doch endlich waren die Busse da. Die Kinder stiegen mit lauter Fröhlichkeit aus.
Als Jeremy Renate erblickte, lief er mit einem Freudenschrei auf sie zu und streckte die Arme nach ihr aus. Sie hob ihn hoch und gab ihm einen Kuss. »War’s schön?«, fragte sie dann.
»Sehr schön, Tante Renate«, erwiderte er auf deutsch, wechselte aber dann in seine Muttersprache über, als er ihr von den vielen Tieren im Zoo erzählte.
Renate begrüßte nun auch die anderen Kinder und flüsterte Regine zu: »Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen.«
»Sobald ich die kleinen Kinder versorgt habe, habe ich für dich Zeit«, erwiderte Schwester Regine. »Bestimmt handelt es sich um deinen Engländer.«
Renate nickte und ließ sich dann von Jeremy und Heidi in den Wintergarten ziehen. »Wir wollen nämlich Habakuk erzählen, dass wir im Zoo genauso einen Papageien gesehen haben. Aber er konnte nicht sprechen.«
»Da wird Habakuk aber stolz sein, dass er mehr kann als der Papagei
im Zoo«, ging Renate auf die Kinder ein.
In der nächsten halben Stunde herrschte lauter Trubel im Haus. Dann aber saßen die Kinder endlich am Abendbrottisch. Doch auch beim Essen standen ihre Münder keinen Augenblick still. Denise war mit Henrik gleich weiter nach Schoeneich gefahren, während Nick in Sophienlust übernachten wollte.
Nach dem Abendbrot kehrte endlich Ruhe in Sophienlust ein. Selbst die größeren Kinder gingen an diesem Tag früh zu Bett.
Renate erzählte Regine nun von Daisys Brief. Sehr nachdenklich hörte diese ihr zu. Dann meinte sie: »In gewisser Weise hast du recht, wenn du behauptest, es könnte aufdringlich erscheinen, ohne Einladung von Roy Bennet nach Wales zu reisen. Aber eben nur in gewisser Weise. Ich gebe dir den Rat, dir eine Woche Urlaub zu nehmen und Jeremy nach Hause zu bringen. Wie du mir erzählt hast, schreibt Roy in jedem seiner Briefe, dass er Jeremy nur aus Zeitmangel noch nicht heimholen könne. Auch habe ich bemerkt, dass Jeremy oft unter Heimweh leidet. Er spricht viel von Daisy und von seinem Daddy und auch von dem Hund Tommy. Neulich habe ich ihn belauscht, als er sich mit unserem Bernhardiner Barri unterhielt. Er hat dem Hund sein Herz ausgeschüttet und ihm erzählt, dass er auch einen schönen Hund habe, der aber auch Daisy gehöre. Und er werde bald wieder bei ihm sein. Er zähle schon die Tage bis dahin.«
»Vielleicht sollte ich tatsächlich fliegen«, erwiderte Renate tief aufatmend. »Ich kann ja als Grund angeben, dass Jeremy großes Heimweh hatte. Trotzdem würde ich noch gern mit Frau von Schoenecker sprechen.«
»Dafür bin ich auch, Renate. Dein Chef wird aber nicht begeistert sein, wenn du schon wieder Urlaub haben willst.«
»Er ist ein sehr netter Mensch. Aber er liebt mich, und das ist mir manchmal peinlich. Ich habe schon erwogen, ob ich nicht meine Stellung wechseln sollte.«
»Vielleicht erübrigt sich das nun alles«, erwiderte Regine mit einem verschmitzten Lächeln.
»Du meinst, dass ich gleich ganz auf der Farm bleiben sollte?« Renate schüttelte den Kopf. »Das ist doch unmöglich.«
»Seit ich in Sophienlust bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass auf der Welt eigentlich nichts unmöglich ist. Ich habe hier schon die unmöglichsten Dinge erlebt. Frisch gewagt, ist halb gewonnen, sagt doch ein Sprichwort.«
*
Verständlicherweise konnte Renate in dieser Nacht vor Aufregung kaum schlafen. Am nächsten Tag rief sie gleich nach dem Frühstück in Schoeneich an, weil sie ja gegen Mittag wieder losfahren musste, um pünktlich in Ulm zu sein.
Denise versprach, sobald wie möglich nach Sophienlust zu kommen. Als sie eintraf, ging ihr Renate entgegen und sagte: »Ich weiß, dass es unverschämt von mir ist, Ihre Güte auch noch am Sonntag zu beanspruchen. Aber ich weiß mir einfach keinen Rat mehr.«
Denise ging mit ihr ins Biedermeierzimmer, in den Raum, der schon viele Beichten mit angehört hatte.
Renate gab Denise Daisys Brief. Nervös beobachtete sie die Herrin von Sophienlust, als diese die Zeilen las.
Mit einem lieben Lächeln reichte Denise ihr dann den Briefbogen zurück. »Ich rate Ihnen, nach Wales zu fliegen, Fräulein Hagen.«
»Sie meinen, ich soll Jeremy heimbringen?«
»Ja, Fräulein Hagen. Am besten sogleich. Daisy braucht Hilfe, und Mister Bennet ebenfalls.«
»Dann fliege ich.« Erleichtert atmete Renate auf. »Aber dann müsste ich Jeremy schon heute mit nach Ulm nehmen. Morgen müsste ich dann mit dem Oberarzt sprechen und mir Urlaub nehmen.«
»Ich werde Ulla sogleich bitten, Jeremys Sachen zu packen. Wo steckt denn der Junge?«
»Soviel ich weiß, ist er mit den Kindern zu den Koppeln gelaufen.«
»Dann gehen wir am besten gleich hin.«
Renate hatte das Gefühl, auf Wolken zu schweben, als sie mit Denise zusammen das Haus verließ. Wenn alles klappte, würde sie schon morgen Abend Roy wiedersehen. »Und Sie meinen, ich soll kein Telegramm abschicken?«, fragte sie leise.
»Daisy wäre enttäuscht, wenn Sie es täten. Ich glaube, Sie sollten sich ihr Vertrauen erhalten, Fräulein Hagen. Ich möchte mich natürlich nicht in Ihre Privatangelegenheiten einmischen, wenn ich Sie frage, ob Ihnen Mister Bennet mehr bedeutet?«
»Das tun Sie gewiss nicht, Frau von Schoenecker. Ich bewundere und verehre Sie und hatte es auch von Ihrem Rat abhängig gemacht, ob ich Daisys Bitte erfülle. Ja, Roy bedeutet mir sehr viel. Ich liebe ihn«, gestand Renate. »Natürlich weiß ich, dass noch lange Zeit vergehen wird, bis sich mein Traum erfüllen könnte. Seine Frau ist ja erst kurze Zeit tot. Aber wenn er mich bitten würde, bei ihm zu bleiben, um ihm den Haushalt zu führen, würde ich mit Freuden meinen Beruf an den Nagel hängen.«
»Das würde ich an Ihrer Stelle auch tun. Da ist ja Jeremy schon«, stellte Denise fest und deutete auf ihren Sohn Nick, der den kleinen Jungen eben auf das lammfromme Pony Nicki setzte.
Jeremy entdeckte Renate sofort und rief stolz: »Sieh doch, Tante Renate, ich kann schon reiten. Daheim bin ich schon mal auf einem großen Pferd geritten. Vielleicht schenkt Daddy mir ein Pony.«
»Vielleicht«, erwiderte Renate lächelnd. »Nick, bitte, hebe Jeremy wieder von dem Pony herunter. Deine Mutter und ich müssen ihm etwas sagen.«
»Was denn?«, fragte der Kleine neugierig.
»Du verlässt heute nach dem Mittagessen mit mir Sophienlust«, sagte Renate. »Wir fliegen nach Hause.«
»Nach Hause? Zu Daddy und Daisy? Und zu Tommy? Und du kommst mit?«, fragte der Junge aufgeregt. »Heidi, Heidi! Ich darf nach Hause fahren!«, rief er dann seiner kleinen Freundin zu. »Schon heute!«
Heidi stieg sofort von ihrem Pony ab.
»Heute schon?«, fragte sie erschrocken. »Warum denn so schnell?«
»Weil Daisy Sehnsucht nach ihrem Bruder hat«, antwortete Denise. »Das verstehst du doch, Heidi?« Sie strich der Vierjährigen über die Wange. »Du willst doch jetzt nicht weinen?«
»Nein, Tante Isi, aber ein ganz klein bisschen bin ich doch traurig. Ob ich Jeremy mal besuchen darf?«
»Sicherlich darfst du das!«, rief Renate fröhlich.
»Dann will ich auch nicht weinen.«
Nick fragte später seine Mutter: »Ist etwas bei den Bennets geschehen?«
»Aber nein, Nick. Daisy hat einen Brief an Fräulein Hagen geschrieben und sie gebeten, Jeremy heimzubringen.«
Nick lächelte verschmitzt, als er fragte: »Mutti, glaubst du, dass Mister Bennet Schwester Renate heiraten wird?«
»Möglich wäre es. Ich glaube es sogar bestimmt. Aber vorläufig kommt das noch nicht infrage.«
»Du meinst, weil seine Frau erst vor acht Wochen gestorben ist und er sie sehr geliebt hat?«
»So ist es, mein Junge. Kommst du mit nach Schoeneich?«
»Heute esse ich lieber hier, Mutti, Weil doch Jeremy fortfährt. Es ist doch immer dasselbe. Sobald man sich an ein Kind gewöhnt hat, verlässt es uns wieder.«
»So ist es nun mal in einem Kinderheim. Aber wir sollten froh sein, wenn ein Kind wieder ein glückliches Heim findet.«
»Ja, Mutti, das ist wahr«, gab Nick zu.
Denise verabschiedete sich herzlich von Renate und Jeremy. Renate versprach ihr, so bald wie möglich etwas von sich hören zu lassen und auf alle Fälle gleich nach ihrer Ankunft in Wales zu telegrafieren.
*
Jeremy fühlte sich als Held des Tages. Vor Aufregung brachte er beim Mittagessen kaum einen Bissen herunter. Dass er in der kommenden Nacht bei Tante Renate in ihrer Wohnung in Ulm schlafen würde, erzählte er jedem stolz.
Und dann war es soweit. Jeremy stieg in Renates Wagen ein.
Ganz Sophienlust hatte sich auf der Freitreppe versammelt, um dem abfahrenden Wagen nachzuwinken. Jeremy kniete sich auf den hinteren Sitz und blickte zum Heckfenster hinaus. Erst als nichts mehr von Sophienlust zu sehen war, setzte er sich wieder. Seinen Teddy hielt er ganz fest in den Armen.
Während der ganzen Fahrt unterhielt sich Jeremy mit Renate. »Nicht wahr, du bleibst dann für immer bei uns?«, fragte er mehrmals. »Unsere Mummy ist doch tot.«
Renate verstand es, ihm darauf keine direkte Antwort zu geben. Jeremy gab sich auch zufrieden und wurde still, als sie endlich Ulm erreichten. Neugierig sah er sich nach allen Seiten um, als sie durch die Straßen fuhren.
»Wir sind da!«, rief Renate und hielt an. »Bleib nur sitzen, ich fahre gleich in die Tiefgarage.«
Jeremy war fasziniert, als das Tor allein aufging und Renate in einen tiefen Keller hinunterfuhr. »Was machen wir denn hier?«, fragte er verwundert. »Oh, da stehen aber viele Autos.«
»Das ist eine Tiefgarage, Jeremy«, erklärte Renate lächelnd. »In allen modernen Hochhäusern gibt es solche Garagen.«
»Wir haben daheim eine Garage aus Wellblech.«
Jeremy stieg mit leuchtenden Augen aus und ging neben Renate zum Fahrstuhl. Diese stellte zuerst die Koffer in den Lift und schob dann Jeremy hinein.
Jeremy war so müde, dass er schon beim Abendbrot einschlief. Renate richtete ihm ein Bett auf der Couch. Liebevoll deckte sie ihn dann später zu und sagte: »Schlaf gut, mein Liebling. Morgen Abend liegst du schon daheim in deinem Bettchen.«
Hoffentlich stimmte das auch, dachte sie, als sie das Geschirr abräumte. Leise schloss sie die Tür des Wohnzimmers und hob dann den Telefonhörer in der kleinen Diele ab, um im Krankenhaus anzurufen. Sie nahm an, dass der Oberarzt noch dasein würde.
Dr. Aigner war noch da. Als sie ihm sagte, sie müsse dringend mit ihm sprechen, könne aber nicht aus der Wohnung fort, versprach er, sofort zu ihr zu kommen.
Danach suchte Renate die Nummer des Stuttgarter Flughafens heraus und buchte für den nächsten Vormittag zwei Plätze nach London. Dann bettete sie den tief schlafenden Jeremy in ihr Schlafzimmer um und räumte noch schnell ein wenig im Wohnzimmer auf.
Lange brauchte Renate nicht auf Dr. Jürgen Aigner zu warten.
»Wo brennt’s?«, fragte der Oberarzt fröhlich beim Eintreten. »Ich habe statt Blumen eine gute Flasche Wein mitgebracht.«
»Vielen Dank.« Renate war momentan unsicher, ob ihr impulsiver Anruf gut gewesen war. Vielleicht machte er sich wieder falsche Hoffnungen? »Bitte, kommen Sie doch weiter«, bat sie verlegen. »Ich habe nämlich Besuch. Von einem kleinen Jungen. Um offen zu sein, von Jeremy Bennet. Ich möchte ihn morgen nach England bringen.«
»Ach so.« Das Leuchten in den Augen des Besuchers erlosch. »Dann wollen Sie mich um Urlaub bitten?«
»Nicht nur das.« Renate wusste, dass sie ihre Karten nun offen auf den Tisch legen musste. »Bitte, setzen Sie sich doch.« Sie deutete auf einen der Sessel. »Ich hole Gläser.«
Jürgen Aigner begrub eine stille Hoffnung. Aber er blieb gleichbleibend freundlich, als Renate ihm von den jüngsten Ereignissen berichtete.
»Ich habe das Gefühl, dass Sie uns für immer verlassen werden«, erwiderte er nach einer Weile. »Das tut mir unendlich leid, Renate.«
»Aber wir bleiben doch Freunde, nicht wahr?«, fragte sie bittend.
»Ja, Renate, das bleiben wir. Ich werde immer für Sie dasein, wenn Sie Hilfe brauchen.«
Es wurde doch noch ein netter Abend. Besonders, als Jeremy verschlafen aus dem Schlafzimmer kam und sich verwundert umblickte.
»Tante Renate, ich bin aufgewacht«, sagte er und rieb sich schlaftrunken die Augen. Dann sah er Dr. Jürgen Aigner neugierig an. »Bist du Tante Renates Mann?«, fragte er enttäuscht.
»Leider nicht, kleiner Mann.« Jürgen Aigner suchte seine ganzen englischen Kenntnisse zusammen.
»Dann ist es ja gut.« Jeremy schmiegte sich an Renate. »Weil sie doch für immer bei uns bleiben soll. Aber du darfst uns auch besuchen, weil du ein netter Onkel bist«, erlaubte er großzügig.
»Das ist ja fein.« Jürgen musste lachen.
»Jeremy, aber nun musst du schnell wieder ins Bett zurück.«
»Ist es dein Bett, Tante Renate?«
»Es ist mein Bett, Jeremy.«
»Darf ich dann heute Nacht bei dir im Bett schlafen, weil es doch so groß ist? Bei Mummy habe ich auch schon geschlafen.«
»Das darfst du.« Renate stand auf und trug den Jungen in ihr kleines Schlafzimmer zurück.
Jeremy schlief sofort wieder ein. Leise zog Renate die Tür wieder zu.
Jürgen sah sie nachdenklich an. »Nun bin ich ganz sicher, dass Sie uns für immer verlassen, Renate. Der Junge vergöttert Sie geradezu.«
»Ich bin glücklich darüber, Jürgen.« Sie sah ihm in die Augen. »Und ich wünsche mir auch, dass ich bei dem Kind bleiben darf.«
»Das wünsche ich Ihnen auch.« Er blickte auf seine Armbanduhr. »Ich gehe jetzt, damit Sie endlich ins Bett kommen. Denn morgen liegt ein anstrengender Tag vor Ihnen.«
»Ich weiß. Und noch einmal vielen Dank, Jürgen.«
»Renate, darf ich Ihnen einen Abschiedskuss geben?«
»Gern, Jürgen.« Sie legte den Arm um seinen Nacken und küsste ihn zuerst. Es war ein scheuer, fast kindlicher Kuss, der ihn zutiefst rührte. Kleine Renate, dachte er mit stiller Wehmut.
Renate wartete an der Wohnungstür, bis der Lift nach unten fuhr. Dann wandte sie sich mit einem glücklichen Lächeln um. Sie räumte noch die Gläser und die leere Flasche weg, dann ging sie zu Bett.
Jeremy seufzte leise auf und drehte sich zu ihr um. »Ich habe dich lieb«, flüsterte er im Halbschlaf.
»Ich dich auch, mein Liebling.«
Renate schlief sofort ein. Am nächsten Morgen wurde sie von Jeremy geweckt. Er rief: »Aufstehen, Tante Renate. Die Sonne scheint schon. Wir dürfen doch nicht das Flugzeug versäumen.«
»Jeremy, es ist doch erst sechs«, seufzte Renate nach einem Blick auf den Wecker auf ihrem Nachttisch.
»Aber ich mag nicht mehr schlafen.«
»Also gut, dann stehen wir auf.«
Renate bereitete ein gutes Frühstück zu. Dann überlegte sie, was sie auf die Reise mitnehmen sollte. Sie entschloss sich, nur wenig mitzunehmen. Sollte sie tatsächlich für längere Zeit in England bleiben, müsste sie auf alle Fälle noch einmal nach Ulm zurückkehren.
Nachdem der Koffer gepackt war, fuhr Renate mit Jeremy zu ihrer Bank, um Geld abzuheben. Danach war es höchste Zeit, nach Stuttgart zu fahren.
Endlich saßen sie dann in dem Düsenklipper. Jeremy strahlte übers ganze Gesicht.
»Ich freue mich sehr auf Daisy und Daddy«, wiederholte er zum x-tenmal.
»Ich auch, Jeremy.« Renate legte den Arm um die Schulter des neben ihr sitzenden Kindes, als sich die Maschine in die Lüfte hob. Plötzlich musste sie so intensiv an Roys verstorbene Frau denken, dass ihr die Tränen in die Augen schossen. Einen Augenblick überfiel sie auch die Angst, dass auch dieses Flugzeug abstürzen könnte.
Die Angst verließ Renate während des ganzen Fluges nicht. Als sie endlich wieder festen Boden unter ihren Füßen hatten, fühlte sie sich wie neugeboren.
»Hier war ich auch schon mit Daddy und Daisy!«, rief Jeremy. »Und alle sprechen wieder so wie ich«, stellte er zufrieden fest. Es hatte ihm nicht immer gefallen, dass er in Sophienlust nicht alle hatte verstehen können. Er war froh, wieder daheim zu sein.
Sprachschwierigkeiten gab es für Renate keine. Und dann saß sie mit Jeremy in dem Bus, der sie nach Alvery bringen sollte.
*
Daisy stellte Tommy seine Morgenmilch hin. Aber der Hund wandte sich ab und lief davon.
»Warum willst du denn nicht trinken?«, fragte Daisy enttäuscht. Sie roch an der Milch und stellte fest, dass sie sauer war.
Seufzend schüttete sie die Milch fort und wusch den Napf aus. Dann füllte sie den Napf mit frischem Wasser. Ob Daddy schimpfen würde, weil sie vergessen hatte, die Milch in den Eisschrank zu stellen?
Daisy blickte sich in der Küche um. Sie sah das ungewaschene Geschirr und die schmutzigen Fenster. Als Mummy noch lebte, war die Küche am Morgen immer ganz sauber gewesen. Da hatte es kein schmutziges Geschirr und keine verschmierten Fensterscheiben gegeben. Glücklicherweise war an diesem Tag keine Schule, sodass Daisy die Fenster putzen konnte. Ihr Daddy war schon in aller Frühe nach Alvery gefahren, um sich dort mit einigen Farmern zu treffen. Er hatte sie gebeten, keine Dummheiten zu machen.
Daisy füllte den Eimer mit Wasser und überlegte, was Mummy immer zum Fensterputzen genommen hatte. Aber sie konnte sich nicht erinnern.
Eigentlich sind die Fenster doch nicht so schmutzig, überlegte sie, weil sie keine Lust hatte, allzu viel zu arbeiten. Aber das Geschirr musste sie auf alle Fälle abwaschen.
Seufzend machte sie sich an die Arbeit. Tommy kam zurück und zupfte sie am Ärmel, um ihr zu sagen, dass die Sonne so schön schien und er spazierengehen wolle.
»Die Zeiten sind vorbei, Tommy.« Daisy stellte die Teller in den Schrank. Dabei streifte sie mit der viel zu großen Schürze einige Glasteller und riss sie heraus.
Laut weinend kehrte sie die Scherben zusammen. »Daddy wird bestimmt schimpfen, denn es waren Mummys schönste Teller«, erzählte sie Tommy. »Vielleicht merkt er es aber nicht so schnell. Ach, Tommy, ich kann nicht mehr.« Daisy setzte sich auf die Bank und weinte lauter. Mit dem Schürzenzipfel fuhr sie sich immer wieder über die Augen. »Glaubst du, dass Tante Renate mit Jeremy kommt? Eigentlich müsste sie meinen Brief schon bekommen haben.« Tommy bellte, und Daisy entschloss sich, einfach ein bisschen spazieren zu gehen.
Voller Freude sprang der Hund um Daisy herum, als sie das Haus verließ. Sommerwölkchen flogen über den Himmel. Es war so warm, dass Daisy den Weg zum Forellenbach einschlug. Sie wollte ein bisschen mit den Füßen im Wasser waten. Dabei dachte sie an Jeremy. Einmal hatten sie gemeinsam mit den Händen eine Forelle gefangen, sie aber gleich wieder schwimmen lassen, weil sie ihnen so leid getan hatte.
Bei dieser Erinnerung wurde Daisy wieder ganz traurig. Vielleicht war Schwester Renate böse auf sie, weil sie so unfreundlich zu ihr gewesen war?
Daisy setzte sich in das hohe Gras am Ufer des Baches und blickte betrübt auf das sprudelnde Wasser. Wie dunkle Schatten huschten die Forellen vorbei. Ganz in der Nähe quakte ein Frosch.
Unaufhörlich liefen dem kleinen Mädchen die Tränen über die Wangen. Niemand hat mich wirklich lieb, dachte es. Selbst Daddy ist ganz anders als früher. Wenn wir zusammen in der Küche beim Essen sitzen, spricht er kaum ein Wort.
Plötzlich spitzte Tommy, der bisher still neben Daisy in der Sonne gelegen hatte, die Ohren. Dann sprang er freudig bellend auf. Seine Rute schlug hin und her. Schließlich rannte er davon.
»Tommy! Hierher!«, rief Daisy voller Angst, weil sie glaubte, er habe ein Wild in die Nase bekommen und jagte nun hinter ihm her. Erst vor ein paar Tagen hatte der Jäger einen wildernden Hund erschossen.
»Tommy! Tommy!«, schrie Daisy außer sich vor Angst und lief hinter ihm her. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass der Hund die Richtung zum Haus eingeschlagen hatte. Und dann hörte sie sein Gejaule. So jaulte er immer nur dann, wenn er sich riesig freute.
Daisy lief schneller und erreichte endlich die Stelle, von der aus sie das Haus sehen konnte. Sie erblickte einen kleinen Jungen in einem blauen Anzug und eine dunkelhaarige Dame in einem hellen Kostüm.
»Jeremy«, flüsterte sie. »Es ist Jeremy!«, rief sie dann und rannte los.
»Daisy! Daisy!« Jeremy kam ihr entgegengelaufen. Die Geschwister umarmten sich voller Freude.
»Findest du nicht, dass ich gewachsen bin?«, fragte der kleine Junge stolz. »Mein dunkelblauer Anzug ist mir viel zu klein geworden. Sieh nur, die Hosenbeine sind ganz kurz.« Er streckte seine Arme aus. »Und die Ärmel sind auch zu kurz geworden. Bald bin ich so groß wie du.«
Renate hielt sich im Hintergrund. Sie wollte das Wiedersehen der Kinder nicht stören. Tommy, der Jeremy schon gebührend begrüßt hatte, strich schnuppernd um sie herum. Man sah ihm deutlich an, dass er noch nicht viel mit ihr anfangen konnte.
»Du bist gewiss der Tommy«, redete Renate ihn an.
Tommy wedelte mit der Rute und kam etwas näher.
»Ja, Tante Renate, das ist unser Tommy. Hast du gesehen, wie er sich gefreut hat?«, fragte Jeremy.
Daisy streckte Renate ihre kleine Hand hin und sah sie treuherzig an. »Ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagte sie statt einer Begrüßung. »Ich war so allein.« Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. »Daddy ist nicht da. Er hat eine Tagung in Alvery.«
Renate zog das Mädchen an sich. »Ich bin gern gekommen, Daisy. Und ich danke dir für deinen lieben Brief. Er ist sehr schön geschrieben.«
»Ich habe auch ganz langsam geschrieben. Nicht wahr, ich habe viele Fehler gemacht, Tante Renate?«
»Überhaupt keine, Daisy.« Renate hatte sofort gemerkt, wie blass das kleine Mädchen aussah und wie schmal seine Wangen geworden waren.
»Ich habe das Geschirr noch nicht fertig abgewaschen. Weil ich Mummys beste Glasteller zerbrochen habe, bin ich ganz einfach fortgelaufen.«
Renate hörte aus der weinerlichen Stimme die große Verzweiflung des Kindes heraus. Liebevoll strich sie Daisy übers Haar. »Glas kann man ersetzen, Daisy. Glaub mir, auch uns Großen passieren im Haushalt immer wieder Pannen. Wollen wir jetzt nicht ins Haus gehen?«
»O ja.« Daisy atmete hörbar auf. Sie hatte das Gefühl, dass eine ganz große Last von ihrem Herzen genommen sei. Stolz zeigte sie ihrer neuen Tante Renate das Haus.
Renate erkannte die geschmackvolle, aber einfache Einrichtung des Farmerhauses, aber auch, dass überall Staub war, dass die Vorhänge gewaschen werden mussten und dass selbst die Bettwäsche seit Wochen nicht mehr abgezogen worden zu sein schien. Es war der typische Haushalt eines Junggesellen und eines kleinen hilflosen Mädchens, dem die Last zu schwer geworden war.
»Wisst ihr was?«, rief Renate munter. »Jetzt beziehen wir zuerst einmal die Betten frisch, und dann machen wir uns ein Abendessen. Es ist ja schon spät. Wann wird dein Daddy kommen, Daisy?«
»Vielleicht gegen neun, Tante Renate. Vielleicht auch früher. So eine Tagung dauert immer lange. Meist gehen die Männer danach noch ins Gasthaus«, fügte sie altklug hinzu.
Zu dritt nahmen sie dann die Arbeit in Angriff. Die Betten waren bald frisch bezogen und das Besucherzimmer, wie Daisy die Kammer neben der ihren nannte, gesäubert. Renate hatte auch das restliche Geschirr abgewaschen. Während die Kinder es nun abtrockneten, bereitete sie aus den Lebensmitteln, die sie im Eisschrank fand, ein gutes Abendessen zu.
Renate hatte sich inzwischen umgezogen und trug nun Jeans wie die Kinder. Das Haar hatte sie im Nacken mit einer Spange zusammengefasst. Der Kragen der hellgrünen Bluse schmiegte sich weich an ihren schlanken Hals. Ihre Wangen waren leicht gerötet, ihre Augen leuchteten vor Eifer.
Roy, der unbemerkt von den dreien heimgekommen war, stand mit fassungslosem Staunen unter der Küchentür. Jeremy entdeckte ihn zuerst. »Daddy! Daddy! Ich bin wieder da!«, rief er. »Tante Renate hat mich hergebracht!«
»Mein Junge!« Roy hob seinen Sohn hoch und gab ihm einen Kuss. Dann suchte sein Blick Renate.
Renate stand mit einem Teller in der Hand stumm da und erwiderte seinen Blick. Wenn sie bis zu diesem Augenblick noch unsicher gewesen war, ob sie das Richtige getan hatte mit ihrer impulsiven Entscheidung, Daisys Wunsch zu erfüllen, jetzt zweifelte sie nicht mehr daran.
»Herzlich willkommen«, sagte Roy. Er stellte Jeremy wieder auf seine Beine und streckte Renate die Hand hin. »Ich bin sehr froh, dass Sie Jeremy heimgebracht haben, Renate. Ich danke Ihnen. Und ich bin auch sehr froh, dass Sie da sind«, fügte er kaum verständlich hinzu.
»Daddy, Tante Renate hat gekocht!«, rief Daisy. »Nicht wahr, jetzt riecht es bei uns in der Küche wieder viel besser? Aber sie hat gesagt, dass auch ihr manchmal Pannen im Haushalt passieren, weil … ja, weil ich doch die schönen Glasteller zerschlagen habe. Die von Mummy.«
»Mach dir deshalb keine Gedanken, Daisy. Wir kaufen neue.«
Roy war außer Rand und Band vor Freude über Renates Anwesenheit, und Renate fühlte sich so glücklich wie noch nie, als sie seine Blicke sah. Sie war stumm vor Glück. Dafür redeten Daisy und Jeremy umso mehr.
»Daddy, wir haben auch die Betten frisch bezogen«, erzählte Daisy. »Auch das Bett im Besuchszimmer. Nicht wahr, Tante Renate, du bleibst hier? Daddy, ich habe nämlich an Tante Renate einen langen Brief geschrieben und sie gebeten, zu uns zu kommen. Auch wegen Jeremy, weil ich doch so große Sehnsucht nach ihm hatte. Und …«
»Jeremy schläft«, sagte Renate leise und deutete auf den Jungen, der auf der Fensterbank lag. »Der Tag war ziemlich anstrengend für den kleinen Kerl.«
»Ich trage ihn nach oben«, raunte Roy ihr zu. Fast schämte er sich ein wenig, weil er so unverschämt glücklich war. Er hatte Mary doch innig geliebt. Aber dann sagte er sich, dass das Leben weiterging, dass die täglichen Arbeiten gemacht werden mussten. Er hatte Mary zwar mitunter bei schwereren Hausarbeiten geholfen, aber mit den Finessen eines Haushaltes war er nicht vertraut. Und Daisy war viel zu klein, um mit allem fertig zu werden.
Als Renate den Jungen auszog und ins Bett legte, schlug er für einen Augenblick die Augen auf und flüsterte: »Mutti, ich habe dich lieb.« Er hatte diese Worte auf deutsch gesagt.
»Ich habe dich auch lieb, mein Liebling«, erwiderte Renate und deckte ihn liebevoll zu. »Schlaf gut, mein Junge.«
Roy hatte die beiden mit einem zufriedenen Lächeln beobachtet, während Daisys Augen immer größer geworden waren. So etwas wie Eifersucht nagte an ihrem Herzen. Es quälte sie auch, dass sie weder Jeremy noch Tante Renate verstanden hatte. Still wandte sie sich um und lief nach unten. Tommy folgte ihr.
Renate war die Reaktion des Kindes nicht entgangen. »Ich glaube, Daisy braucht mich«, raunte sie Roy zu und suchte nach dem Kind.
Daisy saß im dunklen Wohnzimmer und weinte leise. Tommy hatte seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt und sah sie tieftraurig an.
Renate setzte sich neben Daisy aufs Sofa und nahm das weinende Kind in ihre Arme. »Wein nur, kleine Daisy«, sagte sie weich. »Weinen tut gut. Es erleichtert das Herz.«
Daisy schluchzte lauter. Renate wiegte sie zärtlich in ihren Armen hin und her. Endlich verebbte Daisys Kummer. Sie wischte sich über die Augen und fragte: »Darf ich dich auch einmal so umarmen wie vorhin Jeremy?«
»Aber ja, mein Kleines.«
Daisy schmiegte sich selig an Renate. »Nicht wahr, du bist mir nicht mehr böse, weil ich nicht lieb zu dir war?«
»Ich war dir niemals böse.«
»Bitte, bleibe bei uns. Wie hat Jeremy zu dir gesagt?«
»Mutti.«
»Mutti? Was heißt das denn?«
»Mutti heißt in eurer Sprache mother oder mummy.«
»Mutti klingt lieb. Darf ich auch Mutti zu dir sagen?«
Renate befand sich in einer Zwickmühle. Griff sie dem Schicksal nicht vor, wenn sie Daisy diese Bitte erfüllte? Sie hob den Kopf und erblickte im Türrahmen Roy. Seine Silhouette zeichnete sich gegen das helle Rechteck ab. Dann sah sie, dass er ihr zunickte. Demnach hatte er die Worte seiner Tochter gehört.
»Ja, Daisy, nenne mich Mutti«, erwiderte Renate. Dabei bekam sie heftiges Herzklopfen.
»Mutti«, sagte das Kind leise. »Mutti«, wiederholte es dann. »Und was hat Jeremy noch gesagt, Mutti?«
»Ich habe dich lieb.« Wieder hatte Renate in ihrer Muttersprache gesprochen.
»Ich … habe dich lieb«, wiederholte Daisy. »Was heißt das, Mutti?«
»I love you«, erwiderte Renate.
»Ich habe dich auch lieb«, gestand Daisy ein wenig verlegen und barg ihren Kopf in ihrem Schoß.
Renate strich ihr über das blonde Haar. Ihr Blick suchte Roy, der noch immer unter der Tür stand. Sein Gesicht lag im Schatten, sodass sie den Ausdruck darin nicht erkennen konnte, aber sie spürte seine Erregung fast körperlich.
»Ich glaube, Daisy sollte schlafen gehen«, sagte er und knipste das Licht an.
»Ja, Daddy. Nicht wahr, du erlaubst doch, dass Mutti – so nenne ich Tante Renate jetzt – bei uns bleibt!«
»Warum sollte ich es nicht erlauben, Daisy? Aber darin hat sie das letzte Wort.«
»Sie will bestimmt bei uns bleiben.« Daisy sah Renate zuversichtlich an.
Renate brachte Daisy noch in ihre Kammer. Sie wartete, bis das Mädchen im Bett lag, und gab ihm dann einen Gutenacht-Kuss.
»Es ist fast genauso wie damals, als Mummy noch lebte«, sagte Daisy leise und umschlang noch einmal Renates Hals. »Sie wird bestimmt nicht traurig sein, wenn ich dich Mutti nenne. Weil sie doch unsere Mummy war.«
»Sie ist bestimmt nicht traurig, kleine Daisy.«
Als Renate die Treppe hinunterstieg, wurde sie von Roy unten erwartet. Das plötzliche Alleinsein mit ihm ließ sie schrecklich unsicher werden. Aber auch er schien so verlegen wie ein kleiner Junge zu sein.
»Ich hatte keine Ahnung, dass Daisy Ihnen geschrieben hat, Renate«, sagte Roy. »Wollen wir noch ein bisschen hinausgehen? In solchen sternenhellen Nächten sitze ich gern auf der Bank unter unserer alten Eiche. Sie steht schon über dreihundert Jahre an diesem Platz. Ein Urahne meiner verstorbenen Frau hat sie gepflanzt.«
Renate erkannte in diesem Augenblick, dass Marys Schatten wohl immer zwischen ihnen stehen würde. Aber es störte sie nicht. Sie setzte sich neben Roy auf die Holzbank und sagte: »Ihr Land ist wunderschön.«
»Ja, ich liebe seine Weite. Morgen zeige ich Ihnen das Meer. Was hat Daisy Ihnen denn geschrieben, Renate?«
»Ich gebe Ihnen nachher den Brief«, versprach sie. »Jedenfalls hat sie sich sehr einsam gefühlt.«
»Ich weiß, aber ich bin in manchen Dingen recht ungeschickt. Dazu gehört wohl auch, dass ich viel zu wenig Geduld mit Daisy gehabt habe. Als meine Frau noch lebte, gab es keine Probleme dieser Art.«
»Daisy ist ein empfindsames kleines Mädchen, Roy. Jedes Kind ist wie ein Bäumchen, das den Stürmen des Lebens noch nicht gewachsen ist. Man muss so ein Bäumchen oft abstützen, wenn es gerade wachsen soll.«
»Das haben Sie sehr schön gesagt, Renate. Wie lange bleiben Sie bei uns?«, fragte er spontan.
»Ich habe acht Tage Urlaub.«
»Acht Tage«, erwiderte er geistesabwesend.
»Wenn Sie einverstanden sind, würde ich in dieser Zeit gern bei Ihnen bleiben. Ich glaube, es gibt eine Menge im Haus zu tun.«
»So ist es.« Roy schob seine sentimentalen Gedanken beiseite. »Daisy ist nicht damit fertig geworden. Und die alte Barbara, die früher immer zur Aushilfe kam, ist auch gestorben.«
Renate lächelte. Als er ihre Hand umfasste und drückte, lehnte sie für einen Augenblick den Kopf an seine Schulter und sagte: »Ich werde mein möglichstes tun, um Ihren Haushalt wieder instand zu setzen.« Sie richtete sich wieder auf. »Sind Sie mir sehr böse, wenn ich jetzt schlafen gehe? Ich bin, ehrlich gesagt, hundemüde.«
»Ich auch, Renate.«
Sie kehrten ins Haus zurück. Renate reichte Roy die Hand. »Gute Nacht, Roy.«
»Gute Nacht, Renate.« Er hielt ihre Hand noch immer fest. Als sich ihre Blicke trafen, schlug Renate die Augen nieder und löste sich aus seinem Griff. Dann lief sie rasch nach oben.
Roy wartete am Fuß der Treppe, bis er das Schließen ihrer Tür hörte. Dann ging er noch einmal in sein Arbeitszimmer und nahm Marys Bild hoch. »Mary, ich glaube, Renate hätte dir auch gefallen«, sagte er laut und stellte das Bild wieder auf seinen Platz zurück.
Ein befreiender Atemzug weitete seine Brust bei dem Gedanken an Renate. Vielleicht kann ich sie überreden, länger zu bleiben, überlegte er. Vielleicht für immer? Sie könnte doch kündigen und … Nein, das war wohl unmöglich. Der Entschluss, bei ihnen zu bleiben, musste von ihr selbst kommen.
Roy ging zu Bett. Zum erstenmal seit langem schlief er wieder die ganze Nacht durch.
*
Auch Renate hatte wunderbar geschlafen, als sie beim ersten Hahnenschrei wach wurde. Kurz darauf hörte sie Kinderfüße. Vorsichtig wurde die Klinke von außen heruntergedrückt. Jeremy steckte seinen dunklen Haarschopf ins Zimmer und fragte: »Schläfst du noch, Mutti?«
»Nein, Jeremy, komm nur herein.«
Das ließ sich der Junge nicht zweimal sagen. »Darf ich ein bisschen zu dir ins Bett kriechen?«
»Komm nur, kleiner Mann.«
Jeremy kroch unter die Bettdecke und sah Renate schelmisch an. »Weißt du, warum ich dich Mutti nenne?«
»Nein, Jeremy.« Sie lachte leise.
»Weil Daisy es mir erzählt hat. Wir sind schon ganz lange wach und haben über dich gesprochen. Daisy hat mir gesagt, dass sie dich auch Mutti nennen darf. Und nun sage ich das auch.«
»Ich freue mich darüber, Jeremy.«
Es klopfte leise an die Tür. »Herein!«, rief Renate sofort.
Diesmal war es Daisy. Sie war auch noch im Schlafanzug und sah ganz allerliebst aus.
Verlegen lächelte sie, als sie fragte: »Hat Jeremy dich auch nicht aufgeweckt? Ich habe ihm gesagt, er soll dich noch schlafen lassen.« Sie kam näher. »Darf ich dir einen Gutenmorgen-Kuss geben, Mutti?«
»Natürlich, Daisy.«
Kurz darauf saß auch Daisy in Renates Bett. Tommy, der Daisy gefolgt war, betrachtete sich das Bild ein Weilchen und landete dann mit einem Satz zwischen ihnen.
Lachend bugsierte Renate ihn wieder hinaus. »Ich glaube, wir sollten jetzt alle aufstehen«, erklärte sie. »Heute gibt es eine Menge Arbeit für uns.«
»Aber ich muss doch in die Schule gehen.« Daisy sah plötzlich wieder ganz traurig aus.
Roy erklärte jedoch beim Frühstück, dass er sie bei der Lehrerin für diesen Tag entschuldigen werde. »Denn heute ist für uns alle ein Festtag«, fügte er hinzu. Er schnupperte. »Der Tee ist ausgezeichnet.«
»Ich hoffe, dass ich ihn richtig gemacht habe, Roy. Daisy hat mir erklärt, wie man ihn macht. Ich trinke ja daheim immer Kaffee zum Frühstück.«
»Das sollen Sie hier doch auch. Daisy, wir haben doch noch Kaffee im Haus.«
»Nein, Daddy, es ist keiner mehr da.«
»Dann bringe ich welchen aus der Stadt mit. Ich bin pünktlich zum Lunch wieder da.« Er erhob sich und verabschiedete sich mit einer Handbewegung. »Bis nachher.«
Renate sah ihn lächelnd an. Als er fort war, sprang Daisy jubelnd von ihrem Stuhl auf. »Ich bin so froh, dass ich heute daheim bleiben darf. Nicht wahr, wir fangen dann gleich mit der Hausarbeit an?«
Es wurde für Renate und die beiden Kinder ein fröhlicher Vormittag. Renate staunte über Daisy. Für ein achtjähriges Mädchen leistete sie erstaunlich viel. Und die Arbeit ging ihr sehr flink von der Hand.
Als Roy heimkam, stand ein ausgezeichnetes Essen auf dem Tisch, die Fenster blitzten vor Sauberkeit und die Vorhänge hingen hinter dem Haus auf der Leine. Am Nachmittag griff auch Roy bei der Hausarbeit mit zu, und am Abend war das Haus nicht mehr wiederzuerkennen.
Nach dem Abendessen gingen die Kinder gleich zu Bett. Renate und Roy sagten ihnen gute Nacht und unternahmen danach noch einen Spaziergang. Dabei zeigte Renate dem Vater Daisys Brief.
Gerührt las Roy die Zeilen. »Daisy würde sehr enttäuscht sein, wenn Sie uns so bald wieder verlassen würden, Renate«, meinte er, ermutigt durch die kindlichen Zeilen seiner kleinen Tochter.
»Wenn Sie wollen, bleibe ich vorläufig hier«, erwiderte sie, ohne viel zu überlegen.
»Wollen Sie das wirklich, Renate?« Roy umfasste ihre Hände und zog sie an sich. »Sie müssen doch gespürt haben, dass ich Sie sehr gern habe.«
»Ja, Roy, das habe ich gespürt.«
»Aber ich …« Er zögerte. »Es ist nur, weil Mary doch …« Wieder sprach er nicht weiter.
»Ich verstehe Sie auch ohne Worte, Roy.«
»Niemals hätte ich für möglich gehalten, dass ich so schnell … Ach was, ich liebe dich, Renate. Und ich möchte dich später heiraten.«
»Ich warte auf dich, Roy.«
Als er sie küsste, wehrte sie sich nicht. Sie liebte ihn mit der ganzen Kraft ihres Herzens und fühlte sich auch stark genug, in der nächsten Zeit neben ihm zu leben, ohne wirkliche Erfüllung in ihrer Liebe zu finden.
*
Während Renate und Roy spazierengingen, lag Jeremy bei seiner Schwester im Bett. Eifrig flüsterten die beiden Kinder miteinander.
»Glaubst du, dass Daddy Mutti heiraten wird?«, fragte der Junge nachdenklich. »Eigentlich müsste er das doch, weil wir schon Mutti zu ihr sagen.«
»So schnell wird er sie aber nicht heiraten. Ich weiß das von meiner Freundin Pamela. Sie hat gesagt, ihr Daddy wolle auch wieder heiraten. Aber er müsse damit noch ein halbes Jahr warten wegen der Leute.«
»Wegen der Leute?« Jeremy setzte sich auf. »Was haben denn die Leute damit zu tun, Daisy?«
»Weißt du, die Leute glauben dann nämlich, dass Daddy Mummy nicht liebgehabt habe. Jedenfalls sagt das Pamela. Aber Pamela weiß auch nicht alles.«
»Wenn Daddy aber so lange mit einer Heirat warten muss, dann könnte es doch sein, dass Mutti wieder nach Deutschland zurückfliegt.« Jeremy seufzte kummervoll auf. »Dann wären wir wieder allein.«
»Ich glaube aber, dass Mutti dableiben wird«, meinte Daisy. »Sie hat uns beide doch lieb.«
»Und Daddy hat sie auch lieb.« Jeremy schien erleichtert zu sein über Daisys Antwort, denn er lächelte glücklich in sich hinein.
»Du, ich kann noch nicht schlafen«, erklärte Daisy. »Ich möchte gleich wissen, ob Mutti bei uns bleiben wird.«
»Ich auch.« Jeremy kroch aus dem Bett und blickte zum Fenster hinaus. »Es ist schon fast ganz dunkel. Ob sie bald zurückkommen?«
Tommy, der auf dem Bettvorleger gelegen hatte, hob seinen Kopf und gab Laut. Dann erblickte Jeremy seinen Daddy und seine Mutti. Die beiden kamen Arm in Arm auf das Haus zu. »Sie kommen«, flüsterte er. »Ob Daddy sie gefragt hat? Ich meine, vielleicht hat er vergessen, sie zu fragen, ob sie seine Frau werden will?«
Daisy stieg nun ebenfalls aus dem Bett. »Zieh deine Pantoffeln und deinen Bademantel an«, befahl sie. »Ich ziehe mich auch an.«
Auf Zehenspitzen verließen die beiden Kinder das Zimmer. Lauschend blieben sie auf dem Flur stehen. »Sie kommen«, flüsterte Daisy aufgeregt.
»Ich höre sie auch.« Jeremy fasste nach der Hand seiner Schwester. Tommy aber lief unbefangen nach unten und begrüßte Roy und Renate mit wedelnder Rute.
Roy blickte nach oben. »Mir scheint, die Kinder sind noch auf. Sie sind es«, stellte er sogleich fest. »Ihr macht ja so feierliche Gesichter. Was ist los?«
Nebeneinander stiegen die Geschwister die Treppe hinunter. »Daddy, wir wollten dich nur fragen, ob du …« Jeremy kam nicht weiter. Er sah seine Schwester jetzt hilfesuchend an.
»Jeremy meint … Ich meine … Daddy, hast du Renate gefragt, ob sie für immer bei uns bleiben will – als unsere Mutti?« Daisy sah ihren Vater groß an.
»Das habe ich, Daisy.«
»Und, willst du bei uns bleiben, Mutti?«
»Ja, ich will bei euch bleiben, Daisy.«
»Wirklich?«, rief Jeremy. »Aber du hast doch noch eine Wohnung?«
»Die gebe ich auf, Jeremy.« Renate hatte das bis zu diesem Augenblick noch nicht vorgehabt, nun aber wollte sie das so bald wie möglich tun. »Deshalb muss ich noch einmal nach Deutschland zurück.«
»Dann kommen wir aber mit!«, rief Daisy sogleich.
»Klar, wir kommen mit«, sagte Jeremy voller Freude. »Ich habe eine Nacht bei Mutti geschlafen.«
»Renate, ich bringe dich nach Deutschland. Nein. Wir vier begleiten dich.«
»Wir vier«, wiederholte Daisy feierlich.
»Daddy, bitte, rufe doch in Sophienlust an. Ich möchte allen erzählen, dass wir wieder glücklich sind.«
»So spät?« Roy schüttelte den Kopf. »Es ist gleich neun.«
»Aber alle schlafen doch noch nicht. Bitte, Daddy.« Jeremy hob bittend die Hände.
»Also gut.« Roy lachte und wandte sich an Renate. »Du willst bestimmt mit deiner Freundin Regine sprechen.«
»Das wäre fein.«
Die Verbindung war bald hergestellt. Zuerst war Frau Rennert am Telefon, danach kam Regine. Renate erzählte ihr, dass sie für immer bei Roy Bennet und seinen Kindern bleiben werde.
Auch Jeremy wollte durchaus mit Schwester Regine sprechen. Er erzählte ihr, dass sie bald wieder nach Sophienlust kommen würden, aber nur für kurze Zeit. Dann würden sie wieder nach Hause fahren.
Daisy hatte nicht den Wunsch, mit jemandem von Sophienlust zu sprechen. Es war ihr etwas peinlich, dass sie sich dort so ungezogen benommen hatte.
»So, und nun marsch ins Bett!«, rief Roy. »Daisy, morgen musst du auf alle Fälle in die Schule gehen. Jeden Tag kann ich dich wirklich nicht entschuldigen.«
»Ich weiß, Daddy.«
Als die Kinder endlich wieder in ihren Betten lagen, saßen Renate und Roy noch lange beisammen und redeten von der Zukunft. Noch verlangte es Roy nicht danach, Renate in die Arme zu nehmen, denn noch war die Wunde in seinem Herzen über Marys Tod zu frisch.
Renate verstand ihn und respektierte seine Gefühle. Aber sie wusste, dass der Tag nicht mehr fern war, an dem sie unendlich glücklich sein würden.
*
Am Morgen nach dem abendlichen Anruf aus England rief Frau Rennert in Schoeneich an, um Denise von Schoenecker davon zu berichten.
»Was ist los?«, fragte Nick, als seine Mutter den Hörer wieder aufgelegt hatte.
»Schwester Renate hat aus England angerufen, mein Sohn. Sie will ganz dort bleiben.«
»Dann heiratet sie Mister Bennet, und Daisy und Jeremy bekommen eine neue Mutti.«
»So ist es, Nick.«
»Wie ich vermutet habe, Mutti. Wieder einmal sind zwei Menschen durch Sophienlust glücklich geworden. Das heißt eigentlich vier Menschen.«
Nick nahm sich vor, gleich nach der Schule zum Wildmooser Friedhof zu gehen, um auf dem Grab seiner Urgroßmutter einen Strauß dunkelroter Rosen zu legen und ihr damit für alles zu danken. Aber er behielt das für sich.
Als die Kinder in Sophienlust erfuhren, dass Daisy und Jeremy bald wieder eine Mutti haben würden, freuten sie sich für sie. Nur Heidi war ein bisschen traurig, weil Jeremy nun nicht mehr für längere Zeit nach Sophienlust kommen würde, wie sie im Stillen gehofft hatte. Aber sie gönnte ihm das Glück und war auch nicht neidisch auf ihren Freund, weil er nun wieder Eltern hatte und sie nicht. Ihre Heimat war Sophienlust. Sie wusste, dass alle, die hier lebten, sie liebhatten.