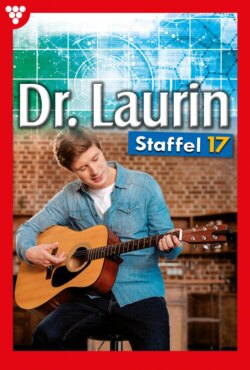Читать книгу Dr. Laurin Staffel 17 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Was macht Ihnen denn das Herz schwer, Moni?«, fragte Dr. Leon Laurin, da er nicht gewöhnt war, dass seine Sekretärin an einem so strahlenden Morgen eine so ernste, nachdenkliche Miene aufsetzte.
Sie reichte ihm eine Büttenkarte. Eine Geburtsanzeige, die doch eigentlich Freude bereiten müsste. Aber Moni Hillenberg, die hübsche Frau des Assistenzarztes Dr. Michael Hillenberg, wusste, dass diese Karte mit hintergründiger Absicht an Dr. Laurin geschickt worden war.
Wir freuen uns sehr über die glückliche Geburt unserer gesunden Tochter Sandra.
Bettina Hammilton – Constantin Hammilton.
zzt. Privatklinik Dr. Dietsch.
»Interessant«, sagte Dr. Laurin ruhig. »Sie meinen, dass ich mich getäuscht habe, Moni?«
»Nein«, erwiderte sie lakonisch.
»Es würde mich freuen, wenn ich mich getäuscht hätte«, erklärte er ruhig. »Dietsch ist ein guter Arzt. Er hat Frau Hammilton über die Runden gebracht. Hoffen wir also das Beste.«
Er konnte nicht umhin, Monate zurückzudenken, als er eine Viertelstunde Zeit dazu hatte. Der Fall Bettina Hammilton war ihm noch sehr gut in Erinnerung. Er brauchte dazu nicht die Anamnese nachzulesen, denn allzu oft in seiner langen Praxis war es nicht geschehen, dass er zu einem Schwangerschaftsabbruch so eindringlich geraten hatte.
So hatte es begonnen: Vor sieben Monaten war Bettina Hammilton in der Prof.-Kayser-Klinik erschienen, eine aparte junge Frau mit grüngrauen Augen und blauschwarzem Pagenkopf.
Auf der Karteikarte stand vermerkt, dass sie zweiundzwanzig Jahre jung, ein Meter sechzig groß und fünfzig Kilo leicht sei. Seit vier Wochen war sie mit dem Testpiloten Constantin Hammilton verheiratet, schwanger jedoch im zweiten Monat. Doch hatte diese Tatsache Dr. Laurin nicht sehr beeindruckt. Amüsiert hatte es ihn anfangs nur, dass Bettina ihm ausreden wollte, dass sie bereits gut zwei Monate schwanger sei. Äußerlich war sie eine sehr moderne Frau, gab sich sehr selbstbewusst, sogar arrogant, und war ganz auf Wirkung bedacht.
Nach einer gründlichen Untersuchung jedoch war Dr. Laurin nicht mehr amüsiert gewesen, denn er hatte festgestellt, dass Bettina an Störungen des Zentralnervensystems litt. Freilich hatte er ihr dies nicht gleich gesagt.
Er hatte vielmehr ihren Mann um ein Gespräch gebeten. Das war erst eine Woche später zustande gekommen, da Constantin Hammilton beruflich sehr beansprucht war.
Constantin war der Typ eines Sonnyboys, und es passte zu ihm, dass er Conny genannt wurde. Er war groß, sportlich, forsch und von bezwingender Natürlichkeit. Dabei aber so konzentriert, wie es sein Beruf erforderte. Er erklärte Dr. Laurin frank und frei, dass das zu erwartende Kind der eigentliche Grund der etwas überstürzten Heirat gewesen sei, womit er jedoch nicht sagen wollte, dass er nicht die Absicht gehabt hätte, Bettina zu heiraten. Sie hatten sich erst vier Monate gekannt, und ihm wäre es lieber gewesen, wenn sie mit der Heirat noch gewartet hätten, da er sehr viel unterwegs gewesen sei.
Auch die Rolle des werdenden Vaters schien ihm einiges Unbehagen zu bereiten.
»Ist bei Bettina etwas nicht in Ordnung, weil Sie mit mir sprechen wollten, Dr. Laurin?«, hatte er gefragt. »Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Ich bin so ungefähr der einzige Mensch, der Einfluss auf sie hat. Von ihrer Mutter wird sie wie ein rohes Ei behandelt und jede kleine Erkältung wird zu einem Drama gemacht.«
»Ich möchte mir eine ziemlich genaue Kenntnis über Ihre Frau verschaffen«, erklärte Dr. Laurin. »Von ihr selbst konnte ich nicht viel erfahren, und in einem solchen Fall ist die Vorgeschichte wichtig, sehr wichtig sogar. Ich kann noch keine endgültige Diagnose stellen, aber ich wäre Ihnen für einige Auskünfte sehr dankbar.«
»Bitte, fragen Sie nur«, sagte Conny Hammilton unbefangen.
»Am liebsten wäre es mir, Sie würden erzählen, wie Ihre Frau im täglichen Leben ist – alles, was Sie über sie wissen.«
Conny runzelte die Stirn. »Offen gestanden weiß ich reichlich wenig über Bettina. Ich lernte sie in Paris kennen. Ihr Charme hat mich gefangen genommen. Sie ist kein leeres Püppchen. Sie ist sehr intelligent und weit gereist. Ihre Mutter ist in zweiter Ehe mit dem Kunsthändler Bernulf verheiratet. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört.«
Dr. Laurin kannte den Namen durch seine kunstbeflissene Frau. Er nickte.
»Bettina war achtzehn, als ihr Vater starb. Sie behielt seinen Namen, aber sie versteht sich gut mit ihrem Stiefvater, der ihr jeden Wunsch erfüllt. Natürlich stattete er uns auch eine fürstliche Hochzeit aus. Ich habe für diesen Klimbim nicht viel übrig. Meine Schwiegereltern hatten keine Ahnung, dass schon ein Baby unterwegs ist. Sie denken auch jetzt noch, dass Bettina sich damit Zeit bis nach der Hochzeit gelassen hat.« Er seufzte. »Ich habe erst da festgestellt, wie exzentrisch Bettina sein kann. Nun ja, der Zustand wird daran schuld sein.«
»War Ihre Frau früher ausgeglichener?«, fragte Dr. Laurin.
»Ein Temperamentsbündel war und ist sie. Sprunghaft, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, aber niemals langweilig. Sie ist gewöhnt, der Mittelpunkt zu sein. Einen Ehealltag habe ich noch nicht kennengelernt. Launisch sind ja wohl alle Frauen.«
»Nicht alle«, erwiderte Dr. Laurin, und dabei dachte er zuerst an seine Frau Antonia, mit der er eine sehr harmonische Ehe führte.
»Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches an Ihrer Frau aufgefallen?«, fragte er dann weiter.
»Manchmal ist sie nahezu euphorisch und im nächsten Augenblick müde, falls so etwas ungewöhnlich ist bei Frau. Ganz genau habe ich noch keine Frau kennengelernt, wenn ich ehrlich sein soll.«
Seine Aufrichtigkeit machte Dr. Laurin Mut. Er erklärte Conny Hammilton vorsichtig, dass er bei Bettina eine Störung des Zentralnervensystems festgestellt hätte.
»Was bedeutet das in diesem Fall?«, fragte Conny. »Ich weiß nur so viel, dass das Zentralnervensystem im Kopf und Wirbelkanal konzentriert ist. Ich musste mich ja auch einiger Tests unterziehen, bis ich meinen Job bekam. Unser Gedächtnis ist ja davon auch abhängig. Ein gutes Gedächtnis hat Bettina allerdings nicht, und sie legt alles so aus, wie es ihr passt. Hat das damit zu tun?«
»Ja, das somatische und vegetative Nervensystem zeigt keine normalen Reflexe. Aber worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass eine Schwangerschaft mit der damit verbundenen hormonellen Umstellung einen schwer krankhaften Zustand auslösen könnte.«
Bestürzt, aber auch sehr nachdenklich, sah Conny den Arzt an. »Sie wollen damit sagen, dass es besser wäre, wenn Bettina kein Kind bekommen würde?«
»Ja, es wäre meiner Ansicht nach besser.«
»Sie meinen, die Krankheit könnte sich auf das Kind auswirken? Es könnte vielleicht gesund sein?«
»Ich denke jetzt nicht an das Kind, Herr Hammilton, ich denke an Ihre Frau. Es ist möglich, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringt, aber es ist nicht abzusehen, wie weit ihr Zustand sich während oder nach der Schwangerschaft verschlimmert.«
Conny bewies, wie konzentriert er war und wie sehr ihn sein Beruf schon geformt hatte, der von ihm verlangte, immer den Tatsachen ins Auge zu schauen.
»Wie könnte sich das auswirken?«, fragte er. »Bitte, sagen Sie es mir genau, Herr Doktor.«
»Ich will nicht schwarzmalen, aber es besteht die Möglichkeit einer multiplen Sklerose, und wir wissen, dass Hormonumbildungen einen Körper sehr verändern können.«
»Nicht auch zum Guten?«, fragte Conny.
»Oft auch zum Guten«, erwiderte Dr. Laurin. »Im Fall Ihrer Frau wäre jetzt noch eine Behandlung möglich, die sie selbst vor weiteren Komplikationen bewahren könnte. Möglicherweise, möchte ich hinzufügen. Aber diese Behandlung könnte wiederum dem Embryo schaden. Ich befinde mich in einem schweren Gewissenskonflikt, Herr Hammilton.«
»Das verstehe ich«, sagte Conny ruhig. »Das ist so, wie wenn ich eine Maschine einfliege und etwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob es an der Maschine liegt oder daran, dass ich noch nicht vertraut mit ihr bin. Ich finde es sehr anständig von Ihnen, dass Sie so offen mit mir sprechen, Herr Doktor. Ich wünschte, ich könnte mich auch so mit den Konstrukteuren unterhalten, die ihre Fehler erst dann zugeben, wenn sie ein Wrack vor sich haben.«
Diesen Vergleich fand Dr. Laurin denkbar gut, und er war erleichtert, dass er mit Conny Hammilton sachlich reden konnte.
»Ich meine, dass man ein Risiko ausschließen sollte, wenn es möglich ist«, sagte Conny. »Ich werde mit meiner Frau sprechen. Ich mag sie sehr. Sie ist manchmal atemberaubend und hinreißend. Ich möchte, dass sie immer so ist.«
Aber er sagte nicht: »Ich liebe meine Frau. Ich will sie behalten.« Er sagte nicht: »Ich möchte das Kind haben.«
Dr. Laurin hatte alle Hoffnung auf ihn gesetzt, aber diese sollte bald zerstört werden. Er bekam sehr viel Ärger.
Bettina ließ sich nicht mehr bei ihm blicken. Dafür erschien ihre Mutter, das ältere Ebenbild der Tochter, aber bedeutend arroganter und aggressiver.
»Ich habe nur das Wohl Ihrer Tochter im Sinn«, erwiderte Dr. Laurin knapp.
Es gäbe auch noch andere Ärzte, sagte sie, und er würde es zu bereuen haben, einen solchen Vorschlag gemacht zu haben.
Dann erschien auch noch Jonas Bernulf, Bettinas Stiefvater. Er war nicht so aggressiv wie seine Frau, doch er wollte, dass Dr. Laurin sich in der Diagnose festlegte. Dr. Laurin sagte ihm das, was er auch schon Conny gesagt hatte. Er schilderte dem Mann dann die Symptome und auch die Untersuchungsergebnisse noch etwas ausführlicher, wenn auch nicht ohne Unbehagen.
Jonas Bernulf sagte darauf, dass er hoffe, seine Argumente widerlegt zu finden.
Dr. Laurin rechnete mit schlimmen Folgen, aber die blieben aus. Er hörte nichts mehr von Bettina Hammilton – bis zu diesem Tag, als die Geburtsanzeige kam.
*
»Du bist in Gedanken, Leon«, sagte Antonia am Abend dieses Tages zu ihrem Mann. »Was hat es gegeben?«
Er nahm die Geburtsanzeige aus seiner Jackentasche. Antonia las und sah ihn dann fragend an. »Hoffen wir das Beste«, sagte sie leise.
»Das habe ich auch gesagt, Antonia. Manchmal geschehen ja Wunder, und ich wäre der Letzte, der dann sein Versagen nicht zugeben würde. Warum soll mir das nicht auch passieren?«
Antonia wusste nur zu gut, wie schwer er daran tragen würde, wenn er sich tatsächlich geirrt hatte.
»Ich möchte zu gern wissen, was Dietsch davon gehalten hat«, sagte Leon, »aber ich kann doch jetzt nicht zu ihm hingehen und ihn fragen.«
»Nein, das tust du nicht«, sagte Antonia.
Aber sie nahm sich vor, ihm diesen Weg abzunehmen. Sie kannte Robert Dietsch von der Studienzeit her. Sie waren ein Jahrgang. Sie hatten zwar nie einen engeren Kontakt gehabt, aber sie schätzte ihn auch als einen guten und sehr seriösen Gynäkologen ein.
Am nächsten Vormittag rief sie Dr. Dietsch an. Seine Sekretärin sagte jedoch, dass der Chef gerade sehr beschäftigt sei.
»Richten Sie ihm bitte aus, dass ich angerufen habe, Dr. Antonia Laurin. Ich würde mich sehr freuen, wenn er zurückrufen würde.«
»Frau Dr. Laurin?«, wiederholte die Sekretärin erstaunt.
»Ja, die Frau von Dr. Leon Laurin«, erwiderte Antonia.
»Ich werde es dem Chef ausrichten. Er wird bestimmt zurückrufen«, tönte die weibliche Stimme schon bedeutend freundlicher durch den Draht.
Und er rief schon nach einer halben Stunde an.
»Das war wirklich eine Überraschung, Antonia«, sagte er. »Was gibt es denn? Habt ihr zu viele Patientinnen? Dann müsste ich allerdings auch gleich passen. Unsere Klinik ist klein. Wir sind voll belegt.«
»Ich möchte Sie sprechen, Robert«, sagte Antonia. »Wann haben Sie Zeit?« Sie redete nicht lange herum.
»Bald?«
»So bald wie möglich.«
»Heute gegen vier Uhr, vor der Visite?«
»Ich komme. Bis dann und vielen Dank«, sagte Antonia.
Sie machte sich pünktlich auf den Weg.
Die Klinik von Dr. Dietsch war ein modernisierter Altbau, aber recht anheimelnd. Seine Sekretärin war eine sympathische Dame schwer schätzbaren Alters. Sie konnte dreißig oder auch vierzig sein, ein zeitloser Typ mit aschblondem kurz geschnittenem Haar, schönen blauen Augen, einem runden, recht reizvollen Gesicht, das makellose Haut aufwies.
Sie begrüßte Antonia mit einem liebenswürdigen Lächeln, das keineswegs gekünstelt wirkte. An der Tür hatte auf einem kleinen Messingschild ihr Name gestanden – Maria Dorn.
»Dr. Dietsch kommt sofort, Frau Dr. Laurin«, sagte sie, Antonia die Tür zu dem Chefzimmer öffnend. Es hatte eine persönliche Note, wie Leons auch. Es standen Blumen auf dem Schreibtisch, der ansonsten auch so eine geniale Unordnung aufwies wie der von Dr. Laurin. Leon konnte es nicht ausstehen, wenn man seine Sachen wegräumte.
Dr. Robert Dietsch kam schon nach ein paar Sekunden. Äußerlich hatte er allerdings nicht die geringste Ähnlichkeit mit Leon Laurin. Aus dem dürren jungen Burschen, den Antonia in Erinnerung hatte, war ein recht gewichtiger Mann geworden.
»Antonia, ich freue mich, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen«, sagte er und gab ihr die Hand. »Sie sind noch schöner geworden. Sie sind eine glückliche Frau, das sieht man Ihnen an. Nun frage ich mich, aus welchem Grund Sie sich meiner erinnert haben.«
»Ich werde es Ihnen erklären, Robert«, erwiderte Antonia. »Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für mich haben.«
»Das ist doch selbstverständlich. Maria bringt uns einen Kaffee. Ist es Ihnen recht?«
»Ja, sehr«, erwiderte Antonia, und sie dachte dabei, dass er mit seiner netten Sekretärin auf vertrautem Fuß stehen musste, wenn er sie Maria nannte.
Sie erinnerte sich aber auch daran, dass er schon während der Studentenzeit geheiratet hatte.
»Wie geht es?«, fragte sie.
»Beruflich bin ich zufrieden, privat – na ja, es könnte besser sein. Die Ehe ist schiefgegangen. Meine Tochter lebt bei mir. Sie ist achtzehn. Ihrer Mutter hat es nicht behagt, dass ich beruflich so viele Sorgen hatte. Sie hat sich für einen anderen entschieden, der ihr ein leichteres Leben bieten konnte. Aber Katrin ist ein liebes Mädchen, das entschädigt mich für vieles.«
»Was hatten Sie für berufliche Sorgen, Robert?«, fragte Antonia.
»Na ja, die Klinik war ziemlich heruntergewirtschaftet. Es sah nicht so rosig aus, wie mancher meinte. Mein Vater hatte den Überblick verloren. Er war krank, aber er wollte sich das Heft ja nicht aus der Hand nehmen lassen. Reden wir nicht mehr davon. Jetzt habe ich es geschafft, wenn ich auch keine Konkurrenz für die Prof.-Kayser-Klinik bin.«
»Wir hören das Wort Konkurrenz nicht gern«, sagte Antonia mit einem Lächeln.
Maria kam mit dem Kaffee und Gebäck.
»Meine beste Freundin«, sagte Dr. Dietsch.
Maria verschwand schnell wieder.
»Sehr sympathisch«, sagte Antonia. »Nicht mehr als eine Freundin?«
»Gebranntes Kind scheut das Feuer, Antonia. Wir verstehen uns prächtig, aber Maria hat auch eine böse Erfahrung gemacht. Man muss ja nicht unbedingt heiraten, um sich zu verstehen. Wir sind aufeinander eingespielt. Was würde ich ohne Maria anfangen? Katrin versteht sich auch gut mit ihr. Was will ich mehr?« Er sah ganz zufrieden aus. »Die Laurins haben ja reichen Kindersegen«, fügte er dann schmunzelnd hinzu.
»Und wir sind auch zufrieden, Robert«, sagte Antonia. Dann erzählte sie schnell von den Kindern, aber sie war ja nicht gekommen, um sich privat mit ihm zu unterhalten, deshalb kam sie rasch zum Grund ihres Besuches.
»Wir haben gestern eine Geburtsanzeige bekommen – von Bettina Hammilton«, sagte sie nach einer kurzen Gedankenpause.
»Sie kennen Frau Hammilton?«, fragte der Arzt erstaunt.
»Hat sie nichts über Leon gesagt?«, fragte Antonia zurück.
»Wieso das? War sie hinter ihm her?«
Antonia hielt unwillkürlich die Luft an. »O nein, das nicht. Aber sie war mal seine Patientin«, erwiderte sie.
»Das ist interessant«, staunte jetzt Dr. Dietsch. »Ich hatte noch nie eine Patientin, die von Dr. Laurin zu mir übergelaufen wäre. Allerdings hatte ich schon mehrere Patientinnen, die in jedem einigermaßen interessanten Mann ein Objekt sahen. Bettina Hammilton hat meine Klinik nicht meinetwegen aufgesucht, um es gleich zu sagen. Ich habe einen Belegarzt, der schien die treibende Kraft zu sein.«
»Aber sie hat doch einen attraktiven Mann«, wandte Antonia ein.
Dr. Dietsch seufzte. »Manche Frauen brauchen die Bestätigung von mehreren Männern, Antonia. Aber das bleibt unter uns, nicht wahr?«
»Selbstverständlich, Robert. Was ich fragen wollte, muss auch unter uns bleiben. Welchen Eindruck haben Sie von Bettina Hammilton?«
»Ich habe nicht viel mit ihr zu tun. Dr. Bernulf betreut sie. Er ist sozusagen ihr Stiefbruder. Sohn aus der ersten Ehe von Jonas Bernulf. Er heißt übrigens auch Jonas. Ist erst seit drei Monaten hier Belegarzt. Ich konnte die Klinik nicht anders halten, Antonia. Die Modernisierung hat irrsinniges Geld gekostet. Er hat zehn Betten belegt, obwohl er noch jung ist. Gerade zweiunddreißig. Sein Vater finanziert alles.«
»Das ist interessant. Also könnte verwandtschaftliches Interesse vorliegen«, meinte Antonia.
»Meiner Ansicht nach ist sie eine recht labile, manchmal hysterische Frau«, erklärte Dr. Dietsch.
»Leon hatte eine andere Diagnose gestellt«, sagte Antonia nachdenklich. »ZNS, um es gleich zu sagen.«
»Störung des Zentralnervensystems?« Dr. Dietsch war plötzlich hellwach.
»Leon weiß übrigens nicht, dass ich bei Ihnen bin. Er zweifelt jetzt an seiner Diagnose und leidet darunter. Ich möchte ihm irgendwie helfen, deshalb bin ich hergekommen.«
Dr. Dietsch runzelte die Stirn. »Ich habe sie nicht untersucht. Wie schon gesagt, sie ist Patientin von Dr. Bernulf. Das Kind ist jedoch gesund. Sie können es sich anschauen, Antonia. Sie sind ja auch Ärztin. Aber was Sie da gesagt haben, beschäftigt mich. Ein paar Schwestern haben sich bei mir schon über Frau Hammilton beklagt. Sie werden Tag und Nacht in Atem gehalten. Bernulf ist ja nicht immer hier. Er meckert nur herum, dass Frau Hammilton nicht genügend betreut würde. Das Personal steht ja unter meiner Aufsicht.«
»Mich würde es sehr interessieren, welcher Meinung Sie sind, Robert«, sagte Antonia nachdenklich. »Leon hegt nicht den geringsten Zweifel an Ihrer Qualifikation, um das vorauszuschicken. Aber ihn quält der Gedanke, dass er eine Fehldiagnose gestellt haben könnte.«
»Hier war nie die Rede davon, dass sie bei Dr. Laurin gewesen ist. Sie kam drei Tage vor der Geburt hierher. Vorher habe ich sie nie gesehen. Ich mache meine Visiten, wenn Bernulf nicht da ist, weiter nichts. Frau Hammilton ist nicht gerade freundlich zu mir, aber ich kann auch nichts Ungewöhnliches an ihr bemerken. Ich weiß nur von den Schwestern, dass sie manchmal aus der Rolle fällt. Aber da Sie mir jetzt einen Hinweis gegeben haben, werde ich mich intensiver mit ihr befassen, wenn es möglich ist. Sie kann mich natürlich ablehnen. Aber auch für mich wäre der Fall sehr interessant, wenn Sie recht hätten.«
»Wie hat sie entbunden?«
»Durch Kaiserschnitt. Ich war dabei. Es ging recht gut. Ich kann Bernulf nichts nachsagen, er ist ein guter Gynäkologe. Das Kind wog knapp sechs Pfund, war ganz in Ordnung. Herr Hammilton war erst einmal hier. Er ist im Ausland, wie ich hörte. Frau Bernulf jedoch ist jeden Tag hier. Sie macht einen kränklichen Eindruck. Mehr kann ich Ihnen vorerst nicht berichten, Antonia.«
»Wie lange wird Frau Hammilton noch hierbleiben?«
»Wohl noch vierzehn Tage. Ich werde die Zeit nützen, wenn es mir, wie schon gesagt, möglich ist. Ich werde Sie informieren, wenn ich etwas herausbringe. Ich rufe Sie an.«
»Besuchen Sie uns doch, Robert, und bringen Sie Ihre Tochter mit. Es würde uns freuen. Was macht sie denn?«
»Sie bereitet sich aufs Abitur vor und möchte auch Medizin studieren. Und leider scheint sie ziemlich viel für Bernulf übrig zu haben«, fügte er seufzend hinzu.
»Wieso leider?«
»Weil er ganz auf Bettina Hammilton fixiert ist.«
»Manchmal sieht das nur so aus«, meinte Antonia. »Er ist anscheinend finanziell noch ziemlich abhängig von seinem Vater. Und sie ist verheiratet.«
»Aber sie äußert sich nicht sehr nett über ihren Mann. Das weiß ich von den Schwestern. Jetzt betrachte ich das allerdings unter anderen Gesichtspunkten, Antonia. Ja, es scheint ein interessanter Fall zu sein. Ich habe noch nicht gehört, dass Leon Laurin sich je getäuscht hätte.«
»Es kann vorkommen, Robert. Kein Mensch ist unfehlbar, und das kalkuliert auch mein Mann ein. Aber ich bin froh, dass ich so offen mit Ihnen sprechen konnte.«
»Ich wäre froh, wenn ich Ihnen schon mehr hätte helfen können, Antonia. Aber ich werde mich darum bemühen. Möchten Sie jetzt das Kind sehen?«
»Ja, gern. Immerhin ist es beruhigend, dass es gesund ist.«
»Aber was nützt das letztendlich der Mutter?«
»Es könnte ja möglich sein, dass die Schwangerschaft doch eine positive Wirkung gehabt haben könnte«, räumte Antonia ein.
Sie gingen zur Säuglingsstation, die auch vorbildlich eingerichtet war, wie Antonia feststellen konnte. Und die kleine Sandra Hammilton war ein gesundes, hübsches Baby. Die Reaktionen waren ganz natürlich, wie Antonia feststellte. Als sie über den Flur zurückgingen, erklang aus einem Krankenzimmer plötzlich ein furchterregendes Gekreisch, und gleich darauf erschien aufgeregt eine junge Krankenschwester.
Sie stürzte auf Dr. Dietsch zu.
»Ich halte das nicht mehr aus, Herr Doktor. Sie beschimpft mich mit den übelsten Worten. Sie hat Schmerzen, aber …«, die Schwester tippte sich an die Stirn, »mit Verlaub gesagt, stimmt es da nicht.«
»Ich werde mich um sie kümmern«, versprach der Klinikchef.
»Und ich werde gehen«, sagte Antonia.
»Sie hören von mir«, sagte Dr. Dietsch rasch. »Grüßen Sie Leon bitte.«
*
Als er das Krankenzimmer betrat, lag Bettina mit weit aufgerissenen Augen in ihrem Bett. Große Schweißtropfen bedeckten ihr Gesicht. Dr. Dietsch tupfte sie ab.
»Wo fehlt es denn, Frau Hammilton?«, fragte er betont höflich.
»Jonas soll kommen«, stammelte sie. »Keiner kümmert sich um mich. Niemand hat Zeit. Mir tut alles weh.«
Ein Zittern durchlief ihren Körper, ihre Augen verdrehten sich. Sie bot einen erschreckenden Anblick. Dann verlor sie plötzlich das Bewusstsein.
Dr. Dietsch läutete und gab seine Anordnungen. Der Medikamentenwagen wurde gebracht. Eine Infusion wurde vorbereitet, und der Tropf wurde angehängt. Als Dr. Dietsch gerade damit fertig war, erschien Dr. Jonas Bernulf, ein mittelgroßer, schlanker Mann, der augenblicklich völlig konsterniert schien.
»Ein Kreislaufzusammenbruch«, erklärte Dr. Dietsch knapp. »Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen, Herr Kollege.«
Dr. Bernulf folgte ihm deprimiert. Als sie das Chefarztzimmer erreicht hatten, sagte er leise: »Ich habe solche Folgen befürchtet.« Dann trat er ans Fenster. »Machen Sie mir Vorwürfe, Herr Kollege?«
»Keineswegs. Ich hätte früher mit Ihnen sprechen sollen. Frau Hammilton neigt zu absonderlichen Reaktionen. Meine Krankenschwestern haben sich verschiedentlich beschwert. Ich möchte das Personal nicht verlieren.«
»Es ist eine Kindbettpsychose, wie ich annehme. Bettina hat das alles nicht verkraftet«, sagte Jonas Bernulf leise. »Aber Professor Gellinger war der Meinung, dass sich ihr Zustand durch die Geburt bedeutend bessern würde. Mein Vater erwartet von mir Wunder, die ich nicht vollbringen kann, Herr Kollege.«
»Sollten wir über diesen Fall nicht einmal sprechen, Herr Bernulf?«, fragte Dr. Dietsch. »Ich bin sehr wenig informiert.«
»Ich sollte eigentlich keine Informationen weitergeben, aber ich kann die Sache nicht mehr allein verantworten«, stöhnte der junge Arzt. »Am Ende bleibt alles an mir hängen. Verstehen Sie mich bitte. Ich fühle mich menschlich verpflichtet, alles, was möglich ist, für Bettina zu tun. Mein Vater hat genug Sorgen mit Charlotte. Das ist Bettinas Mutter, die zweite Frau meines Vaters. Mein Gott, ich kann Sie doch nicht mit meinen familiären Problemen aufhalten …«
»Warum nicht? Es geht um eine Patientin, die in meiner Klinik liegt, und ich musste feststellen, dass sie in einem desolaten Zustand ist.«
»Ja, das ist sie, und das war sie während der gesamten Schwangerschaft. Aber ich habe keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Das muss ich wohl zugeben. Mir ist unbegreiflich, was diesen Zustand hervorruft. Professor Gellinger hat mich wohl nicht hinreichend informiert.«
»Was hat er Ihnen gesagt?«, fragte Dr. Dietsch.
»Dass Bettina zu Beginn der Schwangerschaft unter Hormonstörungen gelitten hätte, und dass die Schwangerschaft dadurch auch erst verhältnismäßig spät festgestellt werden konnte. Die Periode hielt über drei Monate, wenn auch abgeschwächt, an. Das hat Bettina ausgesagt. Als die ersten Geburtswehen einsetzten, musste ich mit einer Frühgeburt rechnen. Aber es war ein ausgetragenes Kind. Das alles hat mich durcheinandergebracht, und dafür werde ich von Charlotte heftig angegriffen. Darf ich auf Ihre Diskretion rechnen, wenn ich Ihnen diese Umstände erzähle, Herr Kollege?«
»Selbstverständlich.«
»Ich muss persönliche Dinge erwähnen, wenn ich Ihnen genau erklären will, wie Bettina meine Patientin wurde. Mein Vater hatte mir die Praxis eingerichtet. Ich war offen gestanden, gegen seine Heirat gewesen. Ich habe sehr an meiner Mutter gehangen, und als ich Charlotte kennenlernte, war ich der Überzeugung, dass sie nicht die richtige Partnerin für meinen Vater sein könnte. Es gab da Meinungsverschiedenheiten, über die ich nicht gern sprechen möchte.«
»Das brauchen Sie auch nicht«, sagte Dr. Dietsch. »Als Arzt und Inhaber dieser Klinik ist nur Frau Hammilton als Patientin für mich von Interesse.«
»Ich lernte Bettina erst vor drei Monaten kennen. Sie hatte in der Schweiz gelebt und war von Professor Gellinger betreut worden. Sie war in ausgezeichneter Verfassung, als mein Vater mich ersuchte, die weitere Betreuung zu übernehmen. Er hat es ja auch arrangiert, dass ich als Belegarzt zu Ihnen kam. Es war zur Versöhnung zwischen uns gekommen. Mein Gott, ich wollte keine Feindseligkeit aufkommen lassen, und ich hatte auch keinen Grund, mich über meinen Vater zu beklagen. Bettina war reizend, aber irgendwie auch nicht glücklich, wie es schien. Sie hatte sich von ihrer Ehe wohl mehr versprochen. Conny war selten zu Hause, das machte ihr zu schaffen.«
»Sie hat also nicht darüber gesprochen, welchen Arzt oder welche Ärzte sie konsultierte, bevor sie von Professor Gellinger betreut wurde?«, warf Dr. Dietsch ein.
»Nein. Es gab keinen anderen Arzt, jedenfalls weiß ich davon nichts.« Dr. Bernulf sah Dr. Dietsch offen an. »War sie vorher bei einem anderen Kollegen in Behandlung?«
»Es könnte möglich sein«, erwiderte Dr. Dietsch ausweichend. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir alles sagen würden, was Sie wissen.«
»Das ist schwierig. Ich bin da meinem Vater verpflichtet«, erwiderte der Jüngere. »Es war ja nur eine Vermutung von ihm, dass Bettina nicht ganz gesund gewesen sein könnte, schon bevor sie heiratete. Ich bin da in einen Teufelskreis geraten. Jetzt wird es mir ganz bewusst.«
»Es gibt immer einen Ausweg, Herr Bernulf«, sagte Dr. Dietsch.
»Immer? Ich weiß nicht. Sie haben mehr Erfahrung als ich, aber ich habe in der letzten Zeit manchmal das Gefühl gehabt, dass Professor Gellinger die Verantwortung von sich abwälzen wollte. Ich habe mich auch schon mit ihm in Verbindung gesetzt.«
»Und was hat er gesagt?«
»Dass die Beschwerden wohl aus dem psychischen Bereich kämen, da die Ehe nicht sonderlich harmonisch verlaufe.«
»Stimmt das?«
»Ich kann es nicht beurteilen, da ich Conny kaum kenne. Er ist beruflich sehr engagiert. Männer wie er sollten nicht so früh heiraten, aber das Kind war wohl der Grund. Und Bettina ist diesbezüglich sehr verklemmt. Ihre Mutter sollte es wohl nicht wissen, dass sie schon schwanger war, als sie heiratete. Sie hat sich da in etwas hineingesteigert, was zwangsläufig Konflikte hervorrufen musste.«
Dr. Dietsch überlegte, denn Jonas Bernulf tat ihm jetzt aufrichtig leid. Der junge Kollege saß zwischen zwei Stühlen.
»Setzen wir uns doch«, schlug er vor. »Wir müssen wenigstens versuchen, die Ursache dieser Psychose zu enträtseln.«
»Aber wie?«, fragte Dr. Bernulf.
»Nehmen wir einmal an, es zeigte sich bei Frau Hammilton schon bei Beginn der Schwangerschaft ein Krankheitsbild, vielleicht sogar schon vorher. Es kann – es könnte möglich sein, dass ein Gynäkologe ihr demzufolge zu einem Schwangerschaftsabbruch riet, sie diesen Rat aber nicht befolgen wollte. Sie ging zu einem anderen Arzt, und der sagte das Gegenteil. Das soll es ja geben. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, bitte, verstehen Sie mich richtig.«
»Mein Vater bat mich, Bettina zu betreuen«, sagte Dr. Bernulf nach längeren Schweigeminuten. »Sie lebt jetzt auch bei meinen Eltern. Das heißt, bis sie in die Klinik kam. Conny hat sich damit einverstanden erklärt.«
»Ist ihm seine Frau gleichgültig?«, fragte Dr. Dietsch.
»Er ist der Ehe einfach nicht gewachsen, glaube ich, und Bettina war sehr launisch in letzter Zeit.« Er schwieg sekundenlang, dann meinte er: »Aber ich sollte das wohl nicht alles sagen.«
»Aber wir wollen doch gemeinsam einen Weg finden, um Frau Hammilton zu helfen«, meinte Dr. Dietsch. »Ich hatte den Eindruck, dass sie Ihnen sehr zugetan ist.«
»Mir ist das etwas peinlich. Es könnte falsch gedeutet werden«, sagte er leise. »Ich wollte nur meinem Vater diesen Gefallen erweisen. Wenn ich ehrlich sein darf, muss ich sagen, dass ich Bettina auch nicht lange ertragen könnte. Sie ist zu exzentrisch.«
»Ihnen gegenüber hat Frau Hammilton keine Beschwerden geäußert?«, fragte Dr. Dietsch.
»Nein, auch wenn Sie es mir jetzt nicht glauben. Sie war immer in bester Laune, wenn sie zu mir kam. Wir sind auch manchmal zum Essen gegangen, und da war sie immer in guter Verfassung.« Er senkte den Blick. »Sie beschwerte sich nur über ihren Mann und ließ manchmal durchblicken, dass sie sich mit mir viel besser verstünde. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich ihr zu solchen Regungen keinen Anlass gegeben habe. Ich möchte es deshalb betonen, weil ich mich mit Katrin sehr gut verstehe, Herr Kollege. Es würde mir gar nicht behagen, wenn Sie auf abwegige Gedanken kommen würden.«
Er straffte sich und sah Dr. Dietsch wieder offen an. »Ich hege keine Gefühle für Bettina Hammilton. Sie ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, wenn ich es so ausdrücken darf, aber ich kann doch nicht sagen, dass sie nicht normal ist. Ich bin kein Psychiater.«
»Vielleicht ist es nicht die Psyche, sondern das Zentralnervensystem«, deutete Dr. Dietsch nun an.
Dr. Bernulf starrte ihn betroffen an. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte er heiser.
»Ich möchte mich darüber noch nicht äußern. Gestatten Sie mir bitte, dass ich mich mit Frau Hammilton näher befasse.«
»Von mir aus herzlich gern. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Es bleibt nur die Frage, wie sie reagieren wird.«
»Sie müssen doch Ihre Sprechstunden abhalten. Wie mir Schwester Ilse sagte, hat Frau Hammilton heute auch schon auf sie geschimpft. Sie hatte einen schlimmen Ausbruch. Um es drastisch zu sagen, sie hat gekeift, dass man es auf dem Gang hörte. Ich hatte gerade Besuch von einer Studienfreundin, sie ist mit einem Gynäkologen verheiratet. Sie haben sicher schon von Dr. Laurin gehört?«
»Aber ja. Er ist ein sehr bekannter Kollege«, sagte Dr. Bernulf.
»Antonia Laurin ist Ärztin. Das heißt, sie ist jetzt Ehefrau und Mutter, aber sie hat nicht vergessen, was sie gelernt hat, und ich bat sie, einige Babys zu untersuchen.«
»Auch Bettinas?«, fragte Dr. Bernulf.
»Sie hat es sich angeschaut. Das Baby ist in Ordnung. Daran hegte ich auch keinen Zweifel, Herr Bernulf. Aber Frau Hammilton bereitet auch mir Sorgen.«
»Und mir erst«, seufzte der Jüngere. »Aber ich weiß nicht, wie ich es meinem Vater beibringen soll – und vor allem seiner Frau. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann und dass Sie Verständnis für meine Sorgen haben.«
»Ich werde mich mit Frau Hammilton befassen, wenn sie ansprechbar ist«, erklärte Dr. Dietsch.
»Dann machen Sie ihr Komplimente, um überhaupt etwas zu erreichen.« Er machte eine kleine Pause. »Und noch eine Frage hätte ich, die mich persönlich betrifft.«
»Bitte.«
»Dürfte ich Ihre Tochter zu einem Konzert einladen?«
»Fragen Sie Katrin. Sie geht zwar noch zur Schule, aber mündig ist sie ja nach dem Gesetz«, erwiderte Dr. Dietsch zurückhaltend.
Er hatte nichts gegen Jonas Bernulf. Er wusste, dass Katrin viel für den jungen Arzt übrig hatte. Ihm selbst erschien augenblicklich der Altersunterschied noch etwas zu groß, aber er war ein sehr toleranter Vater und wusste, dass man letztlich doch nichts ändern konnte, wenn es um ernste Gefühle ging.
Katrin war ein vernünftiges Mädchen. Sie hatte schon recht bewusst miterlebt, woran die Ehe ihrer Eltern gescheitert war, und sie hatte ganz die Partei ihres Vaters ergriffen. Sie würde natürlich glücklich sein, wenn Dr. Bernulf sie einlud.
Gegen fünf Uhr rief Dr. Dietsch Antonia Laurin an. Sie war schon eine halbe Stunde daheim und hörte nun voller Spannung, was er ihr zu berichten hatte.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Robert«, sagte sie, und das vernahm die kleine Kyra.
»Wer ist Robert, Mami?«, fragte sie eifersüchtig. »Papi mag bestimmt nicht, dass du mit fremden Herren telefonierst.«
»O doch, in diesem Fall wird er sich nur freuen, mein Schätzchen«, sagte Antonia, und deshalb erfuhr Leon es gleich aus dem Mund seiner Jüngsten, als er heimkam.
»Mami hat mit einem Robert telefoniert, und du wirst dich darüber freuen, hat sie gesagt«, verriet Kyra eifrig.
»Robert?«, wiederholte Leon fragend.
»Robert Dietsch«, sagte Antonia rasch, um ihm jedes Überlegen zu ersparen.
Seine Augen weiteten sich. »Eigentlich hätte ich es mir denken können, dass du da gleich nachhakst, Antonia«, sagte er.
»Und ich habe sehr viel erfahren«, erklärte sie.
*
Viel mehr erfuhr Dr. Dietsch an diesem Tag nicht mehr, aber er konnte sich ein etwas besseres Bild über Bettina Hammilton machen, als sie erwacht war. Sie wurde nicht aggressiv, sondern machte eher einen apathischen Eindruck.
»Warum kommt Jonas nicht?«, fragte sie müde, als sich Dr. Dietsch zu ihr ans Bett setzte.
»Er war hier, als Sie schliefen. Er hat jetzt noch Sprechstunde und ist unabkömmlich.«
Nun wurde sie schon wieder unwillig. »Er soll sich um mich kümmern. Sein Vater hat es ihm befohlen.«
»Er hat noch andere Patientinnen«, erklärte Dr. Dietsch freundlich.
»Ich bin wichtiger.« Sehr deutlich war herauszuhören, wie wichtig sie sich nahm.
»Möchten Sie Ihr Baby sehen, Frau Hammilton?«, fragte Dr. Dietsch ablenkend.
»Nein, mir geht es nicht gut. Ich kann mich kaum bewegen.«
Dr. Bernulf hatte gesagt, dass er ihr Komplimente machen solle, doch das fiel Dr. Dietsch nicht leicht, denn Bettina sah im Moment nicht anziehend aus.
Konnte sie seine Gedanken erraten? »Ich möchte einen Spiegel haben«, sagte sie gereizt. »Diese dumme Person hat ihn weggenommen.«
»Sie sehen ganz reizend aus«, erklärte er nun mit einem erzwungenen Lächeln.
Ihr Blick belebte sich sofort. »Aber meine Frisur ist hin«, murmelte sie. »Ich bin gewöhnt, dass mein Haar jeden zweiten Tag gewaschen wird.«
»Jetzt geht es doch auch mal so«, sagte er.
Wie ein trotziges Kind führte sie sich auf, wie ein gefährlich bockiges Kind. Dr. Dietsch nahm sich vor, mit Constantin Hammilton zu sprechen, vor allem im Interesse der Kranken.
*
Dr. Leon Laurin hegte auch diesen Wunsch, und er sollte ihm erfüllt werden, ohne dass er selbst etwas dazu tat. Constantin Hammilton meldete sich zu einem Besuch bei ihm an, schon drei Tage später.
Dr. Laurin war erschrocken, als er kam, so sehr hatte er sich verändert. Der jungenhafte Sonnyboy war ein reifer Mann geworden, die strahlenden Augen waren düster.
»Dr. Dietsch hat mit mir gesprochen«, erklärte er ohne Umschweife, »aber mit Ihnen kann ich offener sprechen, Herr Dr. Laurin. Sie wissen ja, wie alles anfing.«
»Und wie ging es weiter?«, fragte Dr. Laurin sehr direkt. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu mir gekommen sind, das möchte ich vorwegschicken.«
»Ich muss Ihnen dankbar sein, dass Sie mir damals schon diese Andeutungen machten. Leider sind nicht alle Ärzte so verantwortungsbewusst. Ich bin nämlich überzeugt, dass auch Professor Gellinger – der übrigens ein persönlicher Freund von Herrn Bernulf ist – recht genau wusste, wie es um Bettina bestellt ist. Er hat sich nur gescheut, die Wahrheit zu sagen, und er scheute sich auch, die weitere Verantwortung zu übernehmen. Die wurde dann Jonas aufgeladen, der viel zu jung und unerfahren ist, um Bettinas Zustand zu durchschauen. Ich will nichts gegen ihn sagen, er ist sehr nett, aber er wurde von meiner Schwiegermutter überrollt. Sie denkt ja nicht daran zuzugeben, dass Bettina früher auch schon seltsame Anfälle hatte.«
»Vielleicht hatte sie solche auch gar nicht«, wandte Dr. Laurin ein.
»Doch, sie hatte welche«, erwiderte Constantin. »Ich habe mit einer Hausangestellten gesprochen und auch mit einer Freundin von Bettina. Sie hatte öfter unter Schwächeanfällen zu leiden, und wenn sie einmal ihren Kopf nicht durchsetzen konnte, fiel sie in Ohnmacht. Das war nicht gespielt. Sie war manchmal ziemlich lange bewusstlos. Ja, das alles habe ich herausgefunden. Ich habe allerdings mit den Beteiligten nicht über den Grund für mein Interesse gesprochen. Ich will auch nicht schildern, wie Bettina sich aufgeführt hat. Sie kann ja nichts dafür, sie ist krank, und Sie haben dies genau erkannt, Herr Dr. Laurin. Ich habe versucht, mit meiner Schwiegermutter zu sprechen, doch sie hat böse reagiert. Sie hat auch dafür gesorgt, dass Bettina nicht mehr zu Ihnen kam, sie hat sie gleich zu Gellinger in die Schweiz gebracht. Und dort blieb sie auch bis zum sechsten Monat. Dann ging es ihr tatsächlich besser. Ich schöpfte Hoffnung. Sie hielt mir dann vor, dass Jonas sie halt viel besser verstünde als ich und dies zu ihrem seelischen Wohlbefinden beitrüge. Gestern hat sie mir auch klipp und klar erklärt, dass sie sich von mir scheiden lassen und Jonas heiraten würde.«
»Und er ist damit einverstanden?«
»Nein, allerdings forciert meine Schwiegermutter dieses Vorhaben. Ich bin gespannt, was bei der heutigen Unterredung zwischen Jonas, seinem Vater und Charlotte herauskommen wird. Ich bin jetzt jedenfalls so weit, dass ich es nervlich nicht mehr verkrafte, meinem Beruf gerecht zu werden. Ich wurde kaltgestellt.«
»Entlassen?«, fragte Dr. Laurin erschrocken.
»Nein, das nicht, an den Schreibtisch versetzt. Aber ansonsten ist mir alles gleichgültig. So schrecklich es klingen mag, aber ich sehne diese Trennung herbei.«
»Und das Kind?«
»Es tut mir leid, von Herzen leid. Ich begreife nur nicht, dass man nun auch Jonas ins Unglück stürzen will.«
»Er ist ein Mann, und er ist Arzt. Er wird verstehen, sich zu wehren«, sagte Dr. Laurin.
»Ich kann es nur hoffen. Ich mag ihn. Jedenfalls hatten Sie recht, wenn es auch sonst niemand zugeben will – Dr. Dietsch ausgenommen.«
Dr. Laurin überlegte. »Und wenn es nun doch nicht zu einer Scheidung kommt?«, fragte er.
»Ich weiß nicht, was ich dann tue. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Chance, mit einer Maschine abzustürzen.«
»Solchen Gedanken dürfen Sie keinen Raum geben«, erklärte Leon Laurin eindringlich.
»Was würden Sie in meinem Fall tun? Leider, ohne zu klagen? Mein Gott, ich werde nie mehr eine Frau anrühren nach diesen Erfahrungen. Bettina hat mich mit dem Kind geködert. Hätte ich sie nur früher durchschaut. Aber schließlich muss man wohl für jede Dummheit bezahlen«, sagte er bitter. »Verstehen Sie mich bitte, sie tut mir leid, aber es ist schrecklich, dass ich zum Prügelknaben gemacht werde, der an allem schuld sein soll. Durch mich ist sie doch nicht krank geworden. Ich habe auch ganz vorsichtig versucht, meiner Schwiegermutter klarzumachen, warum Bettina das Kind besser nicht bekommen sollte, aber was habe ich zu hören bekommen? Ich wäre ein Schuft, ich hätte Bettina seelisch ruiniert. Ich hätte sie krank gemacht. Man wüsste ja nicht, mit was für Frauen ich mich abgegeben und welche Krankheiten ich aufgefangen hätte, mit denen sie dann angesteckt worden wäre. Deshalb möchte ich, dass ich jetzt nochmals gründlich untersucht werde, Herr Dr. Laurin. Ich lasse den Verdacht nicht auf mir sitzen, dass ich Bettinas Zustand verschuldet habe.«
»Aber Sie standen doch ständig unter ärztlicher Kontrolle«, warf Dr. Laurin ein.
»Natürlich, aber dieses bornierte Weib – damit meine ich meine Schwiegermutter – denkt darüber nicht nach. Ich hege den Verdacht, dass sie auch einen Defekt hat, um es drastisch zu sagen. Ein klar denkender Mensch kann doch Tatsachen nicht einfach wegzaubern wollen. Vielleicht bin ich ungerecht geworden. Aber wenn es so weitergeht, drehe ich durch.«
»Wenn Sie es wollen, spreche ich mit Dr. Sternberg, damit er Sie klinisch untersucht«, bot Dr. Laurin an.
»Ich bin einverstanden. Ich lasse mich nicht als Abfall behandeln. Danke, dass Sie mich angehört haben, Herr Doktor.«
*
Indessen hatte sich Dr. Jonas Bernulf mit Katrin Dietsch getroffen. Sie waren sich am Abend zuvor bei dem gemeinsamen Konzertbesuch schon sehr nahe gekommen, und Jonas war sich gewiss, dass er mit Katrin, so jung sie auch noch war, über seine Probleme sprechen konnte.
Es war Mittwoch. Er hatte nachmittags keine Sprechstunde. Allerdings hatte er Bettina besuch und stand noch unter diesem deprimierenden Eindruck. Und er hatte die Unterredung mit seinem Vater und Bettinas Mutter vor Augen, die am Abend stattfinden sollte.
Er hatte Katrin angerufen und sie um ein Gespräch gebeten. Sie war sofort dazu bereit gewesen.
Katrin war ein Mädchen, so klar wie eine Quelle und auch so springlebendig, so herzerfrischend in ihrer Natürlichkeit, dass ein Vergleich mit Bettina überhaupt nicht möglich war.
Sie war genau vom gleichen Typ wie Maria Dorn, und man hätte sie leicht für deren Tochter halten können, nur war ihr Gesicht nicht rund, sondern herzförmig, aber ihre violetten Augen, das feine Näschen, das aschblonde Haar machten sie Maria ähnlich, und vielleicht war das auch der Grund, warum ihr Vater Maria so sehr mochte.
Dr. Jonas Bernulf kannte Maria nicht, und er hätte Katrin auch mit keinem anderen Menschen vergleichen wollen. Für ihn war sie eine Offenbarung in ihrer unkomplizierten Frische, da er sich selbst in einem Stadium innerer Zerrissenheit befand und mit niemandem sonst offen sprechen konnte. Mit Katrin konnte er das.
Sie kam lächelnd auf ihn zu. Er nahm ihre Hände und presste sie an seine Brust.
»Ich liebe dich, Katrin«, sagte er leise, »das muss ich sagen, bevor ich das andere loswerde.«
»Ich liebe dich auch, Jonas«, erwiderte sie offen und küsste ihn zart. Das war in diesem Augenblick das größte Glück für ihn, und er wollte dieses Glück festhalten.
»Nun sag mir, was dich bedrückt«, flüsterte sie, als er sie so festhielt, als wolle er sie nie mehr loslassen.
»Das ist nicht so einfach.«
»Probleme sind nie einfach, sonst wären es keine Probleme«, erwiderte Katrin. »Sprich nur frei von der Leber weg. Ich höre zu und sage dir, was ich davon halte. So habe ich es mit Vati damals immer gemacht, als Mama alles kaputt machte. Du hast doch mit Vati keinen Ärger?«
»Nein, aber mit ihm kann ich nicht so sprechen wie mit dir«, erwiderte Jonas.
»Darauf bilde ich mir jetzt aber etwas ein«, sagte sie schelmisch.
»Es ist keine hübsche Geschichte, Katrin. Es geht darum, dass Bettina sich scheiden lassen und mich heiraten will. Und ihre Mutter will das auch.«
»Und du?«, fragte Katrin beklommen. »Willst du es auch?«
»Dann würde ich dich doch nicht um Rat fragen.«
»Ich soll dir raten? Aber du bist doch viel klüger als ich.«
»Eben nicht«, erwiderte er. »Ich will dich heiraten.«
»Und das findest du nicht klug?«
»Ich möchte wissen, was du dazu sagst. Davon hängt alles ab. Du bist noch so jung.«
»Ich verstehe das nicht ganz«, sagte Katrin ruhig. »Wenn ich nein sagte – würdest du dann Bettina heiraten?«
»Nein, das würde ich nicht, aber wenn du ja sagen würdest, könnte ich es mir einfacher machen und erklären, dass ich bereits einem Mädchen die Heirat versprochen habe.«
»Was Männer doch so manchmal denken«, lachte Katrin. »Du bist kein Feigling.«
»Vielleicht doch. Ich muss die Wahrheit sagen, und die ist hart, Katrin. Sie ist hart für Bettinas Mutter und auch hart für meinen Vater. Ich werde es dir erklären. Bettina ist krank. Sie leidet an einer Störung des Zentralnervensystems. Weißt du, was das bedeutet?«
Katrin blieb stehen. »Ich bin die Tochter eines Arztes«, sagte sie leise, »und ich will Medizin studieren. Ist es MS?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, sie daraufhin zu untersuchen. Das müsste ein Neurologe tun. Ich dürfte mit dir eigentlich auch gar nicht darüber sprechen, Katrin.«
»Ich rede nicht darüber, Jonas.«
»Charlotte will nicht wahrhaben, dass ihre Tochter krank ist. Sie würde es niemals wahrhaben wollen. Und mein Vater hängt an ihr. Heute Abend haben wir eine Aussprache. Sie wird nicht so verlaufen, wie mein Vater und Charlotte es wohl erwarten. Aber für mich kann es bedeuten, dass man mich fallen lässt, und dann muss ich von vorn anfangen. Es würde auch bedeuten, dass ich noch einige Jahre brauche, um auf eigenen Füßen zu stehen.«
»Na und, was ist daran schlimm?«, fragte Katrin. »Inzwischen studiere ich, und Vati wird dich bestimmt nicht fallen lassen. Du kannst dich auf ihn verlassen.«
»Das will ich aber nicht.«
»Sei doch nicht dumm. Er wirft dir schon nichts nach, im Gegenteil, er wird dafür allerhand verlangen. Du musst dir dein Geld verdienen. In vier bis fünf Jahren bin ich fertig und …«
»Und ich bin dann sechsunddreißig«, warf er ein. »Und du hast wahrscheinlich bis dahin einen jungen Mann kennengelernt, der dir mehr bedeutet.«
»Wenn du so denkst, brauchen wir gar nicht weiterzureden«, sagte sie. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich liebe.«
»Weiß man das, wenn man erst achtzehn ist?«
»Ich weiß es. Ob andere es wissen, interessiert mich nicht. Und mich interessiert auch nicht, was du verdienst. Mich würdest du aber sehr enttäuschen, wenn du um des Geldes willen Zugeständnisse machen würdest, die charakterlos sind.«
»Ich mache keine Zugeständnisse«, sagte Jonas ruhig. »Es wird nur alles leichter für mich, wenn ich weiß, dass du zu mir hältst.«
»Ich bin stur«, meinte Katrin mit einem kleinen Lächeln. »Wenn du mich nicht heiratest, werde ich eine alte Jungfer. Aber eines sage ich dir, Jonas. Ich würde dich niemals heiraten, wenn ich vorher ein Kind bekäme. Das sieht immer nach Erpressung aus.«
»Nicht immer, wenn man sich liebt«, sagte er leise.
»Wenn man sich liebt, kann man auch warten. In dieser Beziehung bin ich altmodisch. Und wenn man sich liebt, braucht man auch nicht gleich alles zu haben – das meine ich jetzt in Bezug auf das Materielle. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar.«
Sie verstand es, ihn aufzumuntern. Sie war umwerfend in ihrer Frische.
»Und wie stünde ich denn vor deinem Vater da?«, fragte er.
»Ach, Vati ist souverän. Und er weiß auch, was er von mir zu halten hat. Er ist einmal in eine Falle getappt, da war er noch sehr jung. Mama hatte sich alles so schön ausgerechnet. Er würde die Klinik erben und etwas darstellen. Sie hat nicht damit gerechnet, dass Vati sehr würde kämpfen und arbeiten müssen, um die Klinik zu halten. Mama wollte alles auf einmal, und sie hat Vati überhaupt nicht verstanden. Sie war nur attraktiv, wenn du begreifst, was ich damit sagen will. Und Bettina war wohl auch ziemlich attraktiv und hat sich so Conny Hammilton geangelt. Einen Testpiloten würde ich nicht heiraten.«
»Und wenn ich nun einer wäre?«, fragte Jonas.
Sie sah ihn an. »Kluge Frage, Jonas. Ja, vielleicht würde ich in diesem Fall eine Ausnahme machen. Er scheint ja auch ein recht netter Mensch zu sein. Über Bettina kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich weiß, dass Vati sich viel mit ihr beschäftigt, mit ihrem Fall, meine ich. Er wälzt dicke Bücher über ZNS und MS, aber viel wird dabei nicht herauskommen. Über diese Krankheiten haben sich schon andere die Köpfe zerbrochen, die sich viele Jahre damit beschäftigt haben. Es ist schrecklich für die Betroffenen, aber da kann man nur den Tatsachen ins Auge blicken und darf nicht erwarten, dass Gesunde sich opfern.«
»Was würdest du sagen, wenn du an meiner Stelle wärest?«
»Ich weiß es nicht, Jonas, aber wenn sie von dir verlangen, dass du dich opferst, müsste ich sie verachten. Es tut mir leid.«
»Es braucht dir nicht leidtun, Katrin. Ich bin sehr froh, dass ich den Mut hatte, mit dir über alles zu sprechen.«
»Wenn man sich liebt, sollte das doch ganz einfach sein«, erklärte das Mädchen. »Aber Liebe ist wohl doch nicht einfach. Man muss sie immer ernst nehmen. es bedeutet ja nicht nur, zusammen zu sein und sich zu küssen. Es bedeutet sehr viel mehr.« Sie legte ihre Hände um sein Gesicht. »Es bedeutet alles«, flüsterte sie.
*
So hatte Bettina nicht gedacht, als sie ihrer Mutter sagte, dass sie Conny heiraten wolle. Sie gönnte ihn keiner anderen. Sie wusste, dass die Frauen hinter ihm her waren.
»Er bindet sich nicht«, hatte einmal ein Kollege von ihm gesagt. »So dumm ist er nicht.« Und Bettina hatte es gehört. Das hatte sie aufgestachelt. Und noch mehr die Worte, die auf diese Bemerkung folgten. »Das muss schon eine ganz besondere Frau sein, die Conny mal zum Standesamt bringt.«
Sie hatte es geschafft, sie konnte diesen Triumph für sich verbuchen.
»Du könntest eine andere Partie machen«, hatte ihre Mutter gesagt. »Warum muss es ein Pilot sein?«
Aber jeder Widerstand hatte Bettina schon immer gereizt. Ihren Willen wollte sie durchsetzen, sonst nichts. Ihren Willen hatte sie auch durchgesetzt, als ihre Mutter zögerte, sich nochmals zu verheiraten. Sie hatte ja immer Rücksicht auf ihre Tochter genommen, wissend, zu welchen Ausbrüchen Bettina neigte.
Charlotte war an dem Abend, an dem die Aussprache mit Jonas Bernulf junior stattfinden sollte, sehr müde und abgespannt. Früher hatte sie solche Schwächen nicht gekannt, erst seit einiger Zeit litt sie unter ständiger Müdigkeit.
»Ich würde mich gern niederlegen, Jonas«, sagte sie zu ihrem Mann. »Du kannst doch allein mit deinem Sohn sprechen.«
»Ich möchte, dass du dabei bist, Charlotte«, sagte er. »Es geht schließlich um deine Tochter.«
»Warum betonst du das immer so?«, fragte sie ungehalten.
»Tue ich das? Du sprichst doch auch nur von ›meinem‹ Sohn.«
»Warum bist du so gereizt?«, fragte sie.
»Weil mir deine Pläne nicht gefallen. Ich finde sie unfair.«
»Inwiefern?«, fragte sie herablassend.
»Gegen Constantin und auch gegen Jonas.«
»Aber Jonas liebt Bettina. Er kümmert sich um sie. Constantin hingegen tut das nicht. Er möchte sich am liebsten davonstehlen. Er hat für das Kind nichts übrig«, sagte Charlotte klagend.
Da läutete es, Jonas kam. Charlotte musste jetzt bleiben. Sie begrüßte ihn dann so überschwänglich freundlich, dass Jonas Bernulf, der Ältere, erstarrte.
Der Jüngere wunderte sich ebenfalls. »Da bin ich also«, sagte er rau.
»Ich bin so froh, dass du kommst, Jonny«, sagte Charlotte, doch diese Verniedlichung ihres Namens mochten weder Vater noch Sohn, und zu dieser Stunde waren beide fast peinlich berührt, denn Conny und Jonny war ihnen zu ähnlich. Aber Charlotte wurde sich dessen nicht bewusst. »Mit dir kann ich reden, du verstehst mich, weil du meine Bettina verstehst«, fuhr sie exaltiert fort.
»Ich verstehe, dass du deine Tochter liebst«, erwiderte Jonas ruhig, und dabei blickte er seinen Vater an, dessen Gesicht sich verdüstert hatte.
»Du liebst sie doch auch«, sagte Charlotte. »Bettina hat es mir vorhin gesagt. Oh, warum musste sie diese Ehe eingehen, die alles so erschwert?«
In Jonas’ Gesicht arbeitete es. Sein Vater hatte sich abgewandt und ging zur Tür. »Was möchtest du trinken, Jon?«, fragte er.
»Einen Whisky, Vater, einen doppelten, wenn ihr nichts dagegen habt.«
Es kam nur selten vor, dass er Whisky trank, aber ihn fror es innerlich, obwohl es im Haus sehr warm war.
»Ich trinke meinen Piccolo«, sagte Charlotte.
»Ja, ich weiß«, sagte der ältere Jonas rau. »Morgens, mittags, abends.«
Mein Gott, dachte Jonas, der Jüngere, wie soll das alles nur enden? Zwischen den beiden stimmt es doch auch nicht mehr.
Sie saßen in den niedrigen Sesseln um den Glastisch, den Charlotte liebte und den beide Männer nicht leiden mochten.
»Ich möchte auch etwas erklären, damit nicht noch mehr Missverständnisse aufkommen«, begann Jonas, nachdem er einen langen Schluck heruntergespült hatte. »Ich hatte nie die Absicht, Bettina zu heiraten. Ich liebe ein anderes Mädchen.«
Charlotte zuckte zusammen und setzte ihr Glas ab. Es klirrte. »Das begreife ich nicht«, stotterte sie.
»Du begreifst manches nicht, Charlotte«, antwortete der junge Mann. »Und einiges willst du nicht begreifen. Dafür habe ich Verständnis.«
»Aber Bettina sagte doch, dass zwischen euch alles klar ist«, begehrte sie auf.
»Hast du dir eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, dass es mehr als eigenartig ist, wenn eine Frau sich etwas einredet, obwohl sie gerade das Kind eines anderen zur Welt gebracht hat? Es tut mir sehr leid, wenn du dich dadurch gekränkt fühlst, Charlotte, aber ich habe nur Mitleid mit Bettina.«
»Mitleid? Mitleid mit meiner Tochter? Wie findest du das, Jonas?«, richtete sie das Wort an ihren Mann, und ihre Stimme überschlug sich dabei.
»Du kannst meinen Sohn nicht zwingen, dieses Spiel mitzumachen, Charlotte«, sagte er. »Jon wird sich jetzt auch seine eigene Meinung gebildet haben, und was Dr. Laurin damals gesagt hat, mag nicht so abwegig sein.«
Charlotte sank in sich zusammen. »Ich bin doch bereit, jedes Opfer zu bringen, aber ihr seid nicht bereit«, flüsterte sie. »Ihr tut doch nichts, was ihr helfen könnte.«
»Das hast du auch nicht getan, Charlotte«, meinte Jonas mit fester Stimme. »Bettina wollte das Kind doch nur, um Conny an sich zu binden. Sie war bereits schwanger, als die Hochzeit stattfand.«
»Das ist nicht wahr«, widersprach Charlotte heftig.
»Rechne doch nach. Ich habe mich zunächst auch täuschen lassen. Gellinger vielleicht auch. Vielleicht hat er sich aber auch seine Gedanken gemacht und mehr gewusst, als er zugeben wollte. Herrgott, es ist doch nicht unverzeihlich, wenn man schon vor der Heirat ein Kind erwartet.«
»Conny ist schuld, nur er!«, stieß Charlotte hervor. »Niemals hätte sich Bettina ihm freiwillig hingegeben.«
»Tu nicht päpstlicher als der Papst«, sagte der ältere Bernulf. »So genau hast du es auch nicht genommen, Charlotte. Wir wollen jetzt mal hübsch bei den Tatsachen bleiben. Ich will nicht, dass mein Sohn sein Leben ruiniert, nur weil Bettina ihn jetzt unbedingt haben will.«
»Ich habe nichts mehr zu sagen«, stieß Charlotte hervor. »Ich gehe zu Bett.«
»Du bleibst!«, sagte ihr Mann. »Jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt. Du kannst dich nicht drücken. Setz dich wieder!«
Sie setzte sich, denn so hart hatte er sie noch niemals angesprochen.
Er fuhr fort: »Bettina kam damals zu dir und hat gesagt, dass sie Conny heiraten wolle. Du warst zunächst dagegen, aber sie hat geheult und gejammert, und du hast wie immer nachgegeben, obwohl ich auch gegen diese Heirat war. Du hast mich angefleht, Bettina eine schöne Hochzeit auszustatten. Das habe ich getan. Jedenfalls hast du dann nichts mehr gegen Conny einzuwenden gehabt. Stimmt’s? Natürlich darf ich nicht vergessen, dass Bettina in Ohnmacht fiel, als ich zuerst nein sagte.«
»Willst du jetzt mich anklagen, Jonas?«, jammerte Charlotte.
»Ich klage niemanden an. Ich zähle Tatsachen auf, weil es jetzt nicht nur um Bettina geht, sondern auch um Jon. Ich habe dir bisher jeden Wunsch erfüllt – und Bettina auch. Sie wollte ihren Conny, sie hat ihn bekommen. Und dann kam sie daher und erzählte uns glücklich, dass sie ein Kind erwartet, und ich habe mich gefreut. Doch dann kam Conny und teilte uns sehr dezent und diplomatisch mit, dass Dr. Laurin seine Bedenken hätte wegen Bettinas labilem Zustand. Daraufhin wolltest du ihn gleich anzeigen, aber du hast es nicht getan. Stattdessen haben wir Bettina zu Gellinger gebracht.«
»Und er sagte, dass es gut wäre, wenn sie ein Kind bekommen würde.«
»Ja, das sagte er. Er schloss aber nicht aus, dass Bettinas Zustand diffizil sei. Er wollte von dir wissen, wie ihre Pubertät verlaufen sei. Du sagtest, dass sie niemals Schwierigkeiten gehabt hätte, aber sie hatte Schwierigkeiten. Ich weiß es von eurer Hanna.«
»Hanna ist dumm und ungebildet«, begehrte Charlotte auf.
»Lass jetzt diese Ausreden«, fauchte er sie an.
»Ich habe auch mit Bettinas Freundin Sibylle gesprochen«, warf Jon ein. »Sie hat mir berichtet, dass Bettina manchmal von Sekunde zu Sekunde abschlaffte oder völlig unmotiviert einen hysterischen Ausbruch bekam. Versteh doch, Charlotte, wir können ihr nur helfen, wenn wir die ganze Wahrheit wissen.«
»Ich wusste sie doch auch nicht«, weinte Charlotte auf. »Ich konnte mir das alles nicht erklären. Bettina war immer sensibel. Kein Arzt sagte mir, was der Grund dafür sein könnte. In der Pubertät sind Mädchen oft sehr eigenartig.«
»Beruhige dich, Charlotte«, sagte Jonas Bernulf, »niemand will dir was. Wir alle wollen Bettina helfen, aber es sollen nicht noch mehr Menschen zerbrechen. Jon wird uns erklären, was er herausgefunden hat.«
»Ich habe nichts herausgefunden, aber Dr. Dietsch vertritt die gleiche Meinung wie Dr. Laurin. Bettina leidet an einer Störung des Zentralnervensystems. Durch die Schwangerschaft, die eine Veränderung der Hormonbildung mit sich bringt, hat sich ihr Zustand verschlechtert. Ihre Reaktionen sind jetzt schon anormal.«
»Was soll das bedeuten?«, fragte Charlotte entsetzt.
»Es kann bedeuten, dass sie unter schweren Gleichgewichtsstörungen leiden wird, dass sie sich nicht mehr auf den Füßen halten kann. Ich will nicht zu schwarz malen, vielleicht wird es nicht gar so schlimm werden. Man muss sie physisch und psychisch stabilisieren. Aber dabei müsstest du uns in erster Linie helfen, Charlotte. Und vielleicht hilft ihr auch das Kind, wenn sie es lieben lernt. Bisher gibt es dafür keine Anzeichen. Sie zeigt kein Interesse an dem Baby. Sie will umworben werden, aber dafür bin ich das falsche Objekt. Ich kann nicht heucheln.«
Charlotte starrte ihn aus trüben Augen an.
»Aber was kann ich tun?«, fragte sie leise.
»Vor allem solltest du offen mit ihr reden. Ihr auch sagen, dass sie die Heirat mit Conny erzwungen hat. Nicht so krass, wie ich es jetzt sage, aber du könntest ihr andeuten, dass sie schon schwanger war, als sie vor den Traualtar trat.«
»Das kann ich nicht. Das ist mir unbegreiflich«, schluchzte Charlotte.
»Stell dich nicht so an, Charlotte«, sagte Jonas Bernulf, »du warst auch kein Kind von Traurigkeit. Und das ist doch alles menschlich.«
»Ich verstehe nicht, wie du über die intimsten Dinge so reden kannst«, warf sie ihm vor.
»Warum denn nicht? Was man tut, soll man auch verantworten. Ich fand dich sehr begehrenswert, und wir waren beide in einem Alter, in dem man noch nicht entsagungsvoll auf alles verzichtet, was das Leben lebenswert macht. Jedenfalls glaubte ich, dass es lebenswert ist. Zweifel kommen mir erst jetzt. Ich denke, dass du sehr viel dazu beitragen könntest, dass sich alles wieder normalisiert. Mir hängt das Herumgerede und Getue nachgerade zum Hals heraus, um es ganz deutlich zu sagen. Ich bin kein Tattergreis, und du bist eine Frau von knapp fünfundvierzig Jahren. Bettinas seltsame Krankheit ist nicht einmalig, und mag sie auch schwer ergründlich sein, werden wir damit leben müssen. Es genügt, dass Conny auch damit fertig werden muss, aber Jonas hat ein Recht, sich sein Leben besser einzurichten. Um es ganz deutlich zu sagen, Charlotte, wenn wir morgen einen bildschönen Jüngling zu Bettina schicken, wird sie sich auch einbilden, dass er der einzige Mann ist, der sie glücklich machen kann.«
»So darfst du nicht reden, Jonas.« Sie legte die Hände vors Gesicht und schluchzte.
»Wir können es ja probieren«, sagte er. »Ich will nicht nur Bettina helfen, Charlotte, sondern auch dir und damit uns, denn bald weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber vielleicht erklärt sich auch Conny bereit, uns zu helfen – um des Kindes willen. Er ist doch für Bettina viel attraktiver als Jon. Wenn du einverstanden bist, werde ich ihn darum bitten. Er ist auf Sparflamme gesetzt. Er darf nicht mehr fliegen, weil er mit den Nerven fertig ist. Aber Sandra ist sein Kind, genauso wie Bettinas Kind. Und ich glaube, ihn richtig einzuschätzen, wenn ich sage, dass er für sein Kind einiges zu tun bereit ist, wenn er sich von uns nicht angegriffen fühlen muss. Wir sollten gemeinsam alles daran setzen, Bettina zu helfen. Wie sind die Aussichten, Jon?«
»Ich kann es nicht sagen. Es müsste ein Neurologe hinzugezogen werden.«
»Ihr könnt doch nicht sagen, dass Bettina geisteskrank ist«, stöhnte Charlotte.
»Das sagt niemand, es ist das Zentralnervensystem, Charlotte«, erklärte Jon. »Medizinisch könnte ich es dir genauer erklären, aber du würdest es nicht verstehen.«
Charlotte widersprach nicht. Sie weinte haltlos, und ihr Mann tröstete sie. Er brachte sie ins Bett und gab ihr Beruhigungstropfen.
Es ängstigte ihn, als er sah, wie abhängig auch sie von Medikamenten war. Eine Vielzahl von Dosen und Fläschchen standen in der Hausapotheke, verschreibungspflichtige Medikamente, aber nie hatte Charlotte gesagt, dass sie in ärztlicher Behandlung war. Er wollte sie jedoch jetzt nicht fragen. Sie war zu erregt. Er war froh, dass das Beruhigungsmittel rasch wirkte und sie einschlief.
Er ging zu Jon in den Wohnraum zurück. Sein Sohn saß in einem Sessel, den Kopf in die Hände gestützt und starrte vor sich hin.
»Würdest du mir sagen, wie das Mädchen heißt, dass du heiraten willst?«, fragte Jonas Bernulf.
»Katrin Dietsch. Sie ist die Tochter von Dr. Dietsch.«
»Das ist doch noch ein Schulmädchen«, meinte der Ältere bestürzt.
»Sie macht jetzt ihr Abitur und wird Medizin studieren«, erwiderte Jon.
»Du bist vierzehn Jahre älter, hast du das bedacht?«
»Es macht Katrin nichts aus. Wir lieben uns, wie verstehen uns, und wir können auch warten. Wir haben uns ausgesprochen, Vater. Sie weiß alles, auch von Bettinas absurden Ideen. Zwischen uns gibt es keine Unklarheiten. Und sie würde mich nie mit einem Kind erpressen, da bin ich ganz sicher.«
»Das klingt sehr hart, Jon«, sagte sein Vater.
»Es tut mir leid, aber ich glaube, dass diese Ehe nicht zustande gekommen wäre, wenn Bettina nicht nach außen hin den Schein der Jungfräulichkeit hätte wahren wollen. Sie ist total verklemmt erzogen worden. Mir tut Conny leid.«
»Wir werden mit ihm sprechen, Junge. Ich verschließe die Augen und Ohren auch nicht mehr. Man macht auch Fehler, wenn man schon alt genug ist, um die Welt und die Menschen zu kennen. Ich will damit nicht sagen, dass ich es als einen Fehler betrachte, Charlotte geheiratet zu haben. Es war aufrichtige Zuneigung, und ich kann mich nicht beklagen. Sie ist in gewisser Weise immer noch naiv. Sie wäre auch hilflos ohne Mann. Ich hatte nie etwas für emanzipierte Frauen übrig. Es schmerzt mich, wenn sie leidet.«
»Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du sie geheiratet hast, Vater«, sagte der junge Arzt leise. »Sie liebt dich. Sie ist glücklich mit dir. Daraus entsprang wohl auch ihr Wunsch, dass Bettina mit mir auch glücklich sein könnte. Ich bin dir ja doch ziemlich ähnlich, und Conny ist aus einem anderen Holz geschnitzt.«
»Er ist auch ein Mensch mit Herz und Seele«, sagte der Ältere.
*
Drei Tage später berichtete Dr. Laurin seiner Frau Antonia, dass der Neurologe Professor Carlson bei Bettina eine beginnende Multiple Sklerose festgestellt hätte.
»Das ist entsetzlich«, flüsterte Antonia. »Und Carlson täuscht sich nicht?«
»Nein, er bestätigt nur, was ich ahnte und doch nicht wahrhaben wollte.«
»Und das Kind?«
»Das Kind ist gesund.«
»Wir reagiert der Ehemann?«, fragte Antonia stockend.
»Er ist bereit, sich mit der tragischen Tatsache abzufinden. Er hat mein Mitgefühl. Jedenfalls werde ich mich bemühen, dass ich eine Pflegerin für das Kind bekomme, denn Frau Hammilton wird es nicht versorgen können.«
»Und ihre Mutter?«
»Die würde doch nur alles noch schlimmer machen. Augenblick mal, Antonia, mir kommt da gerade etwas in den Sinn. Hast du mal wieder was von Eva Keller gehört?«
»Die letzten Wochen nicht, sie hat doch diese kanadische Familie nach Toronto begleitet. Aber sie wollte nicht für immer dort bleiben. Soll ich mich mal erkundigen? Meinst du, dass sie geeignet wäre, eine solche Aufgabe zu übernehmen?«
»Wenn nicht sie, wer sonst? Ihre Schwester ist an MS gestorben. Sie ist mit der Krankheit vertraut. Und immerhin würde sie sehr gut verdienen, denn Bernulf wird sich nicht lumpen lassen.«
»Ich erkundige mich gleich morgen«, sagte Antonia. »Aber will Herr Hammilton seine Frau denn nach Hause holen?«
»Das scheint sicher zu sein. Und ganz schlimm wird es wohl nicht gleich kommen. Es kann durchaus sein, dass sie alle Energien mobilisiert, wenn Dr. Bernulf ihr sagt, dass er Katrin Dietsch heiraten wird.«
»Das sagst du so nebenbei?«, rief Antonia aus.
»Habe ich es noch nicht gesagt?«, fragte Leon.
»Kein Wort.«
»Ich werde auch schon vergesslich. Die grauen Zellen werden müde.«
»Unsinn, sie müssen sich nur mit zu vielen Dingen beschäftigen«, lächelte Antonia. »Schalte jetzt mal ab. Paps hat eine neue Weinsendung bekommen und uns einige Flaschen spendiert. Wir werden mal eine Flasche probieren, ja?«
»Einverstanden, mein Schatz«, erwiderte Leon. »Aber ich bin sehr gespannt, was sich da alles noch tun wird.«
Dr. Jonas Bernulf war auch gespannt, und mit Zittern und Zagen betrat er an diesem Nachmittag Bettinas Krankenzimmer.
Sie begrüßte ihn nicht so freudig wie sonst. Das stimmte wiederum ihn optimistischer, denn er wusste, dass vorher Conny bei ihr gewesen war. Ein Strauß Rosen stand auf dem Tisch.
»Conny ist gerade gegangen«, sagte Bettina müde. »Er ist sehr nett, Jonas. Ich fürchte, ich bin manchmal ungerecht.«
»Das mag sein, Bettina«, erwiderte er.
»Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Jonas. In meinem Kopf geht alles durcheinander.«
»Das sind noch Nachwirkungen von der Narkose«, sagte er beruhigend.
»Manchmal denke ich, ich habe dummes Zeug geredet, und dann kann ich mich beim besten Willen gar nicht mehr daran erinnern, was ich geredet habe. Vorhin hat mir die Schwester meine Tochter Sandra gebracht. Sie ist sehr hübsch, findest du das auch?«
»Ja, sie ist wonnig.«
»Das sagt Conny auch, aber die Schwestern sind nicht sehr freundlich.«
»Sie haben viel zu tun, Bettina«, meinte er ruhig. »Sie können sich nicht nur um dich kümmern.«
»Du kannst dich auch nicht nur um mich kümmern. Ärzte sind dauernd beschäftigt. Weißt du schon, dass Conny nicht mehr fliegt?«
»Er hat es mir gesagt.«
»Es ist eigentlich rührend von ihm, dass er mir dieses Opfer bringen will. Er liebt mich anscheinend doch. Ich habe daran gezweifelt, das weißt du.«
»Ja, das weiß ich.«
»Liebst du mich auch?«, fragte sie.
»Wie eine Schwester«, erwiderte er.
»Nicht mehr und nicht weniger«, sagte sie geistesabwesend. »Ich habe es ja gespürt.«
»Ich liebe ein anderes Mädchen«, erklärte Jonas.
»Wen?«, fragte sie, sich aufrichtend.
»Katrin Dietsch, die Tochter von Dr. Dietsch.«
Sie sank zurück ins Kissen. »Ist sie hübscher als ich?«, fragte sie.
»Das kann man nicht sagen. Ich liebe sie, wie sie ist.«
»Aber sie ist keine Schönheit.«
»Nein, sie ist keine Schönheit.«
»Und ich war ja für dich immer eine verheiratete Frau, die gerade erst ein Kind bekommen hat.« Sie lachte auf. »Ich liebe dich auch nicht, Jonas. Du gefällst mir, aber man weiß ja nie, was ein Mann für Fehler hat. Also bist du mein Bruder, und Conny ist mein Mann, und ihr seid beide nett zu mir. Warum seid ihr so nett, dass ich nicht weiß, wen ich lieber haben könnte?«
Sie muss zu retten sein, dachte Jonas. Sie denkt doch eigentlich ganz klar. Sie forscht in sich selbst.
»Dich muss man doch mögen, Bettina«, erwiderte er lächelnd. »Du bist eine zauberhafte Frau, du hast ein süßes Kind und einen sehr netten Mann. Wir mögen Conny. Deine Mutter mag ihn auch.«
»Nein, sie mag ihn nicht«, widersprach Bettina aggressiv. »Sie wollte nicht, dass ich ihn heirate. Sie liebt nur deinen Vater und sein Geld. Sie liebt den Luxus.«
»Den liebst du doch auch«, entfuhr es ihm.
»Du etwa nicht?«, fragte sie hintergründig. »Würde es dir gefallen, irgendwo als Assistenzarzt herumzustopseln? Jetzt kannst du in eine Klinik einheiraten. Mich hat Conny geheiratet, obwohl ich nicht viel aufzuweisen hatte. Schließlich ist dein Vater nur der zweite Mann meiner Mutter.«
Er schluckte diese Anzüglichkeit schwer, aber er wusste ja, dass man nicht alles wörtlich nehmen durfte, was sie sagte.
»Ich würde Katrin auch heiraten, wenn sie nichts besäße«, sagte er. »Außerdem tut sich Dr. Dietsch mit der Klinik auch nicht leicht.«
»Das dachte ich mir schon«, sagte Bettina. »Da schaut die Prof.-Kayser-Klinik schon anders aus, und Dr. Laurin ist ein umwerfender Mann. Da hält man die Luft an. Warum hat Mama mich eigentlich veranlasst, nicht mehr zu ihm zu gehen? Ich denke immerzu darüber nach.«
Ihr Gesicht wurde plötzlich starr.
»Ach ja, ich erinnere mich. Dr. Laurin hat gesagt, dass ich zu zart für eine Schwangerschaft sei, aber Mama hat mir das ausgeredet. Aber er hatte sicher recht, ja, ganz sicher. Er hat es besser gewusst als ihr alle zusammen. Und Conny hat es auch gesagt. Dr. Laurin und Conny haben es geahnt, was ich durchmachen muss. Geh jetzt, Jonas. Ich möchte Dr. Laurin sprechen. Du hast überhaupt keine Erfahrung, und Professor Gellinger ist von gestern. Ich will Dr. Laurin haben!«, schrie sie. »Ich will gesund werden! Sandra ist vor zehn Tagen geboren, und ich kann mich nicht mal aufsetzen. Was habt ihr aus mir gemacht? Scher dich weg und heirate deine Katrin. Conny soll kommen, und Dr. Laurin soll kommen, und Mama soll mir nichts mehr vorheulen!«
Jonas wollte beruhigend nach ihrer Hand greifen, aber sie stieß ihn weg. Geh, so geh doch endlich!«, schluchzte sie. »Du kannst mir nicht helfen. Ich möchte schlafen, schlafen und nicht mehr aufwachen.«
Dr. Dietsch gab ihr wenig später eine Injektion. Ein Bündel Elend lag da im Bett. Und er fühlte sich mitschuldig, weil er ihren Zustand nicht erkannt hatte.
»Sie will Dr. Laurin sehen«, sagte Jonas deprimiert. »Vielleicht hat sie es morgen schon vergessen, aber …« Er wusste nicht mehr weiter, seine Stimme versagte.
»Dr. Laurin wird kommen, wenn ich ihn darum bitte«, sagte Dr. Dietsch. »Machen Sie sich jetzt keine Gedanken. Wir müssen mit solchen Ausbrüchen rechnen. Sie wollte vorhin aufstehen, aber sie konnte sich nicht auf den Beinen halten. Sie wollte baden oder wenigstens duschen, aber auch das durfte sie noch nicht.«
Sie hatte die Schwestern wieder herumgejagt, und man war knapp mit dem Pflegepersonal, und so geriet Dr. Dietsch auch langsam in Bedrängnis, denn für die Schwestern war Bettina eine Wöchnerin wie jede andere, und er durfte nicht sagen, dass sie eben doch anders war.
Dr. Robert Dietsch wusste, dass allen, die mit Bettina lebten, Schweres bevorstand, aber kein Arzt konnte wohl sagen, ob das Schlimmste für sie zu verhindern gewesen wäre, wenn sie das Kind nicht bekommen hätte. Es war so oder so eine Tragödie.
Dr. Jonas Bernulf fürchtete sich davor, Charlotte und seinen Vater darauf vorzubereiten, wie schwierig sich das Leben für Bettina gestalten würde. Er wollte die beiden nicht noch mehr deprimieren.
*
Charlotte reagierte sehr aggressiv, als Jonas sie mit den notwendigsten Tatsachen vertraut machte. Aber schließlich musste das sein, denn niemand konnte Augen und Ohren vor der Wahrheit verschließen.
»Ihr dramatisiert das alles«, sagte Charlotte heftig. »Ich glaube es nicht, nein, das glaube ich nicht!« Man konnte ihr diesen Ausbruch nicht verübeln, schließlich war Bettina ihr einziges Kind.
Ihr Mann blieb ruhig. »Jedenfalls können die jungen Leute nicht in einer Wohnung leben, zu der sie mit dem Lift hinauffahren müssen«, erklärte er. »Sie brauchen ein ebenerdiges Haus. Ich werde mich darum bemühen.«
Er war ein Mann der Tat und brachte alles zustande, was er in die Hand nahm. Für Conny war dies allerdings bedrückend, denn dadurch musste er sich noch abhängiger fühlen. Aber er musste seinen Stolz hintenan stellen, da das Leben für Bettina so bequem wie möglich gemacht werden sollte.
Etwas erleichtert fühlte er sich, als Dr. Laurin ihm mitteilte, dass sie eine Kinderpflegerin für die kleine Sandra gefunden hätten.
Antonia Laurin hatte Eva Keller aufgesucht und ihr Anliegen ohne jede Verniedlichung geschildert. Eva war, obwohl erst vierundzwanzig, ein sehr ernstes Mädchen, das wusste, was Multiple Sklerose bedeutete.
Sie hatte das Leiden ihrer um vier Jahre älteren Schwester mit durchlebt. Sie hatte erfahren, welche psychische und auch finanzielle Belastung dieses Leiden für ihre Eltern mit sich brachte, die noch immer sehr zurückgezogen lebten und unter Depressionen litten, wohl auch deshalb, weil sie der jüngeren, gesunden Tochter keine bessere Ausbildung bieten konnten.
Eva hatte auch einige Zeit gebraucht, um mit diesen bitteren Erlebnissen fertig zu werden, aber der Aufenthalt in Toronto, in einer Familie, die alles besaß und dennoch nicht zufrieden war, hatte ihr zu anderen Erkenntnissen verholfen.
Sie überlegte nicht lange, als Antonia Laurin mit ihrer Bitte zu ihr kam.
Antonia arrangierte dann ein erstes Zusammentreffen mit Constantin Hammilton in ihrem Haus. Die Kinder hatte sie zu den Großeltern geschickt, damit dieses Kennenlernen ungestört verlaufen konnte.
Befangen war Eva ebenso wie der Man, als sie einander vorgestellt wurden. Constantin betrachtete das schlanke, zurückhaltende Mädchen forschend.
»Hat Frau Dr. Laurin Ihnen bereits erklärt, worum es sich handelt?«, fragte er heiser.
Eva nickte. »Meine Schwester litt an der gleichen Krankheit«, erwiderte sie leise.
»Und wie hat Ihre Schwester diese Krankheit ertragen?«, fragte er.
»Wechselhaft«, erwiderte sie zögernd. »Am Ende hatte sie sich damit abgefunden.«
»Am Ende«, wiederholte er gequält.
Eva sah ihn offen an. »Manche Menschen klammern sich auch in solchen Leiden an das Leben«, sagte sie so ruhig, dass es fast kühl klang. »Meine Schwester resignierte, als ihr bewusst wurde, dass es keine Hilfe für sie gab. Leider gibt es ja keine. Es ist eine harte Tatsache. Es tut mir leid für Sie, Herr Hammilton. Und für Ihr Kind«, fügte sie nach einer kleinen Pause hinzu.
»Aber Sie würden dennoch die Pflege des Kindes übernehmen?«
»Ja«, erwiderte sie.
Er atmete auf. »Ich danke Ihnen, Frau Keller«, erwiderte er. »Und Ihnen danke ich auch, Frau Dr. Laurin. Ich werde darauf bedacht sein, Ihnen Ihre schwere Aufgabe zu erleichtern«, fuhr er, zu Eva gewandt, fort. »Soweit mir das möglich ist. Selbstverständlich wird Ihre mühevolle Arbeit entsprechen honoriert werden.«
Wie mühelos diese Tätigkeit für Eva werden würde, ahnte in dieser Stunde noch niemand, auch Eva selbst nicht.
*
Bettina blieb noch vier Wochen in der Klinik. Die Krankenschwestern wussten nun, dass sie ein besonders schwerer Fall war, wenngleich sie auch nicht über die Krankheit selbst informiert wurden. Aber sie waren darauf bedacht, Bettina jeden Wunsch zu erfüllen, uns so gestaltete sich dieser Aufenthalt nicht gar so schwierig, wie Dr. Dietsch anfangs gemeint hatte.
Bettina selbst schob alles auf die Schwangerschaft, und für sie zählte als Arzt jetzt nur noch Dr. Laurin, der sie mehrmals besuchte. Ihn erschütterte es, wie sehr sie sich an ihn klammerte.
Er wäre ja der Einzige gewesen, der vorausgesehen hätte, dass sie zu zart für eine Schwangerschaft gewesen sei, hatte Bettina ihm erklärt, als er das erste Mal bei ihr war.
Und sie hatte auch gesagt, dass sie ihrem Mann unrecht getan hätte. Erschreckend war es nur, dass sie nun das Kind selbst für ihr körperliches Elend verantwortlich machte. Sie war keines mütterlichen Gefühles fähig. Aber wenn Conny sie besuchte, war sie die Zärtlichkeit selbst. Von Jonas sprach sie nie. In der Klinik wurde sie ärztlich auch nur noch von Dr. Dietsch betreut, der eine solche Reaktion erwartet hatte, nachdem sich Jonas so offen zu Katrin bekannt hatte.
Bettina akzeptierte nur noch die Menschen, von denen sie sich geliebt und umsorgt fühlte. An erster Stelle stand da ihre Mutter, aber gleich nach ihr rangierte nun wieder Conny. Dann wieder zog sie sich an ihrem Stiefvater empor, als er ihr erklärte, dass er einen sehr hübschen Bungalow für sie gekauft hätte.
Sie genoss es, so verwöhnt zu werden. Sie geriet in Hochstimmung, als Conny ihr sagte, dass er eine Krankenschwester für Sandra engagiert hätte. Er hatte es sehr behutsam getan und ihr erklärt, dass sie geschont werden müsse und sich erst erholen solle.
Tatsächlich schien eine Besserung einzutreten. Bettina machte Gehversuche, und wenn sie auch nur schwankende Schritte tun konnte, so erwachte doch neue Hoffnung in ihr.
An solche Hoffnung klammerte sich aber vor allem Charlotte. Sie hatte Eva inzwischen kennengelernt und zeigte sich ihr gegenüber von ihrer liebenswürdigsten Seite.
Es kam der Tag, an dem Bettina und das Baby aus der Klinik heimgeholt werden konnten. Heim in ein schönes Haus, das ganz darauf eingerichtet worden war, das Leben der kranken jungen Frau zu erleichtern.
Bettina war so begeistert, dass sie an Connys Arm recht sicher durch die Räume ging.
Charlotte triumphierte. Sie war überzeugt, dass die Ärzte sich getäuscht hatten.
Eva wusste, dass solche euphorischen Stimmungen trügerisch waren. Die hatte sie bei ihrer Schwester auch erlebt. Aber ihre Fürsorge galt nun in erster Linie der kleinen Sandra, die ein kräftiges, gesundes Baby war.
Sie tat ihre Arbeit in einer so rücksichtsvollen, diplomatischen Art, dass Conny sie bewundern lernte. Man spürte Eva kaum. Bettina äußerte sich sehr zufrieden über sie.
Aber wie sie es tat, war typisch für sie. »Was soll ein so reizloses Mädchen auch sonst tun, als einen Pflegeberuf zu ergreifen«, sagte sie zu Conny. »Ein Schattengewächs ist diese Schwester Eva. Doch das ist beruhigend für mich. Ich brauche nicht eifersüchtig zu werden.« Er sagte nichts, doch sie fragte ihn dann: »Du warst doch hoffentlich nicht eifersüchtig auf Jonas?«
»Warum sollte ich?«, fragte er zurück.
Sie schmollte. »Immerhin hat sich Jonas sehr viel mehr um mich bemüht als du. Wenigstens einige Zeit – bis diese Katrin ihn beanspruchte. Ich bin ja sehr gespannt, was das für ein Mädchen ist.«
»Ein sehr nettes Mädchen«, entfuhr es ihm.
»So?« Ihre Mundwinkel bogen sich abwärts. »Du findest sie auch nett?«
»Ich kann nichts anderes sagen«, erklärte er.
Bettina kniff die Augen zusammen. »Wir werden die beiden bald einladen«, sagte sie aggressiv.
»Du musst dich schonen.«
»Fang du jetzt nicht auch davon an. Ich bin froh, endlich aus der Klinik entkommen zu sein. Dort hat man mich ja erst krank gemacht. Ich fühle mich sehr wohl. Und wir werden oft Gäste haben.«
Für das Kind zeigte Bettina keinerlei Interesse. Sie beschwerte sich nur, wenn Sandra schrie. Dann ging sie, sich an der Wand entlangtastend, auch mal zum Kinderzimmer, und Eva konnte ihre ersten Erfahrungen sammeln, wie schwierig sich dieses Miteinanderleben gestalten würde, aber sie hatte wahrhaft eine Engelsgeduld.
»Was fehlt Sandra?«, fragte Bettina.
»Ein Baby schreit ab und zu einmal, anders kann es sich ja nicht bemerkbar machen«, erwiderte die junge Kinderschwester.
»Es braucht nicht zu schreien, wenn es richtig versorgt wird«, erwiderte Bettina ungehalten. »Sie sind doch eingestellt worden, um dafür zu sorgen, dass es dem Kind an nichts fehlt.«
»Sandra wird gleich ihr Fläschchen bekommen. Dann ist sie wieder ruhig«, erwiderte Eva.
»Dann geben Sie ihr die Flasche, bevor sie schreit«, sagte Bettina.
Aber immer, wenn Sandra die Stimme ihrer Mutter vernahm, war sie kaum zu beruhigen. Für Eva war es beruhigend, dass Bettina meist mit sich selbst beschäftigt war. Die Friseurin kam ins Haus, auch die Kosmetikerin, und Charlotte kümmerte sich um alles, was ihre Tochter betraf. Irgendwie war sie schon eine große Hilfe, denn sie verstand es tatsächlich, Bettinas wahren Zustand zu ignorieren, und sobald sie anwesend war, schien es Bettina bedeutend besser zu gehen.
Jeder Wunsch wurde Bettina erfüllt, und nur Eva entging es nicht, dass Constantin immer schweigsamer und ruheloser wurde.
Als Bettina vier Wochen daheim war, sollte die Party stattfinden, zu der auch der junge Jonas und Katrin Dietsch eingeladen wurden.
Auch ihre früheren Freundinnen hatte Bettina eingeladen, doch alle hatten abgesagt, ob nun ahnungslos oder ahnungsvoll, wusste niemand, aber gar so eng war die Verbindung nie gewesen, wie Bettina jetzt klagend bemerkte. Dann verlangte sie, dass Dr. Laurin und seine Frau Antonia eingeladen werden sollten. Constantin hatte keine Hoffnung, dass das Arztehepaar kommen würde, aber zu seiner Überraschung sagte sie dann zu.
Dr. Leon Laurin interessierte es ungemein, wie sich Bettina in das Leben fügte, das ihr bestimmt war, und Antonia Laurin wäre aus ebensolchem Interesse auch allein gekommen, wenn ihr Mann verhindert gewesen wäre.
So wurde der Tisch von Eva dann für acht Personen gedeckt. Die Haushaltshilfe, die man zusätzlich engagiert hatte, war an diesem Tag nicht erschienen. Sie hatte sich krankgemeldet, aber Eva wusste, dass Bettina sie mit ungerechten Vorwürfen vergrault hatte.
So jedoch erwarb sie sich an diesem besonderen Tag auch Bettinas besonderes Vertrauen, weil alles reibungslos ablief. Bettina war in bester Verfassung, weil Eva nicht murrte, sondern auf alle ihre Wünsche einging.
Für das Essen hatte Charlotte gesorgt. Ein delikates kaltes Büfett wurde geliefert, das sogar Bettinas Beifall fand.
Die junge Frau sah bezaubernd aus. Sie trug eine neue Frisur und war von der Kosmetikerin blendend hergerichtet worden. Ein bildschönes, plissiertes Flatterkleid umhüllte ihren noch immer plumpen Körper. Es mochte verwunderlich erscheinen, aber sie hatte kaum an Umfang verloren, obwohl sie wenig aß. Doch ihr Gesicht war verführerisch anmutig, und die Laurins waren verblüfft.
Constantin hatte mit ihnen verabredet, dass sie möglichst die Ersten sein sollte. Sie hatten es geschafft, obwohl Dr. Laurin ziemlich spät aus der Klinik gekommen war.
Nach ihnen kamen dann Charlotte und Jonas Bernulf, und erst mehr als eine Viertelstunde später Dr. Bernulf und Katrin. Da war man dann schon in ein so angeregtes Gespräch vertieft, dass Bettina dem jungen Paar nur flüchtige Aufmerksamkeit widmete.
Katrin war betont schlicht gekleidet. Ihr Vater hatte ihr den Rat gegeben, ihre unbestreitbaren Vorzüge ja nicht zu unterstreichen. Ihre natürliche Frische war freilich nicht zu übertünchen. Antonia Laurin fand das Mädchen als Wohltat in dieser Umgebung.
Bettina schenkte Katrin vorerst keine Beachtung. Sie war wieder in euphorischer Stimmung.
Sie hing an Constantins Arm, nannte ihn »Schatzilein« und »Herzensmann« und betonte immer wieder, dass sie erst jetzt so richtig wüsste, wie sehr ihr Mann sie liebe. Dabei warf sie allerdings immer wieder bedeutungsvolle Blicke zu Jonas, und ihr Lächeln konnte man eher gehässig als anzüglich nennen. Aber sie aß und trank völlig hemmungslos, und dann verlangte sie von Eva, dass sie Sandra bringen solle.
»Die Kleine schläft«, wandte Eva ein.
»Na und, sie kann die ganze Nacht schlafen«, sagte Bettina ironisch. »Unsere Gäste wollen schließlich auch die Hauptperson bewundern.«
»Die Hauptperson bist du, Bettina«, sagte Charlotte. »Wir freuen uns, dass es dir wieder so gut geht.«
Vielleicht hatte sie instinktiv das Richtige gesagt, denn Bettina lächelte.
»Wenn alle dieser Meinung sind, lassen wir den kleinen Schreihals schlafen«, erklärte sie. »Trinken Sie mit uns ein Glas Sekt, Eva. Es ist wirklich ein Glück, dass wir Eva haben. Sie ist einfach perfekt. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Alles läuft wie am Schnürchen.«
Sie machte einen Schritt auf Dr. Laurin zu und legte ihre kraftlose Hand auf seinen Arm. »Ich weiß, dass ich Ihnen diesen guten Geist zu verdanken habe«, sagte sie. »Hätte ich nur immer auf Sie gehört und nicht auf das Geschwafel von anderen.«
Dann traf ein vernichtender Blick ihre Mutter, die fahl wurde.
»Wenn Mama sich nur nicht in alles einmischen würde«, fuhr Bettina aggressiv fort. »Ich werde mein Kind niemals mit solcher Affenliebe plagen.«
Eine prekäre Situation war das.
Schweigen herrschte.
Dann sagte Katrin: »Mütter sind sehr fürsorglich, Bettina.«
»Manchmal sind sie lästig«, erwiderte Bettina darauf.
»Wenn wir stören, können wir ja gehen«, ließ sich Jonas Bernulf vernehmen.
Sein energischer Tonfall ließ Bettina aufhorchen. »So war es doch nicht gemeint, Onkelchen«, lachte sie blechern auf. Dann griff sie sich an die Stirn. »Ich möchte mich ein paar Minuten ausruhen. Seid mir bitte nicht böse. Amüsiert euch, Conny ist sowieso am liebsten mit mir allein.«
Constantin sah, wie sie schwankte. Er führte sie hinaus.
Charlotte brach in ein haltloses Schluchzen aus, als die Tür ins Schloss fiel.
Katrin war die Erste, die sich fing. »Man muss bedenken, dass es schnell einen Stimmungsumschwung geben kann«, sagte sie leise. »Mein Vater hat mich darauf vorbereitet.«
»Ich wusste nicht, dass es so plötzlich kommt«, schluchzte Charlotte. »Lass uns gehen, Jonas.«
»Nein, nicht jetzt«, erwiderte ihr Mann. »Wir sollten ruhig darüber reden. Wir wussten ja alle, dass es kein Freudenfest werden würde – du ausgenommen, Charlotte. Aber es scheint an der Zeit zu sein, dass du dich endlich mit den nackten Tatsachen abfindest.«
»Bitte, setzen Sie sich«, sagte Dr. Laurin.
*
Constantin hatte Bettina auf ihr Bett gelegt. Sie umklammerte seine Hand mit so festem Griff, dass er sie nicht zu lösen vermochte. Es war erstaunlich, wie viel Kraft die Kranke in solchen Situationen entwickelte. Schon mehrmals hatte er dies erfahren.
»Sie ist albern«, stammelte Bettina. »Sie will immer die erste Geige spielen.«
»Wer?«, fragte er rau.
»Mama. Fällt dir das nicht auf?«
»Nein«, erwiderte er. »Sie ist sehr besorgt um dich, aber jetzt hast du sie gekränkt, Bettina.«
»Ach was, man kann sie nicht kränken. Sie will mich nur als kleines, hilfloses Mädchen behandeln. Sie will keine große Tochter haben, sie will nicht Großmutter sein. Und diese Katrin bildet sich wunder was ein, weil sie sich Jonas geangelt hat. Dabei ist er doch nur auf die Klinik ihres Vaters aus.«
»Rede dir doch so was nicht ein«, stieß er hervor, weil es seinem Wesen widersprach, ihr in allem recht zu geben.
»Sie stellt doch gar nichts dar«, sagte Bettina mit schriller Stimme. »Sie ist genauso unscheinbar wie Eva. Du kannst stolz auf mich sein, Conny. Sag es, dass du stolz auf mich bist. Schick die Leute fort. Ich möchte allein mit dir sein.«
»Du wolltest die Party, Bettina«, wandte Constantin heiser ein.
»Sie langweilen mich«, schrie sie ihn an. »Sie verderben mir die Stimmung. Ich war so gut gelaunt. Und nun schreit Sandra wieder, weil sie so laut sind.« Bettina hielt sich die Ohren zu. »Ich kann dieses Geheul nicht ertragen. Bring das Kind fort, Conny. Ohne die Kleine wären wir so glücklich wie früher.«
Er hatte sich aus ihrem Griff befreien können und hielt nun ihre Arme fest.
»Es ist unser Baby, Bettina«, sagte er hart. »Ich will das Kind behalten.«
»Du wolltest es nicht haben, ich wollte es nicht haben. Mama hat mir eingeredet, dass ich es zur Welt bringen muss. Soll sie es doch nehmen.«
»Jetzt ist es auf der Welt, und wir werden es behalten«, sagte Constantin. »Du wolltest es auch haben, vergiss das nicht.«
»Aber es hat mich krank gemacht«, stöhnte sie, »und ich kann das Geschrei nicht ertragen.«
»Das Kind schreit nicht. Du schreist«, sagte er. »Sei still, dann wirst du merken, dass alles ruhig ist.«
Sie verstummte. Sie vergrub ihr Gesicht in den Kissen. Und von Sekunde zu Sekunde schlief sie ein. Er blickte auf sie hinab, und heißes Mitgefühl ergriff ihn. Arme Bettina, dachte er, du kannst nichts dafür. Niemand ist schuld an deinem Elend. Jeder möchte auf seine Weise damit fertig werden.
Aber wie soll es weitergehen?, dachte er, als er sich erhob. Was bleibt letztendlich übrig?
*
Eva gab dem Baby die letzte Mahlzeit. Sie blickte nicht auf, als die Tür geöffnet wurde. Sie konzentrierte sich ganz auf das kleine Wesen, das sie beim Trinken mit großen Augen anschaute.
»Ist alles in Ordnung, Eva?«, fragte Antonia Laurin.
»Hier schon«, erwiderte das Mädchen. »Hier ist alles normal.«
»Und sonst?«, fragte Antonia.
»Wie vorauszusehen«, erwiderte Eva leise. »Aber es ist erst der der Anfang. Wie es weitergeht, weiß ich nicht.«
»Werden Sie es durchhalten? Haben wir Ihnen zu viel zugemutet?«, fragte Antonia Laurin.
»Ich hätte ja nein sagen können«, antwortete Eva.
»Sie können doch aber den Haushalt nicht auch noch machen«, meinte Antonia.
»Es geht ganz gut. Es ist vielleicht sogar besser so. Sandra ist ein liebes Kind, sie schläft viel, also bin ich gar nicht ausgelastet.«
Das Baby hatte das Fläschchen ausgetrunken. Eva nahm Sandra empor. Zärtlich tätschelte sie der Kleinen den Rücken. »Mach schön dein Bäuerchen, dann kannst du schlafen, Püppeli.«
Antonia war gerührt von dem anmutigen Bild, das Eva mit dem Kind im Arm bot. Ganz weich war das sonst so herbe Gesicht des Mädchens, als sie das Baby ins Bettchen legte und über das seidige dunkle Haar strich.
Als sie dann Antonia anblickte, hatten ihre Augen einen nachdenklichen Ausdruck.
»Frau Bernulf sollte nicht so übermäßige Besorgnis zeigen«, stellte sie fest, »dadurch wird Frau Hammilton nur noch nervöser. Man darf ihr nicht alles aus der Hand nehmen. Frau Bernulf ist doch selbst nicht gesund, sie verbreitet nur Unruhe. Aber das kann ich doch nicht sagen.«
Bestürzt sah Antonia die Jüngere an. »Sie meinen, das Frau Bernulf krank ist?«, fragte sie gedehnt.
»Vielleicht auch nur labil. Sie raucht wahnsinnig viel und schluckt dauernd Tabletten, und Frau Hammilton raucht auch von Tag zu Tag mehr, und dann trinkt sie Unmengen Kaffee. Es gibt doch Sanatorien, die ausschließlich für diese Kranken eingerichtet sind, oder?«
»Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass Frau Hammilton kaum einwilligen wird, in ein Sanatorium zu gehen.«
»Sie würde es vielleicht, wenn ihre Mutter ihr zureden würde, aber die ist ja die Einzige, die den Ernst der Situation noch immer nicht wahrhaben will«, sagte Eva. »Bei meinen Eltern war das anders, und deshalb lernte wohl auch Angela, ihr Leiden zu ertragen. Allerdings hatte sie keinen Mann und kein Kind, und sie hat nicht zu lange leiden müssen«, schloss Eva leise.
Sie wusste genauso gut wie Antonia Laurin, dass sich dieses Leiden über einen unendlich langen Zeitraum ausdehnen konnte und dass es keine Chance für eine Heilung gab nach dem derzeitigen Stand der Forschung. Auf dem Gebiet der Technik schien nichts unmöglich zu sein, aber der Mensch war eben keine Maschine.
»Wenn ich doch ihr Vertrauen erringen könnte«, flüsterte Eva nach einem langen Schweigen, »aber ich fürchte, dass in ihr Hass wächst auf alle jungen gesunden Menschen. Sie war immer umschwärmter Mittelpunkt, verwöhnt von allen und gewöhnt, alles zu bekommen, was sie sich wünschte.«
Und was ihr nicht zufiel, erzwang sie sich, dachte Antonia. Mit dem Kind hatte sie die Ehe erzwungen.
Sie legte ihren Arm um Evas Schultern. »Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, Eva, kommen Sie zu mir«, sagte sie leise.
»Sie tut mir unendlich leid«, murmelte Eva tonlos. »Es ist schrecklich, wenn man nicht helfen kann. So will ich wenigstens für dieses hilflose kleine Wesen tun, was möglich ist. Es braucht Liebe.«
*
Noch begriff die kleine Sandra nicht, was um sie herum vor sich ging. Sie brauchte nichts zu entbehren. Sie wurde von Eva auf die liebevollste Weise versorgt. Wenn sie aber Charlottes Stimme vernahm, begann sie zu weinen.
Dann geschah es, dass Eva mit ungerechtem Zorn überschüttet wurde, aber seltsamerweise ergriff Bettina in solchen Augenblicken Evas Partei.
»Du sprichst zu laut, Mama, daran ist Sandra nicht gewöhnt«, sagte sie, oder: »Du bist zu hektisch, das spürt das Kind. Misch dich doch nicht in alles ein.«
Die Folge war, dass Charlotte gekränkt bald wieder das Haus verließ und sich dann bei ihrem Mann beklagte.
Schließlich musste Jonas bemerken, dass Charlotte heimlich zur Flasche griff. Nicht, wenn er zugegen war, aber es konnte ihm nicht verborgen bleiben, dass die Hausbar ständig neu aufgefüllt wurde. Er war ein toleranter Mann. Er wollte seiner Frau das Verständnis für ihre Verzweiflung nicht versagen. Er wollte ihr helfen, aber Charlotte geriet mehr und mehr in ein Stadium der Haltlosigkeit, das beängstigend war. Er sprach mit seinem Sohn darüber.
»Ich weiß nicht, wohin es noch führen wird, Jon«, sagte er, »aber ich weiß, dass ich diesen Zustand nicht ewig aushalte. Wir können doch nicht alle kaputtgehen.«
Jon konnte sich seiner jungen Liebe auch nicht unbeschwert erfreuen, aber er hatte in Katrin eine Gefährtin, mit der er alles besprechen konnte. Obwohl sie noch sehr jung war, zeigte sie ein Verständnis, das beispielhaft war. Katrin wuchs auch dem älteren Jonas schnell ans Herz. Eine innige Zuneigung verband sie, aus der er Kraft schöpfte, aber auch das war Charlotte ein Dorn im Auge.
Die Konflikte vertieften sich mehr und mehr, bis Jonas Bernulf sich entschloss, die Ostasienreise, die er immer wieder hinausgeschoben hatte, endlich anzutreten. Er war bereit, Charlotte mitzunehmen. Er setzte alle Hoffnung darauf, dass sie so auf andere Gedanken kommen könnte.
Zuerst war sie empört. »Was würde Bettina von uns denken«, sagte sie aggressiv.
»Immerhin muss ich mich auch um die Geschäfte kümmern«, erklärte Jonas energisch. »Ich kann mich nicht auf die faule Haut legen, meine Liebe. Von nichts kommt nichts, und ich fühle mich nicht als Rentner. Um es noch deutlicher zu sagen, wir verbrauchen Unsummen, und so reich bin ich nun auch wieder nicht, dass wir von den Zinsen leben können. Es geht hart an die Reserven, Charlotte. Ein wenig Verständnis musst du auch für mich aufbringen.«
»Ich müsste mich impfen lassen«, sagte sie beklommen. »Und es geht mir ohnehin nicht gut.«
An die Impfung hatte er augenblicklich nicht gedacht, aber als sie es sagte, kam ihm ein anderer Gedanke. Das war eine Möglichkeit, Charlotte einmal gründlich untersuchen zu lassen.
»Ein guter Arzt wird feststellen, ob du die Impfung verträgst«, sagte er betont gleichmütig.
»Und wenn ich sie nicht vertrage?«, fragte sie.
»Dann bleibst du daheim.«
»Und du?«
»Du wirst einsehen müssen, dass ich im Geschäft bleiben muss, Charlotte. Wir werden für Bettina noch einiges aufwenden müssen.«
»Immerhin hat sie einen Ehemann«, stieß Charlotte hervor.
»Woher soll er so viel Geld nehmen? So grandios ist sein Einkommen nicht.«
»Sie hätte eine andere Partie machen können«, sagte sie.
»Es fragt sich allerdings, ob sich jeder Mann so anständig verhalten würde wie Constantin. Ohne das Kind, das Bettina erwartete, wäre er vielleicht nur eine Episode in ihrem Leben geblieben.«
Charlotte schwieg. Ihr ging nun doch manches durch den Sinn. »Du bist sehr großzügig, Jonas«, sagte sie leise. »Du hättest das Haus nicht kaufen müssen. Du hattest nicht die geringste Verpflichtung, für meine Tochter zu sorgen.«
»Ich habe es gern getan, Charlotte«, erwiderte er, »aber ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Wir können Bettina das Leben nur erleichtern, heilen können wir sie nicht.«
Charlotte brach wieder zusammen. »Es muss doch eine Möglichkeit geben«, schluchzte sie.
»Es gibt keine«, erwiderte er. »Ich habe mich überall erkundigt. Man kann ihr Erleichterung verschaffen, wenn sie einige Wochen in ein Sanatorium geht, aber dazu muss man ihr erst klarmachen, wie es um sie steht.«
»Das kann ich nicht. Und ich vermag auch nicht, es als unabwendbar hinzunehmen, dass sie an dieser Krankheit sterben muss.«
»Immerhin besteht die Möglichkeit, dass sie dich überleben wird, wenn du dich weiterhin so aufreibst und dich nur noch von Zigaretten, Tabletten und Alkohol ernährst wie in den letzten Wochen. Schaust du überhaupt noch in den Spiegel? Ich habe eine reizvolle, charmante Frau geheiratet, und ich habe mir viel von unserem gemeinsamen Leben erhofft, Charlotte. Ich bin auch bereit, alles mit dir zu teilen, und ich denke, dass ich dir bewiesen habe, wie ernst es mir damit ist.«
»Warum bist du so hart?«, fragte sie schluchzend.
»Weil ich nicht tatenlos zusehen will, dass du dich auch zerstörst.«
Dann ließ er sie allein. Er konnte ihr jämmerliches, haltloses Weinen nicht mehr ertragen – und vor allem nicht dieses Selbstmitleid, dass ausgerechnet sie dies durchmachen müsse. Er hoffte, dass sie nachdenken würde.
Doch dazu war Charlotte nicht mehr fähig. Sie lief in ihr Zimmer und blickte in den Spiegel. Sie sah ein graues faltiges Gesicht, glanzlose Augen, einen schmalen, verkniffenen Mund, und dann wankte sie zu ihrem Bett und vergrub dieses zerrissene Gesicht in den Kissen.
*
Jonas Bernulf hatte diesmal nicht mit seinem Sohn gesprochen. Er rief vielmehr Dr. Laurin an und fragte ihn, wo er Charlotte am besten untersuchen lassen könne. Er machte auch eine Andeutung über die Ostasienreise und die Impfung.
Dr. Sternberg könne die Untersuchung vornehmen, meinte Dr. Laurin. Dies sei jedoch nur ein Vorschlag. Aber damit war Jonas Bernulf sofort einverstanden. Es bedurfte nun nur noch Charlottes Einwilligung, doch zu seiner Überraschung erklärte sie sich ohne jeden Widerspruch dazu bereit. Sie war sanft wie ein Lamm und sagte, dass sie mit Bettina sprechen und sie zu einem Kuraufenthalt bewegen wolle.
Auf dem Weg zu Bettinas Heim geriet sie in eine melancholische Stimmung. Gedankenverloren sagte sie: »Es war eine wundervolle Zeit mit dir, Jonas. Es tut mir leid, dass ich dir für alles, was du mir gegeben hast, so wenig zurückgeben kann.«
»Du sollst nicht so sprechen, Charlotte, du sollst so etwas gar nicht denken. Es kann nicht immer nur Sonnenschein und Glückseligkeit herrschen, aber ich wäre sehr beruhigt, wenn du dich nicht in völliger Resignation verlieren würdest. Immerhin bist du nicht allein. Du hast mich, und ich möchte sehr gern die Charlotte neben mir haben, die ich als so positiv eingestellte Frau lieben lernte.«
»Inzwischen bin ich alt und hässlich geworden. Du hast es mir deutlich gemacht«, flüsterte sie.
»Unsinn, ich wollte dir nur klarmachen, dass du dich nicht aufgeben sollst.«
»Wie aber soll ich Optimismus verbreiten, wenn ich so sehr mit Bettina leide?«, fragte sie.
»Indem du dir sagst, dass ihr mit Jammern und Klagen nicht geholfen ist. Wir wissen alle, wie schwer es für sie ist, keine Besserung zu spüren. Aber wir können ihr doch nicht unentwegt einreden, dass es schon von selbst wieder in Ordnung kommen wird.«
»Jeder kranke Mensch klammert sich doch an die Hoffnung, und wenn er das nicht mehr kann …« Sie schluckte die aufsteigenden Tränen herunter. »Ich fühle mich selbst so elend«, schloss sie mit erstickter Stimme.
Das brauchte sie ihm nicht zu sagen. Er sah es und wusste es. Und auch für sie empfand er Mitleid.
Eva öffnete ihnen die Tür. Sie zwang ein Lächeln auf ihre Lippen.
»Frau Hammilton wird sich freuen«, sagte sie, »es geht ihr heute recht gut.«
Sogleich hellte sich auch Charlottes Miene auf. Als Eva auf die Wohnzimmertür deutete, ging sie eilends darauf zu. Jonas blieb zurück und warf Eva einen fragenden Blick zu.
»Es geht ihr wirklich besser«, sagte sie leise. »Der erste Schub klingt ab.«
»Sie scheinen sehr gut Bescheid zu wissen«, meinte er.
»Ich habe das ja mit meiner Schwester durchlebt«, erwiderte sie.
»Wir sollten darüber sprechen, Eva, aber ein anderes Mal.«
*
Bettina saß in ihrem Rollstuhl vor der breiten Fensterfront, die den Eindruck vermittelte, dass man sich im Freien befand.
Neben ihr stand die Wiege, in der Sandra schlief. Jonas Bernulf war sehr überrascht, denn das war ein unerwarteter Anblick. Und Bettina sah fast so hübsch aus wie in früheren Zeiten. Sie war frisch frisiert. Das kastanienbraune Haar lockte sich um ihr schmales Gesicht, und das zarte Pastellblau des Kleides stand ihr ausnehmend gut.
»Es geht wieder aufwärts«, meinte Bettina, als Jonas ihre federleichte Hand zwischen seinen kräftigen Fingern hielt. »Man darf nur den Mut nicht verlieren. Und unsere Kleine wird schon ganz manierlich.«
In dieser Stunde hätte man wirklich meinen können, dass ein Wunder geschehen war, und es wäre ein schlechter Zeitpunkt gewesen, jetzt von einem Sanatoriumsaufenthalt zu sprechen. Aber es war Bettina selbst, die davon anfing.
»Dr. Laurin hat mich heute Vormittag besucht«, begann sie. »Er ist so reizend und besorgt um mich. Er hat mir da einen Vorschlag gemacht, dem ich wohl zustimmen werde.«
»Welchen Vorschlag?«, fragte Charlotte interessiert, und auch ihr gelang es glücklicherweise, ein zuversichtliches Lächeln zu zeigen.
»Dr. Laurin meint, dass mir eine Luftveränderung sehr guttun würde, dazu Bäder und Heilgymnastik. Und außerdem meint er, dass es mir auch helfen würde, andere Menschen kennenzulernen, die viel schlechter dran sind als ich. Was meint ihr? Es ist ein Privatsanatorium, wunderschön gelegen. Schaut euch doch mal die Prospekte an. Schließlich möchte ich an meinem ersten Hochzeitstag wieder tanzen können.«
Charlotte zuckte zusammen, aber Jonas verstand es, sich zu beherrschen. Der Hochzeitstag war nur noch fünf Wochen entfernt. Daran dachte Bettina wohl nicht.
O doch, sie dachte daran. »Wenn ich gleich am Montag fahren würde – und Dr. Laurin meint, dass dies durchaus einzurichten sei – könnte ich in vier Wochen wieder fit sein. Ich spüre ja jetzt schon, dass es aufwärts geht. Mit Eva bin ich schon ein Stück gegangen, und es ging prächtig. Um Sandra brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Sie ist bestens versorgt, und Conny muss ohnehin eine Woche verreisen.«
»Jonas muss auch verreisen«, sagte Charlotte hastig. »Und er wollte mich mitnehmen.«
»Das ist doch prächtig«, sagte Bettina, »dann sitzt du hier nicht herum und machst dir Sorgen um mich, überflüssige Sorgen, wie ich meine. Wohin soll denn die Reise gehen?«
»Japan, Ceylon und so weiter«, sagte Jonas.
»Das klingt verlockend. Nimmst du mich mal mit, wenn ich wieder ganz okay bin?«
»Gewiss«, erwiderte er rasch.
Sandra begann zu maunzen, und gleich bekam Bettinas Gesicht wieder einen unwilligen Ausdruck.
»Eva soll das Kind holen«, sagte sie.
»Ich bringe es ins Kinderzimmer«, sagte Charlotte.
Sandra schrie diesmal nicht, es blieb bei dem Maunzen. Bettina lachte. »Jetzt gewöhnt sie sich auch schon an Mama. Alles kommt in Ordnung, Jonas. Man braucht wirklich nur Geduld.«
»Ja, die braucht man«, sagte er ruhig. »Du siehst reizend aus, Bettina. Nun wird Charlotte auch wieder aufleben.«
»Sag ihr, dass sie nicht immer so wehleidig tun soll, das deprimiert. Aber vielleicht ist es für sie auch gar nicht einfach, so schnell Großmutter geworden zu sein.« Sie warf ihm einen schrägen Blick zu. »Du hättest auch noch bei jüngeren Frauen Erfolg, Jonas.«
Ein Kribbeln lief ihm durch den Körper. Wenn man aus ihr doch nur klug werden könnte, ging es ihm durch den Sinn.
»Ich war nie auf Abenteuer aus, Bettina«, erwiderte er. »Du weißt, wie sehr ich deine Mutter mag.«
»Aber sie ist sehr gealtert, findest du nicht?« Das klang fast gefühllos, und Bettinas Stimme klirrte, als sie fortfuhr: »Natürlich fühlt sie sich schuldig, weil sie mir so zugeredet hat, das Kind auszutragen. Wir hätten eben auf Dr. Laurin hören sollen, dann wäre ich schon längst wieder in Ordnung.«
»Ihr habt ein süßes, gesundes Kind, Bettina«, sagte er rau.
Ein eisiger Ausdruck kam in ihre Augen. »Es hätte auch anders kommen können«, sagte sie. »Meinst du, ich denke nicht darüber nach? Mama hätte auch darüber nachdenken müssen.«
»Du darfst ihr solche Vorwürfe nicht machen«, erwiderte Jonas beschwörend, nicht ahnend, dass Charlotte schon mithörte. Er drehte sich zwar zur Tür um, die einen Spalt offen stand, aber er konnte sie nicht sehen.
Bettina lachte klirrend. »Welche Frau hat schon so ein Glück wie Mama? Als spätes Mittelalter bekommt sie noch einen blendend aussehenden und dazu reichen Mann. Conny sieht älter aus als du, und er muss rechnen wie ein Maikäfer.«
O Gott, was soll das noch werden?, dachte Jonas, und er ahnte auch jetzt noch nicht, was Charlotte alles dachte.
»Du hast doch sicher gewusst, was Conny verdient«, sagte Jonas betont.
Bettinas Augen verengten sich, dann hob sie lauschend den Kopf. »Ich glaube, er kommt«, flüsterte sie, und dann versank sie in Schweigen.
Charlotte hatte auch gehört, wie die Tür aufgeschlossen wurde. Schnell ging sie in die Diele. Ihr Herz klopfte wie wild, als als sie in Constantins bleiches müdes Gesicht blickte, gelang ihr auch jetzt ein Lächeln.
»Nett, dass ihr Bettina Gesellschaft leistet«, sagte er mit klangloser Stimme.
»Es geht ihr heute ja viel besser«, brachte Charlotte stockend über die Lippen. »Aber ihr werdet jetzt sicher essen wollen. Ich werde Eva ein bisschen helfen.«
»Das ist nicht nötig. Ich muss noch mal weg.«
»Freut es dich, dass sich Bettina für das Sanatorium entschieden hat?«, fragte sie misstrauisch.
»Davon weiß ich noch gar nichts. Ist das nicht nur wieder eine Laune?«
»Nein, sie ist völlig einverstanden. Dr. Laurin hat anscheinend großen Einfluss auf sie. Ich glaube fest daran, dass eine Besserung eingetreten ist, Conny.«
Er erwiderte nichts. »Entschuldigung, ich muss mich waschen«, sagte er heiser.
Und wenn es nun eine andere Frau in seinem Leben gibt?, ging es ihr durch den Sinn. Vielleicht trifft er sich jetzt mit ihr. Sie ging nun wieder zu Bettina, und gleich darauf kam Constantin. Er küsste Bettina auf die Stirn. »Du siehst gut aus, Liebes«, sagte er. »Tut mir leid, dass ich gleich wieder weg muss.«
»Warum?«, fragte Bettina gereizt.
»Ich habe eine geschäftliche Besprechung.«
»Inwiefern?«, fragte sie.
»Ich kann meine Stelle wechseln. Ich habe ein sehr gutes Angebot. Aber darüber wollen wir erst sprechen, wenn es perfekt ist.«
»Würdest du dann mehr verdienen?«, fragte sie mit glitzernden Augen.
»Ja, einiges mehr«, erwiderte Constantin.
»Dann zögere nicht«, sagte Bettina drängend. »Es ist dir doch ohnehin peinlich, dass wir Jonas auf der Tasche liegen.«
»Allerdings«, sagte Constantin rau.
»Ihr liegt mir nicht auf der Tasche«, bemerkte Jonas. »Aber jetzt werden wir uns verabschieden, damit ihr noch über Constantins Pläne sprechen könnt.«
Constantin blickte auf seine Armbanduhr. »Ich muss mich umkleiden und gleich wieder gehen«, sagte er.
»Und ich hätte eigentlich große Lust, mal wieder in einem schicken Restaurant zu speisen«, erklärte Bettina. Sie blinzelte zu Jonas hinüber. »Ein festliches Abschiedsessen, bevor ihr eure Reise antretet und ich ins Sanatorium gehe.«
Constantins Blick wurde starr, als sie die Decke zu Boden schleuderte.
»Ich kann gehen«, sagte Bettina euphorisch. »Würdest du so freundlich sein, mir herauszuhelfen, Jonas?«
Es war eine fast gespenstische Situation, aber tatsächlich stand Bettina dann, auf Jonas Arm gestützt, und ging verblüffend sicher bis zur Tür. »Da staunt ihr«, sagte sie. »Gehen wir.«
Jonas und Constantin tauschten einen langen Blick. »Gehen wir«, sagte Jonas. »Wonach steht dir der Sinn, Bettina? Ein französisches, ein italienisches oder ein chinesisches Restaurant?«
»Ein chinesisches«, erwiderte sie. »Mach deine Sache gut, Conny.«
*
Einige Minuten brauchte es, bis sich Constantin von seiner Verblüffung erholt hatte. Jonas hatte Bettina den Mantel umgelegt, und Charlotte war so verwirrt, dass sie Constantin zum Abschied nicht mal die Hand gab. Dann hatten sie Bettina zum Wagen geführt.
Constantin ging ins Kinderzimmer. Eva hatte das Baby gebadet und gefüttert. Nun lag Sandra auf dem Bauch auf der Wickelkommode und jauchzte.
»Guten Abend«, sagte Constantin, als er durch die Tür trat.
»Guten Abend, Herr Hammilton«, erwiderte die junge Kinderschwester.
»Was ist eigentlich mit meiner Frau los?«, fragte er verwirrt.
»Es geht ihr besser«, erwiderte Eva. »Das war vorauszusehen.«
»Wieso?«
»Weil es bei dieser Krankheit eben so ist«, erwiderte sie langsam.
»Und wie lange hält es an?«
»Das kann man im Voraus nicht sagen.«
»Wie war es bei Ihrer Schwester?«
»Anfangs waren die guten Wochen länger, später kamen die Schübe schneller. Aber es ist wohl in jedem Fall anders.«
»Bettina hat von einem Sanatorium gesprochen. Meint sie das ernst?«
»Dr. Laurin war hier, er hat sie wohl überzeugt. Es kann durchaus möglich sein, dass eine gezielte Therapie eine Besserung auf längere Zeit bewirkt.«
»Aber keine Heilung«, sagte er.
Eva nahm das Kind empor. Es schmiegte das Köpfchen an ihre Schulter.
Mit einem seltsamen Ausdruck ruhte Constantins Blick auf den beiden.
»Ich muss noch mal weg«, sagte er, »hoffentlich erwartet mich bei meiner Rückkehr nicht wieder ein Dilemma. Meine Frau wird mit meinen Schwiegereltern außerhalb essen. Ruhen Sie sich ein wenig aus, Eva. Die Kleine wird ja schlafen.«
»Sie ist sehr brav«, sagte Eva.
Er drehte sich schon zur Tür. »Sie wird von Ihnen ja auch wahrhaft mütterlich betreut. Ich schulde Ihnen sehr viel Dank«, sagte er leise.
Eine Viertelstunde später verließ er das Haus. Sie hörte, wie sein Wagen davonfuhr. Sie lüftete das Wohnzimmer gründlich und richtete Bettinas Bett. Dann setzte sie sich in die Küche, trank eine Tasse Tee und aß gedankenlos ein Brot. Gegen neun Uhr brachten die Bernulfs Bettina heim.
»Der erste Ausflug war doch ziemlich anstrengend«, erklärte Charlotte, »aber es war eine nette Abwechslung.«
»Es war wundervoll«, sagte Bettina. »Ich danke euch. Ihr wisst, was mir Freude bereitet.«
Wie beklemmend diese zwei Stunden für Jonas und Charlotte gewesen waren, konnte Eva von den Gesichtern der beiden ablesen.
*
Sie hatte Bettina entkleidet und gewaschen. »Schritt für Schritt in ein neues Leben«, sagte Bettina dabei. »Wie schön ist es doch, wieder überall dabei sein zu können.«
Aber dann schlief sie bald ein, erschöpft, ausgelaugt, das Gesicht eingefallen. Mitleidvoll betrachtete Eva die Kranke. Sie blieb an Bettinas Bett sitzen, bis sie hörte, dass Constantin kam.
Schnell und leise ging sie hinaus, und unbemerkt wollte sie sich auch zurückziehen, aber Constantin rief sie zurück, als sie in ihrem Zimmer verschwinden wollte.
»Bitte, weichen Sie mir nicht aus, Eva«, rief er gedämpft. »Ich muss noch mit Ihnen sprechen.«
Sie ging langsam zurück. »Ja, bitte«, sagte sie leise.
Er öffnete die Tür zum Wohnzimmer und bat sie, Platz zu nehmen. »Ein Glas Sekt?«, fragte er.
Eva schüttelte verneinend den Kopf.
»Es kann nicht schaden, und es regt den Kreislauf an«, meinte er. »Sie sind auffallend blass, Eva.«
»Ich bin nur müde«, erwiderte sie leise.
»Ich halte Sie nicht lange auf. Ich möchte nur wissen, ob es Bettina noch genauso gut ging, als sie zurückgebracht wurde.«
»So gut, wie es schien, ging es ihr nicht«, erwiderte Eva. »Aber es war eine Abwechslung für sie.«
»Will sie immer noch in das Sanatorium?«
»Sie hat nichts anderes gesagt. Herr und Frau Bernulf werden ja verreisen. Es ist für alle so recht gut.«
»Und Sie bleiben und betreuen Sandra weiterhin?«
»Selbstverständlich.«
»Sie werden ziemlich lange allein sein. Ich habe einen Vertrag mit einer anderen Firma abgeschlossen. Da ich keine Chance mehr habe, als Testpilot eingesetzt zu werden, musste ich sie wahrnehmen. Ich werde oft abwesend sein. Man wird es mir wahrscheinlich zum Vorwurf machen.«
»Ich nicht«, erwiderte Eva. »Sie müsse auch an sich denken – und an Sandra.«
Seine Augen weiteten sich. Sie senkte ihren Blick. »Sie sehen alles sehr realistisch«, stellte er mit gepresster Stimme fest.
»Deshalb verstehe ich alles, auch Sie«, entgegnete sie ruhig. »Ich hoffe für Sie, dass Sie in der neuen Stellung zufrieden sind.«
Constantin gab sich einen Ruck. »Trinken wir darauf«, sagte er, »und auch auf Sie. Es wäre gut um diese Welt bestellt, wenn es mehr Frauen von Ihrer Art geben würde, Eva.«
Heiße Glut schoss in ihre blassen Wangen. »Oh, ich bin ganz bestimmt nicht die Einzige, die Verständnis hat für solche Situationen«, flüsterte sie.
»Und wie lange werden Sie hier durchhalten?«
»Bis man mich wegschickt.«
Seine Stirn legte sich in Falten. »Das ist ein Wort«, sagte er heiser. »Niemand wird Sie wegschicken.«
Ihre Lider senkten sich, und ihre langen Wimpern warfen Schatten auf die nun wieder blassen Wangen.
»Wenn diese Worte eine Brücke wären, würde ich nicht darübergehen«, erwiderte sie. Dann erhob sie sich. »Ich möchte noch einmal nach Ihrer Frau sehen«, sagte sie.
Sein Blick folgte ihr, und ihm ging es durch den Sinn, woher dieses schmale Mädchen die Kraft nahm, alle Mühsal zu ertragen. Er schämte sich, dass er so viel Kraft nicht in sich fühlte.
Dann vernahm er einen Aufschrei. Eva rief nach ihm, und er stürzte in Bettinas Schlafzimmer. Sie lag am Boden vor dem Bett.
»Sie muss versucht haben, aufzustehen«, stammelte Eva. »Sie ist ohnmächtig. Welchen Arzt soll ich rufen?«
»Rufen Sie Jon«, stieß er hervor. »Wir können doch nicht dauernd andere Ärzte bemühen.«
Er hob Bettina empor und legte sie auf ihr Bett zurück. Eva wählte indessen mit zitternden Fingern die Nummer, die sich ihr schon eingeprägt hatte.
*
Jon hatte gerade Katrin heimbegleitet. Sie waren in der Oper gewesen, aber nicht ganz befriedigt von der Aufführung.
Er hörte schon das Telefon läuten, als er die Tür zu seiner Wohnung aufschloss.
Als er dann Evas erregte Stimme vernahm, fragte er nicht lange. »Ich komme sofort«, sagte er.
Als er dann kam, war Bettina schon wieder zu Bewusstsein gekommen. Sie hatte Constantin auch sofort erkannt.
»Du bist ja schon ja, Conny«, sagte sie, und sie erinnerte sich auch gleich daran, was er vorgehabt hatte. Das verblüffte ihn.
»Hat alles geklappt?«, fragte sie.
»Ja, bestens«, erwiderte er.
»Ein schöner Tag«, seufzte sie befreit auf. »Und an unserem Hochzeitstag werden wir tanzen. Ich verspreche es dir, Conny.«
Seine Kehle war trocken. Er konnte nichts sagen. Er strich ihr nur das feuchte Haar aus der Stirn.
»Bringst du mich zum Sanatorium«, fragte sie, »oder hast du dafür keine Zeit?«
»Doch, die werde ich mir nehmen. Willst du es wirklich, Bettina?«
»Ja, es ist bestimmt sehr schön dort. Und ich komme auch mal wieder mit anderen Menschen zusammen. Außerdem möchte ich ganz gesund werden, Conny. Das willst du doch auch?«
»Natürlich will ich das, Bettina.«
»Nimm mich in die Arme, ganz fest«, bat sie. »Sag mir, dass du mich liebst, genauso wie früher.«
Er sagte es, obwohl er wusste, dass es eine Lüge war, damals wie heute, aber damals hatte er nie gesagt »Ich liebe dich«. Sie hatte es nur für selbstverständlich genommen.
Er war sich längst darüber im Klaren, dass es keine Liebe gewesen war. Er hatte Bettina reizend und begehrenswert gefunden, wie manches andere Mädchen vor ihr. Ja, er hatte sie reizvoller gefunden als diese anderen Mädchen und Frauen, die bislang seinen Weg gekreuzt hatten. Ein Kind der Traurigkeit war er nie gewesen, aber an Heirat hatte er nicht gedacht – erst dann, als Bettina ihm sagte, dass sie ein Kind erwarte.
»Es wird alles besser werden, mein Liebes«, sagte er. »Ich wünsche es so sehr.« Und er wünschte es aus ehrlichem Herzen.
Er war tief erschüttert, als sie sich an ihn klammerte und flüsterte: »Verzeih mir, dass ich manchmal an dir gezweifelt habe, Conny. Verzeih mir alles, was ich die angetan habe.«
Plötzlich vernahm sie den Türgong, und ihr Kopf ruckte empor. »Es hat geläutet. Wer kommt da noch?«, fragte sie.
»Es wird Jon sein. Wir haben ihn angerufen, weil es dir nicht gutging, Liebes.«
»Aber es ging mir doch gut, sehr gut sogar. Ich habe geschlafen. Wie kommst du nur darauf zu sagen, es wäre mir nicht gutgegangen?« Ihre Stimme hatte schon wieder einen schrillen Klang.
»Eva hatte dich vor dem Bett liegend gefunden«, sagte er.
»Das ist nicht wahr! Das hat sie dir nur eingeredet«, begehrte Bettina auf.
»Ich habe dich emporgehoben und auf das Bett gelegt, Bettina«, sagte er ruhig. »Eva lügt nicht.«
»Ich verstehe das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, Conny«, schluchzte Bettina.
»Es ist alles gut, Kleines«, sagte er tröstend. »Ich schicke Jon wieder fort.«
»Ja, tu das, ich will ihn nicht sehen. Er wollte uns auseinanderbringen, aber als es mir schlechtging, hat er sich Katrin angelacht. Er soll nicht mehr kommen. Sag es ihm.«
»Ja, das werde ich tun. Eva kann so lange bei dir bleiben.«
»Nein, das ist nicht nötig. Ich möchte, dass du bei mir schläfst, so wie früher.«
Das Blut in seinen Adern schien zu gefrieren. Alles in ihm war Abwehr und Auflehnung.
Das nicht, nein, das nicht, dachte er, als er zum Wohnraum ging, steif wie eine Marionette.
Eva hatte Jonas schon informiert, aber einfühlsam, wie sie war, hatte sie ihn daran gehindert, in Bettinas Schlafzimmer zu gehen.
Als nun Constantin kam, sah sie ihn fragend an. »Soll ich bei Frau Hammilton bleiben?«
»Nein, das ist nicht nötig, Eva. Gehen Sie jetzt schlafen«, erwiderte er. »Meine Frau wird auch schlafen. Ich sehe noch nach ihr. Sie kann sich an nichts mehr erinnern.«
Eva entfernte sich mit einem Gutenachtgruß. Jonas gab ihr die Hand. Conny nickte ihr nur zu.
»Ein unglaublich zuverlässiges Mädchen«, sagte der junge Arzt, als Eva die Tür hinter sich ins Schloss gezogen hatte.
»Ja, ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun sollte«, erwiderte Constantin.
»Soll ich nicht nach Bettina sehen?«, fragte Jonas.
»Nein, sie will dich nicht sehen, Jon. Aber wir sollten uns einmal ganz offen unterhalten. Ich bitte dich, aufrichtig zu sein.«
»Selbstverständlich.«
»Wie eng war deine Beziehung zu Bettina?«, fragte Constantin.
»Es gab gar keine. Es bestand doch nur in ihrer Einbildung, dass ich sie liebe, um es ganz deutlich zu sagen. Ich habe nicht das Geringste für sie empfunden, Conny, das musst du mir glauben. Nicht einmal brüderliche Gefühle, wenn wir es genau nehmen wollen. Für mich war sie ein Luxusgeschöpf, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Als mein Vater mich bat, mich um Bettina zu kümmern, tat ich es sehr widerwillig. Aber ich bin ja abhängig von Papa.«
»Ich auch«, sagte Constantin bitter.
»Jetzt sehe ich ihn und manches mehr mit anderen Augen, Conny. Ich habe damals nicht verstanden, dass er noch einmal heiraten wollte. Wozu, dachte ich, er hat doch seine Arbeit, die er liebt. Aber er liebt Charlotte, jetzt weiß ich es, und irgendwie gefiel es ihm wohl auch, zu seinem langweiligen Sohn eine so charmante, temperamentvolle Tochter zu bekommen. Es nimmt ihn sehr mit, dass Bettina an dieser schrecklichen Krankheit leidet. Ich habe indessen begriffen, dass Geld auch Segen bringen kann und mein Vater nicht der besitzgierige Kapitalist ist, für den ich ihn lange Zeit hielt, da ich nun mal eine soziale Ader habe. Für Papa ist es arg, dass er mit all seinem Geld Bettina nicht helfen kann, aber …«
»Er hilft uns sehr«, fiel ihm Conny ins Wort. »Ich wüsste wirklich nicht, wie ich es schaffen sollte, Bettina alle Annehmlichkeiten zu verschaffen, die ihr dieses trostlose Leben erleichtern. Ich hätte ihr niemals ein solches Haus kaufen können. Ich könnte auch diesen Sanatoriumsaufenthalt nicht finanzieren.«
»Mach dir keine Gedanken, Conny«, sagte Jon, »Paps tut das Geld nicht weh. Ich hoffe nur, dass Charlotte für ihn so viel Verständnis aufbringt, dass sie nicht von ihm verlangt, hier untätig herumzusitzen.«
»Sie wollen eine Ostasienreise antreten, wenn Bettina im Sanatorium ist und Charlotte die Impfungen zugemutet werden können.«
»Ich weiß nicht, ob man ihr das zumuten kann, Conny«, sagte Jon nachdenklich. »Ich fürchte, dass sie psychisch und physisch am Boden ist. Es ist schrecklich für eine Mutter, ihrem einzigen Kind nicht helfen zu können. Es ist auch schrecklich für dich, so hilflos zuschauen zu müssen.«
»Es ist für jeden schlimm, der damit konfrontiert wird. Nur gut, dass Eva Erfahrungen mit dieser Krankheit hat und uns nicht davonläuft. Sie lässt sich auch durch den ständigen Stimmungswechsel nicht abschrecken.«
»Du bringst auch viel Verständnis auf, Conny«, warf Jon leise ein.
»Bettina tut mir entsetzlich leid, und schließlich ist sie meine Frau.«
»Sie kann noch viele Jahre leben«, sagte Jon heiser. »Und du bist jung, Conny.«
»Soll ich mein Kind nehmen und gehen? Soll ich sagen: ›Seht zu, wie ihr fertig werdet‹?«
»Man würde letztendlich auch dafür Verständnis aufbringen müssen«, meinte Jon mit schwerer Stimme. »Meines hättest du. Es war doch nicht die große Liebe, Conny, aber vielleicht findest du diese eines Tages, und was dann?«
»Ich denke nicht in die Zukunft. Ich muss mit der Gegenwart und ihren Gegebenheiten fertig werden.«
»Wann immer du einen Freund brauchst, Conny, du kannst dich auf mich verlassen«, versicherte der junge Arzt.
»Siehst du, alles hat auch etwas Gutes in sich, Jon. Ich hatte nie einen richtigen Freund. Ich habe in meinem bisherigen Leben auch keine echte Hilfsbereitschaft kennengelernt. Auch das ist eine Verpflichtung. Ich habe mich einmal für einen sehr gefährlichen Beruf entschieden. Es hat mich sogar gereizt, mit der Gefahr zu spielen. Man sagt: Wer die Gefahr sucht, kommt darin um. Aber so ist es nicht. Man gibt nicht so schnell auf, wenn die Situation auch aussichtslos erscheint. Man versucht damit fertig zu werden, wie lange es auch dauern mag. Im Grunde kommt alles doch so, wie es einem bestimmt ist. Auch diese Erkenntnis habe ich erst jetzt gewonnen. Ich lebe nicht nur für mich. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich beginne mein Kind zu lieben. Ich will für Sandra leben.«
*
Es war spät geworden, als Jon sich verabschiedete. Constantin hörte das Kind weinen, als er sich in sein Zimmer begeben wollte, nachdem er noch einmal nach Bettina geschaut hatte. Sie schlief jetzt, aber er brachte es nicht fertig, sich neben sie zu legen, wie sie es gewünscht hatte. Er hätte kein Auge zutun können.
Er ging ins Kinderzimmer, aber Eva war schon bei dem Baby. Sie hielt es im Arm und sprach beruhigend auf das kleine Wesen ein.
Constantin blieb an der Tür stehen und verhielt sich ganz still. Sandra hatte sich schnell beruhigt, und Eva legte die Kleine wieder ins Bettchen zurück.
Dann drehte sie sich zu ihm um. Sie hatte seine Nähe gespürt, obwohl sie ihn nicht hatte kommen hören.
Auf Zehenspitzen kam sie auf ihn zu. »Sie hat nur geträumt«, sagte sie flüsternd.
»Können Babys denn schon träumen?«, fragte er erstaunt.
Eva zog den türkisfarbenen Frotteemantel enger um sich. »Natürlich träumen sie«, erwiderte sie ernst.
»Und was träumen sie?«
»Das weiß ich nicht.« Sie lächelte flüchtig, und gerade dieses Lächeln bewirkte es, dass er sie plötzlich mit anderen Augen betrachtete. Die so unauffällige Eva wirkte mit ihrem blassen müden Gesicht schöner, als Bettina in ihren besten Stunden je auf ihn gewirkt hatte, und sein Herz begann schmerzhaft zu pochen. Warum hatte er nur immer so viel auf Äußerlichkeiten gegeben? Warum war sein Blick nicht mal auf ein solches Mädchen gefallen, das so viel mehr zu geben hatte als diese hübschen, schillernden Geschöpfe, die nur seine Sinnlichkeit erregt hatten?
»Wovon träumen Sie, Eva?«, fragte er gedankenverloren.
Sie sah ihn überrascht an. »Ich weiß es auch nicht, aber eigentlich träumt ja jeder Mensch. Ich kann mich nur nie daran erinnern, wenn ich erwache. Es wäre wohl auch zu verführerisch, sich eines schönen Traumes zu erinnern, weil man dann hoffen könnte, dass er in Erfüllung geht.«
»Vielleicht träumt man manchmal auch mit offenen Augen«, sagte er leise. »Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Eva, und einen sehr schönen Traum, der sie den Alltag vergessen lässt, der ja wahrhaft nicht erfreulich für Sie ist.«
»Oh, ich habe sehr viel Freude an Sandra«, erwiderte sie leise. »Gute Nacht, Herr Hammilton.«
Während Constantin noch lange wach lag, schlief Eva bald ein, und sie träumte einen wunderschönen Traum, aber als sie am Morgen erwachte, meinte sie, dass es nur ein Wunschtraum gewesen sei, denn in ihm war sie mit Constantin durch einen blühenden Garten gegangen, und zwischen ihnen Sandra in einem weißen Kleidchen. Sandra hatte dann Blumen gepflückt und ihr diese gebracht. »Für meine liebe Mami«, hatte sie gesagt.
Eva erschrak und legte ihre Hände vor das Gesicht, vor die Augen, die so verträumt in den Spiegel schauten.
Aus dem Kinderzimmer drang ein helles Jauchzen an ihr Ohr. Sandra erwachte, und sie weinte nicht an diesem Morgen. Als Eva an ihr Bett eilte, strampelte sie und fuchtelte mit den Ärmchen.
Eva hob sie empor. »Mein Liebling«, flüsterte sie zärtlich, »mein kleiner Liebling, es war ja nur ein Traum, aber ich werde bei dir bleiben, solange man es zulässt.«
Und wenn ich Constantin liebe – wen geht es etwas an?, dachte sie. Niemand wird es erfahren. Mein Traum gehört nur mir.
*
Für Constantin begann der Morgen schreckensvoll. Schrilles Schreien aus Bettinas Zimmer weckte ihn auf, während Eva das Baby fütterte. Er sprang aus dem Bett, noch völlig benommen, weil er nur knapp zwei Stunden unruhig geschlafen hatte. Er wurde mit einem wüsten Wortschwall von Vorwürfen überfallen, als er zu Bettina kam.
Warum er nicht bei ihr geschlafen hätte, warf ihm Bettina vor. Schließlich wäre es seine Pflicht, sich um sie zu kümmern. Sie hätte Durst, und Eva hätte ihr die Zigaretten weggenommen.
Sie sah so erschreckend aus, dass jedes Gefühl in ihm erstarb. Er umfasste ihre Arme und schüttelte sie. Im nächsten Augenblick war er entsetzt über sich selbst.
»Komm doch zu dir, Bettina«, sagte er. »Ein paar Stunden muss ich auch schlafen. Ich muss doch einen klaren Kopf für die Arbeit haben.«
»Ich brauche dich, und du brauchst nicht zu arbeiten«, stieß sie hervor. »Jonas hat genug Geld, er braucht es nicht auf kostspieligen Reisen zu vergeuden, die Mama ohnehin nicht bekommen würden.«
Er hielt ihre Hände fest. »Jonas hat viel für uns getan, Bettina. Er hat das Haus verkauft. Er hat es dir geschenkt. Er schickt dich zur Kur und …«
»Zu welcher Kur?«, fragte sie.
»Du hast mir gestern doch selbst gesagt, dass du gern in ein Sanatorium gehen würdest, um gesund zu werden. Du möchtest an unserem Hochzeitstag wieder tanzen können, hast du gesagt.«
Er wusste nicht, wer ihm diese Worte in den Mund legte. Er war nicht fähig zu denken.
Und wie schon so oft, schlug auch diesmal ihre Stimmung um.
»Ja, ich möchte unseren ersten Hochzeitstag herrliche feiern, Conny«, sagte sie. »Sei nicht böse, dass ich dir Vorwürfe gemacht habe. Ich fühle mich nur so allein, und Eva nimmt mir alles weg, was ich mag.«
»Sei nicht ungerecht, Bettina. Eva weiß, dass die vielen Zigaretten dir nur schaden, ebenso wie der starke Kaffee. Schließlich ist sie Krankenschwester.«
»Mir kann nichts schaden, was ich mag«, antwortete die Kranke trotzig. »Wenigstens du solltest Verständnis dafür haben, Conny. Ich möchte jetzt mein Frühstück. Wo ist Eva? Schläft sie noch?«
»Sie wird bei Sandra sein«, erwiderte er, »bitte, gedulde dich noch.«
»Das Kind kann doch warten«, widersprach sie.
»Und wenn es weint, regst du dich wieder auf«, erwiderte er.
Ihre Augen verengten sich. »Ich bin nur froh, dass Eva so hässlich ist«, sagte sie, »sonst würdest du mir am Ende noch untreu werden.«
Hässlich?, dachte er. Das finde ich gar nicht. Aber es war ein beruhigender Gedanke, dass Bettina so dachte. Es war für ihn eine Qual, sie anzusehen, denn sie sah jetzt wirklich hässlich aus mit dem verzerrten fahlen Gesicht.
»Warum sagst du nichts?«, fragte sie. »Bist du mir schon untreu?«
»Ich habe wirklich andere Sorgen«, stieß er hervor. »Eva wird dir dein Frühstück gleich bringen. Ich muss mich fertig machen fürs Büro.«
»Ich möchte wissen, was du den ganzen Tag treibst«, sagte sie. »Du erzählst mir gar nichts mehr. Was hast du für eine Sekretärin? Ist sie attraktiv?«
»Ich habe keine Sekretärin. Wir haben Schreibkräfte, Bettina. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie sie aussehen. Was ich zu diktieren habe, spreche ich auf Band, und das wird weitergegeben.«
Nun lachte sie auf. »Auf Tonbänder brauche ich ja wohl nicht eifersüchtig zu sein«, sagte sie. »Eva soll sich jetzt um mich kümmern. Sie kann das Kind ins Wohnzimmer stellen, da höre ich nicht, wenn es schreit, und es kann ruhig mal schreien.«
Mit einem beklemmenden Gefühl verließ er das Zimmer, aber er fand Eva nicht mehr bei Sandra. Die Kleine schlief schon wieder. Mit heißer Zärtlichkeit betrachtete er das Kind. So lieb war die Kleine, obwohl sie Mutterliebe gar nicht kennenlernte. Aber war Eva nicht wie eine Mutter zu ihr? Sie war die Bezugsperson für das Kind. Er hatte gelesen, dass jedes Kind eine Bezugsperson brauchte.
War es nicht seltsam, dass er Sandra als sein Kind lieben lernte, und Bettina, als Sandras Mutter, es nicht liebte?
Er fand Eva in der Küche. Leise wünschte er ihr einen guten Morgen. Sie erwiderte seinen Gruß.
»Meine Frau verlangt nach ihrem Frühstück«, sagte er rau.
»Ich bin schon dabei«, erwiderte Eva.
»Sie ist sehr gereizt, nehmen Sie es sich nicht zu Herzen«, sagte Constantin.
»Ich kenne solche Zustände«, erwiderte sie ruhig.
»Geben Sie ihr die Zigaretten und den Kaffee. Schaden kann ihr doch nichts mehr.«
Eva blickte auf. »Ich bin nur besorgt, dass sie nachts raucht und dann das Zimmer in Brand setzen könnte«, meinte sie.
»Sie denken auch an alles«, murmelte er.
»Das muss ich ja wohl.«
Er lehnte sich an den Türrahmen. »Machen Sie es mir zum Vorwurf, dass ich nicht mit Bettina in einem Zimmer schlafen kann?«
»Nein«, erwiderte Eva lakonisch.
»Das wäre auch zu viel verlangt«, sagte er heiser.
*
Jonas Bernulf brachte seine Frau selbst in die Prof.-Kayser-Klinik. Dr. Eckart Sternberg war bereits von Dr. Laurin informiert, und ein hübsches Zimmer war für Charlotte reserviert worden. Aber Dr. Sternberg genügte ein Blick um festzustellen, dass er in Charlotte Bernulf ein Nervenbündel vor sich hatte.
Sie brach schon in Tränen aus, als er bei ihr die notwendige Blutabnahme machte. Er verabreichte ihr ein Beruhigungsmittel, das bald seine Wirkung zeigte. Sie schlief ein.
Jonas Bernulf wartete geduldig, bis Dr. Sternberg kam und ihm sagte, dass er die weiteren Untersuchungen erst am nächsten Tag vornehmen könne.
»Ich glaube nicht, dass Ihre Frau einer anstrengenden Reise körperlich gewachsen ist«, erklärte der Chirurg.
»Aber sie braucht Tapetenwechsel«, sagte Jonas Bernulf. »Wenn sie dauernd an Bettinas Bett sitzt, dreht sie noch völlig durch.«
Dr. Sternberg stimmte mit Dr. Laurin darin überein, dass man in diesem Fall auch an die noch gesunden Familienmitglieder denken müsste.
»Könnten Sie diese Reise nicht aufschieben, Herr Bernulf?«, fragte er.
»Ich will sie nicht aufschieben, ich kann es nicht, Herr Dr. Sternberg. Mit Ihnen kann ich ja wohl offen sprechen. Ich bin kein armer Mann, aber so reich bin ich nicht, dass ich nur von vorhandenem Vermögen zehren kann. Zudem weiß ich nicht, was noch auf mich zukommt. Ich will mich nicht um eine Verantwortung herumdrücken, aber vielleicht muss ich einer solchen auf lange Zeit hinaus gerecht werden. Selbstverständlich ist die Gesundheit meiner Frau vordringlich – bei allen Erwägungen. Wenn ihr eine solche Reise nur schaden könnte, müssten wir nach einem Ausweg suchen.«
»Ich habe auch für Sie alles Verständnis, Herr Bernulf«, versicherte der Arzt. »Sicher wäre für Ihre Frau eine Kur vordringlicher als eine Reise.
Jonas Bernulf runzelte die Stirn. »Bringen Sie es ihr bei?«, fragte er.
»Ich könnte es versuchen.«
»Versuchen kann man ruhig alles, ob es gelingt, ist die andere Frage.«
»Warten wir die Blutbefunde ab«, sagte Dr. Sternberg.
»Sie befürchten doch nicht etwa, dass Charlotte an der gleichen Krankheit leiden könnte wie ihre Tochter?«, fragte Jonas beklommen.
»Dafür hätten sich schon früher Anzeichen ergeben«, erwiderte Dr. Sternberg ruhig. »Aber es gibt auch noch andere Krankheiten, die bedrohlich werden könnten. Könnten, sage ich, nicht müssen.«
»Ich verstehe.«
Die Blicke der beiden Männer trafen sich.
Jonas Bernulf straffte sich.
»Ich bin ein Mann, der mit Tatsachen besser fertig wird als mit falschen Hoffnungen, Herr Dr. Sternberg. Ich möchte nicht, dass Sie denken, meine Geschäfte wären mir wichtiger als meine Familie. Wenn ich nämlich an meine Geschäfte denke, dann vor allem hinsichtlich der Absicherung dieser unglücklichen Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Ich kann es mir einfach nicht leisten, mich Illusionen hinzugeben, wenn Sie begreifen, was ich damit sagen will.«
»Ich begreife Sie, Herr Bernulf«, versicherte Dr. Sternberg. »Sie bedenken, dass Frau Hammilton noch viele Jahre leben könnte.«
»Wollen Sie mir das ausreden?«, fragte Jonas Bernulf. »Ich habe mich mit dieser Krankheit in den letzten Wochen sehr genau beschäftigt und mir Informationen beschafft, wo immer sie zu beschaffen waren.«
»Ich will Ihnen nichts ausreden«, erwiderte Dr. Sternberg. »Ich möchte Ihnen eher einreden, dass Sie auch an sich denken müssen. So schlecht ist es um meine Menschenkenntnis nicht bestellt, dass ich nicht erkenne, wie sehr Sie gefühlsmäßig engagiert sind. Sie können nicht abschütteln, was um Sie herum vor sich geht.«
»Wer kann das schon?«, fragte Jonas.
»Oh, sehr viele Menschen. Es ehrt Sie, dass Sie daran nicht denken.«
Jonas Bernulf starrte schweigend zu Boden.
*
Eva hatte es an diesem Tag nicht schwer mit Bettina. Nachdem Constantin das Haus verlassen hatte, frühstückte die Kranke fast eine Stunde lang. Dabei las sie Zeitung und rauchte drei Zigaretten. Die Kaffeekanne war auch geleert.
»Jetzt geht es mir gut«, sagte Bettina. »Man darf mir nicht alles nehmen, was dieses triste Leben einigermaßen angenehm macht. Nun sagen Sie nicht wieder, dass mir die paar Zigaretten schaden.«
Die paar Zigaretten wurden im Laufe des Tages immerhin zu einer Schachtel oder gar noch mehr. Aber Eva sagte nichts mehr, seit sie von Bettina ein paar Mal grob angefahren worden war.
»Ich möchte mich jetzt gern ein bisschen bewegen«, sagte Bettina.
»Sandras zweite Mahlzeit ist bald fällig«, wagte Eva nun doch einzuwenden.
»Na schön, dann später, das Kind ist ja wichtiger.« Es klang anzüglich, aber auch davon ließ sich Eva nicht irritieren. »Ich weiß es dennoch zu schätzen, dass Sie sich auch um mich kümmern«, fügte Bettina hinzu.
Eva versorgte das Baby und nahm sich dafür genügend Zeit. Sandra war ja tatsächlich die Hauptperson für sie, und die Zeit, die sie mit dem Kind verbringen konnte, war kostbar und gab ihr Kraft, das weniger Gute durchzustehen.
Als sie dann zu Bettina ins Zimmer kam, hatte diese plötzlich keine Lust mehr, sich zu bewegen. Sie hatte das Radio angestellt und hörte Musik.
»Elvis Presley«, sagte sie begeistert, »welch ein Jammer, dass er so jung sterben musste. Er war einfach hinreißend, finden Sie nicht auch, Eva?«
Die junge Pflegerin nickte nur, um Bettina nicht zu widersprechen. Sie mochte nur klassische Musik. Elvis Presley war für sie nur ein Name, den man oft genug gelesen und gehört hatte.
»Setzen Sie sich zu mir«, sagte Bettina. »Erzählen Sie mir von sich. Was haben Sie für Interessen? Haben Sie einen Freund? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?« Sie geriet ins Stocken und sagte dann entschuldigend: »Bei uns haben Sie ja bisher leider kaum Freizeit. Aber das wird besser, wenn ich aus dem Sanatorium komme. Sie werden doch bei uns bleiben, Eva?« Das klang fast flehend.
»Ja, ich bleibe gern.«
»Und wie ist das mit dem Freund?«, fragte Bettina neugierig.
»Ich habe keinen Freund.«
Bettina musterte sie. »Sie müssen mehr aus sich machen, Eva. Sie können sich auch ein paar Kleider von mir nehmen«, sagte sie großmütig.
»Vielen Dank, aber ich brauche nichts.«
»Ich will Sie nicht kränken, aber wenn Sie sich gar zu unscheinbar geben, werden Sie nie einen Mann bekommen«, meinte Bettina.
»Ich will niemanden beeindrucken«, erklärte Eva ruhig. »Ich habe auch nicht die Absicht, zu heiraten.« Alles, was Bettina so hintergründig sagte, wollte sie doch nicht widerspruchslos hinnehmen.
»Waren Sie noch nie verliebt, oder sind Sie schon mal enttäuscht worden?«, fragte Bettina.
»Ich war noch nie verliebt, und ich bin auch noch nicht enttäuscht worden.«
»Also eine standhafte Jungfrau«, lachte Bettina spöttisch auf. »Wollen Sie vielleicht mal ins Kloster gehen?«
»Ja, vielleicht«, erwiderte Eva ernst.
Bettina kniff die Augen zusammen. »Dann brauche ich ja nicht besorgt zu sein, dass Sie mit meinem Mann flirten, wenn ich im Sanatorium bin«, sagte sie.
»Sie können ganz unbesorgt sein, Frau Hammilton«, sagte Eva ironisch.
»Sie werden es mir aber berichten, wenn er eine andere Frau mit hierherbringt.«
»Ich glaube nicht, dass Herr Hammilton so geschmacklos wäre.«
»Sie verstehen nichts von Männern, Eva. Man darf ihnen niemals trauen. Meinem Mann sind fast alle Frauen nachgelaufen. Aber mich hat er geheiratet«, erklärte sie triumphierend. Und wieder schlug ihre Stimmung um. »Bringen Sie mir das Telefon ans Bett. Sie können jetzt wieder an die Arbeit gehen.«
*
Dr. Laurin ging am frühen Nachmittag zur Chirurgischen Abteilung hinüber, in der nun auch Charlotte Bernulf von Dr. Sternberg betreut wurde. Nicht jeder Patient, der ihm anvertraut wurde, musste mit dem Operationssaal Bekanntschaft machen. Dr. Sternberg war es auch lieber, wenn er das Skalpell nicht in die Hand nehmen musste. Manchmal war das Operationsmesser jedoch die einzige Rettung für einen Patienten. Doch leider kam mancher Eingriff zu spät, weil der Patient sich zu lange dagegen gesträubt hatte.
So war es auch im Fall des Herrn Roloff gewesen, den Dr. Sternberg noch vor zwei Tagen zu retten versucht hatte, aber der Magenkrebs war zu weit fortgeschritten gewesen. Herr Roloff war vor einer Stunde gestorben, und Dr. Sternberg war von der Ehefrau mit den bittersten Vorwürfen bedacht worden.
»Nimm es dir doch nicht so zu Herzen, Eckart«, sagte Leon Laurin, der davon durch Moni Hillenberg erfahren hatte. »Du hast getan, was du konntest. Niemand kann dir etwas anhaben.«
»Als er vor einem Jahr bei mir war, wäre er vielleicht noch zu retten gewesen, aber als ich von Operation sprach, ist er geflüchtet. Die Frau hat mir mit dem Anwalt gedroht.«
»Du hast ihr damals doch gesagt, dass nur eine schnelle Operation ihren Mann noch retten könne«, meinte Dr. Laurin. »Ich erinnere mich genau.«
»Und da hat sie gesagt, dass ich den Teufel nicht an die Wand malen soll. Mich trifft keine Schuld, das weiß ich, Leon, aber es ist so bitter, wenn man zum Sündenbock gestempelt wird. Jetzt ist die Operation plötzlich schuld, dass er sterben musste.
»Wir wissen, dass es nicht so ist. Was ist mit Frau Bernulf?«
Dr. Sternbergs Miene verdüsterte sich noch mehr. »Blutsenkung schlecht, Blutbild ebenso.«
»Diagnose?«, fragte Dr. Laurin.
»Perniziöse Anämie. Ja, es ist traurig, aber Herr Bernulf wird es erfahren müssen, dass auch seiner Frau keine lange Lebensdauer beschieden ist.«
»Wobei wir allerdings wissen, dass die kranke Tochter noch lange leben kann, so weit man das als Leben bezeichnen kann. Manchmal ist es zum Verzweifeln, Eckart.«
»Jedenfalls würde eine Impfung einem Totschlag gleichkommen. Aber wer soll es diesem geplagten Mann sagen?«
»Hat dich aller Mut verlassen? Dann werde ich es tun. Aber wir werden warten, bis Bettina Hammilton im Sanatorium ist. Jetzt bleibt die Frage, wer länger leben wird. Wahrhaft ein Trauerspiel.«
Dementsprechend war auch seine Stimmung, als er an diesem Abend heimkam. Antonia und die Kinder merkten sofort, dass er nicht zu Späßen aufgelegt war, obwohl er sich bemühte, ein heiteres Gesicht zu zeigen. Aber wenn Leon Laurin so lange im Bad zubrachte, bevor er sich an den Tisch setzte, wussten alle Bescheid.
Die Kinder waren rücksichtsvoll. So geschah es dann, dass sich alle vier, auch die kleine Kyra, ganz schnell zurückzogen mit der Ausrede, dass sie noch Schulaufgaben machen müssten. Da sah Leon Laurin dann seine Frau doch etwas verblüfft an.
»Es hat doch erst Zwischenzeugnisse gegeben«, sagte er. »Warum sind sie denn so eifrig?«
»Weil sie merken, dass du nicht in Stimmung bist, Liebster«, erwiderte Antonia.
»Merkt man mir das wirklich sofort an?«, fragte er erstaunt.
»Ich schon, und Karin auch. Sie hat dann schnell ein Zuckerl für die Kinder bereit. Aber du kannst auch Vanilleeis mit Schokolade haben, wenn dir der Sinn danach steht.«
»Mir steht der Sinn nach einem doppelten Whisky«, erwiderte er. »Wir habe doch noch den guten von McLean.«
Er schlug sich an die Stirn, während Antonia schon die Flasche holte. »McLean«, rief er aus, »warum bringe ich ihn zuerst mit dem Whisky in Verbindung und nicht mit seiner Forschung über die Anämie?«
»Wer leidet an Anämie?«, fragte Antonia.
»Charlotte Bernulf. Perniziöse Anämie.«
»Mit Sicherheit?«
»Zweifelst du an Eckarts Diagnose?«
»Nein, aber das ist furchtbar. Ich glaube nicht, dass der gute Professor McLean da helfen kann. Er weiß zwar genau, welches der beste Whisky ist, aber gegen perniziöse Anämie wird er auch noch kein Heilmittel gefunden haben. Trink jetzt erst mal, mein Schatz.«
»Und dann rufe ich ihn an. Vielleicht hat er doch etwas zusammengebraut. Ich halte viel von diesem alten Schotten.«
»Jedenfalls kann er einen guten Whisky brennen«, sagte Antonia aufmunternd. »Und der wird ihm mehr einbringen als die mühselige Forschung.«
»Damit verdient er aber das Geld, um weiterzuforschen«, sagte Leon. »Wer gibt es ihm sonst? Und wo wären wir, wenn es nicht solche Männer gäbe wie den guten Charly. Er müsste nur noch einige Jahre jünger sein.«
»Und ein bisschen mehr unterstützt werden«, fügte Antonia hinzu.
Leon trank seinen Whisky. Dann wählte er die Nummer von Professor McLean.
Antonia ließ ihren Mann nicht aus den Augen. Sie hörte seine Stimme, und sie beobachtete sein Mienenspiel. Sie sah, wie er erblasste, sie hörte, wie er stockend sagte: »I’am sorry. Beg your pardon.« Dann legte er langsam den Hörer auf.
»McLean ist vorige Woche gestorben, Antonia«, sagte er stockend. »An perniziöser Anämie. Nun wissen wir, warum er so besessen war, ein Gegenmittel zu finden.«
»Und warum er einen so guten Whisky brennen ließ«, flüsterte Antonia. »Aber vielleicht war der für ihn eine Hilfe.«
Sie schenkte sich auch ein Glas ein. »Auf McLean, der helfen wollte«, sagte sie. »Es war ihm nicht vergönnt, wie vielen vor ihm, Leon. Aber du lebst und kannst helfen. Der gute McLean wäre dir sehr böse, wenn du resignieren würdest. Wie alt ist er geworden?«
»Lass mich überlegen, Antonia. Achtundsechzig? Nein, in diesem Jahr hätte er seinen Siebzigsten feiern können.«
»Und man würde sagen, er hat ein erfülltes Leben im Dienste der Menschheit hinter sich gebracht.«
»Vielleicht sagen manche, dass er mit seinem Whisky die Menschen ruiniert hat.«
»Was man mit Maßen genießt, ist Genuss«, korrigierte Antonia. »Und wer kein Maß und Ziel kennt, wird nicht McLeanschen Whisky trinken, weil ihm dann bald die Mittel dazu fehlen würden. Er hat viel getan, und wem gelingt es schon, alles zu erreichen, was er sich vorgenommen hat? Wenn man ihm genügend Geld für seine Forschungen gegeben hätte, wäre er nicht auf den Gedanken gekommen, Whisky zu brennen. Kann man das eigentlich so nennen, Leon?«
»Ich weiß es nicht, aber der Whisky ist köstlich. Er ist fast Medizin, Antonia. Ein Glas genügt.« Er legte seine Hände um die Flasche. »Ein Andenken an einen großen Mann, der alles daran setzte, helfen zu wollen. Doch sein Leben war zu kurz.«
*
Am nächsten Tag erfuhr Jonas Bernulf, wie es um seine Frau stand. Es war ein Schock für ihn, obwohl er schon schlimme Ahnungen gehabt hatte. Nun war an die Reise nicht mehr zu denken, er hätte Charlotte jetzt auch keinesfalls allein gelassen. Er hatte sich gut in der Gewalt, als er sich zu ihr ans Bett setzte.
»Ja, mein Mädchen, mit der Impfung wird es nichts«, sagte er, »die würde dir nicht bekommen. Ich bin sehr froh, dass Dr. Sternberg ein so gewissenhafter Arzt ist und kein Risiko eingeht. Mir hat er auch empfohlen, eine solche Reise lieber noch aufzuschieben.«
»Was fehlt dir?«, erkundigte sie sich besorgt.
»Die Bauchspeicheldrüse ist nicht ganz in Ordnung, und eine Nahrungsumstellung würde ihr wahrscheinlich nicht bekommen«, übertrieb er, um seine Entscheidung zu rechtfertigen, mit ihr zusammen eine Kur zu machen. »Wir werden uns ein Sanatorium aussuchen, das dem nahe ist, wo Bettina die nächsten Wochen verbringen wird. Dann können wir sie öfter besuchen.«
»Das ist eine gute Idee«, sagte Charlotte. »Du bist sehr lieb, Jonas. Wie soll ich dir nur für alles danken, was du für Bettina tust?«
»Psst«, machte er und küsste sie leicht auf die Stirn. Von tiefer Wehmut war er erfüllt, aber er ließ sich nichts anmerken.
Bettina zeigte sich sehr erfreut, als er sie in seinen Plan einweihte. Sie hatte ein paar recht gute Tage, bevor Constantin sie zum Sonnenhof brachte. Der Name gefiel ihr, und das Gebäude, das auf das Modernste ausgestattet war, gefiel ihr noch mehr. Ein komfortables Zimmer wartete auf sie. Dass der Chefarzt ein interessanter Mann war, hob ihre Stimmung noch mehr. Constantin war es peinlich, mit welch lockenden Blicken sie gleich den ersten Flirtversuch machte. Dr. Eckart schien jedoch nicht schockiert zu sein.
Er sprach später, als er allein mit Constantin war, ganz offen darüber, dass gerade im Anfangsstadium dieser Krankheit junge Frauen sich in ihrer Weiblichkeit bestätigt sehen wollen.
»Es ist eine instinktive Reaktion«, erklärte er. »Man will nicht krank sein, nicht in die Ecke geschoben werden. Diese Krankheit weckt gewisse Aggressionen, für die man Verständnis haben muss. Ich werde tagtäglich damit konfrontiert.«
Constantin führte ein langes, gutes Gespräch mit ihm, und als er sich dann von Bettina verabschieden wollte, erlebte er, dass sie ihm völlig gleichgültig die Hand reichte.
»Du bist ja immer noch da«, sagte sie. »Hattest du mir nicht schon Adieu gesagt?«
Adieu, das tönte so endgültig in seinen Ohren, erschreckend kühl.
»Auf Wiedersehen, Bettina«, sagte er leise.
»Du brauchst mich nicht zu besuchen. Ich möchte meine Ruhe haben. Du glaubst ja doch nicht daran, dass ich wieder gesund werde. Du willst es auch gar nicht. Du willst mich loswerden.«
»Du hast keinen Grund, so zu sprechen, Bettina«, sagte er gepresst.
»Bettina, wie du das schon sagst«, lachte sie blechern auf. »Du bist doch schon so weit von mir entfernt. Nun geh endlich!«
Er ging. Er hatte in ihrem Blick ein hassvolles Funkeln bemerkt. »Sie will begehrt werden«, hatte Dr. Eckart zu ihm gesagt, »und sie fühlt, dass sie Ihnen nicht begehrenswert erscheint.«
Das war eine nüchterne Tatsache, wenn auch eine erschreckende. Wieder fragte sich Constantin, wie es weitergehen sollte, aber dann dachte er an das Kind. Wieder wunderte er sich, dass ihm das kleine Wesen nun doch so viel bedeutete. Dabei hatte er sich überhaupt nicht vorstellen können, Vater zu sein. Zuerst hatte er sich geschämt, dass Eva, die Fremde, die einzige Person war, die zärtlich und liebevoll mit der kleinen Sandra umging.
Ja, Eva und das Kind waren eine Einheit. Ein eigentümliches Gefühl bewegte Constantin bei solchen Gedanken. Je näher er seinem Haus kam, desto ruhiger wurde er, und plötzlich wusste er es ganz genau, dass er so lange ausharren konnte in diesem Haus, wie Eva dort sein würde. Seine Zuneigung galt nicht nur dem Kind, sie galt auch Eva. Eine Zuneigung, die fern von allem Begehren sein musste, eine tiefe Verehrung und Bewunderung für dieses bescheidene Mädchen, das so viel zu geben vermochte und nichts forderte.
Ohne sich über sein Tun Rechenschaft abzulegen, hielt er vor einem Blumengeschäft und kaufte einen Strauß zartrosa Rosen.
Ein Ausdruck der Erleichterung huschte über Evas blasses Gesicht, als sie ihm die Tür öffnete. Ihre Augen leuchteten auf, und Constantin meinte, noch niemals so schöne, warme Augen gesehen zu haben.
Er enthüllte die Rosen. »Ein kleiner Dank für all die Mühe, die Sie mit uns haben«, sagte er leise.
»Oh, vielen Dank«, stammelte sie, »wie wunderschön! Aber Mühe habe ich doch gar nicht.«
Er sah ihr zu, wie sie die Rosen behutsam in eine Vase ordnete, so ganz anders als Bettina, die manchmal sogar vergaß, die Vase mit Wasser zu füllen, manchmal auch einen Strauß erst auf dem Tisch liegen ließ. Aber durfte er jetzt Vergleiche ziehen?
»War Sandra brav?«, fragte Constantin.
»Sie ist immer brav. Ich hatte sie am Nachmittag auf die Terrasse gestellt. Sie strampelt jetzt schon ganz hübsch und stützt sich schon kräftig auf. Und Appetit hat sie immer.«
»Es wird Ihnen doch nicht zu einsam werden, wenn ich fort bin, Eva?«, fragte er.
Sie schüttelte stumm den Kopf, wandte sich dann aber schnell ab.
Bald darauf kamen Charlotte und Jonas, um sich zu erkundigen, wie Bettina untergebracht war. Eva verschwand schnell mit den Rosen in ihrem Zimmer.
»Hat sie einen Verehrer?«, fragte Charlotte spitz.
»Warum nicht?«, meinte Constantin ausweichend, um keinen neugierigen Fragen ausgesetzt zu werden.
»Meinst du nicht, dass es ungeschickt ist, sie allein mit dem Kind zu lassen? Jonas, wir sollte doch besser erst fahren, wenn Conny wieder zurück ist.«
»Unsinn«, brummte Jonas. »Eva ist die Zuverlässigkeit selbst. Wir fahren morgen, basta!« Wenn er etwas so bestimmt sagte, wagte Charlotte keinen Widerspruch. Jonas hatte eine leise Ahnung, von wem Eva die Rosen bekommen hatte, aber er war frei von irgendwelchen Hintergedanken, die Charlotte bestimmt gehegt hätte.
»Bettina gefällt es sehr gut«, berichtete Constantin. »Es ist ein schönes, gepflegtes Haus, und Dr. Eckart genießt schon Bettinas Sympathie.«
»Das ist gut«, sagte Charlotte. »Es ist immer gut, wenn man Vertrauen zu einem Arzt hat. Es kann ja auch durchaus sein, dass ihre Schwäche psychisch bedingt ist.«
Jonas warf Constantin einen bedeutungsvollen Blick zu, der ihn mahnte, ihr nicht zu widersprechen, aber das hätte Constantin ohnehin nicht getan.
»Ich werde mal nach unserem Püppchen schauen«, sagte Charlotte.
»Aber rede nicht so laut auf sie ein«, sagte Constantin, und Charlotte war entsprechend beleidigt. »Sie ist halt nur Evas leise Stimme gewöhnt«, fügte Constantin entschuldigend hinzu. Er hoffte, dass sich nun auch Jonas nicht gekränkt fühlte, aber der hatte ganz andere Gedanken.
Er legte die Hand auf Constantins Schulter. »Jetzt sind wir Leidensgenossen, Conny«, sagte er leise. »Ich muss es dir sagen, denn auch auf Charlotte müssen wir Rücksicht nehmen.«
»Was ist mit ihr?«
»Perniziöse Anämie. Ich darf es dir nicht verschweigen. Ich halte es für ratsam, dass Sandra ständig unter ärztlicher Kontrolle bleibt.«
»Sandra ist gesund«, stieß Constantin hervor.
»Ich würde dennoch einen guten Kinderarzt zu Rate ziehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht.«
»Es gibt doch harmlose Anämien«, sagte Constantin rau.
»Diese ist nicht harmlos. Man nennt sie auch die Addinsonsche. Dr. Sternberg hat seine Untersuchungen sehr gewissenhaft durchgeführt. Es kann durchaus sein, dass Bettina die Anlage geerbt hat und die Krankheit bei ihr nur anders zum Ausbruch gekommen ist. Im Grunde weiß man ja nur, dass man kaum etwas dagegen unternehmen kann. Jedenfalls darf Charlotte nichts erfahren.«
»Du bist sehr gefasst«, sagte Constantin gequält.
»Du warst es doch auch. Und wie’s da drinnen aussieht«, er legte seine Hand aufs Herz, »geht niemanden etwas an. Ich will, dass sie noch eine gute Zeit hat.«
»Hoffentlich wird sie nicht so aggressiv wie Bettina«, sagte Constantin. »Und ich kann auch nur hoffen, dass Bettina Dr. Eckart nicht so in die Enge treibt wie Jon.«
»Gibt es dafür Anzeichen?«, fragte Jonas besorgt.
Constantin fühlte sich ihm enger verbunden denn je. Er war ein feiner, aufrechter, geradliniger Mensch.
»Ja, die gibt es, aber Dr. Eckart ist so etwas anscheinend gewöhnt. Diese verfluchte Krankheit scheint auch eine Persönlichkeitsveränderung mit sich zu bringen.«
Sie unterhielten sich gedämpft, während sich Charlotte nun im Kinderzimmer aufhielt. Das Baby schlief. Rund und rosig war das Gesichtchen. Die Fäustchen hatte die Kleine an die Wangen gepresst.
Eva trat leise ein und wollte sich schnell wieder entfernen, aber Charlotte winkte ihr zu bleiben.
»Sie dürfen das Kind nicht zu gut füttern«, sagte sie. »Sie scheint mir sehr rund.«
»Sie ist gesund«, antwortete Eva, »und ich kontrolliere ihr Gewicht genau.«
»Ich will Ihnen ja nicht dreinreden, aber wir hoffen, dass Sandra nichts fehlt, wenn wir zurückkommen. Mein Schwiegersohn wird ja nicht oft anwesend sein. Sie können sich doch eigentlich nicht beklagen. Sie haben ein herrliches Leben hier, Eva.«
»Ich beklage mich nicht, und ich hoffe, Sie zufriedenzustellen.«
»Sie werden doch keine Herrenbesuche hier empfangen?«, sagte Charlotte mahnend.
»Ich habe keinerlei Herrenbekanntschaften«, erwiderte Eva.
»Und von wem waren die Rosen?«
»Ich habe sie mir gekauft«, erwiderte Eva geistesgegenwärtig. »Ich liebe Rosen.«
»Sie lassen doch das Kind nicht allein im Haus?«, sagte Charlotte mit schriller Stimme, und gleich begann Sandra zu schreien. Und wie sie schrie!
»Ich nehme Sandra selbstverständlich immer mit«, erklärte Eva ruhig.
Dann streichelte sie das Köpfchen des Kindes, und das Weinen verstummte.
»Na ja, Sie verstehen es wohl anscheinend recht gut mit ihr«, sagte Charlotte gönnerhaft. »Ich muss ja leider immer daran denken, dass meine Tochter durch die Geburt so leiden muss.«
Eva presste die Lippen aufeinander, damit ihr kein unbedachtes Wort entschlüpfte. Aber sie konnte erst wieder frei atmen, als Charlotte gegangen war. Und dann hörte sie, wie der Wagen wegfuhr.
Sie ging in die Küche, um Sandras Abendmahlzeit herzurichten.
Constantin stand am Kühlschrank. »Gibt es was für mich zu essen?«, fragte er.
»Selbstverständlich. Ich wusste nur nicht, wann Sie zurück sind. Ich habe Kalbsgulasch vorbereitet.«
»So viel habe ich gar nicht erwartet«, sagte er mit einem flüchtigen Lächeln. »Ein Schinkenbrot hätte es auch getan. Aber wenn Sie mir Gesellschaft leisten, schmeckt mir das Gulasch noch besser.«
»Sie wissen gar nicht, wie es schmeckt«, meinte Eva.
»Sie kochen ausgezeichnet, Eva. Ich wundere mich nur, wie Sie alles schaffen.«
»Liebe Güte, was müssen andere Frauen leisten, die vier oder fünf Kinder haben und manchmal noch mehr. Ich habe doch nur ein Kind zu versorgen.«
»Und das Haus halten Sie perfekt in Ordnung. Sogar meine Hemden sind gebügelt.«
»Das geht doch so nebenbei, wenn Sandra schläft. Möchten Sie Kartoffeln oder Nudeln, Herr Hammilton?«
»Nudeln kochen schneller. Was machen Sie noch so alles nebenbei?«
»Was mir halt so unter die Hände kommt. Ich musste zu Hause auch tüchtig helfen, und da hatten wir nicht so viel elektrische Geräte. Übrigens möchte ich Ihnen sagen, dass ich Frau Bernulf gesagt habe, ich hätte mir die Rosen selbst gekauft. Hoffentlich haben Sie nicht die Wahrheit gesagt. Sie ist misstrauisch.« Sie sah ihn dabei nicht an.
»Es ist in Ordnung, Eva«, sagte er mit einem eigenartigen Unterton. »Es würde ja doch nur an Ihnen ausgelassen werden. Und das will ich nicht. Ich kann es mir nämlich nicht mehr vorstellen in diesem Haus zu leben, wenn Sie nicht da wären. Aber wir müssen nachsichtig mit Charlotte sein. Sie leidet an pernizöser Anämie. Jonas hat es mir gesagt.«
Schreckensweit waren Evas Augen auf ihn gerichtet. »Das ist entsetzlich«, flüsterte sie. »Das ist fast zu viel.«
»Es sind harte, nackte Tatsachen. Ich komme mir vor wie auf einem Schleudersitz und kann doch nichts tun. Jonas hat mir geraten, Sandra ständig ärztlich kontrollieren zu lassen.«
»Sandra ist gesund«, stieß Eva hervor. »So viel verstehe ich auch von Kindern.«
»Bettina war auch mal gesund«, sagte er tonlos. »Ich liebe mein Kind, Eva. Ich habe es durch Sie lieben gelernt.«
»Durch mich?«, fragte sie etwas zögernd.
»Weil Sie Sandra lieben, weil Sie so behutsam mit ihr umgehen. Ich hatte dergleichen noch niemals erlebt. Ich hatte noch nie ein so winziges Baby gesehen.«
Eva wurde verlegen unter seinem Blick. »Das Essen ist in einer Viertelstunde fertig«, sagte sie rasch.
»Aber Sie müssen mir Gesellschaft leisten, Eva, bitte. Morgen früh muss ich weg.«
Er hatte das Bedürfnis, mit ihr zu sprechen und ihr all das zu sagen, was ihn bewegte und bedrückte. Das tat er dann auch, nachdem sie gegessen hatten.
Eva war anfangs verwundert, als er erzählte, wie er Bettina kennengelernt hatte. Dann begriff sie rasch, dass es nicht nur ein Mitteilungsbedürfnis war, sondern die Suche nach einem Ausweg aus dem Zwiespalt seiner Gefühle.
»Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht zu heiraten«, erklärte er, »auch Bettina nicht. Sie war reizend, aber es gab viele so reizende Mädchen, und ich wollte mich nicht binden. Ich liebte meinen Beruf, und ein Flirt war nur Ausgleich für die nervliche Belastung, die mein Beruf mit sich brachte. Nun, jedenfalls verstand es Bettina, mich mit dem Kind zum Standesamt zu zwingen.«
Eva sah ihn nachdenklich an. »Nur das war der Grund?«, fragte sie ruhig.
»Nur das, keine Liebe. Und ich bin überzeugt, dass Bettina für mich auch keine Liebe empfand. Sie mag sich das eingebildet haben, aber sie ist tiefer Gefühle gar nicht fähig. Warum ich Ihnen das erzähle, werden Sie sich fragen, Eva. Nun …«, er machte eine kleine Pause, »zwischen uns soll alles klar sein, das ist mein Wunsch. Sie bedeuten mir mehr als Bettina. Sie machen mir das Ausharren in diesem Haus erträglich. Aber ich kann mich nicht drücken, schon um Sandras willen nicht. Mein Gott, ich wünsche so sehr, dass Bettina gesund würde, damit ich mich auf faire Weise von ihr trennen könnte. Ich weiß, dass es aussichtslos ist. Ich weiß auch nicht, ob es jemals möglich sein wird, Sie zu fragen, ob Sie mir mehr als ein guter Freund sein könnten.«
Ein Zittern durchlief Evas Körper. »Sie haben es schon ausgesprochen«, sagte sie leise. »Und ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich bleiben werde, wenn man mich nicht fortschickt. Es kann noch ziemlich schlimm werden«, fuhr sie bebend fort. »Meine Schwester war anders als Bettina, aber manchmal gab es entsetzliche Stimmungen. Der kranke Mensch begreift es ja nicht, wenn er ungerecht ist. Er leidet, und er gibt anderen die Schuld daran. Warum also sollen sie nicht auch leiden? Aber es kann auch eine lange Zeit der Stagnation kommen bei dieser Krankheit, bis der nächste Schub kommt. Und so kann es zehn oder zwanzig Jahre weitergehen, die besten Jahre Ihres Lebens, Herr Hammilton.«
Er legte die Hände vor sein erstarrtes Gesicht. »Es ist gut, dass Sie es sagen, Eva. Es wäre ein Verbrechen, Sie festhalten zu wollen. Sie können gehen, wann immer Sie wollen.«
Sie stand auf. »Das wollte ich damit nicht sagen. Es wäre nicht gut, sich Illusionen hinzugeben.«
»Und Sandra soll so aufwachsen? Ohne frohe Kindheit?« Auch er hatte sich erhoben. Er starrte Eva blicklos an. »Ich hätte schweigen sollen«, murmelte er.
»Das würde doch alles nur schlimmer machen«, erwiderte sie sanft. »Sie haben doch einen Freund. Ich verstehe Ihre Verzweiflung, Constantin.« Weich sprach sie seinen Namen aus, und sie streckte ihm beide Hände entgegen, die er ergriff und an seine Lippen zog.
»Ich muss Sie um Verzeihung bitten, Eva. Es ist unverantwortlich von mir, Sie festhalten zu wollen.«
»Ich bleibe doch freiwillig«, erwiderte sie. »Und jetzt muss ich Sandra füttern.« Sie musste seiner Nähe entfliehen. Sie wollte nicht zu viel von ihren Gefühlen verraten. Es sollte bei freundschaftlichen Gefühlen bleiben. Mehr durfte nicht sein. All ihre Zärtlichkeit konnte sie Sandra schenken, und alles zwischen ihnen sollte gut bleiben, ehrlich und sauber.
Aber als Constantin sich am nächsten Morgen von ihr verabschiedete, überfiel Eva eine jähe, heftige Angst, dass ihm etwas passieren könnte. Sie sagte leise: »Passen Sie gut auf sich auf. Kommen Sie gesund zurück, Constantin.«
Er beugte sich zu ihr hinab und küsste sie auf die Stirn. »Liebe, kleine Eva«, sagte er mit zärtlicher dunkler Stimme. Ihr Herz klopfte stürmisch, und Tränen stiegen ihr in die Augen, als er ihr noch einmal zuwinkte.
Sie liebte ihn, und sie würde ihn immer lieben, auch wenn diese Liebe zum Verzicht verdammt war. Sie wusste es, aber sie wusste auch, dass ihre Gefühle erwidert wurden.
Sie nahm Sandra in die Arme, küsste sie auf die Stirn, wie vorher Constantin sie geküsst hatte.
»Du bist gesund, mein kleiner Liebling«, flüsterte sie, »dir darf nichts geschehen.«
Als Sandra wieder schlief, rief Eva Antonia Laurin an.
*
Beim Mittagessen ging es im Haus Laurin lebhaft zu. Die Zwillinge Konstantin und Kaja hatten sich wieder mal über einen neuen Lehrer zu beklagen.
»Der Strube macht alles anders als der Hilscher«, empörte sich Konstantin, »und wenn es dann schlechte Noten hagelt, sind wir die Dummen. Es ist doch ein starkes Stück, was die sich so einfallen lassen.«
»Hilscher kann doch nichts dafür, dass er krank geworden ist«, lenkte Kaja ein, »wenn man auch sagen muss, dass Strube sich an seinen Lehrplan halten müsste.«
»Ihr könnt doch auch reden, und ihr könnt ganz schön aufmucken«, war Leons Meinung.
»Mit dem kann man nicht reden«, beklagte sich Konstantin. »Der ist stur. Der brüllt los wie ein Stier. Vielleicht kann Mami mal mit ihm reden.«
»Besser gleich mit den Direx«, meinte Kaja. »Der kuscht, wenn Mami kommt.«
»Ihr seid mir die Richtigen«, lächelte Antonia, »sonst seid ihr ja auch nicht auf den Mund gefallen. Beruhigt euch erst mal. Man kann einen Menschen, auch einen Lehrer, nicht gleich nach der ersten Stunde beurteilen. Ihr habt ihm wahrscheinlich zu verstehen gegeben, dass Herr Hilscher eure Sympathien hatte und wart recht aggressiv, und da ist er halt auch aggressiv geworden. Wir unterhalten uns darüber noch in aller Ruhe.«
Für alle vier Kinder war es das ermahnende Stichwort, jetzt den Eltern ein halbes Stündchen Ruhe zu gönnen.
Antonia hielt sich nicht lange bei der Vorrede auf, als sie mit ihrem Mann allein war. »Ich fahre heute Nachmittag zu Eva«, erklärte sie ihm. »Sie hat mich angerufen und gebeten, die Kleine gründlich zu untersuchen.«
»Fehlt ihr was?«, fragte Leon bestürzt.
»Nein, das wohl nicht, aber Herr Bernulf ist jetzt besorgt, weil er meint, dass Sandra erblich belastet sein könnte. Kann diese Möglichkeit eigentlich bei Bettina auch bestehen?«
»Gewisse Anlagen werden wohl fast immer weitergegeben an die Kinder und Kindeskinder«, erwiderte Leon, »aber es ist nicht die Norm.«
»Jedenfalls finde ich es vernünftig, wenn man nicht die Augen verschließt vor den Eventualitäten. Übrigens ist Eva jetzt ganz allein mit dem Baby. Herr Hammilton befindet sich auf einer Geschäftsreise.«
»Dann wird es Eva auch guttun, wenn sie eine Ansprache hat«, meinte Leon. »Du wirst ja feststellen, ob sie den Umständen gewachsen ist.«
Davon konnte sich Antonia überzeugen, und ebenso davon, dass die kleine Sandra kerngesund war.
»Ist Ihnen nicht bange, wenn Sie allein sind in dem großen Haus, Eva?«, erkundigte sich Antonia.
»Nein, es kommt ja doch alles, wie es einem bestimmt ist«, erwiderte die junge Krankenschwester ernst.
Ja, so war es wohl, wenn auch manche Menschen sich gegen schicksalhafte Bestimmungen auflehnten. Es sollte sich gerade in dieser Familie erweisen.
*
Bettina hatte sich die ersten zwei Wochen im Sanatorium sehr wohlgefühlt, und Charlotte schien sich überraschend gut zu erholen. Jonas erlebte seine Frau heiter und zuversichtlich, und wenn sie Bettina besuchten, war Charlotte voller Hoffnung, dass diese Kur einen Umschwung zur Genesung brachte. Jonas bemühte sich, seine pessimistischen Gedanken nicht laut werden zu lassen. Dann erklärte Bettina plötzlich, dass sie es satt hätte, immer von Kranken und Gebrechlichen umgeben zu sein. Sie fühle sich jetzt wohl genug, um heimzufahren, und außerdem wolle sie ihren ersten Hochzeitstag festlich begehen. Mehr denn je erwartete sie, dass man ihr keinen Wunsch abschlug, und so fuhren sie dann heim. Jonas hatte es Constantin telefonisch angekündigt, dass sie anderntags heimkehren würden und dass er Bettina einen festlichen Empfang bereiten möge.
»Es ist aus mit dem Frieden, Eva«, sagte Constantin leise. »Sie kommen morgen. Und nun muss ich etwas auf die Beine stellen, damit der Hochzeitstag gefeiert werden kann.« Bitter klang seine Stimme. Resignation zeichnete sich auf seinem ernsten Gesicht ab.
Er hatte sich gut in seine neue Stellung hineingefunden. Er hatte seine seelischen Konflikte mit einer Arbeitswut ohnegleichen verdrängt. Er hatte sich ausruhen können, wenn er heimkam. Eva verströmte eine wundervolle Ruhe. Sie wussten, dass ihre Herzen füreinander schlugen, wenn sie auch kein Wort darüber verloren, es mit keinem Blick verrieten. Sie hatten beide die Kraft, Freunde im besten Sinne des Wortes zu sein.
Sandra krabbelte schon lebhaft in ihrem Bettchen herum und versuchte sich mit eigener Kraft emporzuziehen. Constantin hatte sich an ihrem Jauchzen erfreuen können, und er war gelöst und glücklich, wenn sie noch heller jauchzt, wenn er sie empornahm und durch die Luft schwenkte. Sollte dies alles nun wieder vorbei sein?
»Ich kann mich nicht verstellen, Eva«, sagte er deprimiert. »Ich kann Bettina keine Gefühle heucheln, jetzt weniger denn je. Woher soll ich die Kraft nehmen, dich wie eine Fremde anzusprechen?« Zum ersten Mal sagte er du zu ihr, und ihr Herz begann schmerzhaft zu klopfen. Aber sie sah ihn offen an.
»Wir werden die Kraft haben, Constantin«, sagte sie verhalten. »Wir müssen immer daran denken, dass sie wenigstens Mitleid verdient.«
»Wenigstens Mitleid«, wiederholte er mühsam. »Aber nicht die Spur mehr. Ich liebe dich. Mag ich dafür verdammt werden, aber das allein ist die Wahrheit.«
Sie schluckte die aufsteigenden Tränen herunter.
»Ich verdamme dich nicht, Constantin«, flüsterte sie.
Er legte den Arm um sie und zog sie an sich, ganz leicht und behutsam. »Du bist so tapfer«, murmelte er. »Ich muss mich schämen.«
»Ich erwarte nichts. Ich habe kein Recht dazu«, sagte Eva leise, und dann wandte sie sich schnell ab und ging zu dem Kind. Sie machte sich auch ihre Gedanken. Was würde schmerzhafter für sie sein? Auf das Kind zu verzichten oder Constantin nicht mehr sehen zu dürfen? Sie fürchtete sich vor Charlottes misstrauischen Blick. Sie war nicht so ruhig, wie sie sich Constantin gegenüber zeigte.
Sie richtete die Räume festlich her. Constantin brachte Blumen in Fülle, aber keine Rosen. Nur eine wunderschöne dunkelrote Rose für sie, und ein goldenes Halskettchen mit einem Medaillon.
»Aber …«, begann sie stockend, doch er legte ihr den Finger auf den Mund. »Sag nichts, Eva, etwas von mir muss immer bei dir sein. Wie schwer der Weg auch sein wird, den wir gehen müssen – du bist das Beste in meinem Leben.«
Und dann küsste er sie zum ersten Mal, zart und doch innig, und sie erwiderte seinen Kuss.
*
Am nächsten Tag kamen sie. Charlotte, Jonas und Bettina. Es war eine schreckliche Heimfahrt gewesen, die sich in Charlottes Mienenspiel widerspiegelte. Bettina war eine Viertelstunde lang in euphorischer Stimmung gewesen, um dann ins Gegenteil umzuschlagen. Nie würde sie sich wieder einsperren lassen, hatte sie gewütet. Nichts hätte man ihr erlaubt. Nur gequält hätte man sie, und in Dr. Eckart hätte sie sich genauso getäuscht wie in Jon. Dann hatte sie Charlotte Vorwürfe gemacht, dass sie sich nicht um sie gekümmert hätte.
Nun war sie so erschöpft, dass sie sich für gar nichts interessierte. Sie sah die Blumen nicht, sie hatte kein Grußwort für Eva und schenkte dem Kind keinen Blick. Als Constantin sie ins Haus bringen wollte, stieß sie ihn zurück.
Jonas brachte sie in ihr Zimmer. Charlotte, einem Nervenzusammenbruch nahe, sank schluchzend in einen Sessel. Constantin wusste sich keinen anderen Rat mehr, als Dr. Laurin anzurufen. Der überließ es seinen Assistenzärzten, die Nachmittagsvisite in der Klinik zu machen.
Er war zutiefst erschrocken, als er Bettina sah, und noch mehr, als sie plötzlich ungereimtes Zeug daherredete.
»Nehmen Sie mir das Kind. Ich will es nicht haben. Ich will leben.« Ihr Aufbegehren ging in ein unverständliches Lallen über. Als er ihr dann eine Injektion verabreicht hatte, schlief sie ein. Dr. Laurin gab auch Charlotte ein Beruhigungsmittel. Eva brachte diese dann ins Gästezimmer, und dort legte sich Charlotte nieder.
Jonas sprach später offen mit Dr. Laurin. Dr. Eckart hätte Bettina als einen besonders schweren Fall bezeichnet, erklärte er.
»Er hat ihr abgeraten, die Kur zu unterbrechen, aber das hat sie besonders wütend gemacht. Durch ihren starken Zigarettenkonsum sind ihre Abwehrkräfte geschwächt. Und weil sie im Sanatorium keine Zigaretten bekommen hat und auch keinen Kaffee, weigerte sie sich zu bleiben. Wenn wir sie besuchten, war sie jedoch guter Dinge. Ich muss gestehen, dass ich Dr. Eckarts Warnungen in den Wind schlug, aber auf dieser Fahrt haben wir es erlebt, wie unberechenbar sie ist. Nun ist auch meine Frau, die sich gut erholt hatte, völlig fertig. Ich fürchte das Schlimmste, Dr. Laurin.«
Wie sollte er da noch trösten? »Vielleicht hat Bettina doch die gewohnte Umgebung gefehlt«, sagte er, »und auch das Kind. Man weiß ja nicht, was in ihr vorgeht.«
Bettina schlief bis zum nächsten Morgen, und dann schien sie wieder völlig verändert. Sie hatte alles vergessen, und niemand erinnerte sie daran.
»Jetzt bin ich wieder zu Hause«, sagte sie. »Eva soll mir einen guten Kaffee machen und Zigaretten bringen.«
»Es sind keine im Haus«, erwiderte Charlotte. »Du sollst auch nicht rauchen, Kleines.«
»Fang du jetzt nicht auch damit an. Wo ist Constantin?« Sie sagte nicht Conny, aber Charlotte, die noch immer erschöpft war, fiel das nicht auf.
»Im Büro«, erwiderte sie.
»Da siehst du mal, wie viel ich ihm wert bin, Mama. Er geht einfach.«
»Er muss doch Geld verdienen, Bettina«, sagte Charlotte.
Bettinas Augen verengten sich. »Wird Jonas knauserig?«, fragte sie.
»Nein, aber zwei Haushalte kosten viel Geld. Das musst du verstehen, Bettina.«
»Wenn ich mich scheiden lasse, kann ich bei euch leben, und Constantin kann sehen, wie er mit dem Kind zurechtkommt. Aber darüber reden wir später. Eva soll gehen und mir Zigaretten holen.«
Charlotte wagte keinen Widerspruch, als sie eine zornige Flamme in Bettinas Augen glimmen sah. Sie wünschte jetzt nur ihren Mann herbei, weil sie sich so machtlos fühlte.
»Eva muss doch das Kind versorgen«, flüsterte sie.
»Das kann ich auch«, erklärte Bettina.
Auch da wollte Charlotte nicht widersprechen. Sie rief Eva herein.
Bettina zeigte sich von ihrer liebenswürdigsten Seite. »Sie sind ja verlässlich, Eva«, sagte sie mit freundlichem Lächeln. »Besorgen Sie Hummer, Austern und Kaviar, und natürlich Zigaretten, wenngleich ich nicht verstehe, dass keine im Haus sind.«
»Es raucht niemand, Frau Hammilton«, erwiderte Eva mit erzwungener Ruhe.
»Ich rauche, genügt das nicht?« Bettinas Augen hatten wieder einen boshaften Ausdruck. »Und außerdem möchte ich meinen Hochzeitstag festlich begehen. So, wie ich es von früher gewöhnt bin.«
»Aber hier gibt es weder Hummer noch Austern«, wandte die Kinderschwester ein.
»Dann fahren Sie in die Stadt.«
»Das dauert Stunden, und Sandra muss doch versorgt werden«, sagte Eva mit erstickter Stimme.
»Sandra, immer nur Sandra! Ich befehle es Ihnen, sonst suche ich mir eine zuverlässigere Kraft.«
»Echauffiere dich nicht, Bettina«, warnte Charlotte. »Ich werde Eva sagen, wo sie alles bekommen kann. Und um Sandra kann ich mich kümmern.«
»Aber die Zigaretten möchte ich gleich«, rief Bettina mit schriller Stimme.
Charlotte drängte Eva nach draußen. »Verstehen Sie es bitte, Eva«, sagte sie bebend, »man darf ihr jetzt nicht widersprechen. Ich weiß ja auch nicht mehr, was ich tun soll. Bringen Sie ihr Zigaretten, vielleicht hat sie das andere dann schon wieder vergessen. Ich werde meinen Mann anrufen und ihn bitten, dass er Hummer, Austern und Kaviar besorgt.«
»Ich lasse Sie aber ungern mit Frau Hammilton allein, Frau Bernulf«, sagte Eva. »Ich kenne diese unberechenbaren Stimmungen.«
»Es handelt sich um meine Tochter, Eva«, erwiderte Charlotte. »Es gibt keinen Menschen, der ihr näher steht als ich. Wir dürfen sie jetzt nur nicht noch mehr reizen.«
»Und ihr alles geben, was ihr noch mehr schaden kann?«, fragte Eva.
»Was kann ihr denn noch helfen?«, murmelte die Ältere. »Sie wissen es doch so gut wie ich, dass nichts und niemand ihr helfen kann.«
»Dann gehe ich jetzt«, sagte Eva beklommen.
»Ja, gehen Sie.«
*
Als Eva das Haus verlassen hatte, begann Sandra zu weinen, als wisse sie es, dass nicht weiche, zärtliche Hände sie emporheben würden. Charlotte ging in das Kinderzimmer. Leise und beruhigend redete sie auf Sandra ein, und das Weinen verstummte. Große dunkle Augen blickten Charlotte verwundert an. Und nun, sich ihrer eigenen Hilflosigkeit bewusst, empfand Charlotte eine tiefe Zärtlichkeit für dieses hilflose kleine Wesen.
Sie vergaß alles um sich, auch Bettina. Sie betrachtete nur das süße Gesichtchen. Sie verlor sich in Gedanken.
»Du kannst ja nichts dafür, mein Püppchen«, flüsterte sie.
Doch da ertönte eine klirrende Stimme: »Wofür kann sie nichts?«
Charlotte fuhr herum. Da stand tatsächlich Bettina. Es war kein Trauma, kein Geist.
»Ich habe Eva weggeschickt. Jemand muss sich doch um Sandra kümmern«, sagte sie tonlos.
»Es ist mein Kind. Ich kann es versorgen. Misch du dich nicht auch noch ein. Es genügt, dass Eva sich hier breitmacht. Scher dich weg.«
Grenzenloses Entsetzen erfasste Charlotte, denn in Bettinas Augen flammte Hass. »Du machst mich krank, dabei bist du viel kränker als ich«, kreischte Bettina. »Du fasst das Kind nicht an!«
Sie taumelte vorwärts, doch Charlotte hatte noch die Kraft, sich schützend vor das Kinderbettchen zu stellen.
Doch Sandra schrie jetzt, erschrocken durch die lauten Stimmen. Bettina schlug nach ihrer Mutter, ihrer Sinne nicht mehr mächtig. Charlotte wurde es schwarz vor Augen, aber sie konnte noch nach Bettinas Armen greifen, die nach dem Kind fassten.
»Beruhige dich«, flüsterte sie, nach Atem ringend und von Schwäche ergriffen. Sie rangen miteinander, Bettina stürzte rückwärts und zog ihre Mutter mit sich, dann lag sie leblos da.
»Bettina!« Ein letzter gellender Aufschrei kam über Charlottes Lippen, dann verlor auch sie das Bewusstsein.
Eva hörte nur das Weinen des Kindes, als sie mit den Zigaretten zurückkam. Und dann bot sich ihren Augen dieser entsetzliche Anblick dar. Die beiden Frauen, Mutter und Tochter, lagen bewegungslos auf dem Teppich. Eva kniete nieder, fühlte beiden den Puls und konnte doch keinen Pulsschlag vernehmen.
Sie zitterte am ganzen Körper, und das Baby schrie und schrie.
Da läutete es. Blindlings stürzte Eva zur Tür, nur von dem Gedanken beseelt, dass jemand ihr helfen könnte. Da stand Jonas Bernulf.
Er umfasste ihre Schultern und schüttelte sie, als sie ihn so fassungslos anstarrte.
»Was ist, Eva?«
»Ich sollte Zigaretten holen, und dann … Sie liegen im Kinderzimmer«, brachte sie schluchzend hervor.
So schrecklich auch alles war, Jonas Bernulf zögerte nicht, er handelte. Minuten später kam der Krankenwagen. Eine Stunde danach kam Constantin, von Jonas herbeigerufen.
»Ich hätte das Haus nicht verlassen dürfen«, schluchzte Eva.
Er nahm ihre Hände. »Wie hast du doch gesagt, Eva? Es kommt doch alles so, wie es uns bestimmt ist.«
Da erst beruhigte sie sich und war wieder fähig, dem Kind die gewohnte Fürsorge zuteil werden zu lassen.
Am Abend erfuhr sie, dass Bettina und Charlotte gestorben waren. Charlottes Herz hatte versagt. Bettina war bei dem Sturz mit dem Kopf so hart aufgeschlagen, dass eine Gehirnblutung ihr jammervolles Leben ausgelöscht hatte.
Jonas Bernulf wusste nichts anderes zu sagen als: »Es sollte wohl so sein.«
Die gleichen Worte gebrauchte auch Dr. Laurin. Er fügte hinzu: »Es ist besser so.«
Wie es geschehen konnte, musste man sich ausdenken. Und Constantin musste Eva die Schuldgefühle, unter denen sie litt, ausreden. Von einem Tag zum anderen konnte das nicht geschehen, doch Jon und Katrin halfen ihm dabei. Doch vor allem war es Dr. Laurin, der ihr versicherte, dass kein Verdacht gegen sie bestehe, dass sie sich nichts vorzuwerfen habe. Da erst atmete Eva auf.
Nach der Beerdigung trat Jonas Bernulf seine Reise an. Er blieb drei Monate in fernen Landen, aber als er zurückkam, hatte er zu sich selbst gefunden. Jon und Katrin trugen Verlobungsringe an den Fingern. Still und ohne jedes Aufsehen hatten sie diesen ersten, wohlüberlegten Schritt in ein gemeinsames Leben getan, mit dem Segen von Dr. Dietsch, der seinen Lebensabend mit seiner Maria verbringen wollte.
»Wie geht es Constantin?«, fragte Jonas seinen Sohn.
»Besser«, erwiderte Jon.
»Wer versorgt das Kind?«
»Natürlich Eva.«
»Ist das so natürlich?«, fragte Jonas.
»Für diese beiden sollte es die natürlichste Sache der Welt sein, Papa«, erwiderte Jon, »wie für Katrin und mich. Wie für Robert und Maria. Und du bist jedem von uns herzlich willkommen, falls du nicht auch ein Pendant findest.«
»Das bestimmt nicht mehr«, brummte Jonas. »Aber die Rolle des Großvaters würde mir schon gefallen.«
»Wir werden dich hoffentlich nicht enttäuschen, Papa«, sagte Jon. »Aber in der Zwischenzeit kannst du großväterliche Qualitäten ja bei Sandra erproben. Constantin möchte ohnehin mit dir sprechen – wegen des Hauses. Es wird zwar ziemlich lange dauern, bis er es dir abzahlen kann, aber du könntest ihm entgegenkommen.«
»Wirst du es mir vorhalten, Jon?«, fragte der Ältere.
»Ich doch nicht, Papa. Ich würde es ihm schenken. Wir sind Freunde, und Eva ist die richtige Frau für ihn.«
»Ich bin zwar kein Geschäftsmann, aber wenn du darauf bestehst, tue ich es sofort.«
»Du und Katrin könntet dann mein Haus haben, wenn es euch recht ist.«
»Nur, wenn du bei uns bleibst, Papa.«
»Nur dann«, sagte auch Katrin.
»Ich möchte aber bald Enkel haben«, lächelte Jonas Bernulf.
»Dann müssen wir aber bald heiraten. Katrin hat da gewisse Prinzipien«, sagte Jon.
»Worauf wartet ihr denn eigentlich noch?«
»Wir haben auf dich gewartet, Papa«, sagte Katrin, und da nahm Jonas Bernulf dieses junge, strahlende Mädchen in die Arme.
»Nun fahre ich zu Constantin, damit ich alles gleich hinter mich bringe«, erklärte er schließlich.
»Du wolltest noch was schriftlich haben, Papa«, sagte Jon.
»Das hat Zeit. Ich möchte erst hören, ob die beiden genauso denken wie ihr.«
Es war ein bisschen anders. Constantin wollte nichts geschenkt haben, so ergriffen er auch war von Jonas’ Großzügigkeit.
»Na gut«, sagte Jonas, »dann schenke ich das Haus Sandra, und sie wird es euch wohl gestatten, darin zu wohnen. Und wenn sie dann erwachsen ist und euch hinauswirft, müsst ihr euch eine andere Bleibe suchen. Natürlich stelle ich meine Bedingungen. Ihr müsst mir schon gestatten, mich ab und zu hier aufzunehmen, damit ich auch mal mit Sandra spielen kann und sie mich nicht als Eindringling betrachtet.«
»Was meinst du, Eva?«, fragte Constantin.
»Ich kann das doch nicht entscheiden. Du hast mich doch noch nicht mal gefragt, ob ich hierbleiben will«, erwiderte sie.
»Dann wird es aber Zeit«, sagte Jonas. »Richte das Haus ein, wie du es magst, Eva. Dann komme ich noch lieber.«
Und wie gern kam er in dieses Haus. Evas Traum ging in Erfüllung. Sandra pflückte Blumen und brachte sie ihrer »lieben Mami«.
Ein glückliches Kind wuchs heran, und als Eva ihrem Mann zwei Jahre später einen Sohn schenkte, wusste auch Dr. Laurin, dass Constantin Hammilton ein vollkommen glücklicher Mann war. Nur Liebe konnte tiefe Wunden heilen.