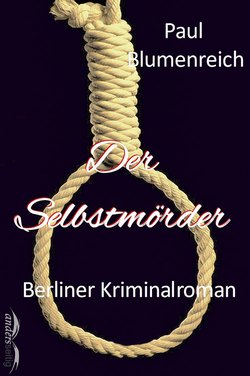Читать книгу Der Selbstmörder - Paul Blumenreich - Страница 5
ОглавлениеGanz aufgeregt war Pauline am Abend nach Hause gekommen. Ach, es war zu viel, was auf sie einstürmte!
Die kleine Wohnung, drei Treppen hoch, mit niedrigen Stuben, die mit kümmerlichem Hausrat vollgepfropft waren, wurde ihr heute zu eng, ihr war zum Ersticken.
Sie hatte, seit sie die Flügel regen konnte, hinausgestrebt aus ihrer engbegrenzten Existenz. Ihr Vater war früh gestorben, die Mutter ein schwacher Charakter mit herkömmlichen, beschränkten Lebensanschauungen, der Vormund ein gleichgiltiger Geschäftsmann, der sein Mündel gewissenhaft betreute, aber sich wenig um die Eigenart des Mädchens kümmerte. Sie war ein begabtes Kind, lernte leicht, überflügelte spielend ihre Mitschülerinnen und wurde sich sehr früh ihrer persönlichen Macht bewußt. Ja, sie besaß die glückliche Gabe, zu gefallen. Schon in der Schule an ihren Lehrern, an dem strengen Rektor erprobte sie es. Aber ihre Koketterie blieb immer die eines unschuldigen Kindes; sie war sittenstreng erzogen, und man hatte von früh an ihren Sinn auf den Ernst des Lebens gelenkt. Sie sollte lernen ihr Brot verdienen, das prägte man ihr täglich ein. Sie sah Sorge und Entbehrung im Hause und begriff die Notwendigkeit, welche ihr der Vormund und die Mutter predigten.
Dennoch träumten sie von einer schönen, glücklichen Zukunft. So lange sie klein war, von Aschenbrödel und dem Prinzen, später von Romanschicksalen, nach welchen hübsche, tugendhafte, wenn auch arme Mädchen ihr Glück machen. – Einmal hatte sie bei einer Schulfeier eine große Deklamation vorzutragen; das gelang ihr so vollkommen, sie gefiel so außerordentlich, daß die Hörer in Beifall ausbrachen, obgleich der gestrenge Herr Rektor gleich zu Beginn jede Zustimmungsäußerung verboten hatte. Und nun nahmen ihre Träume eine bestimmte Gestalt an: zur Bühne zu gehen. Sie blieb diesem Vorsatz treu, trotzdem man sie nach Beendigung ihrer Schulzeit nötigte, zwei Jahre lang Kunststickerei zu erlernen. Nebenbei arbeitete sie mit einer für ihr Alter seltenen Energie an ihrer Fortbildung, lernte Sprachen, Literatur in billigen oder unentgeltlichen Abendkursen. Sechzehn Jahre alt geworden, trat sie mit ihrem großen Wunsche hervor, zur Bühne zu gehen.
Die Mutter war entsetzt über diesen Einfall und der Vormund pflichtete ihr bei. Da kam Paulinen unerwartet Hilfe.
Ihre Tante, eine etwas excentrische, nicht ganz unbemittelte, alte Jungfer, deren Liebling sie immer gewesen, erklärte sich bereit, das junge Mädchen ausbilden zu lassen. Der Vormund und die Mutter gaben nun ihre Zustimmung. Nachdem Paulinens Unterricht notdürftig zu Ende geführt war, stand sie vor einer neuen, ungeahnten Schwierigkeit. Ihre Neigung, ihr Talent, ihr ganzes Gefühlsleben drängte sie zum tragischen Fach. Sie wollte die in ihr schlummernde Leidenschaft auf der Bühne ausleben. Aber ihr Soubrettengesichtchen, ihre angenehme, aber kleine Stimme, genug, ihre ganze Erscheinung stand ihr im Wege. Dieselbe hübsche, aber nicht imposante Erscheinung verschaffte ihr auch ein Engagement an einer Berliner Bühne, zwar nicht ersten Ranges. Sie spielte hier Stubenmädchen, machte das ganz allerliebst, fühlte sich aber sehr unglücklich dabei. Man riet ihr ab, in die Provinz zu gehen, es sei dann noch schwieriger, emporzukommen. So hoffte sie denn wenigstens auf eine größere Rolle. Der Oberregisseur war ihr gewogen, leider nur zu sehr gewogen. Seine Liebenswürdigkeit beleidigte sie, und es wurde nichts, immer und immer nichts mit der großen Rolle. Ihre Lage wurde schließlich ganz unerträglich. Die kleine Gage reichte kaum hin für die Kosten der wenn auch einfachen Garderobe. Sie erübrigte bei großer Sparsamkeit ein kleines Kostgeld für die Mutter. Die Art und Weise, wie man hinter den Kulissen mit ihr, der »kleinen Norden«, umging, verletzte sie täglich und stündlich. Die Mutter überhäufte sie unaufhörlich mit Vorwürfen über ihre verfehlte Laufbahn, und die Tante schloß sich jetzt an, denn sie hatte doch nicht ihr Geld hergegeben, damit Pauline Stubenmädchen spiele.
Da kam eine unerwartete Wendung. Pauline nahm an einem Tanzabend des Theatervereins teil, wozu sie ihr weißes Battistkleid selbst modernisiert hatte. Sie tanzte sehr gern; im übrigen versprach sie sich nicht sonderlich viel Vergnügen, denn die männlichen Kollegen flößten ihr kein Interesse mehr ein. Diese Herren, meinte sie, seien nur für jene Damen interessant, welche der Bühne ganz fern stehen. Der Abend ließ sich indessen glücklich an. Ein anwesender Bühnenschriftsteller, den sie hinter den Kulissen kennen gelernt hatte, versprach ihr eigens eine Rolle für sie zu schreiben. Und dann machte sie gleich beim ersten Tanz die Bekanntschaft eines jungen Mannes, den sie vorher nie in diesem Kreise gesehen und der ihr außerordentlich gefiel. Es war ein hübscher, schlanker, brünetter Mann von selbstbewußtem Wesen, offenbar kein Schauspieler. Er tanzte vortrefflich und machte ihr lebhaft den Hof. Auch sie gefiel ihm, das merkte sie gleich. Anfangs hielt sie ihn für einen jungen Schriftsteller, weil solche öfter hierherkamen; dann für einen Bildhauer, weil er von Modellieren sprach. Endlich rückte sie offen mit ihrer Neugier heraus, denn er interessierte sie immer mehr und mehr, und frug nach seinem Berufe.
»Ja, ich bin auch Schriftsteller.« sagte er mit einem Seufzer, »ich schreibe ein großes dickes Buch – es ist das Hauptwerk meines Lebens. Der Apoll von Belvedere und Amor und Psyche und noch andere olympische Herrschaften kommen darin vor und alle werden darin nach ihrem wirklichen Werte gekennzeichnet, von drei Mark fünfzig Pfennig aufwärts.«
Und er überreichte ihr seine Karte.
»Ich bin nämlich Buchhalter eines Kunstgewerbe-Magazins.« Und er seufzte wieder tief auf.
Pauline war ganz erstaunt. Das hätte sie nie für möglich gehalten; er war ihr ganz und gar als Künstler erschienen.
»Sie stimmen mich wehmütig, Fräulein,« versetzte er; »dürfte ich das wenigstens anstreben, was ich Ihnen schien!«
Und angeregt, sympathisch berührt, wie er war, erzählte er ihr, wie künstlerische Ideale ihm vorschwebten, wie heiß er sich nach einer Ausbildung sehnte, und wie doch Pflicht und Dankbarkeit ihn an die Bronzewaren-Firma Hilmar, das Geschäft seines Onkels und Pflegevaters, ketteten.
Nun erschloß Pauline ebenfalls ihr Herz. Sie stellte ihm vor, was sie von einer Schauspielerlaufbahn gehofft und wie wenig ihr die Wirklichkeit davon gehalten habe. Sie schilderte, welchen Versuchungen sie ausgesetzt sei und wie unwürdig ihr Chef, der Oberregisseur mit ihr verfahre.
Karl Hilmar hörte voll Teilnahme zu.
»Es ist schade um Sie, Fräulein,« rief er, »und Sie sollten die erstbeste Gelegenheit erfassen, ins Privatleben zurückzukehren. Was Sie mir da erzählen, ist mir nicht ganz neu, aber es bestätigt von neuem, wie schwer es für junge Mädchen ist, in dieser Atmosphäre ganz rein zu bleiben. Sie erschweren sich sogar die Möglichkeit eine gut bürgerliche Partie zu machen, wozu sich Ihnen sonst sicherlich Gelegenheit böte. Mich zum Beispiel würde mein Onkel gewiß enterben, wenn ich eine Schauspielerin heiraten wollte.«
Pauline hörte nachdenklich zu. Diesen Punkt hatte sie noch nicht erwogen, denn sie hatte ja noch nicht geliebt. Wenn sie die Neigung eines jungen Mannes fand, wie Karl Hilmar, stand ihr die Schauspielerin, die sie ja in ihrer jetzigen Form ohnehin nicht befriedigte, nicht im Wege?
»Aber ich muß mein Brot verdienen,« wandte sie ein.
»Das wird doch auf verschiedene Weise möglich sein,« entgegnete er. »Ich könnte Ihnen gleich einen Vorschlag machen, aber er wird Ihnen nicht sehr imponieren. Soll ich ...?«
»Natürlich sollen Sie,« antwortete Pauline, erstaunt über die Teilnahme, die er an ihrem Schicksal nahm. In diesem Augenblick erschien ihr dies Schicksal gar nicht mehr düster.
»Unser Kassierer geht ab,« fuhr Karl Hilmar fort, »und seine Stelle ist, soviel ich weiß, noch nicht besetzt. Wenn Sie sich mit diesem Posten begnügen wollten ...? Für uns wäre es ein wahres Glück, denn ein junges hübsches Mädchen wie Sie ziert das ganze Geschäft.«
Freilich, das Anerbieten im ganzen entsprach wenig den stolzen Zukunftsträumen Paulinens; aber derjenige, der es ihr machte, besaß bereits ihr ganzes Vertrauen und auch noch mehr. Sie wollte sich die Sache also überlegen.
Im Verlaufe der Nacht indessen rückten sie einander näher und näher. Sie waren zwei verwandte Seelen mit gleich hochfliegenden Neigungen, deren Flügel in gleicher Weise durch die Verhältnisse gebunden waren.
Als sie sich trennten und er die Rede wieder auf die freie Stelle gebracht hatte, rief Karl Hilmar:
»Ach, wenn Sie zu uns kommen, Fräulein Pauline, da könnte ich Sie immer sehen, so oft die Tür zum Comptoir aufgeht. Und dann würde es mir da drinnen so gut gefallen, wie nie zuvor!«
Mit einem feurig bittenden Blick sah er sie an und dieser Blick entschied. Sie wollte ihm folgen, weil er es war. Er hatte ihr Herz gewonnen, und sie wollte in seiner Nähe bleiben, wenn auch vorläufig nur in einer bescheidenen Stellung.
So war sie Kassiererin im Hause Hilmar geworden.
Schon unter gewöhnlichen Umständen lag eine schwere Last auf ihr, dem lebenslustigen, kraftsprühenden jungen Mädchen. Der Vater war lange tot, die Mutter genoß eine kleine Pension. Außer Pauline waren noch drei jüngere Söhne da, begabte, hübsche Jungen, die für eine anständige Lebensbahn erzogen werden sollten und höhere Schulen besuchten. Dazu reichte die Pension der Mutter bei weitem nicht hin. Zwar die Jungen genossen Freischule und manche andere Vergünstigungen, aber sie brauchten noch immer allerlei, hatten kleine Wünsche und bettelten dann bei der Schwester.
Die Hoffnung der ganzen Familie beruhte stillschweigend auf der Tante, welche im Hause wohnte und eine der drei Stuben mit ihren eigenen Möbeln eingerichtet hatte. Sie war eine alte Jungfer, welche etwas Geld haben sollte und damit wichtig tat. Einmal sagte sie:
»Nun, Kinderchen, ich werde es Euch gedenken. – Kinderchen, etwas wird für Euch doch bleiben.«
Und ein nächstes Mal wieder klagte sie:
»Ach Gott, ich bin ja nur ein armer Schlucker; ich habe nichts und hinterlasse nichts.«
Die Tante liebte es, immerfort von ihrem Tode zu sprechen, wie es die Manier mancher alten Leute ist. War von einem in der nächsten Zukunft liegenden Ereignis die Rede, von Weihnachten, Ostern, einem Geburtstage oder dergleichen, so seufzte sie:
»Wenn ich's erlebe!«
Und sagte man ihr:
»Den Mantel kannst Du ja im nächsten Jahre noch tragen, Tante,« dann antwortete sie:
»Nächsten Winter, da lebe ich nicht mehr.«
Und so ging das fort. Unwillkürlich wurde man immer an die geheimnisvolle Erbschaft erinnert:
»Die paar Groschen, die unsereins sich mit Not und Mühe vom Munde abspart, ... ja, wenn ich Euch nur etwas Ordentliches hinterlassen könnte!«
Zum Kaffee und zum Abendbrot, zur Suppe und zum seltenen Braten, immer klang dasselbe Lied, immer machte die Tante ihr mysteriöses Gesicht, rasselte mit ihrem Schlüsselbund, als hätte sie Schätze zu verschließen.
Sehr gern saß sie über dem Kalender und brütete und brütete, als wolle sie ihren Todestag ausrechnen. Bisweilen knurrte sie die Jungen an:
»Ich spare noch immer jetzt auf meine alten Tage, daran solltet Ihr Euch ein Beispiel nehmen.«
Die Jungen trieben auch wohl ihren Mutwillen mit der Erbschaft:
»Ja,« sagte Richard, »wenn wir die Tante beerbt haben werden, dann machen wir dieses und jenes, dann kaufe ich mir ein Zweirad.«
Und der jüngere meinte:
»Einen schönen Grabstein aber muß sie zuerst haben.«
Schließlich wünschten alle der Tante das Leben. Aber die alte Dame war siebzig Jahre alt und ewig konnte es nicht mehr währen. Sie war auch mit soviel Liebe und Aufmerksamkeit gepflegt worden, daß man sich ein Anrecht auf ihre Dankbarkeit erworben hatte. Ihr Hab und Gut bestand in einer Leibrente, aber sie sollte sich außerdem, so lange sie einen guten Posten als Wirtschafterin besessen, ein kleines Kapital erspart haben, und so sehr nun auch ihr Tod in der Luft schwebte, so bestürzt war doch die ganze Familie, als die Tante eines Tages vom Schlage gerührt wurde. Zwar die alte Frau war nicht tot, nur gelähmt, aber es erfaßte doch ein grenzenloser Schrecken das ganze Haus. Es mußte sich jetzt entscheiden, wie es mit der Erbschaft stand. Zugleich hörte man allerlei Gewissensregungen: Hatte man sie auch genügend gut behandelt? – Und wenn sie lange so lebte, gelähmt und hilflos, was sollte da geschehen? – Wer sollte ihre Pflege übernehmen? –
Pauline war den ganzen Tag über abwesend, die Jungen in der Schule, und wenn sie heimkamen, so suchten sie Freiübungen auf, die alte Mutter besorgte das bißchen Wirtschaft – was sollte also werden, wenn die hinfällige Tante vielleicht keinen Schritt mehr gehen konnte, zu jeder Handreichung eines dritten bedurfte?
Und in all' dieser Angst und Aufregung mußte Pauline fort. So war sie zum ersten Male zu spät gekommen, aber man bemerkte es glücklicherweise nicht; der Chef war sehr streng und ohne Verweis wäre es sonst nicht abgelaufen. Sie hatten zu Hause oft gedrängt, daß Pauline lieber nach einer Beschäftigung suche, die ihr daheim Verdienst gewähre, oder daß sie sich nach einer anderen, minder anstrengenden Stellung umsehe. Aber sie wollte nicht fort von ihrem Kassenschalter – nicht fort aus der Nähe Karl Hilmars.
Auch manche Versuchung trat an das hübsche, muntere Mädchen heran, sie indes blieb fest, blieb treu ihrem Kassenfenster. So kam sie jetzt, abends nach Hause. Wieder, wie immer, erregte sie die Aufmerksamkeit einzelner Passanten, aber sie sah keinen der bewundernden Blicke, hörte keinen der hingemurmelten Grüße. Eine Welt von Sorgen und schweren Gedanken wogte in ihrem hübschen Köpfchen. Man hatte ja bis abends noch immer keine Kunde von dem jungen Herrn. Und nun fiel ihr noch die Tante ein. Wäre es schlimmer mit ihr geworden, einer der Jungen hätte die Schwester abgeholt; so hatte man es heute früh ausgemacht.
Und wirklich, die Tante befand sich etwas besser; sie war bei Besinnung. Die Mutter kochte eben in der kleinen, engen Küche, in der man sich kaum umdrehen konnte, eine Suppe für die Tante. Die zwei älteren Jungen waren bei ihren Schularbeiten und aßen ihr Schmalzbrot dazu. Sie bestürmten sogleich die Schwester, doch eine Flasche Bier zu »spendieren«, denn die Mutter hatte sich ausgegeben für die teure Kalbsbrühe. Der jüngste, der elfjährige Walter, saß bei der Tante und sah mit seinen großen, runden, fragenden Kinderaugen ängstlich nach ihr.
Pauline schickte den Kleinen auf die Straße spielen; sie schenkte ihm fünf Pfennige, um Obst zu seinem Schmalzbrot zu kaufen. Dann setzte sie sich an seiner Stelle zum Krankenbett, ohne zu bedenken, daß sie selbst noch nichts gegessen hatte; sie war sonst bei gutem Appetit und verschmähte nicht eine dicke »Butterstulle«, wie sie ihre Brüder verzehrten; heute aber ging zu viel durch ihren Sinn.
Was war aus dem jungen Herrn geworden? – Sie konnte nicht glauben, daß ihm ein Unfall zugestoßen war, sie glaubte eher an einen tollen Streich. Aber jedenfalls war er fort, weit fort, die schöne Josepha würde ihn nie haben; aber er würde auch nicht mit ihr, Pauline, mehr seine freundlichen Scherze machen, und von nun ab würde es recht trübselig werden in dem blinkenden, glänzenden, mit Luxusgegenständen angefüllten Geschäft.
Die Tante aber, da lag sie mit dem gelben, eingefallenen Gesicht und schlummerte. Pauline hatte die feste Ueberzeugung, daß die alte Dame nichts oder so gut wie nichts hinterlassen würde, irgend einen Sparpfennig ohne Belang; sie hatte sich eben nur gerne wichtig gemacht. Das junge Mädchen besaß einen scharfen Verstand und eine gesunde Beobachtungsgabe, sie hatte Aeußerungen und Betragen der Alten genau summiert und gefunden, daß alle übertriebenen Hoffnungen töricht waren; gerechnet hatte Pauline nie darauf. Sie würde eben arm bleiben – arm, aber tugendhaft und ehrlich. Wohlsituierte Männer aus den Kreisen, die ihr gefielen, würden wohl einmal mit ihr tändeln, dann aber würden sie bessere Partien machen. Oder ihresgleichen, einen armen Teufel heiraten und das Leben der Not und Entbehrungen fortsetzen?
Sie machte trotz ihrer Jugend und ihres Temperaments diese melancholischen Betrachtungen, denn sie hatte schon zu viel durchlebt, das Leben hatte sie ernst gemacht über ihre Jahre hinaus.
Jetzt erwachte die Kranke. Sie nahm mit einer gewissen Hast die Suppe zu sich und freute sich, daß Pauline, ihr Liebling, da war.
»Du bleibst doch bei mir, Paulinchen, nicht wahr?« fragte sie.
»Ja, Tante, ich bleibe.«
Ohne weiteres verlangte die kranke alte Frau von ihr die Nachtwache mit dem Egoismus des Alters und der Hinfälligkeit.
Und so war es gewesen, seit Pauline denken konnte. Das Leben hatte sie immer bis aufs äußerste in Anspruch genommen. Manchmal empörte sich ihre Jugend und lechzte nach Genuß und Freude.
Da saß sie nun bei der Nachtlampe. Die Mutter hatte ihr etwas Kaffee gebracht, und sie benutzte diese einsamen Stunden, um sich ihre Garderobe in stand zu setzen. Die Tante verlangte wiederholt zu trinken, sonst schien sie teilnahmlos, und Pauline weinte, weinte heiße, schwere Tränen in den Schoß der verschwiegenen Nacht.
Auf einmal sah sie, wie die Augen der Kranken auf sie gerichtet waren, so lebendig und anteilsvoll wie noch kaum vorher; ihr Blick glänzte unheimlich aus dem gelblichen Gesicht.
»Was wünschest Du?« rief Pauline erschrocken.
»Du weinst, Paulinchen,« sagte die Alte; »aber nicht allein um meinetwegen. Nein, so klug bin ich auch, meinetwegen weinst Du nicht.«
Freilich, Pauline hatte nicht allein um der Tante willen geweint, warum aber sollte diese es nicht glauben? – Es war ihr vielleicht ein Trost, und ihr Testament war doch sicher gemacht. Krokodilstränen waren es auf keinen Fall. Sie suchte sie zu beruhigen, suchte ihr auszureden, daß sie überhaupt geweint habe, aber wenn ihr Tränen gekommen wären, so sei doch wohl der beängstigende Zustand der lieben Tante schuld.
»Nein, nein, mein Kind,« entgegnete die alte Frau. »Du hast's schwer, sehr schwer, – ich weiß das sehr wohl, ich verstehe das und habe auch an Dich gedacht.«
»O Tante, sprich doch nicht davon! Es wäre mir schrecklich, wenn Du dächtest – –«
»Nein,« unterbrach sie die Alte eilig, als fürchte sie, die Zeit könne ihr zu kurz werden. »Nein, Du mußt das wissen, was ich meine. Heute, wie mir auf einmal ganz schwarz vor den Augen wurde, und Du warst nicht da, dachte ich: Mein Gott, wenn sie es nicht erfährt, nachher würde es vergessen werden. Aber jetzt, wie ich Dich weinen sah, fiel es mir wieder ein. Komm, ich will es Dir leise sagen.«
Pauline war ganz entsetzt. Welch ein Geheimnis sollte sich ihr offenbaren? – Sie neigte ihr Ohr zu der Kranken.
»Ich habe etwas für Dich zurückgelegt, mein Kind,« keuchte die alte Frau, »nur für Dich; die anderen brauchen nichts zu wissen. In meiner Kommode ganz unten, in dem roten, wattierten Rock, da liegt es. Es ist Dein, Du brauchst's niemandem sonst zu sagen, – hörst Du, niemandem.«
Und noch eine ganze Weile wiederholte sie, daß es niemand zu wissen brauche, immer dieselben Worte, und es seinur für Pauline allein. Schließlich meinte Pauline, es sei nur kindisches Gefasel von der alten Frau, denn was konnte in einem wattierten Rocke verborgen sein, einem jener Röcke, wie sie vor Jahrzehnten getragen wurden? – Es war gewiß nur kindisches Geschwätz.
Nun schlief die Tante ein, und da sie ziemlich wohl schien, legte sich auch Pauline auf den Divan zum Schlummer. Am nächsten Morgen ging es der Tante wieder besser. Pauline dachte kaum noch daran; sie vergaß umsomehr, als die Tante Neigung zeigte, aufzustehen, und während der nächsten Tage nicht mehr von der nächtlichen Enthüllung sprach.
Wieder saß Pauline an ihrem Kassenschalter, traurig und verlassen. Er, der die Sonne ihrer Existenz gewesen, der mit ihr plauderte und scherzte, war verschollen; die Zeitungen hatten ihn als vermißt gemeldet. Und daheim lag die Tante krank, erforderte viel Mühe, unablässige Pflege und Ausgaben. Das junge, lebenslustige Mädchen hatte Anwandlungen von Trübsinn, sie wünschte sich ganz ernstlich den Tod; ihr war ja doch kein Glück beschieden. Und wenn sie etwas Gewaltsames versuchte, vielleicht würde sie irgendwie mit ihm vereint, der die Leuchte ihres Lebens war, der so geheimnisvoll verschwunden. Aber rasch verbannte sie die Gedanken wieder. Sie hatte Pflichten gegen die Ihren; nein, sie durfte dergleichen nicht aufkommen lassen, jetzt nicht und niemals.
Der kleine Kommis, Herr von Waldenburg, begleitete sie jetzt manches Mal nach Hause und machte ihr den Hof.
»Seien Sie nur hübsch vorsichtig,« sagte Pauline lächelnd, »daß es keiner sieht und dem Fräulein Josepha hinterbringt! – Sie schneiden ja auch ihr die Cour.«
Er stellte sich sehr entrüstet, berief sich auf seinen wirklichen Adel, auf sein Rittertum; aber Pauline hatte etwas gelernt, sie zitierte ihm den Wahlspruch des Ritters ohne Furcht und Tadel: »A Dieu mon âme, ma vie au roi, mon coeur aux dames – l'honneur pour moi!«
Da war von den Damen in der Mehrzahl die Rede, und so war sein Adelsbrief keine Garantie für sie.
Aber Paulinens Spott reizte ihn, und eines Tages, an der Ecke, wo sie sich immer trennten, rief er:
»Wahrhaftig, Fräulein Pauline, wenn Sie wollten, ich biete Ihnen meine Hand.«
»Auch wenn ich nichts erbe, Herr Waldenburg?« bemerkte sie.
»Sie sehen, wie offenherzig ich bin,« antwortete er; »auch wenn Sie nichts erben, denn ich weiß, Sie sind ein vortreffliches Mädchen.« Pauline schwieg einen Augenblick.
»Ich bin der Liebe eines Mannes nicht ganz unwert,« sagte sie ernster, »das weiß ich wohl. Aber ich bin arm, blutarm, und dazu bin ich fest überzeugt, daß meine Tante nichts, so gut wie nichts hinterläßt.«
Der kleine Waldenburg legte die Hand aufs Herz, beteuerte die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung. Er sah ordentlich hübsch aus, nur daß Pauline auf ihn herabblicken mußte. Nun platzte er heraus:
»Ach, Fräulein Pauline, sehen Sie, mein ganzes Unglück ist, daß ich so klein bin. Niemand nimmt mich ernst, kein Mädchen will mich lieben.«
»Es ist wahr,« bestätigte Pauline; »auch ich habe Sie bisher nicht ernst genommen, aber nicht weil Sie so klein sind, sondern weil Sie auch mit Josepha liebäugelten.«
»O,« versicherte er eifrig, »das ist nur die Artigkeit, die man der Tochter des Hauses schuldet.«
»Gut denn,« sagte sie, ihm die Hand reichend; »wenn ich Ihnen unrecht getan habe, wird sich's ja zeigen. Wir wollen es uns beide bedenken.«
»Sie ist ganz reizend,« sagte sich der Kommis, als sie verschwunden war. »Aber bedenken muß man's doch. Josepha ist im Grunde frei, und das wäre eine Partie. Und ich bin ja doch von altem, guten Adel.«
Auch Pauline dachte bei sich:
»Ich muß ihn noch erproben, ich traue ihm nicht.«
Zu Hause öffnete ihr niemand auf ihr Klingeln; endlich kam der kleine Walter, die Tante sei wieder sehr schwer krank.
Und wirklich, soeben war die Greisin von einem neuen Schlaganfall betroffen worden. Der Arzt hatte ihr gestern gestattet, Kaffee zu trinken, und sie hatte sich so sehr gefreut darüber. Da fiel sie auf einmal vom Stuhl. Pauline kam eben recht, ihr die Augen zuzudrücken.
Das gab einen ungeheuren Aufruhr in der kleinen Häuslichkeit. Die winzige Barschaft, welche die Tante hinterließ, würde kaum für die Beerdigung hinreichen. Man hatte sich in letzter Zeit mancherlei Mehrkosten auferlegen müssen, immer im stillen auf die Erbschaft hoffend. Das Testament war gerichtlich deponiert, im Hause fand sich nur etwas Schmuck und ein kleines Sparkassenbuch. Dennoch raffte die Familie alles zusammen; man wollte sie doch anständig zur Ruhe bringen.
Am Tage darauf fand die Testamentseröffnung statt. Es war eine höchst umständliche Verfügung, man hätte glauben sollen, es handle sich wirklich um eine nennenswerte Hinterlassenschaft. Aber schließlich war es nichts, so gut wie nichts, die Tante hatte ihre Angehörigen nicht enterbt, aber sie hatte auch nichts zu vererben als Schmuck, Wäsche, Kleider, Möbel und jenes Sparkassenbuch.
Natürlich kam das alles der Familie sehr zu statten, das Büchlein deckte auch reichlich die Kosten, aber von einer Erbschaft konnte eben nicht die Rede sein. Die großen Hoffnungen der Familie waren vernichtet, die Tante hatte nichts erspart, oder das Ersparte auf irgend eine törichte Weise verloren, deren sie sich geschämt. Genug, es war nichts.
Man wollte nun die Stube an einen Herrn vermieten, es wurde alles geräumt. Nach der Testamentsverfügung fiel ein Teil des baren Geldes der Mutter zu, der Schmuck Paulinen, den Jungen allerlei Kleinigkeiten; Möbel und Wäsche sollten alle zusammen haben, so hatte die Tante höchst gewissenhaft disponiert.
Am folgenden Sonntage begann man zu räumen. Die Mutter war bald getröstet; es zeigte sich, die Betten waren schön leicht, lauter Daunen, vortreffliche Bezüge, die Möbel zwar altmodisch, aber dauerhaft, und aus den altfränkischen Kleidern würde noch mancherlei zurecht gemacht werden können. Die Jungen machten sich über den alten Kram her, Bücher, Kuriosa, Erinnerungsstücke. Walter bekam sozusagen den Abhub, Muschelchen, Riechfläschchen und was dergleichen zu Tage kam; aber er freute sich nach Kinderart.
Von der Wäsche sollte etwas verwahrt werden für Paulinens Aussteuer, meinte die Mutter. Pauline lächelte schmerzlich, aber die Mutter sagte, das Kaufen würde immer schwer gehen.
»Und da, sieh, ein wattierter Rock, noch fast neu!« – Es war der rote Rock, von dem die Tante gesprochen; und nun pochte Pauline das Herz. »Den kannst Du Dir behalten,« sagte die Mutter; »mich würde er zu dick machen, Dir wird er im Winter an der zugigen Kasse sehr gut zu statten kommen.«
»Gut, Mamachen,« sagte das Mädchen. Mit einemmale erinnerte sich Pauline an jene Nacht, an die geheimnisvollen Worte der Tante, an ihren leuchtenden Blick. Wenn die die Frau wirklich eingesehen hatte, daß Pauline eine Belohnung um sie verdient hatte! – Und versteckten alte Leute nicht oft ihr Geld in dieser Weise? –
Sie legte den Rock in ihren Schrank. Der Mutter wollte sie keine vorzeitigen Hoffnungen machen und sie nahm sich vor, abends, wenn alles schlief, den Rock zu untersuchen.
*