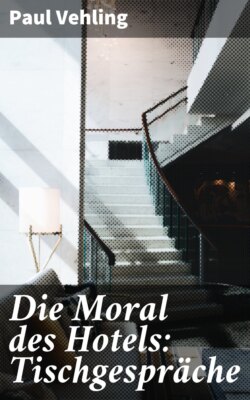Читать книгу Die Moral des Hotels: Tischgespräche - Paul Vehling - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT.
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Gespräche mit mir zu Tisch! – Wie schön läßt sich an der Tafel reden, wenn die Runde liebenswürdig, wenn das Essen gut und der Appetit nicht verdorben ist! Wie fröhlich läßt sich nach einer edlen Flasche philosophieren, wenn man aus feiner Schale heißen Mokka nippt und den blauen Rauch einer guten Zigarre in die Luft bläst, während der sinnende Blick den duftigen Wolken nachzieht. Der wachsamste Mensch wird dann unvorsichtig, dem Trug und der Täuschung zugänglich. Ja, was das Schlimmste ist: er wird vergeßlich. Und dennoch! Jeder will einmal so vergeßlich sein, jeder sich einmal als Mensch fühlen. Mehr als alles andere hat ein gutes Diner eine Wirkung daraufhin. Es verleiht dem Esser eine schöne, ja olympische Ruhe und Sicherheit, teilt ihm das stille, wohltuende Gefühl eines gesteigerten Selbstbewußtseins mit, welches kein anderer Genuß, keine andere Lebenslage in solch ruhiger Fülle zu bieten vermag. Darin liegt die große Gefahr, die Falle für den modernen Menschen. Ein derartiger Zustand, dünkt mich, sollte ruhiges, klares, vernünftiges Denken fördern, erwecken. Weit entfernt! Unsere Zeit hat kaum jemals ernstlich über diese Frage nachgedacht, hat nur instinktiv gehandelt. Darum versteht man auch so wenig zu essen. Die meisten verstehen es überhaupt gar nicht. Man will es nicht verstehen. Die Gefahr ist zu groß; die Zeit fehlt. Man könnte sich zu sehr als Mensch fühlen.
Da ich jedoch in der glücklichen Lage bin, über genügend Zeit zu verfügen, da ich die Gefahren eines guten Diners für uns moderne Menschen erkannt habe, so bemeistere ich dieselben – mit anderen Worten: ich bin ein aufrichtiger, meiner völlig bewußter Esser. Das will etwas sagen. Daher kann ich mir auch kaum etwas Menschlich-Schöneres denken als eine gesellige Tafelrunde. Das gute Gelingen eines Mahls hängt freilich von tausend verborgenen, mißgünstigen Kleinigkeiten ab, die nicht jedermann bekannt sind. Der Gourmet selbst hat seine Last damit. Ärger über mißlungenes Essen wird besonders stark empfunden. Als gesundheitsschädliche Gemütserregung tut er an Heftigkeit nur der wahnsinnigen Eifersucht eines Verliebten gleich. Diese beiden Tornados der menschlichen Seele haben – ganz wie die atmosphärischen – ein Zentrum, das absolut still und ruhig und unerreichbar ist: die Dummheit im psychologischen Falle.
So habe ich denn als Gastrosoph die verschiedenen Störungen, Hindernisse und Gefahren, die unseren Tafelfreuden drohen, eifrig studiert. Die Mähler, die ich gebe, sind daher berühmt, meine Gastlichkeit ist gepriesen; mein Bild ist in jedem Winkel der Erde bekannt – den Gebildeten wenigstens. Man prahlt mit meiner Bekanntschaft. Und hat keinen Grund dazu. Wo ich auftauche und erkannt werde – und ich werde erkannt – da entsteht Reportergedränge. Natürlich mischt sich allerhand unliebsames Volk unter. Gewöhnlich ist dies sogar am stärksten vertreten. Wie immer und überall und in aller Ewigkeit. Aber ich habe Verpflichtungen. Das Klappern gehört auch zu meinem Handwerk. Das Schweigen, das feine, lächelnde Schweigen gleichfalls. Was eine negative, aber nicht minder wirksame Reklame ist. Vor allem darf ich daher nicht grob werden. Und vor allem einem internationalen Banausentum gegenüber nicht. Denn dies ist ungefähr das bösartigste, gefährlichste Gesindel auf Gottes weitem Erdboden. Als Mann der Welt werde ich schließlich überhaupt nicht grob. Das heißt allerdings Zeitverluste. Als tüchtiger Geschäftsmann aber – denn das bin ich auch oder eigentlich – habe ich mir ausgerechnet, daß derartig angelegtes Kapital sich reichlich verzinst. –
So entstanden meine Tischgespräche, oder richtiger ein Teil derselben, die besonderen, die vorliegenden. Für mich waren sie eine höchst interessante, wenn auch teilweise verhängnisvolle, kritische Untersuchung der erwähnten Gefahren; dagegen eine gute Lehre und Strafe zugleich für meine Quälgeister. Denn hartnäckig ließ ich den teuflisch gesuchten, einmal gesponnenen Faden nicht mehr fallen. Selbst nicht auf die Gefahr hin, heimlich verfemt oder gar für langweilig gehalten zu werden. Weil meine Worte ehrlich und wohlgemeint sein sollten, drum mußten sie notwendigerweise so hinterlistig sein. Auch mußten sie interessant sein. Sonst hätten sie meinem Rufe geschadet und ich hätte nichts, absolut gar nichts damit erreicht. Weil meine Zuhörer an der Tafel Banausen waren, mußte ich fachsimpeln, mußte ich Griffe in die diversen Hanfbündel des Lebens tun, um sie – die Zuhörer, die Spezialisten – zu ködern, mit ihrem Fache ihre Aufmerksamkeit fesseln. Darin lag das Interessante. Für sie, die Zuhörerschaft. Ich erwartete im voraus alle Schrecken einer Inquisition, alle Qualen einer Selbsterniedrigung, ich sah die gähnenden Kiefer einer entsetzlichen Langeweile, ihre dunkle Rachenhöhle, ich empfand das Nagen eines bösen Gewissens, – aber statt alledem ergriff mich plötzlich ein fremdes Verlangen – Neugier – Schaffensdrang – Mitleid – Entdeckermut – sei es, was es will. Und vorsichtig und geduldig zog ich den verhängnisvollen Faden ein. Weiter und weiter! Denn, ach, nun wollte ich wissen, wie er entstand, woher er kam, was an seinem Ende hing. –
Es ist etwas Eigenartiges um die menschliche Seele. Ich wußte genau: der Faden wird in meinen Fingern gebildet. Aus dem wirren, losen Bündel Hanf entsteht das feste Knäuel. Das Bündel wird kleiner, das Knäuel wächst. Und dazwischen liegt die Wonne der Arbeit, die unwiderstehliche aber unbefriedigte Neugier, das Wissen und das Nichtwissen, die Furcht vor meiner Spule für den brausenden Webstuhl der Zeit, meiner Hände Werk zwar, aber nicht mein Eigentum.
Wer den Lauf der Ereignisse in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachtet, wird es ganz erklärlich finden, daß unsere Generationen (und vielleicht auch noch die kommenden) trotz aller technischen Fortschritte, trotz aller redlichen Bemühungen manches unbeachtet lassen, manches vom Strom der Zeit ins Leben Gerissene und im Aufblühen Begriffene ersticken lassen, das vielleicht zu scheu, zu unansehnlich, zu bescheiden oder zu schwach ist oder das gar wissentlich als zu verächtlich beiseite geschoben, als daß es der Teilnahme der Weisen und gar erst des gewöhnlichen Sterblichen wert wäre.
Unsere Zeit hat indessen vor allen anderen das Verdienst, daß sie uns die schöne Erde ganz erschlossen hat. Das Bedürfnis hierfür ist das ursprünglichste Empfinden im Forschensdrange (oder Neugier), das jede menschliche Brust bewegt. Wichtige Erfindungen haben es den Völkern ermöglicht, schnell, bequem und billig reisen zu können. Man macht ausgiebigen Gebrauch davon, denn man reist gern. Und jeder, der hierzu in seinem Leben Geld, Zeit und Gelegenheit hatte, kann, wenn er glücklich und klug genug war, nicht allzuviel Bücherweisheit in sein Reiseränzlein einzuschnüren, sich stolz in die Brust werfen und sagen, falls ihn irgendein Naseweis nach seiner Bildung befragt:
»Ich habe die Hoheschule des Lebens besucht; bin Doktor der Rechte des Daseins.« Und ähnliches mehr.
Wir Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts haben uns den Gesetzen der Anpassung getreu den heranstürmenden Ereignissen gefügt. Schranke um Schranke fiel, der Naturalismus kam und ging wie die Romantik vor ihm. Es wanken schon (so denken wir) die letzten Barrieren vor dem Gesuchten. Schließlich folgt die letzte Emanzipation, und wir stehen da mit leeren Händen vor einem Nichts. Wir stehen davor und sehnen uns nach neuen (oder gar zurück nach ein paar alten »abgelegten«) Idealen, denn ohne Ideale, mit einem puren Nichts geben sich Menschen nicht zufrieden. Wir sorgen und sorgen und vergessen, daß die Zeit für uns sorgt. Das ist die Nervosität des zwanzigsten Jahrhunderts, der Menschen nüchtern, kalt, berechnend, businesslike, aber dennoch mit einer qualvollen Sehnsucht im Herzen, mit der Genußsucht nach dem gewissen Etwas, das die dunkle Zukunft uns immer wieder hartnäckig vorenthält. Das ist Neugier. Wir haben die äußersten Winkelchen der Erde betreten, wir wollen die Tiefen der Lüfte und der Meere, ja die der eigenen Seele ergründen, den geheimsten Funktionen des Cerebellums nachspüren. Man muß sich sehr weit von den Menschen entfernen, um ein gutes Bild von ihnen zu erhalten. Ein Zusammenhang, eine Einheit ist schwer mehr zu erkennen, obgleich sie besteht. Aber die hinterlistigen Verhältnisse unserer Zeit haben die früher nach einer Einheit strebenden Gewebe der Zivilisation getrennt, sie haben neue Kontraste und Abgründe geschaffen, einzelne Reiche gebildet. Wir können kein Ende sehen, weil wir am Anfang stehen. Und immer stehen werden.
Daher toben gewaltige Kämpfe zwischen Kapital und Arbeit, blutige, verderbliche Aufruhre, mörderische Kriege, politische Umwälzungen. Daher fängt man sogar schon an, human zu werden. Einsichtsvolle Geister arbeiten beständig an dem Wohl des Volkes. Die Regierungen und Kapitalisten, vielleicht nur von gewissen Ängsten dazu angetrieben, geben Mittel mit vollen Händen her. Kurz, der Dankbare sieht hinter jedem Ereignis ein Streben zur Läuterung. Mögen nun edle Menschenliebe oder bloß graue Furcht vor unabsehbaren, unheimlichen, fabelhaften Folgen dies Streben fördern, wir wissen es nicht. Vielleicht helfen beide. Wir wissen nur Tatsachen, wie zum Beispiel, daß Menschenliebe und folglich auch Menschenfurcht Mythen sind, welche in uns lebendig geworden, nun in Wirklichkeit existieren. Furcht natürlich im erhöhten Maße. Wir wissen nur Tatsachen, wie zum Beispiel, daß die mehr oder weniger deutlichen Drohungen des Sozialismus manches aufgerüttelt und manches ins Bockshorn gejagt, manches in Bewegung gesetzt haben, das sonst in arkadischem Frieden weiter gewuchert hätte. Und wir wissen, daß die weisen Gesetzgeber sich immer erst durch verzweifelte Notwendigkeiten veranlaßt sahen, Gesetze zu ihrer und zu anderer Schutz und Recht herauszutüfteln und herauszugeben. Das Gesetz, eine Erfindung wie alle anderen, ist das legitime Kind der Notwendigkeit und des Geistes der Zeit. Nur das erste nicht: »Du sollst nicht vom Baume der Erkenntnis essen!« Das ist eine rätselhafte Kaprice, das Kind einer üblen Laune.
Die Bilder, welche unser Leben bedeuten, sind zwar stets andere, aber immer und immer wieder nur Illustrationen der alten Geschichte von dem der Menschheit eigentümlichen Wanken zwischen dem »Guten« und dem »Schlechten« oder dem Vollkommenen und dem Unvollkommenen. Ihr Werdegang ist eine Springprozession zum Heiligtum des Ganzen, ein wogendes Meer, ein Suchen, ein Sehnen nach Vollkommenheit und ein Rückfall ins Dunkle. Und wie im Brausen des Meeres, so ertönt dazwischen ein gellendes Hohngelächter von abertausend kapriziösen Geistern der Finsternis. Und Männer mit ganz feinen Ohren, begabt mit reicher Phantasie, hören dies. Sie haben darauf nichts Eiligeres zu tun, als es den Schwerhörigen mitzuteilen. Erst dann hält es die Menschheit für nötig, langsam sich wieder aufzuraffen. Wenn sie den Weisen glauben, heißt das.
Wie ungeschickt sind wir doch! Wie kurz denken wir nicht und fügen uns und andern dadurch unermeßlichen Schaden zu, den wir bei einiger Einsicht von Anfang an hätten vermeiden können. Gewöhnlich nennt man dies »Irrtum«. Der Irrtum, bildlich dargestellt, aber ist, wie wenn ein armes, leidendes Menschenkind sich in Schmerzen am Boden windet, während ein grinsender, abscheulicher Teufel hinter ihm steht, ihm eine Narrenmütze aufsetzt und sich vor Lachen über das komische Bild den Bauch hält. Zu solcher Demütigung muß es kommen, damit die meisten von uns angetrieben werden, einen schwachen Versuch von Selbsterkenntnis zu machen. Wie sind sie alsdann plötzlich so geschickt, den Schaden zu reparieren! Man denke sich nur einen Tölpel, der eine Schüssel fallen läßt. Was treibt ihn dazu an, die Scherben möglichst flink wegzuräumen oder gar wieder zusammenkitten zu wollen? Jemand, der nicht gewöhnt ist, Scherben zu machen, wird lachen und sie liegen lassen. Aber den Tölpel überzeugt selbst die Erfahrung nicht. Warum hat unsere Zivilisation, unser nationales und soziales Leben Situationen, Verhältnisse, Orte geschaffen, wo sie Laster, Verbrechen, Schwindsucht, Wahnsinn, Nervosität und alle sonstigen erdenklichen Leiden wie auf einem Mistbeete züchtet? Warum hat sie Industrien und Fabriken, die alle Beteiligten in die Ketten von Krankheit, Elend und Sklaverei legen? Nur damit sie, dieselbe Zivilisation, Hospitäler, Sanatorien, Kirchen, Wohltätigkeits- und Besserungsanstalten bauen und mit Wundern der menschlichen Erfindungsgabe protzen kann. Denn all der Jammer, den sie verursacht hat, soll wieder gut gemacht werden. Die Scherbenmacher des Lebens bedenken nicht, daß die Gefäße des Lebens aus dem feinsten Material verfertigt sind und daß der Saft des Lebens unaufhörlich daraus hervorsickert, wenn sie einmal einen richtigen Knacks bekommen haben. Leider aber steckt die Wurzel und der Same der giftigen Pflanze und des Unkrauts im Boden. Man sieht sie nicht eher, als bis sie mit dem Weizen aufgewachsen sind.
Man hat aber trotzdem schon viel eingesehen in unseren Tagen. Man fängt auch schon an, vorzubeugen statt zu reparieren. Ein erfreuliches Zeichen! Es gibt fast keine Industrie mehr ohne ihre Literatur. Arbeiterheere tun sich zusammen, ihre geschäftlichen und menschlichen Rechte zu beschützen und zu verteidigen. Selbst in den jüngsten, täglich neu entstehenden Industrien ist dies wahrzunehmen. Es ist jedoch kein Zufall, daß die Gastwirtschafts-Industrie, obgleich sie streng genommen jung, sehr jung ist und jetzt gerade gewaltig heranwächst, als solche unbeachtet geblieben ist. Ich will nicht den Anspruch erheben, die Vernachlässigung entdeckt zu haben, denn das wäre nicht richtig. Jedermann, der an dieser Industrie beteiligt ist, empfindet sie mehr oder weniger. Wenn auch schon viel in den Zeitschriften über das Gastwirtschaftswesen gesagt worden ist, so kann ich dies aber nur meistens für fragmentarisch und für leere Verwunderung über die plötzlich aufgeschossenen Riesenprachthotels oder für Reklame halten. Müßige Plauderer ohne jede tiefere Kenntnis haben sich damit befaßt, jedenfalls weil alles darin so schön aussieht, weil sie dort sehr gutes Essen und Trinken bekommen und im großen ganzen sehr gut aufgehoben sind. Derlei Tändeleien schrumpfen aber elend zusammen, wenn das Leben mit seinem ernsten Gesichte und seiner wuchtigen Sprache an sie herantritt.
Wir besitzen meines Wissens nach noch keine nennenswerte einheitliche, sachliche Kritik über das moderne Gastwirtswesen, das nunmehr – streng genommen – ein viertel Jahrhundert alt ist. Selbst wenn ein derartiges klassisches Werk schon existierte, so würden meine Tischgespräche doch nur als ein kleines Kapitel in dem großen Bande über die weitverzweigte Industrie kondensiert sein müssen, ja eigentlich gar keinen gebührenden Platz finden können. Im Zeitalter der Spezialisierung beschränke ich mich bei meiner Beschreibung des Hotels daher hauptsächlich auf ein Thema: das menschliche. Es wird jedoch auch der »Fachmann« an den vorliegenden Gesprächen verständnisvolles Gefallen oder Mißfallen haben. Aber ich will nur schildern – nichts anderes. Darum kann jedermann zuhören. Ich will dem »Fachmann«, namentlich dem jüngeren, und dann auch den Leuten, die täglich mit ihm zu tun haben, das Werden, Sein und Vergehen eines Menschen vor Augen stellen, chaotische Zustände kritisieren und erörtern und Kulturgewächse und -auswüchse betrachten, die von großem, allgemeinem Interesse sind. Wenn ich durch diese Darstellungen auch nur einen einzigen jungen »Fachmann« von der aktuellen Lage seiner Sache zu überzeugen vermag, wenn ich ihm den rechten Weg andeuten kann, der ihn an leiblichem und seelischem Niedergang vorbei zum allgemeinen und persönlichen Nutzen führt, so wird diese Arbeit überreichlich belohnt. Gerade im Leben des Arbeiters in der modernen Gastwirtsindustrie gibt es Zustände und Fragen, die schon lange nach Erlösung schreien. Ich bin vor keiner dieser schreienden und wimmernden Fragen zurückgewichen, noch habe ich sie schonend behandelt, Fragen, die an Menschlich-Allzumenschlichem so unendlich reich sind.
Die ganz außerordentliche, sonderbare Stellung, die der moderne Kellner in der Geschäftswelt einnimmt, hat ihn ungleich anderen Arbeitern weniger zum Kämpfer als zum Vermittler geschaffen. Das, dünkt mich, ist etwas Besseres. Jedenfalls erfordert seine Rolle in unserem Zivilisationstheater oft eine größere Geschicklichkeit als die des Helden oder des Naiven. Ein hervorragender Zug darin ist der kosmopolitische. Der moderne Kellner hat keine nationalen Bedenken. Er scheint der Vorläufer einer Völkerverbrüderung zu sein. Der ins Riesige gewachsene, heute schon unermeßliche Verkehr zwischen den Völkern der Erde, die stetige, ruhig, aber unaufhaltsam und triumphierend fortschreitende Kultur, deren Same von Europa in die entlegensten Eckchen der Erde getragen wurde, hat diese Verbrüderung aufkeimen lassen. Patrioten, Chauvinisten, wirkliche und Pannationalisten haben keinen triftigen Grund, diese Legierung von Völkerelementen zu verdammen. Wo die Eigenschaften verschiedener Erze vereinigt werden, entsteht zum mindesten ein nützliches Metall. Ob jemals ein edles Metall aus einer Völkerlegierung entstehen kann, bleibt dem stillglühenden Läuterungsprozesse künftiger Jahrtausende überlassen. Aus der Phiole aber sehen wir schon eines: den Weltfrieden leuchten.
So ist der Kellner mit all den Kenntnissen und Fähigkeiten, die er besitzen muß, dank seiner sozialen Stellung das typischste, kommerzielle Produkt des zwanzigsten Jahrhunderts, ein hervorragendes soziologisches, ja psychologisches »Problem«. Der Beweis dafür ist, wie oft man sich zum Beispiel auf der Bühne, in der Gesellschaft, in der Presse seiner Gestalt bemächtigt und sie auf billige, sehr, sehr billige Weise auszubeuten sucht. Niemals ernstlich behandelt und ernst nimmt, denn das kann man von den genannten Ausbeutern noch nicht oder nicht mehr verlangen. Gerade aber darum will ich eine rühmliche Ausnahme erwähnen: Bernard Shaw in seinem Schauspiel »You never can tell«. In dem Dilettantismus und der Spöttelei aber erblicke ich, wie eine neuentstandene dringende Notwendigkeit die erste Achtung auf sich zieht und wie sie empfangen wird. Indes kindisches Stammeln, müßiges Tändeln oder – in unserem Falle – selbst der spitzige Stift des Karikaturisten, dem man doch sonst genügend Vertrauen sollte schenken können, sind impotent und können den Problemen der Gastwirtsindustrie nicht helfen. Was der Kellner benötigt, sind starke Worte und starke Taten. Ein fremder Stein, der vielleicht vom Himmel fiel oder den ein Vulkan oder die See ausspie, wird ja immer zuerst die Runde durch die betastenden Kinder- und Narrenhände machen müssen, die sich daran belustigen, bevor der Mann kommt, der ihn liebevoll untersucht und ihm einen passenden Platz in seiner Sammlung einräumt, froh, eine neue, vielleicht interessante Spezies gefunden zu haben. Man wird hinter das Interessante und Kuriose eines vermeintlichen oder wirklichen Fundes kein Fragezeichen stellen. Die Situation wird jedoch spannender, wenn die Frage auftritt, ob man dem Funde oder ob er uns nützen kann. – Darum fand ich es nach einigem Schwanken der Mühe wert, die Tischgespräche aufzuzeichnen.