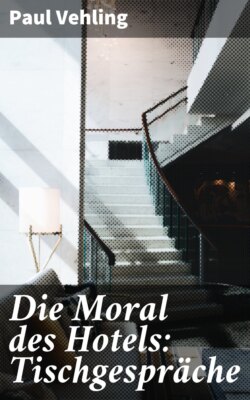Читать книгу Die Moral des Hotels: Tischgespräche - Paul Vehling - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
»Die Dinge und ihre Zusammenhänge bestehen«, sagt Paul Garin, »lange bevor sie gesehen und bevor sie erkannt werden. – Nach vieltausendjährigem Bestand von Familie, Gemeinde, Staat und Volk gab uns doch erst die jüngste Vergangenheit einige feste Vorstellungen über das Wesen und Wandel dieser Gebilde.« – – – Eine verblüffende Wahrheit wird uns da ins Gesicht gesagt! Wir könnten es nicht glauben, wenn wir es nicht täglich neu erlebten. Sie sehen, meine Herrschaften, wir wohnen nun doch schon so lange in diesem fashionablen Hotel. Haben wir uns jedoch jemals für das Haus näher interessiert, über seine Entstehung, seine Entwicklung nachgedacht? – Ja, dies Leben, dieser Betrieb! Wie interessant! Gewiß, das sehen wir alle. Aber ist es nichts mehr als interessant? – Das wäre wenig. Doch dies genügt uns. Wir schauen an, was uns gefällt, kritisieren vielleicht, was uns mißfällt; nehmen indes alles hin mit einer wunderbaren Sorglosigkeit und Selbstverständlichkeit, bezahlen und gehen wieder. Aber unwissend gehen wir, wie wir kamen. Außerdem haben wir damit unsere Schuldigkeit nicht getan. Es ist für uns als denkende Menschen absolut notwendig, daß wir uns ernstlich umschauen, uns orientieren, unsere Umgebung studieren und daraus profitieren. – Wie meinen Sie? Man hat gewöhnlich keine Zeit dazu? Oh, mehr als Sie glauben! Man nimmt sich gewöhnlich nicht die Zeit. Es kommt darauf an, die fliehende Minute nicht fortzulassen, bevor sie uns ihre Botschaft mitgeteilt hat. Und jede hat eine wichtige Botschaft für uns, die auf ewig verloren geht, wenn wir nicht Gewalt brauchen. Verlangende Bilder drängen sich uns jeden Moment auf, fremde Gestalten, fremde Welten sehnen sich nach uns, stumm mahnend, unwillkürlich unsere Teilnahme erflehend, nach Erlösung schreiend, uns Glück und Erlösung anbietend. Wir dürfen nicht achtlos daran vorübergehen, wenn wir schließlich selber nicht vereinsamt – Brachland – Wüste sein wollen. Darin liegt das große Geheimnis der Liebe. – Sehen Sie nur den stummen Blick eines wildfremden Menschen. Wieviel Fragen, Verlangen, Wünschen, Begehren oder Kälte, Verachtung, Abscheu, Haß, Wut, Zorn, Gefahr birgt er nicht in sich? Und das alles für uns? Für uns, auf denen er ruht? Beobachten, empfänglich sein, wachen ist daher unsere größte Pflicht im Interesse unserer Selbsterhaltung.
Ergreifen Sie doch nur einmal das erste Beste, das Ihnen in den Weg kommt, und lassen Sie alles andere einen Moment außer acht. Sie werden eine ganze Weile lang Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit darauf richten müssen, bis Sie es erkennen. Der Augenblick hat Ihnen viel Neues zu sagen, Sie werden viel lernen. – Hier kommt schon jemand. Ein Kellner. – Für Sie als Soziologe, Herr Professor, sollte dieser junge Mann doch besonders interessant sein. Natürlich, Sie und wir alle wissen, daß dieser Mensch zur Bedienung der Gäste hier gegenwärtig ist, doch darf ich fragen: haben Sie schon jemals über seinen Ursprung und folglich über seine Existenz nachgedacht? – Wer mag wohl der erste Kellner gewesen sein? – Das dachte ich mir! Sie lächeln! Ist die Frage so amüsant, weil sie scheinbar so einfach ist? Läßt sie sich darum mit einem teilnahmslosen Lächeln entlassen?
Ganymedes. Ganz richtig. Aber der zählt eigentlich zu den antiken himmlischen Heerscharen, während der Kellner eine verzweifelt irdische, menschliche Gestalt ist. Wer der erste Kellner war, wo er lebte, wie er hieß und wie er aussah, läßt sich nicht sagen. Es fehlen jegliche Urkunden oder Traditionen. Obgleich des Gastwirts Gewerbe eigentlich so uralt ist wie unsere Zivilisation, obgleich die Geschichtschreiber aller Zeiten, ganz wie alle anderen Bürger, jederzeit und überall dem Gasthause sehr gewogen waren, die Gestalt des Kellners blieb obskur. Nur hie und da wird er erwähnt und dann in das ungünstigste Licht gestellt. So in der schönen Geschichte von dem historischen Gasthause zu Askalon, dem »Schwarzen Walfisch«. Es wird dort erzählt, wie die Kellner die Rechnung präsentierten, ein gewichtiges, in Keilschrift auf Ziegelsteinen geschriebenes Dokument. Nun da Sie, Herr Professor, den Namen des Ganymedes scherzhaft erwähnt haben, komme ich darauf zurück. Es erzählt allerdings eine einzige, aber wunderbare Geschichte aus dem grauen Altertum uns von dem ganz außerordentlichen Kellner, der Ganymedes hieß. Er war schön an Körper und Geist, dieser Jüngling, der schönste seiner Zeit. Und man kennt sogar seine Familienverhältnisse. Er war der eheliche Sohn des Tros und der Kallirrhoe und tummelte sich mit seinen Brüdern Assarakos und Ilos auf den sonnigen Höhen des Idagebirges herum, das eine gute Reise im Luxuszug weit gegen Sonnenaufgang sich zum tiefblauen Himmel emporstreckt. – Ja, ja, gnädiges Fräulein, ich versichere Ihnen, Ganymedes war so schön, daß die bösen Nachbarn die Vaterschaft des braven Tros in Frage stellten und allerhand davon munkelten, daß der Jüngling einen der ewigen Götter zum Papa haben müsse. – Sehr richtig, gnädige Frau, stimme Ihnen vollkommen bei! Obgleich Zeus als oberster der Götter in dieser Hinsicht tatsächlich manches geleistet hat, was man heutzutage ganz recht mit gestrengen Blicken betrachtet und ihm sehr übel anrechnet und er infolgedessen wirklich der heimliche Schrecken manch eines jungen Ehemanns war, so wollen wir aber derartige Gerüchte bezüglich der Abstammung des Ganymedes als unbegründet aufs entschiedenste ablehnen. Denn es fehlt jeder authentische Beleg dafür. Tatsache jedoch ist, daß Zeus unendliches Wohlgefallen an dem Jüngling hatte, und die Sage geht, daß er seinen großen Adler aussandte, der den Ganymedes erfaßte und hinauf in den Himmel trug oder in das Elysium – wie Sie wollen.
In diesen Gefilden der Götter und der Seligen brauchte Zeus zu den vielen festlichen Gelegenheiten einen anständigen Kellner, und er ließ sich, da er viel auf gutes Service hielt, also den schönsten und besten der erdgeborenen Jünglinge kommen, um sich von diesem den Nektar und Ambrosia, die damalige Table d'hote der Götter servieren zu lassen. Und Ganymed muß mit seiner Stellung sehr zufrieden gewesen sein, denn er ist niemals mehr zur Erde zurückgekehrt. Sehr bedauerlich für die Irdischen. Von dem schlanken Götterkellner, der später selbst zu dem Rang eines Halbgottes avancierte, hätte sogar unser moderner Kellner hier ohne Zweifel manches lernen können. Was Wunder daher, daß die alten Künstler ein solches Exemplar von Schönheit und Gewandtheit verschiedentlich verherrlicht und sein Bild in Bronze und Marmor darzustellen versucht haben. Einiges davon hat sich sogar bis auf unsere Tage erhalten, damit jeder Kellner, der nach Rom kommt, sich sein Prototyp ansehen kann. – Sie erinnern sich, Herr Doktor? – Ach ja, natürlich! Sie als Kunstkritiker. Das ist ja Ihr Fach. – Nicht wahr? Es ist der Mühe wert, sich den Ganymed anzusehen; und es kostet nichts ... Wie meinen Sie? Ei, richtig! Welches Gedächtnis Sie haben! Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags wird ein Lire Eintritt erhoben, der nebst anderem in die Kasse des Heiligen Vaters fließt. Na, jedenfalls aber bekommt man an den anderen Tagen beim Eingang einen Zettel, der sagt:
»Permesso personale per visitare i Musei del Palazzo Apostolico Vaticano.«
Und unten drunter steht groß und großmütig:
»Gratis.«
Das weiß ich noch ganz genau, denn ... hm, verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, Sie wollten etwas sagen. – Ganz recht! In Wien hängt auch ein Bild. Ein wunderbarer Corregio. – In Dresden, gnädige Frau? – Gleichfalls richtig. Ja, in Dresden auch. Rembrandt, wenn ich nicht irre. So 'n pausbäckiger, kräftiger Bengel, der mächtig schreit, als ihn der Adler erfaßt. Auch etwas jung nach unseren Begriffen. – Indes, diese Bilder sind archäologisch unzureichend. Der Kellner profitiert nicht viel davon. Er kann höchstens das eine von seinem klassischen Kollegen lernen: nämlich, daß er ihm an Schönheit des Geistes und auch des Leibes soviel wie möglich nachstreben soll. Aber es haben sich seit dem klassischen Altertum die Verhältnisse so sehr verändert, alles hat ein so ganz anderes Gesicht angenommen, so daß wir den modernen Kellner nicht allzu sehr schmähen dürfen, wenn er dem Ganymedes wenig oder gar nicht ähnlich sieht. Außerdem haben wir auch gesellschaftliche Skandale und Mesalliancen sowieso gerade genug.
Dennoch oder gerade darum, so wie er heute ist, bleibt der Kellner aber ein ganz interessantes Thema. Und während wir hier auf den unsrigen warten, wollen wir nicht gleich schimpfen, wenn unsere Geduld etwas auf die Probe gestellt wird, sondern wir wollen einmal betrachten, was seine Arbeit ist und warum er uns oft so lange warten läßt. Das ist tatsächlich ein großes Gebiet. Zuviel für einen Tag. Vor allem müßten wir uns mit der Gastwirtsindustrie bekannt machen. Zu diesem Zwecke müßten wir, wie gesagt, sehr weit in die Geschichte zurückgreifen. Denn die Geschichte unserer Väter und Vorväter steht an den Wänden der Gaststuben geschrieben. Oft viel besser als in dicken Büchern. Wenn Sie mir folgen wollen, so werden Sie sehen, wie wenig sich die Menschheit eigentlich seit ihren frühesten Dokumenten bis auf unsere Tage innerlich verändert hat. Die äußeren Umstände sind freilich andere geworden. Sie werden sehen, wie sich aus der schönen, vielgepriesenen alten Gastfreundschaft eine Industrie großartigsten Stils entwickelte, die notwendige Folge des wachsenden Verkehrs der Völker untereinander.
Gastfreundschaft. Was ist, oder besser, was war Gastfreundschaft eigentlich? Einem Wanderer in alter Zeit, der ermattet, bestaubt von fernher kam und beim Sonnenuntergang an eine fremde Haustür anklopfte, wurde aufgetan. Man empfing ihn freundlich, nahm ihn ins Haus auf, wusch ihm die Füße, salbte sie, brachte ihm Salz und Brot, lud ihn zu Tisch, bereitete das beste Bett für den Müden. Das war Gastfreundschaft. Diese Sitte ist heutzutage fast nur noch dem Namen nach bekannt, ausgenommen bei einigen patriarchalisch lebenden Völkern des Orients. Daher wird sie auch allenthalben als eine große Tugend gepriesen. Wir sind aber immer zu leicht verführt, etwas schön und freundlich Aussehendes zu hoch zu schätzen. Wenn die Menschen sich gegenseitig etwas Gutes antun, so treibt sie gewöhnlich kleines persönliches Profitchen dazu an. Ganz leer will der Wohltäter nie ausgehen. Welchen Zweck verfolgen die Menschen, wenn sie sich in den Haaren liegen, sich gegenseitig bekämpfen? – Nur derjenige, der sich gar nicht mit den Menschen abgibt, ist der ganz Selbstlose. Sind wir moderne Menschen, die wir einem armen einlaßbegehrenden Wandersmann höflich aber kühl die Türe vor die Nase schlagen, etwa weniger tugendhaft als die Braven vor Jahrtausenden, die sich gegenseitig mit dem größten Vergnügen bewirteten? Ich hoffe nicht. Die Zeiten haben sich nur geändert. Wir besitzen statt der Gastfreundschaft eben eine andere »Tugend«, ein Äquivalent. Die Geschichte beweist dies. Zu früheren Zeiten wanderte man nicht so viel wie heutzutage. Es war beschwerlich und gefahrvoll. Die Menschen waren selten. Drum kam auch nur selten ein Wandersmann an die Haustür und begehrte Unterkunft. Man freute sich jedesmal von ganzem Herzen, einen Fremdling zu sehen und aufnehmen zu können. Dies Gefühl hat sich bis auf unsere Tage erhalten. Denn wenn man mit jemand gut Freund bleiben will, so darf man sich nicht zu häufig bei ihm blicken lassen. Dies scheint auch das Geheimnis der meisten Ehemiseren zu sein. Man darf daher die alten Völker ihrer edlen Gastfreundschaft wegen nicht allzu hoch preisen. Der fremde Gast war wirklich einmal eine angenehme Abwechslung in der stillen Eintönigkeit ihres Lebens. Besonders wenn er wohlhabend aussah. Er wurde staunend von oben bis unten betrachtet. Sein Felleisen war der Gegenstand stiller, aber allgemeiner Bewunderung. Man war auf die Geschenke gespannt. Selbst dem weniger selbstsüchtigen Gastgeber hatte der Wandersmann allerhand zu bieten. Er konnte die spannendsten Geschichten, die schönsten Abenteuer, die letzten Neuigkeiten aus fernen Landen erzählen. Zu einer Zeit, da es noch keine Zeitungen gab, war ein solcher Mensch daher jedem willkommen. So baut sich also die sogenannte Tugend der Gastfreundschaft auf der sogenannten Untugend der Neugier auf. Die Neugier hieß damals den Wandersmann willkommen. Man profitierte von ihm, wie man heute von ihm Nutzen zieht. Darum begleitete der freundliche, stolze Hausvater seinen Fremdling am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang und zeigte ihm seinen Weg. Wenn der Reisende sicher war, daß er die richtige Fährte gefunden und das Ziel des Tages nicht mehr verfehlen konnte, so schüttelten beide die Hände, dankten einander für das Vergnügen und gingen, – der Hausvater zurück, der Wandersmann voraus.
Heutzutage, namentlich in den großen Städten, können die reisenden Fremdlinge keinen Reiz mehr auf die Hausväter ausüben, wenn diese nicht gerade an den vom Fremdenverkehr abhängigen Unternehmungen beteiligt sind. Man liest alle Neuigkeiten aus der ganzen Welt in der Zeitung, man hat Menschen genug um sich herum. Die Haustüren bleiben daher dem Wanderer verschlossen. Seine Gegenwart, seine Übernachtung würde in einer gewöhnlichen modernen Haushaltung höchst unerwünscht und peinlich sein. Sind wir deshalb aber zu schmähen? Oder ist die heutige Welt nicht mehr neugierig? Was ist das Äquivalent für die alte Gastfreundschaft? – Die moderne Gastfreundschaft hat sich auf das seelische Gebiet begeben. So wenig Menschen es noch vor einigen Jahrtausenden gab, so viel gibt es heute. Wie damals der Menschenmangel als Einsamkeit, als Wüste empfunden wurde, so leidet heute das einzelne Individuum unter dem Eindruck der Menschenfülle. Und je größer, je stärker diese wird, um so hoffnungsloser erscheint sie dem einzelnen. Der Grund hierfür scheint in der Verschlossenheit und Unzugänglichkeit des inneren Menschen zu liegen. Und folglich in seiner Selbstsucht. Trotzdem haben die Menschen ein Bedürfnis, in Herden zu leben. Gesellschaft nennen sie dies. Ein wirklicher, normaler Mensch wird, wie gesagt, niemals selbstsüchtig und folglich niemals sich einsam fühlen. Doch darüber läßt sich viel sagen. Ich weiß, daß ich nicht ganz mit Ihnen darin übereinstimme. Ich würde keine Seele finden, die das täte. Das muß man mit sich selber ausmachen. – Also, wenn wir uns daher in der großen Menschenwüste sehr einsam fühlen und nun plötzlich einen Menschen antreffen, der uns gefällt, so nehmen wir ihn genau so freundlich auf, wie die einsamen alten Völker die einsamen alten Wanderer empfingen. Wir suchen die Seele des Gefundenen zu erkennen, denn diese hat uns vielleicht etwas Neues aus fremden Regionen zu berichten, etwas Neues, das nicht in der Zeitung steht. Wir betrachten den Fremdling mit ebenso großer Neugier und suchen ihm ebenso aufrichtig alles Gute anzutun, das in unseren Kräften steht. Es ist aber schwierig, die verwandte, freundliche, einsam wandernde Seele anzutreffen, die wir suchen. Nahe sucht man sie oft nicht, in der Ferne findet man sie gewöhnlich nicht. Es scheint alles Glückssache zu sein. Und bevor man regelrecht vorgestellt ist, bereitet eine Annäherung große Schwierigkeiten. Die moderne Seeleneinsamkeit scheint daher oft so groß und so unerträglich zu sein, daß sich viele praktische Menschen sogar in der Zeitung nach einem seelisch verwandten Wanderer umsehen, da sie gewissermaßen absolut jemand haben müssen, an dem sie ihre Gastlichkeit ausüben können.
Durch die uralte Sitte und Tradition wurde die Gastfreundschaft natürlich im Laufe der Zeit eine Art Gesetz und wurde als solches heilig gehalten. Damit waren dann ebenso natürlich allerhand Rechte, Gebräuche und Zeremonien verbunden, die teils den Gast, teils den Gastgeber verpflichteten. Als der Verkehr zunahm, sah man sich jedoch genötigt, vielfach vom alten Rechte und den alten Gebräuchen abweichen zu müssen. An den Hauptstraßen wuchsen kleine Häuser empor, die sich die Beherbergung der Fremden zum Geschäft machten. Die ersten Gasthäuser! Der Kommerzialismus erschien. Das Wandern und Reisen wurde bald so unsicher, die Gastfreundschaft unzuverlässig, daß sich entfernte Familien und Völker veranlaßt sahen, Verträge miteinander abzuschließen. Einzelne Staaten sandten Männer in fremde Länder, welche unter dem Schutze des betreffenden Volkes standen und sich um das Wohl ihrer reisenden Landsleute bekümmerten. Die alten Griechen nannten diese Männer Proxenoi, und wir haben sie heute noch und nennen sie Konsuln.
Die Reisenden schienen es allmählich für am bequemsten und besten zu halten, in den Gasthäusern an der Landstraße abzusteigen. Dieser Brauch wurde nach und nach allgemein. Die Römer, zur ersten christlichen Zeit auf dem Höhepunkte ihrer Macht und ihres Glanzes, waren natürlich die Hautevolee des damaligen Reisepublikums, die antiken Globetrotters. Als solche machten sie sich das Reisen so angenehm und sicher als möglich. An allen Landstraßen errichteten sie Stationen zum Pferdewechseln, mit welchen gleichzeitig ein Nachtquartier verbunden war. An Weinschenken und Gasthöfen in den Städten und Dörfern des Altertums war wirklich kein Mangel. Auf Reinlichkeit ihrer Lokale schienen die antiken Wirte jedoch im allgemeinen wenig Wert gelegt zu haben. Oder Horaz war ein großer Kostverächter. Denn der alte Dichter drückt sich sehr verächtlich über die Tavernen und Wirtshäuser seiner Zeit aus. Es ist auch möglich, daß er als Poet nicht immer bei Kassa war und die damals schon existierenden erstklassigen Lokale daher nicht frequentieren konnte. Vornehme Reisende, welche keine Freunde in der fremden Stadt hatten, stiegen gerne in den besseren Deversorien ab, weil sie dort gut aufgehoben waren. Zur Unterkunft der Dienerschaft und der Gespanne der Reisenden dienten die gewöhnlich etwas abseits liegenden Dependancen des vornehmen Gasthofes.
Wie von der ganzen antiken Zivilisation, so gewinnt man auch von den Hotel- und Restaurantverhältnissen der römischen Blütezeit ein wunderbar lebendiges Bild bei einem aufmerksamen Spaziergang durch die toten Straßen Pompejis. Als der Vesuv an dem verhängnisvollen Augusttage des Jahres 79 die schrecklichen Verheerungen in seinem Umkreis anrichtete und das blühende Leben rings um sich her zerstörte, da dachte niemand der Unglücklichen daran, welchen Dienst dieser polternde, feuerspeiende Bergriese den kommenden Geschlechtern erweisen würde. Er gab den leichtherzigen Bewohnern der Städte gerade noch Zeit genug, ihre kostbaren Siebensachen und Barschaft zusammenzuraffen und sich dann wörtlich aus dem Staube zu machen. Die fröhlichen Städte aber wurden samt allem, das nicht fliehen konnte, mit dicken Schichten von Asche, Bimsstein und Lava bedeckt. Sie wurden den späteren Zeiten aufbewahrt. War es die Vorsehung, welche mit prophetischen Augen die wütenden, verheerenden Scharen bärtiger, struppiger Barbaren aus dem Norden heranziehen sah, um Rom zu vernichten? – Wer kann sagen, was die schrecklichen Werkzeuge der Vernichtung des Schönen in der Faust des dunklen Schicksals der Völker bedeuten? – Wir, die Nachkommen, freuen uns, daß Pompeji gerade zu seiner Glanzzeit bedeckt und uns aufbewahrt wurde. Als man vor etwa hundertundfünfzig Jahren anfing, die Decke von der toten, vergessenen Stadt zu lüften, war man sehr erstaunt. Man fand Dinge, worauf man sich als neueste Errungenschaft etwas einbildete, man fand, daß die toten Bürger der toten Stadt sie besser verstanden hatten.
Und je weiter man vordrang, vorsichtig, Schritt für Schritt, Zoll für Zoll, um so herrlicher und wunderbarer und lebendiger rollte sich das Bild ab. Nun sehen wir sie alle vor uns! Unbewußt, ahnungslos, daß sie beobachtet werden, schalten und walten sie weiter. Und besser als irgendwo anders erkennen wir das lustige Völklein von Pompeji in seinen Gasthöfen, Weinschenken und Speisewirtschaften. Wir sehen sie essen und trinken, lachen und zürnen, all die würdigen Senatoren, die edlen Frauen, die Bankiers, die strammen Zenturionen, die flotten Maler und Bildhauer, die düsteren und fröhlichen und lausigen Dichter, die leichtherzigen Komödianten, die sanften Flötenspieler, die großsprecherischen Gladiatoren, die Handwerker, die Krämer, die Wirte, die Soldaten, die Bauern, die Sklaven, die Priester, die Priesterinnen, die Kellnerinnen, die Köche, die Sklavinnen, die leichtsinnigen Dämchen.
Natürlich hat das antike Gastwirtsgewerbe mit der Entwicklung des anderen Lebens Schritt gehalten. Bis heute hat man ein schönes, mäßig großes antikes Gasthaus in Pompeji bloßgelegt. Dieses befindet sich an der Gräberstraße. Eigentlich ist es nichts mehr als ein dürftiger Trümmerhaufen, aber die Fundamente und Säulenstumpfe deuten darauf hin, daß die Hauptzierde des Gebäudes eine schöne Säulenhalle war. Im Erdgeschoß unter den Säulen befanden sich allerhand Kaufläden; im ersten Stock wohnten die Gäste, welche von dort eine prachtvolle Aussicht auf das blaue mittelländische Meer genossen. Dienerschaft und Pferde wurden in neben dem Hause liegenden Ställen untergebracht. Man weiß nicht, ob die Gäste ihre Mahlzeiten in diesem Hotel einnahmen oder die vielen Speise- und Weinwirtschaften der Stadt aufsuchten. Auch ist es möglich, daß sie sich die Speisen von einer solchen in ihr Quartier bringen ließen, denn das Gasthaus selbst weist keine Einrichtungen für die Zubereitung von Speisen auf. An Speise- und Weinwirtschaften jeden Ranges war zur damaligen Zeit in Pompeji kein Mangel. Eines der renommiertesten Häuser war das nahe beim herkulaner Tor gelegene Gasthaus des Albinus, der in würdiger, stolzer Einfachheit seinem Etablissement gleichfalls die Firma »Albinus« gab. Das Gasthaus »Fortunata« hatte eine sehr günstige Lage im Mittelpunkt der Stadt an einer belebten Straßenecke und war gleichfalls sehr beliebt. Vor seiner Tür steht ein garstiger Brunnen, worauf ein Raubvogel abgebildet ist, der einen Hasen davonträgt. Wir müssen den hochentwickelten Geschäftssinn der damaligen Wirte bewundern. Den großen Wert einer guten Lage kannten sie ganz genau. Fast jedes Eckhaus war daher als Schenke oder Gastwirtschaft eingerichtet. Andererseits ist mir jedoch die stumme aber bedeutungsvolle Gegenwart eines Trinkbrunnens an vielen Straßenkreuzungen, also vor der Tür der meisten Gasthäuser geradezu rätselhaft. Über das Verhältnis der hohen städtischen Behörde oder der Polizei von Pompeji zum zeitgenössischen Gastwirtsgewerbe ist leider nichts bekannt. Ob die antiken Stadtväter mit den Ausbeutereien der antiken Wirte weniger Erfolg hatten wie ihre modernen Amtsbrüder bei ihren Zeitgenossen, und ob sie aus solch niedrigen Motiven daher als Maßregelung der streitbaren Wirte die rätselhaften Trinkwasserbrunnen vor die Türen der Tavernen pflanzten, ist ein noch unerforschtes Geheimnis. Da ich in den meisten Fällen sehr realistisch denke, so habe ich die Überzeugung, daß die Wirte an der Existenz der besagten Brunnen unschuldig sind, und ich werde in dieser Annahme bestärkt, je mehr ich mir das Leben und Treiben der pompejanischen Wirte und ihrer Habitués betrachte. Eine große, höhnische, heimtückische Macht verschanzt sich hinter diesen Brunnen. Ich glaube wirklich allen Ernstes, daß eine damalige, uns unbekannte große Temperanzbewegung unter den nüchternen Bürgern und Bürgerinnen der sonnigen Stadt am Meerbusen von Neapel es zustande gebracht hat, mit Hilfe öffentlicher Subskription jedes neu entstehende Gasthaus mit einem nassen, nüchternen Brunnen zu beantworten. Obgleich das Wasser darin heute nicht mehr fließt, so sprechen die Brunnen selber auch für diese Behauptung. Sie können ihre Herkunft wirklich nicht verleugnen. Sie sehen ganz nach einem temperänzlerischen Ursprung aus. Durchweg prosaisch und geschmacklos wie sie sind, stehen sie in scharfem Kontraste zu dem ästhetischen Bedürfnis der Alten. Vergleicht man sie mit Brunnen in einem pompejanischen Atrium oder Peristil, so sehen sie wirklich nur steinernen Trögen ähnlich, darinnen das liebe Vieh seinen Durst stillt. Da ich aber kein Historiker bin und auch weder Zeit noch Lust habe, das Wirken dieser antiken Temperänzler schärfer zu beleuchten, so werden moderne Mäßigkeitsgesellschaften, die die Früchte ihres Eifers als ein erst in ihnen gezeitigtes Verdienst beanspruchen, meine Mutmaßung mit ungläubigen und zweiflerischen Augen betrachten und die Existenz von antiken seelenverwandten Bruder- und Schwesterschaften leugnen, statt mir für die wichtige Entdeckung zu danken.
Schenken und Wirtschaften, welche Sklaven, Krämer, kleine Makler, Gladiatoren und Schauspieler zu ihrer Kundschaft zählten, waren sehr zahlreich. Diese Lokale hatten verschiedene Namen, wie Oenopolium, Taberna vinaria oder Caupona. Viele verabreichten nur Getränke, wovon eines der beliebtesten die »posca« war, eine Art Cocktail von Wein, Eiern und Wasser, welches kräftig zusammen geschlagen wurde. Die Popinae, die Speisewirtschaften für die niederen Klassen, bezogen ihren Bedarf an Fleisch aus den Tempeln, wo sie die geopferten Rinder, Schafe und Schweine zu billigen Preisen ankaufen konnten. Sehr häufig stellten diese spekulativen Wirte die verlockend zubereiteten Leckerbissen im Fenster oder in der Haustüre aus. Die hungrigen Passanten konnten natürlich solchen appetitlichen Anblicken nur schwer widerstehen. Doch auch schon damals, ganz wie heute, bediente man sich gewisser künstlicher Mittel, um die zäheren Gäste über Quantität und Qualität der Ware hinwegzutäuschen. Die Thermopolia, Tavernen, welche als Spezialität warme Getränke, unsere heutigen Grogs und heißen Punsche, verabreichten, wurden schon von den besseren Klassen besucht. Wenn ich »bessere« Klassen sage, so meine ich natürlich auch feinfühlende Menschen. Wie schwach müssen die Pompejaner und wie stark ihr Grog gewesen sein! Wie verrufen die Thermopolia! Denn viele der braven Zecher vermieden aus allen möglichen Gründen beim Besuch der Taverne jedes unnötige Aufsehen. Unter dem Schutze des cucullus, einer Art Haube oder Kapuze am Mantel, die über das edle Haupt gestreift wurde, schlüpfte manch ein Pompejaner durch die Gasse und verschwand im Hinterpförtchen der Schenke. – – Wie meinen Sie? Keinerlei historische Berechtigung? Gewiß nicht. Aber es bedarf doch wirklich keiner kühnen Kombinationsgabe, um diese zartfühlenden, heimlichen Trinker als Mitglieder der erwähnten antiken Temperanzgesellschaften zu erkennen, welche dem warmen Thermopolium den kalten, klaren Brunnen vor die Türe setzten. Ich gebe daher dem Dichter Plautus vollständig recht, wenn er sich über die bedauernswerten Männer lustig macht, welche verhüllten Hauptes in die Schenke schleichen mußten, um sich am warmen, würzigen Glühwein gütlich zu tun. Und dann, hm, verzeihen Sie, daß ich's erwähne, doch zur Psychologie der Zecher ist es notwendig – diese Schenken hatten außer dem Glühwein noch eine andere Attraktion in der Gestalt der Copa, was die antike Kellnerin oder Barmaid war. – Bitte – – dies ist vielleicht nicht so verdammenswert, wie wir annehmen mögen. Nach pompejanischen Gemälden zu urteilen waren diese Copae genau so resolute und stramme Jungfrauen und Geschäftsgenies wie ihre Kolleginnen von heute. Ein Bild stellt uns eine solche holde Hebe dar, wie sie von einem zaudernden Gaste energisch Bezahlung für den warmen Trunk verlangt. Ohne Zweifel ein antiker Mäßigkeitsbruder.
Schon früh empfanden die Wirte das Bedürfnis, dem Gedächtnis ihrer Kunden zu Hilfe zu kommen. Daher tauchen schon im grauen Altertum all die schönen Firmen »Zum Adler«, Hahn, Apfel, Rad, Merkur, Traube, Krug usw. auf. Daher die prangenden Schilder, die dem durstigen Passanten sagen, wo etwas Gutes zu haben ist. Daher die verlockenden Inschriften, die rührige Reklame der Gasthäuser. Die Pompejaner waren groß darin. Weder Temperanzbewegung noch Trottoir oder Reklame sind Errungenschaften unserer Zeit; wie vieles andere, worauf wir stolz sind. Die Alten hatten und übten es schon. Genau wie heute blühte damals die Sitte, die Wände der Häuser und die Mauern der ganzen Stadt mit Reklamen zu verschönern. Da es noch keine Zeitungen gab, so war in ganz Pompeji kein freies Plätzchen mehr, worauf nicht etwas Nützliches, Geschäftliches, Offizielles oder Wissenswertes angezeigt, gemalt oder gekritzelt gewesen wäre. Wie alle erdenklichen öffentlichen, politischen, städtischen, Neuigkeiten, Theater- und Ringkampfanzeigen, persönliche Mitteilungen wie Liebesseufzer und Beleidigungen, Lob- und Schmähreden an allen Ecken und Enden zur Einsicht offen standen, so übten auch die Menüs der Restaurants und Speisehäuser an den Mauern ihre stumme Pflicht. Bei der starken Konkurrenz kann ein Geschäft nur mit wirksamer Reklame aufrecht erhalten werden. Diese, eine unserer neuesten Ideen, verwirklicht von pompejanischen Wirten vor beinahe zwei Jahrtausenden! – Sarinus, der wackere Sohn des Publius, begrüßte auf der Wand an einer Straßenecke den müden oskischen Wanderer und teilt ihm höflichst mit, daß man um die zweite Ecke biegen müsse, um das vorzügliche Hotel Sarinus zu finden. Ein anderer Wirt, welcher noch über ein unvermietetes schönes Zimmer mit drei Betten und allen »Bequemlichkeiten« zu verfügen hat, läßt es der Mitwelt unverzüglich wissen:
»HOSPITIUM HIC LOCATUR TRICLINIUM CUM TRIBUS LECTIS ET COMM«(odis)
Ein sehr interessanter Speisewirt, ein Reklamegenie ersten Ranges, ein köstlicher Humorist, überzeugt von der Güte seiner Küche, preist dieselbe folgendermaßen:
»UBI PERNA COCTA EST SI CONVIVAE APPONITUR NON GUSTAT PERNAM LINGIT OLLAM OUT CACCABUM«
womit er sagen will, daß ein Zeitgenosse, welchem einer von seinen gekochten Schinken vorgesetzt wird, nicht gleich den Schinken kosten, sondern zuerst das Geschirr auslecken wird, worin der Schinken gekocht wurde.
Die antike Weinwirtschaft sah häufig einer modernen American Bar sehr ähnlich. Noch heute weist eine ehemalige elegante Taverne an der Via Nolana, der Straße nach Nola, in Pompeji einen stattlichen Schanktisch aus polychromem Marmor auf. Darunter befanden sich die großen irdenen Weinkrüge, die amphorae, angenehm durch Wasserleitung gekühlt. Der Wirt oder die Copa schöpften den Wein mit großen bronzenen Schöpflöffeln heraus und füllten die »poculae«, die Becher ihrer Gäste je nach dem Durst und den Mitteln derselben. Der Wirt an der Via Nolana muß ein kunstsinniger Mann gewesen sein. Sein Lokal war mit Freskogemälden geschmückt, welche einen Bacchus und einen Silenus darstellten. Andere Tavernen wiesen weniger künstlerischen Wandschmuck auf, aber überall schien ein Bedürfnis für Dekoration zu herrschen. Die Gäste selber schrieben oder malten oft etwas an die Wände der Schenken. Sie machten Anzeigen irgendwelcher Art, schrieben ihre Namen nieder, kritisierten das Essen und Trinken oder wurden anzüglich. Verschiedene künstlerische Versuche antiker Amateure sind auf diese Weise erhalten geblieben. So zum Beispiel eine verdächtig aussehende Gruppe von Würfelspielern, ein Jüngling, der mit einem Mädchen schäkert, ein Wirt, welcher ein Paar Krakehler an die Luft setzt. Nach unseren gegenwärtigen Verhältnissen zu schließen, müssen dies Studentenkneipen gewesen sein. In manchen Lokalen läßt auch die Orthographie der Sprache zu wünschen übrig. In Pompeji wurden auch mehrere Sprachen gesprochen. Das Resultat ist ein oft an den Wänden der Schenken zu findendes Kauderwelsch von Latein, Griechisch und Oskisch, dessen man sich im allgemeinen Umgang viel bediente. Wir dürfen daher die modernen Deutschamerikaner nicht allzusehr schmähen, wenn ihr Jargon die Reinheit der Muttersprache verloren hat.
So können Sie alle Stätten sehen, wo die Alten aßen und tranken und fröhlich waren. Vom schönen, erstklassigen Hotel Bellevue an der Gräberstraße herab bis zu den einfachen Herbergen, vom eleganten künstlerischen Weinwirt an der Straße nach Nola, in dessen Lokal sich die Honoratioren und Hautevolee der Stadt einfanden, um an zierlichen Tischchen und auf künstlerischen Dreifüßen zu sitzen und aus schön verzierten silbernen Pokalen Wein zu trinken, bis hinab in die Spelunken mit ihren »Chambres separées« und deren passendem Wandschmuck, Lokale, die genau wie heute sich ihres zweifelhaften Charakters wegen unter der Bürgerschaft eines großen Renommees und Zuspruchs erfreuten und jedenfalls glänzende Geschäfte machten.
Ja, leider, gnädige Frau! Zu allen Zeiten scheint die Menschheit ein gewisses Bedürfnis und eine Hinneigung zu Ausschweifungen, verschwenderischen Gelagen und Völlerei gehabt zu haben. Aber deshalb dürfen Sie doch wirklich nicht glauben, daß die alten Römer zum Beispiel entsetzlichere Schlemmer gewesen seien als wie wir. – Freilich, freilich, es herrscht diese allgemeine irrige Ansicht. Die Namen Lukullus, Nero, Elagabalus und wie sie alle heißen, die antiken Lebemänner, sind heute noch für jeden Gourmand der Inbegriff höchster Genußfähigkeit und nachahmenswerte Idole, während der Fromme sie nur mit einem Schauer von Entsetzen betrachtet und der hungrige Proletarier nur mit einer grimmigen, unterdrückten Verwünschung dieser Namen gedenken kann. Man hat jedoch schon verschiedentlich versucht, diese Irrtümer der Geschichte aufzuklären, und ich schließe mich gerne den einsichtsvollen Männern an, welche ein derartiges lobenswertes Werk unternehmen. – Nur durch die Geschichte der Menschheit kann man wirklich erkennen, was Mäßigkeit oder Unmäßigkeit ist. Wer dadurch der Menschheit Mäßigkeit in körperlichen Genüssen predigt, ist ihr Wohltäter. Das Bestiale in ihr nimmt doch immer wieder sein Teil. Und was die Mäßigkeit in Gedanken anbelangt – hm, da braucht man nicht so sehr zu sorgen, die kommt meistens von selber. Unser Heil liegt also in der Mäßigung in allen Dingen. – Wie für alles, so ist es auch für die antike Lebensweise und zu ihrem Verständnis wichtig, genau zu beachten, in welchem Lichte sie uns gezeigt werden.
In der grellen elektrischen Beleuchtung unserer Zeit nehmen sich die traditionellen »Schlemmereien« des Altertums doch recht dürftig aus. Ich will mich bemühen, Ihnen dies möglichst genau zu erklären. – Mögen wir auch noch so starke Scheinwerfer moderner Wissenschaft auf das Dunkel in der Geschichte der alten Kulturvölker richten, wir werden niemals in die rätselhafte Tiefe der vergangenen Jahrtausende dringen können, wenn wir nicht unsere Blicke in die eigenen Herzen tauchen und das Land der Alten mit der Seele umfassen. Dumpf schweigend betrachten wir alsdann das grauenhafte Ringen zwischen herrlicher, lebensdurstiger Schönheit und deren unerforschlichen, wilden, gegnerischen Mächten. Es ist der zögernde Kampf des Werdens, des Seins und des Vergehens, das wundervolle Trauerspiel des Lebens, das sich schon im Auge des Säuglings ahnen läßt, das Spiel, dessen klagende Akkorde das Jubilieren des Frühlings schon durchziehen. Wir sehen die Jugend dieser Nationen, ihren Trotz, ihren Mut, ihre Einfalt, ihre frische Stärke, ihre Einfachheit, Arbeitslust, Sittenstrenge. Wir sehen ihre Pläne, die sie als Erbauer von Weltreichen entwerfen; sie träumen von der Ernte künftiger Kulturen, deren Same in ihren Herzen wühlt. Sie essen einfach, trinken Wasser, opfern ihre Söhne für das öffentliche Wohl und die Gerechtigkeit. Wir sehen die gereiften Nationen, ihre Herrscher, Politiker, ihre Künstler und Denker. Wir beobachten die Wechsel in der Brust der Nationen. Fremde Einflüsse, welche durch den Verkehr mit der Außenwelt unvermeidlich sind, arbeiten im Charakter des Volkes. Wir sehen Wohlstand, Reichtum, Luxus, veränderte Lebensweise, veränderte Sitten, veränderte Ansichten und Gedanken, nagende Zweifel, lockende Versuchungen, heiße Kämpfe, überwundene Standpunkte, – Triumph des Neuen. So entschieden und bestimmt und scharf abgegrenzt sich die Konturen der Zeiten von ferne ansehen, so unmerklich ist ihr Übergang von einer zur andern. Sprossen, Wachsen, Verwelken. Und jedes hat seine Zeit, jedes seine Rechte.
Wie im Denken, im künstlerischen Empfinden, Weltanschauung und Lebensweise die Alten zur Blütezeit der Antike einfacher, stärker als wir und uns daher überlegen waren, so betrachteten sie auch das Gastmahl nicht lediglich als eine Funktion zur Körperernährung, sondern als eine geweihte Handlung, aus welcher sie Freude und Stärkung schöpften. Doch es gibt ein Halt. Und das ist das Rätselhafteste, das Unerforschlichste des Lebens: mit der größeren Ausdehnung, der steigenden Entwicklung der Nationen, mit ihrer wachsenden Freude am Dasein, mit ihrer Blüte und Manneskraft schlichen sich auch schon die grinsenden, verkleideten Dämonen des Verderbens in die Mitte der daseinsfrohen Menschen. Diese bösen Widersacher verteilten Reichtum und Macht mit vollen Händen, schmeichelten der Bestie des Menschen, fachten die wildesten Leidenschaften an. Sie weckten Myriaden von bisher ungekannten, verborgen schlummernden, unersättlichen Begierden. Überall, wo der Reichtum sich vermehrt, wo die berauschende, verführerische Stimme der Großstadt flüstert, da recken sich diese Gespenster empor und fahnden nach ihren Opfern. Und ihren Spuren folgen alle Greuel des menschlichen Lebens: Laster, Verbrechen, Krankheit, Sklaverei, Wucherei, Raub, Totschlag, Krieg, wie die Geier, Hyänen, Schakale, Raben, Würmer und andere Aastiere dem Geruche der Fäulnis folgen. Ein verheerendes Feuer schleicht durch das Mark eines Volkes, das im Banne dieser Mächte liegt, wie eine Seuche verbreitet es sich, vererbt es sich auf die Kinder der Eltern, bis das ganze Geschlecht wurmstichig, faul zusammenbricht und sich in den Stürmen der Zeit als Staub auflöst.
So fuhren die herrlichen Geschlechter des Altertums dem rätselhaften Finale entgegen, das ihrer harrte. Was war es? Lauerte es in dem blutdürstigen Gebrüll aufgebrachter Barbaren und in ihren Fußtritten? War es halb heraufbeschworen durch die Wünsche in der eigenen Brust, die aufreibende Gier nach Freude, nach Reife, nach Vollendung, nach Erlösung? War es eine schlaffe, süße Ermattung, eine Sehnsucht nach Tod oder der eigentliche Zweck, der Triumph ihres Erdenwallens? – Das Trauerspiel ist aus – der Winter ist da – wählen Sie, meine Freunde, sich den Schluß – ganz nach Ihrem Belieben und Ihrer Auffassung.
Unter solchen Eindrücken einer großen Vergangenheit, die ihre Hand selbst noch bis in unsere heutige Zeit hinein erstreckt und wunderbar mit der zauberischen Gewalt, welche von den Gräbern gestorbener Freuden ausgeht, unsere Herzen erfaßt, verbleicht natürlich unser eigenes Leben. Das ist das Recht, welches der Tod auf das Leben – oder die Vergangenheit auf die Gegenwart hat und ausübt. Wir fühlen uns klein. Es ist, als wollte sich das Vergangene an uns, den Lebenden, rächen, weil wir es verdrängt haben. So entstehen auch die Geschichten von dem märchenhaften Luxus, Schönheit und der schwelgerischen Lebensweise des Altertums. Aber ein einziger nüchterner Blick auf die technischen Möglichkeiten wird uns von dem magischen Banne des Vergangenen befreien. Ich will daher, meine Freunde, nicht Ihre Zeit verschwenden und Ihnen antike Gastmähler in allen meiner Phantasie zu Gebote stehenden Farben und mit allen Einzelheiten darstellen. Wir wollen uns auch nicht durch den Eindruck eines vergangenen Glanzes oder durch schwärmerische Geschichtschreiber beim Entwurf unseres Bildes vom antiken Gastmahl beirren lassen. Muß man nicht gewöhnlich über Historienbilder und »historische« Literatur lächeln, wenn man sich nicht gerade angeekelt fühlt? – Uns gilt nur, den Geist der damaligen Zeit mit den Augen unserer Seele zu betrachten und in uns aufzunehmen. Dies und nichts anderes ist der bleibende Wert, den die große Zeit hat, dessen Erben wir sind, den wir besitzen sollen. Alles andere ist Schutt und Trümmer und altes Gerümpel.
Es würde daher ungerecht und unrichtig sein, zu behaupten, daß die Alten in Raffinesse der Küche und Feinschmeckerei unsere Zeit übertroffen hätten. Was die Kunst des Essens und Trinkens jedoch anbelangt, so scheinen sie uns weit überlegen gewesen zu sein, obgleich – wie gesagt – die antike Küche bei weitem nicht so vollendet und reichhaltig war, wie es die der französischen Renaissance, also die unsrige ist. Denn dies ist gewiß: die Alten nahmen sich mehr Zeit zu ihrem Gastmahl: sie brachten ein einfaches, stolzes Selbstgefühl mit an ihre Tafel, ein Gemüt, das ungetrübt von einer vielverzweigten, rastlosen Zivilisation, unberührt von bedrückender, einengender Konvention steifer Faltenhemden und frei von jeder geschäftlichen Sorge einzig und allein einem inneren, angeborenen Bedürfnis für Schönheit folgend, die Freude suchte und sich rückhaltslos der Freude ergab. Denn die Gemütsbeschaffenheit des Gastes ist ein ebenso wichtiger Faktor im Wohlgelingen des Gastmahls wie die Qualität der Speisen. Daher maßen die Alten auch dem Gastmahl viel mehr Bedeutung bei, wie man es heutzutage tut. Man muß staunen über die herrliche Fülle von schönen, künstlerischen Tafelgeräten, Haushaltsgegenständen, Trinkbechern, Wärmebecken für Speisen, Leuchtern, Tripoden usw., die man noch in den letzten Jahren in Pompeji gefunden hat, wenn man bedenkt, daß die Pompejaner vieles für sie Wertvolle auf der Flucht vor dem großen Verhängnis ihrer schönen Stadt eiligst zusammenrafften und mitnahmen. Viele kehrten zurück, nachdem sich die Wut der Elemente gelegt hatte, drangen durch die eingestürzten Dächer ihrer verschütteten Heime ein und gruben aus, was in der Angst und dem Tumult der Katastrophe liegen geblieben war. Ferner waren in den darauf folgenden Jahrhunderten diese herrlichen Gräber des Altertums der Gier und Beutelust einzelner Menschen ausgesetzt, die eine leise Ahnung von den vergrabenen Schätzen hatten und diesen stets beizukommen suchten. Im siebzehnten und zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurde die unglückliche Stadt von gierigen Horden von Piraten und Kunsthyänen überfallen, die auf der Suche nach Schätzen und kostbaren Gegenständen alles wüst umwühlten und nichts verschonten. Erst vor wenigen Jahrzehnten regte sich das menschliche und archäologische Gewissen der Schatzgräber, und unserer Zeit verdanken wir alles, was wir über die Alten wissen. Sie erst machte uns auf jeden, selbst den kleinsten unscheinbarsten Fund aufmerksam und erklärte uns, wie die Alten aßen, tranken, handelten und wandelten.
Wie wenig war uns das Glück günstig, und wieviel haben wir noch gefunden! Und aus allen Funden spricht ein unersättliches Begehren nach Schönheit, ein auserlesener strenger Geschmack, ein gesundes, verlangendes Formen- und Stilgefühl. Warum sollte man nicht daraus schließen können, daß sich dieser künstlerische Geschmack auch auf die Auswahl, Zubereitung, auf das Servieren und Genießen der Speisen erstreckte? Was tut eine barbarisch zubereitete und barbarisch gegessene Speise in einer künstlerischen, edlen Schüssel? Was ein schlechtes Getränk in einer pocula, einem mit Rosen bekränzten Trinkbecher? – Sehen Sie, warum die Alten die Kunst des Essens besser verstanden als wir? In den Gastmählern eines Plato oder eines Plutarch erblicken wir einen schönen Gottesdienst, vor welchem ein modernes Diner mit allen seinen Raffinessen wie eine sachgemäße Abfütterung erscheint. Soundsoviel pro Kuvert. Im Essen und Trinken aber liegt ein tieferer Sinn verborgen. Und wenn wir den überirdischen Inhalt in etwas Irdischem erkennen, so nennen wir den irdischen Gegenstand oder Handlung ein Symbol, ein Sinnbild, ein Gefäß, ein greifbares Äquivalent für einen körperlosen, unsichtbaren Wert. Man bedarf dieser kleinen Symbole, um große Gedanken, seelische Welten, körperlose Vorgänge plastisch und verständlich darstellen und ausdrücken zu können. Die Welt, die Natur, das Leben ist voll davon. Die Menschen, die Religionen lieben sie. Im Bilde des Gastmahls namentlich ist der Sinn schön und unverkennbar klar. Ein Freund ladet den anderen gewöhnlich nicht zu sich, um ihn abzufüttern, sondern um mit dem Mahl eine Wohltat auszudrücken, die er ihm antun will. Daß eine solche Tat wiederum ihren reziproken Wert hat, daß sie dem Geber gleichfalls von Nutzen ist, ändert nichts an der Schönheit der Handlung.
So dürfen wir mit gutem Gewissen behaupten, daß die Alten zu ihren Blütezeiten den Sinn des Gastmahls ganz erfaßt und beherzigt hatten und dasselbe als das Symbol einer schöneren Handlung denn die Tätigkeit des Kauens und Verdauens betrachteten. Die alten Historiker und Dichter, obgleich sie viel über ihre zeitgenössischen Gastmähler berichtet haben, tragen freilich wenig zur Unterstützung dieses Gedankens bei. Vor allem aber hat sich die Weihe der Jahrhunderte über die vergangenen, versunkenen Zeiten gebreitet, hat geläutert und den Schmutz des Alltags ausgeschieden, so daß die erlebten und genossenen Freuden der Alten in verklärtem Glanze vor unseren bewundernden Augen auferstehen und jung sind – jung und schön, schöner als zu ihrer Zeit, da sie irdisch waren, wie die unsrigen zu unserer Zeit irdisch sind.
Wenn ich aber das realistische Bild eines antiken Gastmahls gegen das moderne Leben halte, so verblassen alle unsere Träume von der großen Zeit. Wer als Historiker, Wirt, Kellner, Fleisch-, Gemüse- oder Viktualienhändler oder gar als Gourmet den Irrtum begeht, die Größe der Antike in ihren Kochtöpfen zu suchen, der verdient gerecht bestraft zu werden, und er wird es. Seine Enttäuschung wird gräßlich sein. Er wird die alten Dichter und Historiker, die ihre Mähler besangen und feierten, für harmlose, schwärmerische Enthusiasten halten; er wird nicht begreifen können, wie die großen führenden Geister der damaligen Zeit von Schlemmerei und Völlerei ihrer Zeitgenossen faseln und solche »Ausschweifungen« bejammern konnten. Er wird sie für kurzsichtige Moralisten und schüchterne, schamhafte Schwachköpfe halten. – O ja, die Alten hätten wirklich gern geschlemmt – in unserem Sinne geschlemmt – wenn sie gekonnt hätten. Aber sie konnten beim besten Willen wirklich nicht. Die antiken Dichter haben tatsächlich viel gesündigt. Durch ihre Lobreden und glühenden Schilderungen der Tafelfreuden einerseits und deren absolute Verdammung andererseits haben sie die Nachwelt zu dem Glauben verführt, daß die antike Genußsucht und Prasserei etwas ganz Beispielloses in dem Schuldkonto der Menschheit gewesen sei. Aber lächelnd müssen wir den Dichtern etwas mehr Spielraum geben als den Photographen. Ein kurzer kritischer Blick über die Möglichkeiten zur Schlemmerei, die den Vielgeschmähten zu Gebote standen, wird alle Befürchtungen beschwichtigen und die Röte der Scham vor unserer eigenen Verwerflichkeit in unsere Wangen treiben. Es ist kein Zweifel, die Alten waren Feinschmecker. Wir auch. Möglichst gut essen will jeder. Sogar die, die darüber am meisten schimpfen. Aber die Güte des Menüs hängt ausschließlich von der Fülle und der Beschaffenheit der Rohmaterialien ab. Kürzlich fand man ein antikes Kochbuch. Ich weiß aber leider noch nicht, welchen Gebrauch die Alten von den guten Gaben der Natur machten. Woraus diese bestanden, können wir jedoch leicht erraten. Im großen ganzen waren sie wohl gleich denen von heutzutage. Nur nicht in so reicher Fülle. Der Boden schenkte den alten Völkern reiche Nahrung an Gemüsen und Pflanzen, wie er es heute noch tut. Der Süden bot ihnen seine köstlichen Früchte; die nützlichen Haustiere hatten sich schon lange den Menschen angeschlossen. Die alten Fischerleute wußten den Seetieren nachzugehen. Alle Muscheln, Mollusken und Krustazeen, die vielen Sorten delikater Fische des Mittelmeers, welche die Bouillabaise mit Recht so berühmt gemacht haben, alle zierten sie schon die Tafel der Alten. Und was die südliche Heimat nicht aufbot, das holten sich die Alten aus fernen Ländern. Aber vieles muß doch auf dem langsamen, beschwerlichen Transport gelitten haben. Wie die Austern, welche sich die Cäsaren von Englands Küste holen ließen, in Rom noch frisch und genießbar sein konnten, ist mir rätselhaft. Die meisten Gewürze und Spezereien des Morgenlandes vertrugen die schwierige Beförderung der damaligen Zeit wahrscheinlich schon besser. Daß jedoch derartige Importen zur damaligen Zeit mit großen Kosten verknüpft und folglich etwas ganz Unerhörtes waren, ist sehr natürlich. Nur die allerreichsten Gourmets konnten sich einen derartigen Luxus erlauben, während den weniger Bemittelten nichts übrig blieb, als sich respektvoll fernzuhalten oder über die »Extravaganzen« zu schimpfen und sie als verderblich zu bezeichnen. Eine besonders schmackhafte Art von Würstchen und gesalzene Fische, welche vom Pontus nach Rom gebracht wurden, galten nach den damaligen Begriffen der renommiertesten Feinschmecker als die größte Delikatesse. In den Augen der minder begüterten Bürger waren diese harmlosen Nahrungsmittel geradezu staatsgefährlich, ein Zeichen bedauerlichster Dekadenz. Wollüstige Gourmets, welche sich nicht mehr mit den heimischen zähen Hahnenbraten zufrieden erklärten und die korrupte, gottlose, orientalische Methode des Geflügelmästens in ihren Hühnerhof einführten, wurden entweder zu Genies oder zu Hochverrätern gestempelt. Zu gewissen Zeiten waren derartige Verfeinerungen ungefähr gleichbedeutend mit Gotteslästerungen, und römische Patrizier und Senatoren ergrimmten darüber mehr als heutzutage ein hungriger Proletarier, der zufällig etwas von indischer Vogelnestersuppe oder »Poularde truffée Regence« hört.