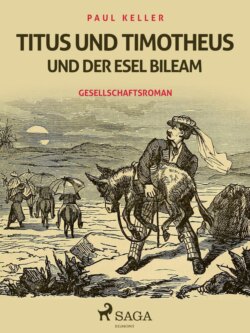Читать книгу Titus und Timotheus und der Esel Bileam - Paul Keller - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nachtbetrachtungen.
ОглавлениеAch, wohl waren sie müde, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Der ernste Gedanke, jetzt hast du an einem neuen fremden Ort deine Hütte gebaut, darin du zu leben entschlossen bist bis an dein Ende, verscheuchte den Schlummer. Die Vergangenheit kam mit ihren alten Bildern, von denen es nun Abschied zu nehmen galt für immer.
Titus starrte nach der dunklen Zimmerdecke, er dachte an Vergangenes. In allen entscheidenden Augenblicken des Lebens kommen die Bilder der Jugend zurück, sogar in das erlöschende Auge eines Sterbenden. Auch vor dem Auge des weltflüchtigen Titus wurden alte Bilder lebendig.
Sein Vater war Arzt gewesen. Er erinnerte sich seiner noch dunkel. Er war ein grosser Mann mit einem Vollbarte. Er hat immer viel Spass mit ihm gemacht, und Titus hatte den lustigen Vater lieber gehabt als die stille Mutter. Sie besassen ein leichtes Wägelchen, das von einem munteren Schimmel gezogen wurde. Mit diesem Gefährt fuhr der Vater zu den Kranken nach den Dörfern. Er nahm den Jungen oft mit. Vor der Tür des Kranken musste der Knabe warten. Er guckte sich dann die Dorfstrasse an, hielt die Pferdeleine und freute sich, wenn vorübergehende Dorfkinder mit einem gewissen Respekte sagten: „Das ist Doktors Junge!“ Einmal ist der Schimmel mit ihm losgegangen, er hatte aus Langweile zu stark an der Leine gezupft. Der Schimmel setzte sich gleich in Trab, und da hörte der Junge auch schon den Vater schreien, und er wusste wohl, dass er dem Wagen nachrannte. Aber der Schimmel hatte einen starken Vorsprung und hatte sich in seinen berühmten „schlanken Trab“ gesetzt. So war für den Vater nichts zu erreichen. Dem kleinen Titus, der damals noch Philipp hiess, fiel ein, er könne die Bremse andrehen, aber die Bremse ging zu schwer, er konnte sie nicht drehen. So musste er weiterfahren. Die Dorfstrasse war belebt, zwei Heufudern musste er ausweichen, zwei Radfahrern, einer Langholzfuhre und einer Herde Gänse. Die Gänse waren das schlimmste Hindernis; denn sie wollten nicht ausweichen. Der Wagen schleuderte, als er durch die kreischende Schar lenkte. Schliesslich gelang es ihm, durch kosende Zurufe das Temperament des Weissen zu sänftigen und ihn durch milde Zusprüche und etliches Leinezupfen zu bewegen, an einer verbreiterten Stelle der Strasse vorsichtig und ganz regelrecht zu wenden und die Dorfstrasse zurückzutrotten. So begegnete er dem Vater, der ausser Atem war. „Du musst nicht böse auf den Schimmel sein, Papa, ich habe an der Leine gezupft, da hat er gedacht, du sitzest schon im Wagen, und ist losgegangen.“
Der Vater sagte nichts als „Gott sei Dank!“ und küsste den Sohn. Dann rief er dem Schimmel zu: „Los, du rasender Renner!“ Sie lachten beide, der Schimmel wieherte, und alle waren herzlich vergnügt. Schön waren diese Besuchsfahrten bei Kranken! Manchmal freilich war es traurig; wenn weinende Verwandte in der Haustür standen und fragten, ob denn gar keine Hoffnung mehr sei, und der Vater bedauernd die Achseln zucken und fortfahren musste. Dann dachte der kleine Junge, es sei eigentlich recht schlimm und traurig auf dieser Erde. Aber öfters noch begleiteten Verwandte den Vater bis zum Wagen, und ihre Gesichter strahlten, und manchmal küssten sie dem Vater die Hände. Dann war der kleine Junge sehr stolz. Welcher Junge in der Stadt hatte wohl einen Vater, dem die Leute die Hände küssten? — Dann kamen die sechs Wochen, wo der Knabe den Vater nie mehr begleiten durfte; da hauste eine Seuche in der Gegend, der Typhus. Der Vater war kaum ein paar Stunden zu Hause, Tag und Nacht war er unterwegs. Und nach sechs Wochen ging der kleine Philipp mit seiner Mutter hinter dem Leichenwagen des Vaters. Die Leute standen am Wege oder gingen hinter dem Sarge, und viele weinten laut und sagten: „Der gute Herr Doktor. Er hat sich geopfert!“ Dann wurde das schöne Haus, der liebe Schimmel und das Wägelchen verkauft, und Philipp zog mit der Mutter in eine kleine Mietswohnung.
Er durchlief die Klassen des heimischen Gymnasiums ohne grosse Mühe und bezog mit neunzehn Jahren die Universität. Seit der Vater tot war, hatte die Mutter, die von jeher still und fromm war, nur noch Gedanken, Sehnsüchte und Hoffnungen, die hinübergingen in das Land der Wiedervereinigung und aller Erfüllung. So war sie glücklich, als ihr Einziger einwilligte, Theologie zu studieren. Er studierte mit allem Eifer und hielt sich von wildem, studentischem Treiben ganz fern. Aber er vergrübelte sich in der Einsamkeit seiner kleinen, kahlen Stube. Ganz und gar der starken Persönlichkeit Luthers verfallen, wollte er sich nicht abfinden mit der Allianz von Lutheranern und Reformierten. Da er nun in seelischen Konflikt mit der evangelischen Landeskirche kam, insonderheit den Fürsten und weltlichen Behörden das Recht abstritt, in religiösen Dingen ein so grosses Wort zu führen, da er insonderheit auch den Satz: „Cuius regio, eius religio,“ von Herzen verwarf, so gab er es auf, ein Diener der evangelischen Glaubensgemeinschaft werden zu wollen; er trat zu den Altlutheranern über, obwohl er ja auch da auf Sätze und Auffassungen stiess, die ihn störten.
Kurz vor dem Wechsel starb seine Mutter. So blieb ihr der Schmerz erspart, ihre Lebenshoffnung zerrinnen zu sehen, die sie bis jetzt aufrecht erhalten hatte, ihren Sohn bei St. Katharina im Heimatstädtchen predigen und ihn den Segen: „Der Herr segne dich und behüte dich!“ singen zu hören.
Auch im altlutherischen Lager fühlte sich Philipp nicht wohl, und so kam er zu der Überzeugung, er sei für den Beruf eines Geistlichen überhaupt nicht geeignet. Im schwarzen Rock aber etwa nur Unterkunft und Versorgung zu suchen, dazu war er zu stolz. So gab er das Studium der Theologie auf. Er besass damals ein ererbtes Vermögen von etwa 20 000 Mark. Von den Zinsen dieses Kapitals, meinte er, würde er bei seinen geringen Ansprüchen ganz gut leben können. Aber er war jung; er wollte arbeiten. Was? Was sollte er arbeiten? Entgleiste Theologen finden sich in der Welt schwer zurecht, denn die Welt sagt: „Fortgelaufene Pfaffen taugen nichts!“, und die Ausbildung ist zu einseitig. Für die realen Bedürfnisse des Tages nicht brauchbar. Philipp Deutschmann war einige Zeit seines Lebens ganz ratlos. Was sollte er nur tun? Arzt hätte er wohl werden mögen, wie sein Vater war, aber wenn er an die stinkende Anatomie und die Schlachtbänke der Operationssäle dachte, die er doch hätte passieren müssen, wurde ihm physisch übel; Jurist wollte er auch nicht werden, die Händeleien vor dem Zivilrichter wollte er nicht übernehmen, noch viel weniger über Leben und Freiheit der Menschen verfügen. Auch zum Lehramt fühlte er sich nicht berufen, obwohl ihm das am meisten gelegen und er diesen schönen Beruf herzlich gern ausgeübt hätte. Aber er hatte in seiner Schule erlebt, dass gutmütige Lehrer meist von den Schülern misshandelt wurden und vor allen Dingen, dass sie nicht die gewünschten Erfolge erzielten. Die richtige Lehrerhand muss weich und warm sein, im Innern aber doch ein unzerbrechliches Stahlwerk haben. Diese Lehrerhand hatte er nicht; der Stahl fehlte, der zupackt, wenn es sein muss. Vielleicht war seine Jugend schuld, dieses immerwährende Alleinsein mit der trauernden Mutter. So war Philipp ratlos. Einem praktischen Berufe getraute er sich erst recht nicht zuzuwenden; er war völlig unpraktisch, es fehlte ihm aller Sinn für reale Erfordernisse und Hilfsmittel zu deren Erfüllung. Für handliche Betätigung war er nun schon gar nicht geschickt. Was sollte er nur tun? War er denn zu gar nichts nutze, war er nur ein lebensuntüchtiger Träumer? Da erinnerte er sich, dass er noch einen lebenden Verwandten habe, der in einer süddeutschen Stadt Goldschmied und Uhrmacher war. Der Verwandte war ein Neffe seines Vaters, also mit ihm Geschwisterkind.
Titus zog aus und fand seinen Bruder Timotheus. Er fand ihn in Verzweiflung. Der Mann, der wohl an die zwanzig Jahre älter war als Titus, aber die Fünfzig noch nicht erreicht hatte, war völlig ergraut. Er erzählte die Tragödie seines Lebens ganz kurz: Ein Weib hatte er genommen, obwohl er sich immer vor der Ehe gefürchtet hatte. Sie war fünfzehn Jahre jünger als er. Und sie war so ganz anders als er. Strebte er zu religiösen oder wissenschaftlichen oder künstlerischen Versammlungen, so ging ihr Sinn lediglich nach Tand, Spiel, Tanz, Kino, Reisen, Theater. Sie hat ihm zwei Kinder geboren; sie starben, kaum drei Jahre alt, an einem Tage. Damals, so bekannte Timotheus, sei er von seinem Gott abgefallen, hätte nicht mehr glauben mögen, dass die Welt von einem liebevollen Vater regiert werde, dass Weisheit und Gerechtigkeit die Menschheit beherrschen. Er habe nie wieder gebetet, kein frommes Lied mehr gesungen, sei nie wieder zu einem Gottesdienst gegangen; dagegen habe er mit Eifer alles gelesen, was die Weltordnung verachtete als böse, verpfuscht und grausam, viel mehr als die Schöpfung eines Dämonen denn als die eines Lichtgottes betrachtete. Da sei sein Damaskus gekommen. Eines Tages habe er an den beiden Kindergräbern gestanden und gesagt: „Nun weiss ich, warum ihr so früh sterben musstet; ihr solltet nicht erfahren, dass eure Mutter eine Dirne war!“
Als Titus bei Timotheus anlangte, war dieser gerade vor einer Woche von seiner Frau geschieden worden. — Und nun wusste auch Timotheus nicht, was er im Leben noch beginnen sollte. Zur Arbeit hatte er jede Lust verloren. Timotheus war Goldschmied und Uhrmacher gewesen. Er galt als berühmter Meister weit und breit und war ein wohlhabender Mann. Nun liess er die geschickten Hände müssig im Schosse ruhen.
Timotheus weinte vor Freude, als Titus in sein Zimmer trat. „Dich sendet Gott, du kommst als mein Erretter, bleibe bei mir immer, lasse mich nicht untergehen!“ Titus blieb dem Unglücklichen mit wortreichen Tröstungsversuchen fern. Er tröstete durch Stille, durch leises, vorsichtiges Ablenken von dem Schmerzhaften. Und dann kam er auf das beste Trost- und Ablenkungsmittel — auf den Kampf! Ein ganzes Jahr haben sie — Lutheraner und Calvinianer — einen Religionskampf geführt, hauptsächlich über die Prädestinationstheorie und über die Abendmahlslehre. Wenn Timotheus mit seinem heiligen Augustinus angerückt kam und anderem ganz schwerem Geschütz, dann geriet Titus in Lutherzorn, und der Kampf wurde zwar nicht so heftig, wie es in den Tagen des Mittelalters war, da die Menschen um nichts anderes rangen als um religiöse Überzeugungen, um die sie entsetzliche Kriege führten, sich im Namen des liebreichen Erlösers gegenseitig verfluchten und verbrannten, aber der Streit nahm doch manchmal auch Formen an, welche die sanfte Flamme der Zuneigung, die ihr einsames Leben erhellte, zu verlöschen drohten. Etwas Gutes hatten diese oft leidenschaftlichen Erörterungen: das Bild der ungetreuen Frau verblasste in der Seele des Timotheus als etwas Kleines und Verächtliches, für das Herz und Hirn anzustrengen, töricht war. Die Strassenecke, an der Timotheus die Frau zuletzt mit dem andern gesehen hatte, war für den Religionsstreiter nur noch ein ganz gleichgültiger, fast unwirklicher Ort, der in seinem Leben keine Rolle mehr spielte. Was aus ihr geworden war, würde er nie wissen, denn er würde nie danach fragen.
So blieben die beiden ein ganzes Jahr zusammen, mit nichts anderem beschäftigt, als mit dem Studium der verschiedensten Werke, die sie sich käuflich erwarben oder aus grossen Büchereien leihweise verschafften. Das Goldschmiedsgeschäft ging derweil zurück, denn der Meister liess sich in Werkstatt oder Laden kaum noch sehen.
Sie verlebten das Jahr in Weltabgeschiedenheit, und da sie kaum mit einem anderen Menschen sprachen, so verkapselten sich ihre Gedanken und Gefühle, und sie standen schon, als sie noch in der Stadt lebten, abseits ihrer Zeitgenossen. Mehr und mehr erfüllte sie Bewunderung für den Apostel Paulus. Timotheus sagte: „Christus war der Gründer der Kirche, Paulus der Organisator; Christus brachte das Gold des Glaubens aus der Schatzkammer seines himmlischen Vaters auf die Erde, Paulus schmiedete es zu königlichem Diadem und zu kostbaren Münzen.“ Anfangs, erst mehr als liebevolle Neckerei, nannten sie sich Titus und Timotheus, mehr und mehr aber wurde es ernst mit diesen Namen, die ihnen ehrwürdig und vorbildlich waren. Sie betrachteten mit Bewunderung die Lebensgeschichte dieser beiden, die aus Heidenland in den Sonnenbezirk des christlichen Heros kamen, ihn begleiten durften und in Heiligkeit starben, der eine auf Kreta, der andere in Ephesus.
Auch mit einigen profanen Büchern beschäftigten sich die Jünger. Eines Tages hatten sie die Lektüre des „Faust“ beendet. Sie hatten während der Lesung über dies und das aus dem Werke gesprochen, viel darüber nachgedacht. Nun fragte Timotheus: „Ist dieses Buch wert, dass man es liest?“ — „Nein,“ sagte Titus, „es fehlt ihm das ‚Unum necessarium‘, und damit fehlt ihm alles.“
Timotheus, der ohne sprachliche Bildung war, erkundigte sich, ob dieses Wort griechisch, hebräisch, arabisch oder aramäisch sei; das waren die Sprachen, die, hauptsächlich der Schrift wegen, Titus auch heute noch eifrig betrieb. „Es ist Latein,“ sagte Titus, „es stammt von dem grossen mährischen Pädagogen Commenius und heisst auf deutsch: ‚Das eine, was not tut‘.“ Und Titus sagte damals: „‚Das eine, was not tut,‘ ist, den Weg in den Himmel zu finden. Alles andere, was von diesem Wege ablenkt, ist unselig. Auch im ‚Faust‘ fehlt das ‚Unum necessarium‘. Die Heimat, die ewige, ist alles, die Erde ist nichts als auf öder Wüstenwanderung eine schmutzige Karawanserei. In dürrer Wüste der Gedanken und Gefühle, mit verlogenen Fata Morganen, mit brutschwülen Tagen und frostschauernden Nächten, mit ungeheuer viel Kamelgeschrei und elendem Fusel. Das blühende Eiland, dahin die Wanderung gehen soll, ist unermesslich weit. Wer nicht ganz stark bleibt, der erliegt; seine Gebeine bleichen in der Wüste, und die meisten der liegenbleibenden Knochen stammen von Menschen, die, vom Sonnenstich des eigenen Hochmuts betroffen, von dem zweihöckerigen Kamel ihres Weisheits- und Kunstdünkels in den Sand fielen.“
Damals hatte Timotheus die Hände aufgehoben und seinen Bruder beschworen, beim Predigerberuf zu bleiben. „Wer sollte predigen, wenn nicht du? Der Geist ist über dir, überhöre seine Stimme nicht! Du bist rein; du hast im Leben nie ein Weib berührt. Du hast dich, wie Johannes Baptist, enthalten aller berauschenden Getränke, du verschmähst sogar den Tabak, ohne den ich Schwacher nicht sein kann. Du hast mich seit einem Jahre lehren wollen, nicht das Fleisch ermordeter Tiere zu verzehren, sondern zu leben von den unschuldigen Produkten der Natur, die Gott uns schenkt und zur Speise bietet. Ich bin meinen angewohnten Schwachheiten bis jetzt unterlegen. Wer sollte Prediger und Führer einer Gemeinde sein, wenn nicht du?“
„Ich fühle mich zum Führer nicht berufen; ich bin nicht stark und still genug in mir selbst.“
Dabei blieb es, und dann kam der Plan, auszuwandern und abseits der Welt in Frieden die kurze Spanne Zeit zu verbringen, welche die Menschen so hochtönend und falsch „Leben“ nennen. So sagte Titus: „Lebt denn einer, der von Geburt an zum Tode verurteilt ist? Das Leben muss ewig sein, oder es ist kein Leben, sondern nur ein Scheindasein. Darin täusche sich niemand, glaube vor allen Dingen nicht an den Unsinn irgendwelcher ‚Unsterblichkeit‘ hier auf Erden, seien es Personen, Werke oder Ideen.“ —
Der Agent wurde gefunden, das alte Patrizierhaus des Timotheus durch einen Anwalt für gutes Geld verkauft und das Geld klug und vorsichtig angelegt. Timotheus war ein recht wohlhabender Mann.
Ehe sie auszogen, sagte Titus: „Nimm dein Handwerkzeug mit!“ — „Warum?“ — „Es könnte dir die Sehnsucht kommen nach deinem alten Berufe.“ Das bestritt Timotheus. Da sagte Titus: „Immer studieren kann man nicht; eine manuelle Tätigkeit ist für alle Geistesarbeiter gut. Der Garten wird uns nicht genug Beschäftigung geben, im Winter gar keine. Ich habe mich für deine Kunst immer interessiert, überhaupt für Kunstgewerbe; ich kann auch zeichnen und mancherlei entwerfen; möchtest du mich nicht als Lehrling annehmen, Timotheus?“ Auf diesen Plan ging der Meister mit Freuden ein. „Ich will dein Lehrmeister sein in der Goldschmiede- und Uhrmacherkunst, und du sollst mein Lehrer und Führer sein in allen geistigen Dingen, ausgenommen religiöse Unterweisung, die ich von einem Lutheraner nicht annehmen kann.“
So packten sie zu den wenigen Habseligkeiten, die sie mitzunehmen beschlossen hatten, die feinsten Handwerkszeuge des Meisters; alles andere, was zur Ausstattung einer vollständigen Werkstatt gehörte, wollte Timotheus aus der Hauptstadt kommen lassen, wenn er in Altenroda erst einen geeigneten Raum entdeckt hatte.
So wanderten sie fort. Sie hatten sich ihre Pilgerkleider nach eigenen Entwürfen nähen lassen und kümmerten sich nicht um die offenen Mäuler der Gaffer. Die Welt ging sie nichts mehr an. Als sie auf den Hügel kamen, über den die Landstrasse nach der Ferne führt, blieb Timotheus mit einem Ruck stehen. Titus betrachtete ihn stumm. Hinter ihnen lag die Stadt, in der Timotheus geboren war, in der er dreissig Jahre als Goldschmied und Uhrmacher gelebt hatte und ein hochgeachteter Bürger gewesen war. Nun lag diese Stadt hinter ihm für immer. Ein Gedanke flog zurück zu den Gräbern der Eltern, zu den kleinen Gräbern der Kinder; einem Gedanken an das böse Weib, das er geliebt und das ihn verraten hatte, wich Timotheus aus. Einige Sekunden stand er, an seinen Pilgerstock gelehnt, nach vorn geneigt da; zwei Tränen tropften in den Sand, es waren die einzigen, die Timotheus seiner Vergangenheit je nachgeweint hat. Dann sagte er: „Komm!“, und ohne sich umzuwenden, ging er den Berg hinab.
Nun waren sie in Altenroda, wo sie keine wahre Heimat, aber doch eine friedliche Behausung suchten. Titus auf seinem harten Lager konnte nicht schlafen. So armselig hatte er nie geruht; hatte er auch nie üppig gelebt, ein ordentliches Bett hatte er immer besessen, auch noch im Goldschmiedehause in der Stadt. Aber diese Armut war freiwillig. „Die Vögel haben ihre Nester, die Füchse haben ihre Gruben, der Menschensohn weiss nicht, wohin er sein Haupt legen soll.“ Es gab keinen anderen Weg der Nachfolge Christi als den der Armut und Demut. —
Drunten in der Stadt schlug eine Uhr zweimal. Schwarz war die Sommernacht, kein Ast am Baume rührte sich, manchmal nur flatterte ein Nachtschmetterling ans Fenster. Da hörte Titus seinen Bruder Timotheus leise singen. Also auch er schlief nicht; auch ihm war das harte Lager fremd, auch ihm scheuchte wohl die Vergangenheit den Schlummer. —
Da tönte ein Klagelaut schauerlich durch die Stille der Nacht. Kam er von einem Menschen oder von einem Tiere? Es war stöhnender Schmerz und flehende Bitte um Hilfe in diesem Rufe.
Titus erhob sich und kleidete sich notdürftig an. An der Haustüre traf er seinen Bruder Timotheus.
„Wer ruft da um Hilfe in der Nacht? Ich denke, es wird ein Hund sein!“
Ja, es war ein Hund. Vor der Gartenpforte lag ein brauner Jagdhund. Er winselte und stiess mit der Vorderpfote nach der Tür.
„Er will zu uns herein,“ sagte Timotheus, „ob er wohl toll ist?“
Statt aller Antwort öffnete Titus die Tür. Der Hund kroch auf dem Bauche in den Garten, immer mit dem Kopfe nach dem Erdboden zuckend, als ob er fürchtete, geschlagen zu werden.
„Er ist sehr verängstigt,“ sagte Timotheus, „sieh, wie er sich fürchtet!“
„An seinem Halsbande hängt der Teil eines zerrissenen Strickes. Und sieh, wie elend er aussieht und wie furchtsam er sich gebärdet.“
Timotheus leuchtete mit seiner Laterne den Rücken des Tieres ab, das leise winselnd vor ihm kauerte. Der Mond schien jetzt ein wenig, und so konnte Timotheus feststellen: „Er sieht ganz heruntergekommen aus und hat wohl vier oder fünf Wunden.“
Titus sagte erbittert: „Wahrscheinlich hat ihn sein roher Herr, der ihn anband, so furchtbar zugerichtet. Da hat der gemarterte Hund den Strick zerrissen und ist geflüchtet. Und nun ist er bei uns. Er scheint ganz verschmachtet zu sein.“
Titus beugte sich nieder und streichelte dem Tiere den Kopf. Da knurrte der Hund und schnappte nach oben.
„Er fürchtet sich, er glaubt, man könne sich ihm nur nähern, um ihn zu quälen. Es hat ihn wohl noch niemals jemand gestreichelt. Komm, armer Freund, wir werden dich füttern! Wir haben doch noch etwas, Timotheus?“
„Ja, es ist noch ein grosses Stück Wurst da und noch ziemlich viel Brot. Milch wäre am besten, aber wir haben keine. Nun, morgen gehen wir nach der Stadt, um einzukaufen. Ich werde unserem Nachtgaste zunächst eine kräftige Suppe bereiten.“
Sie standen in der Küche beim schwachen Schein der Laterne. Über einem Spirituskocher wurde Wasser erwärmt. Aus der Handreisetasche, die sie auf der Wanderung abwechselnd getragen hatten, nahm Timotheus von dem letzten Provianteinkauf ein Stück Brot, schnitt in eine grosse Schüssel viele Brocken, entnahm einem Töpfchen einen reichlichen Esslöffel Schmalz, fügte Salz bei und schnitt dann sieben Scheiben Zervelatwurst in die Suppe.
„So,“ sagte Timotheus befriedigt, „diese Suppe ist nicht schlecht, sie wird ihn aufrichten.“
Der Hund sah derweil all diesen Verrichtungen gierig zu, setzte sich auf die Hinterbeine und bettelte jaulend mit den Vorderpfoten. Timotheus ermahnte ihn zu standhafter Geduld, goss heisses Wasser in die Schüssel und reichte dem Hunde nicht eher das Mahl, bis er sich durch Eintauchen des Zeigefingers und Umrühren mittels dieses beliebten Küchenutensils überzeugt hatte, dass sich nun der Hund mit der Suppe nicht den Schlund verbrennen könne. Selten hat man einen Gast sein Nachtmahl mit so gediegenem Appetit verzehren sehen wie diesen Hund. Der Inhalt der grossen Schüssel war verschwunden, ehe man es für möglich gehalten hätte. Der Hund beleckte sich das Maul und sah fragend zu Timotheus auf.
„Noch mehr? Nein, mein Freund, für den Anfang genügt das! Du hast jetzt einen schwachen Magen und musst dich an kräftigere Kost erst gewöhnen. Auch könntest du leicht Alpdrücken und schlimme Träume bekommen. Komm, du gehst mit mir schlafen!“
Er löschte die Laterne aus, sagte: „Gute Nacht, Titus!“ und verschwand mit dem Hunde nach seiner Stube. Titus dachte: „Jetzt wird er eine der beiden Wolldecken, die er hat, dem Hunde opfern!“