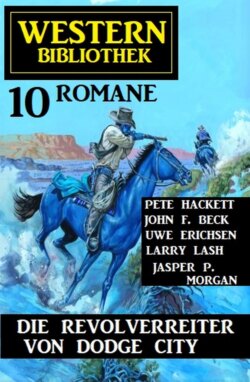Читать книгу Die Revolverreiter von Dodge City: Western Bibliothek 10 Romane - Pete Hackett - Страница 6
Letzte Abrechnung in Silverrock John F. Beck
ОглавлениеIMPRESSUM
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author/Cover: W. Öckl, 2019
Korrektorat: Dr. Frank Roßnagel
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
postmaster@alfredbekker.de
Als der Mann ermordet wird, den Tonto als „Onkel“ Ben Smolett kennt, und dieser ihm enthüllt, dass er nicht mit ihm verwandt ist, bricht Tontos Weltbild zusammen. Er schwört, einen Mörder zu stellen, einen mächtigen Mann als Verbrecher zu entlarven und das Schicksal seines Vaters zu klären, den er nicht kennt. Tonto reitet fünfhundert Meilen nach Colorado und stellt sich einer gewaltigen Übermacht zweier ebenso skrupelloser wie brutaler Banden und deren Anführer. Als Tonto sich in die Saloon-Tänzerin Sally verliebt, sitzt er zwischen allen Stühlen, denn auch ihr Bruder hat eine Rechnung zu begleichen in dem Spiel um Rache, Macht und Loyalität. Erlösung und Erkenntnis gibt es nur in der letzten Abrechnung in Silverrock …
Der Wind strich sachte durch die halbverdorrten Salbeistauden und führte das monotone Hämmern von Pferdehufen mit sich. Die Haltung des sehnigen Mannes an der engen Fensterluke spannte sich. Etliche Sekunden spähte er reglos zum Rand der weiten Senke hinauf, dann wandte er sich ruckartig um.
„Er kommt!“, meldete er heiser.
Nat Henshaws ledern wirkendes Gesicht wurde noch verkniffener, als es ohnehin schon war. Er setzte dem dritten Mann im Blockhaus die Coltmündung auf die Brust und sagte gepresst: „Du weißt Bescheid, Smolett! Wenn du diese Sache lebend überstehen willst, dann hältst du deine Klappe! Nur ein Laut, und ich brenne dir ein Loch in deinen Pelz!“
Ben Smolett saß verkrampft auf einem Stuhl in der Zimmermitte. Er war ein weißhaariger stämmiger Mann, dessen derbe Fäuste von Lassonarben bedeckt waren. Sein tiefbraunes faltiges Gesicht war von einem Netz glitzernder Schweißperlen überzogen. Einen Moment war sein Blick starr auf die schussbereite Waffe in Henshaws Faust gerichtet. Dann hob er den Blick zum Gesicht des Banditen empor.
„Ihr Schufte!“, flüsterte er erstickt. „Ihr elenden Lumpen! Ihr seid es nicht einmal wert, dass …“
„Behalte es für dich, Alter!“, fauchte Henshaw. Der Druck der Coltmündung verstärkte sich.
Draußen kamen die Hufschläge den salbeibestandenen Hang herab.
Henshaw wandte sich an den Mann neben dem Fenster. „Etwas von Fess und Larry zu sehen, Dick?“
„Nein, Nat! Sie sind gut im Stall versteckt! Wenn dieser Kerl wirklich vorzeitig Verdacht schöpft, schneiden sie ihm den Rückweg ab! Es bleibt ihm keine Chance!“
„Gut so!“, brummte Henshaw zufrieden.
Die Hufe trommelten jetzt über die Sohle der Senke. Gleich darauf verstummten sie.
„Was macht er jetzt?“, fragte Henshaw flüsternd.
„Er bindet seinen Gaul am Korralzaun fest! Und jetzt … jetzt kommt er zum Haus!“ Die Stimme des zweiten Banditen klang erregt.
Hastig wich er vom Fenster zurück, presste sich mit dem Rücken gegen die raue Balkenwand und zog den Revolver. Die Lippen in seinem stoppelbärtigen Gesicht waren zu einem dunklen Strich geworden.
Der Wind trieb Sandkörner gegen die Außenwand des kleinen Blockhauses.
Staub und Salbeigeruch wehten durch das offene Fenster. Vom Korral herüber kam das ständig lauter werdende Mahlen von Stiefeltritten. Sporen klirrten silbern.
In Ben Smoletts Gesicht arbeitete es. Sein Atem ging schneller.
Ächzend stieß er hervor: „Das könnt ihr doch nicht tun! Großer Himmel! Er ist allein und ihr seid zu viert! Gebt ihm wenigstens eine Chance …“
„Ruhig, verdammt noch einmal!“, zischte Henshaw. „Und wenn du ihn zu warnen versuchst, bist du als erster dran!“
Die Schritte waren dicht vor der Tür.
Smolett wand sich auf dem Stuhl. Mit flackernden Augen sah er, wie Henshaw langsam den Hammer des Colts zurückbog – so behutsam, dass dabei kein Laut entstand.
Ein Schaben an der Tür. Die Klinke bewegte sich. Smolett und die beiden Banditen hielten den Atem an.
„Hallo, Onkel Ben!“, sagte eine ruhige feste Männerstimme, während sich die Tür langsam öffnete. „Bist du schon zurück? Ich hatte Pech. Das Wildpferdrudel, hinter dem ich her war …“
Der Türspalt war jetzt weit genug, dass der Schatten des Mannes über die Schwelle ins Zimmer fiel.
Da hielt es Ben Smolett nicht mehr aus.
Verzweifelt brüllte er, die Augen weit aufgerissen: „Vorsicht, Tonto! Eine Falle! Sie wollen …“
Die Worte versanken im dröhnenden Bersten von Nat Henshaws 45er Colt.
*
Alle Lässigkeit fiel von Tonto ab. Jeder Nerv in seinem drahtigen Körper war plötzlich zum Zerreißen gespannt. Das Krachen des Coltschusses war noch nicht verklungen, da hatte er seinen Revolver bereits aus dem Holster gebracht.
„Onkel Ben!“, schrie er gellend.
Mit dem linken Fuß stieß er die Tür vollends auf. Zwei Feuerlanzen stachen ihm entgegen – zwei Kugeln pfiffen über ihn weg. Pulverqualm wolkte, und dahinter sah er zwei dunkle Gestalten sich blitzschnell bewegen.
In diesen Sekunden handelte er ganz automatisch.
Er feuerte, warf sich seitlich auf die Bodenbretter, rollte herum, während eine Kugel neben ihm ins ungehobelte Holz fuhr, und schoss abermals. Durch das trockene Peitschen der Schüsse, das ohrenbetäubend zwischen den Wänden hallte, drang der schrille Aufschrei eines zu Tode getroffenen Mannes. Ein schwerer Fall war zu hören, ein Stuhl polterte auf die Bretter.
Tonto lag neben dem Tisch und kippte ihn geistesgegenwärtig um. Eine Kugel klatschte in die dicke Eichenplatte, eine zweite prallte scheppernd gegen den gusseisernen Ofen in der Ecke und jaulte als Querschläger zur Decke hoch.
Tonto sah einen Mann auf die offene Tür zu springen und riss den Revolver herum.
Da hörte er dicht neben sich ein leises Stöhnen. Aus den Augenwinkeln sah er das graue schweißverschmierte Gesicht mit den vor Schmerz geweiteten Augen.
„Onkel Ben!“
Für einen Moment zögerte er. Und dann war der zweite Bandit schon über die Schwelle geschnellt und schlug krachend die Tür hinter sich zu.
Stimmen schwirrten draußen durcheinander, heisere aufgeregte Stimmen. Stiefel scharrten im Sand. Dann war es still.
Tonto ließ den Revolver sinken. Auf den Knien rutschte er an Smolett heran. Der weißhaarige Mustangjäger lag auf dem Rücken, beide Hände gegen die Brust gedrückt. Er atmete stoßweise. Fiebrig tasteten seine Blicke über Tontos scharfgeschnittenes Gesicht.
„Bist du … bist du unverletzt, Junge?“
„Yeah, Onkel Ben!“ Tontos Stimme war heiser. „Du hast mich rechtzeitig gewarnt!“
„Dann ist es gut!“, ächzte der Verwundete. „Ich … Tonto, sei auf der Hut. Sie sind zu viert und …“
„Nicht mehr!“, unterbrach ihn Tonto finster. „Nur noch zu dritt!“
Er warf einen grimmigen Blick zur Wand hinüber, wo eine verkrümmte Gestalt reglos, mit dem Gesicht nach unten am Boden lag.
„Kennst du diese Leute, Onkel Ben?“
„Ja, mein Junge! Sie sind gekommen, um dich zu töten!“
„Mich?“ Tonto furchte die Brauen.
„Ja!“ stöhnte Smolett. „Monroe hat sie geschickt …“
„Monroe? Ich kenne keinen Monroe! Onkel Ben, lieg jetzt ganz ruhig. Ich werde dich verbinden. Ich …“
„Nein, nein. Verliere um Himmels willen keine Zeit mit mir! Du musst …“
Von draußen kam eine scharfe hasserfüllte Stimme:
„Heh, du verfluchter Bastard! Komm heraus! Na los, komm schon! Du rechnest dir doch keine Chance aus, oder? Ich bin nicht allein, mein Junge! Ich habe zwei verdammt gute Revolverschützen bei mir! Du vergeudest nur Zeit, wenn du dich in deinem Nest verschanzen willst!“
„Das …“, brachte Smolett gepresst hervor, „das ist Nat Henshaw! Er hat mir die Kugel in die Brust gejagt!“
Tonto biss wild die Zähne zusammen.
Smolett flüsterte: „Du musst kämpfen, Tonto! Nein, keinen Verband für mich! Es lohnt sich nicht mehr!“
„Onkel Ben!“
Ben Smolett winkte kraftlos ab. „Widersprich mir nicht, Junge! Ich weiß besser als du, wie es um mich steht! Glaube mir, ich habe keine Angst vor dem Sterben! Ich … ich möchte nur …“ Seine Stimme erstarb.
„Hast du nicht gehört?“, schrie draußen Henshaw. „Wenn du nicht kommst, holen wir dich!“
Schüsse donnerten. Kugeln bohrten sich in die Außenwand.
„Kämpfe, Tonto!“, flüsterte Smolett wieder.
Der junge Mann mit dem scharfgeschnittenen Gesicht richtete sich geduckt auf. Ein kaltes Feuer erschien in seinen graugrünen Augen.
„Das Gewehr!“, ächzte der schwer verwundete Mustangjäger.
„Nimm das Gewehr, Tonto! Du warst schon immer besser mit ihm als mit dem Revolver!“
Wortlos glitt Tonto zur Wand hinüber, steckte den Revolver in das Holster und nahm das kurzläufige Henry Gewehr aus dem obersten Fach eines hohen Regals. Er überprüfte flüchtig das Magazin, riegelte die erste Kugel in den Lauf und schob sich neben die Fensterluke rechts der Tür.
Ein Kugelregen prasselte gegen die Vorderfront des Blockhauses. Schatten bewegten sich an der Stallecke und hinter dem Brennholzstapel. Tontos Gesicht wirkte plötzlich wie aus Stein gemeißelt.
Er presste den Gewehrkolben an die Schulter, der Lauf zielte ins Freie. Und dann feuerte er.
Blitzschnell repetierend, jagte er Schuss auf Schuss aus dem Rohr. Holzsplitter wirbelten von der Stallecke, Rindenstücke flogen beim Brennholzstapel auf.
Die Banditen fluchten und wichen erschrocken hinter ihre Deckung zurück. Ihre Revolver schwiegen. Tonto ließ das Henry Gewehr sinken und lud mit ruhiger Hand das Magazin, das fünfzehn Patronen fasste, nach.
Mehrere Sekunden war es totenstill. Dann ließ sich wieder Henshaw vernehmen: „Du elender Coyote! Verlass dich darauf, wir bekommen dich schon!“
„Dann kommt doch!“, rief Tonto klirrend zurück. „Los, macht doch weiter, ihr Mördergesindel!“
„Hältst du uns für Idioten?“ Jetzt mischte sich Hohn in Henshaws Stimme. „Mein Junge, wir haben Zeit genug! Hier gibt es weit und breit keine Menschen außer dir und uns! Wozu sollten wir uns also beeilen, heh? Hast du dir schon überlegt, Freundchen, dass in einer Stunde die Sonne sinkt? Dann wird es prächtig dunkel sein, mein Junge! Dann erst kommen wir, verstehst du?“ Henshaw lachte hässlich.
„Es liegt bei dir, wie du es haben willst! Du kannst jetzt gleich herauskommen oder warten! Entwischen wirst du uns so oder so nicht!“
Tonto antwortete nicht. Draußen blieb es still. Nur die Mustangs drüben im Korral, die er und Ben Smolett in den letzten Tagen oben auf der Tonto Mesa gefangen hatten, schnaubten unruhig und stampften mit den Hufen. Das Flüstern des Windes war erstorben. Die Sonne stand nur noch wenige Handbreit über dem westlichen Horizont.
„Tonto!“, flüsterte Smolett mühsam. Eilig drehte sich Tonto um.
„Ich komme sofort, Onkel..
„Nein! Bleib, wo du bist, Tonto! Lass diese Halunken da draußen nicht aus den Augen! Jeder noch so geringe Fehler kann das Leben kosten, Tonto! Und das darf nicht sein! Hörst du, Tonto, du musst überleben! Du musst …“
Tonto spähte wachsam über den sandigen Hof. Die Abdrücke von hochhackigen Reitstiefeln zeichneten sich deutlich ab. Die Schatten wurden immer länger.
„Onkel Ben“, fragte Tonto leise, „warum sind diese Männer meine Feinde? Seit ich mich erinnern kann, lebe ich mit dir hier in den Bergen von Arizona. Wir haben Wildpferde gefangen und unten in Tucson verkauft. Die meiste Zeit des Jahres haben wir keine Menschenseele zu Gesicht bekommen. Ich frage dich, warum sind diese Banditen darauf aus, mich umzubringen, Onkel Ben?“
Smolett lag reglos auf dem Boden und starrte erschöpft zur Decke hoch. Tonto blickte zu ihm hin. Er biss sich auf die Unterlippe, als er sah, wie blutverschmiert Smoletts Hemd war. Schatten lagen unter den Augen des alten Mustangjägers.
„Ich muss dich verbinden!“, sagte Tonto rau. „Ich kann das nicht mit ansehen, wie du …“
„Nein, Tonto! Sinnlos, glaube mir doch! Du musst jetzt hart sein, hart wie nie zuvor!“
Tonto schluckte. „Und meine Frage, Onkel Ben?“
„Nenne mich nicht mehr so, mein Junge!“, raunte Smolett matt. „Ich bin nicht dein Onkel!“
*
Tonto stand sekundenlang wie versteinert. Dann wollte er den Platz neben der Fensterluke verlassen und auf Smolett zueilen.
„Bleib, wo du bist!“, krächzte Smolett. „Ich werde dir alles erzählen!“
Tonto atmete tief ein und lehnte sich an die Balken zurück. Seine Hände umkrampften den Schaft des Henry Gewehrs. Langsam verdämmerte das Licht im Blockhaus. Die Sonne stand als glutroter Ball über der dunklen Kante der Tonto Mesa, dieses gewaltigen Tafelberges, auf dessen von Schluchten und Tälern zerfurchtem Plateau Hunderte von Wildpferden lebten.
„Du hast schon richtig gehört, mein Junge“, sagte Ben Smolett mit einem Unterton von Bitterkeit. „Ich bin keine Spur mit dir verwandt. Zwanzig Jahre lang habe ich es dir verheimlicht. Jetzt bleibt mir wohl keine andere Wahl, als die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Ich hoffe, Tonto, du wirst mich verstehen!“
„Ich höre!“, murmelte Tonto heiser. Sein Herz klopfte in harten Stößen. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Die Ahnung beschlich ihn, dass etwas Großes, Überwältigendes auf ihn zukam. Von dieser Stunde an würde sein Leben in völlig anderen Bahnen verlaufen – wenn er überhaupt mit dem Leben davonkam.
Jahre hindurch hatte er an der Seite von Ben Smolett in tiefstem Frieden gelebt, abgeschieden von allem rauen Geschehen in den Städten und auf dem Weideland jenseits der Berge. Und nun lauerten da draußen drei gefährliche Mordbanditen, und hier drinnen lag ein Sterbender einige Schritte von einem toten Banditen entfernt und schickte sich an, Tontos bisherige Überzeugungen mit einem Schlag wegzufegen.
„Ich werde es kurz machen, Junge“, sagte Smolett mühsam. „Ich fürchte, mir bleibt nicht mehr viel Zeit!“ Er holte tief Atem und fuhr fort: „Dein wirklicher Name ist Jim Trafford. Ich habe dich Tonto genannt, weil deine Heimat hier am Fuß der Tonto Mesa lag. Es liegt alles zwanzig Jahre zurück, zwanzig lange Jahre! Damals warst du vier …“ Smolett seufzte. „Und ich war noch kein Wildpferdjäger – ich war Revolvermann!“
Er drehte mühsam den Kopf, um Tontos Reaktion zu erkennen. Der junge Mann schwieg. Die Schatten, die sich im Blockhaus breitmachten, verdunkelten sein Gesicht.
„Ja“, flüsterte Smolett, und in der bleiernen Stille war jedes Wort deutlich zu verstehen.
„Ich war ein rauer Bursche damals, ziemlich schnell mit dem Eisen zur Hand und für klingende Dollars jederzeit zum Kämpfen entschlossen. Es war in Colorado, da wurde ich von einem Mann namens Elmer Monroe angeheuert. Elmer Monroe! Merk dir den Namen, Tonto. Es ist der Mann, der auch Henshaw und seine Kumpane losschickte, um dich zu töten. Irgendwie muss er herausgefunden haben, dass du noch am Leben bist …“
„Wieso? Warum sollte ich nicht …“
„Tonto, weißt du, warum ich damals vor zwanzig Jahren meinen Job aufgab und Mustangjäger wurde? Nein, du kannst es ja nicht wissen! Ich erhielt einen Auftrag, den ich nicht ausführen konnte – den schmutzigsten Auftrag, den ein Mann nur bekommen konnte! Ich sollte ein Kind ermorden, ein unschuldiges, kleines, vierjähriges Kind …“
„Du … du meinst …“
„Dich, Tonto!“, sagte Smolett dumpf. Eine Weile war es so still im Blockhaus, dass man eine Nadel hätte zu Boden fallen hören.
„Ich weiß nicht, was du am Schluss dieser Geschichte von mir denken wirst, Junge“, murmelte Smolett, „aber du sollst die Wahrheit hören, die reine Wahrheit!“
Seine Hände fielen kraftlos auf die Bodenbretter. Smolett sprach jetzt schneller, wie um jede Sekunde, die ihm noch blieb, auszunutzen.
„Elmer Monroe gab mir diesen Auftrag. Und das Kind, der kleine Jim Trafford, war der einzige Sohn von Monroes Partner. Dein Vater, Tonto, hieß Allan Trafford. Zusammen mit Monroe entdeckte er droben in Colorado, in den Elk Mountains, ein reiches Silbervorkommen. Sie gründeten eine Minengesellschaft, um das Silber abzubauen. Eine Stadt wuchs empor, Silverrock. Monroe und dein Vater hatten vollen Erfolg. Und da kam der Teufel über Elmer Monroe!“
Wieder seufzte der Sterbende.
„Dein Vater hatte das meiste Geld ins Unternehmen gesteckt und besaß deshalb die größten Anteile. Und Monroe fasste den Plan, alles für sich allein zu bekommen. Die Aussicht auf Reichtum nahm ihm alle Skrupel. Monroe warb Banditen an, die Allan Trafford, deinen Vater, durch einen angeblichen Unfall aus dem Weg räumen sollten. Du lebtest damals noch bei deiner Mutter. Sie starb, und dein Vater wollte dich zu sich nach Silverrock kommen lassen. Monroe schickte mich aus, dich abzufangen und ebenfalls durch einen vorgetäuschten Unfall …“
Smolett schluckte schwer. Er schüttelte den Kopf. Die Erinnerung an jene fernen Tage wühlte seine Miene auf.
„Monroe war damals schon ziemlich mächtig. Wenn ich einfach abgelehnt hätte, wäre das mein sicherer Tod gewesen. Also ritt ich los. Aber ich war von Anfang an entschlossen, diesen Auftrag nicht auszuführen. Ich überfiel die Kutsche, in der dich eine Bekannte deiner verstorbenen Mutter nach Silverrock bringen sollte, entführte dich – und floh! Ich floh nicht nur vor den Sheriffs und Marshals – am meisten fürchtete ich Elmer Monroe! Ich schrieb ihm, der Auftrag sei erledigt, und ließ mich nicht mehr bei ihm blicken. Ich zog mit dir hierher nach Arizona, hängte den Colt an den Nagel und fing die Arbeit als Wildpferdjäger an. Von Monroe hörte ich nichts mehr – bis heute!“
Er starrte Tonto aus brennenden Augen an.
„Er hat die Wahrheit herausgefunden, dieser Schuft. Und dass er Henshaw und seine Komplizen geschickt hat, beweist, dass er noch immer das Ruder in der Hand hält – droben in Silverrock in Colorado. Du bist Allan Traffords rechtmäßiger Erbe, dir gehört über die Hälfte von Monroes Besitz. Deshalb will er dich tot wissen. Ich wollte, du hättest nie davon erfahren. Aber jetzt …“
„Mein Vater ist also tot!“, murmelte Tonto erstickt. „Ermordet von den Banditen, die dieser Elmer Monroe gedungen hat.“
„Du musst es annehmen, mein Junge!“, bestätigte Smolett schwach.
In Tontos graugrünen Augen blitzte es.
„Aber wenn er ähnliches Glück hatte wie ich? Wenn er …“
„Die Leute, die ihn ermorden sollten, kannten keine Skrupel wie ich, das ist alles, was ich dir dazu sagen kann, mein Junge! Und bedenke, es ist zwanzig Jahre her! Wenn er noch lebte, hätte er sicher etwas gegen seinen früheren Partner unternommen!“
Das Feuer in Tontos Augen erlosch. Er ließ den Kopf sinken.
„Ich weiß, was du denkst!“, flüsterte Smolett.
„Du denkst daran, nach Colorado zu reiten, nach Silverrock.“
„Yeah!“
„Das ist es, was ich befürchtete. Deshalb habe ich zwanzig Jahre lang geschwiegen. Aber ich begreife, dass du es tun musst. Es ist nur … du musst auf die Hölle gefasst sein, Tonto! Monroe ist mächtig und schreckt vor nichts zurück!“
„Du hast mir das Reiten und Schießen beigebracht! Ich kann es besser als mancher andere Mann!“
„Yeah!“, murmelte Smolett. „Aber vergiss Henshaw da draußen nicht! Ich wollte, ich könnte dir helfen …“
Sein Kopf rollte plötzlich zur Seite.
„Ben!“, keuchte Tonto. „Onkel Ben!“
Er dachte nicht mehr daran, dass dieser Mann in Wirklichkeit nicht mit ihm verwandt war.
„Onkel Ben!“, wiederholte er lauter und rannte auf den weißhaarigen Mustangjäger zu.
Keuchend kniete er neben Smolett nieder.
Das Leben in den Augen des ehemaligen Revolvermannes war erloschen.
Etwas in Jim Trafford, den man seit seiner Kindheit Tonto nannte, zerbrach in diesem Augenblick. Heiß strömte es in seiner Kehle, und das Atmen fiel ihm plötzlich schwer.
Alles, was Ben Smolett ihm gesagt hatte, hallte in seinen Ohren nach. Was dieser Mann auch früher gewesen sein mochte, in Tontos Erinnerung würde er immer der gute, grundehrliche Mustangjäger bleiben, der stets wie ein Vater zu ihm gewesen war.
Behutsam drückte ihm Tonto die Augen zu. Als Tonto sich langsam erhob, war eine seltsame Kälte in ihm. Seine Ahnung hatte ihn nicht getrogen: Von jetzt an verlief sein Leben in neuen Bahnen! Sein Weg war ihm vorgezeichnet – er würde ihn hinauf nach Colorado führen, nach Silverrock, wo ein Mann namens Elmer Monroe lebte!
Dann wurde ihm bewusst, dass mittlerweile die Sonne hinter der Tonto Mesa verschwunden war. Die Nacht kam mit der Schnelligkeit, die hier im Süden üblich war.
Matt funkelten die Sterne am samtschwarzen Firmament. Irgendwo in der Ferne bellte ein Wüstenfuchs.
Draußen auf dem Hof zwischen Wohnblockhaus, Stall und Korral war es stockfinster.
Nat Henshaws siegesgewisse Stimme verjagte den letzten Rest von Nachdenklichkeit aus Tontos Gehirn.
„Wirst du schon ungeduldig, Trafford Junge? Nur noch ein paar Sekunden, mein Lieber, dann sind wir bei dir!“ Die Worte gingen in raues Hohngelächter über.
Dann war es wieder still – stiller scheinbar als vorher.
Tonto dachte an jene ferne Stadt Silverrock, in der sein Vater versucht hatte, sich eine glückliche Zukunft aufzubauen. Und die Entschlossenheit, lebend aus dieser Todesfälle zu kommen, ließ das alte, kalte Leuchten wieder in seinen Augen aufsprühen …
*
Vor Sonnenaufgang desselben Tages rollte fünfhundert Meilen von der Tonto Mesa entfernt eine rotlackierte Concord Kutsche durch ein von bewaldeten Hängen gesäumtes Tal in den Elk Mountains von Colorado.
Neben dem schnurrbärtigen Kutscher, der die Peitsche schwang, saß ein junger schwarzhaariger Mann auf dem Bock, ein Winchester Gewehr über die Knie gelegt. Links und rechts vom Fahrzeug ritten je zwei Männer auf hochbeinigen Pferden, hartgesichtige, kaltäugige Gestalten in staubbedeckter Reiterkleidung.
Die Ladung der Kutsche bestand aus Silberbarren im Werte von zehntausend Dollar!
Und dieses Silber stammte aus den Monroe Minen von Silverrock.
Die sinkende Sonne zauberte einen purpurnen Lichtschimmer über die stillen Wälder. Im Westen hatte sich das Firmament in flammendes Orange gefärbt. Ein Geier zog davor seine lautlosen weiten Kreise – ein einsamer pechschwarzer Fleck.
Außer dem Knarren der Räder und dem Hufgetrappel war kein Laut zu hören. Eine düstere Staubfahne zerflatterte über der schmalen Straße, die sich kreuz und quer durch die Elk Mountains von Silverrock nach Gunnison wand.
Die Kutsche war bis auf ein Dutzend Yard an den engen Talausgang herangekommen, da begann auf einmal eine hohe Douglasfichte, die auf einem moosüberwucherten Felsvorsprung kümmerte, ästerauschend zu wanken.
Quer über der Poststraße hing plötzlich ein schwarzer schräger Strich, der im dichten Unterholz verschwand, ein gestrafftes Lasso, das um den Stamm der Douglasfichte geschlungen war. Im Unterholz raschelte und knackte es, Zweige schnellten hoch, das Lasso straffte sich bis zum Zerreißen.
Die hohe Fichte neigte sich mehr und mehr.
Der junge schwarzhaarige Mann auf dem Kutschbock sprang auf die Füße. Mit einer Hand hielt er sich an der Seitenlehne fest. Seine Stimme überschlug sich.
„Eine Falle! Die Baxter Bande ist da! Die Baxter Bande!“
Der schnurrbärtige Kutscher fluchte und riss an den Zügeln. Schnaubend drosselten die Gespannpferde das Tempo. Die vier hartgesichtigen Transportbegleiter rissen ihre Revolver heraus.
Vorne, in der Enge des Talausgangs, knirschte und splitterte der angesägte Fichtenstamm. Das Lasso erschlaffte jäh, und mit donnerndem Getöse stürzte der Baum vom Felsvorsprung herab und legte sich mit rauschenden Ästen quer über die Straße. Eine Wolke aus gelbem Staub schlug dem Fahrzeug entgegen.
Der vorderste Begleiter wendete sein Pferd.
„Umkehren, Tom!“, brüllte er dem Kutscher zu. „Verdammt noch einmal, kehr um, Mann, sonst erwischen sie uns!“
Der Fahrer fluchte noch lauter, stemmte sich mit beiden Füßen gegen das Trittbrett und zerrte wie verrückt an den Zügeln. Die Pferde wieherten, schlugen mit den Hufen, verstrickten sich im Geschirr.
Aus dem Unterholz links und rechts des Talausgangs stachen die ersten Mündungsflammen.
Ein Kutschenbegleiter warf aufschreiend beide Arme hoch und stürzte vom Pferd. Sporen und Stiefel seines linken Fußes verfingen sich am Steigbügel, er wurde vom davonstiebenden Pferd mitgeschleift.
Die anderen feuerten blind vor Wut ins Dickicht hinein.
Die Kutsche kam endlich herum, das ganze Gefährt wankte bedenklich. Der Fahrer schlug schwitzend und brüllend auf die Zugtiere ein. Dann traf sein Blick in das kreidebleiche Gesicht des jungen Beifahrers.
„Cleve Milburn, du verwünschter Idiot. Worauf wartest du noch? Wozu hältst du dein Gewehr in den Fäusten, heh? Du sollst endlich …“
Er brach mitten im Satz ab, seine Augen wurden weit. Jetzt, da die Kutsche gewendet hatte, sah er das Reiterrudel quer durch das Tal auf der Poststraße heranrasen. Lauter sehnige tiefgeduckte Gestalten mit Halstüchern vor den Gesichtern.
Gleichzeitig brachen hinter ihnen andere maskierte Reiter aus dem Unterholz am versperrten Talausgang.
„Großer Lord!“, ächzte der Kutscher. „Sie haben uns in der Zange! Sie haben uns fest, diese Dreckskerle! Cleve, Junge, schieß doch endlich! Menschenskind, starr mich nicht so an, du bist doch dafür da, um …“
Eine Kugel traf ihn mitten in die Stirn und schleuderte ihn vom Kutschbock.
Aufwiehernd versuchten die Gäule zur Seite auszubrechen. Ein Kugelhagel mähte die vordersten Tiere nieder. Die nachfolgenden Pferde stolperten, bäumten sich hoch – und das Fahrzeug drohte jeden Augenblick umzukippen.
Die Augen vor Schreck weit aufgerissen, hechtete der junge Cleve Milburn vom Bock.
Er überschlug sich im Gras am Straßenrand und blieb eine Weile benommen liegen.
Ringsum schien die Hölle losgebrochen zu sein!
Hufe trommelten einen rasenden Wirbel, pausenlos knatterten Revolverschüsse, gellende Schreie schallten.
Keuchend kam Milburn auf die Beine. Sein Gewehr lag vor ihm im Staub, er sah es nicht. Er taumelte und wischte sich benommen über das zerschürfte Gesicht.
Aus dem wehenden Staub brach ein reiterloses Pferd und fegte mit schlingernden Steigbügeln an ihm vorbei – ein Pferd, das einem der Transportbegleiter gehört hatte. Kugeln sirrten heran und ließen vor Cleve Milburn Sandfontänen aus der Poststraße spritzen. Der markdurchdringende Todesschrei eines Mannes vermischte sich mit den Detonationen.
Milburn schnappte nach Luft. Entsetzen verzerrte seine Miene.
Er wirbelte herum und begann, zu laufen, quer über die mit Schwertgras und niedrigem Gesträuch bewachsene Talsohle auf die bewaldeten Hänge zu.
Der Lärm hinter ihm wurde plötzlich leiser. Die Schüsse verstummten. Da waren nur noch Hufgestampfe und heisere Männerstimmen. Dürres Gras streifte Milburns Stiefelschäfte.
Er rannte immer weiter. Pfeifend blies der Atem aus seinem halboffenen Mund.
Hinter ihm, auf der Straße, rief jemand: „Hoh, da ist noch einer von den Burschen! Seht doch!“
Immer weiter hetzend, riss Milburn den Kopf herum.
Er sah das Reiterrudel bei der Kutsche. Ein Bandit hatte sich in den Steigbügeln hochgestellt und deutete zu ihm her. Ein paar dunkle Bündel lagen unweit der Reiter im Straßenstaub: die toten Begleiter des Silbertransportes.
Cleve Milburn war der einzige Überlebende. Die Angst durchströmte ihn wie Feuer.
„Los!“, schrie der Bandit, der ihn zuerst entdeckt hatte. „Los, holen wir ihn!“
Er spornte seinen Gaul an, und das Pochen der Hufe dröhnte überlaut in Milburns Ohren.
Er hielt den Blick wieder nach vorne gerichtet und rannte wie noch nie in seinem Leben. Hinter ihm schwoll das Hämmern der Hufe an. Vor seinen Augen verschwamm alles: die Sträucher, das Gras, der von hohen Tannen und Fichten bestandene Berghang, der schon so nahe war.
Ein Schuss peitschte. Die Kugel zischte an Milburns Kopf vorbei. In dem instinktiven Versuch, dem Geschoss auszuweichen, stolperte der Fliehende über eine im Gras verborgene Wurzel und schlug der Länge nach auf das Gesicht.
Sofort rollte er herum. Heiße Panik in den Augen, griff er zum Holster.
Es war leer.
Der Oberkörper des Verfolgers erschien wiegend über einer Reihe von Ginsterbüschen. Das Halstuch war vom Gesicht des Reiters gerutscht. Deutlich sah Milburn das hämische Grinsen, das die dünnen Lippen verzerrte.
Der Bandit war allein. Ohne Eile hob er abermals den Colt.
„Nein!“, brüllte Cleve Milburn. „Nein!“
Seine Stimme ging in ein Krächzen über.
Stolpernd raffte er sich hoch. Zweige peitschten ihm ins Gesicht. Eine Kugel fetzte durch das Laubwerk. Mit hart stampfenden Hufen bog das Pferd des Banditen um die Büsche.
Abwehrend streckte Milburn beide Hände aus und wich rückwärts, Schritt für Schritt.
Die Coltmündung zielte direkt auf seine Stirn.
Der Verbrecher drückte ab.
Es klickte nur metallen.
Der Bandit fluchte und trieb sein Pferd zum Galopp. In Milburns Gehirn entstand eine seltsame Leere. Er ließ sich fallen. Der Schatten des Reiters war über ihm, dann donnerten die Hufe zwischen die Sträucher hinein.
Nach Luft schnappend, raffte sich der junge Transportbegleiter hoch. Der Bandit wendete eben sein Pferd und spornte es wieder auf ihn zu. Milburn verlor keinen Sekundenbruchteil.
Ehe ihn diesmal der Desperado einholte, hatte er den Saum des Fichtenwaldes erreicht und warf sich zwischen die engen Bäume, wohin ihm der Bandit nicht folgen konnte. Das Schnauben des Gauls und die Schimpfworte des Verbrechers in den Ohren, stolperte Milburn den steilen Hang hinauf.
Überall stachen Felsen aus dem Moos und Fichtennadelteppich hervor. Verfilztes Unterholz wucherte zwischen den glatten hohen Stämmen.
Milburn erwartete, dass der Bandit zu Fuß die Verfolgung auf nehmen würde, und hielt nicht inne. Er lief, bis er nicht mehr konnte. An einen moosüberwucherten Felsen gepresst, schaute er endlich zurück. Er befand sich schon hoch am Hang, und durch eine Lücke in den dunkelgrünen Fichtenwipfeln konnte er das kleine Tal überblicken.
Sein Verfolger kehrte eben zur Poststraße zurück. Keiner der Banditen kümmerte sich noch um ihn. Sie alle waren damit beschäftigt, die Silberbarren aus der Kutsche auf ihre bereitgehaltenen Packpferde zu laden.
Bei diesem Anblick krampfte sich Cleve Milburns Magen zusammen. Er konnte keine Erleichterung darüber aufbringen, dass er den Banditen entkommen war. Nur zu gut erinnerte er sich daran, wie sehr ihnen Elmer Monroe eingeschärft hatte, diesen Silbertransport unversehrt nach Gunnison zu bringen!
Und Monroe war ein Mann, der es gewohnt war, dass seine Befehle aufs Haar genau ausgeführt wurden!
Milburn schauderte, wenn er daran dachte, jemals wieder diesem mächtigen Minenbesitzer gegenübertreten zu müssen!
Er sagte sich, dass es besser sei, nie mehr nach Silverrock zurückzukehren. Einen Schimmer von Hoffnungslosigkeit in den dunklen Augen, irrte er tiefer in den dunkelnden Wald hinein.
*
Jim Trafford, der Tonto genannt wurde, lauschte angespannt in die Finsternis hinaus. Sand mahlte leise, gleich darauf war es wieder totenstill. Die Nacht hing wie ein samtener Vorhang vor den Fenstern des Blockhauses. Irgendwo da draußen waren die drei Mörder unterwegs und kamen Yard um Yard näher an die Hütte heran.
Tonto presste die Lippen zusammen. Es hatte keinen Sinn, länger untätig zu warten. Jede Sekunde, die verstrich, steigerte die Chancen seiner Gegner. Wenn sie erst die Blockhütte erreicht hatten, sah es böse für ihn aus. Seine einzige Möglichkeit lag darin, selbst zum Handeln überzugehen!
„Heh, Trafford Junge!“, kam von draußen Henshaws höhnischer Ruf. „Wie fühlst du dich, Hombre? Wie ein Lamm auf der Schlachtbank, was?“
Er lachte, und dieses Lachen war schon ganz nahe.
Sie wollten ihn unsicher machen, sie wollten, dass er die Nerven verlor.
Aber Tontos Miene blieb eiskalt. Seit er in Ben Smoletts gebrochene Augen geschaut hatte, seit er, fern in Colorado, ein Ziel wusste, seitdem strahlte alles an ihm eine Härte aus, die ihn älter machte, als er in Wirklichkeit war.
Er bückte sich, schnallte die Sporen ab und verstaute sie in der Hemdbrusttasche. Dann ging er lautlos durch den Raum. Er brauchte kein Licht, er kannte hier jeden Fußbreit und jeden Winkel. An einem Haken hing ein alter verwaschener Kavallerie Mantel. Tonto hängte ihn sich um die Schultern und füllte die großen Taschen mit Munition für sein Henry Gewehr.
Dann glitt er zur Tür und öffnete sie behutsam.
Wieder war da das Knirschen von Stiefelsohlen im Sand – er konnte die Richtung nicht feststellen. Beide Fäuste um das Gewehr gekrampft, schob er sich vorsichtig auf die Schwelle.
Henshaw und seine Gefährten hatten vergessen, dass die Dunkelheit nicht nur sie schützte! Sie dachten überhaupt nicht an die Möglichkeit, dass der junge Trafford die sichere Deckung der Blockhütte verlassen könnte.
Geduckt bewegte sich Tonto von der Tür fort auf den offenen Hof. Ein Schaben war plötzlich dicht neben ihm. Undeutlich war ein Schemen zu erkennen.
Jemand flüsterte: „Weiter, Larry, weiter! Der Kerl entwischt uns nicht!“
„Okay!“, murmelte Tonto undeutlich und glitt hastig von dem verschwommenen Schatten weg.
Dann war es wieder still, und er gewann den Eindruck, weit und breit gebe es außer ihm keinen Menschen.
Er erreichte die Mitte des Hofes und blieb stehen.
In der Nähe des Blockhauses wurde geflüstert. Ein paar Sekunden später rief Henshaw scharf:
„Trafford! Es ist aus mit dir! Mach Licht drinnen und gib auf, sonst zünden wir dir das Dach über dem Kopf an!“
Sie hatten also die Außenwände der Hütte erreicht.
Tontos Mundwinkel verkniffen sich. Breitbeinig, aufrecht und unbeweglich stand er da, den Kolben des kurzläufigen Henry Gewehres in der Armbeuge.
„Zum Teufel!“, schrie Henshaw wütend. „Meinst du, wir bluffen nur? Larry hat einen Kanister Petroleum bei sich. Der reicht, um deine Hütte in ein paar Minuten in eine Fackel zu verwandeln. Also?“
Die Stimme des Mannes, der Ben Smolett ermordet hatte, schmerzte in Tontos Ohren. Aber er wusste, dass sein Augenblick noch nicht gekommen war, und rührte sich nicht.
Henshaw knurrte giftig: „Noch eine Minute, Trafford! Mehr gebe ich dir nicht!“
Dann war es ganz still.
Tonto wunderte sich, dass er keine Erregung verspürte – weder Furcht noch Hass. Er hatte einfach das Gefühl, dass dies alles unabänderlich war.
„Dann eben nicht!“, grollte Nat Henshaw, als die Minute vorbei war. „Larry, zeig ihm, wie groß seine Chancen noch sind! Los, Larry, heize ihm ein!“
Blech schepperte. Ein gelbes Flämmchen beleuchtete sekundenlang ein angespanntes hageres Männergesicht. Dann beschrieb das brennende Zündholz einen kurzen Bogen durch die Luft und landete im ausgegossenen Petroleum.
*
Mit einem dumpfen Sausen fuhr eine grelle Stichflamme an der Balkenwand empor.
Sofort fraßen sich die Flammen ins zundertrockene Holz.
„Da hast du es, Trafford Koyote!“, schrie Henshaw.
Roter flackernder Schein zog einen weiten Kreis durch die samtschwarze Nacht.
Henshaw stand an der Blockhausecke, Larry wich eben von den züngelnden Flammen zurück, und Fess, der dritte Bandit, kauerte hinter einem leeren Fass und starrte, wie die anderen, zur offenen Blockhaustür.
„Vielen Dank für die Beleuchtung!“, sagte Tonto ruhig.
Wie von Hornissen gestochen, fuhren alle drei Banditen herum. Fess stieß einen dumpfen Schrei aus.
Henshaw krächzte: „Verdammter Kerl! Hol dich der …“
Ihre Waffen ruckten.
Tontos Gewehrlauf spie eine Mündungsflamme nach der anderen aus. Tonto stand wie aus Stein gemeißelt. Er repetierte und schoss blitzschnell, dass man kaum mit den Augen folgen konnte.
Fess taumelte gegen das leere Fass und sackte zusammen.
Larry brach, die wild lodernden Flammen hinter sich, in die Knie und kippte dann lautlos zur Seite.
Nur Henshaw war schnell genug gewesen, sich zur Seite zu werfen und Tontos Kugel auszuweichen. Sein Geschoss zischte haarscharf an Tontos Wange vorbei. Der junge Kämpfer verzog keine Miene, sein Gewehrlauf ruckte um eine Handbreit, und die Kugel schleuderte Henshaw eine Handvoll Holzsplitter ins Gesicht.
Henshaw verschwand mit einem gurgelnden Aufschrei hinter der Hausecke.
Der rote Feuerschein geisterte unheimlich über Tontos starres Gesicht. Knistern und Prasseln füllten die Luft. Funken stoben in die Schwärze der Nacht empor und regneten als Ascheteilchen auf den Hof nieder.
Die Wildpferde drängten sich ängstlich in die abgelegenste Korralecke.
Staub wolkte über die Stangenumzäunung.
„Henshaw!“, rief Tonto klirrend. „Los, Henshaw, komm und führe deine Sache zu Ende!“
Er schaute sich nicht nach Deckung um, blieb an derselben Stelle stehen und ließ den wachsamen Blick in die Runde tasten.
„Hörst du nicht, Henshaw? Wo bleibt denn deine ganze Überlegenheit?“
Das Feuer griff immer mehr um sich, leckte zum Dach empor und drang durch Fenster und Tür ins Innere des Blockhauses ein. Das Licht bildete eine rote Kuppel über dem einsam gelegenen Anwesen.
Tonto sah Henshaw in grotesken Zick Zack Sprüngen vom Wohnblockhaus zum Stall hinüber rennen. Tonto feuerte, und im vollsten Lauf wurde Henshaw der Hut vom Kopf gerissen. Gleich darauf war der Verbrecher hinter dem Stall verschwunden.
„Henshaw, du Mörder, du sollst kämpfen!“, schrie Tonto. Hinter dem Stall stampften Hufe. Eine Gebisskette klirrte.
„Kämpfen?“, drang Henshaws Gekrächze durch das Tosen und Prasseln des Brandes. „Bin ich verrückt? Du Teufel, wir bekommen dich schon! Monroe ist ein mächtiger Mann, und du bist ein Nichts gegen ihn, du verdammter Panther!“
Hufschlag setzte ein.
Tonto rannte los, die Lippen grimmig zusammengepresst. Als er um die Stallecke bog, sah er den Verbrecher bereits den Hang zum Senkenrand hinaufgaloppieren. Henshaw lag fast auf dem Pferdehals. Wie wild schlug er auf die Hinterhand des Tieres ein.
Sofort zog Tonto den Gewehrkolben an die Schulter hoch. Das flackernde Licht des Brandes reichte aus, ihm ein einigermaßen genaues Ziel zu bieten. Die Waffenmündung zielte genau auf Henshaws Rücken.
Dann besann sich Tonto und ließ das Gewehr sinken. Wie gemein und verkommen Nat Henshaw auch sein mochte – Tonto brachte es nicht fertig, einem Mann in den Rücken zu schießen. Und er wusste, wo er ihn wiederfinden würde: in der Minenstadt Silverrock in Colorado.
Henshaw erreichte den Senkenrand und verschwand, ohne noch einen Blick zurückzuwerfen, wie von Furien gehetzt in der Nacht.
Tonto klemmte das Gewehr unter den Arm und ging auf den Hof zurück. Das Blockhaus hatte sich in eine wild lodernde Fackel verwandelt – das Grab Ben Smoletts, an dessen Seite Tonto zwanzig Jahre seines Lebens verbracht hatte.
Eine ganze Weile stand der junge Mann reglos da und starrte auf die zerstörerische Wut des Feuers. Schließlich ging er mit steifen Schritten zum Korral hinüber. Sein hochbeiniger Kentucky Fuchs stand noch immer an den Zaun gebunden. Er rollte mit den Augen, mit denen er seinen Herrn erkannte.
Tonto nahm den alten Kavallerie Mantel von der Schulter und schnallte ihn zur übrigen Gepäckrolle hinter dem hochbordigen Sattel fest. Dann band er den Fuchshengst los und schwang sich auf seinen Rücken.
Vom Sattel aus öffnete er das Korralgatter, und das Dutzend ungezähmter Wildpferde stob in wilder Flucht aus der Senke davon. Mit den Schenkeln, nach Indianerart, lenkte Tonto seinen Gaul zum brennenden Haus hinüber. Der Fuchs sträubte sich gegen das Feuer, aber Tonto hatte ihn eisern in der Gewalt.
Er ritt so nahe heran, dass er einen bereits brennenden Pfosten packen konnte. Mit diesem ließ er den Hengst zum Stall hinübertraben und schleuderte mit einem kräftigen Schwung das von züngelnden Flammen bedeckte Holz durch das offene Tor.
Drinnen schoss sofort eine gelbrote Lohe aus einem Strohhaufen empor.
„Vorwärts, Red Blizzard!“, raunte Tonto dem Fuchshengst zu. „Vorwärts! Hier gibt es nichts mehr, was uns noch halten könnte!“
In wiegendem Galopp fegte er den salbeibestandenen Hang hinauf. Oben schaute er nochmals zurück.
Haus und Stall brannten lichterloh. Der Korral war leer.
Bald würde die Zeit die Spuren von menschlicher Anwesenheit völlig verwischt haben. Sandstürme würden diese Senke am Fuß der Tonto Mesa und die Überreste der verkohlten Pferdefarm unter sich begraben, und nur der Zufall mochte vielleicht eines Tages die Silberknöpfe eines alten Zaumzeugs und ein paar unbenutzte Hufeisen ans Sonnenlicht befördern.
Tonto zog sachte den Kentucky Fuchs herum.
„Weiter, Red Blizzard, mein Freund! Weiter! Wir haben einen langen Trail vor uns!“
Und er ritt in der Richtung in die Nacht hinaus, in der Nat Henshaw vorhin geflohen war: nach Nordosten, nach Colorado …
*
Es war ein strahlend heller Tag, als Tonto seinen Fuchshengst vor dem Mietstall in Silverrock zum Stehen brachte.
Silverrock bot ein Bild wie viele andere Städte auch, die Tonto auf seinem langen Ritt von der Tonto Mesa in Arizona hierher in die Elk Montains hinter sich gelassen hatte. Da waren die niedrigen Wohnhäuser mit den falschen herausgeputzten Fassaden, ein Saloon, ein Hotel, eine Spielhalle, die Schmiede, die Futtermittelhandlung und der Generalstore. Hölzerne Gehsteige, teilweise überdacht, verliefen zu beiden Seiten der staubigen Fahrbahn.
Die Stadt lag in einem schüsselförmigen Becken. Ringsum wuchteten die bewaldeten Hänge der Elk Mountains hoch, darüber hoben sich schroffe Felsgipfel vom Blau des Firmaments ab. Schon während Tonto ins Tal geritten war, hatte er an verschiedenen Stellen droben in den Bergen den Rauch von Schmelzöfen aufsteigen sehen.
Und von dem freien Platz vor dem Mietstall aus entdeckte er über die Dächer von Silverrock weg ein hochgelegenes Plateau mit einem Gewirr von Bretterhütten. Die Stolleneingänge wirkten von hier aus wie winzige schwarze Löcher im Steilhang des Berges. Stahl blinkte da oben, und der schwarze Qualm aus einem Schmelzofen zerwehte über grünen Fichtenwipfeln.
„Elmer Monroes Hauptquartier, da oben!“, sagte eine Stimme hinter Tonto.
Er wandte den Kopf. Ein schmächtiger alter Mann war aus dem Mietstalltor getreten. Seine Hemdsärmel waren aufgekrempelt, die von Flicken übersäte Hose wurde von zerfransten Hosenträgern gehalten.
Er schaute in die Richtung, in die Tonto eben gespäht hatte, dann fasste er den Fuchshengst an den Zügeln. „Wollen Sie ihn unterstellen?“
„Ja!“ Tonto glitt aus dem Sattel und schnallte die Gepäckrolle los.
Die fünfhundert Meilen durch Wüsten, einsame Prärien und über wild zerklüftete Gebirge waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Sein Gesicht war schmaler geworden, und auch härter. Ein wochenalter Bart bedeckte Kinn und Wangen. Seine Kleidung war über und über mit Staub gepudert.
„Für wie lange?“
„Weiß nicht! Ich zahle für zwei Tage im voraus.“
„Das macht sechs Dollar.“
„Ziemlich teuer, wie?“
Der Alte zuckte die mageren Schultern.
„Monroe macht die Preise.“
„Monroe?“
„Yeah, der Mietstall gehört ihm. Die ganze Stadt! Und sämtliche Minen da droben in den Bergen.“
Der Stallmann führte das Pferd durch das offene Tor in den Stall. Tonto schlenderte hinterher. Drinnen war es dämmerig. Es roch nach Heu, Leder und Pferdemist. Die meisten Boxen waren leer. Der Stallmann brachte den Kentucky Fuchs in eine mit frischem Stroh aufgeschüttete Box und machte sich daran, ihn abzusatteln.
Tonto lehnte sich gegen einen kantigen Stützbalken und hakte die Daumen in seinen Revolvergurt. Er war seit dem frühen Morgen unterwegs und hatte viele Meilen über unwegsames Gebirgsgelände zurückgelegt. Aber jetzt war seine Müdigkeit verflogen. Er vergaß, dass er zuallererst ein Bad hatte nehmen wollen und dann eine tüchtige Mahlzeit. Seit der Name Monroe gefallen war, war alles wieder in ihm lebendig, was damals auf Smoletts Anwesen geschehen war.
„Ein prächtiges Tier!“, sagte der Alte, warf den Sattel über ein Rundholz und betrachtete den Hengst mit Kennermiene. Tonto hörte nicht. Nachdenklichkeit lag in seinen Augen.
„Dieser Monroe …“
„Ja? Was ist mit ihm?“ Der Stallmann musterte ihn forschend.
„Ein reicher und mächtiger Mann, wie?“
Das faltige Gesicht des Alten verfinsterte sich.
„Wollen Sie wissen, wie hoch sein Bankkonto ist und wie viele Anzüge er im Schrank hängen hat?“, knurrte er mürrisch. „Well, dann fragen Sie ihn doch selber.“
„Ich möchte etwas anderes wissen …“
„Nicht von mir!“, brummte der Alte. „Ich bin Stallmann, keine Auskunftei.“
„Und vor allem“, lächelte Tonto grimmig. „Sie arbeiten für Elmer Monroe!“
„Ja, zum Teufel!“
„Schon lange hier in Silverrock?“
„Von Anfang an! Damals standen nur drei oder vier Häuser. Lange ist das her, verdammt lange. Über zwanzig Jahre.“ Seine Miene hatte sich aufgehellt, jetzt wurde sie wieder düster. „Warum fragen Sie das alles, Fremder?“
„Weil ich annehme, dass Sie dann auch Allan Trafford gekannt haben!“
„Trafford?“ Der Stallmann starrte Tonto misstrauisch an. „Natürlich habe ich ihn gekannt.“
„Dann sagen Sie mir, was aus ihm geworden ist.“
Tontos Äußeres war völlig unbewegt, nur in seinen graugrünen Augen brannte dieses kalte Licht.
Einige Sekunden rührte sich der Stallmann nicht. Dann schob er sich ganz nahe an Tonto heran.
„Hören Sie, Mister, das gefällt mir nicht! Hat Elmer Monroe Sie geschickt, um hier herumzuspionieren?“
„Monroe kennt mich nicht – noch nicht!“ Wieder glitt dieses flüchtige grimmige Lächeln über Tontos bärtiges Gesicht.
„Zum Kuckuck! Was wollen Sie dann? Was geht Sie Allan Trafford an, heh?“
„Eine Gegenfrage: warum geben Sie mir nicht schlicht und einfach eine klare Antwort?“
„Höllenfeuer!“, schnappte der Alte. „Weil ich nicht … Ach was, ich will meine Ruhe haben, verstehen Sie? Ich weiß nichts! Ich habe keine Ahnung, was aus Allan Trafford geworden ist. Ich bin ein alter Mann, und mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut …“
„Sie lügen!“
„Was?“, schnaufte der Alte. „Das hat noch kein Mensch zu George Rafman gesagt, Mister, ich …“
„Regen Sie sich wieder ab, Rafman!“, sagte Tonto kalt. „Hoher Blutdruck schadet in Ihrem Alter!“
Er ging, nachdem er sein Henry Gewehr aus dem am Sattel befestigten Scabbard gezogen hatte, den Stallgang entlang zum offenen Tor. Hinter ihm klopften Rafmans Tritte auf dem festgestampften Lehmboden.
„Wohin, Fremder?“
„Zu jemand, der nicht gleich die Hosen voll hat, wenn der Name Allan Trafford fällt!“
„Mister, das sollten Sie lieber bleibenlassen!“
„Warum?“
„Weil … weil …“
„Weil es Elmer Monroe nicht gefallen könnte, was? Lassen Sie das nur meine Sorge sein, Rafman! Ihre Aufgabe steht da hinten in der Box und wartet darauf, trockengerieben und gefüttert zu werden!“
Der Stallmann schnappte hörbar nach Luft. Tonto wollte auf die Straße treten, da entdeckte er die Reiter, die am Ortseingang aufgetaucht waren. Er übersah die Szene mit einem Blick und wich geschmeidig in den Schatten des Stalles zurück.
Es waren vier Männer, alle in Weidereitertracht, obwohl es im ganzen Silverrock Basin keine einzige Ranch gab. Aber man brauchte nur ihre außergewöhnlich tiefgehalfterten Revolver zu sehen, um zu wissen, dass sie ihr Brot nicht mit Lasso und Brenneisen verdienten.
Sie ritten zu zweien hintereinander. Zwischen den beiden vorderen Reitern taumelte ein Mann zu Fuß. Seine Handgelenke waren links und rechts an den Sätteln der Reiter festgebunden. Sein junges bleiches Gesicht war zerschrammt, staub und schweißverschmiert. Schwarzes Haar hing ihm verklebt in die Stirn. Das Hemd war an den Schultern zerfetzt.
„Himmel! Milburn!“, ächzte Rafman neben Tonto. „Sie haben ihn also doch erwischt!“
„Wer sind denn die Leute?“, fragte Tonto leise, den Blick unverwandt auf die Reiter geheftet, die mit ihrem Gefangenen die Straße herabkamen.
„Die Reiter sind Monroes Revolvermänner. Er hat eine ganze Garde, die …“ Er stockte und warf Tonto einen argwöhnischen Blick zu.
„Weiter!“, forderte der ehemalige Mustangjäger hart.
George Rafman räusperte sich.
„Der junge Schwarzhaarige ist Cleve Milburn. Seine Schwester Sally arbeitet im Frontier Palace als Tänzerin. Cleve bekam seinen Lohn von Monroe direkt. Er war Begleitfahrer für die Silbertransporte nach Gunnison. Vor zwei Wochen wurde so ein Transport von Baxters Bande überfallen. Alle wurden niedergemacht. Nur Cleves Leiche fand man nicht. Er blieb verschwunden, bis heute.“
„Baxters Bande? Wer ist Baxter?“
„Seit einigen Monaten tut er alles, um Elmer Monroe das Leben sauer zu machen. Er haust mit seinen Banditen irgendwo nördlich von Silverrock in den Bergen. Niemand weiß, wo. Monroes Leute waren schon ein paarmal unterwegs, um sein Versteck aufzuspüren. Jedes Mal haben sie sich blutige Köpfe geholt. Der Transport vor zwei Wochen war nicht der einzige, den diese Desperados kassiert haben.“
„Und was unternimmt der Marshal?“
„Es gibt keinen Gesetzesvertreter in Silverrock, Fremder. Der Sheriff sitzt in Gunnison, und das ist weit. Hier sorgt Monroe mit seinen Leuten für Ruhe und Ordnung. Auf seine Art!“ „Und wie ist diese?“, fragte Tonto, obwohl er sich das recht gut vorstellen konnte.
„Das werden Sie gleich zu sehen bekommen!“, murmelte Rafman gepresst und deutete mit einer Kopfbewegung auf die vier Reiter, die mit ihrem Gefangenen eben vor der Veranda des Frontier Saloons anhielten.
*
Die Revolvermänner saßen ab. Einer band Cleve Milburn von den Pferden los, ein anderer eilte die ausgetretenen Verandastufen hinauf und verschwand im Saloon. Auf beiden Straßenseiten klappten Türen, pochten Schritte. Überall tauchten Menschen aus den Häusern auf. Gemurmel lief die Gehsteige entlang. Aber niemand dachte daran, zum Saloon herüberzukommen.
Cleve Milburns Brust hob und senkte sich unter harten Atemstößen. Mit den gefesselten Händen wischte er sich über das Gesicht.
„Hört mich doch endlich an!“, keuchte er. „Ich habe wirklich nichts mit …“
„Spar dir deinen Atem für Monroe auf, Junge!“, knurrte einer der Reiter.
Die Schwingtür knarrte. Der Revolvermann, der vorhin in den Saloon gelaufen war, erschien wieder im Freien. Hinter ihm tauchte ein großer schwer gebauter Mann in städtisch geschnittenem Tuchanzug auf der Veranda auf. Ein eckiges Kinn sprang aus dem fleischigen Gesicht vor, die Augen waren klein, hell und scharf.
Elmer Monroe nahm mit einer lässigen Handbewegung die dicke Zigarre aus dem Mund und drückte sie am Verandageländer aus. Sein Blick richtete sich auf Milburn.
„Da bist du ja endlich!“, sagte er gelassen. Aber der drohende Unterton in seinen Worten war nicht zu überhören.
In Milburns dunklen Augen flackerte es auf. Er starrte den mächtigen Minenbesitzer beschwörend an.
„Mister Monroe! Sagen Sie Ihren Leuten, sie sollen mich endlich losbinden! Ich bin …“
„Wo habt ihr ihn geschnappt?“, fragte Monroe die anderen.
Ein Mann, dessen breitflächiges Gesicht mit den engstehenden Augen und dem großen wulstlippigen Mund an einen Gorilla erinnerte, sagte heiser: „Drüben im Eagle Canyon hat er sich verkrochen, Boss. Er behauptet, er sei nur deshalb nicht in die Stadt zurückgekommen, weil er fürchtete, Sie würden ihn zur Verantwortung ziehen.“
„Das ist wahr, Mister Monroe!“, keuchte Milburn. „Ich weiß, es war falsch von mir! Aber es ist …“
„Bindet ihn am Haltegeländer fest!“, befahl Monroe ungerührt.
Zwei Männer packten Milburn und führten Monroes Befehl aus.
Verzweifelt drehte der Gefangene den Kopf.
„Glauben Sie mir doch, Mister Monroe! Ich habe mit dem Überfall nichts zu tun!“
„So?“, dehnte Monroe. „Und du findest es gar nicht seltsam, dass ausgerechnet du als Einziger lebend davonkamst?“
„Zufall, Mister Monroe! Ich …“
„Meine Leute haben dein Gewehr gefunden!“, unterbrach ihn Elmer Monroe scharf. „Kein einziger Schuss wurde daraus abgefeuert.“
Dunkle Röte schoss Milburn ins Gesicht.
„Ich …ich …“
„Entweder bist du ein schäbiger Feigling oder ein Verräter!“, grollte Monroe. „Für beide Sorten habe ich nur eine richtige Medizin bereit! – Ernie, die Peitsche!“
Der mit Ernie Angesprochene grinste breit, ging zu seinem Pferd und nahm die zusammengerollte Bull Peitsche vom Sattelhorn. Tiefe Stille herrschte jetzt auf der Main Street von Silverrock. Keiner der Zuschauer auf den Gehsteigen bewegte sich noch.
Milburns Augen waren weit geworden.
„Nein!“, ächzte er. „Nein, um Himmels willen, nein! Das nicht, Mister Monroe!“
Die übrigen drei Revolvermänner waren zur Seite gewichen. Breitbeinig baute sich Ernie Wilkes hinter Cleve Milburn auf, der mit dem Gesicht zur Veranda am Haltegeländer festgebunden war. Wilkes machte eine zuckende Handbewegung, und die zusammengerollte Peitschenschnur glitt schlangengleich über den gelben Sand.
„Nein!“, schrie Milburn gellend. „Mister Monroe, das dürfen Sie nicht tun! Es war doch nicht alles meine Schuld! Ja, ich bin weggelaufen! Aber wir hatten nicht die geringste Chance! Ich wollte nicht sterben – das … das ist doch kein Verbrechen!“
„Fang an, Ernie!“, befahl Monroe ungerührt.
Wilkes hob die Faust mit der Peitsche.
Da knarrte die Pendeltüre des Frontier Palace erneut. Eine helle angespannte Stimme rief: „Nicht! Tun Sie es nicht!“
Eine junge Frau kam auf Monroe zu. Ihr schmales hübsches Gesicht mit dem etwas breiten, ausdrucksvollen Mund war blass. Furcht und Empörung vermischten sich in ihren grünen Augen. Das kupferrote Haar trug sie hochgesteckt, es schien im Sonnenlicht zu flammen. Das Kleid war aufregend tief ausgeschnitten, spannte sich eng um die Hüften und fiel, glockenförmig weiter werdend, bis zu den Knöcheln hinab.
Elmer Monroe runzelte die Stirn.
„Es wäre besser,. Sie gingen auf Ihr Zimmer zurück, Miss Milburn!“, sagte er unpersönlich.
Die junge Frau blieb dicht vor ihm stehen. Ihre vollen Brüste wogten in der Erregung.
„Ich soll so tun, als ginge mich das alles nichts an, wie?“, rief sie heftig. „Wofür halten Sie mich denn, Monroe? Der Mann, den Sie auspeitschen lassen wollen, ist mein Bruder!“
Grelle Röte färbte ihre Wangen. Monroe zuckte ungerührt die massigen Schultern.
„Sie können ihm nicht helfen, Miss Milburn! Also, seien Sie vernünftig!“
„Vielleicht verstehe ich unter Vernunft etwas anderes als Sie!“, erwiderte Sally Milburn mit bebender Stimme. „Cleve ist kein Verbrecher! Er ist jung, sehr jung – darum hat er vielleicht nicht ganz richtig gehandelt! Aber das ist kein Grund, um ihn …“
„Wollen Sie mir sagen, was ich zu tun habe?“, brummte Monroe. „Miss Milburn, verkennen Sie nur nicht die Situation!“
Die junge Frau atmete tief ein. Verzweiflung erschien für einen Moment auf ihrem angespannten Gesicht. Ihre Stimme war plötzlich herb und leise.
„Ja, ich weiß schon! Sie sind der, mächtigste Mann im Tal, der Boss! Aber ist es wirklich notwendig, Cleve auszupeitschen, um Ihre Macht nicht ins Wanken geraten zu lassen? Mister Monroe, es ist … “
„Genug jetzt!“, unterbrach er sie schroff. „Bisher habe ich versucht, Sie wie eine Lady zu behandeln! Gehen Sie jetzt endlich!“
„Nein!“
„Wenn Sie zusehen wollen, ist das Ihre Sache!“, sagte Monroe brutal. „Los, Ernie!“
Wilkes schwang die Peitsche. Die Schnur pfiff durch die Luft und landete klatschend quer über Milburns Rücken. Das Hemd fetzte auf. Ein blutiger Striemen lief über die Haut darunter. Milburn stöhnte auf.
„Monroe!“, schrie Sally Milburn. „Lassen Sie auf hören, ich bitte Sie!“
„Weiter!“, knurrte der Minenbesitzer.
Wilkes schlug erneut zu. Cleve Milburn zuckte zusammen und schrie gellend auf. Das Hemd hing jetzt in Fetzen herab. Und schon peitschte der dritte Schlag auf den bloßen Rücken nieder und hinterließ einen roten riss. Wimmernd ging Milburn in die Knie.
Wilkes schaute fragend zu Monroe hoch.
„Nur zu!“, nickte ihm dieser zu. „Ich sage dir schon, wenn du aufhören sollst!“
Wieder hob sich die Faust, die den kurzen Peitschenstiel umklammerte.
„Nein!“, gellte Sally Milburns Schrei. „Nein, nicht mehr!“ Sie eilte die Stufen hinab.
„Cleve! Ich helfe dir, Cleve! Sie sollen nicht mehr …“
Einer der anderen Revolvermänner riss sie roh zurück. Sie stolperte, stürzte und fing sich mit den Händen ab.
Eine kräftige Faust schloss sich um ihren Oberarm und zog sie behutsam in die Höhe. Dicht neben ihr sagte eine feste ruhige Männerstimme:
„Keine Sorge, Ma’am! Ihr Bruder wird die Peitsche nicht mehr zu spüren bekommen!“
Monroe und seine Leute drehten die Köpfe. Ein bärtiger junger Mann stand mit ausdruckslosem Gesicht neben Sally Milburn. Er hielt ein kurzläufiges Henry Gewehr in der Armbeuge. Sein Blick heftete sich kalt auf Elmer Monroe.
*
Eine Weile war es ganz still. Nur Cleve Milburns Keuchen und unterdrücktes Stöhnen waren zu hören. Alle Blicke hingen wie gebannt an dem schlanken staubbedeckten Fremden.
Monroe starrte aus stechenden Augen den Mann mit dem Gewehr an.
„Wer sind Sie?“
„Man nennt mich Tonto!“, antwortete der junge Kämpfer ruhig.
Sekundenlang schien es, als atme Monroe erleichtert auf. Es war, als habe er einen anderen Namen zu hören erwartet. Tonto ahnte, welchen: Jim Trafford!
Monroes Schultern strafften sich. Sein fleischiges Gesicht wirkte selbstbewusst wie vorher.
„Ich gebe Ihnen eine einzige Chance, Fremder“, sagte er überheblich. „Verschwinden Sie sofort! Ich will Ihnen zugute halten, dass Sie die Verhältnisse in dieser Stadt nicht kennen!“
„Irrtum! Ich weiß recht gut Bescheid! Und – auf Ihre Chance verzichte ich, Monroe! Lassen Sie sofort diesen Mann losbinden!“
„Das hört sich wie ein Befehl an!“, sagte Monroe stirnrunzelnd.
„Es ist einer!“, gab Tonto kalt zurück.
„Dann wissen Sie also doch nicht gut Bescheid in Silverrock!“, erklärte Monroe gelassen. „Wenn jemand in dieser Stadt Befehle gibt, dann bin ich es!“
„Sie waren es!“
„Mann!“, schnaufte Monroe. „In Ihrem Gehirn scheint eine Schraube locker zu sein! Nur ein Wink von mir, und meine Leute verwandeln Sie in ein Sieb!“
„Worauf warten Sie dann noch? Winken Sie!“
Tonto machte einige gleitende Schritte von Sally Milburn weg und blieb mitten auf der Straße stehen – groß, aufrecht, vom Sonnenschein umbrandet.
In einer Mischung aus Wut und Überraschung starrte ihn Monroe an. Tonto erwiderte kalt seinen Blick. Die Erinnerung an alles, was der sterbende Ben Smolett ihm über diesen Mann erzählt hatte, wühlte ihn bis ins Innerste auf. Aber er war nicht gekommen, um Monroe eine Kugel in den Kopf zu jagen und dann das Weite zu suchen. Das würde ihn auf die gleiche Stufe mit Monroes Mordbanditen stellen!
Er war hier, um mit Monroe abzurechnen – aber auf rechtliche Art. Doch das war nicht alles. Einer von Smoletts Mördern war entkommen: Nat Henshaw. Er musste ebenfalls gestellt werden. Und dann war noch dieses andere, über das Tonto auf dem harten langen Fünfhundert Meilen Ritt am meisten nachgedacht hatte: Was war damals vor zwanzig Jahren aus Allan Trafford, seinem Vater, geworden? Hatte Monroe seine Pläne ausgeführt und seinen Partner ermorden lassen? So wie er ihn, Jim Trafford, hatte ermorden lassen wollen? Oder lebte Allan Trafford noch – durch irgendeinen Zufall gerettet?
Diese Frage war am wichtigsten. Erst wenn sie geklärt war, konnte er den nächsten Schritt machen!
All das schoss ihm in Sekundenschnelle durch den Kopf.
Dann sagte Elmer Monroe scharf: „Los, Ernie! Zeig ihm, was für ein Dummkopf er ist!“
Der Mann ließ die Peitsche in den Staub klatschen.
„Mit Vergnügen, Boss!“ Grinsend bleckte er das gelbliche Gebiss.
Mit wiegenden Schritten stellte er sich Tonto gegenüber auf der Straße auf und winkelte seine langen Arme so weit an, dass die rechte Hand dicht über dem Revolverkolben schwebte.
„Tonto!“, schrie Sally Milburn erschrocken. „Lassen Sie sich darauf nicht ein! Ernie Wilkes ist noch nie besiegt worden!“
„Einmal schlägt für jeden Mann die Stunde! Auch für Wilkes!“, erwiderte Tonto grimmig.
Aus den Augenwinkeln heraus sah er, dass die junge Frau auf ihn zueilen wollte. Er rief schnell: „Bleiben Sie, wo Sie sind!“
Sally prallte zurück.
„Ich … Sie sollen Ihr Leben nicht aufs Spiel setzen, nur um …“
„Wollen Sie lieber Ihren Bruder halb totgeschlagen im Sand liegen sehen?“, fragte Tonto hart.
Sie senkte den Kopf und schwieg.
„Fang an, Wilkes!“, sagte Tonto zu dem Desperado.
Der musterte ihn lauernd.
„Es ist nur schade, dass du in einer Minute nicht mehr feststellen kannst, wie groß du in Wirklichkeit bist, du größenwahnsinniger Satteltramp! Heh, was willst du mit dem Gewehr? Schmeiß die Knarre weg und sieh zu, dass du deinen Colt aus der Halfter bekommst, wenn es so weit ist!“
Die Mündung des Henry Gewehrs zeigte nach unten. Tonto hielt den Kolbenhals der Waffe nur mit der rechten Hand locker umschlossen.
„Ich ziehe das Gewehr vor!“, erklärte er gelassen.
Ernie Wilkes brach in schallendes Gelächter aus.
„Was? Mit dem Ding willst du schneller sein als ich mit meinem Revolver? Der Boss hatte recht! Hahaha, bei dir stimmt es wirklich nicht mehr im Oberstübchen!“
„Ich dachte, du wolltest kämpfen!“, sagte Tonto eisig.
Das Lachen des Banditen fror ein. Sein breiter Oberkörper neigte sich etwas nach vorne.
„Kämpfen?“, knurrte er höhnisch. „Das wird kein Kampf, das wird ein Kinderspiel! Da hast du es, Tonto!“
*
Wie ein Blitz fuhr seine Faust zum Revolver, schraubte sich um den glatten Kolben, und schon flirrte die Waffe in die Höhe. Alles war eine einzige rasende Bewegung.
Doch in dem Moment, da die Mündung auf Tonto angeschlagen war, sah Ernie Wilkes schon eine Mündungsflamme auf sich zustechen.
Seine Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen. Er wollte den Zeigefinger am Abzugshebel krümmen. Da schleuderte ihn die Kugel aus dem Henry Gewehr bereits nach hinten.
Zwei, drei Sekunden hielt sich Wilkes noch auf den Füßen, dann brach er, während der Knall des Schusses an den Häuserfronten verhallte, zusammen und regte sich nicht mehr.
Tonto verlor keinen Moment und wirbelte geduckt herum. Der Gewehrkolben war an seine rechte Hüfte gepresst. Der kurze Lauf blinkte silbern im Licht.
Einer von Monroes Revolverleuten hatte eben den Colt halb aus der Halfter gebracht, als Tontos Gewehr wieder peitschte.
Der Mann schrie auf. Er taumelte gegen das Verandageländer des Saloons und starrte entsetzt auf seinen rechten Unterarm, wo plötzlich ein blutiger Riss klaffte.
„Will es noch jemand versuchen?“, fragte Tonto, und seine Stimme klang eiskalt. Geduckt stand er da, wie sprungbereit.
Elmer Monroe biss sich auf die Lippen. Die beiden anderen Revolvermänner tauschten unsichere Blicke. Langsam wanderte Tontos Gewehrlauf hin und her, jederzeit bereit, erneut eine tödliche Flamme auszuspeien.
Monroe räusperte sich.
„Ich muss zugeben, Fremder, Sie sind schneller, als ich erwartet habe.“
„Ich warte nicht auf Ihr Kompliment“, erwiderte Tonto eisig, „sondern darauf, dass Milburn losgebunden wird. Also?“
Monroes breites Gesicht färbte sich dunkelrot. Für einen Moment blitzte rasender Hass in seinen kleinen hellen Augen auf. Dann hatte er sich schon wieder unter Kontrolle.
„Bindet ihn los!“, sagte er zu seinen Leuten.
Sie kamen wortlos und mit finsteren Gesichtern dem Befehl nach.
Als die Fesseln fielen, hielt sich der junge Milburn krampfhaft am Holm fest. Sally eilte zu ihm hin und stützte ihn.
Ihr Blick flog zu Tonto – ein Blick, in dem sich Freude, Besorgnis und Überraschung mischten. Sie wollte etwas sagen, aber Tonto kam ihr zuvor.
„Sie sind mir keinen Dank schuldig, Ma’am! Wenn Sie jetzt das einzig Richtige tun wollen, dann schaffen Sie Ihren Bruder von hier weg.“
Eine Sekunde schaute sie ihn an, als wollte sie mit ihrem Blick die Undurchdringlichkeit seiner Miene durchbrechen. Dann nickte sie stumm und führte ihren jüngeren Bruder die Verandastufen hinauf. Weder Monroe noch einer seiner Leute rührte sich. Gleich darauf schwangen die Pendeltüren hinter der jungen Frau und ihrem Bruder zu.
„Well, Tonto“, sagte Monroe heiser, „Sie haben erreicht, was Sie wollten. Aber damit ist die Sache nicht zu Ende! Hören Sie zu, Mann! Wie schnell Sie auch sein mögen – gegen meine ganze Revolvergarde kommen Sie niemals an. Und hinzu kommt, dass ich kein Mann bin, der stillschweigend über eine Niederlage hinweggeht!“
„Das heißt, Sie wollen mich tot sehen?“
„Es gibt nur eine einzige andere Möglichkeit, Tonto: Reiten Sie für mich! Ich zahle guten Kämpferlohn.“
„Darauf bin ich nicht scharf.“
„Auf ein Stück heißes Blei dürften Sie noch weniger scharf sein, oder?“ Der Anflug eines Lächelns geisterte um Elmer Monroes dünne Lippen. „Glauben Sie mir, Tonto, Sie haben keine andere Wahl! Entweder Sie gleichen Ernie Wilkes Tod dadurch aus, dass Sie an seine Stelle treten – oder Sie bezahlen dafür mit Ihrem Leben!“
„Eine Rechnung, die typisch für Sie ist, wie mir scheint!“
„Eine Rechnung“, sagte Monroe schneidend, „die auf jeden Fall aufgeht! – Tonto, ich gebe Ihnen eine Frist bis abends. Ich werde im Frontier Saloon sein und auf Ihre Entscheidung warten. Und versuchen Sie nur nicht, vorher unbemerkt aus der Stadt zu entwischen – es würde Ihnen nicht gelingen, mein Wort darauf!“
Er kam mit schweren Tritten die Stufen herab. Dem toten Wilkes und dem verwundeten Revolvermann schenkte er keinen Blick mehr.
„Mein Pferd, Rock“, sagte er und winkte. „Wir reiten!“
Er ging an Tonto vorbei, als existierte dieser nicht mehr.
Grimmig lächelnd schaute Tonto ihm nach. Bald würde Elmer Monroe wissen, dass er in Wirklichkeit Jim Trafford war, und dann würde die Hölle losbrechen in Silverrock …
*
Die Sonne sank hinter den Felsgraten und Gipfeln der Elk Mountains. In Sally Milburns Zimmer im Obergeschoss des Frontier Palace breitete sich die Dämmerung aus. Die junge Frau hatte einen Umhang über ihr rüschenbesetztes Tanzkleid geworfen und stand, eine Hand auf die Klinke gelegt, an der Tür.
„Ich muss gehen, Cleve“, sagte sie zu ihrem Bruder, der auf dem breiten Bett lag. „Bleib ruhig liegen. Ich werde zwischen den Auftritten nach dir sehen.“
Ihre Stimme klang warm und besorgt.
Cleve Milburns Gesicht war ein fahler Fleck in der zunehmenden Dämmerung.
„Schon gut, Sally!“, krächzte er heiser. „Geh nur! Ich komme schon zurecht! Ich … ich bin wirklich kein kleines Kind mehr, wirklich nicht!“
Einen Moment schien es, als wollte die Tänzerin noch etwas sagen. Dann seufzte sie schweigend und verließ den Raum. Ihre Schritte verklangen auf dem Korridor.
Cleve presste das Gesicht zwischen die angewinkelten Arme. Seine Schultern waren verkrampft. Er zuckte zusammen, als er hörte, wie die Tür sachte geöffnet wurde. Er drehte sich halb, und die Schmerzen auf seinem Rücken malten sich auf seinem Gesicht ab.
„Bleib, wo du bist, Cleve!“, sagte Monroe hart.
Er kam schnell ins Zimmer und drückte hinter sich die Tür ins Schloss. Der dicke Teppich dämpfte seine Schritte zur absoluten Lautlosigkeit. In der einbrechenden Dunkelheit wirkte seine Gestalt noch massiger.
Cleve richtete sich ruckartig auf dem Bett hoch. Er atmete schneller.
„Mister Monroe, was … ich …“
„Still! Wenn jemand redet, bin ich es!“
Cleve krallte sich an einem Bettpfosten fest und zog sich auf die Füße.
„Ich habe nicht …“
„Hör endlich auf mit dem Gejammer! Wenn ich dich töten wollte, hättest du kein einziges Wort mehr über deine Lippen gebracht! Hör zu, Milburn. Ich will dir glauben, dass du nicht mit Baxter unter einer Decke steckst!“
Cleve atmete erleichtert auf.
„Aber“, redete Monroe kalt weiter, „im anderen Falle hast du deine Pflicht vergessen, und das wiegt kaum weniger schwer. Ich kann Männer, auf die kein Verlass ist, nicht in meiner Mannschaft brauchen.“
„Mister Monroe …“
„Du sollst still sein! Pass auf! Ich biete dir zwei Möglichkeiten für einen neuen Anfang in meiner Crew! Wenn du es nicht schaffst, bist du erledigt!“
„Was muss ich tun?“, fragte Cleve Milburn tonlos.
Breitbeinig stand Monroe mitten im Raum, die Arme vor der Brust verschränkt. Gnadenlose Härte lag in seinem Blick.
„Die eine Möglichkeit ist, dass du das Silber zurückschaffst, das die Baxter Bande dem Transport vor zwei Wochen abgenommen hat!“
„Das Silber?“, stöhnte Cleve. „Boss, das ist doch … mein Gott, das ist unmöglich! Ein Mann allein …“
„Ich meine nicht, dass du gegen die ganze Baxter Bande kämpfen sollst! Ich will sagen, es genügt, wenn du das Versteck dieser Halunken aufspürst!“
Kraftlos ließ sich der junge Mann auf das Bett sinken.
„Das ist …“
„Dein Urteil will ich nicht hören!“, unterbrach ihn der Minenbesitzer grob. „Ich habe die Bedingungen zu stellen, nicht du! Und erinnere dich daran, Milburn, dass du anderswo nicht mehr anfangen kannst! Nur hier in Silverrock, in meiner Mannschaft, bist du sicher! Ich habe dir deinen Steckbrief gezeigt, weißt du noch? Ich brauche nur den Sheriff in Gunnison zu verständigen, und im ganzen Land geht die Hetzjagd auf dich los!“
„Ich weiß“, murmelte Cleve mühsam. „Ich weiß!“
„Schön, dass du vernünftig bist!“ Monroe lächelte kalt. „Und nun die zweite Möglichkeit. Ich erwarte einen Mann namens Jim Trafford im Silverrock Basin. Er kann jeden Tag hier auf tauchen. Halt die Augen nach ihm offen, Cleve. Und wenn du ihn triffst, dann erschieß ihn!“
Milburn gab sich einen Ruck.
„Ich soll ihn … Monroe, warum?“
„Das geht dich nichts an! Du hast zu tun, was ich sage, klar?“
„Mister Monroe, ich bin kein Revolvermann! Ich bin als Transportbegleiter für Sie gefahren, und ich will das jederzeit wieder tun! Ich will …“
„Was du willst, interessiert mich nicht! Ich habe dir deine Chancen geboten! Entweder du spürst das Baxter Camp in den Bergen auf, oder du erledigst diesen Jim Trafford, wenn er auftaucht! Andernfalls … nun ja, dein Steckbrief ist gut aufgehoben bei mir, und der Sheriff in Gunnison wird sich freuen, einen guten Tipp zu bekommen!“
„Nein, nein, das nicht! Nur das nicht! Sally …“
„Es liegt bei dir, ob sie noch mehr Kummer bekommt!“
Cleve Milburn schluckte. Er starrte zu Boden und sagte heiser: „Ich werde tun, was Sie verlangen, Boss! Ich verspreche Ihnen, ich werde mein Möglichstes tun!“
„Sehr schön, mein Junge! Ich habe es nicht anders erwartet!“
Monroes Stimme war von hämischer Selbstsicherheit erfüllt. Ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, wandte er sich ab, und gleich darauf war Cleve Milburn allein …
*
Eine Woge aus Tabaksqualm, Schnapsdunst und Stimmengewirr brandete Tonto entgegen, als er die halbhohen Schwingtüren aufstieß und den Frontier Palace betrat.
Die Tischreihen waren voll besetzt. Stühle wurden gerückt, Karten klatschten und Gläser klirrten. Beim Großteil der Gäste handelte es sich um Arbeiter aus den umliegenden Silberminen, das war an der derben, einfachen Kleidung, an den kräftigen Gestalten mit den schwieligen, erdverkrusteten Händen festzustellen. Die anderen Männer wären Bürger der Stadt.
Als Tonto zur Theke ging, folgten ihm sämtliche Blicke. Er kümmerte sich nicht darum, bestellte einen Whisky, und der hemdsärmelige Barkeeper bediente ihn mit zuvorkommender Schnelligkeit.
Der Duft eines herben Parfüms umfing Tonto plötzlich. Direkt neben ihm raschelte seidig ein Kleid. Eine leise Frauenstimme fragte: „Sie warten auf Monroe?“
Er drehte sich halb und schaute in Sally Milburns Gesicht. Das gelbe Lampenlicht verstärkte noch den Glanz ihrer großen grünen Augen. Ihre Schultern waren bloß, die Haut schimmerte pfirsichfarben. Das enge Kleid betonte noch die erregenden Formen ihres biegsamen Körpers.
Ihr Blick war fest und forschend. Schweigend wartete sie auf Antwort.
Er stellte das leere Glas auf die Theke zurück.
„Sie haben recht, Ma’am!“
„Nennen Sie mich doch Sally“, sagte sie lächelnd. „Ich bin keine reiche Lady – ich bin nur Tänzerin.“
Er erwiderte ihr Lächeln. „Nun gut, Sally!“
Ihre Miene wurde ernst. „Sie haben sich also entschieden, Tonto?“
„Blieb mir eine andere Wahl?“
„Nein, das nicht!“, murmelte sie mit jäher Bitterkeit. „Wir alle hier in Silverrock haben nur die eine Möglichkeit.“
„Meinen Sie? Ich habe jedenfalls die andere gewählt!“
Ein Schimmer von Überraschung glitt über ihre Miene. Impulsiv fasste sie mit beiden Händen seine Arme.
„Tonto! Heißt das, dass Sie nicht auf Monroes Angebot eingehen?“
Die Erregung in ihrem Blick erstaunte ihn.
Ehe er antworten konnte, rief eine ungeduldige Stimme durch den Saloon: „Sally, dein Auftritt! Ich warte schon!“ Ein glatzköpfiger Mann stand neben einem aufgeklappten Klavier und schaute, auf die Zehenspitzen gestellt, zu ihnen herüber.
Sally seufzte und ließ Tonto los. Das Feuer in ihren grünen Augen erlosch.
„Ich komme schon, Rhett! – Tonto, ich sehe Sie nachher!“
Anmutig glitt sie zwischen den Tischreihen davon. Tonto lehnte sich gegen die Theke. Drüben nahm der Glatzköpfige vor dem Klavier Platz. Sally Milburn stieg langsam die Stufen zu dem Podium im Hintergrund des Raumes empor.
Der Kahlkopf schlug ein paar Takte auf dem Klavier an, und der dumpfe Lärm im Saloon erstarb jäh. Alle Augenpaare wandten sich dem Podium zu, auf dem jetzt Sally stand – genau an der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit.
Ein Lächeln lag auf ihren Lippen, ein Lächeln, von dem jeder Mann im Saloon annehmen konnte, dass es ihm galt. Sie machte ein paar federleichte Tanzschritte, wie zur Übung – und die Menge im Frontier Palace staute den Atem.
Tonto merkte plötzlich, wie sein Herz schneller schlug.
Diese Frau da oben auf dem Podium besaß mehr als ein schönes Gesicht und eine wundervolle Figur – ein Hauch berückender Faszination strahlte von ihr aus, der jeden Mann gefangennahm.
Sally Milburn nickte dem Klavierspieler lächelnd zu.
Die Finger des Mannes begannen flink über die Tasten zu gleiten. Die Klänge breiteten sich durch den ganzen Raum aus und formten sich zu einer flotten Melodie.
Sally Milburn raffte den rüschenbesetzten Saum ihres engen Kleides bis zu den Knien hoch, machte vor dem Publikum, noch immer das Lächeln auf den fruchtroten Lippen, einen anmutigen Knicks – und dann begann sie zu tanzen.
In diesem Augenblick legte sich eine Hand auf Tontos Schulter. Eine raue Stimme sagte: „Kommen Sie! Monroe wartet im Nebenzimmer!“
Einer der Männer, die Cleve Milburn am vergangenen Nachmittag gefangen in die Stadt gebracht hatten, stand vor Tonto – ein sehniger finsterblickender Bursche, dessen Revolverkolben mit Kerben übersät war.
Mit einer Kopfbewegung zeigte er zur verschlossenen Nebenzimmertür hinüber.
„Okay!“, sagte Tonto knapp und folgte dem Revolvermann.
Hinter ihnen wurden die Klaviertöne lauter, und dazwischen waren die Steppschritte der Tänzerin auf dem Podium wie Trommelwirbel zu hören.
Der Monroe Mann öffnete die Nebentür vor Tonto. Drinnen brannte eine Petroleumlampe über einem mit grünem Samt überzogenen Spieltisch. Ein breitschultriger Mann in dunkelgrauem Anzug saß an diesem Tisch: Elmer Monroe.
Eine Zigarre glühte vor ihm in einem Aschenbecher. Daneben stand ein halbvolles Whiskyglas. Seitlich hinter Monroe lehnte noch ein Revolvermann an der Wand.
„Kommen Sie herein, Tonto“, sagte Monroe mit einem Lächeln, das Tonto warnte. „Hier sind wir unter uns!“
Tonto wartete, bis der erste Revolvermann vor ihm das Zimmer betreten hatte, dann erst schob er sich langsam über die Schwelle. Er blieb so stehen, dass die Tür von innen noch nicht zu schließen war.
Monroe bewegte sich nicht auf seinem Stuhl.
„Nun?“, fragte er rau.
Es sah ganz so aus, als gelte diese Frage Tonto. Einen Moment später wusste der junge Kämpfer aus Arizona, dass dies ein Irrtum war.
Ein Scharren war hinter der offenstehenden Tür, aus den Augenwinkeln bemerkte Tonto eine schattenhafte Bewegung, und gleichzeitig gab eine vor Erregung kratzende Stimme Antwort auf Elmer Monroes knappe Frage.
„Das ist er, Boss! Ja, das ist er – Jim Trafford!“
Es war die Stimme Nat Henshaws!
Und da wusste Tonto, dass es nur noch eines für ihn gab: den Kampf ums nackte Leben!
*
Er wollte sich rückwärts schnellen und zum Revolver greifen. Da knackte seitlich hinter ihm ein Colthahn, und Henshaw knurrte wild: „Versuch es nur, Freundchen! Ich brauche nur den Finger krummzumachen!“
Tonto erstarrte. Henshaw hatte von Anfang an sein Schießeisen bereitgehalten. Es gab keine Chance mehr!
Auf Elmer Monroes Gesicht erschien ein breites Lächeln. Langsam erhob er sich von seinem Stuhl …
„Was ist denn, Tonto? Wollen Sie nicht hereinkommen?“
Draußen im Saloon klimperte noch immer das Klavier. Sally Milburn hielt mit ihrem aufregenden Tanz die Aufmerksamkeit der Gäste gefangen. Niemand bemerkte, was hier im Nebenzimmer vorging.
„Na los!“, zischte Henshaw und stieß Tonto die Coltmündung zwischen die Rippen.
Tonto bewegte sich in den Raum hinein. Hinter ihm schlug Henshaw mit dem Fuß die Tür zu. Die Musik im Saloon schien jäh in weite Ferne gerückt.
Jetzt hatte auch der Revolvermann an der gegenüberliegenden Wand die Waffe gezogen. Monroe verschränkte selbstgefällig die Arme vor der Brust.
„Wenn ich heute Nachmittag schon gewusst hätte, dass du Jim Trafford bist, mein Junge, dann hättest du diesen Abend gar nicht mehr erlebt. Erst als ich mich mit Henshaw unterhielt, schöpfte ich Verdacht. Well, wie du siehst, ist es nicht zu spät.“
Und hinter Tonto sagte Ben Smoletts Mörder heiser: „Du kannst dir gar nicht vorstellen, welches Vergnügen es mir bereiten wird, dir eine Kugel durch den Kopf zu jagen, du verdammter Geier!“
Tonto schaute dem Minenbesitzer eiskalt in die Augen.
„Einmal werden auch Sie für alles bezahlen müssen! Davon bin ich überzeugt!“
„Lächerliches Geschwätz!“, warf Monroe verächtlich hin. „Du hast Angst, Junge, das ist alles! Vielleicht bist du in Wirklichkeit gar nicht so hart, heh? Und ein Dummkopf bist du obendrein! Wie konntest du nur annehmen, etwas gegen mich auszurichten!“
Er schüttelte beinahe vorwurfsvoll den Kopf.
„Hat dich der Gedanke an meinen Reichtum so verrückt gemacht, Jim Trafford? Hast du gedacht, du könntest so einfach hierherreiten, und ich würde dir dann mit Freuden das Erbe deines Vaters aushändigen? Ja, mein Junge, ich bin reich – reicher, als du vielleicht denkst! Aber ich bin kein Narr! Du wirst keinen Cent erhalten!“
„Sondern ein Stück heißes Blei!“, setzte Henshaw brutal hinzu.
„Ihr Geld und das Silber, das Sie aus den Bergen holen, interessiert mich nicht!“, erklärte Tonto mit unbewegter Miene.
Monroe zog die Augenbrauen hoch. „Wirklich? Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der solchen Dingen gegenüber kalt bleibt! Aus welchem Grund bist du dann gekommen? Nur um mit mir abzurechnen? Um mich der Gerechtigkeit zu überführen, wie?“
Er lachte schallend.
„Auch das!“, sagte Tonto ungerührt.
„Ich wusste ja, du bist ein Dummkopf!“, sagte Monroe lachend. „Und dein Hauptgrund?“
Tontos graugrüne Augen verengten sich.
Leise sagte er: „Ich will wissen, was aus meinem Vater geworden ist!“ Schlagartig verfinsterte sich Monroes Gesicht. Sein Blick wurde hart und erbarmungslos.
„Das liegt zwanzig Jahre zurück! Ich wette, du kannst dich nicht mal mehr an deinen Vater erinnern. Was kümmert dich also sein Schicksal?“
„So kann nur ein Mann wie Sie reden!“, erwiderte Tonto mit eisiger Verachtung. „Haben Sie Angst, mir zu antworten?“
„Angst! dass ich nicht lache!“
„Dann sagen Sie mir, was aus Allan Trafford wurde! Ist er tot oder – lebt er noch?“
In diesen Sekunden hatte Tonto alias Jim Trafford vergessen, dass zwei schussbereite Revolver auf ihn zielten. In diesen Sekunden sah er nur diesen großen skrupellosen Mann auf der anderen Tischseite. Heiße Erregung brannte plötzlich in ihm.
Elmer Monroe zögerte.
Ein heiserer Unterton mischte sich in Tontos Stimme: „Antworten Sie! Ich will wissen, ob mein Vater noch lebt?“
Die Schärfe seiner Worte ließ den Minenbesitzer unwillkürlich zusammenzucken. Doch im nächsten Moment hatte er sich schon wieder gefangen.
„Du hast vergessen, wo du bist, Trafford!“, sagte er kalt. „Du hast hier keine Fragen zu stellen! Weißt du, weshalb du hier bist? Ich will es dir sagen: um zu sterben! Henshaw, ich überlasse ihn dir! Du kannst …“
Auf der nächtlichen Main Street von Silverrock schrillte ein langgezogener Pfiff. Hufschläge setzten ein und wirbelten in rasendem Tempo die Straße entlang. Raue Schreie schallten. Und dann peitschten Schüsse.
Jemand schrie entsetzt: „Die Baxter Bande! Die Baxter Bande ist in der Stadt!“
Jetzt fielen die Schüsse in blitzartiger Reihenfolge.
Alles ging jetzt ganz schnell.
*
Monroe war herumgefahren, die Aufmerksamkeit seiner beiden Revolverbanditen war der Straße zugewandt.
Es war die Chance, auf die Tonto nicht mehr zu hoffen gewagt hatte!
Mit raubtierhafter Geschmeidigkeit wirbelte er herum und warf sich gegen Henshaw. Der Verbrecher fluchte und zog den Stecher durch. Da hatte Tonto Henshaws Arm bereits hochgeschlagen, und die Kugel fuhr splitternd in die Holzdecke.
Tontos Rechte kam blitzschnell hoch, erwischte Nat Henshaw genau unter dem Kinn, und während der Desperado lautlos zusammensackte, riss ihm Tonto den Revolver aus der Faust.
Der zweite Revolvermann schlug mit verzerrtem Gesicht seinen Colt auf Tonto an. Monroes Rechte zuckte in den Ausschnitt seiner grauen Jacke.
Tonto ließ sich auf die Knie fallen und schoss die Petroleumlampe entzwei. Das Petroleum verlöschte, ehe es sich entzünden konnte. Schlagartig senkte sich undurchdringliche Finsternis über den Raum.
Im Saloon waren die Klavierklänge verstummt. Männer schrien durcheinander. Tische und Stühle wurden in der Eile umgeworfen. Die Pendeltüren knarrten.
Auf der Main Street tackten noch immer die Hufe. Schüsse dröhnten zwischen den Häuserfronten. Das Zersplittern von Fensterscheiben war zu hören. Mit schrillen Schreien trieben die Reiter die Gäule an.
„Vorsicht!“, schrie jemand im Saloon.
„Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Großer Himmel! Sie haben die Stadt überfallen, diese Banditen! Sie haben …“
Die Worte gingen im Bersten der Revolverschüsse unter.
Inzwischen hatte Tonto in der Dunkelheit einen Stuhl ergriffen. Er schleuderte ihn in Richtung der Tür. In das laute Poltern hinein krachten zwei Colts, die Mündungsflammen stachen zur Tür.
„Lynn!“, brüllte Monroe. „Versperr ihm den Weg, Lynn!“
Geduckt glitt Tonto quer durch das Zimmer zum Fenster hinüber. Ganz nahe neben ihm feuerte ein Mann, und die Kugeln sirrten wieder zur Tür hinüber. Tonto stieß hastig den angelehnten Fensterflügel auf und ließ sich wendig über das niedrige Fensterbrett gleiten.
Er landete federnd auf dem hölzernen Gehsteig.
Drinnen schrie der Revolvermann: „Das Fenster, Boss! Er ist aus dem Fenster entwischt!“
„Zum Teufel! Dann steh hier nicht herum! Los, ihm nach!“
Tonto raffte sich hoch, rannte die Hauswand entlang und bog hastig in eine tintenschwarze Häuserpassage.
Auf der Straße peitschten noch immer Schüsse. Staub wallte in dichten Schwaden im gelben Lampenlicht, das aus den erleuchteten Fenstern über die Fahrbahn fiel. Ein Reiterrudel sprengte in halsbrecherischem Galopp dem Ortsausgang zu. Überall stürzten jetzt Männer aus den Häusern und schossen wie verrückt hinter den Banditen her. Die Reiter verschwanden in der Nacht.
„Mister Monroe“, schrillte eine Männerstimme, „das war die Baxter Bande! Wir müssen die Verfolgung aufnehmen, Mister Monroe! Wir …“
„Unsinn!“ Monroes grollende Stimme kam von der Veranda des Frontier Palace.
„Vielleicht wollten uns die Halunken nur in eine Falle locken! Wir haben Wichtigeres zu tun! Tonto ist entkommen! Jagt ihn, Leute, jagt ihn und bringt ihn mir, tot oder lebendig! Vorwärts!“
Stimmengesumm lief die Häuserfronten entlang. Türen und Fenster klappten. Tritte pochten auf Veranden und Gehsteigen.
Monroe schrie: „Lynn, sag den anderen Boys Bescheid! Sie sollen die ganze Stadt auf den Kopf stellen, um diesen verdammten Kerl zu erwischen! Los, los, Lynn, jede Sekunde ist kostbar!“
Tonto wartete nicht länger. Es war bezeichnend, dass sich Monroe jetzt nicht um die Baxter Bande kümmerte, die ihm bereits so viele Schwierigkeiten gemacht hatte. Jetzt ging für ihn Jim Trafford vor, und seine Revolverleute würden alles daransetzen, seine Befehle auszuführen. Von dieser Minute an war Silverrock Todesgebiet für den Kämpfer aus Arizona!
Tonto machte sich keine Illusionen. Er musste fort aus der Stadt. Auf dem schnellsten Weg! Wie schnell er auch sein mochte, gegen diese Übermacht konnte er sich unmöglich behaupten.
Er rannte den Häuserdurchlass entlang und bog dann in einen Hinterhof. Kurz blieb er stehen, um sich zu orientieren. Dann schlug er die Richtung zum Mietstall ein. Erst wenn er auf dem Rücken von Red Blizzard saß, würde er eine Chance besitzen, der gnadenlosen Hetzjagd zu entgehen.
Die ganze Stadt hatte sich in einen Hexenkessel verwandelt!
Während Tonto über Hinterhöfe hetzte, Bretterzäune überstieg und sich durch enge Häuserlücken zwängte, waren seine Gedanken wieder bei den Minuten, in denen er Elmer Monroe nach seinem Vater gefragt hatte.
Warum hatte Monroe mit der Antwort gezögert? Warum hatte diese Frage ihn so offensichtlich getroffen?
Diese Gedanken weckten eine fast wilde Hoffnung in Tonto. Ben Smolett hatte ihn vor dieser Hoffnung gewarnt. Er hatte ihm gesagt, dass damals vor jenen langen zwanzig Jahren alle Chancen gegen seinen ahnungslosen Vater gestanden hätten. Und er hatte ihn daran erinnert, dass Allan Trafford in dieser langen Zwischenzeit bestimmt etwas gegen seinen früheren Partner unternommen hätte, wenn er wirklich noch lebte.
Zweifel befielen Tonto. Aber immer wieder musste er an Monroe denken! Hätte es nicht zum Wesen dieses machtgierigen, skrupellosen Mannes gepasst, ihm – Tonto – die Gewissheit über den Tod Allan Traffords höhnisch ins Gesicht zu schleudern? Warum hatte er es nicht getan?
Fünfhundert Meilen hatte Tonto von Arizona aus zu den Elk Mountains in Colorado zurückgelegt, und doch hatte er jetzt das Gefühl, dass sein Trail nunmehr erst den Anfang fand.
Wenn er lebend aus Silverrock entkam!
Er musste es schaffen!
Tonto bog um eine Schuppenecke und hatte den Mietstall vor sich. In stiller Schwärze lag das breite niedrige Brettergebäude. Der weite Korral dahinter war leer.
Tonto wollte schon seine Deckung verlassen, da entdeckte er die schattenhaften Bewegungen drüben bei der Korralumzäunung und an der Mietstallecke. Für einen Moment glaubte er das matte Blinken von Metall zu erkennen.
Flüstern trieb zu ihm her.
„Jetzt haben wir ihn todsicher fest! Ich wette meinen Kopf gegen eine leere Patronenhülse, dass er hierher kommen wird. Und ehe er auch nur eine Hand an sein Pferd legen kann, haben wir ihn in ein Sieb verwandelt.“
Hastig zog sich Tonto hinter die Schuppenecke zurück. Bitterkeit verkniff seine Mundwinkel. Sie hatten ihm den einzigen Ausweg versperrt – er saß in der Falle!
*
Irgendwo hinter Tonto in der Dunkelheit schnaubte leise ein Pferd. Er drehte sich um, seine Augen versuchten die Finsternis über dem engen Hinterhof zu durchdringen. Wieder war da dieses gedämpfte Schnauben.
Tonto presste die Lippen zusammen, senkte die Hand auf den Revolverkolben und schlich geduckt in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Sand mahlte unter stampfenden Hufen. Einige Sekunden später erkannte Tonto die Umrisse eines Pferdes. Auf den Zehenspitzen näherte er sich ihm.
„Tonto!“, rief eine leise Stimme.
Er zuckte zusammen. Seine Hand schloss sich um den Kolben der Waffe.
„Tonto!“ rief es wieder.
„Sind Sie es, Tonto?“
Jetzt erkannte er die Stimme, und ein Schauer der Erregung rieselte über seinen Rücken. Seine Haltung entspannte sich etwas.
„Sally – Sie?“
Eine schlanke hellgekleidete Gestalt schob sich hinter dem hochbeinigen Pferd hervor.
„Ja, ich bin es! Kommen Sie, Tonto, schnell!“
Gleich darauf stand er vor ihr. Sie atmete heftig, und trotz der Dunkelheit sah er das Glänzen ihrer großen Augen. Wieder umfing ihn der herbe Duft ihres Parfums. Ihr Kleid streifte ihn raschelnd.
„Es ist Ihr Fuchshengst!“, sagte sie hastig. „Ich habe ihn aus dem Stall geholt, ehe Monroes Revolverschwinger zur Stelle waren!“
Red Blizzard war gesattelt und gezäumt, und mit einem schnellen Blick erkannte Tonto, dass im Scabbard am Sattel sein Henry Gewehr steckte.
Er atmete tief ein. „Wie soll ich Ihnen nur danken, Sally!“
„Danken? Haben Sie schon vergessen, was Sie für Cleve getan haben?“
„Das ist …“
„Sie dürfen keine Zeit verlieren, Tonto! Sie müssen fort!“
„Yeah!“, nickte er hart. „Yeah, Sie haben recht!“
Er tätschelte dem Kentucky Fuchs flüchtig den Hals und packte dann das steile Sattelhorn.
„Hat Sie jemand gesehen, Sally?“
„Nein! Warum …“
„Ich hoffe, Sie bekommen keinen Kummer deshalb!“
„Kummer bin ich gewohnt!“ Ein bitteres Lächeln war aus ihrer Antwort zu hören.
Impulsiv wandte er sich ihr voll zu. Ihr Gesicht war ein heller ovaler Fleck in der Dunkelheit. Sie war so nahe, dass er die erregende Wärme ihres Körpers fühlte.
„Sally“, sagte er rau, „diese Stadt ist nicht gut für Sie und Ihren Bruder! Sie sollten fortgehen von hier!“
„Ich wollte, das wäre möglich!“, murmelte sie schwermütig.
„Weshalb?“
„Ich werde es Ihnen ein anderes Mal erzählen, Tonto!“
Sie fasste mit beiden Händen seine Rechte, und diese Berührung durchströmte ihn mit einer seltsam süßen Wärme.
„Ich wünsche Ihnen Glück, Tonto! Sie müssen es schaffen, Sie müssen einfach!“
Dann ließ sie seine Hand los und wich einen Schritt zurück. Sekundenlang stand er völlig reglos. Seine Kehle war wie ausgedörrt, in seinen Schläfen hämmerte es. Er war nahe daran, die Hände nach Sally auszustrecken und sie an sich zu ziehen.
Mit einem Ruck wandte er sich schließlich um und schwang sich auf den Pferderücken. Als er den Kopf drehte, sah er die junge Frau eben noch hinter einer Gebäudeecke verschwinden. Zurück blieb nur ein Hauch ihres Parfüms und die Erinnerung an ihre Nähe, die ihn benommen machte.
Er lenkte den Hengst herum und drückte ihm die Stiefelabsätze in die Weichen. Das Tier trabte los.
Drüben beim Mietstall schrie jemand aufgeregt: „Heh, wer reitet da? Jack, sieh mal nach!“
Vom Hinterhof trieb Tonto das Pferd auf die Main Street. Sofort geriet er in den breiten Lichtbalken aus einem nahen Fenster.
„Da ist er! Tonto! Er ist es!“
Ein Schuss fiel, die Kugel warf neben Red Blizzards Hufen Sandkörner empor.
Tonto duckte sich tief auf den Pferdehals.
„Zeig ihnen, was du kannst, Amigo!“, raunte er dem Hengst heiser zu. „Lauf, Blizzard, lauf!“
Der schlanke Leib des rassigen Fuchses streckte sich. Die Hufe trommelten ein wildes Stakkato. Wie von der Sehne geschnellt, flog das Pferd die Main Street entlang.
Die Schreie und Schüsse hinter ihm ließen Tonto Jim Trafford ungerührt. Die Gewissheit, dass ihn auf seinem schnellen Pferd niemand einholen konnte, erfüllte ihn mit neuer Zuversicht.
Bis zu dem Augenblick, da er die Häuser von Silverrock hinter sich gelassen hatte und in der Finsternis um eine Gruppe mannshoher Wacholdersträucher bog …
Er konnte gerade noch feststellen, dass er sich plötzlich zwischen einem halben Dutzend Reiter befand, deren Konturen von der Nacht verwischt wurden – dann traf ein harter Schlag seinen Hinterkopf.
Seine Hände lösten sich von den Zügeln. Er merkte noch, dass er stürzte und aufgefangen wurde. Dann wusste er von nichts mehr.
*
Goldenes Sonnenlicht fiel durch die enge Fensterluke auf Tontos Gesicht und weckte ihn. Er setzte sich auf und stellte fest, dass er auf einem einfachen Feldbett gelegen hatte. Seine Bewusstlosigkeit musste in tiefen Schlaf übergegangen sein, und das war bei den vielen Strapazen, die hinter ihm lagen, nicht verwunderlich.
Jetzt fühlte er sich frisch und ausgeruht und voll neuer Kraft. Forschend schaute er sich um. Der Raum war klein. Außer dem Bett befanden sich noch ein Schrank, ein Tisch und ein Stuhl hier drinnen. Zu Tontos Verwunderung hing sein Revolvergurt über der Stuhllehne.
Er erhob sich rasch und schnallte die Waffe um. Er stellte fest, dass die Trommel geladen war. Dann wurde er sich des Duftes von heißem Kaffee bewusst. Er sah, dass ein Tablett neben der Tür abgestellt war. Eine Kanne, eine Tasse und ein Teller mit Pfannkuchen befanden sich darauf. Sofort verspürte er nagenden Hunger. Er trug das Tablett zum Tisch und frühstückte ausgiebig.
Durch das Fenster sah er graue Felsränder, über denen sich der seidig blaue Morgenhimmel spannte. Irgendwo draußen schnaubten Pferde. Sonst war kein Laut zu hören. Tonto hatte keine Ahnung, wo er sich befand.
Er hatte die letzte Tasse noch nicht ganz geleert, da wurde an der Außenseite der Tür ein Riegel weggeschoben. Gleich darauf schwang die Tür knarrend auf, und ein Mann, den Tonto nie zuvor gesehen hatte, trat über die Schwelle.
Er war groß, hager, ganz in Schwarz gekleidet und besaß ein langes knochiges Gesicht. Seine Augen darin wirkten wie Schlitze. Er blieb in der Lichtflut, die hinter ihm hereinbrandete, stehen und musterte Tonto.
Tonto erhob sich langsam. Ein kaltes Lächeln spielte um seine Lippen, als er sagte: „Sparen wir uns lange Begrüßungsworte! Sagen Sie mir, wer Sie sind, wo ich bin und was Sie von mir wollen!“
Die Miene des Schwarzgekleideten blieb völlig unbewegt.
„Immer langsam, Tonto! Eins nach dem anderen! – Mein Name ist Sol Denrick. Ich bin Vormann bei Gray Baxter, wenn Ihnen das etwas sagt.“
„Allerdings! Über die Baxter Bande habe ich in Silverrock bereits gehört, nichts Gutes allerdings!“
Denrick verzog verächtlich die Mundwinkel.
„Mich kümmert nicht, was Monroes Leute quatschen! Well, Tonto, Sie befinden sich mitten in unserem Camp! Hoffentlich wissen Sie die Ehre zu schätzen! Monroe würde eine Menge dafür geben, seinen Fuß einmal auf dieses Gebiet zu setzen – an der Spitze seiner Revolvergarde, wohlgemerkt!“
„Ehre?“, dehnte Tonto. „Wo liegt die Ehre, wenn man mich einfach überfällt, niederschlägt und dann hierher schleppt?“
Denrick schaute ihn mit schiefgelegtem Kopf an.
„Tonto, haben Sie noch nicht darüber nachgedacht, warum ich mit meinen Reitern gestern Abend diesen Feuerzauber in Silverrock veranstaltet habe? Ich bin kein Mann, der einfach aus Freude am Schießen so etwas unternimmt! Wenn ich meinen Leuten den Befehl gebe, die Eisen herauszuholen, muss schon ein triftiger Grund dahinterstecken!“
„Sagen Sie bloß nicht, dieser Grund sei ich gewesen!“
„Doch, Tonto! – Meinen Sie etwa, wir hätten es auf die Kasse im Frontier Palace oder auf den Krimskrams im Store abgesehen? Mit solchen Kleinigkeiten geben wir uns nicht ab!“
„Dann spannen Sie mich nicht auf die Folter und rücken Sie endlich mit der Sprache heraus!“
„Das hat sich der Boss selber vorbehalten! Kommen Sie, Tonto!“
„Zu Baxter?“
„Ja, zu Gray Baxter!“
Sol Denrick drehte sich einfach um und ging davon. Tonto zuckte die Achseln, rückte mit einer mechanischen Bewegung seinen Revolvergurt zurecht und folgte ihm.
Draußen schaute er sich wachsam um. Ein halbes Dutzend einfacher Blockhütten befand sich auf der grasbewachsenen Sohle einer Schlucht. Links und rechts wuchteten senkrechte glatte Felswände ins Himmelsblau auf. Oben waren vereinzelt die Konturen windzerzauster Fichten zu erkennen. Der einzige Zugang zu dieser Schlucht bestand in einem engen Felsspalt, den ein einziger Mann gegen eine ganze Schwadron verteidigen konnte. Ein idealer Platz für das Bandenversteck!
Vor den Blockhäusern lungerten sehnige hartgesichtige Männer, rauchten, verzehrten den Rest ihres Frühstücks und plauderten. Die Unterhaltung verstummte, als Denrick mit Tonto vorbeikam. Wachsame Augen musterten den jungen bärtigen Mann von Kopf bis Fuß, Augen, die es offensichtlich verstanden, einen Mann einzuschätzen. Keiner sagte ein. Wort.
Denrick führte Tonto am Korral entlang. Etwas abgesondert von den struppigen Cowboygäulen entdeckte Tonto seinen Kentucky Fuchs. Das Pferd wieherte leise, als es ihn bemerkte, und kam im Galopp auf den Zaun zu.
Denrick langte an der Tür eines Blockhauses an und schaute über die Schulter.
„Kommen Sie herein! Der Boss wartet!“
Jeder Nerv in Tonto war angespannt, als er hinter dem Banditen Vormann das Haus betrat. Drinnen saß ein großer kräftiger Mann in einem Lehnstuhl neben dem steingemauerten kalten Kamin. Sein Haar war eisgrau, und die durchdringenden Augen in dem von Falten zerfurchten Gesicht hatten die Farbe von Schießpulver.
Gray Baxter trug einfache Reiterkleidung wie seine Leute. Sein linkes Bein war in seltsam unbequemer Haltung ausgestreckt. Tonto begriff, dass es steif sein musste. Er blieb stehen, während Denrick hinter ihm die Tür schloss.
„Das ist Tonto, Boss!“, sagte Denrick knapp.
Baxter blickte Tonto eine Zeitlang schweigend an. Ausdruckslos erwiderte Tonto seinen Blick. Aber dabei spürte er ganz deutlich den Strom von Härte und Entschlossenheit, der von diesem großen grauhaarigen Mann ausstrahlte.
Schließlich verzogen sich Baxters schmale Lippen zu einem kurzen Lächeln.
„Hallo, Tonto! Nehmen Sie doch Platz!“
„Ich denke“, erwiderte Tonto kalt, „was Sie mir zu sagen haben, dauert nicht so lange, dass ich es nicht im Stehen ab warten könnte.“
Baxter runzelte leicht die Stirn.
„Missverstehen Sie mich nicht, Tonto! Ich betrachte Sie nicht als Feind!“
„Wie bezeichnen Sie dann die Art, in der ich hierher gebracht wurde?“
Sol Denrick mischte sich ein: „Wir hatten es eilig gestern Nacht! Schließlich mussten wir Monroes Verfolgung befürchten. Also gab ich den Befehl, Ihnen eins über den Schädel zu hauen, um die Sache vorerst zu vereinfachen.“
„Sie sollten es ihm nicht nachtragen!“, fügte Baxter lächelnd hinzu.
„Lassen wir das!“, winkte Tonto ab. „Ihre Leute haben in der Stadt nur eine Schießerei veranstaltet, um mir die Flucht zu ermöglichen. Warum, Baxter?“
„Weil ich in Ihnen einen guten Verbündeten sehe!“, antwortete Gray Baxter geradewegs.
„Das habe ich geahnt!“, sagte Tonto trocken.
„Wissen Sie auch, dass Monroe mir bereits anbot, für ihn zu reiten?“
„Sie haben sich gegen ihn entschieden, und das allein zählt für uns! Einer meiner Leute war in der Stadt und hat alles von Anfang an beobachtet.“
„Und Sie rechnen nicht damit, dass ich mich auch gegen Sie entscheiden würde?“
„Das wäre unklug!“, entgegnete Baxter beherrscht. „Hier in den Elk Mountains gibt es nur zwei Parteien – Elmer Monroe und mich! Kein Mann kann sich zwischen den Fronten halten!“
„Zum Teufel, Tonto!“, knurrte Denrick seitlich hinter Tonto.
„Komplizieren Sie doch nicht alles! Wofür haben wir Sie denn hierhergeschleppt? Soll das umsonst gewesen sein? Mann, Sie können gar keine bessere Chance bekommen, als in unserer Crew auf genommen zu werden!“
„Ich bin anderer Ansicht!“
Baxter legte beide Hände auf die Seitenlehnen seines Stuhles und beugte sich etwas vor. Sein Blick aus den grauen Augen schien Tonto zu durchbohren. „Und warum?“, fragte er hart.
Tonto Jim Trafford stand wie aus Stein gehauen.
„Weil ich niemals mit Banditen gemeinsame Sache mache!“, antwortete er fest.
Baxters Kinnladen verkrampften sich. Ein Ausdruck von Wildheit huschte über sein zerfurchtes Gesicht.
„Sagen Sie das nicht noch einmal, Tonto!“, presste er leise hervor. „Ich warne Sie! Wir sind keine Banditen!“
„Ein Mann, der alle Trümpfe in der Hand hat“, erwiderte Tonto beißend, „sollte sich nicht scheuen, die Wahrheit zu sagen! Warum lügen Sie, Baxter?“
„Lügen?“, schnaufte Baxter. „Wissen Sie, Tonto, dass ich einem anderen Mann für dieses Wort eine Kugel in den Kopf jagen würde? Haben Sie nicht gehört, was ich sagte? Wir sind keine Banditen!“
„Und wie nennen Sie es, wenn Ihre Bande Monroes Silbertransporte überfällt und gnadenlos jeden Mann niedermetzelt, der sich ihr in den Weg stellt? Welche Bezeichnung haben Sie dafür?“
*
Baxters Hände krampften sich um die Stuhllehnen. Seine grauen Augen blitzten.
„Wenn meine Beine gesund wären“, stieß er hervor, „würde ich jetzt aufstehen und Ihnen die Faust ins Gesicht schmettern! Zum Teufel! Ich weiß nicht, welche Lügen Elmer Monroe in Silverrock über mich und meine Leute verbreitet, aber …“
„Was ich sagte, ist die Wahrheit!“ ,unterbrach ihn Tonto eisig. „Ich weiß es nicht von Monroe!“
„Was? Was sagen Sie da?“
Eine Ader trat an Gray Baxters Stirn hervor.
„Tonto, Sie müssen sich irren! Meine Leute haben keinen von Monroes Frachttransporten überfallen – obwohl wir allen Grund dazu hätten! Ich bin nicht der Boss einer Verbrecherbande! Ich bin Monroes Feind, ja, das gebe ich ohne weiteres zu! Und ich habe Grund für diese Feindschaft! Ich werde mit Monroe abrechnen, das steht fest! Aber auf andere Weise, als es ein Bandit tun würde!“
Er atmete schwer. Schweiß erschien auf seiner Stirn.
„Ich will Monroe haben, verstehen Sie? Nicht seine Leute! Und auch nicht das Silber! Ich will ihn allein! Ich habe alles für die Stunde der Vergeltung vorbereitet! Sie wird nicht mehr lange auf sich warten lassen!“
Tonto hatte Baxter aufmerksam betrachtet.
„Sie behaupten also, von den Überfällen auf die Silbertransporte nichts zu wissen, Baxter?“
Denrick sagte rasch: „Schweifen wir nicht vom Thema ab! Es dreht sich doch darum, ob Sie mit uns gegen Monroe kämpfen wollen, Tonto! Um nichts anderes! Monroe ist unser Feind und auch Ihrer! Es ist also …“
„Halt, Denrick! Wir sind nicht vom Thema abgekommen! Wir können nicht weiterreden, ehe nicht diese Sache mit den Raubüberfällen geklärt ist!“
„Er hat recht!“ murmelte Baxter gepresst. Sein durchdringender Blick heftete sich auf Sol Denrick.
„Sol! Hast du mir dazu etwas zu sagen? Du warst während der letzten Wochen öfter mit der ganzen Mannschaft außerhalb unseres Camps unterwegs! Hat das … hat das mit diesen Dingen zu tun, die Tonto erwähnte?“
Denrick senkte den Kopf. Sein knochiges langes Gesicht wurde verkniffen.
„Sol, du hattest bisher mein ganzes Vertrauen!“ sagte Baxter rau. „Ich verlange eine Antwort von dir!“
Denrick blickte hoch. Seine Augen waren stechend.
„Zum Satan!“, knurrte er. „Ja, er hat recht! Wir haben einige Transporte überfallen! Warum auch nicht, Boss? Die Leute hatten die lange Warterei satt! Der Gedanke, dass jede Woche Tausende von Dollars in Silber durch die Berge befördert werden, hat uns keine Ruhe gelassen! Zum Teufel, es ist doch ganz in Ordnung, dass wir Monroe auf diese Weise bereits eingeheizt haben! Sind wir nicht da, um gegen ihn zu kämpfen?“
Baxter ließ sich langsam in seinen Stuhl zurücksinken. Einen Moment wirkte sein hartes Gesicht erschöpft.
„Ja, wir sind da, um gegen ihn zu kämpfen!“ murmelte er heiser. „Aber nicht so! Nicht auf diese Banditenart! Sol, ich …“
„Zum Henker!“, knirschte Denrick.
„Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wir haben insgesamt Silber im Wert von vierzigtausend Dollar erbeutet! Vierzigtausend, hören Sie, Boss? Das ist nicht zu verachten! Sie können uns doch nicht vorwerfen …“
„Genug, Sol!“, ächzte Baxter. Sein Gesicht hatte sich fahl gefärbt. „Hör auf damit!“
Denrick zuckte die Achsel und schwieg.
„Nun?“, sagte Tonto ruhig. „Jetzt wissen Sie Bescheid! Verlangen Sie immer noch, dass ich an der Seite Ihrer Leute kämpfe?“
„Sie haben gar keine andere Wahl, Tonto!“, stieß Denrick finster hervor. „Sie sind der einzige Mensch außerhalb unserer Crew, der jetzt unser Versteck kennt. Meinen Sie denn, wir würden Sie einfach reiten lassen, wenn Sie nein sagen?“
Während dieser Worte zog er blitzschnell seinen Colt und richtete die Mündung auf Tonto.
*
„Sol!“, rief Baxter scharf. „Steck sofort dein Eisen weg!“
„Nein, Boss, tut mir leid, diesmal höre ich nicht auf Ihren Befehl! Ich werde den Finger erst vom Abzug nehmen, wenn dieser Mann sein Wort gegeben hat, in unserer Crew zu reiten!“
„Darauf können Sie lange warten, Denrick!“, sagte Tonto schroff.
„Dann werden Sie sterben!“, erklärte Denrick schneidend.
Baxters Gesicht färbte sich dunkel vor Anstrengung, als er sich hochstemmte. Mit beiden Händen musste er sich am Lehnstuhl festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Schweiß rann über sein Gesicht.
„Das wirst du nicht tun, Sol! Du wirst vor meinen Augen keinen Mord begehen! Vergiss nicht, ich bin der Boss!“
„Wirklich, Baxter?“, fragte Denrick lauernd. „Wer führt denn in Wirklichkeit die Mannschaft, heh? Sie können ja nicht einmal auf ein Pferd steigen!“
„Wenn ich es könnte“, presste Baxter wild hervor, „wäre das alles nicht geschehen!“
„Es ist aber geschehen, und Sie können es nicht ändern! Keine Angst, Baxter, ich will Ihnen nicht die Führung entreißen! Sie haben alles eingefädelt, Sie haben das Geld, um die Leute zu bezahlen! Ich denke gar nicht daran, Ihnen die Gefolgschaft zu kündigen, denn ich brauche Sie, so wie Sie mich brauchen! Nur gemeinsam können wir Monroe und seine Revolverschwinger besiegen, und das wollen wir doch! Wenn auch jeder aus verschiedenem Grund! Sie, um eine alte Rechnung mit Monroe zu begleichen, ich, um Beute zu machen!“
„Das also ist es!“, murmelte Gray Baxter bitter. „Jetzt also deckst du deine Karten auf, Sol!“
„Einmal müssen Sie ja Bescheid wissen, nicht wahr?“ Der knochige schwarzgekleidete Desperado zuckte kalt die Schultern.
„Ja, es war das Silber, das mich von Anfang an auf Ihre Seite brachte, mich und die anderen! Glauben Sie nur nicht, Baxter, ein einziger unter Ihren Leuten würde sich um Ihren persönlichen Kampf kümmern! Das Silber ist es, an das die Leute denken! Das Silber, das wir aus Monroes Minen holen können!“
Baxter ließ sich in den Stuhl zurückfallen und saß so reglos, als habe die Lähmung seines linken Beines auf seinen ganzen Körper übergegriffen. Blicklos starrte er vor sich hin.
„Haben Sie gehört, Baxter?“, schnaufte Denrick, den Colt unverwandt auf Tonto gerichtet. „Gefällt es Ihnen nicht, wie? Ich kann es nicht ändern! Sie müssen sich damit abfinden! Oder wollen Sie plötzlich aufgeben? Wollen Sie alles wegwerfen, was Sie angefangen haben? Das werden Sie doch nicht tun, oder? Sie wollen doch Ihren Kampf mit Monroe! Und Sie bekommen ihn durch uns! Also?“
Baxter atmete tief ein.
„Deine Rechnung geht auf, Sol! Yeah, mein Hass gegen Elmer Monroe ist wirklich groß genug, um weiter mit dir zusammenzuarbeiten!“
Zum ersten Mal zeigte Denricks langes Gesicht ein Grinsen.
„Dann wäre also alles geklärt! Jetzt bist du an der Reihe, Tonto! Hast du es dir inzwischen überlegt?“
„Wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch so!“
„Ein Mann mit Grundsätzen, wie?“, knurrte Denrick höhnisch. „Möchte nur wissen, was dir in der Hölle noch helfen wird!“
Es knackte metallen, als er den Revolverhammer spannte.
Baxter rief: „Wenn du abdrückst, Sol, stirbt er nicht allein!“
Er hielt wie durch Zauberei einen langläufigen Navy Colt in der rechten Faust. Die Mündung zielte genau auf Denricks Stirn. Der Bandit verfärbte sich.
„Boss, zum Geier, das …“
„Das ist kein Bluff, Sol!“, erklärte Baxter hart.
In Denricks knochigem Gesicht arbeitete es.
„Haben Sie nicht gehört, dass er es ablehnte, für uns zu reiten?“
„Das ist kein Grund, ihn umzubringen!“
„Wollen Sie ihn einfach reiten lassen? Mit dem Wissen, wo unser Versteck liegt?“
„Er wird es Monroe nicht verraten, davon bin ich überzeugt!“
„Wer garantiert dafür? Sie kennen doch Monroe! Wenn Monroe es will, bringt er den härtesten Mann zum Sprechen! Nein, Baxter, nein, dieses Risiko gehe ich nicht ein! Haben Sie nicht selbst gesagt, dass wir bald zuschlagen? Wollen Sie jetzt zum Schluss noch einen Fehler begehen? Wenn Sie mich und die Mannschaft nicht verlieren wollen …“
„Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Sol!“, sagte Baxter rasch. „Wir können ihn gefangen im Camp halten, bis alles vorbei ist!“
„Diesen Kerl? Wieder ein Risiko, das ich nicht eingehen will! Boss, ich habe ihn in der Stadt kämpfen gesehen! Er ist wie ein Panther, jawohl! Nein, ich bin erst beruhigt, wenn er eine Kugel im Kopf hat und …“
„Dann vergiss nur mein Schießeisen nicht, Sol! Du hast lange genug auf eigene Faust gehandelt! Jetzt führe ich wieder das Kommando – wenn es sein muss mit rauchendem Colt!“
Sol Denrick schluckte würgend. Zorn und Besorgnis vermischten sich in seinen engen Augen.
„So weit gehen Sie nicht, Baxter!“
„Dann versuche es doch!“, knurrte der Grauhaarige grimmig. „Los! Du brauchst nur auf ihn zu schießen, Sol, dann erfährst du sofort, wie weit ich gehe!“
Denrick wand sich.
„Baxter, ich …“
Draußen trommelte plötzlich Hufschlag. Stimmen gellten durcheinander.
Mit einem langen Schritt war Denrick dicht hinter Tonto und riss ihm mit einer blitzschnellen Bewegung den Revolver aus der Halfter. Er schleuderte die Waffe in die Blockhausecke, wandte sich dann halb um und zog die Tür auf.
Draußen kam eben ein schweißbedecktes Pferd zum Stehen. Ein schnurrbärtiger Mann mit eckigem Kinn sprang aus dem Sattel und kam auf die Tür zugerannt.
„Hugh Boynton!“, rief Denrick überrascht.
„Menschenskind, Hugh, was ist los?“
Der Schnurrbärtige langte auf der Schwelle an und lehnte sich schweratmend gegen den Türrahmen. Sein Gesicht war rot und schweißnass.
Denrick rüttelte ihn an den Schultern.
„Hugh! Los, heraus mit der Sprache, Mann!“
Boyntons Atem beruhigte sich allmählich.
„Sie kommen direkt auf die Schlucht zu!“, stieß er hervor und wischte sich fahrig über die Stirn. „Direkt, sage ich euch! Noch eine Stunde, und sie sind da!“
Hinter ihm drängten die anderen Mitglieder der Baxter Bande heran. Das Stimmengewirr verstummte jäh, als Boynton geendet hatte.
Denrick biss sich auf die Unterlippe und starrte Hugh Boynton betroffen an. Den Colt hatte er längst sinken lassen. Er schien Tonto vergessen zu haben.
Tonto spähte zu seinem Revolver in der Zimmerecke. Da sagte Baxter leise:
„Bleiben Sie ruhig stehen, dann ist alles in Ordnung!“ Sein 45er bewegte sich leicht.
„Hugh, nimm dich zusammen!“, rief Baxter dann. „Wer ist nach hier unterwegs? Monroe mit seinen Leuten?“
„Das nicht!“, schüttelte der Schnurrbärtige den Kopf.
„Es ist dieser junge schwarzhaarige Kerl, der uns neulich bei dem Überfall …“ Er verstummte, warf Denrick einen schrägen Blick zu. und hustete verlegen.
„Nur zu, Hugh!“, forderte Baxter scharf. „Ich weiß Bescheid über die Überfälle!“
Boynton räusperte sich.
„Nun ja! Es ist also dieser Kerl, der uns neulich entkam. Ich habe seinen Namen einmal in Silverrock aufgeschnappt. Milburn, Cleve Milburn heißt er.“
„Ist er allein?“, fragte Denrick hastig, der sich wieder gefangen hatte.
„Seine Schwester ist bei ihm, diese rothaarige Tänzerin aus dem Frontier Palace!“
Tonto stockte der Atem, als er das hörte.
Denricks Miene wurde verkniffen. „Nur die beiden? Das wird nicht schwierig sein!“
„Aber wir müssen uns beeilen!“, drängte Boynton. „Sonst stoßen sie geradewegs auf die Schlucht!“
„Habt ihr alles gehört?“, rief Denrick den Desperados zu.
„Worauf wartet ihr dann noch? Los, zu den Gäulen, Leute!“
Er warf Baxter einen schnellen scharfen Blick zu.
„Es ist Ihnen doch klar, dass wir die Milburn Geschwister abfangen müssen, nicht wahr?“
Gray Baxters Lippen waren fest zusammengepresst. Ein Schimmer von Bitterkeit glänzte in seinen harten grauen Augen. Er sagte kein Wort.
Denrick zog Boynton ungeduldig ins Freie. Drüben zerrten die anderen Banditen bereits die Gäule aus dem weiträumigen Korral und sattelten.
„Hör zu, Hugh!“, raunte Denrick dem Schnurrbärtigen zu. „Du kommst nicht mit! Du bleibst im Camp und kümmerst dich um Tonto! Dieser Dummkopf will sich nicht mit uns verbünden, und Baxter will ihn schonen! Stell dir das vor, Hugh!“
„Hm, und was soll ich …“
„Ich will es dir sagen, Hugh! Tonto muss sterben! Kann ich mich auf dich verlassen, Hugh?“
„Das wird schwierig sein, wenn Baxter …“
„Du bekommst eine Sonderprämie von dem Silber, Hugh!“
Der schnurrbärtige Bandit grinste breit.
„Dann brauchst du dir allerdings keine Sorgen mehr zu machen, Sol! Wenn du zurückkommst, wird dein Auftrag erledigt sein!“
Denrick klopfte ihm zustimmend auf die Schulter und eilte zum Korral hinüber, wo ihm einer der Banditen bereits sein gesatteltes Pferd entgegenführte …
*
Cleve Milburn zügelte seinen Braunen und wandte sich seiner Schwester zu.
„Es ist sinnlos, dass du mir nachgeritten bist, Sally! Kehre jetzt um, solange du den Weg zurück zur Stadt nicht verlieren kannst!“
Sie schaute ihn eindringlich an.
„Nicht ohne dich, Cleve!“, erklärte sie entschieden.
Sie trug diesmal eine ausgeschnittene, knapp sitzende Bluse, einen geteilten Reitrock und halbhohe, mit Stickereien verzierte Reitstiefel. Das kupferrote Haar fiel locker und seidig auf ihren Rücken hinab, im Nacken von einem blauen Band zusammengehalten. Die Art, wie Sally Milburn im Sattel saß, verriet die geübte Reiterin. In dieser Kleidung und auf dem Rücken des Pferdes wirkte sie mädchenhafter. Frische strahlte von ihr aus.
Cleves Miene war angespannt, als er den Kopf schüttelte.
„Du musst vernünftig sein, Sally! Mach dir doch endlich klar, dass ich kein kleiner Junge mehr bin, auf den du auf passen musst.“
„Ich habe mir etwas anderes klargemacht“, erwiderte sie herb. „Wir befinden uns mitten in dem Gebiet, in dem das versteckte Camp der Baxter Bande liegen muss.“
Ihr Blick glitt besorgt über die bewaldeten Berghänge und die zerklüfteten Felswände links und rechts. Hoch droben im Blau des Firmaments zog ein Geier seine weiten lautlosen Kreise.
„Das brauchst du mir nicht zu sagen, Sally“, murmelte Cleve unruhig. „Deshalb bin ich ja hier.“
„Was sagst du?“ Sie beugte sich vor, um ihm besser ins Gesicht sehen zu können.
Er wich ihrem Blick aus und nickte. „Du hast schon richtig gehört, Sally! Ich bin unterwegs, um Baxters Versteck aufzuspüren!“
„Cleve! Was ist in dich gefahren!“
„Monroe war gestern bei mir“, erklärte ihr Bruder leise. „Er drohte, meinen Steckbrief dem Sheriff von Gunnison zu übergeben. Nur zwei Chancen ließ er mir. Das Bandenversteck zu finden – oder einen Mann namens Jim Trafford unschädlich zu machen.“
Sallys schmale Hände ballten sich zu kleinen Fäusten. Zorn sprühte in ihren grünen Augen auf.
„Monroe!“, flüsterte sie. „Dieser Schuft!“
„Um Himmels willen, Sally, sprich nicht so!“
„Du hast Angst vor ihm, Cleve, ich weiß!“
„Ich … ich bin machtlos gegen ihn, Sally! Er hat mich in der Hand!“
Sie schaute starr geradeaus. „Ich wollte, wir könnten dieses Land verlassen.“
„Dann würde man mich sofort wie ein Stück Wild jagen. Es ist unmöglich, Sally. Und deshalb gibt es auch jetzt keine Umkehr für mich. Ich muss reiten, ich muss das Camp der Baxter Bande finden.“
„Und dabei wirst du dein Leben verlieren!“, sagte die junge Frau heftig.
Er zuckte unwillkürlich zusammen. „Ich werde vorsichtig sein. Und für dich ist es wirklich besser, wenn du umkehrst.“
„Ich denke nicht daran! Ich begleite dich!“
„Sally …“
In diesem Augenblick krachte ein Schuss. Die Kugel zischte niedrig über die beiden Geschwister weg.
Cleves Gesicht wurde kreidebleich. Sie rissen gleichzeitig ihre Pferde herum. Hinter einer Waldzunge, die von einem Berghang ins Tal vorstieß, preschte ein Reiterrudel hervor, drahtige Gestalten auf struppigen schnellen Gäulen.
Wieder blitzte ein Mündungsfeuer. Die Kugel fetzte durch das Laubwerk eines Eichendickichtes. Die Reiter fegten in donnerndem Galopp auf die Milburns zu.
„Die Baxter Crew!“, schrie Cleve schrill.
„Sally, schnell! Weg von hier!“
Sie spornten ihre Pferde zum Galopp an und duckten sich tief auf die Pferdehälse.
Hinter ihnen krachte eine ganze Serie von Schüssen. Dazu hämmerten die Hufe der Verfolger wie rasend. Cleve und Sally ritten den Weg, den sie gekommen waren. Der Reitwind ließ Sallys rotes langes Haar flattern. Cleve blickte immer wieder zurück, das bleiche Gesicht vor Anspannung verzerrt.
Sie hatten etwa eine halbe Meile zurückgelegt, da tauchten zwischen riesigen Felstürmen vor ihnen weitere Reiter auf. In breit auseinandergezogener Linie starrten sie reglos den Herangaloppierenden entgegen. Über den Mähnen ihrer Pferde blinkten Gewehr und Revolverläufe.
Cleve zerrte so heftig an den Zügeln, dass sein Brauner schrill wiehernd in die Hanken knickte. Sand und Gestein spritzten unter den bremsenden Hufen hoch. Beinahe wäre das Pferd gestürzt.
„Eine Falle!“, gellte Cleve. „Um Himmels willen, eine Falle!“
In diesen Sekunden waren die Minuten des Silbertransport Überfalls wieder für ihn lebendig. Damals war es ähnlich gewesen, da hatten die Banditen sie ebenfalls in die Zange genommen, und nur er war mit knapper Not entwischt. Zu deutlich erinnerte er sich daran, wie seine Gefährten erbarmungslos erschossen worden waren.
Mit bebender Hand riss er seinen Revolver heraus.
Neben ihm hatte Sally ihr Tier gezügelt. Obwohl auch in ihren Augen Angst flackerte, zwang sie sich dennoch zur Ruhe und ließ hastig ihren Blick, nach einem Ausweg suchend, über die Felshänge zu beiden Seiten gleiten.
Vorne rief ein Bandit seinen Kumpanen einen heiseren Befehl zu. Sie hoben ohne Eile ihre Waffen. Hinten prasselten die wilden Hufschläge der Verfolger heran.
Cleve drehte sich halb im Sattel. In seinem schmalen blassen Gesicht zuckte es, als er den Revolver hochschwang.
„Nicht, Cleve!“, schrie ihm seine Schwester zu.
Sie deutete mit ausgestreckter Hand nach rechts.
„Da hinauf! Schnell, wir dürfen keinen Augenblick verlieren, Cleve!“
Sie hatte eine Rinne zwischen Geröll und Felsen entdeckt, in der die Gäule den steilen Hang hinaufklettern konnten. Sofort trieb sie ihre Stute darauf zu. Cleve folgte ihr.
Vorne krachten jetzt Schüsse. Die Kugeln zerschnitten jaulend die Luft. Die Gäule der Milburn Geschwister erreichten den Fuß des steil auf schwingenden Felshanges und begannen in der gewundenen Rinne auf kantigem Gestein nach oben zu klettern.
Bei den Felstürmen schallten Flüche und Wutschreie. Die Banditen trieben ihre Pferde voran.
„Sieh nicht zurück, Cleve!“, rief Sally keuchend ihrem jüngeren Bruder zu. „Immer weiter, weiter!“
Die Pferde schnaubten. Ihre Köpfe bewegten sich nickend auf und ab. Unter den beschlagenen Hufen löste sich lockeres Gestein und polterte in die Tiefe.
Unten hatten sich die beiden Bandengruppen zusammengeschlossen. Revolver und Gewehre, blitzten pausenlos, und das Echo der Detonationen rollte zwischen den Bergen. Die Windungen der Felsrinne und die Gesteinsklötze schützten einigermaßen vor den pfeifenden Geschossen. Unablässig trieben die Milburn Geschwister ihre Gäule weiter voran.
Durch das helle Klappern der Hufe ihrer Pferde hörten sie, wie sich die Desperados anschickten, ebenfalls den Hang heraufzukommen.
Mit schweißüberströmten Gesichtern erreichten Sally und Cleve endlich das Ende des Hanges. Ein kahles, mit einigen Felsklötzen übersätes Plateau lag vor ihnen. Es wurde im Halbkreis von senkrecht ansteigenden Felsmauern umschlossen. Nirgends gab es eine Lücke oder einen Aufstieg, wo man das Plateau hätte verlassen können – nur diese Felsrinne, aus der sie eben gekommen waren.
Die Gäule ließen erschöpft die Köpfe hängen. Schweratmend schaute sich Cleve Milburn um. Dann krächzte er heiser: „Wir sitzen fest! Schwester, es war alles umsonst!“
Sallys Augen waren sekundenlang weit vor Erschrecken. Dann presste sie entschlossen die roten vollen Lippen zusammen und ließ sich aus dem Sattel gleiten. Sie zog das Winchester Gewehr aus dem Scabbard und kauerte sich hinter einen rissigen Felsblock gleich oberhalb der Felsrinne.
„Noch haben sie uns nicht!“, sagte sie leise in Cleves Richtung.
Ihr Bruder starrte sie wie benommen an. Dann schüttelte er den Kopf.
„Was bist du nur für eine Frau, Sally!“ Er stieg ebenfalls ab, führte die Pferde quer über das Plateau zu den Felswänden und kam dann, den Revolver in der Faust, zu Sally zurück.
Unten in der Aufstiegsrinne polterten Steine. Ein Pferdekopf erschien hinter einer Biegung, gleich darauf hob sich der Oberkörper eines Reiters vom hellgrauen Gestein ab.
Sally riegelte schnell eine Patrone in den Gewehrlauf und drückte ab. Gesteinssplitter flogen durch die Luft, und der Bandit riss eilig seinen Gaul hinter die Krümmung zurück. Flüche schallten herauf. Sally repetierte.
Unten zwischen den Felsen peitschte es jetzt in schneller Reihenfolge. Der Felsblock, hinter dem die Milburns kauerten, wurde von Kugeln umschwirrt.
Dann verstummte das Feuern. Pferde schnaubten, Gestein klirrte.
„Sie sitzen ab!“ flüsterte Cleve nervös.
„Sie versuchen es bestimmt zu Fuß, und dann können wir sie nicht aufhalten.“
Die junge Frau antwortete nicht und starrte unverwandt den Hang hinab. Von unten rief eine harte Männerstimme: „In einer halben Stunde haben wir euch! Ich hoffe, ihr habt euch bis dahin ausreichend aufs Sterben vorbereitet!“
Raues Gelächter folgte, dann war es wieder still.
So still, dass beide das Pochen ihres Herzens zu hören glaubten.
*
Tonto schaute Gray Baxter ab wartend an. Der Grauhaarige saß reglos in seinem Lehnstuhl. Ein nachdenkliches Leuchten stand in seinen Augen. Aber seine Coltmündung war noch immer auf Tonto gerichtet.
„Ich habe Ihnen vorhin das Leben gerettet, Tonto!“, sagte er langsam.
„Erwarten Sie, dass ich deshalb aus Dankbarkeit in Ihre Mannschaft eintrete?“, fragte der junge Mann beißend.
„Es wäre das Beste für uns beide!“
Tonto hob flüchtig die kräftigen Schultern.
„Ich muss Sie enttäuschen, Baxter!“
Hinter ihm kam der schnurrbärtige Hugh Boynton durch die offene Tür herein. Die anderen Bandenmitglieder hatten inzwischen die versteckte Schlucht verlassen. Tiefe Stille herrschte draußen. Boynton ging an der Balkenwand entlang, hob Tontos Revolver auf und steckte ihn in seinen Hosenbund.
„Boss, was soll mit ihm geschehen?“, fragte er brummig.
Baxter ließ seinen schweren 45er langsam sinken. Seine Antwort war an Tonto gerichtet.
„Schade! Es tut mir leid, Tonto, aber Sie müssen mein Gefangener sein! Bis alles vorüber ist!“
„Ihr Kampf gegen Elmer Monroe?“
„Yeah!“ Die alte Härte legte sich über Gray Baxters zerfurchtes Gesicht.
„Wenn Sie nicht auf Beute aus sind wie Denrick“, sagte Tonto forschend, „warum dann dies alles?“
„Ein Mann wie Monroe hat viele Feinde!“, erklärte Baxter ausweichend. „Das ist durchaus logisch! Sein steiler Weg nach oben konnte eben nicht auf die sanfte Tour verlaufen! Well, ich bin eben einer seiner Feinde! Und die Rechnung, die ich ihm zu präsentieren habe, ist groß genug, um diesen Aufwand zu rechtfertigen!“
„Vorausgesetzt Sie siegen!“
„Vorausgesetzt!“, bestätigte Baxter. Seine Stimme wurde abweisend und kalt: „Das braucht nicht Ihre Sorge zu sein, Tonto! Hugh, bring ihn wieder in die Hütte zurück und sorge dafür, dass er nicht entkommen kann!“
„All right, Boss!“ Boynton zog seinen Colt und fasste Tonto hart am Arm. „Komm mit, Junge!“
Tonto biss die Zähne aufeinander. Ein wildes Sprühen lebte in seinen Augen auf. Jäh musste er wieder an die Milburn Geschwister denken, die irgendwo in den Elk Mountains unterwegs waren und auf die Denrick mit seinen Banditen Jagd machen wollte, um zu verhindern, dass das Baxter Camp entdeckt wurde.
Er erinnerte sich an die vergangene Nacht, als Sally ihm zur Flucht verholfen hatte, und er war nahe daran, sich gegen Boynton zu werfen und einen Ausbruch zu versuchen.
„Keine Schwierigkeiten, Tonto!“, sagte da Baxter scharf. „Ich möchte Sie nicht tot sehen!“
Die Coltmündung in seiner Faust war wieder hochgeruckt. Tonto entspannte sich.
„Gehen wir!“, murmelte er Boynton zu.
Sie traten ins goldene Sonnenlicht hinaus. Der Kentucky Fuchs stand an der Korralumzäunung und äugte zu ihnen herüber. Boynton stieß Tonto den Revolverlauf in den Rücken.
„Da hinüber!“
Er wies mit dem Kopf zu der Hütte, in der Tonto die Nacht verbracht hatte. Ihre Schritte knirschten. Der Druck von Boyntons Revolvermündung verschwand von Tontos Rücken. Kurz darauf erreichten sie die offene Hüttentür.
„Hinein mit dir, Freundchen!“, befahl der Bandit.
Tonto betrat den Raum und erwartete, dass Boynton hinter ihm die Tür versperren würde. Aber der schnurrbärtige Bandit kam ebenfalls in das Blockhaus herein.
Das Glitzern in seinen stechenden Augen machte Tonto schlagartig hellwach. Er glaubte den Hauch der tödlichen Gefahr plötzlich körperlich zu fühlen. Und jetzt erinnerte er sich auch wieder daran, dass Denrick draußen vor Baxters Hütte leise auf Boynton eingesprochen hatte. Eine dunkle Ahnung beschlich ihn. Seine Haltung spannte sich.
Wortlos zog Hugh Boynton Tontos Revolver aus seinem Hosenbund. Ohne Tonto aus den Augen zu lassen, klappte er die Trommel auf und ließ eine Patrone nach der anderen auf den Bretterboden fallen. Dann erschien ein grausames Grinsen auf den Lippen.
„Fang auf!“
Er warf die entladene Waffe Tonto zu. Unwillkürlich fing dieser den Revolver auf.
Kaum spürte er den glatten Kolben in der Faust, da begriff er, was der Verbrecher plante!
Es sollte so aussehen, als habe er den Banditen angegriffen und zu fliehen versucht. Es sollte eine Rechtfertigung für Boynton sein, wenn dieser im nächsten Augenblick Tonto niederschoss.
„Gut so!“, schnaufte der Desperado, und der Colt in seiner Faust ruckte.
Tonto handelte mit der pantherhaften Schnelligkeit, die ihn so gefährlich machte.
Er schleuderte sich zur Seite und warf gleichzeitig die ungeladene Waffe nach Boynton. Aus dem Colt des Banditen peitschte eine Stichflamme.
Die Kugel bohrte sich knirschend in die Balkenwand. Tontos Revolver schmetterte wuchtig gegen Boyntons Schulter und brachte ihn zum Taumeln. Die zweite Kugel des Verbrechers zischte ebenfalls an Tonto vorbei, und dann lag der junge Kämpfer aus Arizona bereits hinter dem umgekippten Tisch.
Gehetzt schaute er sich nach einem Gegenstand um, mit dem er sich zur Wehr setzen konnte. Es gab nichts! Und Boynton hielt noch immer den schussbereiten Colt in der Faust!
Der Bandit kam tiefer in den Raum herein.
„Das war nur ein Aufschub, du Ratte! Hier kommst du nicht lebend heraus!“
Die Dielen knarrten unter seinen Stiefeln. Ohne Eile schob er sich, den Oberkörper nach vorne geneigt, an den Tisch heran, hinter dem Tonto kauerte.
„Verkriech dich nur! Jetzt wird dir nichts mehr helfen!“
Tonto hatte beide Fäuste um die Tischbeine gekrampft. Mit einem jähen Ruck schnellte er hoch und schleuderte den Tisch gegen den Angreifer.
Boynton duckte sich blitzschnell zur Seite. Seine Kugel klatschte wuchtig in die dicke Holzplatte. Tonto wollte an ihm vorbei zur Tür, aber da war Boynton schon wieder herumgewirbelt und schlug die Waffe auf Tonto an.
„Lass fallen, Hugh!“, kam da eine schneidende Stimme von der offenen Tür.
Boyntons Gesicht verzerrte sich vor Erschrecken und Hass. Er warf sich herum und wollte abdrücken.
*
Da fuhr ihm die Kugel mitten in die Brust, stieß ihn in die Blockhütte zurück und warf ihn zu Boden. Boynton regte sich nicht mehr.
Den rauchenden 45er in der Rechten, stand Gray Baxter groß und breitschultrig auf der Schwelle. Die Anstrengung schien die Falten in seinem braunen Gesicht noch zu vertiefen. Der Sonnenschein verlieh seinem vollen grauen Haar einen silbernen Schimmer. Die Linke war so fest um einen knorrigen Krückstock gekrampft, dass die Knöchel weiß hervortraten.
„Das war knapp, Tonto, wie?“, sagte er heiser.
Tonto Jim Trafford schluckte trocken. Er wusste, dass er dem Tod kaum jemals zuvor näher gewesen war.
„Ich danke Ihnen, Baxter!“, brachte er rau hervor.
„Diese Worte habe ich schon lange nicht mehr gehört!“ Gray Baxter lächelte mühsam.
Er musste sich gegen den Türrahmen lehnen, um sich auf seinen kranken Beinen halten zu können. Schweiß glänzte auf seiner Stirn.
Dann wurde sein Blick wieder kalt.
„Aber vielleicht haben Sie mir zu früh gedankt, Tonto! Ich werde Sie jetzt nämlich hier einschließen!“
„Aber erst, nachdem ich Boynton hinausgeschafft habe, wie?“
„Einverstanden! Machen Sie schnell, Tonto!“
Es fiel ihm immer schwerer, sich auf den Füßen zu halten. Seine Stimme kratzte vor Anstrengung. Der Schweiß auf seiner Stirn wurde dichter.
Tonto bückte sich schweigend nach dem toten Desperado und zerrte ihn zur Schwelle. Baxter wollte aus dem Türrahmen ins Freie treten. Er wankte etwas. Tonto war dicht neben ihm und rammte heftig mit dem linken Fuß gegen den knorrigen Krückstock. Gleichzeitig ließ er Boynton los und schnellte schräg in die Höhe.
Baxter verlor das Gleichgewicht und versuchte sich an die Hüttenwand zu stützen. Dicht vor ihm kam Tonto empor. Baxters Coltlauf ruckte herum – und für einen schrecklichen Moment glaubte Tonto, die Kugel würde ihn mitten in den Kopf treffen.
Doch Baxter zögerte einen Moment mit dem Abdrücken, und das war Tontos große Chance!
Seine geballte Rechte landete knallhart an Gray Baxters Kinnwinkel.
Die Gestalt des großen Mannes erschlaffte jäh. Der Revolver fiel zu Boden, ohne dass die Kugel den Lauf verlassen hätte.
Tonto fing den Zusammenbrechenden auf und ließ ihn behutsam zu Boden gleiten. Er lehnte ihn mit dem Rücken gegen die Blockhauswand und legte ihm den Krückstock quer über die Knie. Benommen bewegte Baxter den Kopf.
„Tut mir leid!“ murmelte Tonto gepresst. „Ich musste es tun! Ich hatte wirklich keine andere Wahl!“
Dann drehte er sich ab und rannte zum Korral hinüber. Seine Gedanken waren schon wieder bei Sally und ihrem Bruder. Er wusste, wie viel Zeit verlorengegangen war, und die Sorge wühlte heiß in ihm.
Der Kentucky Fuchs war noch gesattelt, und im Scabbard steckte das Henry Gewehr. Als Tonto das Gatter öffnete, kam ihm Red Blizzard leise wiehernd entgegen.
Sekunden später saß Tonto im Sattel und trieb den Hengst auf den engen Schluchtausgang zu. Ein letzter Blick über die Schulter zeigte ihm, dass sich Gray Baxter bereits wieder hochgerichtet hatte. An die Balkenwand der Blockhütte gelehnt, spähte er, eine Hand über die Augen gelegt, hinter Tonto her …
*
Cleve Milburn fuhr mit der Zungenspitze nervös über die ausgetrockneten Lippen. Ein Flackern war in seinen dunklen Augen.
„Da! Da hinter dem Felsen hat sich etwas bewegt!“, flüsterte er.
Schon ruckte sein Revolver in die Höhe.
„Nicht, Cleve!“, raunte ihm Sally zu. „Denk daran, dass wir mit der Munition sparsam sein müssen.“
Ihr Bruder schluckte. Verzweifelt schaute er sich um.
„Sie erwischen uns!“, keuchte er. „Sie erwischen uns todsicher!“
„Du darfst nicht die Nerven verlieren, Cleve!“, sagte Sally fest. Ihre feingliedrigen Hände umklammerten den Schaft der Winchester 73.
Ihre roten Lippen zuckten. Sie war alles andere als ruhig. Aber sie wusste, dass die Panik ihren jungen Bruder überwältigen würde, wenn auch sie ihre Furcht offen zeigte. Ihr Herz hämmerte wie rasend, während auch sie die schattenhaften Bewegungen hinter dem Geröll und den Felsklötzen hangabwärts erkannte. Ihre Bluse war staub- und schweißverschmiert. Eine kupferfarbene Haarsträhne hing ihr in die Stirn.
„Na, ihr beiden da oben?“, tönte eine höhnische Stimme den Hang herauf. „Könnt ihr es noch erwarten? Immer mit der Ruhe! Bald sagen wir euch auf unsere Art, guten Tag!“
Zu Fuß besaßen die Banditen ausreichende Deckung, um das Plateau zu erreichen, ohne von den Kugeln der verzweifelten Verteidiger erwischt zu werden. Sie ließen sich Zeit, sie waren sich ihrer Sache vollkommen sicher. Ein gelegentliches Huschen, Kollern von Steinen, Schaben von Stoff gegen Fels – das war alles, was Sally und Cleve von den Gegnern wahrnahmen.
Cleve Milburn bewegte unbehaglich die Schultern.
„Sally! Wir müssen etwas unternehmen! Dieses Warten macht mich noch verrückt! Sally, wir müssen auf die Pferde! Wir müssen einen Durchbruch versuchen!“
Sie wusste, dass dieser Durchbruch im Kugelhagel der Verbrecher enden würde. Aber vielleicht war das wirklich besser, als noch länger untätig auf den sicheren Tod zu warten. Die Übermacht der Baxter Bande war einfach zu groß, dass sie sich eine noch so geringe Chance ausrechnen konnten! Und wie diese Desperados gezeigt hatten, schreckten sie keineswegs davor zurück, ihre Schießeisen auch auf eine Frau abzufeuern.
Sally seufzte. „Also gut, Cleve! Einverstanden! Holst du die Pferde?“
Er nickte stumm und wollte von dem Felsblock rückwärts das Plateau überqueren. Da tauchten die ersten beiden Angreifer zwischen einigen Felsklötzen seitlich der Aufstiegsrinne auf und begannen sofort zu schießen.
Sally und Cleve warfen sich instinktiv flach auf den Boden. Sie schossen gleichzeitig. Ein Bandit verschwand rückwärts kippend zwischen dem Geröll, der zweite duckte sich fluchend in Deckung zurück.
Nun wurde es überall am Rand des halbkreisförmigen Felsplateaus lebendig. Revolver und Gewehrläufe erschienen hinter Felsblöcken. Jemand schrie wild: „Drauf auf sie, Leute! Bringt es zu Ende!“
Schüsse knatterten in rasender Reihenfolge los.
Cleve Milburn ächzte entsetzt. Sallys Hand krallte sich plötzlich in seine Schulter.
„Cleve! Sieh nur, Cleve sieh!“
Das Hämmern der Schüsse dauerte an. Schmetternde Schläge gegen kantiges Gestein waren zu hören. Staubfontänen spritzten zwischen dem Geröll empor. Banditen fluchten und schrien.
Cleve Milburn hob den Kopf und sah den nächsten Angreifer eben mit einer halben Drehung zusammenbrechen. Die anderen warfen sich hastig in ihre Deckung zurück. Und jetzt erst erfasste Cleve, dass die rasenden Schüsse vom Tal heraufkamen, aus einem Gewehr blitzschnell abgefeuert.
Sekunden später sahen er und seine Schwester unten vor dem Hang einen Reiter zwischen verkrüppelten Kiefern und Felstürmen auftauchen.
Ruhig und aufrecht saß er im Sattel eines rotbraunen Pferdes. Er schien eben sein Gewehr nachgeladen zu haben, denn er zog den Kolben wieder an die Schulter hoch. Und schon wieder stach Mündungsflamme um Mündungsflamme aus dem kurzen, blinkenden Lauf. Der Mann repetierte und schoss mit einer Geschwindigkeit, wie sie Cleve Milburn noch bei keinem Gewehrschützen erlebt hatte.
Neben ihm schien Sally beim Anblick dieses Reiters zu erstarren. Ihre Arme fielen herab.
„Tonto!“, stieß sie hervor.
Der junge bärtige Mann in der staubbedeckten Reiterkleidung feuerte das halbe Magazin auf den Felshang ab, wo die Banditen kauerten. Dann schwang er mit einem schrillen Kriegsruf die Waffe über den Kopf und lenkte seinen Fuchshengst hinter die Kiefern und Felstürme zurück. Ein Schleier von Pulverrauch zerwehte an der Stelle, wo er sich eben noch aufgehalten hatte.
Das Echo der Schüsse verrollte an den Hängen der Elk Mountains. Tiefe Stille breitete sich aus.
Sally Milburn hatte sich hinter dem Felsblock aufgerichtet und starrte wie gebannt ins Tal hinab. Cleve richtete sich halb hoch, fasste ihren Arm und zog sie in die Deckung zurück. Unruhe malte sich auf seinem Gesicht.
„Ich fürchte“, murmelte er gepresst, „er kann uns auch nicht viel helfen!“ Sally schien die Worte gar nicht zu hören. Ein seltsames Leuchten stand in ihren Augen.
Matter Hufschlag wehte vom Tal herauf. Die Stille am Felshang wurde von einer scharfen wütenden Stimme zerrissen.
„Zu den Gäulen, Männer, los, los! Jeff, Dan und Will, ihr bleibt hier und achtet darauf, dass die beiden Vögel da oben nicht ausfliegen, klar? Ihr anderen kommt! Tonto darf uns nicht entwischen! Ihr wisst, dass er unser Versteck kennt! Dieser verfluchte Coyote! Der Teufel soll ihn holen!“
Am Stiefelscharren und am Poltern von Gestein erkannten die Milburn Geschwister, dass sich die Banditen hangabwärts zurückzogen. Unten schnaubten und wieherten Pferde.
Wieder war die Stimme des Bandenführers zu hören: „Schneller, Teufel noch einmal, schneller! Wenn uns der Halunke entwischt, sind wir geliefert!“ Steigbügel klirrten, Sattelleder knarrte. Dann setzte Hufgetrappel ein.
Zwischen den Felsen und Kiefern, wo Tonto verschwunden war, blitzte wieder ein Mündungsfeuer auf.
„Da ist er, Sol!“, schrillte eine Männerstimme.
„Ihm nach! Vorwärts!“
Das Trommeln der Hufe nahm an Heftigkeit zu. In dichtgeschlossener Kavalkade preschten die Banditen von dem Steilhang fort quer über den Talgrund auf das Gewirr von verkrüppelten Bäumen und Felsbastionen zu. Staub hing in graugelber Fahne in der sonnenlichtdurchtränkten Luft.
Sally Wilburns Hände waren verkrampft. Ihre Brust hob und senkte sich unter der dünnen schweißnassen Reitbluse. „Mein Gott! Ich wünsche nur, dass er ihnen entkommt! Sie dürfen ihn nicht erwischen! Sie dürfen nicht!“
Ihr Bruder machte ein finsteres Gesicht.
„Denk lieber an uns!“, murrte er. „Für uns hat sich kaum etwas geändert, und wenn diese Schurken erst einmal zurückkommen, dann sind wir geliefert!“ Er wischte sich fahrig über die Stirn, und sein Handrücken wurde nass von Schweiß.
*
Die drei Banditen, die Sol Denrick zur Bewachung der Milburns zurückgelassen hatten, kauerten am unteren Ende der Felsrinne und spähten zum Plateaurand hinauf. Einer von ihnen, ein narbengesichtiger Bursche mit wild blickenden Augen, legte die Hände trichterförmig vor den Mund.
„Hallo, da oben! Glaubt nur nicht, dass wir euch vergessen haben! Wenn ihr einen kleinen Ausflug machen wollt, dann nur zu! Wir warten!“
Die beiden anderen grinsten. Einer stieß den Narbigen mit dem Ellenbogen an.
„Wie ist das Mädel, heh? Hübsch?“
„Und wie! Aber nichts für dich, Amigo! Du bist schließlich nicht allein …“ „Sehr richtig!“ sagte eine trockene Stimme von der Seite her. „Und weil ihr so hübsch beisammen seid, würde mich interessieren, wie es aussieht, wenn sechs Hände zum Himmel greifen!“
Die drei Desperados warfen sich, ihre Revolver hochreißend, herum. Keine sechs Schritte von ihnen entfernt stand Tonto, das Henry Gewehr im Hüftanschlag. Seine Miene war völlig ausdruckslos, nur in seinen graugrünen Augen war das Feuer unerbittlicher
Entschlossenheit zu erkennen, das in ihm brannte.
„Höllenfeuer! Das ist …“
„Keine Reden!“, unterbrach Tonto den Banditen scharf.
„Entweder ihr lasst auf der Stelle die Schießeisen fallen und nehmt endlich die Pfoten hoch, oder ihr kämpft! Alles andere ist reine Zeitvergeudung!“
Es schien für ihn ganz selbstverständlich, dass er hier stand – allein drei Banditen gegenüber.
Die Verbrecher schnauften und tauschten unsichere Blicke.
Schließlich stieß der Narbengesichtige wild hervor: „Zum Satan mit dir! Wir sind zu dritt und …“
Er schlug den Colt auf Tonto an und drückte ab.
Einen Sekundenbruchteil früher krachte das Henry Gewehr. Der Narbige schrie erstickt auf und schlenkerte mit schmerzverzerrter Miene die Hand, über die die Gewehrkugel eine blutige Furche gezogen hatte. Der Revolver lag vor seinen Stiefelspitzen. Nur wenige Handbreit davon entfernt hatte sich die Kugel in die Erde gebohrt.
Die Gesichter der beiden anderen Desperados verfärbten sich.
„Genug!“, keuchte der Mann links von dem Getroffenen.
„Tonto, aufhören, wir geben auf!“
Er schleuderte den Revolver weg, als habe sich dieser in glühendes Eisen verwandelt. Der andere ließ ebenfalls die Waffe fallen. Tonto war nicht anzumerken, wie groß seine Erleichterung war.
Die Banditen hoben schweigend die Arme. Auf Tontos Befehl drehten sie sich um. Oben am Plateaurand bewegte sich jemand. Der Schuss von vorhin musste da oben gehört worden sein. Ohne die Desperados einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen, rief Tonto: „Miss Sally, sind Sie da oben? Hören Sie mich?“
Sekundenlang war es totenstill, dann kam Sally Milburns aufgeregter Ruf.
„Tonto! Tonto! Sind Sie es?“
„Yeah! Es ist alles in Ordnung! Kommen Sie schnell herab, ehe Denrick mit der übrigen Bande zurückkommt!“
Der verwundete narbengesichtige Bandit fluchte unterdrückt. Aber keiner wagte eine Bewegung. Die Mündung des schussbereiten Gewehrs bannte alle drei zu absoluter Reglosigkeit.
Hufe klapperten auf Felsengestein, Steine rollten die gewundene Rinne herab. Schließlich tauchten die Milburn Geschwister am Fuß des Hanges auf. Sie führten ihre Pferde hinter sich. Als Sally Tonto sah, ließ sie die Zügel fallen und eilte auf ihn zu.
„Tonto! Wie sind Sie ihnen nur entkommen!“
„Ein Trick! Ich erzähle es Ihnen später!“ Er lächelte karg. „Jetzt müssen wir reiten!“
Er pfiff leise, und sofort kam Red Blizzard hinter den Felsen hervor auf ihn zugetrabt.
„Milburn“, sagte Tonto zu Sallys Bruder, „es ist besser, wenn Sie die Schießeisen dieser Gents an sich nehmen. Ich möchte beim Fortreiten keine Kugel in den Rücken bekommen.“
Cleve hob die Revolver auf und verstaute sie in den Packtaschen seines Braunen. Dann saßen sie alle drei auf.
„Tonto“, knurrte der Narbengesichtige. „So wie ich Sol Denrick kenne, wird der nicht eher ruhen, bis er dich auf den langen Trail geschickt hat. Freu dich also bloß nicht zu früh!“
„Danke für den Tipp!“, lächelte Tonto grimmig.
Er zog seinen Fuchshengst herum, nickte den Milburns zu, und gemeinsam trieben sie die Gäule an und jagten im Galopp davon, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren.
Erst eine halbe Stunde später zügelte Tonto auf einer mit hohem gelbem Rispengras bestandenen Lichtung in einem Kieferngehölz sein Pferd.
„Ich schätze, wir haben uns eine Verschnaufpause verdient!“, sagte er und schwang sich aus dem Sattel.
Sally saß sofort ebenfalls ab. Nur Cleve blieb noch auf seinem Pferd, die Hände aufs Sattelhorn gestützt, düstere Nachdenklichkeit auf seiner Miene.
Tonto setzte sich auf einen umgestürzten Baumstamm am Waldrand, und Sally nahm neben ihm Platz. Die Luft war warm und voller Harzgeruch. Irgendwo summten Bienen. Das wirre Zweigwerk legte groteske Schattenmuster auf das hohe Gras.
„Ich hatte schreckliche Angst um Sie, Tonto!“, sagte Sally offen heraus.
Er war sich wieder ganz ihrer berückenden Nähe bewusst. Ein Strom von Frische und Fraulichkeit umfing ihn. Sie saß dicht neben ihm, sie schmiegte sich beinahe an ihn. Er hätte gern eine Hand auf ihre Schulter gelegt, nur um die warme Haut unter dem dünnen Stoff der Bluse zu fühlen.
Heiser sagte er: „Ich verstehe nicht, warum Sie und Ihr Bruder hier in den Bergen unterwegs waren. Sie wussten doch, dass Sie sich in der Nähe des Baxter Camps befanden, oder?“
Sally zögerte mit der Antwort.
Tonto sagte rasch: „Ich will natürlich nicht in Sie dringen, wenn Sie Geheimnisse haben …"
„Nein, Tonto, nein!“
Jetzt legte sie ihm die Hand auf die Schulter, und diese Berührung ließ ihn erschauern.
„Sie sollen alles wissen!“
„Sally!“, rief Cleve und sprang jetzt ebenfalls aus dem Sattel. „Es ist besser …“
„Lass mich nur, Cleve! Tonto hat uns jetzt schon zweimal geholfen, nicht wahr? Es ist nur recht, wenn er endlich Bescheid weiß.“
„Es muss nicht sein!“, winkte Tonto ab, der Cleves finstere Miene bemerkt hatte.
„Ich will es aber!“ Die Worte der jungen Frau klangen heftig.
„Hören Sie zu, Tonto! Monroe hat meinen Bruder in der Hand. Cleve hat drüben in Denver einen Mann niedergeschossen, der mich belästigte. Der andere langte zuerst zum Colt, es war Notwehr. Aber dafür besaß Cleve keinen Zeugen. Wir mussten Denver verlassen. Durch Zufall kamen wir nach Silverrock. Cleve fand bei Monroe Arbeit. Und dann tauchte eines Tages bei Monroe Cleves Steckbrief auf. Seitdem …“
„Ich verstehe!“, nickte Tonto grimmig.
„Als dann Cleve den Silberraub vor zwei Wochen nicht verhindern konnte, ließ ihm Monroe nur zwei Möglichkeiten. Entweder Cleve fand das Bandenversteck – darum ritten wir hierher in die Berge –, oder er half Monroe einen Feind beseitigen, einen Mann namens Jim Trafford!“
„Interessant!“, sagte Tonto gepresst. „Wissen Sie auch, dass ich dieser Jim Trafford bin?“
„Sie?“ Sally starrte ihn bestürzt an. „Hasst Monroe Sie so sehr?“
Ehe Tonto antworten konnte, sagte hinter ihnen Cleve Milburn: „Sie hätten Ihren wahren Namen besser für sich behalten, Tonto!“
Sally und Tonto wandten gleichzeitig die Köpfe.
Da stand Cleve im Schatten der windzerzausten Kiefern und hielt seinen Revolver im Anschlag. Sofort nahm Tontos bärtiges Gesicht den alten steinernen Ausdruck an.
„Cleve!“, schrie Sally verwirrt. „Cleve, was soll das?“
„Bleib ganz ruhig, Schwester! Und Sie, Tonto, stehen jetzt langsam auf!“ Tonto gehorchte.
„Es tut mir wirklich leid!“, presste Milburn heiser hervor. „Aber ich muss es tun! Sie kennen jetzt meine Geschichte! Sie wissen, was mir droht, wenn ich unverrichteter Dinge nach Silverrock zurückkehre! Das Bandenversteck habe ich nicht gefunden …“
„Also müssen Sie mich bei Monroe abliefern!“, beendete Tonto eisig den Satz.
„Tot oder lebendig, wie?“
„Tot oder lebendig!“, wiederholte Cleve Milburn erstickt.
Sally war aufgesprungen. Fassungslosigkeit und Entsetzen vermischten sich auf ihrem Gesicht. Aus ihren Wangen war alle Farbe gewichen.
„Cleve, das kann doch nicht dein Ernst sein! Das …“
„Aus der Schusslinie!“, brüllte Milburn.
Da befand sich Sally bereits zwischen ihm und Tonto.
Tonto machte sofort einen tigerhaften Sprung auf sein Pferd zu, um den Kolben des Henry Gewehres zu fassen, der aus dem Scabbard ragte.
Er verfing sich mit dem Stiefelabsatz im hohen verfilzten Rispengras und schlug gegen den Baumstamm, auf dem er mit Sally gesessen hatte. Sofort rollte er herum. Über sich sah er Cleve Milburns verzerrtes Gesicht vor dem Hintergrund der Kiefernkronen und des blauen Himmels auftauchen.
Tonto riss die Fäuste hoch, um Cleves Angriff abzuwehren. Da hatte der niedersausende Revolverlauf bereits seine Stirn getroffen, und alles um Tonto versank in undurchdringlicher Dunkelheit …
*
Sol Denrick stieß die Tür des Blockhauses auf und stampfte sporenklirrend über die Schwelle. Drüben beim kalten Kamin saß Gray Baxter im Lehnstuhl und schaute ihm ruhig entgegen.
Denrick drosch wütend die Faust auf die Tischplatte.
„Sie sind uns entkommen! Alle! Die Milburns und Tonto!“
„Ich ahnte es!“
„Was? Sie … Baxter, zum Teufel! Wissen Sie, was das bedeutet? Unsere ganze Sicherheit lag bisher darin, dass unser Camp unentdeckt blieb. Sonst wäre Monroe mit seiner Revolvergarde längst losgeritten und hätte uns ausgeräuchert! Der Kerl weiß genau, welche Gefahr wir für ihn sind!“
„Und woher weiß er das? Weil du und die anderen euch nicht bezähmen konntet! Weil ihr unbedingt die Silbertransporte überfallen musstet, um Beute zu machen! Sonst wüsste Monroe gar nichts von unserer Anwesenheit!“
„Hören Sie damit auf, Baxter! Hätten Sie Tonto an Ort und Stelle eine Kugel durch den Schädel gejagt, als er sich weigerte …“
Grimmig schüttelte Baxter den Kopf und sagte scharf: „Welchen Sinn hat es, wenn wir uns streiten, Sol? Wir müssen handeln, das ist es! Wenn Tonto alleine entkommen wäre, bestünde kaum Grund zur Aufregung. Ich glaube nicht daran, dass er uns an Monroe verraten würde! Nein, nein, Sol, fange nicht schon wieder damit an! Ich habe die Milburns nicht vergessen! Bei ihnen liegt die Gefahr!“
„Und was sollen wir tun? Wir haben stundenlang nach ihnen gesucht, vergeblich!“
„Wenn Monroe von unserem Camp erfährt“, sagte Baxter ruhig, „müssen wir ihm eben zuvorkommen! Wir müssen zum Endschlag gegen ihn ausholen, ehe er etwas unternehmen kann!“
„Zum …?“ Denrick schluckte.
Sein knochiges langes Gesicht wurde plötzlich ruhig. Ein scharfes Glimmen erschien in seinen Schlitzaugen.
„Sie haben recht, Baxter!“, murmelte er. „Wahrhaftig, Sie haben recht!“
Der Zorn war verflogen. Seinem Gesicht war anzusehen, wie fieberhaft seine Gedanken arbeiteten. Sporenklirrend ging er im Raum auf und ab. Ruckartig blieb er stehen.
„Ich habe es! Ich habe einen Plan, wie wir Monroe mit einem Schlag erledigen können, ohne große Verluste zu erleiden!“
„Lass hören, Sol!“
Denricks Fäuste öffneten und schlossen sich. Die Ungeduld spannte nun seine Züge.
„Wir reiten sofort los! Der Weg nach Silverrock ist weit! In dieser Nacht muss es passieren! Wir stecken die ganze Stadt in Brand!“
Ein Schatten legte sich über Gray Baxters hartes Faltengesicht.
„Was sagst du da?“ Seine Stimme wurde scharf.
„Sol, wir wollen gegen Monroe kämpfen – nicht gegen die Bewohner von Silverrock!“
„Die Stadt gehört Monroe, nicht wahr?“, dehnte Denrick, von seinem Plan überzeugt.
„Wenn die Town erst in Flammen steht, wird Monroe alles tun, um zu retten, was zu retten ist. Ich wette, er schickt seine ganze Mannschaft und auch die Minenarbeiter zur Stadt hinab. Und dann, Baxter, steht uns der Weg zu seinem Hauptquartier frei! Dann können wir Monroe schnappen und das ganze Silber kassieren, das noch nicht nach Gunnison transportiert wurde. Nun, ist der Plan nicht gut?“
„Nein!“, erwiderte Gray Baxter rau. „Ich bleibe bei dem, was ich sagte! Ich will keinen Menschen in Silverrock in Mitleidenschaft ziehen!“
„Aber …“
„Wir beide, Sol“, sagte Baxter leise, „stehen auf verschiedenen Seiten des großen Zaunes! Das weiß ich jetzt! Aber ich bin der Boss! Wenn wir gegen Monroe und seine Desperados kämpfen, darf der Stadt nichts geschehen!“
„Ich denke gar nicht daran, mich mit Ihnen herumzustreiten!“, knirschte Denrick wütend.
Er wandte sich der Tür zu.
„Sol!“, rief Baxter schneidend. „Wohin?“
Denrick grinste verzerrt.
„Nach Silverrock! Mein Plan wird ausgeführt!“
Baxter wollte aufspringen. Aber seine Beine gehorchten ihm nicht. Kraftlos sackte er in den Stuhl zurück. Zum ersten Mal erschien ein Schimmer von Verzweiflung auf seinem Gesicht.
„Du wirst nicht reiten, Sol! Ich verbiete es dir!“
Gepresst entgegnete der schwarzgekleidete Bandit: „Es steht zu viel auf dem Spiel, dass ich jetzt auf Ihre Gefühlsduselei Boss, solange es mir gefällt! Jawohl! Und jetzt führe ich das Kommando! Wir reiten!“
Gray Baxters Hand schnappte zum Kolben des schweren 45ers.
„Sol!“, stieß er rau hervor. „So wehrlos, wie du denkst, bin ich nicht!“
Denrick stand ganz steif und starrte aus engen Augen in die schwarze Coltmündung, die auf ihn gerichtet war. Seine Kinnladen waren verkrampft.
„Kommen Sie zur Vernunft, Baxter!“, knurrte er mit mühsam zurückgedämmter Wut. „Es könnte schlimm für Sie werden, wenn Sie mich zum Feind bekommen!“
„Du kannst mich nicht umstimmen, Sol!“
„Wollen Sie auf Ihre Abrechnung mit Elmer Monroe verzichten?“
„Es muss auch einen anderen Weg geben!“
„Nein, Baxter. Es gibt ihn nicht! Entweder Silverrock brennt – oder Sie werden Monroe niemals zur Rechenschaft ziehen können!“ Ein lauerndes Funkeln war in Denricks Blick.
Eine Sekunde schwieg Baxter, und in dieser kurzen Zeitspanne vermischten sich die widerstreitendsten Empfindungen in seinen pulvergrauen Augen. Dann erklärte er mit schmalen Lippen: „Der Stadt wird nichts geschehen!“
„Wie kann ein Mann nur so verrückt sein!“, sagte Denrick kopfschüttelnd.
„Denkst du denn gar nicht an die Frauen und Kinder in Silverrock?“, rief Baxter eindringlich. „Glaubst du, alles würde so glattgehen, dass es keine unschuldigen Opfer gibt? Nein, Denrick, nein!“
„Ich denke nur an eines“, antwortete der hagere Verbrecher ungerührt.
„An das Silber, das es in Monroes Minen zu holen gibt!“
Mit einem Ruck wandte Denrick sich ab und legte die Hand auf die Türklinke.
Baxters Colthammer klickte hart.
„Halt, Sol! Bleib stehen! Ich warne dich!“
Denricks Schultern waren verkrampft. Er ließ die Hand auf der Klinke liegen.
„Sie werden nicht schießen, Baxter!“, flüsterte er heiser.
„Sol, ich …“
„Sie werden es nicht tun!“, wiederholte Denrick gepresst.
„Sie sind doch kein Bandit, wie? Sie sind doch ein durch und durch anständiger Mann, der sogar davor zurückschreckt, seinen Todfeind mit allen Mitteln zu bekämpfen! Wollen Sie nun zum Mörder werden, Baxter, heh?“
Seine Stimme triefte vor beißendem Hohn.
„Und es wäre Mord, glatter Mord, Baxter! Ich kehre Ihnen den Rücken zu, und mein Revolver steckt im Holster. Also?“
Er lachte verzerrt und öffnete langsam die Tür. Von draußen kam Stimmengewirr und Hufgestampfe.
„Sol! Vielleicht unterschätzt du mich!“, rief Baxter wild.
Etliche Augenblicke zögerte Denrick, dann antwortete er in jäher Entschlossenheit: „Das wird sich gleich herausstellen!“
Er trat über die Schwelle ins Freie. Der 45er in Gray Baxters Faust ruckte, der Zeigefinger am Abzug begann sich zu krümmen. Doch im letzten Moment ließ Baxter die Waffe sinken. Es ging nicht! Denrick hatte recht! Er konnte nicht auf den Rücken eines Mannes schießen.
Lachend schlug Denrick die Tür hinter sich zu.
„Sol!“, rief Baxter verzweifelt. „Reite nicht, Sol!“
Aber Denrick hörte nicht mehr. Er gab draußen knappe laute Befehle. Zustimmende Rufe wurden laut.
Mit bebender Hand schob Baxter seinen Colt in die Halfter zurück. In seinem zerfurchten Gesicht arbeitete es.
„Nein!“, flüsterte er rau. „Nein, das darf nicht geschehen! Das nicht!“
Die Hände um die Stuhllehnen gekrampft, stemmte er sich mühsam auf die Beine. Ei wankte, die Anstrengung trieb Schweiß auf seine Stirn. Der Krückstock lehnte am steingemauerten Kamin. Baxter stützte sich schwer darauf. Sein steifes Bein schleifte leblos über die ungehobelten Bodenbretter.
Das andere drohte immer wieder unter ihm wegzuknicken. Schmerzen zerwühlten Baxters Gesicht und färbten seine Augen dunkel. Seine Lippen waren hart aufeinander gepresst.
Jeder Schritt kostete ihm Mühe. Es kam ihm entsetzlich lange vor, bis er die Tür erreichte. Schweratmend lehnte er sich einen Moment gegen das Holz, ehe er öffnete.
Sonnenlicht brandete ihm entgegen.
Drüben beim Korral saßen bereits sämtliche Mitglieder seiner rauen Crew auf ihren Gäulen. Sol Denrick warf eben anfeuernd seinen rechten Arm in die Luft und stieß einen schrillen Kriegsruf aus. In donnerndem Galopp sprengte die Kavalkade dem Schluchtausgang zu, ehe noch ein einziges Wort über Gray Baxters Lippen gekommen war.
*
Die Nacht hatte sich über die Elk Mountains gesenkt. Die Lichter von Silverrock schimmerten gelb zu den Reitern herüber, die eine halbe Meile vor der Stadt ihre Pferde zum Halten gebracht hatten.
Tonto saß ganz ruhig auf seinem Kentucky Fuchs. Dicht neben ihm war Cleve Milburn. Seit Tonto auf jener Waldlichtung in den Bergen wieder zu Bewusstsein gekommen war, hatte Cleve seinen Revolver nicht mehr aus der Faust gelegt. Auch jetzt war die Mündung starr auf Tonto gerichtet.
Auf Milburns anderer Seite verhielt Sally ihr Pferd. Ihr. Gesicht war weiß, die Finger verkrampften sich um die Zügel. Die Dunkelheit verdeckte die Tränenspuren auf ihren blassen Wangen.
„Was jetzt?“, fragte Tonto ruhig.
Cleve Milburn räusperte sich.
„Sally“, bestimmte er heiser, „du reitest allein in die Stadt. Ich bringe Tonto zu Monroes Mine hinauf!“
„Cleve!“, rief seine Schwester eindringlich. „Ich bitte dich, Cleve, komm zur Vernunft!“
„Wir haben lange genug darüber geredet!“, erwiderte er mürrisch. „Spar dir also deine Worte!“
„Wie kannst du nur so reden, Cleve! Hast du vergessen, was Tonto für dich getan hat? Gestern und heute! Cleve, ich kann einfach nicht glauben, dass du so gewissenlos bist!“
„Du sollst aufhören!“, schrie Milburn kratzend.
„Wie oft soll ich dir noch klarmachen, dass ich gar keine andere Wahl habe! Soll ich mich von Monroe an den Sheriff in Gunnison ausliefern lassen? Nein, ich denke nicht daran!“
Sally wollte wieder etwas sagen, aber da ließ sich Tonto vernehmen – ruhig wie vorher.
„Lassen Sie nur, Sally! Er ist von seiner Idee nicht abzubringen, ich kenne das! Aber insgeheim weiß er ganz genau, dass es falsch ist, was er tut! Und davor hat er Angst! Darum will er alles so schnell wie möglich hinter sich bringen! Ist es nicht so, Milburn? Aber glauben Sie mir …“
„Halten Sie den Mund!“, keuchte Cleve.
„Glauben Sie mir“, redete Tonto unbekümmert weiter, „es ist nicht so einfach, wie Sie denken! Sie sind nicht so skrupellos, wie Sie sich es selber einzureden versuchen! Wenn Sie mich erst an Elmer Monroe ausgeliefert haben, Milburn, dann wird es richtig schlimm für Sie! Sie werden keine ruhige Stunde mehr finden! Sie werden immer daran denken müssen, dass Sie an meinem Tod schuld sind! Und das …“
„Aufhören!“, schrie ihn Milburn an. „Marin, hören Sie endlich damit auf, sonst jage ich Ihnen auf der Stelle eine Kugel durch den Kopf.“
„Sehen Sie, Milburn“, sagte Tonto mit einem kalten Lächeln. „Sie sind jetzt schon völlig mit den Nerven fertig! Ich sage Ihnen, vor Ihnen liegt die Hölle, wenn Sie diese Sache zu Ende bringen!“
„Zum Henker mit Ihren Weisheiten!“, schnaufte Milburn. „Heben Sie sie für sich selber auf! Sie werden es bald nötig haben! – Los, Sally, reite jetzt! Und wir, Tonto, machen uns auf den Weg zu Monroe! Da links hinüber! Dort führt der Weg zu seiner Mine hin, vorwärts!“
Sally lenkte ihr Pferd hastig dicht neben den Braunen ihres Bruders. Sie griff ihm in die Zügel.
„Tu es nicht, Cleve! Du bist doch kein Bandit! Du …“
„Was denn?“, knirschte Milburn. „Hast du meinen Steckbrief vergessen? Für das Gesetz bin ich ein Mörder, jawohl, ein Mörder! Niemand glaubt daran, dass es damals Notwehr war! Soll ich mich jetzt anders verhalten als ein Bandit, zu dem man mich gestempelt hat?“
„Es geht doch nicht darum, wofür man dich hält, Cleve, sondern was du in Wahrheit bist! Und wenn du Tonto jetzt zu Monroe bringst, dann …“
„Dann wirst auch du mich als einen Verbrecher ansehen!“, stieß er wild hervor. „Und wenn schon! Es ist meine Sache, nicht wahr? Habe ich dich gebeten, mich hierher nach Silverrock zu begleiten? Nein, Sally, es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen!“
„Meiner Meinung nach wird es Zeit, dass Sie endlich Ihre Ohren aufsperren!“, sagte Tonto schroff. „Haben Sie die Hufschläge noch immer nicht gehört?“
Milburn verstummte und lauschte angespannt in die Nacht hinein. Das Gras auf der Talsohle dämpfte die Hufschläge. Trotzdem war zu erkennen, dass mehrere Reiter heranpreschten, aus der Richtung, wo Silverrock lag.
Milburn biss sich auf die Unterlippe, Unruhe loderte in seinen Augen auf. Hastig blickte er sich um.
„Los!“,zischte er dann. „Da hinter die Ginsterbüsche, los!“
Sie trieben die Pferde hinter die hohe Strauchgruppe, und dabei war Cleves Coltmündung ständig auf Tonto gerichtet. Die Hufschläge in der Finsternis wurden lauter. Sattelleder knarrte.
*
Einige Minuten später erschien in der Nacht ein Reiterrudel, das immer näher rückte. Schließlich waren die Konturen der Reiter undeutlich auszunehmen. Ihre Richtung musste sie ganz dicht an den Ginsterbüschen vorbeiführen.
Milburns Brauner wieherte plötzlich schrill. Milburn zerknirschte einen Fluch zwischen den Zähnen, als das Hufgetrappel wie abgeschnitten verstummte. Eine Weile war es still, dann trieb eine harte Stimme herüber: „Heh, wer ist da? Kommt hervor, Leute, sonst lassen wir unsere Colts sprechen!“
Etwas Eisiges rieselte Tonto über den Rücken, als er Nat Henshaws Stimme erkannte. Alles in ihm verkrampfte sich, als er sich bewusst machte, dass dort drüben, nur wenige Yard entfernt, Ben Smoletts Mörder auf einem Pferd saß.
Cleve Milburns Haltung entspannte sich.
„Monroes Leute!“, murmelte er erleichtert. „Ich habe es geschafft!“
Henshaw rief ungeduldig: „Habt ihr nicht gehört? Ist es euch wirklich lieber, wenn euch die blauen Bohnen um die Ohren pfeifen, heh?“ Er fügte noch einige Worte hinzu, die beim Gebüsch nicht zu verstehen waren. Es musste ein Befehl für seine Begleiter sein.
Die Reiter schwärmten aus. Metall klirrte.
„Nicht schießen!“, schrie Milburn hastig. „Wir …“
„Tonto!“ rief Sally in seine Worte hinein. „Fliehen Sie, Tonto!“
Und dabei versuchte sie, ihr Pferd zwischen Tontos Tier und den Braunen ihres Bruders zu treiben. Die Angst und Anspannung machten ihre Stimme schrill.
Henshaw hatte kaum den Namen Tonto gehört, da brüllte er wild: „Vorwärts, Leute! Da vorne ist dieser verdammte Panther aus Arizona! Gebt es ihm!“
Jetzt entstand ein wildes Durcheinander. Cleve Milburn fluchte und versuchte, wieder an Tonto heranzukommen. Tonto riss inzwischen seinen Fuchshengst herum. Sallys Stute steilte wiehernd auf die Hinterhand. Und vorne peitschten die ersten Schüsse.
„Nicht schießen!“, brüllte Milburn erneut.
„Hier ist Cleve Milburn! Ich habe Tonto gefangen! Er …“
Eine Kugel kam durch das Zweigwerk gesaust und traf Milburns Pferd direkt in den Kopf. Einen schrillen Laut ausstoßend, brach der Braune in die Vorderbeine. Milburn riss die Füße aus den Steigbügeln, und während der Gaul zur Seite kippte, schleuderte er sich aus dem Sattel.
Henshaw hatte Milburns Worte verstanden. Er schrie: „Schießt nicht mehr! Heh, Milburn, wo stecken Sie?“
Stimmenlärm und Pferdegewieher versanken hinter Tonto. Sein Kentucky Fuchs war in gestreckten Galopp gefallen und preschte über die flache Talsohle an dunklen Baum und Buschgruppen vorbei zu den Berghängen hinüber. Hinten schrie Milburn mit überschlagender Stimme auf Henshaw ein, aber die Worte gingen im dumpfen Trommeln von Red Blizzards Hufen unter.
Nach einer Weile erst warf Tonto einen Blick über die Schulter. Und da sah er, dass ein Reiter dicht hinter ihm her jagte – eine tief geduckte, von Dunkelheit umhüllte Gestalt. Ein einziger von Henshaws Banditen war also geistesgegenwärtig genug gewesen, die Lage zu durchschauen!
Tontos Lippen wurden schmal. Er tastete zum Scabbard. Erst dann fiel ihm wieder ein, dass Milburn ihm das Henry Gewehr abgenommen hatte. Tonto krampfte die Fäuste um die Zügel. Ohne Waffe war er in den Elk Mountains verloren! Alle würden Jagd auf ihn machen: die Monroe Leute und die Baxter Bande! Seine Pläne würden wie eine Seifenblase zerplatzen!
Ein Waldstreifen tauchte vor ihm auf. Er trieb den Hengst unter die Fichten und Kiefern und brachte ihn jäh zum Stehen. Ein Gedanke war ihm gekommen! Der einzelne Verfolger war noch immer hinter ihm her! Und das war die Chance, sich eine Waffe zu holen!
Tonto verlor keine Sekunde und glitt geschmeidig aus dem Sattel. Red Blizzard blieb reglos in der Finsternis zwischen den Bäumen stehen. Tonto duckte sieh hinter einen rauhrindigen Stamm und wartete.
Am Waldrand wurde der Hufschlag des Verfolgers langsamer. Der Mann zögerte. Dann kam er langsam zwischen die Bäume herein. Trockene Zweige zerknackten unter den stampfenden Hufen.
„Tonto!“, rief eine gedämpfte Stimme. „Tonto, sind Sie hier?“
Ein Ruck ging durch seinen angespannten drahtigen Körper.
Er trat hinter der Deckung hervor. Seine Stimme war heiser.
*
„Sally! Hier bin ich, Sally!“
Die Hufe pochten näher. Ein pechiger Schatten erschien zwischen den Bäumen. Das Pferd kam zum Stehen, und die Reitergestalt glitt aus dem Sattel und kam eilig auf Tonto zu. Dicht vor ihm stolperte die junge Frau über eine knorrige Wurzel. Tonto fing sie auf.
Sie lag an seiner Brust, und er fühlte ihren hämmernden Herzschlag durch den dünnen Stoff der Reitbluse. Sie machte keinen Versuch, sich von ihm loszumachen. Die Weichheit ihres Körpers, der Duft ihres seidigen Haares und das leichte Beben ihrer schmalen Schultern – das alles ließ ihn für eine Weile vergessen, was eben da draußen im offenen Tal geschehen war.
Schließlich sagte er rau: „Warum sind Sie mir nachgeritten, Sally?“
Sie trat einen Schritt zurück, und erst jetzt merkte er, dass sie ein Gewehr in den Händen hielt – sein kurzläufiges Henry Gewehr.
„Sie werden es brauchen, Tonto, nicht wahr?“
Er nahm die Waffe entgegen.
„Sie sind eine wundervolle Frau, Sally!“, murmelte er.
Ihre bloßen, weichen Arme schlangen sich plötzlich um seinen Nacken. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Er ließ achtlos das Gewehr fallen und presste sie an sich. Alles in ihm schien jäh zu brennen.
Schließlich bog sie den Oberkörper zurück. Ihre grünen Augen schimmerten feucht in der Dunkelheit. Ihre Fingerspitzen streichelten sein bärtiges straffes Gesicht.
„Du darfst keine Zeit mehr verlieren, Tonto! Verlass dieses Land – für immer!“
„Erst habe ich noch einiges zu erledigen, Sally!“ murmelte er rau. „Dann werde ich reiten, aber nur mit dir!“ Er fühlte, wie sie erschauerte.
„Tonto, sie werden dich töten!“
Er zog sie wieder an sich. Seine Lippen berührten ihre Stirn. Während er über ihren Kopf in die Dunkelheit hineinstarrte, sagte er leise: „Ich liebe dich, Sally! Und ich werde alles tun, um einmal mehr Zeit für dich zu haben! Aber ich kann nicht fliehen. Ich bin nach Silverrock gekommen, um das Schicksal meines Vaters zu klären. Eher kann ich nicht reiten, ich kann es einfach nicht!“
Sie seufzte.
„Tu, was du für richtig hältst! Ich vertraue dir!“
„Danke, Sally!“
Rufe und Hufgetrappel wehten durch die Finsternis heran. Reiter näherten sich dem Waldstreifen.
„Ich muss fort, Sally!“ flüsterte er. „Tonto, sei vorsichtig …“
„Wir sehen uns wieder, Liebste! Ich verspreche es dir!“ Dann war er bereits bei seinem Pferd und zog sich eilig in den Sattel.
*
George Rafman, der alte Stallmann, nahm die Laterne vom Haken an einem der Stützbalken und ging schlurfend den Mittelgang des Mietstalls entlang zum Tor. Ein Pferd schnaubte plötzlich nervös. Rafman blieb sofort stehen und hob die Laterne in die Höhe. Der gelbe Lichtkreis verbreiterte sich.
Stroh raschelte. Dann wuchs der Schatten eines Mannes hinter einer bohlenen Boxwand empor.
„Heh!“, krächzte Rafman erschrocken. „Was soll das? Was …“
„Still! Keine Sorge, Rafman!“
Der Mann schob sich ins Lampenlicht, groß, sehnig, einen alten verwaschenen Kavallerie Mantel um die Schultern geworfen.
„Großer Geist!“, stieß der Alte hervor. „Tonto – Sie?“
„Ich bin es!“ nickte Tonto mit dem Anflug eines grimmigen Lächelns. „Und nicht mein Geist!“
Rafman schluckte würgend.
„Jetzt wäre ein Drink fällig! Ich dachte, Sie wären längst zu Ihren Ahnen versammelt, Mister! Was wollen Sie hier?“
Lautlos kam Tonto näher, mit Bewegungen, die an einen schleichenden Panther, erinnerten.
„Wir sind neulich in unserer Unterhaltung unterbrochen worden, Rafman!“
„Ich … ich verstehe nicht! Tonto, es wäre besser …“
„Ich will wissen, was damals vor zwanzig Jahren aus Allan Trafford geworden ist, Rafman!“
Der Stallmann wischte sich nervös mit dem Handrücken über den Mund.
„Warum nur, Tonto? Was liegt Ihnen an Traffords Schicksal?“
„Ich bin sein Sohn!“
Die Augen des Alten wurden weit. Beinahe wäre ihm die Laterne aus der Hand gefallen.
„Also, Rafman!“, sagte Tonto drängend.
„Sein Sohn! Der kleine Jimmy Trafford, von dem er immer gesprochen hat! Mein Gott!“ Benommen schüttelte Rafman den Kopf.
Dann ging eine Veränderung in seinem Gesicht vor. Er stellte die Laterne auf eine Futterkiste.
„Tonto, versprechen Sie mir, dass Sie niemand verraten werden, dass Sie mit mir gesprochen haben?“
„Ich verspreche es!“
George Rafman holte tief Luft.
„Ich kann Ihnen nicht viel sagen, Tonto! Ich …“
„Hat Monroe meinen Vater ermorden lassen oder nicht?“
Der Stallmann blickte sich hastig um, als wolle er feststellen, ob sie auch wirklich alleine waren. Dann schlurfte er ganz dicht an Tonto heran.
„Monroe wollte es!“ flüsterte er. „Aber … aber ich weiß nicht, ob es ihm gelungen ist! Niemand weiß es – auch Monroe nicht!“
Tontos Herz klopfte plötzlich zum Zerspringen. „Was reden Sie da? Erklären Sie, Rafman!“
„Ihr Vater wollte damals mit einer Kutsche nach Denver reisen, Tonto. Die Kutsche wurde noch innerhalb der Elk Mountains überfallen und in eine Schlucht gestürzt.“
„Und weiter?“
„Fahrer und Beifahrer waren tot. Aber Ihren Vater fand man nicht. Seit jenem Tag blieb er verschollen!“
„Rafman!“, stieß Tonto hervor. „Ist das die Wahrheit?“
„Die reine Wahrheit!“
„Er lebt also noch! Wirklich, er lebt noch!“, murmelte Tonto erschüttert, und die Härte auf seinem Gesicht war plötzlich zerbrochen.
Rafman bewegte sich unruhig.
„Hoffen Sie nicht zu sehr darauf, Tonto! Die Schlucht … nun, sie war verteufelt tief! Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihr Vater den Sturz über standen hat. Vielleicht hatte er nur noch die Kraft gefunden, sich irgendwo zu verkriechen und dann …“ Er sprach nicht zu Ende.
Tonto starrte zu Boden, als habe er die Worte nicht verstanden. Plötzlich ruckte sein Kopf hoch.
„Ich muss zu Monroe!“, sagte er klirrend.
„Um Himmels willen!“ Rafman hob beschwörend die Hände. „Er wird Ihnen auch nicht …“
*
Das Stalltor knarrte. Im nächsten Sekundenbruchteil peitschte ein Schuss. Dröhnend hallte die Detonation zwischen den Bretterwänden. Die Pferde in den Boxen bäumten sich erschrocken auf.
Tonto spürte den Luftzug der Kugel an der Wange. Er warf sich herum.
Neben ihm hustete George Rafman erstickt und brach dann zusammen.
Der Schein der Stalllaterne fiel auf den Mann, der geduckt durch den offenen Torspalt schnellte und erneut feuern wollte: Nat Henshaw. Maßloser Hass malte sich auf seinem ledernen verkniffenen Gesicht.
Tontos Kavallerie Mantel flog vorne auseinander. Der Lauf des Henry Gewehres wurde sichtbar und spie eine orangefarbene Feuerlanze.
Henshaw schrie gellend auf, als ihm die Kugel den Revolver aus der Faust prellte. Blut lief über seine Hand. Sein Gesicht war plötzlich aschgrau. Mit vor Erschrecken geweiteten Augen wollte er den Stall verlassen.
„Halt!“, schrie Tonto scharf. „Du weißt, wie schnell meine Kugeln sind!“
Henshaw erstarrte. Die Pferde in den Boxen zerrten heftig an den Stricken. Hufe polterten gegen die Boxwände.
Tonto ging langsam auf den ledergesichtigen Verbrecher zu.
„Das war dein zweiter Mord vor meinen Augen!“, sagte er dumpf. „Henshaw, das bringt dich an den Galgen!“
In dem Banditen gewann der Hass die Oberhand. Er knirschte wild: „Die Kugel war für dich bestimmt, du Koyote! Zur Hölle mit dir! Glaubst du, du kommst lebendig aus der Stadt heraus? Deine einzige Chance hätte darin bestanden, so schnell wie möglich aus dem Tal fortzureiten! Jetzt bist du geliefert!“
„Du vergisst, dass ich dich vor der Mündung habe, Henshaw!“
„Dann schieß doch!“, brüllte der Verbrecher. „Los, du verwünschter Geier! Drück doch ab!“
„Ich bin nicht von deiner Sorte!“, erklärte Tonto eisig.
52
Henshaws Miene wurde noch verkniffener. Lauernd starrte er Tonto an.
„Was hast du vor?“
„Ich will nicht nur dich, ich will auch Monroe!“
Henshaw begann zu lachen, ein verzerrtes unheimliches Lachen. Er schüttelte den Kopf.
„Du willst Monroe? Ausgerechnet Monroe, den mächtigsten Mann in den Elk Mountains? Tonto, was bist du für ein Narr!“
„Ich werde ihn bekommen! Und dann bringe ich euch beide zum Sheriff nach Gunnison!“
„Und wie willst du es schaffen, heh? Monroe hat noch eine Menge anderer Revolvermänner außer mir!“
„Aber ich habe dich als Geisel!“, sagte Tonto hart.
Der Hohn in Henshaws dunklen Augen erlosch.
Er krächzte: „Du bist ja verrückt, Mann! Das schaffst du nicht!“
Die Entschlossenheit funkelte kalt in Tontos graugrünen Augen.
„Wir werden sehen! Vorwärts, Henshaw! Auf die Straße! Wir reiten zu Monroes Mine!“
Der Bandit öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen. Dann sah er die ruckende Bewegung von Tontos Henry Gewehr. Er schloss die Lippen, machte schweigend kehrt und trat auf die nächtliche Main Street von Silverrock hinaus.
*
Es ging schon auf Mitternacht zu. Die Straße war leer. Nur noch in wenigen Häusern brannte Licht. Aus dem Frontier Palace kam Klaviergeklimper.
Tonto musste an Sally Milburn denken. Sicher war sie längst in die Stadt zurückgekehrt, zusammen mit ihrem jungen Bruder, der Tonto beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Die Erinnerung an jene kurzen Minuten im Wald war so heftig, dass Tonto beinahe Sallys heiße Lippen auf seinem Mund zu fühlen glaubte.
Plötzlich fragte er sich, ob er wirklich richtig handelte.
Wäre es nicht besser, einfach zu Sally zu gehen und mit ihr Silverrock für immer zu verlassen?
Aber dann würden immer die Schatten der Erinnerung über ihm liegen – der Erinnerung an den toten Ben Smolett, der ihm ein zweiter Vater gewesen war, an den Terror Elmer Monroes und an den noch immer ungeklärten Verbleib seines Vaters. Rafman hatte es deutlich genug gesagt: niemand wusste, wo Allan Trafford geblieben war, auch Monroe nicht! Trotzdem brannte die Flamme der Hoffnung jetzt lebendiger in Tonto Jim Trafford! Er konnte jetzt einfach nicht aufgeben.
Vor dem Mietstall stand neben seinem Kentucky Fuchs Nat Henshaws struppiger Gaul.
„Steig auf!“, befahl Tonto dem Verbrecher.
Henshaw warf ihm einen hasserfüllten Blick zu und zog sich in den Sattel.
Das kurzläufige Gewehr in der Rechten, fasste Tonto mit der linken Hand nach seinem Sattelhorn. Red Blizzard stand ganz still.
Ehe Tonto aufsitzen konnte, sagte eine heisere Stimme von der Stallecke her: „Bleiben Sie, wo Sie sind, Tonto! Und lassen Sie sich nur nicht einfallen, auf mich zu schießen! Ich brauche nur den Finger krummzumachen!“
Tonto hatte das Gefühl, einen Stich zwischen die Schulterblätter zu bekommen. Seine linke Hand fiel herab. Langsam wandte er den Kopf.
Ein Reiter verharrte reglos im Schatten der Stallecke. Nur das matte Blinken eines schussbereiten Revolvers war zu erkennen.
„Donner!“, krächzte Henshaw erleichtert.
„Das nenne ich Hilfe zur rechten Zeit! Amigo, wer bist du?“
Er wollte sein Pferd herumziehen. Doch die heisere Stimme rief scharf: „Keinen Yard weiter, Bandit! Ich bin nicht dein Freund, wie du glaubst!“
„Zum Teufel!“, fluchte Henshaw.
„Warum hilfst du mir dann? Was soll das ganze Theater?“
„Ich bin Gray Baxter!“, sagte der dunkle Reiter an der Stallecke. „Und wenn du nur eine einzige falsche Bewegung machst, trifft es auch dich!“
„Baxter!“, ächzte Henshaw. „Das kann nicht wahr sein!“
Statt einer Antwort trieb der Reiter seinen Gaul in das spärliche Licht, das aus den Windlaternen an den gegenüberliegenden Veranden über die Fahrbahn sickerte.
Baxter saß seltsam verkrampft im Sattel. Die Falten in seinem breitflächigen Gesicht glichen schwarzen rissen. Schweiß perlte über Stirn und Wangen. Und die Anstrengung kniff seine Mundwinkel scharf nach unten.
Eine Weile war nur maßloses Erstaunen in Tonto.
Er wusste, wie schlecht Gray Baxter mit seinen kranken Beinen zu Fuß war. Dass er sich auf dem Rücken eines Pferdes halten konnte, war wie ein Wunder. Und noch dazu schien er die ganze Strecke vom versteckten Camp in den Bergen bis hierher in die Minenstadt alleine zurückgelegt zu haben.
Nur ein gewaltiger Wille hielt ihn noch aufrecht auf dem hochbeinigen grauen Pferd.
„Baxter!“, stieß Henshaw gepresst hervor. „Haben Sie den Verstand verloren, dass Sie in die Stadt kommen? Monroe wird Sie in Stücke reißen lassen!“
„Er wird anderes zu tun haben!“, murmelte Baxter erschöpft.
„Hör zu, Bandit!“
„Moment, Baxter!“, mischte sich Tonto ein. „Was soll das alles? Henshaw ist mein Gefangener! Ich habe mein Leben riskiert, um ihn zu stellen. Er gehört mir! Ich bringe ihn zum Sheriff!“
„Seit dem Augenblick, da mein Colt auf Sie gerichtet ist, Tonto, nicht mehr!“, entgegnete Gray Baxter kalt.
Tonto machte eine blitzschnelle halbe Drehung, und seine Gewehrmündung zielte jetzt auf Baxter.
*
„Jetzt können wir uns weiter unterhalten! Jetzt liegen die Chancen gleich!“
„Seien Sie vernünftig, Tonto!“
„Was wollen Sie von Henshaw?“
„Ihn zu Monroe schicken! Halt, Henshaw, versuchen Sie nicht die Flucht! Bleiben Sie, Mann! Was ich zu sagen habe, ist wichtig. – Vor allem für Sie und Monroe!“
„Ich verstehe die Welt nicht mehr!“, sagte Henshaw kopfschüttelnd.
„Sie müssen Monroe warnen!“ forderte Baxter eindringlich, ohne Tonto noch einen Blick zu schenken. „Die Stadt soll in Brand gesteckt werden. Jede Minute kann es passieren!“
„Von wem?“
„Von meiner Bande!“
Henshaw griff sich an den Kopf. „Einer von uns beiden ist wirklich verrückt, Baxter!“
„Es ist die Wahrheit!“, stieß Baxter wild hervor. „Meinen Sie denn, ich sei einfach so zum Vergnügen hierher geritten und rette Ihnen vielleicht noch dazu das Leben, Mann? Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen! Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich nicht mehr der Anführer meiner Crew bin. Sol Denrick hat das Kommando übernommen, und er will die Stadt niederbrennen, um damit Monroes Leute abzulenken! Ich aber will nicht, dass auch nur einem Menschen in Silverrock etwas geschieht!“
„Wirklich?“, knurrte Henshaw voller Argwohn.
„Und wer garantiert, dass dies nicht alles eine verteufelte Falle ist, heh?“
„Genügt es Ihnen nicht“, schnaufte Baxter ungeduldig, „dass mein Colt auf Tonto gerichtet ist!“
„Was aber noch lange nicht heißt, dass ich einverstanden bin!“, sagte Tonto scharf.
„Übersehen Sie nicht mein Gewehr, Baxter!“
„Das muss ich riskieren! Wahrscheinlich sterben wir beide, wenn Sie schießen, Tonto!“
„Baxter, Sie wissen gar nicht, um welche Chance Sie mich bringen, wenn Henshaw jetzt reitet! Fünfhundert Meilen bin ich geritten, um diese Chance zu bekommen!“
„Ihre Feindschaft gegen Elmer Monroe ist wirklich groß!“, murmelte Gray Baxter. „Aber glauben Sie, mein Haß ist geringer?“ Seine Stimme wurde heftig, trotzdem war die beißende Bitterkeit in ihr nicht zu überhören.
„Meinen Sie, Tonto, es wäre nicht alles einfacher für mich, wenn ich weiterhin mit Denrick zusammenarbeiten würde? Sie reden von Ihrer großen Chance! Glauben Sie denn, die meine wäre weniger wert? Was wissen Sie denn schon, was zwischen mir und Monroe ist! Nichts, gar nichts wissen Sie!“ Henshaw starrte verstört von einem zum anderen. Obwohl jetzt keine Waffe mehr auf ihn gerichtet war, dachte er gar nicht daran, sein Pferd anzuspornen und zu versuchen, in die Dunkelheit zwischen den Häusern einzutauchen.
Das, was er eben gehört hatte, und der Anblick dieser beiden Männer, die die Waffen aufeinander gerichtet hatten, nahmen ihn gefangen.
In den Augen jedes dieser beiden Männer brannte das Feuer wilder Entschlossenheit. Die Spannung zwischen ihnen war so groß, dass sie sich jeden Augenblick im Krachen der Schießeisen entladen konnte, so schien es Henshaw wenigstens.
Tonto biss sich schließlich auf die Unterlippe. „Und Sie tun das alles nur, um Monroes Stadt zu retten? Ist das nicht merkwürdig, Baxter?“
„Monroes Stadt? Er beherrscht sie, ja, das stimmt! Die Menschen gehorchen ihm, weil er sie bedroht. Ist es also wirklich seine Stadt? Wollen Sie das Leben von Frauen und Kindern gefährden, Tonto, nur um an Ihr Ziel zu kommen?“
„Das gewiss nicht!“
„Dann sagen Sie mir eine andere Möglichkeit, um es zu verhindern! Monroe ist auch mein Todfeind, Tonto! Trotzdem müssen wir ihn diesmal warnen, durch diesen Mann!“ Er deutete mit dem Kopf auf Henshaw.
Langsam senkte Tonto den Lauf seines Gewehrs. Henshaw glaubte seinen Augen nicht zu trauen.
Tonto stieß rau hervor: „Well, Henshaw, reite! Berichte Monroe, was dir Baxter aufgetragen hat!“
Der Mörder starrte Tonto verblüfft an. Tontos Augen glühten wild.
„Hast du nicht gehört, du Bandit? Du sollst reiten! Oder willst du, dass ich es mir noch anders überlege? Los, Mann, verschwinde, ehe es zu schwer für mich wird!“
Henshaw schluckte würgend und wendete seinen Gaul.
Tonto rief scharf: „Eines verspreche ich dir, Henshaw! Wir sehen uns wieder! Dann werden wir uns noch einmal über Smoletts und Rafmans Tod unterhalten!“
Wortlos schlug Nat Henshaw seinem Pferd die Sporen in die Weichen. Die Hufe begannen zu hämmern, Staub wehte ins gelbe Lampenlicht. Tief geduckt, als fürchte er, dass sich Tonto doch noch anders besinnen und ihm eine Kugel nachsenden könnte, jagte der Verbrecher die Straße entlang zum nahen Ortsausgang. Bald darauf hatte ihn die Nacht verschluckt.
Gray Baxter seufzte tief und ließ seinen 45er Colt sinken.
„Ich danke Ihnen, Tonto!“
Das Feuer in seinen grauen Augen erlosch. Plötzlich wirkte er viel älter, als er in Wirklichkeit war.
Tonto stieß die Mündung seines Gewehres nach unten.
„Danken? Nein, das brauchen Sie nicht! Baxter, ich habe das noch zu keinem Menschen gesagt, aber ich glaube, in Ihnen habe ich wirklich einen großen Mann vor mir!“
Jetzt, da Baxter erreicht hatte, was er wollte, begann er im Sattel zu wanken. Tonto eilte auf ihn zu, da rutschte Baxter bereits vom Pferd. Seine Hände krallten sich am Sattelhorn fest, um sich aufrecht zu halten. Aber in seinen halbgelähmten Beinen war keine Kraft mehr. Die Last des Körpers war zu schwer. Baxter brach ächzend zusammen. Sein Pferd wich nervös schnaufend zur Seite.
Tonto beugte sich über den großen grauhaarigen Mann.
„Helfen Sie mir hoch, Tonto!“, bat Baxter. „Helfen Sie mir auf das Pferd!“
„Baxter!“, sagte Tonto und schüttelte den Kopf. „Sie sind am Ende! Sie können jetzt keine halbe Meile mehr im Sattel zurücklegen.“
„Helfen Sie mir!“, wiederholte Gray Baxter. „Irgendwie werde ich es schon schaffen! Verstehen Sie nicht? Ich muss aus Silverrock verschwinden! In ein paar Minuten wird Monroe wissen, dass ich hier zu finden bin! Sie können sich ausrechnen, was dann geschieht!“
Tonto biss sich auf die Unterlippe. Er griff Baxter unter die Achseln, und der Grauhaarige tat alles, um sich gleichzeitig selbst in die Höhe zu stemmen. Er wankte. Tonto hielt ihn fest.
„Danke!“, ächzte Baxter. „Ich wünschte nur, wir wären uns gleich von Anfang an als Freunde begegnet! Tonto, werden Sie mich jetzt noch auf das Pferd bringen? Ich fürchte, allein ist es eine Unmöglichkeit für mich.“
Baxter streckte die Hände aus und packte hart das Sattelhorn.
Tonto fasste ihn am Gürtel. Er konnte sich kaum vorstellen, wie Baxter es draußen im Camp alleine geschafft hatte, auf den Rücken seines Gauls zu kommen.
„Jetzt!“, stieß Baxter gepresst hervor.
Tonto stemmte den schweren Mann in die Höhe. Baxter zog mit beiden Händen. Er schwang sein steifes Bein über die Hinterhand des Pferdes, im nächsten Moment saß er im Sattel. Mühsam drehte er sein vor Anstrengung verzerrtes Gesicht dem jungen Mann zu.
„Geschafft!“, murmelte er brüchig.
Er ließ das Sattelhorn los und langte nach den Zügeln.
Im nächsten Moment kippte seine große Gestalt erschlaffend zur Seite. Tonto kam gerade noch zurecht, um den Bewusstlosen aufzufangen …
*
Gehetzt schaute Tonto die Main Street entlang. Nirgends war ein Mensch zu sehen. Wieder verlöschten in einem Haus die Lichter, und jetzt war der Frontier Palace das einzige Gebäude, dessen Fenster noch hell waren.
Beim Anblick des Saloons kam Tonto ein Gedanke. In ganz Silverrock gab es nur einen Platz, wohin er Gray Baxter bringen konnte: Sally Milburns Zimmer im Oberstock des Frontier Palace.
Es blieb keine Zeit zum Überlegen. Henshaw würde wie vom Teufel gehetzt reiten, um Monroe von dem geplanten Vernichtungsschlag Sol Denricks gegen die Stadt zu berichten. Und sicher hielt sich Denrick mit seiner Bande bereits am Ortsrand auf. In spätestens einer halben Stunde würde im Silverrock Basin die Hölle losbrechen!
Tonto presste die Lippen zusammen und stapfte los. Das kurzläufige Henry Gewehr hing an einem Riemen über der linken Schulter, Baxters schlaffe Gestalt ruhte auf der rechten. Mit beiden Händen hielt er den Ohnmächtigen fest. Red Blizzard trottete wie ein folgsamer Hund hinter ihm her.
Baxter war schwer, und als Tonto die Rückfront des Saloons erreichte, war er in Schweiß gebadet. Der Lärm im Frontier Palace hatte beträchtlich nachgelassen. Vorne klappten die Schwingtüren, wahrscheinlich verließen die letzten Gäste den Saloon.
Stufe um Stufe stieg Tonto mit Baxter die Treppe empor, die außen an der Saloonrückwand zum Obergeschoss führte. Oben auf der von einem Geländer gesäumten Galerie verharrte er verschnaufend einen Moment. Dann näherte er sich dem Eingang.
Ehe er die Tür erreichte, wurde sie von innen aufgestoßen. Gelber Lampenschein brandete ins Freie und blendete Tonto einen Augenblick. Unwillkürlich bewegte sich seine Rechte zur Hüfte hin. Aber das Coltholster war leer, und das Gewehr auf dem Rücken war momentan unerreichbar für ihn.
Cleve Milburn stand breitbeinig auf der Schwelle, einen schussbereiten Revolver in der Faust.
Er starrte Tonto überrascht an. Tonto hatte das Gefühl, einen Schlag in die Magengrube erhalten zu haben. Jeder Muskel in ihm verkrampfte sich in Erwartung des tödlichen Schusses.
Milburn fragte heiser: „Was wollen Sie hier?“
An Tontos Stimme war nichts von seiner Aufgewühltheit zu merken.
„Dieser Mann braucht Hilfe“, erklärte er ruhig. „Ich möchte ihn zu Sally bringen! Sie können dann immer noch …“
„Wer ist er?“, unterbrach ihn Milburn. Eine seltsame wilde Ungeduld schwang in seinem Tonfall.
Tonto zögerte. Er wusste, wie verhasst die Baxter Crew bei Elmer Monroes Leuten war. Er erinnerte sich an die Überfälle auf die Silbertransporte. Und er fürchtete, dass ihm keine Zeit blieb, zu erklären, dass dies alles nicht Gray Baxters Schuld war.
„Zum Geier! Haben Sie nicht gehört?“, fauchte Milburn. „Wer ist der Mann?“
„Ein Feind Monroes!“
Einen Moment blieb Cleve Milburn völlig bewegungslos, dann steckte er zu Tontos Erstaunen seinen Revolver in die Halfter und wich in den lampenerhellten Korridor zurück.
„Bringen Sie ihn herein!“
Tonto folgte sofort. Milburn öffnete eine Tür. Das Licht aus dem Korridor fiel in ein kleines sauberes Zimmer. An den Einrichtungsgegenständen und an den Kleidern in einem offenstehenden Schrank erkannte Tonto, dass es das Zimmer einer Frau war. Er glaubte, Sallys Parfüm zu riechen.
„Legen Sie ihn auf das Bett!“, sagte Milburn.
Tonto folgte der Aufforderung. Dann drehte er sich mit wachsamen Augen Sallys jungem Bruder zu. Cleves Gesicht zeigte keine Feindseligkeit, es wirkte besorgt und seltsam entschlossen.
„Wo ist Sally?“, fragte Tonto schnell. „Unten im Saloon?“
Cleve Milburn schüttelte mit zusammengebissenen Zähnen den Kopf. Die Sorge in seiner Miene ging auf Tonto über. Hastig trat er auf den jungen schwarzhaarigen Mann zu.
„Wo ist sie? Reden Sie doch!“
Noch immer wortlos, griff Cleve in die Brusttasche seines Hemdes und holte einen zusammengefalteten Papierbogen hervor. Er reichte ihn Tonto.
„Das habe ich vor zehn Minuten auf Sallys Bett gefunden!“, sagte er tonlos.
Tontos Herz pochte hart, als er eilig das Papier entfaltete. Das Licht aus dem Korridor reichte aus, um die steile Schrift entziffern zu können.
Milburn, meine Leute haben Deine Schwester in mein Hauptquartier geholt. Durch Henshaw weiß ich, dass sie es war, die Tonto zur Flucht verhalf. Wenn Tonto nicht noch in dieser Nacht von meinen Männern gestellt wird, hat sie es zu büßen.
Elmer Monroe
*
Tontos Gesicht hatte sich grau gefärbt. Er gab Milburn den Zettel zurück. Dieser ließ ihn achtlos zu Boden flattern.
Aus brennenden Augen starrte er Tonto an.
„Ich war ein Narr, Tonto, nicht wahr? Ein hirnverbrannter Narr! Ich wollte Sie ans Messer liefern, nur um die Stellung bei Monroe nicht zu verlieren! So viel habe ich geschluckt von diesem Schuft, so viel! Jetzt ist es Schluss! Jetzt stehe ich nicht mehr auf Monroes Seite! Jetzt werde ich kämpfen, gegen ihn!“
„Sie werden nicht allein sein!“, erklärte Tonto bedeutsam.
Cleve Milburn schüttelte den Kopf.
„Bleiben Sie hier! Das ist meine Sache! So tief bin ich noch nicht gesunken, um jetzt noch Ihre Hilfe anzunehmen, nach allem, was ich Ihnen angetan habe!“
„Sie werden mich nicht daran hindern können!“, sagte Tonto grimmig.
„Aber …"
„Ich weiß, es ist gefährlich!“, nickte Tonto. „Aber Sie wissen eines nicht, Cleve! Ich liebe Sally! Ich will, dass sie meine Frau wird!“
Eine Weile starrte ihn Milburn wortlos an. Dann rückte er an seinem Revolvergurt.
„Also gut! Gehen wir!“
„Nicht ohne mich!“, sagte Baxter heiser vom Bett her.
Er hatte sich aufgesetzt und schien den letzten Teil von Tontos und Milburns Zwiesprache angehört zu haben. Das alte kalte Licht seines stählernen Willens glänzte wieder in seinen pulvergrauen Augen. Sein Kinn war kantig vorgeschoben.
Die beiden anderen drehten sich ihm schnell zu.
„Unmöglich, Baxter!“, sagte Tonto hastig.
Gray Baxter lächelte hart.
„Hätten Sie meinen Ritt vom Camp nach Silverrock nicht auch unmöglich genannt? Wenn ihr mir ein wenig helft, werde ich durchhalten!“
„Da oben bei Monroes Mine kann sehr leicht der Tod auf uns alle warten!“
„Wem sagen Sie das, Tonto! Ich habe Dinge hinter mir, die schlimmer waren als der Tod! Sie ahnen gar nicht, wie groß die Rechnung ist, die ich Monroe zu präsentieren habe! Also?“
Milburn blickte Tonto fragend an. Der musterte den Grauhaarigen sekundenlang voller Nachdenklichkeit, dann nickte er Sallys Bruder zu.
„Einverstanden!“
Sie fassten Baxter links und rechts und halfen ihm auf die Füße. Nebeneinander verließen sie das Zimmer im Obergeschoss des Frontier Palace und machten sich auf den Weg zu Monroes Mine – den Weg, an dessen Ende die tödliche Entscheidung stehen würde!
Als sie die Hälfte des bergan führenden Reit und Fahrweges zurückgelegt hatten, saßen sie von ihren Pferden ab und ließen die Tiere hinter einem Gewirr von Fichten und Felsen zurück.
Baxters Atem ging ziemlich schwer, aber er ließ nicht zu, dass Tonto und Cleve seinetwegen das Tempo drosselten. Einer der beiden jüngeren Männer stützte ihn abwechselnd.
Nachdem sie ein weiteres Dutzend Yard zurückgelegt hatten, klang bergaufwärts eiliges Hufgetrappel auf und kam die Straße herab.
„Monroes Leute!“, zischte Tonto. „Schnell hinter die Sträucher!“
Sie duckten sich hinter Juniperen Gestrüpp und spähten den Weg hinauf, der sich in scharfen Krümmungen zur Terrasse wand, auf der Monroes Hauptquartier lag. Der Sternenschimmer war hier oben stärker als auf der Talsohle. Es dauerte nicht lange, bis die dichtgeschlossene Kavalkade aus der Dunkelheit auftauchte. Schweigend und in überstürzter Hast fegten die Reiter an den drei Verborgenen vorbei, dem Tal zu, an der Spitze die drahtigen Gestalten von Monroes Revolvermännern, dahinter die derberen Figuren von Minenarbeitern, denen der Sattel etwas ungewohnt war.
Die Hufschläge hallten noch deutlich durch die laue Nachtluft, da stach unten am Stadtrand eine grelle Lohe durch die Dunkelheit.
*
„Denrick!“ presste Baxter hervor. „Er hat bereits angefangen! Ich hoffe nur, Monroes Leute kommen zurecht, um das Schlimmste zu verhüten!“
„Darauf können Sie sich verlassen!“, murmelte Tonto.
„In ein paar Minuten werden die Monroe und Denrick Leute genug damit zu tun haben, sich gegenseitig um das Leben zu bringen.“
„Weiter!“, drängte Milburn. „Denkt an Sally!“
Sie verließen ihre Deckung, und eine halbe Stunde später hatten sie den Rand des Plateaus erreicht. Vor ihnen lagen langgestreckte niedrige Bretterbaracken – die Unterkünfte für die Minenarbeiter und Revolvermänner Monroes. Daneben befanden sich Lagerblockhäuser, offene Schuppen mit untergestelltem Arbeitsgerät. Geleise, auf denen leere Kipploren standen, glänzten als silberne Striche. Sie verschwanden in den pechschwarzen Stolleneingängen, die ringsum in den steilen Berghängen klafften. Neben dem riesigen Schmelzofen türmten sich Schutthalden. Es roch nach Teer, Holzkohle und Öl.
Milburn deutete auf ein massives, fast quadratisches Blockhaus.
„Dort wohnt Monroe!“
Die Fenster waren gelbe Vierecke in der schwarzen Balkenwand. Einmal war ein großer Schatten im Licht zu erkennen: Monroes massige Gestalt.
Vom Tal herauf trieb jetzt das rasende Knattern von Revolverschüssen. Die beiden Banden waren aufeinandergeprallt.
Ein erbitterter Kampf hatte da unten begonnen.
„Vorwärts!“, flüsterte Milburn voll heiserer Ungeduld. „Wer weiß, was dieser Lump Sally antut, wenn wir …“
Er wollte geradewegs auf Monroes Blockhaus zu. Tonto hielt ihn zurück.
„Nichts überstürzen, Cleve! Vergessen Sie nicht, dass Monroe Ihre Schwester als Geisel ausspielen kann!“
„Wie sollen wir dann …“
„Geben Sie mir einen Vorsprung, Milburn, und rufen Sie dann Monroe aus dem Haus. Er wird denken, Sie sind allein. Ich versuche inzwischen, an Sally heranzukommen.“
„Ihr denkt doch nicht“, brummte Baxter, „ich habe den Weg nur zum Vergnügen gemacht, was?“
„Sie sollten da drüben bei den Kipploren in Schussposition gehen, Baxter, und eingreifen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.“
„Einverstanden! “
Baxter humpelte in die Nacht hinein. Die Nähe seines Todfeindes, das Bewusstsein der bevorstehenden Abrechnung schien seine Kräfte verdoppelt zu haben.
Tonto nickte Milburn zu.
„Geben Sie mir drei Minuten! Dann rufen Sie Monroe heraus! Aber Vorsicht, Cleve!“
„Ich weiß! Gehen Sie nur, Tonto!“ Lautlos glitt Tonto in die Dunkelheit zwischen den Mannschaftsbaracken hinein. Seine Hände umschlossen fest den Schaft des Henry Gewehrs. Es dauerte keine drei Minuten, bis er die Seitenwand von Monroes Blockhaus erreicht hatte. Drinnen war es totenstill. Tonto schaute sich nach einer Möglichkeit um, unbemerkt ins Haus einzudringen. Die Läden an der Seitenwand waren geschlossen.
Ein spähender Blick über die Schulter zeigte Tonto, dass sich Cleve Milburns schlanke Gestalt auf den freien, von Sternenlicht matt überglänzten Platz zwischen den Gebäuden schob. Gleich darauf gellte die Stimme von Sallys jungem Bruder zur Hütte herüber.
„Monroe! Elmer Monroe, hören Sie mich?“
Im Blockhaus klopften harte Tritte. Jemand näherte sich der Tür. Tontos Blick wanderte an der Balkenwand hoch und entdeckte dicht unter dem schrägen Dach eine Luke, deren Verschlag halb offenstand.
Während vorne die Tür mit einem Knarren aufschwang und sich ein Lichtstrahl ins Freie ergoss, packte Tonto einen vorspringenden Balken, zog sich daran, das Gewehr auf dem Rücken, empor und erreichte die Luke. Mit einer Hand festgeklammert, stieß er mit der anderen den Verschlag vollends auf und ließ sich schweratmend hineingleiten.
Drinnen umfing ihn undurchdringliche Dunkelheit. Die Dachbalken waren so niedrig über ihm, dass er sich nur auf Händen und Knien voranbewegen konnte.
Unten schallte Monroes harte Stimme.
„Wer ist da? Seien Sie bloß vorsichtig, Mann, ich halte meinen Colt in der Faust!“
„Ich bin es, Monroe – Cleve Milburn!“
„Zum Henker! Was willst du?“
„Das fragen Sie noch?“ Milburns Stimme zitterte vor Wildheit.
„Ich will, dass Sie Sally herausgeben, Sie gemeiner Schurke!“
Tonto begriff, dass jetzt jede Sekunde kostbar war. Wie labil Cleve Milburn auch sein mochte, für seine Schwester würde er alles tun! Tonto hoffte verzweifelt, dass Cleve jetzt keine Voreiligkeit beging.
„Scher dich zum Teufel, Junge!“, grollte Monroe laut.
Milburn erwiderte heftig: „Ich gehe nicht ohne Sally, Monroe!“
*
Der Minenbesitzer lachte rau.
„Dann hol sie doch, du Dummkopf! Los, komme doch! Komm und kämpfe um sie!“
Schritte knirschten auf dem freien Platz. Milburn näherte sich dem Blockhaus.
Tonto biss die Zähne zusammen. Wenn er nicht schleunigst die junge Frau in Sicherheit brachte, konnte es zu spät sein. Cleve hatte jetzt vergessen, dass er Monroe nur hinhalten sollte. Er wollte seinen Kampf!
Licht sickerte spärlich durch Ritzen im Bretterboden zu Tonto herauf. Er presste sich nieder und drückte ein Auge gegen einen Spalt. Sein Atem schien zu stocken, als Tonto unten im lampenlichterhellten Raum Sally auf einem Stuhl sitzen sah. Sie war festgebunden. Ein straff vor den Mund geknotetes Tuch hinderte sie am Rufen. Die Bluse an ihrer linken Schulter war bis zur Brust zerfetzt, und die Haut schimmerte durch. Ihr langes kupfernes Haar flammte im Licht.
Tonto fiel es schwer, klaren Kopf zu behalten.
Draußen rief Milburn: „Monroe, ich warne Sie! Ich bin nicht mehr der harmlose Junge, der vor Ihnen kuschte! Ich werde kämpfen, Monroe!“
„Dann los doch!“, lachte Monroe überheblich. „Meinst du etwa, ich habe Angst vor dir, heh?“
Das Schrittemahlen verstummte. Jeden Moment konnten da unten tödliche Schüsse aufrasen.
Tontos tastende Hände fanden im Dunkeln den Riegel einer Klapptür. Er schob ihn zur Seite und hob vorsichtig die Klappe hoch. Die Scharniere waren geölt, kein Laut entstand. Licht flutete herauf und spülte gelb über Tontos steinhartes Gesicht.
Er konnte jetzt Sallys ganze Gestalt sehen. Verzweifelt zerrte sie an den Fesseln. Sie lockerten sich nicht. Ihr Blick war starr zur Vorderwand des Blockhauses gerichtet, wo Monroe in der offenen Tür stand.
Tonto öffnete die Klappe ganz und zog die Beine zum Sprung an. Behutsam nahm er das Gewehr von der Schulter. Die Minute der Entscheidung war gekommen!
„Ich lasse dir den Anfang, Cleve!“, schrie Monroe eben. „Worauf wartest du noch?“
Tonto richtete sich etwas hoch – und erstarrte im nächsten Sekundenbruchteil.
Sein Blick überflog jetzt den ganzen Raum da unten. Es überrieselte ihn eiskalt, als er feststellte, dass Elmer Monroe so selbstsicher war.
Am schmalen Fenster links der Tür kauerten zwei Männer. Jeder hielt einen schussbereiten Revolver ins Freie gerichtet, auf Cleve Milburn, der völlig ahnungslos war!
Jetzt verstand Tonto, warum Monroe so selbstsicher war.
Ehe Milburn noch einen Colt heraus hatte, würden die Schüsse von Monroes beiden Banditen peitschen.
Es gab nur eines, was Sallys jungen Bruder noch retten konnte! Tonto musste auf den eigenen Überraschungsmoment verzichten!
Es war die Entscheidung eines Augenblicks.
Tonto sah, wie sich die Haltung von Monroes Revolverschwingern spannte, wie sich ihre Revolverläufe auf das Ziel einrichteten! Er durfte nicht mehr warten!
Wie eine Stahlfeder schnellte er geduckt hoch und schrie gellend: „Eine Falle, Cleve! Monroe ist nicht allein!“
Dann stieß er sich bereits von der Lukenkante ab und sprang ins goldene Lampenlicht hinein …
*
Wie eine Raubkatze landete er federnd auf beiden Füßen und schwang sein Henry Gewehr in die Höhe. Sallys Kopf ruckte zu ihm herum, ihre Augen weiteten sich. Gleichzeitig warfen sich die Banditen am Fenster halb herum. Einer von ihnen war Nat Henshaw, das erkannte Tonto jetzt. Sein ledernes Gesicht war hassverzerrt.
Monroe auf der Türschwelle fluchte und riss seinen Revolver unter der grauen Anzugsjacke hervor.
Draußen stieß Milburn einen scharfen Schrei aus.
„Tonto!“, gellte Henshaw in einer Mischung aus Hass und Erschrecken. „Fahr zur Hölle!“
Ein Feuerblitz raste aus seiner Revolvermündung. Gleichzeitig feuerte Tonto.
In das Krachen hinein bellte Monroes Colt, der auf den jungen Milburn feuerte, und von draußen erwiderte Sallys Bruder das Feuer.
Plötzlich war die Hölle losgebrochen. Das Plateau hallte von den Detonationen, und milchige Pulverqualmschleier zogen durch das Lampenlicht.
Henshaw wurde von Tontos Kugel gegen die Wand gestoßen. Tonto warf sich voller Wucht gegen Sallys Stuhl. Die junge Frau stürzte auf die Bretter. Über sie und Tonto hinweg jaulte die Kugel des zweiten Desperados und bohrte sich knirschend in die Balkenwand.
Der Verbrecher brachte nur diesen einen Schuss hinaus, dann hatte ihn Tontos Gewehrkugel in die Schulter getroffen. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, dann knickte er in die Knie und rollte ächzend zur Seite.
Tontos Henry Gewehr schwang herum, die Mündung richtete sich auf die Schwelle.
Aber Monroes massige Gestalt war aus der Tür verschwunden.
Geduckt, jeden Augenblick auf einen neuen Schuss gefasst, richtete sich Tonto hoch. Nichts geschah. Drüben rutschte Nat Henshaw eben an der Wand abwärts, fiel auf das Gesicht und regte sich nicht mehr.
*
Schnell bewegte sich Tonto auf Sally zu. Er löste ihre Fesseln und zog das Tuch von ihrem Gesicht. Sie schnappte nach Luft. Dann warf sie die Arme um seinen Nacken und presste sich an ihn. Ihr schmaler Körper bebte.
„Oh, Tonto! Es war so schrecklich, Tonto, so schrecklich!“
„Ganz ruhig, mein Liebes!“, murmelte er. „Ganz ruhig! Nichts wird dir jetzt noch geschehen!“
Er strich zärtlich über ihr volles seidiges Haar.
Plötzlich machte sie sich von ihm los. Ihr Blick flog gehetzt in die Runde.
„Cleve! Was ist aus Cleve geworden?“ Die Furcht machte ihre Stimme schrill. Sie stürzte zur Tür.
„Vorsicht, Sally!“, rief Tonto und bekam ihren Arm zu fassen.
„Monroe ist noch irgendwo da draußen!“
Sie schien nicht zu hören. Ihre Augen waren plötzlich vor Entsetzen geweitet auf eine ganz bestimmte Stelle im Freien gerichtet.
„Cleve!“, schrie sie erstickt. „Um Himmels willen – Cleve!“
Erst jetzt entdeckte auch Tonto die dunkle Gestalt, die am Boden lag und mühsam versuchte, sich hochzustemmen. Sally wehrte sich gegen Tontos harten Griff.
„Lass los! Mein Gott, lass mich zu Cleve, Tonto!“
„Ich werde mich um ihn kümmern!“, stieß er rau hervor. „Verlass um keinen Preis das …“
Mitten im Satz brach er ab. Draußen sprang eine hohe breitschultrige Gestalt aus dem Schatten zwischen den Unterkunftsbaracken auf den verwundeten Milburn zu. Der Lauf eines Colts glänzte bläulich.
„Monroe!“, hauchte Sally entsetzt, und ihr Körper erschauerte.
Elmer Monroes Waffe war auf Sallys Bruder gerichtet.
„Tonto!“, brüllte er dabei. „Jetzt bist du an der Reihe, du verfluchter Kerl. Los, komm ins Freie, Tonto! Aber ohne dein Teufelsgewehr! Und mit erhobenen Händen! Los, komm, du Schuft, oder soll ich Cleve Milburn eine Kugel durch den Kopf jagen, heh?“
In Tontos graugrünen Augen loderte ein unheimliches Feuer. Langsam ließ er Sally los.
„Sie feiger Schuft!“, rief er eisig. „Müssen Sie sich wirklich hinter einem Verwundeten verstecken?“
Monroe lachte hässlich.
„Ich war schon immer ein Mann, der seine Trümpfe richtig auszuspielen wusste! Tonto, durch Worte können Sie nichts mehr erreichen! Entweder Sie kommen jetzt sofort, oder Cleve bekommt meine Kugel! Also?“
Tonto schaute in Sallys Gesicht. Es war kreidebleich, die Lippen blutleer. Sie wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton hervor.
„Tonto!“, schrie Monroe wild. „Ich warte nicht mehr!“
Tontos Gestalt straffte sich.
„Ich komme, Monroe!“
Er ließ das Gewehr auf die Schwelle poltern. Drüben spannte sich Monroes Haltung.
Bevor Tonto ins Freie treten konnte, rief von den leeren abgestellten Kipploren herüber eine harte Stimme:
„Diesmal verrechnest du dich, Elmer Monroe! Dies war deine letzte Gemeinheit, das verspreche ich dir!“
Ein Zucken ging durch die schwere Gestalt des Verbrechers. Er drehte sich halb.
„Wer … wer sind Sie?“
„Man nennt mich Gray Baxter!“
*
Einen Moment stand Monroe ganz reglos. Dann begann er, wild zu fluchen.
Bei den Kipploren bewegte sich ein hoher Schatten. Steine rollten. Dann kam Baxter aus seiner Deckung hervor, einen Colt in der Faust. Er bewegte sich mühsam, sein steifes Bein schleifte nach, mit der Linken hatte er sich auf eine Latte gestützt, die er irgendwo bei den Loren gefunden hatte.
Mit seiner harten Stimme, die fast unheimlich wirkte, rief er: „Auch wenn du Tonto besiegst, Monroe, wird es dir nichts helfen! Dann musst du immer noch mit mir fertig werden, hörst du?“
„Baxter!“, rief Tonto und bückte sich nach seinem Gewehr. „Überlassen Sie die Sache mir!“
„Nein, Tonto! Nein, ich habe bestimmt länger auf diese Minute gewartet als Sie! Monroe, kennst du mich noch?“
Der Minenbesitzer schien Cleve Milburn und Tonto vergessen zu haben. Wie benommen stand er an der Grenze des Lichtstreifens, der aus dem Blockhaus fiel.
„Diese Stimme!“, ächzte er. „Nein, das kann … kann doch nicht … Himmel, das …“
„Ich bin es wirklich!“, sagte Baxter. „All die Jahre hindurch habe ich unter falschem Namen gelebt, damit du nicht vorzeitig gewarnt würdest! Yeah, Elmer Monroe, sieh mich nur näher an! Ich bin nicht tot, ich bin kein Geist! Dein Plan ging damals vor zwanzig Jahren nicht ganz auf! Der Sturz der Kutsche in jene Schlucht hat mich zum Krüppel gemacht, aber ich lebe, und das allein ist wichtig!“
Als Tonto diese Worte hörte, begann in seinem Gehirn alles zu kreisen. Plötzlich hatte er das Gefühl, dies alles nur zu träumen. Wie aus weiter Ferne hörte er den Mann, der sich bisher Gray Baxter genannt hatte, weiterreden: „Zwanzig Jahre habe ich gewartet, Monroe! Jetzt ist es so weit! Ich habe im Osten gelebt, weil ich hoffte, die Ärzte könnten mich gesund machen. Sie haben es nicht ganz geschafft! Dann bin ich in den Westen zurückgekommen, um dir meine Rechnung zu präsentieren! Monroe, was ist aus meinem Sohn geworden, aus Jim? Was hast du mit ihm gemacht?“
„Allan Trafford!“, stöhnte Monroe.
Er bewegte sich Schritt für Schritt nach rückwärts auf den Schatten zu. Sein Gesicht war aschgrau.
„Was ist aus meinem Sohn geworden?“, wiederholte der große grauhaarige Mann.
Da brach endlich Tontos Lähmung.
„Vater!“, schrie er. „Vater, ich bin es!“
Der Ruf lenkte Allan Trafford ab, und sofort riss Elmer Monroe seinen Revolver hoch.
Die Traffords schossen gleichzeitig. Monroes Revolverfaust fiel herab. Der Verbrecher wankte. Noch immer war sein Blick starr auf seinen ehemaligen Partner gerichtet.
„Yeah!“, ächzte er. „Yeah, Allan, er ist dein Sohn!“
*
Dann brach er zusammen.
Minuten später, als die Traffords den verwundeten Cleve Milburn ins Blockhaus gebracht und verbunden hatten, prasselte Hufschlag auf die Felsterrasse. Die Reste der Monroe Revolvergarde kehrten zurück. Sie hatten Denricks Bande zerschlagen und dabei selber hohe Verluste erlitten. Als sie ihren Boss tot zwischen den Häusern liegen sahen, wendeten sie wortlos ihre Gäule und ritten in die Nacht zurück – ein führerloses Rudel, das sich in alle Winde zerstreuen würde.
Drinnen im Blockhaus saß Allan Trafford in einem weichgepolsterten Stuhl und sagte mit einem Hauch warmer Freude in der Stimme: „Wir werden fortgehen von hier! Aus Monroes Besitz will ich nur das Kapital, das ich damals zur Verfügung stellte, zurück. Alles andere sollen die Bewohner von Silverrock übernehmen. Irgendwo im Süden werden wir eine Ranch aufbauen und in Frieden leben. Auch Sie will ich dabei haben, Cleve! Die Angelegenheit mit Ihrem Steckbrief wird sich ja wohl vor einem Richter klären lassen!“ Cleve, um dessen Schulter ein weißer Verband lief, lächelte.
„Einverstanden, Trafford. Nur eines gibt es noch zu klären!“
Trafford schaute ihn fragend an … Cleves Lächeln wurde breiter.
„Wo soll die Hochzeit stattfinden? Im Süden, oder noch hier in Silverrock?“ Er wies mit einer Kopfbewegung auf Tonto Jim Trafford und Sally, die engumschlungen drüben an der Wand standen …
ENDE