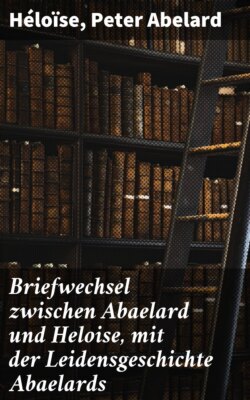Читать книгу Briefwechsel zwischen Abaelard und Heloise, mit der Leidensgeschichte Abaelards - Peter Abelard - Страница 5
Оглавление„Von seinem Namen lebt nur noch ein Schatten,
Wie im fruchtbaren Feld der hohe Eichbaum steht.“
Nachdem ich dies herausgefunden hatte, blieb ich nicht lange müßig in seinem Schatten liegen, sondern besuchte seine Vorlesungen immer seltener. Einige seiner bedeutendsten Schüler waren nun darüber empört, daß ich einem Lehrer von solcher Bedeutung so wenig Achtung zollte und wußten ihn durch allerlei Ränke und Verleumdungen gegen mich einzunehmen. Eines Tags nach Abschluß einer wissenschaftlichen Besprechung unterhielten wir uns in zwangloser Weise. Einer meiner Mitschüler fragte mich bei dieser Gelegenheit, um mich in Verlegenheit zu bringen, was ich vom Lesen der heiligen Schrift halte. Ich, der ich bis jetzt nur weltliche Wissenschaft getrieben hatte, antwortete, daß es kein ersprießlicheres Studium gebe als das der Bibel, weil diese uns über das Heil unserer Seele unterrichte; nur müsse ich mich darüber höchlich wundern, daß den Gelehrten zum Verständnis der heiligen Schriftsteller nicht der einfache Text und etwa die Glossen dazu genügen, sondern daß sie noch weitere Hilfsmittel nötig hätten. Darüber erhob sich ein allgemeines Gelächter und man fragte mich, ob ich mir getraue, einen solchen Versuch zu machen. Ich erwiderte, daß ich zur Probe bereit sei, wenn sie es darauf ankommen lassen wollten. „Gewiß wollen wir,“ antworteten sie mir unter Geschrei und erneutem Gelächter; „man wird Euch zu einem weniger bekannten Text einen Ausleger anweisen und wir werden sehen, wie Ihr Euer Versprechen haltet.“
Sie vereinigten sich nun auf ein höchst schwieriges Kapitel des Propheten Ezechiel; ich nahm den Ausleger an und lud sie schon auf den folgenden Tag zu einer Vorlesung ein. Sie jedoch wollten mich gegen meinen Willen eines Besseren belehren und meinten, eine so wichtige Sache dürfe man nicht übereilen; da ich in diesem Fache doch noch wenig Übung habe, müsse ich mehr Zeit auf die Ausarbeitung meiner Erklärung verwenden. Allein ich antwortete in gereiztem Tone, daß ich gewohnt sei, mich nicht auf eine möglichst lange Frist, sondern auf meinen Verstand zu verlassen, und ich werde überhaupt die ganze Sache aufgeben, wenn sie sich nicht ohne Verzug zu der Vorlesung einfinden wollten, wann ich es wünsche. Zu meiner ersten Vorlesung fanden sich nun allerdings nur wenige ein; die meisten fanden es lächerlich, daß ich — bisher ganz unbewandert im Studium der heiligen Schrift — damit so kurzer Hand verfahren wollte. Denen aber, die meiner Vorlesung anwohnten, gefiel sie so gut, daß sie sie nicht genug loben konnten und mich drängten, meine Erklärung nach dieser meiner Methode fortzusetzen. Als dies bekannt wurde, beeilten sich auch die, die bisher ferngeblieben waren, in die zweite und dritte Vorlesung zu kommen, und waren eifrig darauf bedacht, von dem, was ich am ersten Tag gelesen hatte, sich eine Abschrift zu verschaffen.
Die Folge davon war, daß der alte Anselm von gewaltiger Eifersucht befallen wurde, und da er schon vorher infolge mißgünstiger Einflüsterungen nicht gut auf mich zu sprechen war, verfolgte er mich nun wegen meiner theologischen Vorlesungen gerade so, wie es einst Wilhelm wegen der philosophischen gethan hatte.
Für seine beiden bedeutendsten Schüler galten damals Alberich von Rheims und Lotulph aus der Lombardei; jemehr diese von sich selber eingenommen waren, destoweniger waren sie mir hold. Es hat sich nachmals herausgestellt, daß Anselm sich durch ihre Vorstellungen bestimmen ließ, mir die Fortsetzung meiner begonnenen Erklärung am Schauplatz seiner Lehrthätigkeit kurzweg zu untersagen, unter dem Vorwand, es möchten, da meine Erfahrung in diesem Fache noch mangelhaft sei, Verstöße vorkommen, für die er dann verantwortlich gemacht werden würde. Als dies meinen Schülern zu Ohren kam, war ihre Entrüstung über einen so unverblümten Brotneid groß; denn deutlicher konnte sich ja die Eifersucht nicht zu erkennen geben. Je mehr ich übrigens unter solchen Verfolgungen zu leiden hatte, desto größer wurde dadurch mein Ansehen und mein Ruhm.
So kehrte ich denn auch bald nach Paris zurück, und hatte dort den mir schon längst bestimmten und angebotenen Lehrstuhl, von dem ich vertrieben worden war, einige Jahre in ungestörter Ruhe inne; gleich im Anfang meiner Wirksamkeit ging mein Streben dahin, jene Glossen zu Ezechiel zu vollenden, die ich in Laon begonnen hatte. Dieses Werk fand beim Publikum eine äußerst günstige Aufnahme, und man hörte bereits das Urteil, daß meine theologische Begabung in nichts hinter meiner philosophischen zurückbleibe. Die Begeisterung für meine Vorlesungen in beiden Fächern vermehrte die Zahl meiner Schüler ganz erheblich; welcher Gewinn, welcher Ruhm mir daraus erwuchs, das ist auch dir gewiß nicht unbekannt geblieben. Allein das Glück hat von jeher die Thoren aufgebläht; die Sicherheit dieser Welt schwächt die Kräfte der Seele und der Geist erliegt dann nur allzu leicht den Lockungen des Fleisches. So ging es auch mir: schon hielt ich mich für den einzigen Philosophen in der Welt, der von keiner Seite mehr einen Angriff zu fürchten brauche, und ich, der bis jetzt die strengste Enthaltsamkeit geübt hatte, begann nun meinen Leidenschaften die Zügel schießen zu lassen. Je mehr ich in Philosophie und Theologie Fortschritte machte, desto weiter blieb ich mit meinem unreinen Lebenswandel hinter den Philosophen und den Heiligen zurück. So viel ist sicher, daß die Philosophen und noch mehr die Heiligen, d. h. die, die ihr Leben nach den Geboten der heiligen Schrift einrichteten, ihr Ansehen hauptsächlich ihrer Enthaltsamkeit verdanken. Ich nun war ganz und gar von der Krankheit des Stolzes und der Sinnlichkeit befallen, aber Gott hat mich in seiner Gnade von beiden Übeln geheilt, freilich gegen meinen Willen, und zwar zuerst von der Sinnlichkeit, dann vom Stolz. Von der Sinnlichkeit, indem er mich dessen beraubte, womit ich ihr gefrönt hatte; vom Stolz, der sich auf mein Wissen gründete — denn „Wissen bläht auf“, sagt der Apostel — indem er mich die Demütigung erleben ließ, daß mein berühmtestes Buch verbrannt wurde.
Ich möchte, daß du mit der Geschichte dieser Vorgänge nicht bloß durchs Hörensagen bekannt würdest, sondern durch eine getreue, dem Gang der Ereignisse folgende Darstellung. Vor dem schmutzigen Verkehr mit Buhlerinnen hatte ich von jeher einen Abscheu, andererseits ließ mich mein Studium, das mich ganz und gar in Anspruch nahm, nicht zum Umgang mit edleren Frauen kommen, auch war ich in den Umgangsformen weltlichen Verkehrs nicht bewandert. Da fand das Schicksal, mich scheinbar hätschelnd, in Wirklichkeit aber mir feindlich gesinnt, ein bequemes Mittel, um mich von dem Gipfel meiner Größe herabzustürzen — ja vielmehr die göttliche Liebe wollte mich, der ich in meinem Übermut des Dankes gegen die Gnade Gottes vergessen hatte, durch eine tiefe Demütigung auf den rechten Weg zurückbringen.
Es lebte in Paris eine Jungfrau Namens Heloise, die Nichte eines Kanonikus Fulbert, der ihr zuliebe alles that, um an ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nichts zu verabsäumen. Gehörte sie schon ihrem Äußern nach nicht zu den letzten, so war sie durch den Reichtum ihres Wissens weitaus die erste. Denn je seltener man den Vorzug wissenschaftlicher Bildung bei Frauen findet, destomehr Reiz verlieh sie diesem Mädchen, das sich dadurch bereits im ganzen Lande einen Namen gemacht hatte. Sie, die ich mit allem geschmückt sah, was Liebe zu wecken pflegt, gedachte ich nun durch Bande der Liebe an mich zu fesseln, und zweifelte keinen Augenblick an meinem Erfolg. Mein Name war damals hoch gefeiert und ich stand in der Blüte männlicher Jugendschöne, so daß ich keine Zurückweisung fürchten zu müssen glaubte, wenn ich eine Frau meiner Liebe würdigte, mochte sie sein, wer sie wollte. Von Heloise aber glaubte ich, daß sie sich mir um so lieber ergeben werde, als sie wissenschaftliche Bildung besaß und eine Vorliebe für die Wissenschaften hatte. Ich sagte mir, daß wir infolgedessen selbst in die Ferne schriftlich miteinander verkehren konnten, daß man dabei der Feder manches kühne Wort vertrauen könne, das die Lippe nicht gewagt hätte, und daß uns so allezeit Gelegenheit zum süßesten Gedankenaustausch geboten sei.
Von glühender Liebe zu diesem Mädchen erfüllt, suchte ich nach einer Gelegenheit, um sie durch täglichen Verkehr in ihrem Hause näher kennen zu lernen und sie meinen Wünschen gefügig zu machen. Ihres Oheims eigene Freunde waren mir dabei behilflich; ich kam mit ihm überein, daß er mich um eine beliebige Entschädigung in sein Haus aufnehmen sollte, das ganz in der Nähe meiner Schule lag. Ich gebrauchte dabei den Vorwand, daß mir bei meinem Gelehrtenberuf die Sorge für meine leibliche Notdurft hinderlich sei und mir auch zu teuer zu stehen komme. Nun war Fulbert ein großer Geizhals, dabei aber doch darauf bedacht, daß seine Nichte in ihrer gelehrten Bildung möglichst große Fortschritte mache. Beides zusammen verschaffte mir ohne Schwierigkeiten die Einwilligung zu dem, was ich wollte: einerseits war der Alte auf das Geld aus, andererseits versprach er sich von meinem Unterricht einen Vorteil für das Mädchen. Ja, er kam selber meinen Wünschen über alles Erwarten entgegen und leistete unbewußt meiner Liebe Vorschub. Er überließ mir Heloise ganz und gar zur Erziehung und bat mich obendrein dringend, ich möchte doch ja alle freie Zeit, sei’s bei Tag oder bei Nacht, auf ihren Unterricht verwenden, ja, wenn sie sich träge und unaufmerksam zeige, solle ich sie rücksichtslos bestrafen. Ich mußte nur staunen über eine solch grenzenlose Einfalt, die das unschuldige Lamm dem hungrigen Wolf anvertraute. Er gab sie mir also nicht bloß in die Lehre, sondern übertrug mir auch das Recht der Züchtigung. War damit meinen Wünschen nicht Thür und Thor geöffnet? Machte er es mir auf diese Weise doch möglich, ohne daß ich es wollte, mit Drohen und Schlagen zum Ziele zu gelangen, wenn die Worte der Verführung nichts nutzten! Aber ein Zweifaches hielt jeden Verdacht fern von ihm: die Liebe zu seiner Nichte und die allbekannte Unbescholtenheit meines bisherigen Lebens.
Was soll ich weiter viel sagen? Zuerst Ein Haus, dann Ein Herz und Eine Seele. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft gaben wir uns ganz der Liebe hin und unsere Beschäftigung bot uns von selbst die Gelegenheit des Alleinseins, wie Liebende sie wünschen. Da war denn freilich über dem offenen Buche mehr von Liebe die Rede als von Wissenschaft, da gab es mehr Küsse als weise Sprüche. Nur allzu oft verirrte sich die Hand von den Büchern weg zu ihrem Busen, und eifriger als in den Schriften lasen wir eins in des andern Augen; ja, um jeden Verdacht unmöglich zu machen, ging ich einigemale soweit, daß ich sie züchtigte. Aber es war Liebe, die schlug, nicht Grimm; Neigung, nicht Zorn, und diese Züchtigungen waren süßer als aller Balsam der Welt. Kurz: die ganze Stufenleiter der Liebe machte unsre Leidenschaft durch, und wo die Liebe eine neue Entzückung erfand, da haben wir sie genossen. Der Reiz der Neuheit, den diese Freuden für uns hatten, erhöhte nur die Ausdauer unserer Glut und unsere Unersättlichkeit. Je mehr ich ein Sklave der Lust geworden war, destoweniger hatte ich mehr übrig für Wissenschaft und Schule. Es war mir im Innersten zuwider, vor meine Schüler hinzutreten und unter ihnen zu weilen; zugleich war es ein aufreibendes Leben, das ich führte: meine Nächte gehörten der Liebe, die Tage der geistigen Arbeit. Meine Vorträge waren gleichgültig und matt, meine Rede sprühte nicht mehr von Funken des Geistes, erhob sich nicht mehr über das Gewöhnliche. Ich konnte nur noch wiederholen, was ich früher ausgedacht hatte, und wenn ich dann und wann noch imstande war, ein Lied zu dichten, so sang ich vom Lob der Minne, nicht von den Tiefen der Weisheit. Die meisten dieser Lieder leben noch jetzt, wie du wohl weißt, da und dort im Munde des Volkes und werden von denen gesungen, die Gleiches erleben.
Von der Trauer, dem Jammer, den Klagen meiner Schüler als sie entdeckten, daß ich innerlich in dieser Weise in Anspruch genommen, ja gestört sei, kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Eine Sache, die so klar am Tage lag, konnte ja unmöglich ein Geheimnis bleiben, und ich glaube fast: nur der Mann wußte nichts davon, dessen Ehre dabei am meisten auf dem Spiele stand, der Oheim des Mädchens selbst. Zwar wurde er mehrmals und von verschiedenen Seiten gewarnt; allein er schenkte solchen Einflüsterungen keinen Glauben und zwar aus den oben genannten Gründen, wegen der unbegrenzten Liebe zu seiner Nichte und wegen der unbezweifelten Reinheit meines Vorlebens. Denn wohl fällt es uns schwer, von denen, die wir lieben, Schlechtes zu glauben, und wahre Liebe weiß nichts von dem schleichenden Gifte des Argwohns. So schreibt auch der heilige Hieronymus in seinem Brief an Sabinianus: „Gewöhnlich erfahren wir selbst es zuletzt, wenn in unserem Hause etwas nicht in Ordnung ist, und wissen nichts von den Fehlern unserer Kinder und Frauen, wenn die Nachbarn schon laut davon sprechen.“ — Aber wenn auch spät, einmal wird es doch offenbar; was alle wissen, bleibt einem einzigen auf die Dauer auch nicht verborgen.
Dies war, nachdem einige Monate verflossen waren, auch das Schicksal unserer Liebe. Ach, wie zerriß diese Entdeckung dem Oheim das Herz! Wie groß war der Schmerz, der die Liebenden selbst durch die nun folgende Trennung traf! Welche Schande, welche Verlegenheit für mich! Mit welcher Verzweiflung erfüllte mich das Unglück des Mädchens! Welche Qualen, welche Trauer über den Verlust meines eigenen guten Leumunds stand ich aus! Jedes von uns beklagte nicht sein eigenes Mißgeschick, sondern nur das des andern. Allein die körperliche Trennung befestigte nur das Band unserer Seelen und unsere Liebe wurde um so glühender, je mehr die Befriedigung ihr fehlte. Nachdem unsre Leidenschaft einmal die Fesseln der Scham durchbrochen hatte, wurden wir unempfindlich gegen sie, und das Schamgefühl hatte um so weniger Einfluß auf uns, je lockender die Sünde erschien, die wir begangen. Wir erlebten an uns dasselbe, was der Dichter von Mars und Venus erzählt, als sie bei einander überrascht wurden.
Bald darauf fühlte Heloise sich Mutter; in der höchsten Freude benachrichtigte sie mich davon und fragte mich um Rat, was nun zu thun sei. Nachdem wir vorher darüber eins geworden waren, entführte ich sie ihrem Oheim in einer Nacht, da er nicht zu Hause war. Unverzüglich geleitete ich sie in meine Heimat zu meiner Schwester, bei der sie bis zur Geburt eines Knäbleins verblieb, dem sie den Namen Astralabius gab. Fulbert gebärdete sich bei seiner Heimkehr wie ein Rasender; nur wer es selbst mit ansah, kann sich eine Vorstellung machen von der Wut seines Schmerzes und von seiner peinlichen Verlegenheit. Er wußte nicht, was er mir anthun, welche Rache er an mir nehmen sollte. Mir nach dem Leben zu stehen oder mir einen leiblichen Schaden zuzufügen — davon hielt ihn die Angst ab, seine vielgeliebte Nichte möchte dies bei den Meinigen zu büßen bekommen. Auch konnte er sich nicht etwa meiner Person bemächtigen und mich mit Gewalt in irgend einen Gewahrsam bringen. Denn gerade in dem Punkt war ich sehr auf meiner Hut; ich kannte ihn als einen Mann, der sich nicht lange besinnen würde, wenn sich gute Gelegenheit zu einem Wagnis böte. Zuletzt aber bekam ich selbst Mitleid mit dem ungemessenen Schmerz des Mannes, auch machte ich mir Gewissensbisse über die Art und Weise, wie ich ihn um meiner Liebe willen hintergangen hatte, und klagte mich des schwärzesten Verrates gegen ihn an. So ging ich denn zu Fulbert, bat ihn um Vergebung und bot ihm jede beliebige Entschädigung an. Ich beteuerte ihm, daß niemand über meine That befremdet sein könne, der die Macht der Liebe einmal erfahren habe und der wisse, wie schmählich von Anbeginn der Welt an selbst die größten Männer durch die Weiber zu Fall gebracht worden seien. Um ihn völlig zu besänftigen, bot ich ihm eine Genugthuung an, die er nicht erwarten konnte: nämlich das verführte Mädchen zu meiner rechtmäßigen Frau zu machen, unter der einen Bedingung, daß unsere Ehe geheim bleiben sollte, damit ich an meinem Ruf keine Einbuße erleide. Fulbert ging darauf ein und er sowohl als seine Freunde gaben mir die Hand darauf und besiegelten durch Küsse den Friedensschluß — nur um mich desto sicherer zu verraten.
Ich kehrte nun in meine Heimat zurück und holte die Geliebte ab, um sie zu meiner Frau zu machen. Aber Heloise war keineswegs damit einverstanden und riet mir aus zwei Gründen dringend von meinem Vorhaben ab: nämlich wegen der Gefahr und wegen der Unehre, der ich mich dadurch aussetze. Sie versicherte mich, Fulbert lasse sich durch keine Genugthuung über das, was geschehen sei, beruhigen. Es zeigte sich später, daß sie recht hatte. Sie fragte mich, wie sie sich meines Besitzes sollte freuen können, wenn sie dadurch meinen Ruhm untergrabe und sich und mich zugleich erniedrige. Wie könnte sie es vor der Welt verantworten, wenn sie ihr eine solche Leuchte entzöge! Wie viel Verwünschungen würden diesem Ehebund nachgesandt werden, welcher Schaden würde der Kirche daraus erwachsen, wie viel Thränen würde die Wissenschaft darüber vergießen! Wie erbärmlich und kläglich wäre es, wenn ein Mann wie ich, geschaffen für die ganze Welt, sich durch ein Weib binden lassen und sich unter ein schimpfliches Joch beugen wollte! Sie verwarf diese Ehe aufs lebhafteste, da sie mir in jeder Hinsicht nachteilig und eine Last sei. Sie hielt mir ferner die geringe Achtung vor, in der die Ehe stehe und die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden seien, zu deren Vermeidung der Apostel uns mahnt mit den Worten: „Bist du los vom Weib, so suche kein Weib. So du aber freiest, sündigest du nicht, und so eine Jungfrau freiet, sündiget sie nicht; doch werden solche leibliche Trübsal haben; ich verschonete aber euer gerne.“ — Und noch einmal sagt er: „ich wollte aber, daß ihr ohne Sorge wäret.“ — Und wenn ich weder den Rat des Apostels noch die Warnungen der heiligen Väter vor dem Joch der Ehe annehmen wolle: so möchte ich doch wenigstens auf die Philosophen hören und auf das, was in dieser Hinsicht entweder durch sie oder über sie geschrieben worden sei. Auch die Kirchenväter beziehen sich ja vielfach auf sie, um uns zu warnen. Als Beispiel führte sie den heiligen Hieronymus an, der im ersten Kapitel seiner Schrift „Gegen Jovinianus“ von Theophrastus erzählt, daß dieser in einer ausführlichen Besprechung der unerträglichen Beschwerden und beständigen Aufregungen, die der Ehestand mit sich bringe, schließlich mit den überzeugendsten Gründen zu dem Schluß komme: der Weise sollte überhaupt nicht heiraten. Am Schluß seiner Betrachtungen über jene Äußerungen des Philosophen sagt Hieronymus selbst: „Welcher Christ muß sich nicht beschämt fühlen, wenn er einen Theophrastus also reden hört?“ In derselben Schrift — fuhr Heloise fort — führt Hieronymus das Beispiel Ciceros an. Als dieser sich von Terentia hatte scheiden lassen, redete ihm sein Freund Hircius zu, er solle seine Schwester heiraten; allein er lehnte dies entschieden ab, da er sich nicht zugleich einer Frau und der Philosophie widmen könne. Er sagt nicht einfach „sich widmen“, sondern fügt das Wort „zugleich“ hinzu. Er wollte nichts thun, was ihn verhindert hätte, seine Aufmerksamkeit völlig auf die Philosophie zu beschränken.
Doch ich will davon nicht weiter sprechen, welches Hindernis für deinen gelehrten Beruf eine bürgerliche Ehe wäre. Denke nur an das übrige, was sie in ihrem Gefolge hätte. Was für ein Durcheinander! Schüler und Kammerzofen, Schreibtisch und Kinderwagen! Bücher und Hefte beim Spinnrocken, Schreibrohr und Griffel bei den Spindeln! Wer kann sich mit Betrachtung der Schrift oder mit dem Studium der Philosophie abgeben und dabei das Geschrei der kleinen Kinder, den Singsang der Amme, der sie beruhigen soll, die geräuschvolle Schar männlicher und weiblicher Dienstboten hören? Wer mag die beständige widerliche Unreinlichkeit der Kinder gern ertragen? Reiche Leute wissen sich in dieser Beziehung zu helfen, das gebe ich zu, denn sie sind in ihren fürstlichen Räumen nicht beschränkt, sie brauchen in ihrem Überfluß nicht auf die Kosten zu sehen und die Sorge ums tägliche Brot liegt ihnen fern. Allein die Lage der Philosophen ist eine andere als die der Reichen und wiederum: wer nach irdischen Schätzen trachtet und in die Sorgen dieser Welt verwickelt ist, hat keine Zeit für göttliche oder philosophische Dinge.
Darum haben auch die großen Philosophen der alten Zeit voll Weltverachtung das Leben in der Welt aufgegeben, ja förmlich geflohen, jeden irdischen Genuß sich versagend, um allein in den Armen der Weisheit Ruhe zu finden. Einer der größten von ihnen, Seneca, giebt dem Lucilius folgende Anweisung: „Nicht bloß deine freie Zeit darfst du der Philosophie widmen: ihr zulieb muß man alles andere hintansetzen, nie kann man auf sie zu viel Zeit verwenden. Vernachlässigst du das Studium der Philosophie eine Zeitlang, so ist dies fast ebenso, wie wenn du es ganz aufgeben würdest; denn durch zeitweise Unterbrechung geht der ganze Gewinn verloren. Anderweitigen Ansprüchen müssen wir aus dem Wege gehen und sie fern von uns halten, statt sie zu befriedigen.“ Was noch jetzt unsere Mönche, wenigstens die diesen Namen wahrhaft verdienen, aus Liebe zu Gott thun, das thaten in der alten Zeit aus Liebe zur Weisheit die edlen heidnischen Philosophen. Denn in jedem Volke, sei es heidnischen, jüdischen oder christlichen Glaubens, hat es von jeher Männer gegeben, die durch Glauben oder Sittenreinheit über den anderen standen und durch einen besonderen Grad von Enthaltsamkeit und Strenge von der großen Menge geschieden waren.
So gab es bei den Juden von alters her Nasiräer, die sich nach einer besonderen Gesetzesvorschrift Gott weihten; da waren ferner die Söhne der Propheten, die Jünger des Elia und Elisa, die uns im Alten Testament nach dem Zeugnis des heiligen Hieronymus wie Mönche beschrieben werden. Etwas ähnliches waren auch jene drei philosophischen Sekten, die Josephus in seinen „Altertümern“, Kapitel XVIII, aufzählt und teils Pharisäer, teils Sadducäer, teils Essäer nennt. Bei uns sind die Mönche an ihre Stelle getreten, die entweder das gemeine Leben der Apostel nachahmen, oder nach dem ältern Vorbild das Einsiedlerleben des Johannes. Die Heiden aber hatten dafür, wie gesagt, ihre Philosophen. Denn unter dem Namen „Weisheit“ oder „Philosophie“ verstanden sie weniger den Betrieb der Wissenschaft als eine gottgeweihte Lebensführung; dies lehrt uns die ursprüngliche Bedeutung des Wortes und außerdem auch das Zeugnis der heiligen Väter. So sagt der heilige Augustin im achten Kapitel seines Buches „Vom Gottesstaat“, wo er die verschiedenen Philosophenschulen aufzählt, folgendes: „Der Stifter der Italischen Schule ist Pythagoras von Samos; man sagt, daß von ihm der Name ‚Philosophie‘ herrühre. Früher nämlich wurden Männer, die sich durch tadellose Lebensführung irgendwie über die andern erhoben, Weise genannt. Pythagoras dagegen sagte, als man ihn nach seinem Beruf fragte, er sei ein Philosoph, d. h. ein Jünger oder Liebhaber der Weisheit; sich einen Weisen zu nennen, hielt er für eine Anmaßung.“
Nun geht aus den Worten: „die sich durch tadellose Lebensführung irgendwie über die andern erhoben“ — deutlich hervor, daß die heidnischen Weisen, d. h. die Philosophen, ihren Namen nicht dem Ruhm ihres Wissens, sondern der Vortrefflichkeit ihres Lebenswandels verdankten. Für die Nüchternheit und Enthaltsamkeit ihres Lebens brauche ich dir aber nicht erst Beispiele anzuführen: das hieße Eulen nach Athen tragen. Wenn aber Laien, und dazu Heiden, durch kein religiöses Gelübde gebunden, also gelebt haben, was wirst dann du zu thun haben, du, ein Geistlicher und Chorherr? Wolltest du dem Dienste Gottes niedrige Sinnenlust vorziehen und dich in ihren Strudel hineinziehen lassen, wolltest du in diesem Schlamm versinken, jeder Scham bar und ohne Hoffnung auf Rückkehr? Wenn dich die Rücksicht auf deinen geistlichen Beruf nicht zurückzuhalten vermag, so wirf wenigstens die Würde des Philosophen nicht weg. Lässest du die Gottesfurcht außer acht, so möge doch das Ehrgefühl deine Begierde zügeln. Denke an die unglückselige Ehe des Sokrates, und wie schwer er den Verrat an der Philosophie büßen mußte, allen anderen zum abschreckenden Beispiel. Hieronymus spricht davon im ersten Buch seiner Schrift „Gegen Jovinianus“, wo er eben von Sokrates erzählt: „Xanthippe überschüttete ihn einmal vom Fenster aus mit einer endlosen Flut von Schimpfworten. Sokrates ließ es ruhig über sich ergehen, und als ihm seine Ehehälfte auch noch schmutziges Wasser auf den Kopf goß, trocknete er sich ruhig ab und sagte: ‚Ich wußte wohl, daß ein solches Donnerwetter nicht ohne Regen bleiben werde.‘“
Heloise stellte mir außerdem noch vor, wie gefährlich es für mich sei, sie nach Paris zurückzuführen, und wie viel lieber sie meine Geliebte als meine Gattin heißen wolle, abgesehen davon, daß jenes für mich ehrenvoller sei. Einzig und allein der freien Liebe wolle sie meinen Besitz verdanken, nicht dem Zwang des ehelichen Bandes. Und je seltener unsere Zusammenkünfte stattfinden könnten, desto süßer werden die Freuden unserer Vereinigung nach der zeitweiligen Trennung sein.
Da sie nun durch derartige Ratschläge und Warnungen meinen verblendeten Sinn nicht umzustimmen vermochte und mich doch auch nicht beleidigen wollte, brach sie ihre Vorstellungen unter Seufzen und Thränen mit den Worten ab: dies allein bleibt uns noch zu thun übrig: so wird unser gemeinsames Verderben besiegelt sein und ein Jammer über uns kommen, so groß wie einst unser Liebesglück war. Und auch darin — die ganze Welt weiß es — hatte ihr prophetischer Geist nur allzurichtig gesehen.
Wir ließen unser Kind in der Obhut meiner Schwester und kehrten heimlich nach Paris zurück. Dort wurden wir bald nach unserer Ankunft eines Morgens in aller Frühe getraut, nachdem wir die Nacht in einer Kirche mit der Feier der Vigilien in der Stille verbracht hatten. Als Zeugen waren zugegen der Oheim Heloisens, sowie einige Verwandte von meiner und ihrer Seite. Dann trennten wir uns alsbald — jedes ging still seines Wegs, und von da an sahen wir uns nur noch selten und verstohlen, da unsere Ehe geheim bleiben sollte.
Heloisens Oheim jedoch und seine Angehörigen, die den ihnen zugefügten Schimpf immer noch nicht verschmerzt hatten, fingen an, unser Ehebündnis bekannt zu machen und brachen damit das Versprechen, das sie mir gegeben hatten. Heloise ihrerseits verschwor sich hoch und teuer, daß jene lügen, und zog sich dadurch vielfach Mißhandlungen des erbitterten Fulbert zu. Als ich davon hörte, brachte ich sie in das Nonnenkloster Argenteuil bei Paris, in dem Heloise erzogen worden war. Ich ließ sie auch die Gewandung anlegen, die das Klosterleben erfordert — mit Ausnahme des Schleiers. Nun aber glaubten Fulbert und seine Verwandten, ich hätte sie jetzt erst recht hintergangen und Heloise zur Nonne gemacht, um sie los zu werden. Aufs höchste entrüstet vereinigten sie sich zu meinem Verderben. Nachdem sie meinen Diener durch Geld gewonnen hatten, nahmen sie eines Nachts, als ich ruhig in meiner Kammer schlief, die denkbar grausamste und beschämendste Rache an mir, so daß alles darüber entsetzt war: sie beraubten mich dessen, womit ich begangen hatte, worüber sie klagten. Die Thäter ergriffen alsbald die Flucht, zwei von ihnen wurden jedoch festgenommen, geblendet und entmannt. Einer davon war jener Diener, der stets in meiner Umgebung gewesen und durch seine Geldgier zum Verräter an mir geworden war.
Als es Tag wurde, strömte die ganze Stadt vor meiner Wohnung zusammen, und es ist schwer, ja geradezu unmöglich, die Äußerungen des Entsetzens, des Jammers, des Geschreis, der Klagen zu beschreiben, die nun laut wurden. Hauptsächlich die Kleriker und ganz besonders meine Schüler vermehrten meine Qual durch ihre unerträglichen Lamentationen. Ihr Mitleid war mir schmerzlicher, als meine Wunde selber; das Gefühl meiner Schmach war lebendiger in mir als der körperliche Schmerz, ich dachte mehr an die Schande als an die Verletzung. Der hohe Ruhm, dessen ich mich eben noch erfreut hatte — wie schwer war er in einem Augenblick geschädigt worden! Ja, vielleicht war er für immer dahin! Wie gerecht war Gottes Strafe, die mich an dem Teil meines Körpers schlug, mit dem ich gesündigt hatte! Wie recht hatte der, den ich zuerst verraten hatte, wenn er mir nun Gleiches mit Gleichem vergalt! Wie werden — so sagte ich mir — meine Widersacher die Gerechtigkeit preisen, die hier so offenbar waltete! In welch untröstliche Betrübnis wird dieser Schlag meine Eltern und Freunde versetzen! Wie wird die Kunde von dieser seltenen Schmach die ganze Welt durchlaufen! Blieb mir überhaupt noch ein Ausweg? Wie konnte ich’s noch wagen, in der Öffentlichkeit zu erscheinen, da alles mit Fingern auf mich deuten und hinter mir herzischeln mußte? Würde ich nicht von allen als ein ungeheuerliches Schauspiel betrachtet werden?
Nicht zum wenigsten ängstigte mich auch die folgende Erwägung: nach dem tötenden Buchstaben des Gesetzes sind Eunuchen vor Gott ein solcher Greuel, daß Leute, die ihrer Mannheit beraubt sind, als anrüchig und unrein den Tempel nicht betreten dürfen, und daß sogar Tiere, bei denen dies der Fall ist, nicht zum Opfer zugelassen werden. Im Levitikus heißt es: „Du sollst dem Herrn kein Zerstoßenes oder Zerriebenes oder Zerrissenes oder was verwundet ist, opfern“ — und 5. Mos., Kap. 23: „Es soll kein Zerstoßener noch Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen.“
In dieser verzweifelten Lage trieb mich weniger ein aufrichtiges religiöses Bedürfnis — ich gestehe es offen — als die Verlegenheit und die Scham in den bergenden Schutz der Klostermauern. Heloise hatte schon vorher auf meinen Wunsch bereitwillig den Schleier genommen. Und so trugen wir nun beide das geistliche Gewand: ich in der Abtei von St. Denis, sie im Kloster von Argenteuil. Noch erinnere ich mich: man hatte vielfach Mitleid mit ihrer Jugend und stellte ihr, um sie abzuschrecken, das Joch der Klosterregel als eine unerträgliche Last dar. Vergebens: unter Thränen schluchzend brach sie in jene klagenden Worte der Cornelia aus:
„O herrlicher Gatte,
Besseren Ehbetts wert! So wuchtig durfte das Schicksal
Treffen ein solches Haupt? Ach mußt ich darum dich freien,
Daß dein Unstern ich würd? — Doch nun empfange mein Opfer
Freudig bring ich es dir —“
Mit diesen Worten trat sie vor den Altar, empfing aus der Hand des Bischofs den geweihten Schleier und legte vor dem ganzen Konvent das Klostergelübde ab.
Ich hatte mich kaum von meiner Verletzung erholt, als die Kleriker in Menge herbeiströmten und sowohl meinen Abt wie mich selbst mit Bitten bestürmten: ich solle das, was ich bisher aus Verlangen nach Geld oder Ruhm gethan habe, jetzt aus Liebe zu Gott thun. Ich solle bedenken, daß Gott das Pfund, das er mir anvertraut, mit Zinsen von mir zurückverlangen werde! Bisher habe ich mich fast nur mit Reichen abgegeben, jetzt solle ich meine Kräfte in den Dienst der Armen stellen. Ich möchte erkennen, daß die Hand des Herrn mich vor allem deshalb geschlagen habe, damit ich desto unbehinderter, den Lockungen des Fleisches und dem unruhigen Treiben der Welt entrückt, der Wissenschaft leben könne, und nicht mehr die Weisheit dieser Welt, sondern die wahre Gottesweisheit lehren möge.
In dem Kloster, in das ich eingetreten war, herrschte zu jener Zeit ein überaus weltliches, sittenloses Leben. Je höher der Abt selbst seinem Range nach über den andern stand, desto schlimmer und berüchtigter war sein Lebenswandel. Da ich nun ihre empörende Sittenlosigkeit teils im vertrauten Kreis, teils öffentlich mehrmals aufs nachdrücklichste rügte, so wurde ich ihnen überaus unbequem und verhaßt. Mit Vergnügen sahen sie, wie meine Schüler Tag für Tag unermüdlich mit Bitten in mich drangen; denn dieser Umstand gab ihnen Gelegenheit, sich meiner zu entledigen. Da nun jene mir unaufhörlich zusetzten und mir keine Ruhe ließen, auch der Abt und die Brüder sich in den Handel mischten, gab ich endlich nach und zog mich in eine Einsiedelei zurück, um meine gewohnte Lehrthätigkeit wieder aufzunehmen. Hier strömte nun eine solche Menge von Schülern zusammen, daß es ebenso an Raum, sie zu beherbergen, wie an Lebensmitteln zu ihrem Unterhalt fehlte.
Wie es meinem jetzigen Beruf entsprach, hielt ich hauptsächlich theologische Vorlesungen. Doch gab ich die Unterweisung in den weltlichen Wissenschaften deshalb nicht ganz auf; in ihnen war ich einst am besten bewandert gewesen und um ihretwillen suchte man mich hauptsächlich auf. So benutzte ich sie gleichsam als Köder, um durch diese etwas nach Philosophie schmeckende Lockspeise meine Zuhörer für das Studium der wahren Philosophie zu gewinnen, wie denn die „Kirchengeschichte“ dasselbe Verfahren von Origenes berichtet, jenem größten aller geistlichen Philosophen. Da es nun aber ersichtlich wurde, daß Gott mich mit heiliger wie mit weltlicher Wissenschaft in gleicher Weise begabt hatte, so vermehrte sich die Zahl meiner Zuhörer in beiden Fächern, während die andern Schulen sich bedenklich leerten. Dadurch zog ich mir den heftigsten Neid und Haß der Lehrer zu, die nun alles aufboten, um mir Abbruch zu thun. Hauptsächlich zwei Vorwürfe waren es, die sie immer wieder gegen mich erhoben, während ich fern war: daß sich mit dem Beruf eines Mönchs das Studium weltlicher Wissenschaft nimmermehr vertrage und daß ich mir ein Lehramt in der Theologie angemaßt habe, ohne vorher selbst in die Schule gegangen zu sein. Sie hätten es am liebsten gesehen, wenn mir die Ausübung meiner Lehrthätigkeit ganz untersagt worden wäre, und waren unablässig bemüht, Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte und sonstige einflußreiche Kirchenmänner für ihre Absicht zu gewinnen. Ich befaßte mich nun zuerst damit, das Fundament unseres Glaubens selbst durch menschliche Vernunftgründe faßlich zu machen. Zu diesem Zweck schrieb ich eine theologische Abhandlung „über die göttliche Einheit und Dreiheit“ für den Gebrauch meiner Schüler, die nach vernünftigen, wissenschaftlichen Gründen verlangten, und nicht bloß Worte hören, sondern sich auch etwas dabei denken wollten. Sie meinten, es sei vergeblich, viele Worte zu machen, bei denen sich nichts denken lasse; man könne doch nichts glauben, was man nicht vorher begriffen habe; es sei lächerlich, wenn einer etwas predigen wolle, was weder er selbst noch seine Zuhörer mit dem Verstand fassen könnten; das seien „die blinden Blindenleiter“, von denen der Herr spreche. Mein Buch gefiel allen meinen Schülern außerordentlich, denn hier — so schien es — fand man auf alle Fragen, die über diesen Gegenstand schwebten, eine befriedigende Antwort. Und gerade diese Fragen galten damals für ganz besonders schwierig; je größeres Gewicht man ihnen aber beilegte, desto mehr wurde die Feinheit der Lösung geschätzt. Meine Neider jedoch gerieten dadurch in gewaltige Aufregung und sie beriefen gegen mich ein Konzil, an ihrer Spitze meine beiden alten Widersacher, Alberich und Lotulf. Diese maßten sich nach dem Tode unserer gemeinsamen Lehrer Wilhelm und Anselm die Alleinherrschaft an und wollten sich gleichsam in das Erbe der beiden berühmten Männer teilen.
Alberich und Lotulf lehrten damals beide zu Rheims und sie brachten es bei ihrem Erzbischof Radulf durch allerhand Einflüsterungen in der That soweit, daß man unter Beiziehung des Bischofs von Präneste, Conanus, der damals päpstlicher Legat in Frankreich war, eine dürftige Versammlung unter dem stolzen Namen eines Konzils in Soissons abhielt und mich einlud, mein vielbesprochenes Buch „Über die Dreieinigkeit“ dorthin mitzubringen. Und so geschah es.
Indessen hatten mich meine beiden Hauptwidersacher bei Klerus und Volk noch vor meiner Ankunft in ein so übles Licht gestellt, daß ich mit meinen paar Begleitern von der Menge beinahe gesteinigt worden wäre; es hieß, ich lehre in Wort und Schrift drei Götter — das hatte man ihnen vorgeredet.
Sogleich nach meiner Ankunft in Soissons ging ich zum Legaten und übergab ihm mein Buch zur Prüfung und Beurteilung; zugleich erklärte ich mich bereit, meine Lehre zu berichtigen oder zu widerrufen, falls sie mit dem katholischen Glauben im Widerspruch stehe. Der Legat jedoch schickte mich mit meinem Buch zum Erzbischof und zu meinen Gegnern; die Männer sollten über mich zu Gericht sitzen, die mich angeklagt hatten, und an mir sollte sich das Wort erfüllen: „Meine Feinde sind meine Richter“.
Sie durchstöberten nun mein Buch mehrmals von vorn bis hinten, fanden aber nichts, das sie in der Versammlung gegen mich hätten vorbringen können und verschoben darum die Verdammung des Buchs, nach der sie lechzten, bis auf den Schluß des Konzils. Ich meinerseits benutzte die Zeit ehe die Sitzungen abgehalten wurden täglich zu öffentlichen Vorträgen über den katholischen Glauben, wie er in meinen Schriften zum Ausdruck kam, und unter meinen Zuhörern war nur eine Stimme des Lobes und der Bewunderung für meine Redegewandtheit wie für meinen Scharfsinn. Das Volk aber und die Geistlichkeit fingen an zu murren: „Sehet, nun redet er frei und offen vor aller Welt und niemand widerspricht ihm! Das Konzil, das doch seinetwegen vor allem berufen wurde, ist nächstens zu Ende. Sind vielleicht die Richter zu der Einsicht gekommen, daß sie selber irren, nicht er?“
Infolgedessen stieg die Wut meiner Gegner von Tag zu Tag. Eines Tags nun kam Alberich mit einigen seiner Schüler zu mir, um mir eine Schlinge zu legen. Nach einigen einleitenden höflichen Redensarten sagte er, eine Stelle in meinem Buch habe ihn befremdet: nämlich, obwohl Gott Gott gezeugt habe und nur ein Gott sei, leugne ich doch, daß Gott sich selber gezeugt habe. Unverzüglich antwortete ich ihm: „ich bin bereit, hierüber Rechenschaft abzulegen, wenn es euch genehm ist“. Darauf versetzte er: „In solchen Fragen lassen wir nicht menschliche Vernunftgründe oder unsre eigene Weisheit gelten, sondern einzig und allein die Autorität der Väter.“ — „Schlaget nur in meinem Buche nach,“ erwiderte ich, „und ihr werdet eine solche Autorität finden.“ — Das Buch war zur Hand; er hatte es selbst mitgebracht. Ich schlug die Stelle auf, die ich im Kopfe hatte und die dem Alberich entgangen war, weil er nur nach solchen suchte, die mir schaden konnten. Gott wollte es, daß ich das Gewünschte alsbald fand. Es war ein Citat aus dem ersten Buche von Augustins Werk „Über die Dreieinigkeit“ und lautete: „Wer da glaubt, Gott habe die Macht sich selbst zu erzeugen, ist in einem schweren Irrtum befangen, denn diese Fähigkeit kommt Gott so wenig zu wie irgend einer anderen geistigen oder leiblichen Kreatur; es giebt überhaupt kein Wesen, welches sich selbst erzeugen könnte.“
Diese Worte versetzten die Schüler Alberichs in peinliche Verlegenheit. Er selbst, um nur irgend etwas zu sagen, meinte: „Das ist allerdings deutlich.“ Ich erwiderte ihm, diese Ansicht sei nicht neu, allein für den Augenblick falle sie nicht ins Gewicht, da er ja nur nach Worten suche und nicht den tieferen Sinn, der ihnen zu Grunde liege. Falls er aber eine Darlegung und Begründung ihres eigentlichen Sinnes anhören wolle, so sei ich bereit, ihm aus seinen eigenen Worten nachzuweisen, daß er in die Ketzerei verfallen sei, die annehme, daß Gott-Vater sein eigener Sohn sei. Daraufhin geriet Alberich in große Wut, nahm seine Zuflucht zu Drohungen und versicherte mich, daß weder meine eigene Weisheit, noch meine Berufung auf andere Autoritäten mir etwas helfen sollten. — Und damit ging er.
Der letzte Tag des Konzils war herangekommen. Vor der Sitzung hatten der Legat und der Erzbischof von Rheims mit meinen Gegnern und einigen andern Personen eine lange Beratung darüber, was in Anbetracht meiner Person und meines Buches zu thun sei; denn um dieser Sache willen war ja das Konzil hauptsächlich berufen worden. In meinen Worten oder in meiner Schrift, die vorlag, fand man nichts, was man gegen mich hätte vorbringen können. Einen Augenblick herrschte allgemeines Schweigen und was sich hören ließ, waren nur schüchterne Einwürfe. Da ergriff Gottfried, Bischof von Chartres, durch den Ruf seiner Frömmigkeit und das Ansehen seines Stuhles den übrigen Bischöfen überlegen, das Wort und sprach also: „Würdige Herren! Euch allen, die ihr hier versammelt seid, ist es wohl bekannt, daß die Lehre dieses Mannes, welcher Art sie auch sein mag, und der Reichtum seines Geistes, welchem Gebiet immer er sich zugewandt hat, viel Beifall gefunden und große Anziehungskraft ausgeübt haben, so daß dadurch selbst der Ruhm seiner und unserer Lehrer verdunkelt worden ist und man fast sagen könnte, die Reben seines Weinbergs seien von Meer zu Meer gerankt.
Wolltet ihr nun, was ich nicht glauben kann, einen solchen Mann ungehört verurteilen, so würdet ihr mit einem solchen Urteil, selbst wenn es seinen guten Grund hätte, sicherlich vielen Leuten vor den Kopf stoßen, und es würde nicht an solchen fehlen, die für ihn Partei ergreifen würden; zumal sich in der Schrift, die er vorgelegt hat, nichts findet, was einer offenen Ketzerei ähnlich wäre. Denken wir an das Wort des Hieronymus: ‚Stets hat die Tüchtigkeit den Neid zum Begleiter‘ und daran, daß ‚der Blitz die höchsten Gipfel trifft‘! Hüten wir uns davor, seinen Namen durch ein gewaltsames Vorgehen noch mehr zum Gegenstand der allgemeinen Teilnahme zu machen. Wir würden uns selbst dadurch, daß wir uns den Vorwurf des Neides zuziehen, mehr schädigen, als wir dem Angeklagten durch unsern Richterspruch schaden können. Denn ‚falscher Ruhm‘ — sagt der ebengenannte Lehrer — ‚erlischt schnell und die Folgezeit richtet das Vorleben.‘“
„Beliebt es euch aber, nach Recht und Brauch mit ihm zu handeln, so möge seine Lehre oder sein Buch hier öffentlich vorgetragen werden und ihm selbst soll gestattet sein auf die Fragen, die man ihm vorlegt, Rede und Antwort zu geben, um dann, wenn er überwiesen und zum Widerruf bewogen werden könnte, für immer zu schweigen. Dies war schon die Meinung des frommen Nikodemus, als er, um dem Herrn selbst die Freiheit zu ermöglichen, sagte: ‚Richtet unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhöret und erkenne was er thut?‘“
Auf diese Worte hin erhoben meine Gegner einen gewaltigen Lärm: „Schöne Weisheit“, riefen sie, „die uns zumutet, mit diesem Wortkünstler zu streiten, dessen Schlüssen und Finten die ganze Welt nicht standhalten kann!“ — Und doch — es war gewiß noch viel schwerer, mit Christus selbst zu streiten; trotzdem hat Nikodemus ihn vor seinen Richtern zum Wort kommen lassen wollen, wie es das Gesetz gestattet.
Als nun der Bischof Gottfried die Anwesenden nicht für seine Absicht gewinnen konnte, suchte er ihre Mißgunst durch ein anderes Mittel zu zügeln. Er machte geltend, daß die Versammlung nicht vollzählig genug sei, um über eine so wichtige Sache zu entscheiden, und daß diese Angelegenheit einer gründlichen Prüfung bedürfe. Sein Rat gehe deshalb dahin, mein Abt solle mich in das Kloster St. Denis zurückbringen, woselbst dann meine Sache einer größeren Anzahl von gelehrten Männern zu erneuter gründlicherer Untersuchung vorgelegt werden solle. Dieser letzte Vorschlag fand den Beifall des Legaten und aller übrigen Anwesenden. Alsbald erhob sich der Legat, um vor dem Beginn der Sitzung die Messe zu lesen, und ließ mir durch den Bischof Gottfried die förmliche Erlaubnis zur Rückkehr in mein Kloster übermitteln, wo ich dann das weitere erwarten solle.
Nun aber fiel es meinen Gegnern ein, daß für sie nichts gewonnen wäre, wenn mein Prozeß außerhalb ihres Sprengels geführt würde, wo sie dann auf das Urteil keinen Einfluß ausüben könnten; denn bei dem Gedanken, einfach der Gerechtigkeit den Lauf zu lassen, konnten sie sich freilich nicht beruhigen. Darum stellten sie dem Erzbischof vor, daß es eine große Schande für sie wäre, diese Sache an eine andere Behörde zu verweisen und daß es gefährlich sei, mich so davonkommen zu lassen. Sie liefen auch zum Legaten und wußten ihn, halb gegen seinen Willen, dahin umzustimmen, daß er mein Buch unbesehen verdammte, es vor aller Augen verbrannte und über mich lebenslängliche Haft in einem auswärtigen Kloster verfügte. Sie sagten nämlich, zur Verurteilung meines Buches sei schon der Umstand hinreichend, daß ich mir erlaubt habe, es ohne die Genehmigung des Papstes oder der Kirche öffentlich vorzutragen und daß ich es schon vielen zum abschreiben überlassen habe; es könne nur zur Kräftigung des christlichen Glaubens dienen, wenn einmal, um einer ähnlichen Anmaßung zuvorzukommen, an mir ein Exempel statuiert werde. Der Legat war wissenschaftlich nicht so gebildet, wie er hätte sein sollen, und folgte deshalb in der Hauptsache dem Rate des Erzbischofs; dieser seinerseits ließ sich von meinen Gegnern bestimmen.
Als der Bischof von Chartres hiervon Kunde erhielt, setzte er mich alsbald von diesen Umtrieben in Kenntnis und ermahnte mich eindringlich, ich möchte diese Wendung geduldig tragen, um so mehr, als das Vorgehen meiner Widersacher eine offenbare Vergewaltigung sei. Eine solche, klar am Tag liegende, gewaltthätige Mißgunst könne jenen nur schaden, mir nur Nutzen bringen — davon dürfe ich überzeugt sein; auch solle ich mir wegen der Klosterhaft keine Sorgen machen: er wisse gewiß, daß der Legat, der sich dieses Urteil nur habe abnötigen lassen, mich nach seiner Abreise von hier alsbald in volle Freiheit setzen werde. So suchte er mich zu trösten so gut es ging, indem er selbst mit dem Weinenden weinte.
Ich wurde vor das Konzil berufen, und ohne Untersuchung, ohne Prüfung zwang man mich, mein Buch mit eigener Hand ins Feuer zu werfen. Und so ging es in Flammen auf. Während dieses Vorgangs schien jedermann absichtlich zu schweigen. Nur einer meiner Gegner machte schüchtern die Bemerkung, er habe in dem Buch den Satz gefunden, Gott-Vater allein sei allmächtig. Auf diese Bemerkung antwortete der Legat höchlich erstaunt: einen solchen Irrtum dürfe man ja nicht einmal einem Kinde zutrauen, da doch der gemeinsame Glaube ausdrücklich dahingehe, das alle drei Personen der Gottheit allmächtig seien. — Daraufhin citierte ein gewisser Terricus, Vorsteher einer Schule, höhnisch den Satz des Athanasius: „und dennoch nicht drei allmächtig, sondern einer allmächtig“. Und als ihn sein Bischof zurechtweisen und zum Schweigen bringen wollte, als hätte er ein Majestätsverbrechen begangen, ließ er sich nicht im mindesten einschüchtern, sondern sprach wie ein zweiter Daniel also: „Seid ihr von Israel solche Narren, daß ihr einen Sohn Israels verdammt, ehe ihr die Sache erforschet und gewiß werdet? Kehret wieder um vors Gericht und richtet den Richter selber. Denn der Richter, den ihr eingesetzt habt zur Unterweisung im Glauben und zur Beseitigung des Irrtums, der hat sich selbst gerichtet durch seinen eigenen Mund, da er andere richten sollte. Den Mann, dessen Unschuld heute Gottes Barmherzigkeit an den Tag gebracht hat — befreiet ihn, wie einst die Susanna, von seinen falschen Klägern.“
Nun erhob sich der Erzbischof, und indem er die Worte den Umständen gemäß leicht abänderte, bestätigte er den Satz des Legaten mit den Worten: „In der That, ehrwürdiger Herr, allmächtig ist der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der heilige Geist, und wer von dieser Meinung abweicht, ist in offenbarem Irrtum befangen und nicht anzuhören. Doch vielleicht dürfte es sich empfehlen, daß dieser unser Bruder seinen Glauben vor der ganzen Versammlung bekenne, damit er je nach Umständen gebilligt oder beanstandet und verbessert werde.“ Als ich mich daraufhin anschickte, mein Glaubensbekenntnis abzulegen, und meinen Gedanken einen selbständigen Ausdruck geben wollte, da riefen meine Gegner mir zu, ich brauche nur das Athanasianische Glaubensbekenntnis herzusagen, was jedes Kind ebensogut hätte thun können. Und damit ich nicht etwa die Ausrede gebrauchen könnte, ich wisse den Wortlaut nicht auswendig, gab man mir den geschriebenen Text zum Vorlesen. Unter Seufzern und mit thränenerstickter Stimme las ich, so gut es ging. Hierauf wurde ich wie ein seines Vergehens überwiesener Verbrecher dem Abt von St. Medardus, der auf dem Konzil anwesend war, übergeben und in dessen Kloster, als in mein Gefängnis, abgeführt. Das Konzil selbst wurde alsbald aufgelöst.
Der Abt indessen und seine Mönche, die nicht anders glaubten, als daß ich nun für immer bei ihnen bleiben werde, nahmen mich mit Freuden auf und bemühten sich vergeblich, mich durch möglichst liebevolle Behandlung über mein Schicksal zu trösten. O Gott, der du gerecht richtest! So sehr war mein Herz vergiftet und verbittert, daß ich in verblendetem Wahn wider dich selbst murrte und Klage erhob und unablässig jenen Seufzer des heiligen Antonius wiederholte: „Guter Jesus, wo warest du?“ Schmerz, Beschämung, Verzweiflung — damals habe ich all diese Gefühle durchgekostet, aber sie zu beschreiben, ist mir nicht möglich. Was ich jetzt zu leiden hatte, hielt ich zusammen mit dem früheren Unglück, das mir an meinem Körper widerfahren war, und ich achtete mich für das elendste aller Menschenkinder. Im Vergleich mit diesem neuen Unglück erschien mir jene ruchlose That geringfügig, und ich beklagte weniger den Schaden meines Leibes als den Verlust meines Ruhms. Jenen hatte ich gewissermaßen selbst verschuldet. Dieser offenen Gewalt aber war ich zum Opfer gefallen, obwohl mich nichts anderes als die lauterste Absicht und die Liebe zu unserem Glauben zum Schreiben gedrängt hatte.
Wohin auch die Kunde von diesem grausamen und brutalen Verfahren gegen mich gelangte, überall fand es lebhafte Mißbilligung; von denen, die bei der Verhandlung gewesen waren, schob nun jeder die Schuld auf den andern. Sogar meine Feinde leugneten jetzt, daß sie an dem Urteil der Synode schuld seien, und der Legat bedauerte öffentlich die Mißgunst der Franzosen. Während er für den Augenblick ihrer feindseligen Absicht gegen mich unfreiwillig nachgegeben hatte, bereute er gleich darauf seine Maßregel und ließ mich nach einigen Tagen schon aus dem fremden Kloster in mein eigenes nach St. Denis zurückkehren.
Freilich waren dessen Insassen mir fast alle schon von früher her feindlich gesinnt. Bei der Unordentlichkeit ihres Lebenswandels und dem freien Ton, der unter ihnen herrschte, war ich ihnen ein höchst unbequemer Mahner. Es vergingen nur wenige Monate, da bot sich ihnen eine geschickte Gelegenheit, mich zu verderben. Eines Tages fand ich nämlich beim Lesen zufällig eine Stelle in Bedas Auslegung der Apostelgeschichte, worin die Ansicht ausgesprochen war, daß Dionysius Areopagita nicht Bischof von Athen, sondern von Korinth gewesen sei. Dies mußte natürlich die sehr befremden, die in dem Schutzpatron ihres Klosters eben jenen Dionysius Areopagita verehren, in dessen Lebensgeschichte ausdrücklich stand, daß er Bischof von Athen gewesen sei. Ich zeigte einigen der umherstehenden Brüder halb im Scherz jene Stelle des Beda, die gegen uns sprach. Sie aber erklärten in höchster Entrüstung den Beda für einen Erzlügner und beriefen sich auf ihren Abt Hilduin, als auf einen zuverlässigeren Zeugen. Dieser habe lange Zeit in Griechenland selbst Forschungen gemacht und dann den wahren Sachverhalt in einer Lebensbeschreibung des Dionysius ganz unanfechtbar dargestellt. Einer der Umstehenden drang mit der Frage in mich, wem ich in diesem Streite recht gebe, dem Beda oder dem Hilduin. Ich sagte, das Zeugnis des Beda, dessen Schriften in der ganzen abendländischen Kirche in Ansehen stünden, scheine mir gewichtiger zu sein. Als die Mönche das vernahmen, erhoben sie ein wütendes Geschrei: nun trete die feindselige Gesinnung, die ich von jeher gegen unser Kloster gehegt habe, einmal deutlich hervor; am ganzen Land werde ich zum Verräter, indem ich es seines höchsten Ruhmestitels beraube, da ich leugne, daß Dionysius Areopagita ihr Schutzpatron sei. Ich erwiderte, das leugne ich ja gar nicht, und überdies komme wenig darauf an, ob ihr Schutzpatron wirklich der Areopagite gewesen sei oder ein Mann von anderer Herkunft, da er doch jedenfalls von Gott so großer Ehre würdig befunden worden sei. Sie aber liefen zum Abt und zeigten ihm an, was sie mir zur Last legten. Dieser begrüßte die Gelegenheit, mich einmal demütigen zu können, mit Freuden; denn da er ein sittenloseres Leben führte als alle übrigen, so fürchtete er sich vor mir um so mehr. Vor versammeltem Konvent erteilte er mir einen scharfen Verweis und drohte, er wolle mich unverzüglich vor den König schicken, damit mich die Strafe treffe, die dem gebühre, der den Ruhm und die Ehre des Königreichs antaste. Inzwischen bis zu der Zeit, da er mich dem König vorführen wollte, ließ er mich unter strenge Aufsicht stellen. Vergebens erklärte ich mich bereit, die vorgeschriebene Buße auf mich zu nehmen, falls ich etwas verbrochen hätte. Und nun ergriff mich ein förmlicher Ekel vor der Schlechtigkeit dieser Menschen, und ich, den seit so langer Zeit das Mißgeschick unablässig verfolgte, geriet an den Rand der Verzweiflung: die ganze Welt — so schien es — war gegen mich verschworen. So entwich ich denn mit Wissen einiger Brüder, die Mitleid mit mir hatten, und unter Beihilfe einiger meiner Schüler heimlich bei Nacht aus dem Kloster und flüchtete in das angrenzende Gebiet des Grafen Theobald, wo ich früher in einer Einsiedelei gelebt hatte.
Der Graf selbst war mir nicht ganz unbekannt; auch hatte er mit großer Teilnahme von meinem mannigfachen Unglück gehört. Ich hielt mich zunächst bei dem Schloß Provins auf, in einer Klause der Mönche von Troyes, deren Prior mir vorzeiten befreundet gewesen war und mich ins Herz geschlossen hatte. Dieser nahm den Flüchtling mit Freuden auf und sorgte für mich auf die liebenswürdigste Weise.
Eines Tags nun kam mein Abt in geschäftlichen Angelegenheiten zum Grafen auf das Schloß. Als ich dies erfuhr, ging ich mit dem Prior ebenfalls zum Grafen und bat ihn, er möchte sich bei meinem Abt für mich verwenden, daß er mich absolviere und mir die Erlaubnis gebe, als Mönch zu leben, wo ich einen passenden Ort finde. Der Abt und seine Begleiter zogen die Sache in Erwägung und wollten den Grafen noch am gleichen Tage vor ihrer Heimkehr darüber Bescheid sagen. Als sie nun die Sache näher überlegten, kamen sie auf die Meinung, ich wolle in ein anderes Kloster eintreten, was nach ihrer Ansicht eine große Schande für sie gewesen wäre. Denn sie thaten sich viel darauf zu gut, daß ich mich gerade in ihr Kloster zurückgezogen hatte, sie sahen darin eine Bevorzugung des ihrigen vor allen andern Klöstern, und jetzt, fürchteten sie, würde es ihnen zu großer Unehre gereichen, wenn ich ihr Kloster verließe und mich an ein anderes wendete. Deshalb hörten sie weder mich noch den Grafen in dieser Sache an, sondern begnügten sich damit, mich mit der Exkommunikation zu bedrohen, falls ich nicht unverzüglich ins Kloster zurückkehre. Dem Prior aber, bei dem ich eine Zuflucht gefunden hatte, untersagten sie aufs strengste, mich weiterhin bei sich zu behalten, falls er nicht ebenfalls der Strafe der Exkommunikation verfallen wolle. Dieser Bescheid erfüllte den Prior und mich mit großer Besorgnis. Da starb zum Glück mein Abt wenige Tage, nachdem er mit dieser Drohung in sein Kloster zurückgekehrt war.
Als sein Nachfolger eingesetzt war, ging ich mit dem Bischof von Meaux zu ihm und bat ihn, er möchte mir die Bitte gewähren, die ich schon an seinen Vorgänger gerichtet habe. Als auch er zuerst nicht recht auf die Sache eingehen wollte, gewann ich durch Vermittlung einiger Freunde den König und seinen Rat für mein Anliegen und erreichte so meinen Zweck. Der damalige Seneschall des Königs, Stephanus, nahm den Abt und dessen Vertraute beiseite und stellte ihnen vor, warum sie mich gegen meinen Willen zurückhalten wollten; sie könnten sich dadurch leicht in ärgerliche Händel verwickeln und hätten jedenfalls wenig Nutzen davon, da meine Lebensweise und die ihrige nun einmal nicht zusammenpasse. Ich wußte aber, daß man im königlichen Rat dem Kloster absichtlich manche Unregelmäßigkeit hingehen ließ, um es dafür dem König desto gefügiger zu erhalten und es für weltliche Zwecke ausbeuten zu können. Darum glaubte ich auch, die Zustimmung des Königs und seiner Räte für mein Vorhaben erlangen zu können. Und wirklich, es gelang mir.
Damit aber unser Kloster des Ruhmes, den es an meiner Person hatte, nicht verlustig gehe, sollte ich mich zwar zurückziehen dürfen, wohin ich wollte, aber unter der Bedingung, daß ich nicht in ein anderes Kloster eintrete. Dies wurde in Gegenwart des Königs und seiner Räte von beiden Seiten gutgeheißen und bekräftigt. So begab ich mich in eine einsame Gegend im Gebiet von Troyes, die mir von früher bekannt war. Dort wurde mir von einigen Leuten ein Stück Land zur Verfügung gestellt, und mit Genehmigung des Bischofs erbaute ich daselbst nur aus Binsen und Stroh eine Kapelle zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit. In dieser Einsamkeit, mit einem befreundeten Kleriker lebend, konnte ich allen Ernstes dem Herrn das Lied singen: „Siehe, ich habe mich ferne weggemacht und bin in der Wüste geblieben.“
Bald kam die Kunde von meinem neuen Aufenthalt zu meinen Schülern. Und nun belebte sich meine Einsamkeit. Sie verließen die Städte und festen Plätze und ihre behaglichen Wohnungen, um sich hier elende Hütten zu bauen; ihre ausgesuchten Mahlzeiten vertauschten sie mit der dürftigen Nahrung, die in Kräutern und trockenem Brot bestand; statt weicher Betten gab es hier nur ein Lager aus Binsen oder Stroh und die Tische mußten durch Rasenbänke ersetzt werden. Man hätte wirklich glauben können, sie wollen die alten Philosophen nachahmen, deren Lebensweise dem heiligen Hieronymus im zweiten Buch seiner Schrift „Gegen Jovinianus“ zu folgender Betrachtung Anlaß giebt: „Durch unsere Sinne dringen die Laster wie durch eine Art Fenster ins Herz ein. Die Stadt und Festung der Vernunft kann nicht genommen werden, wenn das feindliche Heer nicht durch die Thore eindringt. Wenn jemand seine Lust hat an Cirkusspielen, an Ringkämpfen, an Gauklerkünsten, an üppigen Frauen, an prächtigem Geschmeide, an Kleiderputz und dergleichen Dingen, dessen Seele hat ihre Freiheit durch die Fenster der Augen verloren und von ihm gilt das Wort des Propheten: ‚Der Tod ist hereingekommen durch unsere Fenster.‘ Wenn nun die Anfechtungen dieser Welt wie ein feindlicher Keil durch solche Thore in die Burg unsres Herzens eingedrungen sind — wo wird dann unsre Freiheit bleiben, wo unsre Tapferkeit, wo der Gedanke an Gott? Zumal das einmal geweckte Herz auch die vergangenen Freuden mit neuen Farben sich ausmalt, mit der Erinnerung an einstige Leidenschaften neue Schmerzen in der Seele weckt und sie gewissermaßen etwas, was in Wirklichkeit nicht mehr besteht, noch einmal durchzumachen nötigt. Aus diesen Gründen haben viele Philosophen die volksbelebten Städte und die städtischen Lustgärten verlassen, wo das bewässerte Land, das Grün der Bäume, das Zwitschern der Vögel, die krystallklare Quelle, der murmelnde Bach und so manches andre Aug’ und Ohr bezauberte; sie wichen der Üppigkeit und der Überfülle, die sich ihnen darbot, aus, damit die Kraft ihrer Seele nicht erschlaffe und ihre Keuschheit nicht befleckt werde. Und in der That: der öftere Anblick dessen, was uns berücken könnte, kann ja nur schädlich wirken, und warum sollte man einen Genuß kennen lernen wollen, auf den man nachher nur mit Schmerzen wieder verzichten kann?“
Auch die Schüler des Pythagoras gingen dem Treiben der Welt aus dem Wege und wohnten in der Einsamkeit und in der Wüste. Selbst Plato, der mit den Gütern dieser Welt gesegnet war und welchem Diogenes einmal sein Ruhebett mit schmutzigen Schuhen bearbeitete, selbst er wählte, um ganz Philosoph sein zu können, einen Ort auf dem Lande, fern von der Stadt, nicht bloß in abgelegener, sondern auch in ungesunder Gegend: durch die beständige Besorgnis vor Krankheiten sollten die Begierden erstickt werden, und seine Schüler sollten keinen anderen Genuß kennen, als den des Studiums. Eine ähnliche Lebensweise sollen auch die Jünger des Propheten Elisa geführt haben. Hieronymus stellt sie als die Mönche jener Zeit dar und schreibt über sie dem Mönche Rusticus unter anderem folgendes: „Die Prophetenschüler, von denen das Alte Testament wie von Mönchen redet, bauten sich an den Ufern des Jordan kleine Hütten, verließen die Gesellschaft und die Stätten der Menschen und lebten von Mais und Kräutern des Feldes.“
In dieser Weise bauten sich auch meine Schüler ihre Hütten am Ufer des Flusses Arduzon, und man meinte eher Einsiedler vor sich zu haben als Jünger der Wissenschaft. Je größer aber der Zulauf von Schülern wurde und je härter die Lebensweise war, die sie meinem Unterricht zuliebe auf sich nahmen, desto ängstlicher sahen meine Nebenbuhler meinen Ruhm wachsen und ihr eigenes Ansehen sinken. Zu ihrem großen Leidwesen mußten sie es erleben, daß alles Böse, das sie mir zugedacht, zu meinem Vorteil ausschlug, und obwohl ich nach dem Wort des Hieronymus fern von dem Treiben der Städte und Märkte, fern von den Händeln der Welt lebte — dennoch fand mich, wie Quintilian sagt, selbst in der Verborgenheit der Neid. Seufzend und klagend sprachen jene zu sich selbst: „Siehe, die ganze Welt läuft ihm nach; nichts haben wir ausgerichtet mit unseren Verfolgungen, ja, wir haben seinen Ruhm nur noch größer gemacht. Wir gedachten, die Leuchte seines Namens zu verlöschen, und wir haben sie nur heller angefacht. In den Städten haben die Schüler alles zur Hand, was sie brauchen, aber auf alle Genüsse menschlicher Kultur verzichtend, strömen sie hinaus in die unwirtliche Einöde und setzen sich freiwillig dem Mangel aus.“
Zu jener Zeit nötigte mich meine drückende Armut, eine regelrechte Schule einzurichten; denn graben mochte ich nicht und schämte mich zu betteln. An Stelle der Handarbeit nahm ich darum, zu meiner eigentlichen Kunst zurückkehrend, die Arbeit des Geistes wieder auf. Gern reichten mir meine Schüler dar, was ich an Nahrung und Kleidung brauchte, sie nahmen mir auch die Bestellung des Feldes und die Errichtung notwendiger Baulichkeiten ab, damit ich durch keine wirtschaftliche Sorge von der Wissenschaft abgezogen würde. Da unsere Kapelle nur den kleinsten Teil der Anwesenden fassen konnte, so vergrößerten sie dieselbe und verwandten zu dem Umbau nunmehr ein besseres Material, nämlich Stein und Holz. Ich hatte die Kapelle einst im Namen der heiligen Dreifaltigkeit gegründet und sie ihr geweiht. Nun aber gab ich ihr den Namen „Paraklet“ (Tröster),[3] in dankbarer Erinnerung an die Wohlthat, die mir einst hier zu teil geworden war: denn an diesem Ort hatte ich, ein schon verzweifelnder Flüchtling, die Gnade des göttlichen Trostes gefunden, hier hatte ich zuerst wieder aufatmen dürfen. Viele Leute erstaunten nicht wenig über diesen Namen; ja einige griffen mich deshalb heftig an und behaupteten, nach altem Herkommen könne man eine Kirche nicht dem heiligen Geist im besonderen weihen, so wenig als Gott dem Vater allein; sondern nur entweder dem Sohn allein oder der ganzen Dreieinigkeit zusammen. Zu diesem Angriff ließen sie sich jedenfalls dadurch verführen, daß sie zwischen den Begriffen „Paraklet“ und „Geist Paraklet“ keinen Unterschied machten. In Wirklichkeit kann ja der Trinität und jeder einzelnen Person der Trinität mit dem gleichen Recht, wie sie Gott oder Helfer genannt wird, auch der Name Paraklet, d. h. Tröster, beigelegt werden — nach dem Wort des Apostels: „Gelobet sei Gott und der Vater unsres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unsrer Trübsal“ — und auch nach dem Wort, das die Wahrheit spricht: „Und er soll euch einen andern Tröster geben.“ — Da doch jede Kirche im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes geweiht wird und sie alle drei an dem Besitz gleichen Anteil haben — warum soll man denn nicht auch einmal ein Gotteshaus Gott dem Vater oder dem heiligen Geist im besondern zueignen dürfen, so gut wie dem Sohne? Wer wollte sich erlauben, den Namen dessen, dem das Haus gehört, über dem Eingang zu tilgen? Oder wenn der Sohn sich dem Vater zum Opfer darbringt und demgemäß bei der Messe die Gebete an Gott den Vater besonders gerichtet werden, wie auch er es ist, dem das Opfer gebracht wird: sollte da nicht der Altar ganz im besonderen ihm zu eigen sein, dem doch Gebet wie Opfer gilt? Ist der Altar nicht mit größerem Rechte dem zuzusprechen, welchem geopfert wird als dem, der geopfert wird? Oder wollte jemand behaupten, daß dem Kreuz oder Grab des Erlösers, oder dem heiligen Michael, Johannes, Petrus oder sonst einem Heiligen ein Altar zukomme, da doch weder sie selbst mit einem Opfer irgend etwas zu thun haben, noch auch Gebete an sie gerichtet werden? Auch bei den Heiden wurden nur denjenigen Wesen Altäre oder Tempel zugeeignet, denen man Opfer und göttliche Ehren darbringen wollte. Aber vielleicht möchte jemand glauben, es sei deshalb nicht zulässig, Gott dem Vater Kirchen oder Altäre zu weihen, weil es kein Fest in der Kirche gebe, das zu seiner besonderen Feier eingesetzt wäre. Dieser Grund mag zwar gegen die Trinität angeführt werden, allein in betreff des heiligen Geistes gilt er nicht, denn dieser hat zum Gedächtnis an sein Herabkommen ein eigenes Fest, nämlich Pfingsten, so gut wie der Sohn das Fest seiner Geburt hat. Denn wie einstens der Sohn in die Welt gesandt wurde, so kam der heilige Geist auf die Jünger und hat zum Andenken daran mit Recht sein eigenes Fest. Ja, wenn wir die Meinung der Apostel und die Wirksamkeit des heiligen Geistes genauer ins Auge fassen, so muß es uns natürlicher erscheinen, ihm einen Tempel zu weihen als irgend einer der andern göttlichen Personen. Denn keiner der letzteren schreibt der Apostel ausdrücklich einen geistigen Tempel zu, wie dem heiligen Geist. Denn er spricht nicht von einem Tempel des Vaters oder des Sohnes, wohl aber von einem solchen des heiligen Geistes, wenn er im ersten Korintherbrief sagt: „Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm“ und ferner: „Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst.“ Und wer wollte verkennen, daß die Wohlthat der heiligen Sakramente, welche in der Kirche verwaltet werden, ganz ausdrücklich der Wirkung der göttlichen Gnade d. h. des heiligen Geistes zugeschrieben werden? Aus Wasser und aus Geist werden wir ja in der Taufe wiedergeboren, und erst dadurch wird aus uns ein eigentlicher Tempel Gottes. Und zum vollständigen Ausbau dieses Tempels wird uns in siebenfacher Gnadengabe der heilige Geist zu teil, und so erhält der Tempel Gottes seinen Schmuck und seine Weihe. Was hat es also auf sich, wenn wir dem einen sichtbaren Tempel weihen, welchem der Apostel einen geistigen zuteilt? Oder welcher Person der Dreieinigkeit könnte man mit größerem Recht eine Kirche zueignen, als derjenigen, welcher alle Gnadenwirkungen, die die Kirche vermittelt, vor anderen zugeschrieben werden? — Wenn ich übrigens meiner Kapelle den Namen „Paraklet“ beilegte, so wollte ich sie damit nicht einer der drei göttlichen Personen geweiht haben. Ich habe schon oben gesagt, warum ich sie so genannt habe: nämlich zur Erinnerung an den Trost, den ich hier gefunden. Im übrigen — auch wenn ich das Gotteshaus in jenem anderen Sinn so genannt hätte, wäre dies nicht gegen die Vernunft, sondern nur gegen das gewöhnliche Herkommen gewesen.
Dieses Asyl gewährte zwar meiner Person den Schutz der Verborgenheit, aber Gerüchte über mich durchliefen gerade damals die ganze Welt und ließen sich allerorten hören nach Art jenes Fabelwesens, Echo genannt, das viel Lärm macht und doch ein wesenloses Ding ist. Meine alten Feinde, ihren eigenen Anstrengungen keinen Erfolg mehr zutrauend, erweckten nun zwei neue Apostel gegen mich, denen die Welt großen Glauben schenkte. Der eine von ihnen rühmte sich, dem Leben der regulierten Chorherren, der andere, dem der Mönche einen neuen Aufschwung gegeben zu haben. Diese Menschen liefen predigend in der Welt herum, verketzerten mich mit der Unverfrorenheit, die ihnen eigen war, und machten mich, wenigstens für den Augenblick, bei weltlichen und geistlichen Obrigkeiten verächtlich. Ja, sie sprengten über meinen Glauben und über mein Leben so abenteuerliche Gerüchte aus, daß selbst achtungswerte Freunde sich von mir abwandten und auch diejenigen, welche mir ihre Freundschaft bis auf einen gewissen Grad erhielten, doch aus Furcht vor jenen nicht den Mut hatten, dieselbe irgendwie zu bekennen. Gott ist mein Zeuge: so oft ich vernahm, daß eine Versammlung von Männern der Kirche im Werk sei, fürchtete ich schon, es geschehe zum Zweck meiner Verurteilung. Wie einer, der jeden Augenblick fürchten muß, vom Blitz getroffen zu werden, so wartete ich in dumpfer Angst darauf, daß ich als Ketzer und räudiges Schaf vor ihre Versammlungen und Schulen geschleppt würde. Und in der That — wenn man den Floh mit dem Löwen, die Ameise mit dem Elefanten vergleichen darf — ich wurde damals von meinen Gegnern mit derselben unbarmherzigen Wut verfolgt, wie einst der heilige Athanasius von den Ketzern. Ja oftmals — Gott weiß es — kam ich in meiner Verzweiflung auf den Gedanken, das Gebiet der Christenheit überhaupt zu verlassen und mich zu den Heiden zu wenden, um bei den Feinden Christi in Ruhe christlich zu leben, unter welcher Bedingung es auch sei. Ich sagte mir, sie werden um so eher geneigt sein, mich bei sich aufzunehmen, als mein Christentum ihnen wegen der Verfolgungen, die ich von Christen erlitt, verdächtig erscheinen mußte; vielleicht würden sie aus demselben Grund auch meinen, sie könnten mich zu ihrer Religion bekehren.