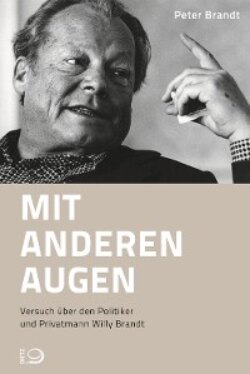Читать книгу Mit anderen Augen - Peter Brandt L. - Страница 7
Familie und Freunde
ОглавлениеA
nders als viele Führer von Parteien der Arbeiterbewegung war Willy Brandt ein echtes Proletarierkind. Das verband ihn mit dem »Arbeiterkaiser« August Bebel, der wenige Monate vor seiner Geburt gestorben war. Am 18. Dezember 1913 kam mein Vater im Lübecker Arbeiterbezirk St. Lorenz zur Welt, ursprünglich als Herbert Ernst Karl Frahm. Die nicht verheiratete neunzehnjährige Mutter Martha Frahm soll eine hübsche Frau mit Anspruch auf ein eigenes Leben gewesen sein. Sie arbeitete als Verkäuferin täglich im Konsum und musste den Knaben zuerst zu Bekannten geben, dann, als er fünf war, ihrem Vater Ludwig zur Aufzucht überlassen. Wie Willy später erfuhr, war Ludwig nicht ihr leiblicher Vater. Die Frahms kamen aus der mecklenburgischen Landarbeiterschaft, einer unteren Schicht der Arbeiterklasse in einem der rückständigsten Territorien Deutschland. Den Großvater Ludwig, der als Kraftfahrer sein Geld verdiente, nannte der Knabe Herbert »Papa«, dessen zweite Frau, die er nicht mochte, »Tante«. Seine echte Großmutter war damals bereits gestorben. Als Martha Frahm 1927 den Maurerpolier Emil Kuhlmann heiratete und im Folgejahr der Halbbruder Günter zur Welt kam, war Herbert schon knapp vierzehn Jahre alt.
Durch die Mutter wie durch den Großvater, der sich 1935 in persönlicher und politischer Verzweiflung das Leben nahm, wuchs Herbert Frahm in die sozialdemokratische Arbeiterbewegung hinein: Kinderturngruppe des Arbeitersports, Arbeiter-Mandolinenklub, Theatergruppe. Dass sich für ihn dort eine neue, größere Familie auftat, liegt nahe – bei aller Unsicherheit und aller Unvollständigkeit der häuslich-familiären Verhältnisse. Hier musste jemand schon sehr früh allein für sich sorgen. Auch beim Lernen für die höhere Schule war er auf sich gestellt. Als Arbeiterkind besuchte er das Johanneum, ein Reform-Realgymnasium, wo ihm das Schulgeld erlassen wurde. Er war dort sozial ein Außenseiter, fügte sich aber problemlos in das fremde Milieu ein. In einer Dachkammer der bescheidenen großelterlichen Wohnung hatte er sich einen Rückzugsraum geschaffen, wo er mit seinen Büchern und seinen Gedanken eine selbstständige geistige Existenz begründete.
Wer sein biologischer Vater war, stand für Willy, der sich aus Trotz bislang nicht dafür interessiert hatte, fest, seitdem er einen Brief seiner Mutter vom 7. Februar 1947 erhalten hatte. Damals, nach der Hitlerzeit, wollte er sich in Deutschland wiedereinbürgern lassen. In der Annahme, dabei nach seinem Erzeuger gefragt zu werden, hatte er seine Mutter um dessen Namen gebeten. Es sei der Buchhalter John Heinrich Möller aus Hamburg gewesen. Ein zweiter Brief, den ein »leibhaftiger Vetter« namens Gerd-André Rank am 7. Juni 1961 schrieb, bestätigte diese Angaben. John Möller, der von 1887 bis 1958 lebte, soll ein ruhiger, besonnener Mensch, überzeugter Sozialdemokrat und Büchernarr gewesen sein.
Eigentlich war damit nach menschlichem Ermessen Klarheit geschaffen. Doch Willy Brandt behielt sein Wissen für sich. Es hatte sogar den Anschein, als würde er Gefallen finden an dem Rätselraten über seine Herkunft väterlicherseits. Noch Mitte der achtziger Jahre präsentierte der »Spiegel« eine Reihe von Kandidaten. Julius Leber, der prominente Lübecker Sozialdemokrat, war einer von denen, auf die man schon länger tippte. Auch ein mecklenburgischer Graf sowie der Kapellmeister Hermann Abendroth wurden nominiert. Mir selbst ging noch vor nicht allzu langer Zeit der keineswegs alberne Brief einer freundlichen Dame zu, die aufgrund frappierender physiognomischer Ähnlichkeiten und weiterer Indizien nahezu sicher war, dass einer ihrer Vorfahren, ein kaiserlicher Diplomat mit dem Spitznamen »Graf Willy«, der Erzeuger meines Vaters gewesen sein müsse.
Als Willy Brandt im April 1933 im Auftrag seiner kleinen Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) fluchtartig nach Oslo übersiedelte, folgte ihm kurz darauf Gertrud Meyer, die ebenfalls in Lübeck geboren und eine Parteiaktivistin war wie er. Beide lebten dort wie Mann und Frau zusammen, bis Gertrud, die Willys Begabung erkannte und förderte, als Assistentin des Psychoanalytikers Wilhelm Reich in die USA emigrierte. Erst später erfuhr sie, dass Willy danach mit Carlota Thorkildsen liiert war, mit der er am 30. Oktober 1940 das Töchterchen Ninja bekam. Im Frühjahr 1941 war die Familie im schwedischen Exil, wo Willy und Carlota heirateten. Carlota, neun Jahre älter als ihr Mann, war eine gebildete Frau aus bürgerlicher Familie, mit eigenem großem Freundes- und Bekanntenkreis. Sie arbeitete bis 1940 als Assistentin am Institut für vergleichende Kulturforschung, während Willy sich mit Zeitungs- und Buchhonoraren eine auskömmliche Existenz erschrieben hatte.
Im Kreis der norwegischen Exilanten Stockholms lernte er Rut Bergaust kennen und lieben, ein Arbeitermädchen aus dem ostnorwegischen Hamar. Rut hatte bald nach ihrer Flucht über die schwedische Grenze ihren Jugendfreund Ole geheiratet, der unheilbar an Tuberkulose erkrankte und 1946 starb. Trotz schwerer Gewissensbisse konnte sie sich von der neuen Verbindung mit Willy nicht frei machen, und auch dieser war ja verheiratet und hing sehr an seiner kleinen Tochter.
Den unermüdlichen Briefeschreiber Willy lernte Rut zwischen Frühjahr 1945 und Frühjahr 1947 kennen, als die beiden räumlich mehr getrennt als zusammen waren. Über Oslo und Nürnberg, wo er als Pressekorrespondent über den Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher berichtete, führte ihn sein Weg nach Berlin. Dort arbeitete er während des Jahres 1947 als Presseattaché der norwegischen Militärmission im formalen Rang eines Majors. In dieser Zeit erreichten ihn die verschiedensten Angebote, so sollte er unter anderem in Lübeck die Führung der Sozialdemokratie oder das Bürgermeisteramt übernehmen. Er sinnierte darüber nach, wie er sich am besten nützlich machen konnte, und da schien die diplomatische Position im viersektoralen Berlin am besten geeignet, den Wiedereinstieg in die deutsche Politik vorzubereiten, auch wenn er diesen Weg zunächst nicht eindeutig und zielstrebig verfolgte. Klar war nur, dass ein dauerhafter Einsatz in oder für Norwegen nicht in Betracht kam. Seiner Tochter Ninja erklärte er am 4. Dezember 1947 in einem Brief, dass Deutschland dasjenige seiner »beiden Vaterländer« sei, dem es schlecht ging und das seiner Unterstützung am meisten bedurfte.
Die Zerstörungen, die materielle Not und der Hunger bestimmten 1947 das soziale Leben in Berlin. Es war unmenschlich kalt in diesem Winter 1946/47 und Brennholz knapp. Willy schrieb an Rut: »Ich pflege nicht zu beten … Sonst würde ich mich auf die Knie werfen und sagen: Lieber Gott, gib den hungernden Menschen in den zerstörten Häusern wenigstens etwas Wärme.« Das Elend war schwer erträglich. Seine Position, die in vieler Hinsicht privilegiert war, bereitete ihm Unwohlsein. Als Rut Ostern 1947 nach Berlin folgte, kamen sie als Angehörige der Alliierten Streitkräfte in einer beschlagnahmten Villa unter, wo sie zusammen mit anderen Angehörigen der Militärmission wohnten. Die Zeit war reich an Widersprüchen und grotesken Regeln. So verlangte die Hausordnung der Villa, dass Chauffeur und Putzfrau, die in der Villa beschäftigt und verheiratet waren, sich vom Garten fernzuhalten hätten, nachdem die »Herrschaften« nach Hause gekommen seien. Das unwürdige und unnatürliche Kolonialleben, so Rut, gehörte beendet.
Die Hausordnung wurde schnell entfernt, und im Januar 1948 wurde Willy Brandt Vertreter des SPD-Vorstands in Berlin und fungierte als Verbindungsmann zu Partei, Magistrat und den vier Siegermächten. Am 1. Juli 1948 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft zurück, welche die Nationalsozialisten ihm 1938 genommen hatten. Am 4. September heirateten Willy und Rut Brandt, und genau einen Monat später kam der erste Sohn zur Welt, dessen Geburtsurkunde den kuriosen Eintrag enthält: »Peter Willy Frahm, genannt Brandt«.
Dass ich als »Frahm« geboren bin, wurde mir erst 1983 bei der Vorbereitung meiner ersten Hochzeit klar. Natürlich war der Name nie ein Problem für mich. Noch vor der Flucht aus Deutschland hatte mein Vater den Allerweltsnamen Herbert Frahm gegen den nom de guerre Willy Brandt getauscht und ihn dann bei der Rückkehr nach Deutschland beigehalten. Er verwendete in den ersten Exiljahren unterschiedliche Pseudonyme, aber »Willy Brandt« verfestigte sich so sehr, dass die Lebenspartnerin und spätere Ehefrau Carlota überrascht war zu erfahren, dass sie demnächst Frahm heißen würde. Die Begründung für den Namenswechsel fand ich stets plausibel: Die publizistische und politische Aktivität des Erwachsenen erfolgte fast ausschließlich unter dem Namen Brandt. Zum Geburtsnamen zurückzukehren, hätte etwas Künstliches gehabt. Mit diesem verband ihn »fast nichts als eine schwierige Kindheit«. Mit der gegenteiligen Entscheidung hätte er sich sogar dem Vorwurf aussetzen können, etwas aus den zurückliegenden Jahren verbergen zu wollen. 1949 wurde der Namenswechsel der Familie schließlich legalisiert. Da war Brandt schon Berliner Abgeordneter des Bundestags der neu gegründeten trizonalen Bonner Republik.
Die Kleinfamilie Brandt entstand gewissermaßen durch meine Geburt, mitten in der Blockade West-Berlins. Der Vater konnte, wie das früher so war, mit dem Winzling noch nicht viel anfangen. Bei dessen erstem Anblick soll er gesagt haben: »Na ja, er wird ja wohl mal etwas größer werden.« Mutter erzählte aber auch, dass er nach der Kunde von der geglückten Geburt eines Knaben sehr gerührt gewesen sei und die halbe Nacht gesungen und Mandoline gespielt hätte. Lars kam im Juni 1951 dazu und brachte uns quantitativ in den unteren Normbereich. Bei mir lösten die Ankündigung und das Erscheinen von Lars erheblichen Unwillen aus – ich soll einige Jahre danach ziemlich unausstehlich gewesen sein, ganz im Gegensatz zu den ersten zwei oder zweieinhalb Jahren. Aber ich hatte meinen jüngeren Bruder längst fest ins Herz geschlossen, als noch Matthias zur Welt kam – über zehn Jahre nach Lars und dreizehn Jahre nach mir. Der Abstand zu den älteren Geschwistern war so groß, dass Neid- oder Konkurrenzgefühle nicht mehr entstanden. Ich fühlte mich eher wie ein junger Onkel denn ein Bruder.
Für die Mutter war Matthias ein großes Geschenk. Sie konnte manche Frustration in ihrer Ehe durch die Hinwendung zu dem neuen Erdenbürger kompensieren. Der Vater musste zur Zeit der nicht risikolosen Geburt von Matthias eine USA-Reise absolvieren. Es waren die Monate kurz nach dem Mauerbau. Willy schien in jüngere Jahre zurückversetzt zu sein. Er erlebte einen emotionalen Ausgleich zu seinem fordernden Amt und wurde 1961/62 angesichts der weltpolitischen Turbulenzen mit der Doppelkrise um Berlin und Kuba zu Hause ständig an das Wesentliche im persönlichen Leben wie in der Politik erinnert.
Ninja, meine große Schwester, genauer gesagt: Halbschwester, die Vaters und meinen Geburtsnamen trägt, verbrachte regelmäßig einen Großteil ihrer Sommerferien bei uns in Berlin und verreiste bis in die siebziger Jahre regelmäßig mit Halbbrüdern, Stiefmutter und Vater. Als Ninja noch klein war, schrieb Willy ihr liebevolle Briefe, in denen er kindgerecht seine Tätigkeit erklärte und warum es wichtig sei, dass er in Deutschland arbeite. Auf jeden Fall gehörte Ninja ohne Wenn und Aber zu uns, und daran hatte meine Mutter großen Anteil.
Ansonsten war die väterliche Sippe überschaubar. Sie bestand aus einer Großtante zweiten Grades, einer Cousine der Großmutter, die als Krankenschwester in der Schweiz lebte und uns gelegentlich besuchen kam, Vaters Hamburger Cousine Erika, aus den Großeltern, Willys Halbbruder Günter und dem Pflegekind Waltraud. Auch Waltraud und Günter lebten, bereits erwachsen, in Lübeck zunächst in dem kleinen, sehr einfachen Haus der Großeltern (Außentoilette im Stall). Doch es gab auch einen großen Obst- und Gemüsegarten, mit Hühnern und zeitweise auch ein oder zwei Schweinen – in der frühen Nachkriegszeit ein Schatz. Er gab fast alles her, was zur Ernährung benötigt wurde.
Günter arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Vollzugsbeamter in einer Strafanstalt. Die beiden hatten kein enges, aber ein gutes Verhältnis. Onkel Günter erzählte, sie hätten manchmal viel Spaß zusammen gehabt. Willy, der eigentlich nicht mehr rauchen sollte, hat sich mit ihm in seine Wohnung zurückgezogen, und dann wurde stundenlang lustvoll gequalmt, denn Günter frönte demselben Laster. Es war eine Art Rauchverschwörung.
Oma und Opa standen bei Lars und mir in höchstem Ansehen: Sie, Martha, war eine liebe und herzliche, doch unsentimentale Frau, bei der ich 1955 gern meine ersten Schulsommerferien verbrachte. Er, Emil, war ein gütiger und bärenstarker Mann, mit spezifischem Humor. Bis zu seinem 76. Lebensjahr arbeitete er als Maurerpolier auf dem Bau. Selbst danach half er Bekannten und Nachbarn, mauerte ihnen Garagen und mehr. Martha und Emil Kuhlmann waren schon vor 1933 Sozialdemokraten und wurden nach Hitler wie selbstverständlich wieder in der SPD und der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Dass Opa nicht der leibliche Großvater war, wusste ich irgendwann irgendwie, aber es interessierte mich nicht.
Einmal im Jahr wurde gefeiert: Opa hatte Geburtstag, und wir reisten an. Das Haus quoll über von Gästen aus der Nachbarschaft und der Arbeiterbewegung, ergänzt um die kleine Verwandtschaft. Lebhaft erinnere ich mich an Opas Achtzigsten. Bei diesen Festen wurde hauptsächlich gesungen: Volks- und jugendbewegte Lieder, Arbeiter- und Spottlieder, und der Ehemann von Vaters Cousine Erika, der Arzt Walter Moritz, der als Student wohl einer schlagenden Verbindung angehört hatte, erweiterte dieses breite Repertoire noch um das Liedgut des »Deutschen Kommersbuchs«. Natürlich gab es reichlich feste und flüssige Nahrung. Bier und Schnaps flossen in Strömen. Vielleicht hat sich mein Vater, wie Mutter in ihrem Erinnerungsbuch berichtet, tatsächlich bei manchen Unterhaltungen mit Oma und Opa gelangweilt, weil ihm die Mitteilungen nichts sagten oder allzu kleinkariert vorkamen. Bei Opas Geburtstagen fühlte er sich jedoch unverkennbar wohl und genoss das fröhliche, unverkrampfte Gemeinschaftserlebnis. Beide Großeltern starben kurz hintereinander im Jahr 1969.
Willy Brandt hielt seine Mutter stets in Ehren und ließ nichts auf sie kommen. Er fand, dass er ihr – trotz der ungünstigen Umstände seiner Kindheit – manches verdankte, so zum Beispiel seine Beharrlichkeit. Auch scheint sie ihm von Anfang an viel zugetraut und ihn so zumindest indirekt bestärkt zu haben. Lübeck blieb er emotional verbunden. Und der vorletzte Auftritt in jedem Wahlkampf fand während der sechziger und frühen siebziger Jahre stets in Lübeck statt – der letzte, rein symbolisch, in Berlin. Willy hielt nicht nur regen Briefkontakt zur Mutter, sondern schickte in den äußerst kargen Nachkriegsjahren regelmäßig Päckchen. An deren Stelle trat dann später eine finanzielle Unterstützung. Als die Großeltern gestorben waren, verzichtete er zugunsten von Günter komplett auf sein Erbteil. (Merkwürdigerweise konnte er das für seine ebenfalls bedachten Söhne gleich mittun, die sicher nichts dagegen gehabt hätten, aber der Einfachheit halber gar nicht erst gefragt wurden.)
Man kann Willy, der für seine Mutter immer »Herbert« blieb, im Verhältnis zu ihr nichts vorwerfen. Dennoch: Auffällig, und für mich schon als Kind erkennbar, war die emotionale Befangenheit zwischen Mutter und Sohn. Der briefliche und mündliche Austausch war ziemlich nüchtern. Martha zeigte Mutterliebe und Mutterstolz auf ihre Art, wenn sie bei Besuchen in Lübeck dem erfolgreichen Spross das größte und beste Stück des Festtagsbratens auftat.
Viel zahlreicher als die väterliche Lübecker Verwandtschaft war die mütterliche norwegische. Willy wurde widerspruchslos eingemeindet. Ruts Vater starb, als sie noch ein kleines Kind war, und auch von der 1955 relativ jung verstorbenen Großmutter habe ich kaum noch ein Bild vor Augen. Drei Schwestern meiner Mutter, daneben etliche Vettern und Cousinen, bildeten mit den jeweiligen Ehepartnern und Kindern eine beachtliche Schar. Bei Urlauben in Norwegen ergaben sich daraus Verpflichtungen, die Vater mit zunehmendem Alter etwas lästig wurden: nicht, dass er die Schwägerinnen und Schwippschwäger nicht gemocht hätte. Aber es war doch ziemlich viel Verwandtschaft. Als Erwachsener konnte ich das nachvollziehen. Gesprächsstoff ergab sich am ehesten mit Arthur Martinsen, dem Mann von Ruts Lieblingsschwester Tulla, die eigentlich Martha hieß. Arthur war außenpolitischer Redakteur der sozialdemokratischen Regionalzeitung Hamar Arbeiderbladet und ein autodidaktisch gebildeter, hilfsbereiter Mann, der allerdings bisweilen ein wenig penetrant sein konnte. Willy und Arthur kannten sich schon aus dem Stockholmer Exil.
Die häusliche Verkehrssprache war die ersten Jahre Norwegisch: Die Eheleute hatten sich in dieser Sprache kennengelernt, und außerdem hatte es Vater, der ungewöhnlich sprachbegabt war, während der dreißiger Jahre zu einer absoluten Perfektion im Norwegischen gebracht, während Mutter sich lange mit dem komplizierteren Deutschen schwertat, insbesondere mit der Grammatik. Während die Eltern untereinander überwiegend bei Norwegisch blieben, setzte sich bei meinem Schulbeginn 1955 Deutsch als Familiensprache durch. Denn aus welchen tiefenpsychologischen Gründen auch immer – von da ab weigerte ich mich, zu Hause Norwegisch zu sprechen, obwohl ich die Sprache meiner Mutter fließend beherrschte, in Norwegen auch künftig gern benutzte und vorher keine Schwierigkeit gehabt hatte, zwischen den beiden germanischen Sprachen hin- und herzuwechseln.
Mir ist verschiedentlich kolportiert worden, Vater hätte sich so gut wie gar nicht um seine Kinder gekümmert. Für die schulischen Angelegenheiten stimmt das weitgehend. Ich bin nicht sicher, ob er jemals einen Elternabend besucht hat. Allerdings kam er, wenn es sich einrichten ließ, zu musikalischen oder schauspielerischen Aufführungen, an denen die Söhne beteiligt waren. Vermutlich hat Mutter ihn gedrängt. Diese Enthaltsamkeit erklärt sich so: Erstens hatte er tatsächlich wenig Zeit, und jedermann verstand das. Zweitens hatte er wohl auch wenig Lust. Drittens hielt ihn zu Recht die Sorge ab, jede seiner Äußerungen und Interventionen könnte falsch verstanden werden. Nur einmal griff er ein, als ein als tyrannisch gefürchteter Lehrer mir wegen eines spontan zum Banknachbarn geflüsterten Kurzkommentars eine Strafarbeit aufbrummte, die mich nach den bis zum frühen Abend dauernden regulären Hausaufgaben noch weitere Stunden beschäftigt hätte. (Die Strafen steigerten sich im Verlauf der Unterrichtsstunde, ungeachtet der Schwere des Vergehens.) Da beschloss Vater, mich von der Strafarbeit zu suspendieren und dem Lehrer einen höflichen und nicht unfreundlichen, aber deutlich kritischen Brief zu schreiben. Während er den von mir übergebenen Brief las, verspannten sich die Gesichtszüge des Pädagogen, und er erklärte, jetzt keine Strafarbeiten, sondern nur noch Rügen, Tadel und schlechte Noten zu vergeben. Von alledem teilte er ohnehin reichlich aus. Nach einigen Wochen war der »gute Vorsatz« aber wieder vergessen.
Wenn ich an unser Familienleben zurückdenke, kann ich das Verdikt der Vernachlässigung durch den Vater nicht bestätigen. Dabei fällt sicher ins Gewicht, dass er in den fünfziger und frühen sechziger Jahren noch recht jung war und die berufliche Tätigkeit ein halbwegs normales Leben ermöglichte. Für Matthias war das in der Bonner Zeit wohl anders. Er erlebte den Vater als »emotional behindert«. Gewiss war Vater vergleichsweise wenig zu Hause. Außer Sonntagmittag fanden die Mahlzeiten ohne ihn statt. Und selbst sonntags mussten wir manchmal stundenlang auf ihn warten. Manchmal wurde das Essen mehrmals aufgewärmt, bis er endlich doch eintraf. Für den Fall, dass er zu einer zivilen Zeit heimkam, hatte er stets Arbeit dabei. Ich war als Kind und Jugendlicher davon fasziniert, dass er, so schien es jedenfalls, gleichzeitig Abendbrot essen, fernsehen, einen Text entwerfen und sich unterhalten konnte.
Er war sicherlich nicht das, was man einen Familienmenschen nennt. Und die Anwesenheitszeiten zu Hause waren in seinem Fall besonders knapp bemessen. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu vermissen. Vermisst habe ich hauptsächlich die ausschweifenden Erzählungen der anderen Väter vom Krieg, wo sie sich je nach Temperament und Einstellung heldenhaft oder listig durchgeschlagen, dabei nicht selten – wie in Franz Josef Degenhardts Lied – abwechselnd den Iwan das Fürchten gelehrt und den Nazigenerälen in den Arsch getreten hatten. Man erfuhr auch so grundlegende Weisheiten wie die, dass der Amerikaner alles mit Material macht – nicht ganz verkehrt – , der Franzose militärisch nur bedingt und der Italiener gar nicht ernst zu nehmen sei, anders als der Engländer, dem man trotz der Flächenbombardements (die die Frontkämpfer ja nicht direkt mitbekommen hatten), Achtung zollte, auch wegen seines ritterlichen Verhaltens gegenüber den deutschen Soldaten zu Wasser und zu Lande.
Alle damit verbundenen Erzählerlebnisse, die die Phantasie der Knaben anregten, blieben mir natürlich versagt. Nun hätte mein Vater das mehr als kompensieren können durch Schilderungen aus dem Untergrund im »Dritten Reich« und im besetzten Norwegen, von den abenteuerlichen Fluchten 1933 und 1940, auch aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Doch es entsprach nicht seiner Persönlichkeit anzugeben, den Kindern gegenüber die eigene Rolle herauszustellen, geschweige denn das eigene Verhalten zu überhöhen. Ich musste ihm fast alles aus der Nase ziehen. Was ich dabei erfuhr, ließ mich im Freundeskreis mithalten, wenn es darum ging, durch Berichte über die Taten der jeweiligen Väter das Prestige in der Gruppe zu festigen.
Ich erhielt im Lauf der Zeit von seinen Reisen viele Ansichtskarten, manchen Brief – knapp, freundlich, informativ und selten persönlich. Besonders in meinen Kindertagen nahm Vater gern Bezug auf die ihm bekannten Faibles beim Sohn. So sollte meine Mutter mir von einer Amerikareise ausrichten – der Brief trägt das Datum 4. März 1954 – , dass Vater »noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Büffeln hatte. Neger habe ich hingegen zu Tausenden gesehen und einige wenige Indianer.« Die Political Correctness im Ausdruck war, wie man sieht, noch nicht entdeckt …
Als Kind muss ich den Vater, so wird berichtet, bei allen sich bietenden Gelegenheiten mit Fragen aller Wissensbereiche gelöchert haben. Zugleich wollte ich ihm stets mitteilen, was mich bewegte. Auf Spaziergängen um den Schlachtensee, ein solcher dauerte etwas über eine Stunde, erzählte ich ihm gern die Handlung der soeben zu Ende gelesenen Romane, etwa Jules Vernes »Kurier des Zaren« oder Felix Dahns »Kampf um Rom«. Mit großer Geduld und, wie mir schien, sogar mit Freude hörte er sich diese Schilderungen an.
Zweifellos profitierte ich davon, dass unsere Wohnung, hauptsächlich das väterliche Arbeitszimmer, immer voller Bücher war: Nachschlagewerke, Belletristik, darunter preiswerte Klassikerausgaben verschiedener Ursprungsgebiete und Sprachen, Sachbücher, nicht nur politische und historische, sozialistische Broschüren und Hefte aus vergangenen Jahrzehnten, doch auch Schriftgut ganz anderer ideologischer Ausrichtung, nicht zuletzt aus der NS-Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mich jemals gebremst oder angeleitet hätte, wenn ich in seinen Schätzen stöberte und schmökerte. Nur Zurückstellen sollte man das Entnommene. Die Vorstellung, dass man durch »falsche« Lektüre infiziert werden könnte wie von einem Bazillus, war ihm fremd. Zumindest bei den Söhnen vertraute er auf die letztendliche Kraft der Vernunft.
Wenn Vater da war und sich Zeit für die Familie, die Söhne oder einen von ihnen nahm, dann war er auch präsent. Ich erinnere mich an Brett- oder Kartenspiele, an Fahrten mit dem Ruderboot auf dem Schlachtensee, an Museums- und Theater-, seltener an Kinobesuche. Auch an Ausflüge in dörfliche Ortsteile und zu den um Berlin reichlich vorhandenen Wäldern und Seen. Gelegentlich ging es in den Ostsektor. Die sowjetisch besetzten Stadtbezirke konnten bis August 1961 problemlos besucht werden. So fuhren wir 1960 zum berühmten Pergamonaltar. Diese privaten Besuche in Ost-Berlin hatten wohl auch etwas Demonstratives. Der Westberliner Senat beanspruchte (wie ursprünglich der Ostberliner Magistrat), die legale und legitime Regierung ganz Berlins zu sein. Und der Viermächtestatus beinhaltete bis zum Mauerbau nach allgemeiner Auffassung eben auch die Freizügigkeit in der ganzen Stadt.
1959 wurde ein Fernsehapparat angeschafft. Zur Premiere durften auch die Söhne nach der Tagesschau, die schon damals um 20 Uhr gesendet wurde, einen Film anschauen (was sonst nicht geduldet wurde). Der TV-Konsum blieb nach heutigen Maßstäben bescheiden. Es gab zu dieser Zeit auch nur »West-« und »Ostsender«. Vater fand ohnehin höchstens am späteren Abend Zeit, den Kasten einzuschalten. Er benutzte ihn mehr und mehr als Mittel der Entspannung, sofern man bei einem Thriller wie »Lohn der Angst« mit Yves Montand von Entspannung sprechen kann. Während der Ausstrahlung dieses Films im ARD-Programm soll er ein Weinglas zerdrückt und sich dabei verletzt haben.
Das andere Wohlstandssymbol, das Auto, gab es da schon. 1957 hatte meine Mutter den Führerschein gemacht und erwarb die erste Familienkutsche, einen VW-Käfer. Vaters Rolle war die des Beifahrers, Kartenlesers und Wegweisers. Nach wenig überzeugenden Versuchen in den späten vierziger Jahren (so die Meinung der Mutter) hatte er davon Abstand genommen, das Autofahren zu erlernen. Das war in seiner Generation und auf seinem Einkommensniveau schon damals eher die Ausnahme, hatte aber noch nichts Exotisches an sich. Erleichtert wurde diese Abstinenz dadurch, dass er, wie damals nicht ungewöhnlich, schon als Vertreter des SPD-Vorstands in Berlin, dann als Präsident des Abgeordnetenhauses und Regierender Bürgermeister einen Dienstwagen gestellt bekam – mit Chauffeur. In der Bürgermeisterzeit war das Georg Maria Holly, der schon Ernst Reuter gefahren hatte. Für die Söhne Brandt war er nur der heißgeliebte »Onkel Holly«, der in den langen Wartezeiten und sogar außerhalb des Dienstes sich tatsächlich wie ein Onkel um uns kümmerte (er hatte selbst wohl keine Kinder). Einmal bastelte er mit uns und unseren Freunden sogar stabile Holzschwerter, Schilde aus Sperrholz, die wir bemalten, und Helme aus dicker Pappe, sodass wir Ritterspiele mit einer zünftigen Ausrüstung abhalten konnten.
Ich weiß nicht, wie zu dieser Zeit die Regeln für den Gebrauch von Dienstwagen beschaffen waren. Jedenfalls wurde die Grenze zwischen dienstlichen und privaten Aktivitäten wohl weniger streng gezogen als heute. Damit will ich nicht nur ansprechen, dass die Grenze in manchen Berufen, wie dem des Politikers, tatsächlich fließender ist als sonst. Bei der Hin- und Rückfahrt zu Urlauben trat Georg Holly oft dann in Aktion, wenn diese mit offiziellen oder offiziösen Besuchen des Berliner Stadtoberhaupts bei Amtskollegen kombiniert waren, zumindest innerhalb Deutschlands, und das kam gar nicht selten vor. Solche Termine waren nicht an den Haaren herbeigezogen. Sie ergaben sich aus der Notwendigkeit, vor allem während der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre, also der Zeit der zweiten Berlinkrise, überall und stets für die Solidarität mit der Westberliner Halbstadt zu werben. Sicherheitsbeamte gab es damals noch nicht. Übrigens war eine Autofahrt aus Berlin nach »Westdeutschland« seinerzeit auch für den Regierenden Bürgermeister eine langwierige Angelegenheit: Vor dem Berlin-Abkommen und den deutsch-deutschen Transit- und Verkehrsverträgen von 1971/72 gab es keinen Anspruch auf zügige Abfertigung und Durchfahrt. Jedes Auto wurde mehr oder weniger gründlich inspiziert, und zu Beginn der großen Schulferien staute sich der Verkehr bei der Einreise in »die Zone« viele Stunden auf, auch für den »Regierenden«.
Im Urlaub wirkte Vater gelöst und wie befreit und konnte die Sorgen der Berliner Amtsgeschäfte zwischendurch ganz vergessen, auch wenn er immer irgendwelche Papiere dabei hatte und brieflich oder telefonisch Kontakt mit dem Rathaus Schöneberg halten musste (was in der norwegischen Einsamkeit nicht ganz einfach war). In Erinnerung sind mir Besichtigungen der üblichen touristischen Attraktionen, etwa der Zugspitze oder der altfränkischen Kleinodien Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl, lange Spaziergänge bei jedem Wetter und abendliches Vorlesen altertümlicher Sagen. Beim Norwegenurlaub 1958 in einer einfachen Hütte las Vater allabendlich vor dem Kamin in der nur leicht modernisierten Originalsprache aus »Snorre« vor, den im Mittelalter aufgeschriebenen klassischen Königs- und Heldensagen der Wikingerzeit. So etwas vergisst man nicht, zumal ich damals mehr in der Welt der Sagen und Rittergeschichten lebte als in der Gegenwart.
Mag sein, dass mein Vater seit den siebziger Jahren keine Lust mehr hatte zu angeln. In der Zeit, die ich in seiner Nähe lebte, war er ein passionierter Angler, sachkundig assistiert von Lars, der die Freizeitbeschäftigung, obwohl ein Kind, ebenfalls mit Ernst und Ausdauer betrieb. Mir war das Angeln meistens zu langweilig. Vater suchte in dieser Beschäftigung vermutlich frische Luft und meditative Einsamkeit. Dieses Bedürfnis muss stark gewesen sein. Bei sommerlichen Familienurlauben, sei es in Fischbachau in Oberbayern 1959, wo er stundenlang in fließenden Gewässern nach Forellen fischte, oder in Gjendesheim im norwegischen Hochgebirge 1962 war er überwiegend mit dem Angeln beschäftigt. In Gjendesheim war der ohnehin nicht besonders warme Sommer im Jahr 1962 so spät gekommen, dass der an sich fischreiche Gebirgssee schlechterdings nichts hergab. Das hinderte meinen Vater aber nicht daran, jeden Vormittag erneut hinaus zu rudern und sein Glück zu versuchen, oftmals in Begleitung von Lars. Dass die Laune dabei nicht besser wurde, ist verständlich.
Die Unterkunft während dieses norwegischen Gebirgsurlaubs war eine Holzhütte, die der Osloer Regierung gehörte, mit offenem Kamin als Heizung (eine Heizung war auch im Sommer dringend erforderlich) und Außenklo. Ich erhielt den Titel »Dr. W. C.«, weil ich mich, um anderer Hausarbeit zu entgehen, bereit erklärte, jeweils den Eimer mit den Fäkalien zu entsorgen. Da diese Art Hütten niedrig gebaut sind, stieß sich mein Vater beim Gang von einem Raum in den anderen fast regelmäßig den Kopf. Dabei fluchte er wahlweise auf Deutsch »Scheiße!« oder »Mist!« oder auf Norwegisch »Fan!«, was soviel wie »Teufel« bedeutet und ein ziemlich drastischer Fluch ist.
1963 war ich nur noch zur Hälfte dabei. Die ersten drei Wochen der Ferien fuhr ich mit den »Falken« in das jährliche große Sommerlager, diesmal im Allgäu, in der Nähe von Füssen, wo ich ein Zelt mit gleichaltrigen Insassen zu leiten hatte. Das war keine leichte Aufgabe für einen Vierzehnjährigen. Anschließend stieß ich zu den Eltern und Geschwistern, die in Alpbach in Tirol Urlaub machten. Dort pflegte sich auch der Schriftsteller Arthur Koestler mit seiner südafrikanischen Frau zu erholen. Koestler, der sich bei Vater später schriftlich für die »eigenhändig« gefangenen Fische bedankte, kam mir reichlich überspannt vor. Als bekehrter Exkommunist entgegnete er heftig auf meine sicher etwas grobschlächtige Kritik am »freien Westen«. Mit blitzenden Augen hielt er mir vor, es seien »junge Burschen« wie ich gewesen, die beim Ungarn-Aufstand im Herbst 1956 auf die sowjetischen Panzer aufgesprungen wären, und verkündete melodramatisch, wenn man das Imperium der Moskowiter nicht abschrecken könne, dann sei es besser, die ganze Erde und mit ihr die Menschheit flöge in die Luft. Koestler war kinderlos …
1964 erwarb meine Mutter in der norwegischen Mittelgebirgslandschaft Vangsåsen, nahe ihrer Heimatstadt Hamar, zwei Hütten mit Grundstück, wovon eine in mehreren Schritten zu einem veritablen Wohnhaus ausgebaut wurde. Ab 1965 standen sie den Familienangehörigen und engeren Freunden für Winter- oder Sommerurlaube zur Verfügung. Für Mutter waren sie ein Refugium, wohin sie sich mit Matthias Jahr für Jahr in fast allen Schulferien zurückzog. Auch die älteren Söhne nutzten das Domizil ausgiebig. Im Sommer pflegte Vater wenigstens eine gewisse Zeitlang dort zu sein. Obwohl er eine starke Verbindung mit Norwegen hatte, meinte ich zu spüren, dass er sich nicht uneingeschränkt wohlfühlte. Wenn sich unsere Aufenthalte überschnitten, stellte ich dieselbe Rückzugstendenz fest, wie ich sie auch sonst zunehmend wahrnahm. Zwischendurch war er dann wieder ganz der Alte, den ich aus der Kindheit kannte. Norwegen und erst recht das Ferienhaus waren untrennbar mit Rut verbunden, und so verwundert es nicht, dass er mit Brigitte in Südfrankreich 1983 etwas Neues kaufte, wo es warm war (was er im Alter mehr schätzte als früher) und woran sie gleichermaßen hingen.
Das Spiel mit starkem Körpereinsatz – wie das Spielen überhaupt – war nicht so sehr Vaters Sache. Doch er ließ sich leicht anstecken, wenn andere Erwachsene dabei waren. 1960 unternahmen wir mit der eng befreundeten Nachbarsfamilie eine Urlaubsreise in den Lungau, den südöstlichen Teil des Landes Salzburg. Ich erinnere mich an manches Versteck- und Geländespiel mit Vätern und Söhnen und sehe heute noch das vergnügte Gesicht meines Vaters vor mir, als er es einmal schaffte, die sehr viel wendigeren und schnelleren Jungen zu überlisten.
Die Familie Bohmbach, mit der zusammen wir den Urlaub verbrachten, wohnte in der anderen Hälfte des Reihenhauses in der Marinesiedlung (Berlin-Schlachtensee), das die Brandts von 1955 bis 1964 bewohnten. Davor war eine etwas kleinere Wohnung an anderer Stelle der Siedlung unser Domizil gewesen. Danach – bis 1966/67 – wohnten wir in einer Dienstvilla in Grunewald, wo der Senat neben einem großen Gästehaus ein auf der anderen Seite desselben Grundstücks gelegenes Haus erworben hatte, das der als »Zuckerkönig« bekannte frühere Eigentümer einst für seinen Chauffeur und Hausmeister hatte errichten lassen. Dieses stand künftig dem Regierenden Bürgermeister zur Verfügung. Es war mehr als ausreichend für eine mehrköpfige Familie. Während ich in Grunewald weder die Namen der Nachbarn nennen konnte noch wusste, wie sie aussahen, kannte man in der Marinesiedlung, die voll von Kindern war, jeden.
Bohmbachs schienen auf den ersten Blick nicht wie geschaffen für eine Freundschaft mit den Brandts: eine seit Generationen etablierte bürgerlich-katholische Familie. Die Bohmbach-Söhne Michael und Christian waren allerdings mit den Brandt-Söhnen dick befreundet, der ältere merkwürdigerweise hauptsächlich mit Lars, während die weniger als ein Jahr auseinanderliegenden Christian und Peter gut zusammenpassten. Vater Hans Eberhard Bohmbach war ein einnehmender, gutaussehender Mann, erkennbar wenig von Selbstzweifeln geplagt, erfolgreicher Rechtsanwalt und Notar, ein Mensch konservativer Lebens- und Weltanschauung. Seine Distanz zur Berliner CDU begründete er mir gegenüber einmal damit, dass deren Spitzenmann Franz Amrehn ein »Prolet« sei, wie immer das gemeint war. Als gläubige Katholiken waren Eberhards Eltern keine NS-Anhänger gewesen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ihnen die Nazis zu primitiv waren. Im Krieg hatte Eberhard Bohmbach als Kriegsfreiwilliger gekämpft, zuletzt als Panzergrenadier an der Westfront, wo er schwer verwundet wurde. In der Nachkriegszeit fuhr er mit seinem Jungen mehrfach zu Veteranentreffen.
Mit diesem Mann schloss Willy Brandt eine zwar nicht intime, aber auch nicht ganz oberflächliche Freundschaft. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie unter vier Augen offen über ihre früheren Lebensphasen sprachen. Ideologie hin oder her – die beiden mochten sich einfach. Willy schenkte Eberhard beim Auszug aus dem Marinesteig seinen dort benutzten Schreibtisch. Trotzdem wären sich diese Männer vermutlich nicht näher gekommen, wenn nicht ihre Ehefrauen Rut und Marianne beste Freundinnen geworden wären. Ich glaube, sie hatten keinerlei Geheimnisse untereinander, und es gab keine Sorgen, die sie nicht teilten und dadurch erleichterten. Zwischenzeitlich wurde sogar erwogen, die Wand zwischen den beiden Häuserhälften zu durchbrechen und so eine Art doppelfamiliäre Wohngemeinschaft aufzumachen.
Zur Familie Brandt gehörte fast von Anfang an Martha Litzl. Sie war unsere Haushälterin. Martha war auf einem Bauernhof in der Neumark aufgewachsen und hatte ihren Mann im Krieg verloren. Sie nahm sich der Brandt-Kinder an, als wären es ihre eigenen, harmonierte bestens mit der »Chefin«, die selbst keine Hausarbeit verschmähte – sie kochte gut und putzte unschlagbar gründlich – und verehrte den Herrn des Hauses. Wenn sie morgens früh um 5 Uhr aufstand, so erzählte sie mir später, hätte oft noch die Schreibmaschine geklappert, und sie riet mir, ebenso viel zu arbeiten wie mein Vater, wenn ich etwas werden wollte. Ein anderes Mal mahnte sie allerdings, ich solle bloß nicht so viel schuften wie der Vater, sondern auch die angenehmen Seiten des Lebens auskosten.
Wie dem auch sei. Litti, wie wir Kinder sie nannten, musste krankheitshalber zurückstecken, als sie etwa fünfzig war, und kam nur noch ein oder zwei Tage in der Woche, um das Kommando zu übernehmen, und tat das auch später noch in Bonn. Seitdem gab es ein junges Hausmädchen. Ursel, die von 1958 bis 1961 bei uns und mit uns lebte, war für Lars und mich wie eine große Schwester, und meine Mutter nahm sie wie ihre Nachfolgerinnen unter ihre Fittiche.
Ich habe mich manchmal gefragt, welche Einstellung Vater zu Martha Litzl hatte. Es erschließt sich mir auch nicht aus den Briefen, die er seiner Frau schrieb, wenn diese in Norwegen weilte. Dass er Litti respektierte, wie er andere Menschen stets respektierte, und ordentlich behandelte, steht für mich außer Frage. Doch eine emotionale Bindung konnte und kann ich nicht erkennen. Das scheint mir auch für die Chauffeure und Sicherheitsbeamten zuzutreffen, die ihm im Laufe seiner Berliner und Bonner Dienstexistenz zugeteilt waren. Das Verhältnis zu den jeweiligen Sekretärinnen schien mir teilweise persönlicher zu sein, vielleicht bedingt durch den berufsmäßig ständigen engen Kontakt.
Ich hatte in den späten fünfziger Jahren nicht das Gefühl, dass die berufliche Stellung des Vaters mich in meinen kindlichen Aktivitäten nennenswert einschränkte. Ich war, obwohl sensibel, das, was man einen »richtigen Jungen« nannte, grobe Streiche, »Mutproben« und »Bandenkriege« inklusive. Mehr unausgesprochen als ausgesprochen gaben beide Eltern mir und meinen Brüdern zu verstehen, dass wir uns auf Vaters Position ja nichts einbilden sollten. Irgendeine Überheblichkeit anderen Menschen gegenüber aufgrund ihrer Hautfarbe, Nationalität, Religion oder gar ihres sozialen Status ist mir zu Hause nicht einmal andeutungsweise begegnet. Auch der Gedanke an Sippenhaftung, etwa im Fall eindeutiger »Nazifamilien«, lag außerhalb des Brandt’schen Horizonts.
Als mein Vater Regierender Bürgermeister wurde, gratulierte mir die Klassenlehrerin in der Grundschule. Ich war ganz verdattert darüber, denn das war ja nicht mein Verdienst. Öfter als mir lieb war, kamen Pressefotografen ins Haus und verlangten irgendwelche mehr oder weniger natürlichen Familiendarbietungen. Das war mir äußerst lästig. Ich fühlte mich fremdbestimmt. Meine Mutter musste manchmal sehr nachdrücklich auf mich einreden, damit ich das Blitzlichtgewitter und die Filmaufnahmen über mich ergehen ließ. Doch das war keine Dauererscheinung. Mein Alltag sonst war kindgemäß.
Als Robert Kennedy, der US-amerikanische Justizminister und Bruder des Präsidenten, im Februar 1962 mit seiner Frau Ethel nach Berlin kam, äußerte er meinen Eltern gegenüber den Wunsch, vor seiner Abreise, die schon für den nächsten Vormittag angesetzt war, die Kinder zu sehen. Den Einwand, diese unterlägen der Schulpflicht, ließ er nicht gelten. Er würde selbst die Entschuldigung schreiben. Nun war ich darüber keineswegs begeistert. Diese Art Aufsehen war mir peinlich. Ich fragte mich, wie das bei der Lehrerschaft ankommen würde. Doch der vereinte Druck der elterlichen Regierung und der amerikanischen Supermacht war zu groß für meinen Widerstand. Lars und ich mussten zu »Bobbys« Verabschiedung zum Flughafen Tempelhof kommen, wo dieser uns ein paar freundliche Worte widmete und hauptsächlich die »Entschuldigung« schrieb: Wir hätten an »sehr wichtigen« Besprechungen teilnehmen müssen, die die »Freiheit der Vereinigten Staaten und Berlins betreffen«. Das war zwar witzig, aber anfangen konnten wir damit nichts.
Eine langjährige Freundschaft ging aus der Verbindung mit Harold, Greta und Kathy Hurwitz hervor, die Willy in seinen Briefen an Harold »die Prinzessin« nannte. Harold, der 2012 starb, war Amerikaner mit ostjüdischem Hintergrund, Sozialist und kam 1946 als Angehöriger der Militärregierung nach Deutschland. In Berlin lernte er seine Frau Margarete (Greta), die aus einer ursozialdemokratischen Familie stammte und ihn mit anderen Sozialdemokraten wie Gustav Klingelhöfer zusammenbrachte, der noch vor der »Zwangsvereinigung« von ostzonaler SPD und KPD mit Grotewohls Linie brach. Von 1946 bis 1951 war er Stadtrat beziehungsweise Senator für Wirtschaft. Auch das Ehepaar Klingelhöfer gehörte zum Freundeskreis meiner Eltern und war Lars und mir sehr zugetan. Ich erinnere mich noch genau, wie der unheilbar krebskranke Gustav mit seiner Frau ein letztes Mal zu uns kam, um bei klarem Verstand Abschied zu nehmen und die Kinder noch einmal zu sehen.
Aber zurück zu Harold Hurwitz. Harold und Willy lernten sich kennen, als mein Vater noch für die Norwegische Militärmission arbeitete. Harold war sein Leben lang so etwas wie ein linker Antikommunist ohne Scheuklappen oder Berührungsängste. Später war ich erstaunt zu erfahren, dass er, der er in den Jahren von McCarthy üblen Verdächtigungen ausgesetzt gewesen war, seine US-Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben hatte und ebenso wenig seine jüdische Konfession. Gefühlsmäßig schien er mir mehr als allem anderen der Berliner Sozialdemokratie verhaftet zu sein. Er wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter von Ernst Reuter und Willy Brandt. Später schlug er die Universitätslaufbahn ein. Harold war ein höchst liebenswertes Unikum, über das man ein eigenes Buch schreiben könnte. Die Hurwitzens wohnten ihr Leben lang in Zehlendorf und gingen oft mit Kathy, Lars und mir baden. Harold brachte Lars das Schwimmen bei und forcierte mein frühes Interesse an Geschichte. Er schenkte mir Fritz Fischers Buch über die deutsche Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg. Das war 1961. Ich war keine dreizehn Jahre alt und hatte bis dahin nicht viel vom 20. Jahrhundert wissen wollen, was sich nun langsam änderte.
1956 machten Brandts und Hurwitzens gemeinsam Urlaub auf der dänischen Insel Møn. Harold erzählte Jahrzehnte später, wie die beiden Elternpaare nach einem guten Abendessen in dem gemütlichen Gasthof, wo wir während der Ferien wohnten, ohne Kinder einen Verdauungsspaziergang machen wollten. Willy grübelte über seine Zukunft – er war auf dem Bundesparteitag in München zum zweiten Mal nicht in den SPD-Vorstand gewählt worden und spürte noch die Berliner Fraktionskämpfe in den Knochen. Da hat Harold ihn angeblich mit der Prophezeiung aufzumuntern versucht: »Denk an Churchill, wie lange er warten musste. Eines ist ganz sicher: Außenminister der Bundesrepublik wirst du jedenfalls werden.« Über diese Perspektive verliefen sich die beiden Brüder im Geiste, verloren ihre Frauen aus den Augen, und als sie nach über zwei Stunden in finsterer, kühler Nacht umherirrend wieder am Ausgangspunkt ankamen, fanden sie Rut und Greta vergnügt in einem der großen Betten liegen und sich mit einer Flasche Weinbrand trösten. Harold sagte mir einmal ohne jeden Groll, Willy wäre »immer wieder« ein ausgesprochen zugewandter, wunderbarer Freund gewesen. Aber man hätte nicht darauf vertrauen können, den Faden bei nächster Gelegenheit einfach weiterzuspinnen.
Bei Klaus Schütz lagen politische und persönliche Freundschaft am dichtesten beieinander. Nach meinem Eindruck war Schütz in der Berliner Zeit Willys engster Vertrauter unter den Freunden – dann wurde es Egon Bahr. Klaus Schütz, auch er starb 2012, trat 1946 in die SPD ein, während er ein Studium an der Humboldt-Universität aufnehmen wollte. Er wurde zum Mitbegründer der Freien Universität. Zunächst liebäugelte er mit einem linkssozialistischen Antistalinismus trotzkistischer Observanz, wurde aber über einen Stipendienaufenthalt in Amerika 1949 zum eifrigen Parteigänger Ernst Reuters und Willy Brandts. Klaus Schütz organisierte jahrelang den Machtkampf um den Berliner SPD-Vorsitz, den Willy Brandt schließlich 1958 gegen den früheren Metallarbeiter und erprobten KPD-Bekämpfer Franz Neumann für sich entscheiden konnte.
Auch im Falle Schütz-Brandt waren die Familien miteinander befreundet, jedenfalls neben den Männern auch die Frauen. Wenn Willy Brandt und Klaus Schütz ihre langen Spaziergänge machten, auf denen sie viel (Macht-)Politisches beredeten, nahmen sie mich oft mit, auch als ich schon älter war und anfing, kritisch über das zu denken, was da zur Sprache kam. Als ich meinen Vater einmal auf etwas ansprach, das mich an Schütz irritierte, legte er mir nahe, den vermeintlichen Zynismus mancher Äußerungen von Klaus nicht falsch zu verstehen. Dahinter verberge sich ein ausgeprägtes moralisches Empfinden, das sich mit Zynismen gegen ständige Verletzungen imprägniere. Solche Belehrungen erteilte mein Vater nicht oft – und wenn, dann ohne Zeigefinger. Vielleicht haben sie sich bei mir deswegen so gut eingeprägt, weil er sie so vorsichtig dosierte. Allerdings, so denke ich, wären etwas mehr direkte Orientierungsangebote in manchen Phasen hilfreich gewesen …
Was Klaus Schütz und Willy Brandt um 1960 überlegten, klang in den Ohren eines aufgeweckten Zehn-, Zwölf-, oder Vierzehnjährigen bisweilen recht bizarr. Weil sie sicher sein konnten, dass der andere nichts in den falschen Hals bekam, sprachen sie ohne Vorbehalt und Vorsicht. Von Willys Kanzlerkandidatur war, soweit ich mich erinnern kann, vor dem Sommer 1960 nicht die Rede, jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Von der programmatischen und strategisch-taktischen Neuaufstellung der SPD sprachen sie dagegen viel und zogen – neben anderem – sogar ein Zusammengehen der SPD mit der Heimatvertriebenenpartei BHE in Betracht. Das war damals nicht ganz so absurd, wie es sich in der Rückschau ausnimmt. Zwischen beiden Gruppierungen gab es inhaltliche Überschneidungen, insbesondere in der Sozialpolitik. Auch koalierten SPD und BHE in mehreren Bundesländern, wie zum Beispiel in Hessen. Schließlich gehörten wichtige Funktionäre des Bundes der Vertriebenen beziehungsweise seiner Landsmannschaften auch der SPD an, so Wenzel Jaksch, der als sudetendeutscher Sozialdemokrat in den dreißiger Jahren einen »volkssozialistischen« Flügel repräsentierte. Jaksch war übrigens im Früherbst 1965 zum letzten Mal bei uns zu Besuch, im Jahr danach kam er bei einem Autounfall ums Leben. Ich will nicht zu viel in solche Episoden hineinlegen. Mir liegt vor allem daran zu illustrieren, wie Willy Brandt um 1960 gemeinsam mit Klaus Schütz Gedankenspiele anstellte, die einem einzigen Ziel dienten: der bundesdeutschen SPD einen Weg aus der Dreißigprozentecke und der strukturellen Minderheitsposition zu eröffnen. Meine Mutter meinte scherzhaft: »Wenn sie das an die Regierung brächte, würden sie sich selbst mit dem Teufel verbünden.«
Im Herbst 1961, kurz nach dem Mauerbau und der verlorenen Bundestagswahl, beschloss mein Vater, im kommenden Januar mit seinem Berater und engen Mitarbeiter Egon Bahr in Tunesien auf der Insel Djerba zwei oder drei Wochen Urlaub zu machen. Verglichen mit dem Tourismus späterer Jahrzehnte war das Land noch ziemlich ursprünglich. Ob er selbst darauf gekommen war oder ob meine Mutter ihm das eingeblasen hatte: Ich als Sohn Nr. 1 sollte mit. Nach einem ausführlichen Antrag an die Schule (»einmaliges Bildungserlebnis«), durfte ich als dritter Mann mitfahren.
Die tunesische Regierung stellte unaufgefordert einen Chauffeur und zwei Sicherheitsleute für uns ab, die wir, in der Annahme, damit auch ihren Rang zu erfassen, Nummer eins, Nummer zwei und Nummer drei nannten. Tatsächlich war Nummer zwei der Chef der kleinen Crew. Einmal zeigte er uns die Narben an seinem Bein, die von Folterungen durch die französische Kolonialmacht herrührten. Wir verbrachten zwei Wochen in einem wunderbar orientalischen Hotel auf Djerba und reisten dann mehrere Tage durchs Land. Es war nicht nur für mich außerordentlich faszinierend. Am Ende der Reise traf mein Vater in Tunis Präsident Habib Bourguiba, der sich schon durch seinen Palast als ein orientalischer Potentat zu erkennen gab, wie er leider auch aus antikolonialen Bewegungen hervorgehen konnte. Der Westberliner Bürgermeister war Anfang 1962 nicht wählerisch, wenn es galt, Unterstützung zu finden.
Meine »objektive Funktion« auf dieser Reise bestand nicht zuletzt darin, bei den gelegentlichen Einladungen durch starkes Essen die Wertschätzung der Gäste für das ihnen Kredenzte glaubwürdig auszudrücken. Ob in einem Beduinenzelt, wo undefinierbare scharfe Gerichte serviert wurden, oder beim Gouverneur von Djerba, der von Soldaten oder Polizisten eine Unzahl von Gerichten in unglaublichen Quantitäten bringen ließ – ich war von Natur aus sehr dünn und konnte folgenlos riesige Mengen verdrücken. Willy und Egon gaben sich ebenfalls Mühe, lagen aber am Folgetag prompt krank darnieder. Nur ich war putzmunter!
Egon Bahr fungierte seit 1960 als Senatspressechef, nachdem er Redakteur beim RIAS gewesen war. Als wir zusammen nach Tunesien fuhren, waren die beiden schon per Du, aber so ganz sicher schien sich mein Vater nicht zu sein, wie vertraulich er mit seinem befreundeten Mitarbeiter und Berater umgehen konnte. Als Egon beim Hochseeangeln besonders viele Fische fing, ernannten mein Vater und ich ihn zu »Dr. Barsch« (natürlich waren es keine Barsche, die er gefangen hatte). Egon wurde des Herumalberns wohl irgendwie überdrüssig, sodass Vater mich, der ich kein Ende finden konnte, unauffällig stoppte. Er war ein sorgsamer Mensch, stets bestrebt, andere weder absichtlich noch unabsichtlich zu beleidigen oder zu verunsichern. Wieder in Berlin, kam Egon Bahr immer häufiger zu uns nach Hause, manchmal auch mit seiner damaligen Frau Dorothea (die sich dauerhaft mit Rut anfreundete), Sohn Wolfgang und Tochter Marion. Ich werde nie vergessen, wie mich Egons Äußerung elektrisierte, nach Adolf Hitler hätte »der Separatist« Adenauer (nebst Ulbricht) am meisten zur Verhinderung der Wiedergeburt Deutschlands als eines einheitlichen souveränen Staates beigetragen. Vater, der dabei war, kommentierte diese Äußerung nicht, obwohl er meine Verwirrung bemerkt haben muss.
Zum Freundeskreis der Familie Brandt gehörten auch nordeuropäische Diplomaten und Journalisten, Iris und Frank Holte, Hjørdis und Oddvar Ås, »Poppi« und Per Monsen aus Norwegen, Christina und Dieter Winter sowie Astrid und Bo Jærborg aus Schweden. Mit den nordischen Freunden sang mein Vater deutsche Volks- und Fahrtenlieder, darunter sein Lieblingslied aus der Jugendbewegung, das auch mein Lieblingslied werden sollte: »Wilde Gesellen«. Dazu spielte er damals noch auf seiner Mandoline.
Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht, Fürsten in Lumpen und Loden, ziehn wir dahin, bis das Herze uns steht, ehrlos bis unter den Boden. Fidel Gewand in farbiger Pracht trefft keinen Zeisig ihr bunter, ob uns auch Speier und Spötter verlacht, uns geht die Sonne nicht unter.
Ziehn wir dahin durch Braus und durch Brand, klopfen bei Veit und Velten. Huldiges Herze und helfende Hand sind ja so selten, so selten. Weiter uns wirbelnd auf staubiger Straß immer nur hurtig und munter. Ob uns der eigene Bruder vergaß, uns geht die Sonne nicht unter.
Aber da draußen am Wegesrand, dort bei dem König der Dornen. Klingen die Fiedeln ins weite Land, klagen dem Herrn unser Carmen. Und der Gekrönte sendet im Tau tröstende Tränen herunter. Fort geht die Fahrt durch den wilden Verhau, uns geht die Sonne nicht unter.
Bleibt auch dereinst das Herz uns stehn, niemand wird Tränen uns weinen. Leis wird der Sturmwind sein Klagelied wehn, trüber die Sonne wird scheinen. Aus ist ein Leben voll farbiger Pracht, zügellos drüber und drunter. Speier und Spötter, ihr habt uns verlacht, uns geht die Sonne nicht unter.
Emotional und intellektuell wichtiger waren für Willy Brandt jedoch die Verbindungen zu politischen Freunden, früheren Genossen der linkssozialistischen SAP, der er ja von 1931 bis 1944 angehört hatte. Stefan und Erszi Szende, beide aus wohlhabenden ungarisch-jüdischen Familien stammend, die fast vollständig in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet wurden, gehörten dazu. Wie alle linksgerichteten Juden, die ich im Umfeld meines Vaters kennenlernte, so auch Valtr und Luci Taub, waren oder schienen sie areligiös zu sein und im Übrigen völlig frei von antideutschen Affekten. Das Leid, das ihnen vom »Dritten Reich« zugefügt worden war, führten sie – und das war ihnen äußerst wichtig – nicht auf »rassische«, sondern auf politische Verfolgung zurück.
Der undogmatische Denker und Zeitdiagnostiker Fritz Sternberg, der 1963 verstarb, war ein sehr geschätzter politischer Gesprächspartner Willy Brandts, ebenso Irmgard und August Enderle, die mit Vater im Stockholmer Exil gewesen waren und mit ihm zusammen den Weg in die SPD fanden. Der schwäbische Facharbeiter und Gewerkschafter August Enderle gehörte gewissermaßen zum Adel der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung: Von der SPD und USPD ging er zum Spartakusbund und zur KPD, von der KPD zur KPD-Opposition, von dort zur SAP und zur SPD. Das war ein Lebensweg, für den Vater hohen Respekt hatte: seine Grundüberzeugungen nicht aufgeben, auch nicht einer pervertierten Parteidisziplin unterordnen, sondern einen glaubhaften Weg suchen, der sich an den Realitäten orientiert und neue Einsichten zulässt. Ein ganz anderer Typ war Boris Goldenberg. Sein Exilland hieß Kuba, wo er als Lehrer auch den Sohn des Diktators Batista unterrichtete. Er erlebte den Umsturz durch Fidel Castro und erzählte bei Besuchen zum Teil haarsträubende Begebenheiten aus der Zeit des alten Regimes und der Kubanischen Revolution. Der relativ reiche Inselstaat hätte völlig unter Kontrolle der USA und des Batista-Clans gestanden und sei eine Art Bordell für US-amerikanische Gangster gewesen. Castro hatte, so Goldenberg, mindestens 95 Prozent der Kubaner hinter sich, als er die Macht übernahm. »Ich wünsche Fidel alles Gute – es wird aber nicht funktionieren.« Den hingerissenen Brandt-Söhnen, die sich Fidel Castro als eine Mischung von Robin Hood und Florian Geyer vorstellten, beantwortete Goldenberg geduldig jede Frage.
Horst Lison war ein jüngerer Freund meiner Eltern und gewissermaßen mein »großer Bruder«. Er hatte mal einem Schul- und Spielfreund von mir Privatunterricht gegeben. Ich durfte einige dieser Nachhilfestunden mitmachen, sie bereiteten mir einen Riesenspaß. Doch mit dem Erlernen des Lateinischen als erster Fremdsprache wehte irgendwann auch bei mir der Wind schulischen Lernens schärfer. Die meisten Mitschüler erhielten von ihren Eltern Unterstützung. Bei mir ging das nicht, wegen beruflicher Überbeanspruchung einerseits und Fehlens höherer Schulbildung andererseits. Da wurde Horst Lison zu einem Helfer in der mehr oder weniger großen Not. Nicht nur für mich, sondern auch für Lars. Aus Gründen, die mir heute nicht mehr erklärlich sind, ging ich ab der Sexta nicht gern zur Schule. Meine Leistungen waren in der Summe so etwas wie guter Durchschnitt. Allerdings wurde damals strenger benotet als heute, und eine gar nicht so kleine Zahl von Jugendlichen wiederholte am Gymnasium mindestens eine Klasse. Meinem väterlich-brüderlichen Freund sei Dank, geriet ich nie in diese Gefahrenzone. Doch die wichtigste Spätfolge seines Einsatzes war, dass er mir das konzentrierte geistige Arbeiten beibrachte.
Horst, der sein Diplom in Psychologie um ein Medizinstudium ergänzte, wurde von meinen Eltern häufig gebeten, nach dem Unterricht noch zu bleiben. Daraus ergaben sich, vor allem mit Vater, oft lange Gespräche über Politik. Bei einigen dieser Unterredungen war ich dabei, und ich erinnere mich, wie Horst von autoritären Tendenzen in der Bundesrepublik sprach. In seinem Freundes- und Kommilitonenkreis habe man vereinbart, im Falle des Falles nicht zuzuwarten, bis ein diktatorisches Regime sich gefestigt hätte, sondern umgehend Widerstandszellen zu bilden. Horst war ein Mann der Tat. Als die innerstädtische Demarkationslinie in Berlin mit den Absperrungsmaßnahmen des 13. August 1961 zur beinahe unüberwindbaren Grenze wurde, organisierte er – wie so viele – nichtkommerzielle Fluchthilfe. Sein Zirkel kümmerte sich speziell darum, an der Freien Universität studierende Ostberliner, die keine Chance hatten, ihr Studium an der Humboldt-Universität oder einer andern Hochschule der DDR fortzusetzen, mithilfe gefälschter Pässe nach West-Berlin zu schaffen. Das ging eine Zeitlang gut. Aber in einer der Gruppen, die herübergeschleust wurden, befand sich ein Spitzel. Horst wurde verhaftet, endlos verhört, auch über Willy Brandt. Er gab sich naiv und räumte nur ein, was schon bekannt war. Nach mehrmonatiger Haft im Stasigefängnis in Hohenschönhausen wurde er zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt.
Mein Vater bemühte sich intensiv um seine Freilassung, und nach knapp zwei Jahren gelang dies im Rahmen eines Gefangenenaustauschs und mit der Hilfe der Anwälte Stange (West-Berlin) und Vogel (Ost-Berlin), die sich seit 1962 um humanitäre Dinge kümmerten. Horst Lison wurde später Leiter von kinderpsychiatrischen Kliniken. Nach seiner Freilassung traf er meinen Vater just an dem Tag wieder, als John F. Kennedy in Berlin war, also am 26. Juni 1963. Trotz des hohen Gastes nahm Willy Brandt sich Zeit, den frisch aus der Haft Entlassenen im Rathaus Schöneberg zu empfangen. Niemals, so erzählte Horst später, hätte er Willy wieder so fröhlich erlebt, nie mehr sei Willy in seiner Gegenwart so aus sich herausgegangen. Der Bürgermeister umarmte den Ankömmling heftig und schüttelte lange seine Hand. Bis heute hat diese Freundschaft Bestand.
Immer wieder ist zu lesen, dass nach der »Wahlniederlage« von 1965 zwischen den Eheleuten Brandt ernsthaft diskutiert worden sei, sich nach Norwegen zurückzuziehen. Tatsächlich war mein Vater aufgrund des SPD-Wahlergebnisses von 39,3 Prozent tief deprimiert und hatte öffentlich seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklärt. Im Familienkreis hatte er den Gleichstand von CDU/CSU und SPD, wenigstens den Sprung über die 40-Prozent-Marke prognostiziert. Die Söhne bekamen von dem, was zwischen den Eltern beredet wurde, nichts mit. Allerdings schüttete Mutter mir ihr mitleidendes Herz aus, weinte und sprach tatsächlich von einem möglichen Rückzug ins Privatleben. Ich würde auch nicht ausschließen, dass im Gespräch mit Vater von ihrer Seite das Stichwort »Norwegen« gefallen ist. Dass aber ein Umzug konkret in Erwägung gezogen worden wäre, insbesondere von meinem Vater, halte ich für extrem unwahrscheinlich, um nicht zu sagen: für Unsinn.
Zum Weihnachtsfest 1965 hatten sich die Gefühle wieder beruhigt. Bemerkenswerterweise war Weihnachten in meiner Erinnerung mehr vom Vater geprägt als von der Mutter, und das, obwohl er sicher nicht die Hauptlast der Vorbereitung trug. Vielleicht kommt meine Erinnerung auch daher, dass Vater und Söhne regelmäßig am späten Nachmittag des 24. Dezember den Kirchgang absolvierten. Obwohl Vater eher ein kirchenferner Agnostiker war als ein gläubiger Christ (doch auch kein Atheist), gehörte der Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend für ihn unbedingt zum Fest dazu. Zu Hause sangen wir häufig Weihnachtslieder. Manchmal las er aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vor. Wenn wir aus der Kirche zurückkamen, wurde nach norwegischer Sitte ein Schweinebraten serviert, den Mutter und Litti vorbereitet hatten. Gans gab es am ersten und Grünkohl mit Rauchfleisch, wie Vater es aus Lübeck kannte, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Bescherung fand nach dem Essen statt. Wir Kinder durften jetzt das Wohnzimmer betreten, wo der von den Eltern herrlich geschmückte Baum stand. Die Geschenke nahmen sich nach heutigen Maßstäben eher bescheiden aus, nach damaligen reichlich, doch nicht übertrieben. Ich bekam meist Bücher, manchmal Ritterfiguren. Noch nicht selbstverständlich waren diverse Süßigkeiten samt den von Mutter nach norwegischen Rezepten gebackenen Keksen. Auch andere Leckereien kamen zunächst nur zu Weihnachten auf den Tisch, wie echte ungarische Salami und französischer oder italienischer Käse. Irgendwann traten Lebensmittelgeschenke weit entfernter Absender hinzu, die den weihnachtlichen Gabentisch bereicherten: Apfelsinen aus Israel, Feigen aus dem Maghreb, Kaviar aus Persien und Russland. Wer hat, dem wird gegeben, dachte ich mir schon damals …
An der abnehmenden Feierlichkeit des familiären Weihnachtsfests ließ sich seit dem Umzug nach Bonn im Frühjahr 1967 der Verfall der Ehe meiner Eltern beobachten. (Ich selbst hatte nur noch ein Jahr bis zum Abitur und blieb in Berlin, wo ich so lange in der Familie meines Freundes Wolf-Rüdiger Knoche wohnte.) In meiner Erinnerung lösten sich nach und nach alle Festelemente ins Unverbindliche auf. Die Eltern hatten sich offenbar nicht mehr viel zu sagen. Die beiden älteren Söhne trugen auch nicht gerade dazu bei, Weihnachten zu retten. Man gewann den Eindruck, nur des jüngsten Bruders Matthias wegen riss sich die Familie noch halbwegs zusammen. Vater verschwand dann sehr schnell mit einem neuen Roman in sein Zimmer. Die Zurückgebliebenen plauderten über mehr oder weniger Belangloses. Zumindest ich war froh, mich manchmal schon am Abend des 25. Dezember mit dem Nachtzug wieder nach Berlin absetzen zu können.
Doch Weihnachten 1970 feierten alle Brandts »groß« in Berlin, was von Willy nach der Unterzeichnung des Moskauer und des Warschauer Vertrags auch als demonstrativer Akt gemeint war. Ein Empfang im Bundesgästehaus, zu dem vor allem alte Berliner SPD-Genossen geladen waren, verstärkte dieses Signal. Ansonsten machten sich Brandts in diesen Weihnachtstagen vor allem mit der Familie des Pfarrers Theodor Jänicke gemein. Seine Tochter Maria und ich lebten, wie man damals noch sagte, in wilder Ehe. Am Heiligen Abend besuchten wir alle zusammen Theos Gottesdienst. Er war ein Mann der ehedem Bekennenden Kirche und entschiedener Anhänger der neuen Bonner Ostpolitik. Wir alle hatten es noch einmal richtig schön. Seitdem zog ich es vor, Weihnachten nur noch zusammen mit meinen Lebensgefährtinnen zu verbringen.
In Bonn besiedelte die Familie Brandt ein großes Haus, das schon als Dienstvilla des vorherigen Außenministers gedient hatte. Als 1969 der Wechsel in den Kanzlerbungalow anstehen sollte, war Vater froh, dass der neue Außenminister Scheel in seinem gerade gebauten eigenen Haus wohnen bleiben wollte. Brandts mussten also nicht umziehen. Die Außenminister-, jetzt Kanzlervilla auf dem Venusberg barg im Erdgeschoss mehrere Repräsentationsräume, während die eigentliche Wohnung im ersten Stock lag. Im zweiten Stock befanden sich etliche, meist kleine Zimmer und Kammern. Dort wohnten Lars und die Hausmädchen. Wenn ich zu Besuch kam, fand auch ich dort problemlos einen Platz. Zwischen August 1972 und März 1974 wohnte ich immer wieder wochenlang auf dem Venusberg, um in Ruhe mein Abschlussexamen und die geplante Dissertation vorzubereiten, sodass ich in diesen etwa fünfzehn Monaten noch einmal dichter am Geschehen war als in den Jahren davor und danach.
Die Einrichtung des Hauses war von Mutter vorgenommen worden: geschmackvoll und freundlich. Vater interessierte sich nicht übermäßig dafür, obwohl das Grundlegende sicher abgesprochen war. Mutter prägte die Atmosphäre, unterstützt von wechselnden fröhlichen Au-pair-Mädchen, die sie teilweise aus der entfernteren norwegischen Verwandtschaft rekrutierten. Meine Freundin Maria weilte mit mir ab und zu einige Tage dort. Sie hatte den Eindruck eines allzu stillen, unlebendigen Ortes, bewohnt von Menschen, die nichts oder nicht mehr viel miteinander anfangen konnten, obwohl sie für sich genommen alle umgänglich und gefühlvoll gewesen seien. Ein »Getüm von beherrschten Gefühlen« sei Vater Brandt gewesen, wenn er plötzlich und unerwartet den Flur entlangkam, höflich und nicht unfreundlich, auch humorvoll, aber von ihr als bedrohlich wahrgenommen. Dass Mutter in der Familie für gute Stimmung sorgen wollte und – mehr noch – für Besucher die charmante Gastgeberin verkörperte, änderte das nur vordergründig.
Noch in Berlin, im Frühherbst 1966, gab es an einem Sonntagmorgen einen bedenklichen Zwischenfall. Mutter war nicht zu Hause und Martha Litzl führte das Regiment. Die Zimmer von Lars und mir lagen im Dachgeschoss. Plötzlich hörte ich einen Schrei oder vielmehr einen leicht röchelnden Ausruf: »Ein Arzt!« Danach die aufgeregte Frauenstimme der Haushälterin, die offenbar schon auf dem Weg zum Telefon war. Als ich die Treppe hinab kam, lag Vater mit geschlossenen Augen im Bett und atmete normal. Höchstens eine halbe Stunde später traf ein mehrköpfiges Team von Ärzten unter der Leitung von Professor Freiherr von Kreß ein. Man untersuchte den Patienten gründlich, aber ohne technische Gerätschaften. Man kam zu dem Ergebnis, dass kein Herzinfarkt oder eine andere bedrohliche Erkrankung vorläge. Den Anfall, bei dem der Oberbauch durch das Zwerchfell aufs Herz drückt, wobei regelrechte Vernichtungsgefühle erzeugt werden, kennen Mediziner als das Roemheld-Syndrom. Vermutlich wurde an einem der Folgetage eine genauere Untersuchung im Krankenhaus nachgeholt. Einen verschiedentlich kolportierten dramatischen Rettungseinsatz habe ich nicht erlebt. Wie mir mein Vater einige Zeit später erzählte, sah er, während er kollabierte, gleich einem Sterbenden sein ganzes Leben in Zeitraffer an sich vorüberziehen – sicherlich ein einschneidendes Erlebnis.
Zwölfeinhalb Jahre später erwischte es ihn tatsächlich. Er stand kurz vor seinem 65. Geburtstag, den die Partei 1978 mit einer Riesenveranstaltung in der Dortmunder Westfalen-Halle unter Einbeziehung weltbekannter Musiker feiern wollte. Offenbar während einer Reise nach New York erlitt Vater einen sogenannten »stillen«, aber beträchtlichen Herzinfarkt und nach der Rückkehr in Bonn einen kleineren zweiten. Dem Krankenhausaufenthalt folgte ein mehrwöchiger Reha-Aufenthalt im südfranzösischen Hyères. Im dortigen Sanatorium wurde er nach allen Regeln der ärztlichen Kunst wieder in Form gebracht, soweit das möglich war. Vater war von den Bemühungen der Ärzte, von den wohnlichen wie kulinarischen Umständen seiner Kur sehr angetan und hatte das Gefühl, gesünder nach Hause zu fahren, als er seit etlichen Jahren gewesen war. Bislang bewegte er sich wenig, rauchte Kette und sprach stark dem Alkohol zu, auch wenn sein Konsum nie völlig aus dem Ruder lief, dazu der unvermeidliche Stress und die vielen Fernreisen mit Klima- und Zeitzonenwechseln – das alles musste er unter dem strengen, doch wohltuenden Einfluss seiner neuen Lebenspartnerin Brigitte Seebacher nun ändern. In den folgenden Jahren konnte man beobachten, wie er auflebte. Die Fotos vom Wochenendeinkauf in Unkel waren keine Show, jedenfalls nicht in erster Linie. Er schien wieder Gefallen am normalen Leben zu finden und ließ sich beim Kochen bereitwillig für die Hilfsarbeiten einsetzen.
Zum 65. Geburtstag hatte ich ihm eine Zeichnung des Malers Michael Sowa geschenkt, der damals noch nicht so bekannt war. Sowa hatte sie nach meinen Wünschen zu einem Freundschaftspreis angefertigt. Zum 70. Geburtstag, am 18. Dezember 1983, konnten meine Frau Gabriele und ich ihm unsere knapp zwei Monate alte Tochter Karoline Luise präsentieren, ein Fressen für die Fotoreporter und unverkennbar eine Freude für den Großvater. Kontinuierlich bemühte ich mich darum, dass sich »Opa Willy« und Karoline immer wieder in Berlin sahen. Ich erlebte ihn dabei zugewandt, lieb und keineswegs unbeholfen. Das nahm wohl auch meine Tochter so wahr, die nur nicht verstehen konnte, warum er manchmal plötzlich so schnell wieder weg musste. Als Dauerbeschäftigung wäre das Opa-Sein aber sicher nichts für ihn gewesen.
Zu einer Scheidung gehört eine finanzielle Auseinandersetzung. Nun hätte meine Mutter bei der Einstellung des Vaters in jedem Fall auf eine ordentliche Versorgung rechnen dürfen. Aber naturgemäß gab es auch Dinge, die sich nicht von selbst regelten, sondern ausgehandelt werden mussten, selbst dann, wenn beide Seiten auf eine einvernehmliche Lösung ausgerichtet waren. Ich vermied damals jede Äußerung zu kontroversen Fragen in der Sache. Vater hätte sie weder erwartet noch goutiert, aber Mutter wohl doch erhofft. Psychische Verletzungen lassen sich ohnehin nicht mit Geld heilen. Am Ende zeigte sich Vater durchaus großzügig und erklärte sich einverstanden, den norwegischen Besitz der Mutter bei der Berechnung der Unterhaltszahlungen unberücksichtigt zu lassen.
Wenn zwei Menschen, die eigentlich Humor besitzen, nicht mehr über dieselben Geschehnisse lachen können und nicht mehr freundlich übereinander und über sich selbst lachen können, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht mehr. Von meinem Vater ist bekannt, dass er zumindest zwei ernsthafte außereheliche Beziehungen hatte. Das blieb mir bis 1974 ebenso verborgen wie die Gerüchte über ein ausschweifendes Sexualleben, die ich für maßlos übertrieben halte. Es lockte mich nicht, ihn zu bitten, für mich das Wahre vom Falschen zu trennen. Über so etwas offen zu reden, waren wir beide zu scheu und zu genant.
Nun ist es eine Binsenweisheit, dass zur Zerstörung einer Beziehung – jenseits der Frage von Schuld und Verantwortung im moralischen Sinn – immer zwei gehören. Während Willy sich immer öfter unverstanden fühlte, reagierte er mit zunehmender Sprachlosigkeit. Nur wenn seine Frau ihn wegen einer politischen Handlung kritisierte, was nicht oft vorkam, konnte er ungehalten werden. Rut hingegen wehrte sich durch Neckereien und Sticheleien, die in einer anderen Situation harmlos gewesen und vielleicht sogar lustig aufgenommen worden wären. In der Niedergangsphase ab 1966, die Zwischenhochs kannte, aber immer öfter einer resignativen Grundhaltung wich, wirkten sie jedoch destruktiv. Als die Trennung Anfang 1979 offiziell vollzogen wurde, war ich weder erstaunt noch unglücklich.
Im Gespräch bestätigte mein Vater mir, dass es eine andere Frau in seinem Leben gab: die Journalistin und Historikerin Brigitte Seebacher. Das wusste ich zwar schon, aber immerhin hat er es direkt angesprochen. Für mich war sofort klar, ich würde diese Wahl akzeptieren und mich vorbehaltslos um ein gutes Verhältnis zu Brigitte bemühen, weil ich den Vater-Sohn-Faden in Eintracht weiterspinnen wollte. Wir würden uns also wie bisher alle paar Monate, manchmal auch häufiger, in Berlin oder in Bonn sehen, meist zum Abendessen, und ich würde ihn gelegentlich auch in der gemeinsamen Wohnung des seit dem 9. Dezember 1983 verheirateten Paars besuchen. Ich konnte stets nur Mutter oder Vater einladen. Er drängte sich nie auf, und so habe ich ihm hier und dort auch manchmal den Vortritt gelassen.