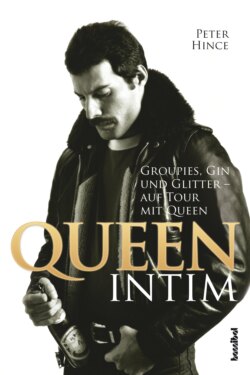Читать книгу Queen intim - Peter Hince - Страница 7
ОглавлениеDie Zugabe bei einer Rock-Show – man weiß, dass sie kommt. Ein kleiner zweiter Auftritt oder vielleicht auch ein dritter. Mitte der Siebziger trat Fred bei einer Zugabe an den Bühnenrand und warf rote Rosen ins Publikum. Die Dornen der Rosen waren natürlich zuvor entfernt worden, was eine mühselige Aufgabe war, doch Fred beschwerte sich immer darüber, nicht genügend Blumen zur Verfügung zu haben. Unvermeidbar wurden einige kleinere Dornen übersehen, die auf seinen zarten Händchen eine unbeabsichtigte Akupunktur hinterließen. Um Freds Nachschub zu garantieren, das Budget nicht zu überschreiten und weiteres Blutvergießen zu vermeiden, verlagerte man die Auswahl auf Nelken, die ich in Wassereimern unter dem Flügel versteckte.
Auf ein Zeichen hin rannte ich mit einem Arm voller Blumen zu Fred. Während er sie an den Stielen in ein regelrechtes Meer aus ausgestreckten, greifenden Armen warf, nahm ich das Mikro mit zur Bühnenseite und stellte den nächsten Strauß zusammen. Wenn er alle Nelken verteilt hatte, sprintete er zum Flügel, und ich beeilte mich, ihm auf halbem Weg das Mikro zu geben. Ein nettes Beispiel für eine Choreographie. Fühlte Fred sich übermütig, schnappte er sich die Plastikeimer mit den Blumen und schüttete den gesamten Inhalt aufs Publikum, über sich selbst – oder über mich.
Bei den frühen Queen-Tourneen führte die Band den leicht tuntigen Kabarett-Song „Big Spender“ von Shirley Bassey auf: „The minute you rolled up the joint …“ Fred schlich sich in einem mit Pailletten bestickten japanischen Kimono auf die Bühne, den er wie ein Stripper abstreifte und dabei rot-weiß gestreifte Shorts mit passenden Hosenträgern enthüllte. Er riss dramatisch am Gürtel des Kimonos, damit dieser an ihm herunterfiel. Was nicht immer geschah. In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Hammersmith Odeon versuchte ich ihn nervös von dem japanischen Kleidungsstück zu befreien und zog dabei die Shorts unbeabsichtigt halb herunter. Panisch schnitt ich Fred mit einem rasierklingenscharfen Stanley-Messer los. Nach dem Zwischenfall lag ständig eine handlichere und sichere Schere in der Nähe. Freds Stimme war schon hoch genug und sicher nicht auf einen spontanen chirurgischen Eingriff durch den Roadie angewiesen.
Freddie Mercury hielt während einer Queen-Tournee alle Mitarbeiter auf Trab – alle, und auch ich blieb davon nicht verschont. Er agierte spontan, wenn man es überhaupt nicht von ihm erwartete, und änderte seinen Bewegungsablauf, den Rapport und sogar die Texte. Spielten Queen „Jailhouse Rock“ als Zugabe, konnte man auf neue Wörter zur Bereicherung des englischen Wortschatzes gefasst sein. In einem Mix aus Singen und Sprechen murmelte er rhythmische Phrasen, während die Band einen ausgedehnten Boogie hinlegte. Ich kann mich noch an folgende Sprachfetzen erinnern: „Shaboonga“, „Shebbahhh“ und „Mmmmmmuma muma muma muma muma muma muma muma muma muma muma – Yaatch!“ Mmmm? Eine alte persische Sprache? Vielleicht ein lokaler Dialekt aus Sansibar?
Wenn wir Fred nach Bedeutung und Herkunft der Laute fragten, antwortete er verteidigend: „Das singe ich doch nicht – oder?“ Doch! Den Beweis lieferte der Tontechniker, der ihm einen Mitschnitt der Show vorspielte. Auch wies man Brian darauf hin, dass der Beginn des Gitarrensolos der TV-Westernserie Bonanza verdächtig ähnelte. Schließlich kamen noch Roger und John an die Reihe, denen man klarmachte, dass sie die Rhythmus-Sektion sind, also auch die Verantwortung für das Timing tragen – sollten!
Nach kurzer Zeit einigte man sich auf eine stets gültige Titelabfolge der Queen-Zugaben: Zuerst spielte die Band Brians „We Will Rock You“, gefolgt von Freds „We Are The Champions“. Als Fred im Sommer 1977 während der Proben zu den Aufnahmen von News Of The World in die Shepperton Film Studios stolzierte und bekanntgab, einen Song für Fußball-Fans zu haben, reagierte die Band skeptisch und mit einem gesunden Misstrauen – was machte er denn nun schon wieder? Von der Rockmusik zur Oper bis hin zu Stadionrängen und Hooligans? Es funktionierte. Fred mag ein zurückgezogen lebender Mensch gewesen sein, oftmals ruhig und reserviert, aber nicht, wenn er auf die Errungenschaften von Queen hinwies: „We are the champions – of the world!“
Ich bin mir sicher, dass er das Potential seiner Sporthymne schon erkannt hatte und zugleich wusste, dass sich die Nummer erfolgreich in ein Konzert einfügen würde. Allerdings bezweifle ich sehr, dass Fred jemals Fußball gespielt oder auf den Rängen eines Stadions gestanden hatte (Sansibar Rovers?). Er erkannte jedoch das bei einem Fußballspiel entstehende Gemeinschaftsgefühl, die Leidenschaft und die Begeisterung. Trotz seiner eher elitären Erziehung konnte Fred gut mit ganz normalen Menschen kommunizieren und die Fans verstehen. Er sah sich im Fernsehen Fußballübertragungen an und liebte alle größeren Sportveranstaltungen. Sein Lieblingsteam – nach England – war Brasilien. Er bewunderte das geschmeidige Auftreten der Brasilianer, das Lächeln, das die Lippen der Sportler umspielte, und die hingebungsvolle „Karneval-Armee“ enthusiastischer Fans. Wenn aus der Menge ein Ball geflogen kam, kickte er manchmal auf der Bühne und schoss ihn kraftvoll und mit ein wenig Stil zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen starken und nach vorne drängenden Mittelfeldspieler abgegeben hätte, der jede Lücke im Tor der Gegenspieler ausnutzt. Doch Fred betrieb nur einen Outdoor-Sport – Tennis, das auch Roger gerne spielte, wann immer sich dazu die Gelegenheit bot.
Der Aspekt Sport tauchte manchmal bei Queen-Shows auf. Zur allerersten Aufführung von „We Are The Champions“ im Dezember 1977 im Madison Square Garden in New York erschien Fred mit einer blau-weißen Jacke der New York Yankees und einer Baseball-Kappe. Die Yankees hatten gerade die World Series gewonnen. Trotz der Tatsache, dass der Garden im fünften Stockwerk lag, brachte die Menge von 20.000 Zuschauern den Veranstaltungsort mit ihrem Beifall zum Beben. Beim Bühnen-Baseball erwies Fred sich als äußerst geschickt, denn als diverse Gegenstände auf die Bühne flogen, betätigte er sich als Batter und setzte den umgedrehten Mikrostab zur Abwehr ein. Die Japaner entwickelten eine wahre Leidenschaft für den Sport. Zu ihrer großen Begeisterung heimste Fred einige Home-Runs mit den bunten Plastikbällen ein, die sie gerne auf die Bühne warfen. Zum Dank warf er einige Flaschen Heineken zielsicher ins Publikum.
Auf der Magic-Tour entfaltete sich während des zweiten Auftritts in München ein wahrhaft magisches Szenario. Abgesehen von der Tatsache, dass man die Stadt als zweite Heimat von Queen bezeichnen konnte und hier viele Freunde wohnten, war es der Tag des Fußball-WM-Endspiels 1986 zwischen der BRD und Argentinien. Die deutsche Crew und das Backstage-Personal in der Olympiahalle klebten förmlich an einem kleinen Fernseher. Das Spiel wurde verlängert und Queen mussten auf die Bühne, ohne das Endergebnis zu kennen. Fred hatte aber einen Masterplan. Im Falle eines Siegs der deutschen Mannschaft wäre er bei „Champions“ in einem dementsprechenden Trikot auf die Bühne gegangen und hätte ein oder zwei Bälle in das zweifellos begeisterte Publikum gekickt. Leider gewann Argentinien, wodurch Fred bei seinem letzten Auftritt in der Stadt, die er so liebte, ein angemessener Höhepunkt verwehrt blieb.
Fußball ist des kleinen Mannes Sport. Trotz der Universitätsabschlüsse und der gelegentlich arroganten Haltung, waren Queen eine Band des Volkes. Sie gaben den Menschen mit ihren Shows stets einen angemessenen Gegenwert für ihre Geduld und ließen ihren Reden auch Taten folgen, womit sie sich kontinuierlich den Kritikern widersetzten. Queen und ihre Musik zu mögen war verpönt, vermutlich, weil sie Erfolg hatten. Ja, so etwas gibt es bei uns in Großbritannien einfach nicht – Leute, die Talent haben und erfolgreich sind. Um eine erfolgreiche Karriere im Musikbusiness aufrecht zu halten, muss man vor allem über Talent und Können verfügen: Auch Zielstrebigkeit, Glaube und Durchhaltevermögen sind notwendig, um ein hohes Niveau zu wahren. Queen hatten das alles. Fred sogar im Überfluss.
Leider bezog sich der Überfluss auch auf negative Aspekte, denn von einigen Zeitungen und besonders von der Regenbogenpresse wurde Fred geradezu mit Mist überschüttet. Sie interessierten sich nur für seine Schwächen, den Lebensstil und die Sexualität. Trotz seiner starken Willenskraft und seines unbeugsamen Charakters verletzte ihn das manchmal. Wenn sich Fans über einen Fußballspieler hermachen, weil er nicht in Form ist oder keine Tore schießt, antwortet er ihnen auf die best mögliche Art – indem er das spielentscheidende Tor schießt, oder, noch besser, einen Hattrick abliefert. Fred antwortete auf die Medienschelte, indem er eine weitere Hit-Single komponierte, Queen ein neues Platin-Album ergatterten und begeisterte Besprechungen für ihre rekordverdächtigen Konzerte erhielten, die sie als die wahren Champions herausstellten.
Das Ende von „Champions“ war das Ende der Zugabe. Die halbkreisförmige Lichttraverse wurde mit voller Beleuchtung wieder herabgefahren, neigte sich zunächst und näherte sich dann wie von einer magischen Hand gesteuert dem Publikum, während Nebel und Trockeneis die Bühne verhüllten und die Band förmlich verschluckten. Nachdem sie sich verbeugt hatten, verschwanden die erhitzten und schwitzenden Musiker von der rechten Bühnenseite, zum Klang des applaudierenden Publikums und dem vom Band gespielten „God Save The Queen“.
Die Assistenten warfen den Musikern kuschelige Bademäntel über, während man sie schleunigst zur Garderobe geleitete, wo sie feiern, sich streiten oder sich einfach stillschweigend hinsetzen konnten. Nach einer kurzen Zeit ging es weiter, wobei man die eben genannten drei Optionen wechselte.
Wie hatten sie heute gespielt? Wie kamen sie an? An den Abenden, an denen sie sehr gut spielten, erkannte man das gewisse Etwas, das Magische an der Band. Falls dem nicht so war, wussten sie es, wussten wir es, aber das Publikum beschwerte sich niemals. Für sie wurde es immer zu einem Erlebnis. Es gab einige Städte und Veranstaltungsorte, die Queen zu Höchstleistungen anspornten: Mir fallen da spontan das L.A. Forum ein, der Madison Square Garden, das Montreal Forum, die Festhalle in Frankfurt/Main, Budokan in Tokio, nicht zu vergessen Auftritte in den Niederlanden und in London – dort gelang es Queen, etwas Besonderes in ihrem Programm herauszuarbeiten. Während der Magic-Tour 1986 brillierten Queen bei zahlreichen Open-Air-Konzerten in Stadien. Bei den Südamerika-Terminen 1981 spielten sie überragend, wobei die dritte Show in Buenos Aires meiner Meinung nach das beste Open Air war, das Queen jemals ablieferten.
Bis auf das engste Personal wurde niemand nach einem Gig in die Garderobe gelassen. Das geschah erst bei einer ausgeglichenen Stimmung. Manchmal mussten alle Mitarbeiter raus, da die Musiker den Abend ausgiebig diskutierten. Wenn etwas bei der Show schief gelaufen war, rief man die Verantwortlichen zur Besprechung der schlechten Leistung zu sich. Gerry Stickells, der Tourmanager, musste am häufigsten das Gewitter über sich ergehen lassen – wegen verpasster Einsätze, Problemen mit dem Equipment, einem schlechten Sound oder dem Muster des Garderobenteppichs.
Nach Verlassen der Bühne war die Show für die Band vorbei, doch nicht für die Roadies, denn uns stand eine zweite Show bevor. In dem Moment, in dem die Band von der Bühne ging, begann das geschäftige Treiben – sogar noch vor Ende des Einspieltapes und dem Aufflackern der Hauslichter. Die Bühne musste schnellstmöglich komplett geräumt werden, denn erst dann konnte man die PA abbauen. Auch mussten die über der Bühne befestigten Scheinwerfer heruntergelassen werden, bevor man sie und die Träger auseinandermontierte. Vor dem Abbau schaute man noch schnell über die Bühne, um zu erkennen, was dort für Goodies oder interessante Gegenstände lagen. Das variierte natürlich von Land zu Land: Neben an die Band adressierten Karten und Briefen (ab in die Mülltonne) fanden wir Münzen, Joints, Ringe (die wir behielten), Spielzeug (das später in die Luft gejagt wurde), Cassetten (meist zum Überspielen behalten), selbst gemalte Bilder der Band und Gedichte (Mülltonne), Zigaretten, T-Shirts (manchmal behalten) und Damenunterwäsche (behalten und sorgfältig aufbewahrt).
Bei der US-Tour 1980 wurden von einigen Fans Einwegrasierer auf die Bühne geschleudert, aus Protest, dass Fred nun einen Bart trug. Wie vorherzusehen, kommentierte er das mit einem „Fuck Off!“ Dann, als er sich zwischen den Songs mit dem Publikum unterhielt, legte ein Fred-Klon mit einem Oberlippenbart und einem Karomuster-Hemd einen kleinen runden Metallgegenstand auf den Catwalk zu seinen Füßen. Fred hob ihn auf. „Was haben wir denn hier?“, fragte er mit schriller Stimme und hielt dabei den Gegenstand in die Luft. „Einen Cock-Ring! Danke dir vielmals, mein Liebling.“
Fred lief zur rechten Bühnenseite und händigte ihn mir aus. Für mich sah das Ding wie ein Designer-Serviettenhalter aus. Ich legte den Ring in meine BLU 8, eine Werkzeugkiste, in der sich so einige Überraschungen befanden, als Paul Prenter, der sexuell unersättliche, schwule Assistent zu mir rüber lief und mir ins Ohr schrie: „Gib ihn mir – ich will ihn!“ Kein Problem – bei mir wäre er eh nur in der Werkzeugkiste gelandet, zusammen mit Schrauben, Hämmern und Nüssen. Ganz offensichtlich hatte Paul andere Pläne für den Ring, die aber ohne jeden Zweifel was mit Hämmern, Schrauben und zwei Nüssen zu tun hatten.
Nachdem alle nennenswerten Geschenke verstaut waren, begann das „Abreißen“ – schnell, aber gut organisiert. Alles, was wir mit Gaffa-Tape gesichert hatten, wurde von dem klebrigen Band befreit, gut eingepackt und dem am nächsten Stehenden zum Verstauen überreicht. Die lokalen Helfer entsorgten unverzüglich alle auf der Bühne stehenden Getränke: Drinks in Plastikbechern, offene Dosen und Ähnliches wanderten in große Plastikmülltonnen, die man am hinteren Bühnenrand aufstellte. Da John immer eine große Auswahl an Drinks zur Verfügung hatte, wurden einige davon als „Bonus-Bezahlung“ betrachtet und konsumiert. Der Tontechniker Tony „Lips“ Rossi kam als erster an die Reihe. Der auf Sparsamkeit bedachte Mann – man nannte ihn auch „Love Criminal“ – sammelte während drei aufeinander folgender Shows die Reste aus drei Rotweinflaschen und kippte sie in einer zusammen. Gefragt, warum er den nun nicht mehr sonderlich frisch anmutenden, sondern eher dubiosen Wein (Winter/Jahrgang 1980) nun wieder mit einem Korken verschloss, erläuterte er uns seinen Plan. Er wollte die Managerin der Vorband Straight Eight verführen, einen eindrucksvollen, feurigen Rotschopf aus besserem Hause. Keine leichte Aufgabe für einen Italo-Amerikaner aus Pennsylvania, der auf der Straße aufgewachsen war. Bewaffnet mit der Weinflasche und ein bisschen Koks, das er sich zurückgelegt hatte, schlich sich Rossi zur großen Verführung ins Park Hotel Bremen. Es klappte. Die beiden heirateten sogar. Doch die Ehe hielt nicht lange.
Nachdem die Bühne abgeräumt und meine Ausrüstung gesichert war, flitzte ich raus zum Truck, der mit ausgeklappter Rampe schon in Position stand, um mit dem Einladen zu beginnen. Mit dem Fahrer ging ich in den Laderaum und gemeinsam mit einem Team Abbauhelfer platzierten wir die Cases wie bei einem Puzzlespiel, um eine möglicht große Ladedichte zu erreichen. In einigen Teilen der USA erlaubten die einflussreichen Gewerkschaften der Crew nur Anweisungen und Hinweise beim Beladen, damit ihre Leute arbeiten konnten. Ich hatte natürlich nichts dagegen, doch es verzögerte die ganze Sache erheblich.
Beim Ausladen in der nächsten Stadt stellten die Schmarotzer eins der größten Hindernisse dar – Typen mit fragwürdigen Verbindungen zur Band, die ständig bei Rockkonzerten auftauchen und einem immer im Weg stehen. Der Haufen von „ehemals wichtigen Personen, die niemals wichtig waren“, bestand aus allen nur erdenklichen Posern, die nur daran interessiert waren, backstage gesehen zu werden (am liebsten mit der Band oder prominenten Besuchern), und sich beim kostenlosen Essen und den Getränken zu bedienen. Sie waren scharf auf Einladungen zu den After-Show-Partys, exklusiven Pässen, Geschenken und allem, wirklich allem, was sie wichtig aussehen oder erscheinen ließ.
Schmarotzer denken oft, dass die komplette Show einzig und allein für ihr Vergnügen veranstaltet wird. Verdreckte Roadies? Igitt! Diese Möchtegerne-VIPs oder Freunde von Freunden ließen sich allerdings nie in Würzburg, Newcastle oder Omaha, Nebraska sehen, sondern nur in den großen Städten.
Wenigstens durften sie sich bei einer Show niemals an den Bühnenseiten aufhalten. Der Raum war allein der Crew vorbehalten und gelegentlich sehr, sehr guten Bekannten und den Frauen oder Freundinnen der Musiker, die von den Seiten aus dem Auftritt zusahen.
„Ratty, heute Abend kommt ein Special Guest. Wir haben ihm versprochen, dass er sich das Konzert von deiner Seite aus anschauen darf.“
„Kommt überhaupt nicht in Frage. Die stehen einem ständig im Weg rum. Die kapieren das nicht. Ich muss beim Gig so viel machen. Ihr wisst doch, wie Fred ist. Auf gar keinen Fall.“
„Sorry, Ratty, aber wir haben es ihm schon versprochen.“
„Und ich habe euch gerade eben meine Meinung gesagt. Kommt nicht in die Tüte! Die Bühnenseite muss frei sein, damit ich anständig arbeiten kann.“
„Ratty …“
„Nein, auf gar keinen Fall – kapierst du es nicht?“
„Es ist Mick Jagger.“
„Oh, alles in Ordnung. Was möchte er trinken?“
Für einen Briten ist sein Haus seine Burg, und für einen britischen Roadie ist seine Burg die Bühne – eine Festung, ein sicherer Hafen, während der Show beschützt von der Security, einem Haufen muskelbepackter Schränke aus den USA oder aus Londons East End. Big Paul, Big Doug, Tunbridge, Big Wally, Wally Gore, Big Terry, Big Black Vic – alle in den USA geborenen Männer waren tatsächlich sehr groß und kräftig. Ab einem bestimmten Zeitpunkt 1981 arbeiteten drei Aufpasser für uns, die alle Wally hießen. Der Aufpasser Mad Jack, ein beängstigender Kampfkunstexperte, entdeckte einmal eine abgerissen wirkende Figur, die hinter Freds Flügel lauerte, und stampfte auf ihn zu, um ihn wegzureißen. Bei dem zwielichtigen Charakter handelte es sich allerdings um mich, und so durfte Jack seine Dienste schon vor Tourende quittieren.
Ein anderer Security-Mann, der nicht sehr lange für uns arbeitete, war ein muskelbepackter Kerl, dessen enthüllende Fotos wir in einem Schwulenmagazin entdeckten – und die daraufhin in der gesamten Crew die Runde machten.
Auch ein Physiotherapeut aus München gehörte auf Freds Wunsch zu unserer Truppe. Er behandelte ihn während der Genesung von einer Bänderverletzung im Knie, die er sich 1984 auf einer Kneipen- und Club-Sause zugezogen hatte. Verständlicherweise plagten Fred Zweifel, ob das Gelenk all die Torturen auf der Bühne überstehen würde. Mercury war ein sehr vielfältiger Charakter, vor allem aber ein Musiker, der sang und auf der Bühne leistungsstark wie ein Athlet eine beeindruckende Show ablieferte. Trainierte er? Arbeitete er hart an sich, um vor einer kräftezehrenden Tour in Form zu kommen? Absolvierte er mit viel Disziplin ausgewählte Übungen oder quälte er sich mit einer Diät? Nein. Er machte gelegentlich ein paar Dehnungsübungen und zeichnete sich vor allem durch einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst aus. Nicht zu vergessen, ein paar Wodka.
Der Physiotherapeut Dieter Breit war unter dem Namen The Fizz [„Dr. Schampus“] bekannt und in bestimmten Kreisen hielt man ihn für einen Luxus-Praktiker, doch der Mann rettete Fred und zahlreiche Shows, als das mercurianische Knie bei einem Auftritt in Hannover Ende 1984 schlapp machte. Er kümmerte sich wenige Wochen darauf auch erfolgreich um Rogers böse Knöchelverstauchung nach einem Fall in Sun City. Tourneen sind für einen Körper eine Schwerstbelastung und Dr. Schampus bearbeitete auch meinen Rücken, wenn er mal nicht wollte. Meistens war das der Fall, wenn einer meiner großen, amerikanischen Tourbrüder mich sturzbesoffen durch die Lobby eines Hotels geschleudert hatte.
Das Beladen dauerte immer unterschiedlich lange, je nachdem, was ich dem Rücken zumuten konnte, wie viele Schmarotzer uns im Weg standen und wie gut die örtlichen Roadies waren. Wenn wir in der Stadt, in der das Konzert stattgefunden hatte, übernachteten und eine Party in Aussicht stand, beschleunigte das gehörig unser Tempo. Der Packvorgang nahm manchmal mehrere Stunden in Anspruch, doch in Tempe, Arizona, stand der Truck direkt an der Bühne, sodass wir nur 45 Minuten benötigten, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Endes der Show. Ein 45 Fuß langer Trailer! Ein Fuß [30,48 cm] pro Minute – persönlicher Rekord!
Das Packen von Trucks ist eine schmutzige und unangenehme Tätigkeit, wobei Beulen am Schienbein, Schrammen, Splitter, Abschürfungen und eingequetschte Finger zum normalen Alltag gehören. Beim Beladen des Trucks achtete ich deshalb immer darauf, den örtlichen Hilfskräften Kippen und Drinks zu spendieren, um sie moralisch aufzubauen. Das Ganze war nie ein Spaß, sondern ein Job, den man mit möglichst guter Laune (Drinks!) erledigen musste, um die Plackerei schnell hinter sich zu bringen. Bei Kälte, Feuchtigkeit oder Minustemperaturen war der Job eine miese Quälerei. Zum Beispiel 1979 in Jugoslawien, mitten im Winter: Fred schenkte mir für das Beladen in der eisigen Kälte ein knallbuntes Paar Handschuhe und eine Mütze. Ich war zutiefst gerührt. Doch sie waren nicht vor Ort gewebt worden und stammten nicht von einer osteuropäischen Firma; er hatte sie in der lokalen Filiale von C&A in Zagreb gekauft.
Die Ursprünge meines Spitznamens lassen sich bis in die Teenager-Zeit zurückverfolgen, als ich einen Truck belud. Man rief mich immer, wenn die Drecksarbeit anstand und ich in den Spalt zwischen der aufgestapelten Ausrüstung und dem Dach kriechen musste, um einen weiteren kleinen Gegenstand dort hineinzuquetschen. Der Fahrer auf dieser Mott-The-Hoople-Tour 1974 sagte, ich sähe mit meinem langen, glatten und fettigen Haar und dem dünnen Körper wie eine vorbeihuschende Ratte aus. Aus „The Rat“, wie man mich nannte, wurde „Ratty“, dank Brian May, der mich so bei meiner ersten Queen-Probe ein Jahr später nannte – der Name blieb an mir hängen. Als Fred bei den Proben erfuhr, dass einer seiner Mitarbeiter für Mott The Hoople gearbeitet hatte und Rat geschimpft wurde, erwiderte er mit einer eleganten Handumdrehung (er trug einen silbernen Armreif in Schlangenform) und einem Fingerschnipsen: „Oh, nein! Ich werde ihn Peter nennen.“ Das hielt jedoch nicht lange an.
Fred, wie er nun mal war, schmückte den Spitznamen aus und mit einem französischen Dreh wurde ich „Ratoise“. Gelegentlich, wenn er mit dem einfachen Mann (also mir) kommunizieren und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, schrie er in einem gewitzelten Cockney-Akzent: „Ere-Rats!“
Hatten wir die Türen des Trucks geschlossen und verriegelt, war es an der Zeit, sich vom Adrenalinschub zu erholen, der durch die Intensität des beinahe schon militaristisch anmutenden Packens der Ausrüstung am Ende einer energiereichen Show verursacht wurde. Nun hatten wir frei – bis zum nächsten Konzert. Als nächstes unterhielten wir uns darüber, wohin es gehen soll und welches Transportmittel wir nehmen. Mussten wir weiterfahren, wollte ich augenblicklich los und rührte nicht den kleinsten Tropfen Alkohol an. Übernachteten wir jedoch in der Stadt, ging es erst ins Hotel, um den gröbsten Dreck abzuwaschen und ein bisschen Aftershave aufzutragen, oder in unseren Arbeitsklamotten direkt in den Club, die Bar oder zur Party. Einige Frauen mögen den Schweißgeruch arbeitender Männer – sagte man mir zumindest.
Pheromone oder so was.
Queen spielten häufig mehrere Konzerte an einem Veranstaltungsort, was uns die Chance bot, nach der Arbeit noch einen draufzumachen. Wenn erst mal die Ausrüstung gesichert und alles abgeschlossen war, gingen wir zur Garderobe der Band, die dort meist vom Stress runterkam und entspannte. Abgesehen vom kostenlosen und erstklassigen Alk sowie einem kleinen Snack, hatten wir dort die Möglichkeit, uns direkt über die diversen Aspekte des Auftritts zu unterhalten.
Abhängig von der Auftrittszeit wurde die Gruppe nach der Show von geladenen Gästen besucht. Doch meist waren es nur wenige Personen. Mum und Dad besuchten die Großbritannien-Konzerte, meist in den Midlands oder den Regionen im Westen. In der NEC-Arena in Birmingham führte ich meine Eltern in die Garderobe, wo Fred sich noch in voller Bühnenkluft entspannte. Augenblicklich umsorgte er meine Mutter, setzte sie auf seinen Schoß, fragte sie nach allem nur Erdenklichen und was sie so gemacht habe. Trotz der Tatsache, dass Fred nur eine kleine Familie hatte, agierte er recht familienorientiert und sorgte sich mit aufrichtigem Interesse um Angehörige seiner Kollegen.
Dad saß zusammen mit John Deacon draußen auf einer Treppe. Die beiden unterhielten sich wie waschechte Kumpel mit einem Dosenbier in der Hand. Auch Brian und Roger begrüßten meine Eltern warmherzig, erkannten sie bei jeder Ankunft wieder und erinnerten sich an vorherige Besuche.
Mum brachte mich oft in Verlegenheit, denn sie brachte mir zu den Shows Essen mit.
„Mum – sie füttern uns schon durch, keine Sorge.“
„Aber du siehst so blass aus – und bist so dünn.“
„Tja, es ist eine harte Arbeit und ich bin nicht dünn, sondern schlank, einfach fit.“
Die eingemachten Zwiebeln waren populäre Hausmannskost, die besonders gut Trip Khalaf schmeckte, dem amerikanischen Tontechniker von Queen.
Er begrüßte sie immer sehr freundlich: „Hello, Mrs Hince.“ Dann zeigte er mit dem Finger auf mich und sagte kopfschüttelnd: „Wie fühlt man sich als am meisten peinlich berührte Frau in ganz Großbritannien?“
Sie nahm es mit Humor.
Wenn wir nach dem Konzert mit einem Bus über Nacht weiterfuhren, konnten wir uns darin erst einmal abregen und runterkommen, bis die Tontechniker, mit denen wir reisten, ihren Job erledigt hatten.
Sobald Queen die Garderobe verlassen hatte, checkten wir, was wir noch an Essen plündern konnten. Bei den Tourneen Mitte der Siebziger war dort nicht viel zu finden, denn es gab noch keinen Catering-Service, der mit uns reiste. Ein geiziger Veranstalter beauftragte meist einen Assistenten, das übriggebliebene Essen so schnell wie möglich beiseite zu schaffen, um es am nächsten Tag wieder aufzutischen – zum vollen Preis. Jener Assistent hatte sich zuvor kritisch über unsere Crew ausgelassen, und so entschieden wir, ihm eine Lektion zu erteilen. Der Kerl bewahrte zur Sicherheit ein neues, schickes, weißes Sporthemd in der Garderobe auf. Wir „entführten“ das teure Kleidungsstück, legten es vor der Newcastle City Hall auf den Gehweg und zündeten es mit Feuerzeugbenzin an.
Als er fragte, ob jemand die geschätzte Neuerwerbung gesehen habe, wurden ihm mehrere Polaroids ausgehändigt, die zuerst das Hemd in Flammen und dann den kleinen Aschehaufen zeigten. Danach achtete er bei jeder Begegnung darauf, für uns Käse und Plätzchen aufzubewahren.
In Europa wurde uns die Zwischenmahlzeit, im Grunde genommen also das reguläre Abendessen, vom Tour-Koch „Toad In The Hole Of Barry Wales“ im Catering-Bereich serviert. Barry Wales? Keine Comicfigur, sondern das kleine Seestädtchen im Süden von Wales. Mittlerweile weiß ich, dass St. David der Schutzpatron von Wales ist, aber werden denn wirklich alle männlichen Nachkommen nach ihm benannt? Der Name des Catering-Besitzers lautete Dave Keeble und die bei ihm angestellten Köche hießen Dave Thomas und Dave Lewis. Man rief die drei allgemein und mit aller Liebenswürdigkeit „Dave, Dave and Dave“. Als die Queen-Tourneen größer wurden, stellten sie einen zusätzlichen Koch ein, den sie Steve nannten, woraufhin es hieß: „Dave, Dave, Dave and not Dave.“
Dieses walisische Quartett – auch bekannt als „die walisische Magen-Mafia“, die „Innereien-Saboteure“ und „die kulinarischen Kriminellen“ – bereiteten für gewöhnlich herzhafte Kost, um eine hart arbeitende Mannschaft nicht vom Fleisch fallen zu lassen: Steaks, Auflauf aus Hackfleisch und Kartoffelbrei, Spaghetti Bolognese, Chili con Carne und ähnliche Mahlzeiten. Dennoch backten sie für die stets größer werdende Zahl von Vegetariern leckere Omelettes. Das Team brutzelte auch die Mahlzeiten für Queen, wobei Dave x 3 + 1 das Menü durch lokale Produkte und Spezialitäten der verschiedenen Regionen Europas bereicherten, durch die wir gerade tourten. Die US-Abteilung der Crew ging ihnen ständig auf die Nerven, den Truthahn für das traditionelle Thanksgiving zu beschaffen, obwohl der Bühnenmanager sie nach Kräften zu überzeugen versuchte, dass in Boston edelster, frischer Hummer zum Feiertag gehört – aber vergebens. Sie einigten sich auf „Thousands on a Raft“, in Haute-Cuisine-Kreisen auch bekannt als „Bohnen auf Toast“. Die lokalen Produkte wurden mit all den ach so gesunden und aus Großbritannien importierten Zutaten ergänzt: Marmite, HP-Soße, Worcester-Soße, Marmelade und Senf.
Gesättigt von den Resten aus der Garderobe unserer Meister, schlenderten wir durch den jeweiligen Veranstaltungsort, während man die letzten Showelemente abbaute und das Gebäude für das nächste Konzert vorbereitete. Zu solch einem Zeitpunkt eine leere Arena zu betreten, wird zu einer beeindruckenden Erfahrung. Ein riesiger Raum, in dem vor ein oder zwei Stunden noch Tausende Menschen wie gebannt ein Spektakel beobachtet hatten, war nun eine Ansammlung von zusammengestellten Metallstühlen, großen summenden Industriereinigungsmaschinen, quietschend manövrierenden Gabelstaplern, Lichtgerüsten, an denen Ketten entlang krächzten, und einer Vielzahl von Stimmen, die durch den ganzen Lärm angestrengt schrien, Anweisungen gaben und Beleidigungen austeilten. Rauch und der Staub der Pyrotechnik hing immer noch in der Luft und vermischte sich mit dem stechenden Gestank der Reinigungsflüssigkeit, Abgasen der Gabelstapler und dem Geruch von fallengelassenem Popcorn – das alles hinterließ ein süßliches, ekliges Kratzen im Hals. Morgen würde ein neuer Tag sein, an dem sich in dem kalten Beton-Kokon die Hoffnungen und Träume einer anderen gesellschaftlichen Schicht treffen und sie ihren Leidenschaften nachgehen würden. Heute Nacht hatten die siegreichen Gladiatoren aber das Colosseum verlassen und der magische Flaschengeist war wieder sicher eingesperrt – nur darauf wartend, wieder zu entweichen.
Den uniformierten hispanischen und asiatischen Einwanderern, die in US-Stadien als Reinigungskräfte schufteten, den Boden und die Toiletten putzten und dabei einen gelben, fluoreszierenden Eimer auf Rollen hinter sich herzogen, war es egal, wer Freddie Mercury oder ein anderer Rock-Act war. Sie versuchten hier nur das saubere Image der USA zu bewahren. Eigentlich wollten sie bei ihrer Familie sein und das Leben führen, das ihnen der amerikanische Traum versprach und ihr Traum ihnen vorgaukelte. Ein gutes Leben.
Moment mal – was machte ich eigentlich aus meinem Leben? Klar, es war ein gutes Leben: Um die Welt reisen und als Sahnehäubchen Sex, Drugs & Rock’n’Roll. Doch ich hätte meine Zeit auch mit etwas Sinnvollerem verbringen können. Zum Beispiel für eine Wohltätigkeitsorganisation in der Dritten Welt arbeiten, mich an der medizinischen Forschung beteiligen oder Kundgebungen zur globalen Erwärmung oder der Umweltverschmutzung abhalten. Über all diese Themen habe ich seit damals nachgedacht. Doch zu der Zeit verschwendete ich keine Gedanken daran, denn ich hatte schlichtweg zu viel Spaß. Wie war ich eigentlich zu dem Job gekommen? Und wo hatte das alles begonnen? In einem Supermarkt in Fulham, im Südwesten von London. Allerdings hatte ich keine Regale befüllt, sondern Verstärker und Boxen gestapelt.
Früher hatte ein altes Kino an dem Platz gestanden, den nun der Supermarkt einnimmt. Nachdem es in den frühen Siebzigern geschlossen worden war, hatte die „Super Group“ Emerson, Lake & Palmer darin ihr gigantisches Equipment gelagert und es Manticore genannt. Abgesehen von der Aufbewahrung der Ausrüstung und den genutzten Büroräumen, wurde es an damals populäre Bands vermietet, die es für Aufnahmen und zum Proben nutzten. Man hatte die Kinositze herausgerissen, und ein verdreckter und schäbiger Teppich erstreckte sich bis zur Theaterbühne, die groß genug war, um den wichtigsten Rock-Shows Platz zu bieten. Obwohl Fallschirmseide zur Verschönerung und Isolierung vom Balkon aus über dem alten Parkett herunterhing, war Manticore im November 1973 – als ich Queen erstmalig begegnete – ein kalter und verdammt ungemütlicher Ort. Ich arbeitete zu der Zeit für Mott The Hoople, eine großartige Rockband, die gerade von einer erfolgreichen US-Tour zurückgekehrt war. Mich beeindruckte das ganze Brimborium mit amerikanischen Markenzeichen, das Richie und Phil, Motts erste Vollzeit-Roadies, aus den Staaten mitgebracht hatten. Das wollte ich schon immer mal machen – in die USA reisen! Mit einer Rockband auf Tour gehen, wäre die Erfüllung eines Traums gewesen – mit kleinen Glöckchen als Bonus. Freiheitsglöckchen!
Industrie-Heizlüfter, angetrieben mit Gas aus großen Flaschen, wärmten den Proberaum nur unzureichend auf, und so trugen die Crew und die Musiker dicke Jacken, Mäntel und sogar Schals. Mott The Hoople zählten damals zu den populärsten Acts und standen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie waren bereit, zu einer ausgedehnten Großbritannien-Tour aufzubrechen. Nach einigen Tagen Arbeit im Manticore tauchten Queen, die die Vorgruppe sein sollten, bei den Proben auf. Es erschien ein wenig seltsam, dass Queen, die bei der EMI unter Vertrag standen, als Support einer CBS-Band auftraten, denn meistens achtete man darauf, dass die Bands vom selben Management oder einer gemeinsamen Plattenfirma kamen. Die vier Typen waren scharf darauf zu spielen und setzten sich unter Druck. In jenem November bibberten wir im Manticore alle vor Kälte, doch Queen probten in voller Bühnenkluft, was bedeutete: Hauchdünne Seide, mit Spitze besetzte Hemden und leichter, bei jeder Bewegung schwebender Satin. Sogar John Harris, ihr ursprünglicher Tontechniker, trug zum Mischen einen schwarzen Samtanzug und hauchzarte Handschuhe. Und wer war wohl der stolzierende Poser mit Make-up, der mit einem abgesägten Mikroständer über die Bühne tänzelte und einen einzelnen Kettenhandschuh trug?
Der Band stand nur eine kurze Probezeit zur Verfügung, und um ehrlich zu sein, beachtete ich sie kaum, denn ich war zu sehr damit beschäftigt, Tee zu machen, diverse Gegenstände schwarz überzupinseln, Botengänge zu erledigen und all die Dinge zu machen, die man von einem 18-jährigen Frischling erwartet. Brian May war der erste, der sich mit Motts Crew anfreundete und ich durfte seine komische selbstgebaute Gitarre testen. Mich erstaunte, dass er keine „richtige“ Gitarre besaß: Eine Gibson, eine Fender oder vielleicht sogar eine Guild, wie die Jungs von Mott The Hoople. May spielte darüber hinaus mit alten Sixpence-Stücken und nicht mit Plektren. Ich schob das alles auf die Tatsache, dass Queen eine neue, sich gerade hoch kämpfende Band waren, die sich kein gutes Equipment leisten konnte. Sogar sein alter, ziemlich mitgenommener Vox-AC-30-Verstärker stand auf einem Klappstuhl. Ich vermutete, er hatte seine Ausrüstung für einen Zandra-Rhodes-Dress geopfert, den Queen zu der Zeit so gerne trugen. Als ich ihn jedoch spielen hörte, verflog mein Mitleid. Ich hatte niemals zuvor so hohe, aber trotzdem voluminöse und facettenreiche Töne gehört, wie Brian sie mit seiner Gitarre produzierte. Er war verdammt gut, und Queen strahlten ein wenig von Led Zeppelins Grundstimmung aus, unterschieden sich aber dennoch grundlegend von ihnen.
Ich kann mich nicht erinnern, damals mit Freddie Mercury gesprochen zu haben. Ich dachte wohl, dass es ein ziemlicher blöder Name für einen Rockstar sei. Für mich waren „Freds“ Bauern, Bauarbeiter oder der Typ von nebenan, der im Pub Darts spielt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Band sich so profund auf mein zukünftiges Leben auswirken würde. Auf der Tour 1973 begrüßte die Mott-Crew die Musiker von Queen mit einem Nicken und unterhielt sich gelegentlich mit ihnen. Doch eine nähere Freundschaft kam nicht zustande. Roger zeigte ein bisschen Anerkennung und John war John, ruhig und in sich gekehrt. Fred war schon damals ein einzigartiges Individuum. Er benahm sich wie ein Star. Ein großer Star.
Von Vorgruppen erwartete man, dass sie den ihnen gebührenden Platz einnahmen. Trotz mangelnden Erfolgs gaben sich Queen reserviert, manchmal sogar arrogant und verlangten während der Tour eine Menge, was so manchen nervte und aufregte. Das änderte sich auch nicht. Die Crew kategorisierte Queen als einen Haufen Poser. Obwohl ich einige der Stücke mochte, irritierte mich ihr super-selbstbewusster und stolzierender Sänger. Die Mott-Roadies waren sich darin einig, dass Queen es niemals schaffen würden. Auf gar keinen Fall. Dennoch war ich von den Freundinnen von Queen beeindruckt: vier attraktiven, cool anmutenden und scharf aufgebrezelten Ladies, die einige der Auftritte besuchten. Modisch wurden sie nur von der Band übertrumpft, die teurere und beeindruckendere Gewänder und Blusen trug.
Im Jahr darauf spielten Queen kurzzeitig als Vorgruppe von Mott The Hoople in den USA, doch mir blieb der tänzelnde Poser mit nur einem Handschuh erspart, da ich für den David-Bowie-Gitarristen Mick Ronson auf dessen UK-Tour arbeitete. Ich hatte es also noch immer nicht in die Staaten geschafft. Ein Jahr später erhielt ich das kurzfristige Angebot, als Roadie für Brian May einzuspringen, weil sein Mann ausgestiegen war und sie dringend einen Ersatz für eine US-Tour suchten. Allerdings tauchte Brians Techniker doch wieder auf, woraufhin man mir einen anderen Job anbot, die Betreuung des Schlagzeugs und des Pianos. Drums: Ähnlich dem Aufbau eines Meccano-Bausatzes. Flügel: Verdammt viele Saiten, die man einzeln stimmen musste. Das wollte ich nicht, und so ließ ich das Angebot sausen. Erneut hieß es: USA – nein! Dann, als die verschiedenen Formationen von Mott The Hoople ihren kreativen Geist ausgehaucht hatten, nahmen Richie, Phil und ich das Angebot von Queen an, die gerade begannen, an ihrem vierten Album zu arbeiten: eine kleine Kollektion von Songs, zusammengefasst unter dem Titel A Night At The Opera. Queen wurden größer und größer und suchten eine Crew mit genügend Erfahrung – und einen 20-Jährigen, der den Unterschied zwischen einer Les Paul und einer Les Dawson kannte und sich um den Bass und das Schlagzeug kümmerte. (Bechstein? War das nicht eine deutsche Biermarke?)
„Er ist jung, er ist begeisterungsfähig – er soll sich mal um Fred kümmern.“ Vielen Dank auch. Das war Mitte der Siebziger gewesen: Schlaghosen, Haarmähnen in der Federschnitt-Frisur, hochhackige Schuhe und Plateaustiefel, Satin, Samt, knallenge Kostüme, Stars und Glitzer … und das Video zu diesem Song. Bohemian Bloody Rhapsody! Gedreht auf Bühne 5 in den Elstree Film Studios während einer kurzen Unterbrechung der Tourneeproben, war das für uns eine nicht sonderlich willkommene Ablenkung. Wir arbeiteten praktisch rund um die Uhr, um die neue Show auszuarbeiten, und so empfanden wir es als eine nervige Angelegenheit, da man ständig umbauen, sich aus dem Kamerawinkel heraushalten, Ruhe bewahren und warten musste. Insgesamt war es aber nicht ganz so schlimm. Dieses kleine sechsminütige Filmchen kam eigentlich ganz gut rüber und half Queen, Karriere zu machen. Es gab durchaus Bands, für die ich lieber gearbeitet hätte, doch der geschilderte Augenblick stellte sich als ausschlaggebend für meine Laufbahn und mein Leben heraus. Auf Queen wartete eine Welttournee. Nach der Mühsal einer Konzertreise durch Großbritannien, würde ich endlich in die USA kommen, und dann nach Japan und Australien.
Als junger Kerl beschränkten sich meine gesamten Ambitionen darauf, mit einer Rockband um die Welt zu reisen, eine Menge Mädchen kennenzulernen und eine gute Zeit zu haben. Queen wollten die bekannteste und beste Tour-Band werden – wieder einmal spielte das Geld eine untergeordnete Rolle. Wir waren beide erfolgreich. Ich war ein junger Typ aus der Arbeiterschicht, der Glück hatte und dank harter Arbeit und Loyalität auch recht glücklich blieb. Ich hatte einen Weg aus dem Leben eines Fabrikarbeiters gefunden und sollte schon bald viele meiner Wünsche verwirklichen – und der größte Wunsch war es, endlich in die USA zu reisen.