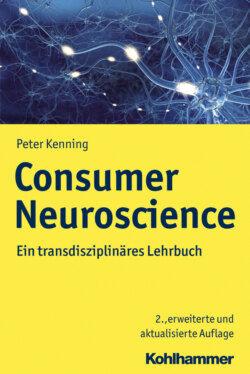Читать книгу Consumer Neuroscience - Peter Kenning - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Consumer Neuroscience: Was ist es und wofür braucht man es? 2.1 Was ist es? Die Entstehung der Consumer Neuroscience
ОглавлениеDie Entwicklung der Consumer Neuroscience resultiert aus einer Evolution der Konsumenten- und Käuferverhaltensforschung, deren Entstehungsgeschichte wiederum eng verbunden ist mit der Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften und hier insbesondere derjenigen des Marketings. Etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellten Ökonomen erstmalig fest, dass das Verhalten der Konsumenten mit Hilfe der bis dahin dominierenden Kaufkraft-Modelle nicht ausreichend erklärt werden konnte. Parallel hierzu gewannen ergänzende psychologische Modelle und Konstrukte wie Einstellungen oder Motive an Bedeutung (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2011, S. 36). Das Konsumentenverhalten wurde in diesem Zusammenhang immer mehr als das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Variablen erkannt. Die wichtigsten Kategorien bildeten dabei die ökonomischen (z. B. der Preis eines Gutes) sowie die psychologischen Variablen (z. B. das Image der Marke; vgl. Gutjahr 2011). Bereits damals war aber erkennbar, dass eine rein auf ökonomischen und psychologischen Modellen basierende Theorie zu ungenau ist und daher eine interdisziplinäre Ausrichtung der Konsumentenverhaltensforschung sinnvoll sein könnte, die z. B. durch eine Ergänzung soziologischer Aspekte (man denke z. B. an Rollenkonzepte oder die Systemtheorie) geschehen sollte.
Gleichwohl dominierte in der Gründungsphase des Marketings eine ökonomische Sichtweise, die primär distributionspolitische Aspekte berücksichtigte (Wilkie, Moore 2003). Es entsprach dem damaligen Zeitgeist, dass die wirtschaftswissenschaftliche Forschung psychologischer Provenienz in jener Zeit hauptsächlich versuchte, das beobachtbare Verhalten der Kunden und Konsumenten mit Hilfe behavioristischer Ansätze zu erklären. Denn mit der Entdeckung der bedingten Reflexe durch Pawlow bot sich den Verhaltenswissenschaftlern damals die Möglichkeit, »nach dem Vorbild der klassischen, exakten Naturwissenschaften zu experimentieren und viele Psychologen hegten die Hoffnung, damit die Bausteine des Verhaltens gefunden zu haben, aus denen sich der ganze bunte Kosmos des Verhaltens konstruieren lasse« (Eibl-Eibesfeldt 1997, S. 15).
Die Idee des Behaviorismus war, dass aufbauend auf der bereits von John Locke formulierten Vermutung, die Menschen kämen als unbeschriebenes Blatt zur Welt, menschliches Verhalten letztlich vollständig als Reaktion auf äußere Reize zu erklären sei (Skinner 1978). Der Mensch sei im Wesentlichen passiv und durch Belohnung und Bestrafung jederzeit in der gewünschten Weise zu konditionieren. Der Hinweis auf eine möglicherweise vorgegebene menschliche Natur brachte – schon damals – die Gefahr mit sich, als biologischer Determinist und Reduktionist disqualifiziert zu werden (vgl. Eibl-Eibesfeldt 1997, S. 15). Parallel dazu entwickelte sich in der Anthropologie ein kultureller Relativismus, der Kultur als eine von der Biologie weitestgehend unabhängige Kategorie definierte und damit auch der Neurobiologie entrückte. Ein Ansatz der in den letzten Jahren in der Entwicklung der sogenannten »Cultural Neuroscience« seine Gegenthese gefunden hat (Chiao 2009), die wiederum mit kollektivistischen Konzepten und Theorien (z. B. dem Konzept der »verteilten Kognition«) konfrontiert wird.
Methodisch untersuchten die Behavioristen den Zusammenhang zwischen einem bestimmten Umfeld bzw. Stimulus und damit verbundenem bzw. daraus resultierendem Verhalten (Reaction) mit Hilfe klar definierter experimenteller Ansätze (Plomin et al. 1990). Die im Rahmen dieser Forschungsarbeiten entwickelten Modelle werden demzufolge als S-R(»Stimulus-Response«)-Modelle bezeichnet (Kotler, Armstrong 2009). Es liegt auf der Hand, dass neurobiologische Methoden und Verfahren in diesem Zusammenhang keine deskriptive Bedeutung hatten. Vielmehr wurde der menschliche Organismus ganz im Sinne von Locke als Black-Box definiert. Ein wesentlicher Grund hierfür bestand in den methodischen Grenzen, die seinerzeit bestanden.
Eine weitere wichtige Annahme der damaligen Wirtschaftswissenschaften war die Idee, Menschen müssten sich stets rational, oder besser: im Sinne des Modells »vernünftig« verhalten. Die mit dieser Annahme verbundene Idee des Homo oeconomicus ist in den letzten Jahren vielfach widerlegt, aber auch regelmäßig zu Unrecht gescholten worden. So wurde oft übersehen, dass es sich eigentlich um eine Strohmann-Diskussion handelte. Tatsächlich bewegt sich die Idee des Homo oeconomicus nicht ausschließlich auf der deskriptiven, sondern auf der ethisch- bzw. praktisch-normativen Ebene. Demnach besteht die Aussage nicht darin, wie Menschen sich tatsächlich verhalten, sondern wie sie sich nach Sicht der Ökonomie in bestimmten Situationen verhalten sollten (Jacoby 2002).
Heute kann diese Diskussion als weitgehend überwunden gelten. So kommen in diesem Zusammenhang Richard Köhler und Manfred Bruhn zu folgendem, quasi »postkritischem« Ergebnis:
»Die experimentelle Spieltheorie ist ebenfalls vom Bild des Homo oeconomicus abgerückt. In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn die Kritiker der betriebswirtschaftlichen Disziplin irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen würden, dass das Bild des Homo oeconomicus schon seit Jahrzehnten nicht mehr Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ist« (Köhler, Bruhn 2010, S. 5).
Schauen wir aber noch einmal auf die Entwicklung der Konsumenten- und Käuferverhaltensforschung zurück: Dort begründeten Jerome McCarthy und Philip Kotler zu Beginn der 1960er und 1970er Jahre das »moderne Marketing« mit der Entwicklung der sogenannten Marketing-Mix-Instrumente (Kotler 1976; McCarthy 1960). Sie propagierten den Gedanken, dass Marketing vielmehr das Konzept der marktorientierten Unternehmensführung beschreiben sollte, als ein bloßes Instrument des Absatzes darzustellen. Die dieser Forderung zugrundeliegende Erkenntnis war, dass letztlich der Kunde die einzige dauerhafte Cash-Flow-Quelle des Unternehmens sei. Alle anderen Stakeholder – u. a. der Staat, die Mitarbeiter sowie die Lieferanten – seien primär dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Einkommenserwartung mit dem Unternehmen verbinden. Daraus resultiert letztlich ein Mittelabfluss, der durch kundenseitig gewonnene Mittelzuflüsse mindestens zu kompensieren sei (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2011).
Aus dem Postulat der marktorientierten Unternehmensführung das auch in Deutschland (weiter-)entwickelt wurde, ergab sich unmittelbar die Forderung, die Konsumenten- und Käuferverhaltensforschung als eine wichtige theoretische Grundlage der Unternehmensführung zu betrachten (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2011). Eine Idee, die sehr schnell rasche Verbreitung fand und heute als allgemein akzeptiert gelten darf. In diesem Zusammenhang wurde 1969 in den USA die Association for Consumer Research (ACR) gegründet, die mittlerweile auf mehreren Kontinenten Ableger etablieren konnte. Etwa zeitgleich wurden die ersten Lehrbücher zum Thema »Consumer Behavior« veröffentlicht (Engel et al. 1968; Kassarjian, Robertson 1968). In diesen Tagen waren die wichtigsten Konzepte übersichtliche Modelle des Konsumentenverhaltens, die interessanterweise zunächst als »prozessuale Einbahnstraßen« gedacht wurden (Engel et al. 1968; Howard, Sheth 1969; Nicosia 1966). Im Zentrum der Modelle stand zumeist die Bedürfnisbefriedigung der Kunden. Nach wie vor wurden aber die im Kunden ablaufenden Prozesse nicht unmittelbar operationalisiert, sondern (re-)konstruiert. Der Kundenkopf blieb weiterhin eine Black Box. Im Gegensatz aber zu den S-R-Modellen wurden die im Organismus ablaufenden Prozesse mit Hilfe theoretischer Überlegungen und empirischer Forschung nun aber systematischer rekonstruiert. Diese Arbeiten manifestierten sich in der Etablierung des auch heute noch bekannten und bedeutsamen S-O-R-Paradigmas ( Abb. 2).
Unterschiede zwischen den verschiedenen S-O-R-Modellen bestanden darin, dass sie teilweise primär auf einige, wenige Facetten des Konsumentenverhaltens abstellten und als Partialmodelle bezeichnet werden konnten (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2012, S. 140). Andere Modelle versuchten hingegen, das gesamte Konsumentenverhalten und die zu seiner Beschreibung notwendigen Konstrukte in einem Modell zu integrieren. Diese Totalmodelle hatten zwar einen gewissen didaktischen Wert, da sie die Komplexität des Verhaltens erahnen ließen, waren aber auch gerade deswegen sehr unübersichtlich. Darüber hinaus suggerierten sie eine zumeist statische deterministische Mechanik, die in der Realität oft nicht gegeben war (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2012, S. 140).
Ein in diesem Kontext entwickeltes und nach wie vor bedeutsames Modell ist das Totalmodell von Howard und Sheth (1969). Das Ziel dieses Modells war es, die kognitiven,
Abb. 2: Das S-O-R-Modell (Kotler, Armstrong 2009 in Anlehnung an Howard, Sheth 1969)
kontrollierten Kaufentscheidungen mit Hilfe bestimmter Variablen zu erklären (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2012, S. 142). Hierzu unterschied das Modell zwischen drei Gruppen von Variablen: Den beobachtbaren Inputs (S), den beobachtbaren Outputs (R) sowie den nicht beobachtbaren, hypothetischen Konstrukten (I), die den internen Zustand des Kunden erfassen und beschreiben sollten. Diese Gruppe der hypothetischen Konstrukte konnte dabei in Konstrukte unterteilt werden, die in die Informationsverarbeitung involviert sind sowie Konstrukte, die im Zusammenhang mit Lernprozessen von Bedeutung sind. Die folgende Abbildung 3 stellt diesen Unterschied sowie die entsprechenden Konstrukte des Modells noch einmal in graphischer Form dar.
Ein weiteres für die Konsumentenverhaltensforschung bedeutsames Totalmodell wurde 1978 erstmalig von Engel et al. vorgelegt und später weiterentwickelt (Engel et al. 1978, 1995). Das zentrale Merkmal dieses Modells war die Differenzierung in verschiedene Kaufentscheidungstypen. In dem Modell wurden extensive, limitierte, impulsive und habitualisierte Kaufentscheidungen unterschieden. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zur Differenzierung dieser Typen waren das Involvement und die mit dem Kaufakt verbundene bewusste Wahrnehmung des Kunden (Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2012, S. 111). Darüber hinaus wurde der Kaufentscheidungsprozess differenziert in verschiedene, aufeinander folgende Phasen. Den Ausgangspunkt bildet dabei das durch den jeweiligen Kunden empfundene Bedürfnis oder ein durch externe Stimuli hervorgerufenes Motiv. Der Wahrnehmung dieser Differenz zwischen aktuellem und gewünschtem Zustand folgt die Phase der Informationssuche. In dieser Phase sucht der Kunde annahmengemäß die zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung stehenden Alternativen. In der dritten Phase werden diese schließlich bewertet, eine entsprechende Kaufentscheidung getroffen und das Ergebnis der Entscheidung evaluiert.
Abb. 3: Vereinfachte Wiedergabe des Modells von Howard und Sheth (Eigene Darstellung in Anlehnung an Howard und Sheth, 1969, S. 30)
Ein weiteres wichtiges Modell zur Erklärung des Käuferverhaltens bzw. der Kaufentscheidung wurde von Jim Bettman 1974 vorgelegt. Im Zentrum dieses Modells standen sogenannte Entscheidungsnetze (»Decision Nets«). Zur Identifikation der mit dem Entscheidungsnetz assoziierten intervenierenden Variablen bediente sich Bettman des Instruments der begleitenden Beobachtung. Hierbei geht ein Interviewer mit dem Kunden zusammen einkaufen und protokolliert die Dinge, die der Kunde im Moment jeweils erlebt und bewusst wahrnimmt. Die Idee dieses Ansatzes besteht somit darin, die in der Black Box ablaufenden Prozesse möglichst zeitnah und spontan zu erfassen, auch wenn sie nach wie vor kognitiv »gefiltert« und expliziert werden müssen.
Aufbauend auf der Entwicklung dieser für die heutige Konsumentenverhaltensforschung noch wichtigen Modelle hat in den letzten Jahren der technische Fortschritt insbesondere im medizinisch-radiologischen Bereich dazu geführt, dass die im Kundenkopf ablaufenden Prozesse mehr oder weniger direkt erfasst werden können (Zaltman 2000). Zwar könnte grundsätzlich der gesamte Organismus des Kunden von Relevanz sein; gleichwohl fokussieren die meisten Wissenschaftler die im Gehirn ablaufenden Prozesse, da man wohl zurecht davon ausgeht, dass ein Großteil des menschlichen Verhaltens in diesem zentralen Organ abläuft. Die wohl nicht ganz unberechtigte Hoffnung der entsprechenden ForscherInnen ist dabei, dass ein besseres Verständnis des menschlichen Gehirns zu einem besseren Verständnis und einer besseren Vorhersage des menschlichen Verhaltens und damit auch des Kauf- und Konsumentenverhaltens führen könnte (Kenning, Plassmann 2005). Diese Hoffnung manifestiert sich derzeit in der sogenannten Brain-as-predictor-Hypothese. Diese Hypothese wurde erstmalig von Berkman und Falk (2012) explizit verwendet. Die Idee dieser Hypothese wird in dem folgenden Zitat deutlich:
»One goal of social science in general, and of psychology in particular, is to understand and predict human behavior. Psychologists have traditionally used self-report measures and performance on laboratory tasks to achieve this end. However, these measures are limited in their ability to predict behavior in certain contexts. We argue that current neuroscientific knowledge has reached a point where it can complement other existing psychological measures in predicting behavior and other important outcomes.« (Berkman, Falk 2012, S. 45).
Der Versuch, biologische Variablen auch in die Käufer- und Konsumentenverhaltensforschung zu integrieren ist dabei nicht grundsätzlich neu. Tatsächlich haben einige prominente Fachvertreter frühzeitig auf die Bedeutsamkeit der Neurowissenschaften und die entsprechenden methodischen Möglichkeiten hingewiesen (Kroeber-Riel 1979). Auch wurden verschiedene apparative Verfahren verwendet, die heute noch wichtig sind (z. B. die EEG; Krugman 1971). Dennoch folgte dann eine Zeit, die Saad (2008) vor einigen Jahren treffenderweise als »collective amnesia of marketing scholars regarding consumers’ biological and evolutionary roots« bezeichnete. Diese Phase scheint heute im Kontext der Entwicklungen in den Bereichen der Neuroeconomics (Camerer et al. 2005) und Consumer Neuroscience (vgl. Kenning/Plassmann/Ahlert 2007; Levallois 2019) überwunden zu sein, denn in diesem Gebieten geht es (wieder) um die Integration neurowissenschaftlicher Methoden, Theorien und Erkenntnisse in die wirtschaftswissenschaftliche Forschung. In diesem Zusammenhang werden zunehmend auch absatzwirtschaftliche Fragen fokussiert und der – etwas irreführende – Begriff »Neuromarketing« verwendet (Lewis, Bridger 2005; Levallois 2019).
Eine der ersten wissenschaftlichen und methodische besonders bedeutsamen Studien im Rahmen der geschilderten Entwicklung war das von Alan Sanfey im Jahre 2003 durchgeführte Experiment zu den neuralen Prozessen, die mit Entscheidungen im Ultimatum-Game verbunden sind (Güth et al. 1982). Bereits diese Studie zeigte, dass die Neuroökonomik einen Beitrag dazu leisten könnte, ökonomisch relevantes Verhalten besser zu verstehen. Diese Studie, die bis dato mehr als 3500mal zitiert wurde, soll daher im Folgenden kurz beschrieben werden.
Im Kern geht es im Ultimatum-Game um folgende Problemstellung: Zwei Akteure werden gebeten, einen durch den Spielleiter zur Verfügung gestellten Betrag einvernehmlich untereinander aufzuteilen. Dabei erhält der erste Akteur (A) den Auftrag, einen Verteilungsvorschlag zu machen. Der zweite Akteur (B) hat dann die Möglichkeit, diesen Vorschlag zu akzeptieren oder abzulehnen. Nur wenn B akzeptiert, bekommen beide den Betrag aber auch tatsächlich ausgezahlt. Lehnt B hingegen ab, bekommen A und B nichts. Wie sollte sich A verhalten? Sein Erfolg hängt nicht nur von seiner Entscheidung, sondern auch von B‘s Reaktion darauf ab!
Folgt man der Axiomatik der klassischen ökonomischen Theorie, sollte A sich rational in dem Sinne verhalten, dass er versucht, seinen Anteil zu maximieren. Gleichzeitig sollte B versuchen, jeden Betrag »größer null« zu akzeptieren, da dies aus seiner isolierten Sicht besser wäre als nichts zu bekommen. Ein, im Sinne der ökonomischen Maxime »Mehr Geld ist besser als weniger Geld«, rationaler Verteilungsvorschlag von A wäre somit 9,99 Euro für sich zu behalten und B einen Cent anzubieten. Tatsächlich findet man in der Realität aber kaum solche Vorschläge und wenn, dann werden sie von B meist empört abgelehnt. Warum?
Nun, neuere Ansätze erklären dieses scheinbar irrationale Verhalten damit, dass Menschen eine implizite Präferenz für Fairness haben und deswegen am häufigsten eine als fair empfundene Aufteilung von 5 Euro für beide Spieler vorschlagen. Doch wie kommt man dieser impliziten Präferenz auf die Spur? Wie kann man sie beobachten und ihre Wirkungen messen? Um diese Fragen zu beantworten, liess Alan Sanfey Versuchspersonen im MR-Scanner das Ultimatum-Game spielen. Tatsächlich konnte er feststellen, dass immer dann, wenn die Spieler mit unfairen Angeboten konfrontiert wurden und diese ablehnten, ein anderer neuraler Prozess ablief als in den als fair empfundenen Situationen. Eine wesentliche Rolle für die Verarbeitung unfairer Angebote spielte dabei die Inselregion im Gehirn (Sanfey et al.2003).
Aus der Studie von Sanfey et al. (2003) ergaben sich vielfältige, für die weitere Entwicklung der neuroökonomischen Forschung und der Consumer Neuroscience relevante Aspekte. Diese können grob in eine methodische und eine inhaltliche Kategorie unterteilt werden:
• Methodisch zeigte die Untersuchung von Sanfey et al. (2003) zunächst einmal, dass es mit Hilfe der funktionellen Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT bzw. fMRI) möglich ist, ökonomisch relevante Prozesse abzubilden. Dies war bis dahin noch nicht versucht worden. Nun aber zeigte die Studie, dass die mit der fMRI zu erreichende bildliche und zeitliche Auflösung ausreichend ist, ökonomisch relevante Entscheidungsprozesse zu erfassen. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die zu bestimmten neuralen Strukturen vorliegenden neurowissenschaftlichen Befunde ausreichend sind, um eine sinnvolle Würdigung der Magnet-Resonanz-Befunde zu ermöglichen.Schließlich wurde drittens durch die Studie von Sanfey et al. deutlich, dass die fMRI eine Simultanität zwischen dem Treffen einer Entscheidung und ihrer apparativen Beobachtung ermöglicht, sodass auf eine nachträgliche (Re-)Konstruktion der mit dem Verhalten assoziierten Prozesse auf verbaler Ebene verzichtet werden kann.
• Inhaltlich zeigte die Studie von Sanfey et al. (2003), dass Menschen offensichtlich mehrere Entscheidungsprozesse in ein und derselben Entscheidungssituation verwenden können. Dies wurde von einigen Forschern als empirischer Beleg für die Gültigkeit der in der Literatur bereits häufiger vorgeschlagenen Dual-Process-Modelle gewertet (vgl. für viele Strack, Deutsch 2004; Camerer et al. 2005). Darüber hinaus zeigte die Studie, dass unbewusste Emotionen, die mit der Wahrnehmung eines bestimmten Stimulus verbunden sind, einen wesentlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess haben und diesen rahmen (framen») können. Insofern gab die Studie auch einen Hinweis auf die mit dem Framing-Effekt verbundenen, neuralen Mechanismen ( Kap. 6.1.2). Zudem wurde deutlich, dass für die Entstehung von Emotionen auch der jeweilige Spielpartner ein wichtiger Faktor ist. Denn immer dann, wenn die unfairen Angebote von einem Computer generiert wurden, entschieden die Akteure deutlich rationaler und zeigten weniger Aktivierung in der Inselregion. Ein Befund der einige weitere Forschungsarbeiten motivierte (vgl. Riedl et al. 2012, Riedl et al. 2014).
Angesichts dieser Ergebnisse wundert es nicht, dass in der Folge eine ganze Reihe weiterer, neuroökonomischer Studien und Versuche durchgeführt wurden. Darüber hinaus beschlossen Forscher an zahlreichen Universitäten, in diesem Bereich aktiv zu forschen und entsprechende Organisationen zu gründen, deren Aufgabe darin bestand und besteht, die neuroökonomische Forschung voranzutreiben. Ein Beispiel hierfür bietet die Society for Neuroeconomics (http://www.neuroeconomics.org). Ihr Ziel besteht zum einen darin, die Erforschung von ökonomischem Verhalten zu fördern, indem der Dialog zwischen Forschern aus der Psychologie, Ökonomie und Neurowissenschaften gefördert wird, zum anderen darin, die Erweiterung des Forschungsfeldes zu unterstützen, indem besonders junge Wissenschaftler gefördert werden. Diese Ziele werden verwirklicht, indem die Society for Neuroecnomics jährliche Treffen und Weiterbildungsprogramme organisiert, die die Entwicklung einer einheitlichen Sprache und methodischer Tools im Gebiet der Neuroökonomik fördern.
Das übergeordnete Ziel der neuroökonomischen Forschung ist es dabei, eine »unified theory of human behavior« zu entwickeln (Glimcher, Rustichini 2004; Kenning, Plassmann 2005, Camerer et al. 2005; FoxHall 2008). Im Kern soll menschliches Verhalten also weitestgehend neurobiologisch beschrieben werden.
In diesem Kontext kann der Gegenstandsbereich der Consumer Neuroscience definiert werden als die systematische Integration neurowissenschaftlicher Theorien, Methoden, Konzepte und Erkenntnisse in die Konsumentenverhaltensforschung (Fugate 2007; Grosenick et al. 2008; Lee et al. 2007). Analog zum Begriff »Consumer Neuroscience« wird in der Praxis oft der Begriff »Neuromarketing« verwendet (Hubert, Kenning 2008; Levallois et al. 2019). Hierbei handelt es sich aber um einen Misnomer, denn Marketing wird üblicherweise verstanden als das Konzept der marktorientierten Führung. Demzufolge kann man die marktorientierte Führung von Handelsbetrieben als Handelsmarketing bezeichnen (vgl. für viele Ahlert, Kenning 2007). Die marktorientierte Führung von Dienstleistungsunternehmen wäre demzufolge als Dienstleistungsmarketing zu bezeichnen (z. B. Evanschitzky et al. 2006). Neuromarketing würde aber streng genommen die marktorientierte Führung von Neuronen bedeuten und dies erscheint – hoffentlich! – ähnlich sinnlos wie Guerilla-Marketing oder Ambush-Marketing.