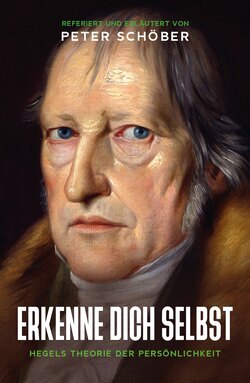Читать книгу "ERKENNE DICH SELBST" - HEGELS THEORIE DER PERSÖNLICHKEIT - Peter Schöber - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Hegels Einleitung in die Philosophie des Geistes
Selbsterkenntnis
Den Geist zu erkennen, das ist, Hegel zufolge, die konkreteste und darum die höchste und schwerste Aufgabe.15 “Erkenne dich selbst“, dieses absolute Gebot fordere weder an sich noch dort, wo es ausgesprochen wurde, nur sich selbst zu erkennen, bezogen auf die besonderen Fähigkeiten, den Charakter, die Neigungen und die Schwächen, sondern das zu erkennen, was am Menschen wahrhaft, was das Wahrhafte an und für sich ist, - das Wesen als Geist. Ebenso wenig habe die Philosophie des Geistes die Bedeutung der Menschenkenntnis, die bemüht sei, die Besonderheiten, Leidenschaften, Schwächen, des Einzelnen zu erforschen. Dies sei eine Kenntnis, die nur Sinn unter der Voraussetzung habe, dass das Allgemeine des Menschen und damit des Geistes erkannt ist; soweit sie sich mit den zufälligen, unbedeutenden, unwahren Existenzen im geistigen Leben beschäftigt, dringe sie nicht zum Substanziellen, dem Geist selbst, vor.
Die Idee des Geistes
Die Schwierigkeit, den Geist zu erkennen, besteht, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert16, darin, dass wir es nicht mehr mit der vergleichsweise abstrakten und einfachen logischen Idee17, sondern mit der konkretesten und am weitesten entwickelten Form der Idee zu tun haben, zu der die Idee in der Verwirklichung ihrer selbst gelangt.18
Auch der endliche oder der subjektive Geist, und nicht nur der absolute, müsse als eine Verwirklichung der Idee gefasst werden. Die Betrachtung des Geistes sei in Wahrheit nur dann philosophisch, wenn sie den Begriff des Geistes19 in seiner lebendigen Entwicklung und Verwirklichung erkennt, was eben heiße, wenn sie den Geist als ein Abbild der ewigen Idee begreift. Seinen Begriff zu erkennen gehöre zur Natur des Geistes. Die vom delphischen Apollo an die Griechen ergangene Aufforderung zur Selbsterkenntnis habe daher nicht den Sinn eines von einer fremden Macht äußerlich an den menschlichen Geist gerichteten Gebots, vielmehr sei der zur Selbsterkenntnis treibende Gott nichts anderes als das eigene absolute Gesetz des Geistes. Alles Tun des Geistes sei deshalb nur ein Erfassen seiner selbst, und der Zweck aller wahrhaften Wissenschaft sei nur der, dass der Geist in allem, was im Himmel und auf Erden ist, sich selbst erkennt. Ein durchaus Anderes sei für den Geist gar nicht vorhanden. Selbst der Orientale würde sich nicht ganz in dem Gegenstand seiner Anbetung verlieren, es seien aber die Griechen gewesen, die zuerst das, was sie sich als das Göttliche gegenüberstellten, ausdrücklich als Geist gefasst hätten. Doch seien sie weder in der Philosophie noch in der Religion zur Erkenntnis der absoluten Unendlichkeit des Geistes gelangt. Somit sei das Verhältnis des menschlichen Geistes zum Göttlichen bei den Griechen noch kein absolut freies. Erst das Christentum habe durch die Lehre von der Menschwerdung Gottes und von der Gegenwart des Heiligen Geistes in der gläubigen Gemeinde dem menschlichen Bewusstsein eine vollkommen freie Beziehung zum Unendlichen gegeben und dadurch die begreifende Erkenntnis des Geistes in der absoluten Unendlichkeit möglich gemacht.20
Nur eine solche Erkenntnis verdiene fortan den Namen einer philosophischen Betrachtung. Die Selbsterkenntnis im Sinne einer Erforschung der eigenen Schwächen und Fehler des Individuums sei nur für den Einzelnen, aber nicht für die Philosophie, von Interesse und wichtig. Selbst für den Einzelnen sei sie von einem umso geringeren Wert, je weniger sie sich auf die Erkenntnis der allgemeinen intellektuellen und moralischen Natur des Menschen einlassen würde und je mehr sie von den Pflichten, dem wahrhaften Inhalt des Willens, absehe und das Individuum sich selbstgefällig in seinen ihm teuren Absonderlichkeiten ergehe. Dasselbe gelte von der so genannten Menschenkenntnis, die ebenso auf die Eigentümlichkeiten einzelner Geister gerichtet sei. Für das Leben sei diese Menschenkenntnis allerdings nützlich und nötig, besonders in schlechten politischen Zuständen, wo nicht das Recht und die Sittlichkeit, sondern Eigensinn, Laune und Willkür der Individuen herrschten. Für die Philosophie aber bleibe diese Menschenkenntnis in eben dem Maße gleichgültig, wie dieselbe sich nicht von der Betrachtung zufälliger Einzelheiten zur Auffassung großer menschlicher Charaktere zu erheben vermag, durch die die wahrhafte Natur des Menschen in nicht verkümmerter Reinheit zur Anschauung gebracht werde. Sogar nachteilig für die Wissenschaft werde jene Menschenkenntnis aber dann, wenn sie - wie in der so genannten pragmatischen Behandlung der Geschichte geschehen - den substanziellen Charakter weltgeschichtlicher Individuen verkennen und nicht einsehen würde, dass Großes nur durch große Charaktere vollbracht werden kann.
Empirische und rationale Psychologie
Die empirische Psychologie habe, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, den konkreten Geist zu ihrem Gegenstand, und seitdem mit dem Wiederaufleben der Wissenschaften Beobachtung und Erfahrung zur Grundlage der Erkenntnis des Konkreten gemacht worden seien, sei teils jenes Metaphysische (die “abstrakte Verstandesmetaphysik“, ders.21) aus dieser empirischen Wissenschaft ausgegrenzt worden, teils habe sich die empirische Wissenschaft an die “gewöhnliche Verstandesmetaphysik“ 22 (ders.) von Kräften, verschiedenen Tätigkeiten usw. gehalten und die spekulative Betrachtung daraus ausgeschlossen.23 Demgegenüber verweist Hegel auf die Bücher des Aristoteles über die Seele, die noch das vorzüglichste und einzige Werk bildeten, das von einem spekulativen Interesse über diesen Gegenstand geleitet sei. Der wesentliche Zweck einer Philosophie des Geistes könne denn auch nur der sein, den Begriff in die Erkenntnis des Geistes wieder einzuführen, und damit auch den Sinn jener Bücher wieder zu erschließen.24
Ebenso wie die oben besprochene, auf die unwesentlichen, einzelnen empirischen Erscheinungen des Geistes gerichtete Betrachtungsweise sei auch, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert, die rationale Psychologie (oder Pneumatologie), die sich nur mit abstrakt allgemeinen Bestimmungen, mit dem vermeintlich erscheinungslosen Wesen, dem Ansich des Geistes, beschäftige, von der echten spekulativen Psychologie auszuschließen. 25 Das müsse deshalb geschehen, weil diese die Gegenstände weder aus der Vorstellung als gegebene aufnehmen, noch die Gegenstände durch bloße Verstandeskategorien bestimmen würde. So werfe jene (rationale, d. Verf.) Psychologie die Frage auf, ob der Geist oder die Seele einfach, immateriell, Substanz sei. Bei solchen Fragen würde der Geist als ein Ding betrachtet werden; würden doch jene Kategorien dabei nach der allgemeinen Weise des Verstandes als ruhende und feste angesehen, und so seien sie unfähig, die Natur des Geistes auszudrücken. Der Geist sei eben nicht ein Ruhendes, sondern das absolut Unruhige, die reine Tätigkeit, das Negieren aller festen Verstandesbestimmungen. Er sei nicht abstrakt einfach, sondern in seiner Einfachheit ein Prozess, in dem er sich von sich selbst unterscheidet26, und er sei auch nicht ein vor seinem Erscheinen schon fertiges, mit sich selber hinter dem Berge der Erscheinungen festes Wesen, sondern sei nur durch die bestimmten Formen, in denen er sich notwendigerweise offenbart, wirklich.27 Der Geist sei nicht, wie die rationale Psychologie meine, ein nur in äußerlicher Beziehung zum Körper stehendes Seelending, sondern mit dem Körper durch die Einheit des Begriffs innerlich verbunden.28
In der Mitte zwischen der auf die zufällige Einzelheit des Geistes gerichteten Beobachtungund der sich nur mit dem erscheinungslosen Wesen des Geistes befassenden Pneumatologie (rationalen Psychologie, d. Verf.) stünde die auf das Beobachten und Beschreiben der besonderen Geistesvermögen ausgerichtete empirische Psychologie. Aber auch diese würde es nicht zur wahrhaften Vereinigung des Einzelnen und des Allgemeinen, zur Erkenntnis der konkret allgemeinen Natur oder des Begriffs des Geistes bringen und habe somit ebenfalls keinen Anspruch auf die Bezeichnung “spekulative Philosophie“.29 Wie den Geist überhaupt, so nehme die empirische Psychologie auch die besonderen Vermögen, in die sie den Geist zerlegt, als gegebene aus der Vorstellung auf, ohne durch Ableitung dieser Besonderheiten aus dem Begriff des Geistes den Beweis der Notwendigkeit zu erbringen, dass im Geiste gerade diese und keine anderen Vermögen sind.30 Mit diesem Mangel in der Form hänge notwendigerweise die Entgeistigung des Inhalts zusammen.
Wenn in den bereits geschilderten beiden Betrachtungsweisen einerseits das Einzelne - Hegel meint offenbar die Beobachtung - und andererseits das Allgemeine - gemeint sind offenbar die begrifflichen Konstruktionen der rationalen Psychologie - als etwas für sich Festes angenommen worden sei, so würden, Hegel zufolge, der empirischen Psychologie auch die Besonderungen, in die, ihr zufolge, der Geist zerfällt, als in ihrer Beschränktheit starre gelten. Dadurch würde der Geist zu einem bloßen Aggregat von selbständigen Kräften werden, von denen jede mit der anderen nur in einer Wechselwirkung, somit in einer nur äußerlichen Beziehung steht. Denn obwohl diese Psychologie auch die Forderung erhebe, dass zwischen den verschiedenen Geisteskräften31 sich ein harmonischer Zusammenhang einstellt - ein nach Hegel häufig geäußertes, unbestimmtes Schlagwort -, so sei damit nur eine Einheit, die sein soll, nicht aber die ursprüngliche Einheit des Geistes ausgesprochen. Noch weniger sei aber die Besonderung, zu der der Begriff des Geistes, der seine an sich seiende Einheit darstellt, fortgeht, als eine notwendige und vernünftige erkannt. Jener harmonische Zusammenhang bleibe daher eine leere Vorstellung, die sich in nichts sagenden Redensarten verbreitend, nicht als eine Macht über die als selbständig vorausgesetzten Geisteskräfte angesehen werden könne.
Anstoß zum spekulativen Denken
Das Selbstgefühl von der lebendigen Einheit des Geistes setze sich, wie Hegel nach dem Zusatz ausführt, von selbst gegen die Zersplitterung des Geistes in die verschiedenen, Vermögen, Kräfte oder Tätigkeiten, die man sich als gegeneinander selbständig vorstelle, durch.32 Noch mehr aber würden die sich sogleich darbietenden Gegensätze zwischen der Freiheit des Geistes einerseits und seiner Determiniertheit andererseits, ferner zwischen der freien Wirksamkeit der Seele einerseits und ihrer äußerlichen Leiblichkeit andererseits sowie auch der innige Zusammenhang beider, das Bedürfnis wecken, hier zum Begreifen zu schreiten. Insbesondere hätten die Erscheinungen des animalischen Magnetismus33 in neueren Zeiten auch in der Erfahrung die substanzielle Einheit der Seele und die Macht ihrer Idealität zur Anschauung gebracht, wodurch alle festen Unterschiede, die der Verstand trifft, in Frage stünden, so dass eine spekulative Betrachtung zur Lösung der Widersprüche geboten sei.
Alle in den oben aufgeführten endlichen Auffassungen des Geistes seien, wie Hegel hierzu in seinem Zusatz erläutert, verdrängt worden, und zwar teils durch die ungeheure Umgestaltung, die die Philosophie in neuerer Zeit erfahren habe, und teils, von der empirischen Seite aus betrachtet, durch die Erscheinungen des animalischen Magnetismus, die das endliche Denken herausgefordert hätten. 34 Was die Umgestaltung der Philosophie betrifft, so habe diese die endliche Betrachtungsweise des nur reflektierenden Denkens zur Auffassung des Geistes als der für sich selbst wissenden wirklichen Idee, also zum Begriff des lebendigen Geistes, erhoben, der sich auf notwendige Weise in sich selbst unterscheidet (differenziert, d. Verf.) und aus seinen Unterschieden zur Einheit mit sich zurückkehrt. 35 Damit seien aber nicht bloß die in jenen endlichen Auffassungen des Geistes herrschenden Abstraktionen des nur Einzelnen, nur Besonderen und nur Allgemeinen überwunden und zu Momenten des Begriffs (des Geistes, d. Verf.), der ihre Wahrheit sei, herabgesetzt worden, sondern es sei auch, statt einer äußerlichen Beschreibung des vorgefundenen Stoffs, die strenge Form des sich selbst mit Notwendigkeit entwickelnden Inhalts als die allein wissenschaftliche Methode zur Geltung gebracht worden.36 Werde in den empirischen Wissenschaften der Stoff als ein durch die Erfahrung gegebener, von außen aufgenommener und nach einer bereits feststehenden allgemeinen Regel geordnet und in einen äußerlichen Zusammenhang gebracht, so habe dagegen das spekulative Denken jeden seiner Gegenstände und die Entwicklung derselben in ihrer absoluten Notwendigkeit zu zeigen. Dies geschehe dadurch, dass jeder besondere Begriff aus dem sich selbst hervorbringenden und verwirklichenden allgemeinen Begriff oder der logischen Idee abgeleitet wird.37 Die Philosophie müsse daher den Geist als eine notwendige Entwicklung der ewigen Idee begreifen und dasjenige, was die besonderen Teile der Wissenschaft vom Geist ausmacht, rein aus dem Begriff desselben sich entfalten lassen.38 Wie bei dem Lebendigen überhaupt auf ideelle Weise alles schon im Keim enthalten sei und von diesem selbst und nicht von einer fremden Macht hervorgebracht werde, so müssten auch alle besonderen Formen des lebendigen Geistes (z. B. Verfassungen und Gesetze, d. Verf.) aus seinem Begriff als ihrem Keim sich hervor treiben. Unser vom Begriff bewegtes Denken bleibe dabei dem ebenfalls vom Begriff bewegten Gegenstand durchaus immanent.39 Wir würden der eigenen Entwicklung des Gegenstandes gleichsam nur zusehen und sie nicht durch Einmischung unserer subjektiven Vorstellungen und Einfälle verändern. Der Begriff bedürfe zu seiner Verwirklichung keines äußeren Antriebs. Seine eigene Natur, die den Widerspruch der Einfachheit und des Unterschieds in sich schließe und deswegen unruhig sei, treibe ihn dazu, sich zu verwirklichen, nämlich den in ihm selbst nur auf ideelle Weise, d. h. in der widersprechenden Form der Unterschiedslosigkeit vorhandenen Unterschied zu einem wirklichen Unterschied zu entfalten. Durch diese Aufhebung seiner Einfachheit als eines Mangels, einer Einseitigkeit, mache er sich wirklich zu dem Ganzen, von dem er zunächst nur die Möglichkeit enthalte.40
Nicht weniger als beim Beginn und Fortgang seiner Entwicklung sei, so Hegel, der Begriff bei ihrem Abschluss von unserer Willkür unabhängig. Bei der nur “räsonierenden Betrachtungsweise“ (ders.) erscheine der Abschluss allerdings mehr oder weniger willkürlich. In der philosophischen Wissenschaft dagegen setze der Begriff selber seiner Entwicklung dadurch eine Grenze, dass er sich eine Wirklichkeit gibt, die ihm völlig entspricht. 41 Schon am Lebendigen sei diese Selbstbegrenzung des Begriffs sichtbar. So schließe der Keim der Pflanze - dieser sinnlich vorhandene Begriff - seine Entfaltung mit einer ihm entsprechenden Wirklichkeit, also mit der Hervorbringung des (neuen) Samens ab. Das gleiche gelte vom Geist; auch seine Entwicklung habe ihr Ziel erreicht, wenn sein Begriff sich vollkommen verwirklicht hat, oder, was dasselbe sei, wenn der Geist zum vollkommenen Bewusstseins seines Begriffs gekommen ist.42 Dieser Vorgang, in dem sich der Anfang mit dem Ende zu einem Eins zusammenziehe, diese Verwirklichung des Begriffs, in der dieser zu sich selber komme, erscheine aber im Geiste in einer Gestalt, die noch vollendeter sei als beim bloß Lebendigen. Denn während beim Lebendigen (z. B. einer Pflanze, d. Verf.) der hervorgebrachte Samen nicht derselbe sei mit dem, von dem er hervorgebracht worden ist, sei in dem sich selbst erkennenden Geist das, was er hervorbringt, ein und dasselbe mit dem Hervorbringenden.43
Nur wenn man den Geist in dem Prozess der Selbstverwirklichung seines Begriffs betrachtet, würde man ihn in seiner Wahrheit erkennen; denn Wahrheit heiße eben Übereinstimmung des Begriffs mit seiner Wirklichkeit. In seiner Unmittelbarkeit (z. B. bei einem Kleinkind, d. Verf.) sei der Geist noch nicht wahr, habe seinen Begriff noch nicht gegenständlich gemacht, habe das in ihm auf unmittelbare Weise Vorhandene noch nicht zu einem von ihm Gesetzten umgestaltet, seine Wirklichkeit noch nicht zu einer seinem Begriff gemäßen umgebildet. Die ganze Entwicklung des Geistes bestünde in nichts anderem als darin, sich zu seiner Wahrheit zu erheben, und die so genannten Seelenkräfte hätten keinen anderen Sinn als den, die Stufen dieser Erhebung zu sein. Dadurch, dass der Geist sich selbst unterscheidet (oder sich differenziert, d. Verf.), sich selbst umgestaltet und seine Unterschiede zur Einheit seines Begriffs zurückführt, sei er ein Wahres, ein Lebendiges, Organisches und Systematisches.44 Nur indem die Wissenschaft vom Geist diese seine Natur erkennt, sei sie ebenfalls wahr, lebendig, organisch und systematisch. Dies seien Prädikate, die weder der rationalen noch der empirischen Psychologie zuerkannt werden könnten, weil jene, also die rationale Psychologie, den Geist zu einem von seiner Verwirklichung abgeschiedenen, toten Wesen mache und diese, also die empirische Psychologie, den lebendigen Geist dadurch abtöte, dass sie ihn auseinander reißt in eine Mannigfaltigkeit selbständiger Kräfte, die nicht vom Begriff hervorgebracht und zusammengehalten werden.
“Animalischer Magnetismus“ 45
Hegel zufolge sei es der Gedanke des “tierischen Magnetismus“ gewesen, der dazu beigetragen habe, die unwahre, endliche, bloß verständige Auffassung des Geistes zu verdrängen. Diese Wirkung habe jener wunderbare Zustand 46 besonders auf die Betrachtung der natürlichen Seite des Geistes gehabt.47 Könnte der Verstand die sonstigen Zustände und natürlichen Bestimmungen des Geistes und seine bewussten Tätigkeiten wenigstens äußerlich 48 auffassen und könnte er den in ihm selbst wie auch den äußeren Zusammenhang von Ursache und Wirkung - den so genannten natürlichen Gang der Dinge - fassen, so zeige er sich dagegen unfähig, an die Erscheinungen des tierischen Magnetismus auch nur zu glauben, weil in denselben das nach seiner Auffassung feste Gebundensein des Geistes an Ort und Zeit sowie an den Zusammenhang von Ursache und Wirkung seinen Sinn verliere. Obwohl es nun, wie Hegel fortfährt, sehr töricht wäre, in den Erscheinungen des tierischen Magnetismus eine Erhebung des Geistes sogar über seine begreifende Vernunft zu sehen und von diesem Zustande über das Ewige höhere Erkenntnisse als jene zu erwarten, die die Philosophie bietet, und obwohl der magnetische Zustand (die Hypnose, d. Verf.) vielmehr für eine Krankheit gehalten werden müsste, in der der Geistes selbst unter das gewöhnliche Bewusstsein herabsinke und er in jenem Zustand sein Denken, das sich sonst in bestimmten Unterscheidungen zu bewegen pflege, aufgebe, sich der Natur gegenüberzustellen, so sei doch nichtsdestoweniger die in den Erscheinungen jenes Magnetismus sichtbare Loslösung des Geistes von den Schranken des Raums und der Zeit sowie von allen endlichen Zusammenhängen etwas, was mit der Philosophie verwandt sei. Mit aller Brutalität einer ausgemachten Tatsache trotze jene Loslösung des Geistes nämlich dem Skeptizismus des Verstandes und mache deshalb das Fortschreiten von der gewöhnlichen Psychologie zum begreifenden Erkennen der spekulativen Philosophie notwendig, für die allein der tierische Magnetismus kein unbegreifliches Wunder sei.
Weitere Bemerkungen zur Methode
Betrachtet man die konkrete Natur des Geistes, so stoße man, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, auf die eigentümliche Schwierigkeit, dass die besonderen Stufen und Bestimmungen in der Entwicklung seines Begriffs nicht auch als besondere Existenzen zurück- und seinen tieferen Gestaltungen gegenüber bleiben, wie dies in der äußeren Natur der Fall sei.49 Die Bestimmungen und Stufen des Geistes dagegen seien wesentlich nur als Momente, Zustände und Bestimmungen an den höheren Entwicklungsstufen. Es geschehe dadurch, dass an einer niedrigeren, abstrakteren Bestimmung das Höhere sich schon empirisch vorhanden zeigt. So sei z. B. in der Empfindung alles höhere Geistige (z. B. das Recht) als Inhalt oder Bestimmtheit vorhanden. Oberflächlich gesehen, könne daher in der Empfindung, die nur eine abstrakte Form sei, jener Inhalt, so das Religiöse, Sittliche usw., wesentlich seine Stelle und sogar seine Wurzel haben, so dass es notwendig erscheine, die Bestimmungen des Inhalts als besondere Arten der Empfindung zu betrachten.50 Aber zugleich werde es nötig, indem niedrigere Stufen betrachtet werden, um sie in ihrer empirischen Existenz vorzuführen, an höhere zu erinnern, an denen sie nur als Formen vorhanden sind. Auf diese Weise würde ein Inhalt vorweggenommen werden, der sich erst später in der Entwicklung zeigt, z. B. im Fall des natürlichen Erwachens: das Bewusstsein, oder bei der Verrücktheit: der Verstand. Hegel verweist hier also auf einen Aspekt seiner Methode, nach der er den subjektiven Geist eines Individuums begrifflich zu entfalten versucht.
15Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 9 f. Dazu auch: E. Metzke, demzufolge die Enzyklopädie Hegels der erste wirkliche, voll durchgeführte Abschluss von Hegels philosophischem Gesamtsystem sei. Ders., Hegels Vorreden, a. a. O., S. 233.
16 Ebenda. Zur Frage der erläuternden Zusätze siehe H. Drüe, Philosophie des Geistes (§§ 377-577), in: Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ (1830), H. Drüe u. a., a. a. O., S. 207.
17 Diese entfaltet er im 1. Teil seiner „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“, in: Hegel, Werke, Bd. 8, Frankfurt a. M. 1970. Die Entfaltung der logischen Idee setzt er mit der Entfaltung der Idee der Natur und schließlich der des Geistes fort. Die logische Idee ist ein System von allgemeinen Kategorien und logischen Formen, die die Geschichte der Menschheit hervorgebracht, von der Philosophie gedacht und überliefert wurden und die Hegel aufnimmt und in einem System miteinander kombiniert, und zwar auf dem Weg des reinen „dialektischen“ Denkens. Die Kategorien haben ihr Dasein, teils in der natürlichen, teils in der wissenschaftlichen oder teils in der philosophischen Sprache. Es sind die Denkkategorien, „die das Wirkliche schlechthin konstituieren; sie sind dieses Wirkliche selbst, abstrahiert von seinem Inhalte, wie er in Natur- und Geisteswelt sich ausbreitet.“ Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, 3. Aufl., 2. Bd., Tübingen 1977, S. 417. Neben seinem philosophischen System gibt es für Hegel nicht noch die „eigentliche Welt“, vielmehr ist es die Welt in ihrer Substanz. In der Philosophie ist es nach Hegel von jeher um nichts anderes gegangen als um die „denkende Erkenntnis der Idee“ (ders.). Alles was verdient, sich „Philosophie“ zu nennen, habe stets das Bewusstsein einer absoluten Einheit dessen zugrunde gelegen, was dem Verstand nur in seiner Trennung gelten würde. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil., ebenda, S. 369. Die Idee ist für Hegel nicht der Einfall eines einzelnen Philosophen, schon „gar nicht irgendeine wirklichkeitsferne Gedankenkonstruktion, sondern der „gediegene Gehalt“ der konkreten Erfahrung und Wirklichkeit, „insofern er gedacht wird“. E. Metzke, Hegels Vorreden, a. a. O., S. 239. Nach K. Marx ist für Hegel „der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet.“ Ders., Das Kapital, 1. Bd., Nachw. z. 2. Aufl., Marx/Engels Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 27. Nicht die Einzelnen sind das Subjekt der Welt, sondern es ist die Idee (Hegel) als Einheit zweier Formen: des Begriffs oder der Subjektivität und der Objektivität oder der Wirklichkeit.
18Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 9 ff. Die Idee in ihrer abstrakten Form (wie sie in Hegels „Logik“ gedacht wird) ist die „unmittelbare“ Idee als Leben, ihr folgen die Idee als Erkennen, die Idee als Wollen und schließlich die absolute Idee als Synthese von Erkennen und Wollen als Identität des Wahren und Guten. Die „unmittelbare“ Idee avanciert zur absoluten Idee dadurch, dass sie in der Form der Philosophie sich selbst denkt und damit in ihr um sich weiß. Dazu: Nicolai Hartmann, G. F. Fr. Hegel, Berlin 1929., S. 281. In ihrer konkreteren Form ist die Idee als Natur (ihrem „Anderssein“, Hegels Naturphilosophie) und in ihrer konkretesten Form ist sie als Geist, nämlich als „subjektiver Geist“ (Seele, Bewusstsein, theoretischer, praktischer und freier Geist), sodann als „objektiver Geist“ (Recht, Moralität und Sittlichkeit - der „absolute Geist an sich“) und schließlich als „absoluter Geist für sich“ (Philosophie der Kunst, der Religion und der Philosophie der Philosophie). Siehe auch die Ausführungen zur „Idee“ im Anhang.
19Der Begriff als solcher ist nach Hegel nicht der durch Abstraktion gewonnene Begriff von einem Gegenstand, der als ein „Werkzeug unseres Wissens, eine Methode zur Erfassung der Wirklichkeit“ (Ch. Taylor) ist. Der Begriff ist nach Hegel „ein aktives Prinzip, das der Wirklichkeit zugrunde liegt und sie zu dem macht, was sie ist“. Ders., Hegel, Frankfurt a. M. 1978, S. 389. Somit weicht der Sinngehalt dieses Begriffs (engl. concept) vom Sinngehalt des Begriffs ab, wie er dem „gesunden Menschenverstand“ entspricht. Dieser steht der Sache gegenüber, jener ist die Sache selbst. Da stellt sich, wie Hegel selbst bemerkt und worauf noch einmal unten eingegangen werden wird, die Frage, weshalb für grundverschiedene Inhalte ein und dasselbe Wort benutzt wird. Hegel gibt darauf, wie Taylor (ebenda, S. 391) ihn referiert, selbst die Antwort: weil die gewöhnliche Sprache und seine Sprache nicht so weit voneinander entfernt sind. Im Fall des Begriffs gelte es, so E. Metzke, daran zu denken, dass er für Hegel nicht Produkt der Abstraktion, sondern dass er das die Wirklichkeit als innere Wesensnotwendigkeit Durchwaltende und Bestimmende ist, das im Geist und im subjektiven Begriff nur zu sich kommt. Ders., Hegels Vorreden, a. a. O., S. 247. Der subjektive Begriff ist, so Hegel, noch nicht die „Idee“. Er sei noch formal (abstrakt), jedoch nicht in dem Sinne, dass er einen anderen Inhalt (als den wahren Inhalt, die Idee, d. Verf.) haben sollte. Als die absolute Form sei er alle Bestimmtheit wie sie in ihrer Wahrheit ist. Obwohl er abstrakt sei, sei er das Konkrete, das Subjekt als solches. Das Absolut-Konkrete sei der Geist - der Begriff existiere, insofern er als Begriff (z. B. Freiheit), sich von seiner Objektivität (z. B. Staatsverfassung) unterscheidet, die aber trotzdem seine Objektivität bleibe. Alles andere Konkrete, so reich es auch sein mag, sei, so Hegel, nicht so innig identisch mit sich, am wenigsten das, was man im Allgemeinen unter Konkreten verstünde, nämlich eine bloß äußerlich zusammengehaltene Mannigfaltigkeit. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O. S. 314. Zum Beispiel schließt der Begriff des Sinns die Mannigfaltigkeit menschlichen Verhaltens und menschlicher Werke zu einer „innigen Identität“ zusammen und konstituiert damit den Gegenstand oder den Bezugsrahmen der einzelnen Geisteswissenschaften, vollends der Philosophie des Geistes. Begriffe, wie sie Hegel versteht, werden also nicht dadurch gebildet, dass man von außen an die Dinge herantritt und von ihren Unterschieden abstrahiert, sondern sie werden, als das Substanzielle der Dinge, enthüllt. Als Beispiel für den Unterschied zwischen Begriff und Idee (als Subjekt-Objekt und Vernunft): So gibt es den Begriff des Handelns als eine sinnhafte Tätigkeit. Auch in der gewöhnlichen Alltagssprache würde man hier nicht von der „Idee des Handelns“ sprechen. Demgegenüber gibt es die Idee der Freiheit. Hier ist ein normatives, ein Wertprinzip gemeint, das jedoch lediglich ein subjektives Phänomen, die Vorstellung Einzelner, bliebe, würde es, Hegel zufolge, keine „absolute“ Einheit (ders.) mit einer geltenden normativen Ordnung, z. B. einer Staatsverfassung, bilden und sich damit nicht durch das Handeln der Einzelnen, z. B. der Staatsbürger, aktualisieren, verwirklichen. Siehe auch Anhang.
20Das lässt sich in dem Sinne verstehen, dass das Christentum die Grundlage für die Philosophie des Geistes als Selbsterkenntnis des Geistes geschaffen hat. Jedenfalls erkennt die Welt des Geistes, anders als die Welt der Natur, die vom Geist als sein „Außersichsein“ gesetzt ist, sich selbst in den einzelnen Geisteswissenschaften, vollends in der Philosophie des Geistes.
21Gemeint ist die „Pneumatologie“ oder rationale Psychologie. Rational heiße, so Hegel, die Psychologie im Gegensatz zur empirischen Betrachtungsweise der Seele. Die rationale Psychologie betrachte die Seele nach ihrer metaphysischen Natur, wie sie durch das abstrakte Denken bestimmt wird. Sie wolle die innere Natur der Seele erkennen, wie sie an sich, wie sie für den Gedanken ist. Heutzutage werde in der Philosophie weniger von der Seele, als vom Geist gesprochen. Der Geist unterscheide sich von der Seele, indem diese gleichsam das Mittlere zwischen dem Körper und dem Geist oder das Band zwischen beiden sei. Der Geist als Seele sei in die Leiblichkeit versenkt, und die Seele sei das Belebende des Körpers. Die alte Metaphysik habe die Seele als Ding betrachtet, eine „Verdinglichung“ (d. Verf.), die Hegel kritisiert. Die rationale Psychologie stehe dadurch höher als die empirische, indem sie den Geist durch das Denken erkennen und das Gedachte auch beweisen will. Die empirische Psychologie gehe dagegen von der Wahrnehmung aus und zähle nur auf und beschreibe nur, was diese ergibt. Den Geist, wolle man ihn angemessen begrifflich fassen, müsste man, so Hegel, wesentlich in seiner konkreten Wirklichkeit, in seiner Energie, betrachten, und zwar so, dass seine Äußerungen als durch seine Innerlichkeit bestimmt erkannt werden. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 100 ff.
22Hegel meint damit offensichtlich die impliziten kategorialen (z. B. die Kategorie der Kraft) Voraussetzungen einer auf Beobachtung beruhenden Psychologie.
23Ders. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 11.
24Gemeint ist nicht der gewöhnliche Begriff im Sinne einer allgemeinen Vorstellung, sondern der spekulative Begriff, der nach Hegel ein Allgemeines ist, das sich selbst spezifiziert und in seinem Anderen in ungetrübter Klarheit bei sich selbst bleibt. Dieser Begriff ist nach Hegel, wie erwähnt, dem allgemeinen Sprachgebrauch keineswegs ganz fremd. So sagt man z. B. dass sich diese oder jene Rechtsbestimmung aus dem Begriff des Eigentums ergibt. Einen Begriff im spekulativen Sinne würden wir, so Hegel, gar nicht bilden, jedoch sei er nicht bloß das Sein oder das Unmittelbare, sondern es gehöre zu ihm die Vermittlung, und diese liege in ihm selbst. Der Begriff sei das wahrhaft Erste, und die Dinge seien das, was sie sind, durch die Tätigkeit des ihnen innewohnenden und in ihnen sich offenbarenden Begriffs. Ders, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 308, 312 u. 313. Formal gesehen, fordert Hegel, dass die Wissenschaft sich nur in der Sphäre des reinen begrifflichen Denkens bewegt, doch bedeutet das nicht, dass die Empirie ignoriert wird, vielmehr muss diese immer der Ausgangspunkt einer theoretischen Wissenschaft sein.
25Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 11 ff.
26So spaltet sich der Geist in ein Subjekt und ein Objekt auf, ein Vorgang, der nach Hegel mit dem Bewusstsein und seinen Formen gegeben ist. Hierbei handelt es sich um eine „dialektische“ Entwicklung in dem Verhältnis zwischen einem Wissenssubjekt einerseits und seinem Objekt andererseits, eine Entwicklung, die Hegel in seiner „Phänomenologie des Geistes“, der Erscheinungslehre des Geistes, im Einzelnen begrifflich-theoretisch nachvollzieht.
27Dabei handelt es sich um die Formen, die Hegel in seiner „Phänomenologie des Geistes“ und in seiner „Psychologie“ denkt.
28So trennt der Verstand Seele und Körper, doch bilden beide eine Einheit, die nur als solche lebendig ist; lässt sich doch keine Seele ohne den Körper und keinen lebendigen Körper ohne die Seele denken. Es gilt also, über diesen Zusammenhang nachzudenken und damit die Trennung des Verstandes zu überwinden.
29Das Allgemeine ist die Herrschaft, z. B. des Geistes oder der Gesellschaft über das Besondere, z. B. das Bewusstsein bzw. den Einzelnen. Dazu: Theodor W. Adorno, Einleitung in die Soziologie (1968), hrsg. v. Christoph Gödde, Frankfurt a. M. 1993, S. 61. Hegel gehe es, so Eugen Heuss, darum, „das „Allgemeine des Begriffs“ vom lediglich „Abstrakten“ (dem abstrakt Allgemeinen) deutlich abzusetzen, was so geschehe, dass er das Allgemeine (z. B. den Geist, d. Verf.) Schritt für Schritt als Totalität erweist. Das wahre Allgemeine (Leben, Ich, Geist) bestehe darum 1. nicht abgetrennt von seinen Besonderungen zu sein, vielmehr erhalte es sich darin und bleibe darin das, was es ist. Deshalb sei 2. Das „Negative oder die Bestimmung“ keine Schranke für das Allgemeine, sondern es greife über sein Anderes über. Und es sei schließlich 3. das Einfache, das, was das „Reichste in sich ist“. Denn ohne die Bestimmtheit, die näher die Besonderheit und Einzelheit sei, könne vom Allgemeinen nicht gesprochen werden. Die Bestimmtheit gehöre wesensnotwendig zum Allgemeinen, so dass es ein „Konkretes und nicht ein Leeres“ sei. Ders., Anmerkung, in: Felix Krueger, Zur Philosophie und Psychologie der Ganzheit, hrg. v. Eugen Heuss, Berlin 1953, S. 331. Das Allgemeine ist, so Hegel, das sich selbst Besondernde oder Spezifizierende und nicht mit dem Gemeinschaftlichen zu verwechseln. Es ist der dem Besonderen und Einzelnen (dem Wirklichen) innewohnende Begriff. Dazu auch: Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 311 ff.
30„Das zeigt sich schroff erst dort, wo sie (die Gesetzesforschung, d. Verf.) beim Menschen anlangt und sein Seelenleben ihr Gegenstand wird. Hier wird sie zur „beobachtenden Psychologie“ (Hegel Zitat). Es ist eine Menge von Gesetzen, die sich hier aufdrängt. Aber die „reale Individualität“ des Bewusstseins fassen sie nicht. Die Welt des Individuums ist nicht nur tief innerlich und verwickelt, sondern auch „zweideutig“: Individuum und Welt „modifizieren“ sich wechselseitig.“ Nicolai Hartmann, G. W. Fr. Hegel, Berlin 1929, S. 115.
31Nach Hubert Rohracher könnte man hier die psychischen Funktionen, wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken und sodann die psychischen Kräfte, wie Trieb Gefühl und Wille nennen. Ders., Einführung in die Psychologie, 9. Aufl., Wien 1965, S. V-VII.
32Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, S. 13 f.
33Laut dem „Neuen Brockhaus“ (3. Aufl., Wiesbaden 1959) werden darunter (nach Franz Mesmer, 1734-1815, auf den Hegel weiter unten eingeht) von Menschen ausstrahlende (Heil-) Kräfte verstanden.
34Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 13 ff.
35Diese Rückkehr zur Einheit geschieht in der Philosophie des Geistes und was die Persönlichkeit des Einzelnen betrifft, im philosophischen Erkennen des „subjektiven Geistes“.
36Dies mag am Beispiel der modernen Gemeinde verdeutlicht werden. Man kann zum Zweck der Bildung einer Theorie der modernen Gemeinde als Ausgangspunkt den Gemeindebegriff nehmen, wie er im Gemeinde- und Staatsrecht verankert ist. Sodann kann man die Gemeinde in die verschiedenen (besonderen) rechtlichen Sphären einteilen, um so zu einer vollständigen Theorie der Gemeinde im Sinne eines rechtlichen Gebildes zu kommen. Doch mit einer solchen Abstraktion würde man nach Hegel die moderne Gemeinde als ein lebendiges konkretes Ganzes nicht erfassen; ist sie doch auch ein politisches, administratives und ökonomisches Gebilde. Um nun die moderne Gemeinde als das zu erfassen, was sie ihrem Wesen nach ist, gilt es herausfinden, was ihr normatives, ihr sittliches Grundprinzip, ihre „Idee “, ist. Ihre Idee würde nach Hegel in der Freiheit vom und in der Freiheit im Staat, kurz, in der kommunalen Selbstverwaltung bestehen. Das Walten dieser sittlichen Idee muss jedoch im Einzelnen im Gemeinde- und Verfassungsrecht, im Wissen und der Gesinnung der Bürger und in der Wirklichkeit der Gemeinde, also im Handeln des Gemeindevorstandes, der Verwaltung, der Bürger nachgewiesen und begrifflich dargestellt werden. Darüber hinaus ist die Idee der Gemeinde im Verhältnis einer Gemeinde zu anderen, im Gemeindewesen des modernen Staates überhaupt und in der Geschichte von Gemeinde und Staat ebenfalls zu verfolgen und begrifflich darzustellen. Zu einer solchen philosophischen Theoriebildung müssen, wie erwähnt, die Ergebnisse der „abstrakten“ Gemeindewissenschaften einbezogen und „aufgehoben“, in dem Sinne, dass sie „negiert“, „bewahrt“ und „erhöht“ werden. Die philosophische Theorie der teilweise autonomen Gemeinde stellt diese nicht nur als eine Wirklichkeit dar, sondern sie beweist auch, dass sie im modernen Staat notwendig und vernünftig ist.
37Um z. B. zum Begriff der christlichen Religion zu gelangen, bedarf es empirischer und vergleichender Forschungen zu den einzelnen Religionen. Durch Abstraktion wird dann ein allgemeiner Religionsbegriff und in weiteren Schritten der Begriff der christlichen Religion gewonnen. Ein Schritt darüber hinaus wäre dann derjenige hin zu dem subjektiven (und zugleich objektiven), also zum spekulativen Begriff der christliche Religion, der das, was, die christliche Religion ihrem Wesen nach und damit das ausmacht, was alle christlichen Gemeinden und ihre Mitglieder vereinigt. In einem weiteren Schritt gilt es, die Idee der christlichen Religion als eine Einheit von Glaubensprinzipien und ihrer Objektivierung und Verwirklichung in der Welt zu verfolgen und begrifflich darzustellen. Das betrifft die Riten, die normativen Ordnungen (z. B. das Kirchenrecht), die Organisation (z. B. die Kirche), die einzelnen Gemeinden und schließlich das religiöse Leben des Einzelnen. Erkennen lassen muss nach Hegel diese Darstellung der Idee der christlichen Religion, dass sie ein notwendiges und vernünftiges Moment der Wirklichkeit im modernen Staat ist, obwohl Staat und Religion voneinander getrennt sind.
38Der Geist bildet, wie sich Hegel verstehen lässt, jeweils den theoretischen Bezugsrahmen, den gemeinsamen Gegenstand, der einzelnen Geisteswissenschaften, die sich innerhalb desselben entfalten müssen.
39Der theoretisch-spekulative Begriff ist demnach, wie erwähnt, mit dem Begriff, der nach Hegel den Gegenstand bewegt, identisch. Er ist demnach nicht der Begriff, der von außen durch Abstraktion gewonnen wird, also im Sinne einer „abstrakten Allgemeinheit“ oder einer „allgemeinen Vorstellung“. Aber als ein tätiges, dem Gegenstand, den Dingen, innewohnendes Prinzip ist er nach Hegel auch nicht, wie schon bemerkt, dem natürlichen Sprachgebrauch völlig fremd.
40Nach Hegel bestimmt der Gegenstand die Methode und die Kategorien, durch die, bzw. in denen er erkannt wird. Die Kategorien müssen dem Gegenstand angemessen, dürfen also nicht nur subjektiv und willkürlich, sein. Was die Methode betrifft, um das herauszufinden, was der Gegenstand in Wahrheit ist, dazu als Beispiel folgende sehr grobe Skizze: Im frühfeudalen Grundeigentum waren die unmittelbaren Produzenten, die für den freien Grundherrn (und Krieger) eine Grundrente erarbeiten und erwirtschaften mussten, Leibeigene. Dies war noch ein Zustand relativer gesellschaftlicher Unterschiedslosigkeit (Undifferenziertheit), der jedoch einen Widerspruch enthielt. Denn die unmittelbaren Produzenten, die leibeigenen Knechte, wurden von den Priestern der sich entwickelnden Kirche im christlichen Glauben sozialisiert, nach dem, Hegel zufolge, jeder Mensch als ein solcher frei ist. Und dieser Glaube stand im Widerspruch zur Leibeigenschaft. Die Freiheit, die das Christentum lehrte, versprachen die teils von geistlichen, teils von weltlichen Herren gegründeten und von ihnen sodann verwalteten Städte. In den Städten, in die viele Leibeigene strömten und sie wachsen ließen, bildete sich ein freies Stadtbürgertum in Gestalt vor allem von Handwerkern und ihren Vereinigungen, den Zünften, heraus, und alsbald befreiten sich die Städte von ihren Herren und gaben sich eine eigene Verfassung und Regierung. Geboren war damit die relativ autonome Stadt des Mittelalters, die eine Vorgängerin des modernen Staates werden sollte. Kurz, es war ein wirklicher Unterschied von Stadt und Land eingetreten, der begrifflich auch dementsprechend entfaltet werden muss. Doch das Gebiet, das Stadt und Land einschloss, entwickelte sich in der Folge zum Territorialstaat als ein Teil des formal übergeordneten Reiches. Damit wurde den Städten wieder die Autonomie genommen. Dieser Einbuße an Gemeindefreiheit stand eine größere Sicherheit und damit Freiheit für den Einzelnen innerhalb der entstandenen Staatsgebiete und des Reichsgebiets gegenüber, und in den Städten konnten sich, infolge einer Vereinheitlichung von Recht und Geldwesen, der Handel weit über die Stadt und ihre Umgebung hinaus ausdehnen, wodurch die Voraussetzung für große Handelsbetriebe und (ihre) Manufakturen geschaffen wurde und sich damit ein neues mächtiges Stadtbürgertum herausbilden konnte. Doch Städte und ihre Bürger, mehr noch, die arbeitende Landbevölkerung, unterlagen dem absoluten Staat oder der absoluten Monarchie in der neueren Zeit. Der Begriff der Freiheit im sich herausbildenden neuen Bürgertums verlangte zu seiner Verwirklichung einen weiteren Schritt, und zwar hin zum modernen Staat und seiner differenzierten Verfassung (Gewaltengliederung), in der die Stadtgemeinden teilweise autonom sind und mit dem ihnen übergeordneten Staat aber eine, wenn auch widersprüchliche Einheit bilden. Der Differenzierungsprozess, der in den relativ einfachen Verhältnissen des frühen Mittelalters begann, denen es an Freiheit mangelte, hat schließlich zum modernen, freiheitlichen Staat als einem Ganzen geführt, der in jenen einfachen Verhältnissen nur der Möglichkeit nach vorhanden war. Die hier am Beispiel der (deutschen) Geschichte nur grob vorgeführte „dialektische Methode“ ist idealistisch oder spiritualistisch, indem sie von der Idee, vom Geist der Freiheit ausgeht, ebenso könnte sie materialistisch sein, indem dieselbe Geschichte, so bei K. Marx, von den Produktionsverhältnissen, gefasst in den Kategorien der Politischen Ökonomie, ausgeht. Bevor der Gegenstand, z. B. die Geschichte, nach der dialektischen Methode „in seinem Begriff“, als theoretisch, dargestellt werden kann, muss der Wissenschaftler auf gründliche empirische und theoretische Studien zurückgreifen können, er muss geradezu in die Geschichte eingetaucht sein, denn sonst bliebe seine Darstellung nur eine subjektive, leere historische Konstruktion. - Erst der wissenschaftliche Apparat erschließe, so Jürgen Habermas, einen Gegenstand, von dessen Struktur man gleichwohl vorgängig etwas verstanden haben muss, sollen die gewählten Kategorien ihm nicht äußerlich bleiben. Dieser Zirkel sei nur in Anknüpfung an die natürliche Hermeneutik der sozialen Lebenswelt dialektisch durchzudenken. Ders., Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, in: Theodor W. Adorno u. a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied 1969, S. 157 u. 158.
41Nimmt man hierfür wieder als Beispiel die Entwicklung von Stadtgemeinde und Staat und sieht in ihr als vorantreibendes Prinzip den Begriff, das Prinzip der Freiheit am Werk, dann ist die rein begrifflich-theoretische Bearbeitung dieses Vorgangs dann vollendet, wenn sie die gewordene moderne Wirklichkeit, d. h. den modernen Staat und in ihm das durch die Staatsverfassung gewährleistete, teilweise autonome Gemeindewesen, erfasst hat. Die gewordene Wirklichkeit, z. B. eine solche der sittlichen Idee (für Hegel der moderne Staat), setzt also, ihm zufolge, dem Begreifen eine Schranke, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Wirklichkeit, so wie sie Hegel versteht, nicht neben ihrem Begriff, ihrer Theorie, steht, sondern in nichts anderem als in ihr zur Darstellung kommt.
42Zum Beispiel hat nach Hegel der moderne Geist, nämlich der Geist der Freiheit, dann sein Ziel erreicht, wenn er sich in allen Sphären eines Staates sowie im ganzen Staatensystem verwirklicht und sich am Ende selbst begriffen hat, etwa in Gestalt der Hegelschen Rechts- und Staatsphilosophie.
43 Nach Hegel ist also der Geist, der Wirklichkeiten hervorbringt, am Ende identisch mit dem Geist, der ihn erkennt.
44 Wie der Geist, ausgehend vom Einfachen der natürlichen Seele, sich fortschreitend differenziert, um sich schließlich zu einem Ganzen zusammenzufügen, das stellt Hegel in seiner Theorie des subjektiven Geistes (oder der Persönlichkeit) dar. Die Entwicklung des subjektiven Geistes des Einzelnen läuft also, mit anderen Worten, darauf hinaus, die Unterschiede, den Prozess der Differenzierung von Seele und Geist, zur Einheit des Begriffs (des Geistes) zurückzuführen, ein Vorgang, der durch Hegel mittels seiner Methode rein begrifflich gedacht wird und sich nur so manifestiert.
45Nach Franz Anton Mesmer (1734-1815) vom Menschen ausstrahlende Kräfte, die durch magnetische Striche Heilkraft erhalten. Der Neue Brockhaus, 3. Bd., a. a. O., S. 405. Dabei geht es offenbar um den Einsatz der Hypnose zu Heilzwecken.
46Hegel scheint den Zustand der Hypnose oder der Trance zu meinen.
47Hegel scheint dabei an das zu denken, was er die „natürliche Seele“ nennt.
48Zum Beispiel das Handeln, das sichtbar als Bewegung erscheint.
49Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 16 ff.
50So spricht man von religiösen und sittlichen Empfindungen, und es liegt nahe zu glauben, dass das Religiöse oder das Sittliche, als die einer höheren Stufe angehörenden Inhalte, ihren Ursprung oder ihren Platz in der Empfindung haben. Dabei können solche Inhalte einer höheren Stufe nicht aus einer niedrigeren, wo die Empfindungen angesiedelt sind, erklärt werden, erstere werden lediglich aus methodischen Gründen bei der Analyse der Empfindungen vorweggenommen. Religion, Sitte und Recht verbinden sich zwar mit Empfindungen oder Gefühlen, haben aber als Momente des „absoluten“ (Hegel) und des „objektiven“ Geistes (ders.) eben nicht ihre Wurzel und ihre ursprüngliche Stelle in den Empfindungen der einzelnen „natürlichen Seele“ (ders.).