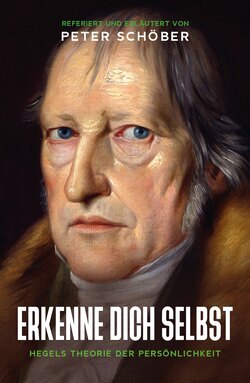Читать книгу "ERKENNE DICH SELBST" - HEGELS THEORIE DER PERSÖNLICHKEIT - Peter Schöber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Der Begriff des Geistes
3.1 Geist und Natur
Der Geist hat für uns, so Hegel, die Natur zu seiner Voraussetzung, er sei aber ihre Wahrheit und damit ihr absolut Erstes.51 Für uns, jedenfalls für unser sinnliches Bewusstsein52, ist die Natur allerdings das Unmittelbare und Erste. Doch für das philosophische Bewusstsein ist der Geist die “Wahrheit“ der Natur und damit ihr “absolut Erstes“ (ders.).53 Es ist die Naturphilosophie, die die Natur als eine der Welt des Geistes völlig andere, extrem entgegen gesetzte Welt setzt, und zugleich ihre Aufgabe darin sieht, die beiden von ihr selbst als einander äußerst gegensätzlich gesetzten Sphären wieder zu einem Ganzen zusammenzuführen. Das geschieht, indem sie die Natur, so wie sie in den diversen modernen Naturwissenschaften gedacht wird und deren Ergebnisse sie aufnimmt und zugleich aufhebt, als eine auf den Geist hin angelegte Welt interpretiert. 54 Für Hegel hat die Welt des Geistes gegenüber der Welt der Natur allerdings von vornherein den Vorrang; habe doch in der Natur das Spiel der Formen nicht nur seine zügellose Zufälligkeit, sondern entbehre doch jede Gestalt des Begriffs ihrer selbst. Das Höchste, zu dem es die Natur bringe, sei das Leben, aber als nur natürliche Idee sei dieses der Unvernunft der Äußerlichkeit hingegeben. Die geistigen Formen enthielten demgegenüber eine höhere Lebendigkeit und seien damit des Geistes würdiger als die natürlichen Formen. Menschliche Taten und Begebenheiten seien gegenüber Sonne, Mond, Tieren, Pflanzen usw. den Vorzug zu geben, wenn auch die Idee an sich göttlich sei.55 Der Geist sei also, so Hegel, die Wahrheit der Natur, und in dieser Wahrheit sei die Natur verschwunden, und der Geist habe sich als die zu ihrem Fürsichsein gelangte Idee ergeben.56 Das Objekt wie auch das Subjekt der Idee sei der Begriff57. Nach Hegel sind also in der Idee des Geistes bis zu deren Schwelle die Naturphilosophie die Natur herangeführt hat, Subjekt und Objekt identisch, d. h. das Subjekt als erkennender Geist steht nicht mehr einem Anderen, einem ihm fremden, nicht-geistigen Objekt gegenüber, wie im Fall der Natur, sondern einzig und allein sich selbst. Jene Identität, in der Subjekt und Objekt gleichermaßen der Begriff ist, sei, wie Hegel fortfährt, eine “absolute Negativität“ (mit Bezug auf die Natur, d. V.), weil in der Natur der Begriff seine vollkommen äußerliche Objektivität habe.58 Anders als die Welt des Geistes, in der der Begriff im menschlichen Handeln wirksam ist, sich manifestiert und sich selbst erkennt, steht also die Welt der Natur dem begreifenden Subjekt zunächst als eine ihm vollkommen “begriffs-“ und “geistlose“, ja geradezu als eine “sinnwidrige“ Sphäre gegenüber. Diese muss aber nach Hegel nichtsdestoweniger als die Entäußerung des einen Geistes begriffen werden. Es ist eben der (moderne wissenschaftliche) Geist selbst, der die Natur als seine äußerste Entäußerung setzt, um sodann diese seine Setzung in der Form der (modernen) naturphilosophischen Theorie, aufbauend auf den Erkenntnissen der empirischen und theoretischen Naturwissenschaften, schrittweise wieder aufzuheben.59 Jene Identität, in der Subjekt und Objekt der Begriff ist, der Geist sich also als eine gegenüber der Natur eigenständige Welt konstituiert, ist damit zugleich seine Rückkehr aus der Natur.60 Mit anderen Worten, für den Philosophen ist es der Geist selbst, der die Natur als das Andere seiner selbst und damit sich selbst als das Andere der Natur setzt; sodann kehrt er in der Philosophie der Natur zu sich selbst zurück, erfasst sich in der Philosophie des Geistes selbst und erkennt sich als das Identische in der einen wie in der anderen Welt, in der Welt des Menschen überhaupt. Es ist also der Geist, der die Natur als Idee setzt und sie als solche als sein Anderssein begreift und ebenso sich selbst als Idee setzt und sich als solche begreift.
In seinem erläuternden Zusatz zu seinen einleitenden Ausführungen zum Begriff des Geistes erinnert Hegel daran, dass dieser als die sich selbst wissende wirkliche Idee zu verstehen ist.61 Der Begriff des Geistes ist demnach sowohl wirklich, z. B. in einer modernen Verfassungswirklichkeit (Wirklichkeit der Freiheit), als auch sich selbst wissend, z. B. in der modernen Rechts- und Staatsphilosophie (in der ja die Wirklichkeit zur Darstellung kommt). Anders als die Natur, kann sich der Geist, so sein Begriff von der Natur, sich selbst erkennen.
Den Begriff des Geistes habe, wie Hegel fortfährt, die Philosophie als notwendig zu erweisen, d. h. als Resultat der Entwicklung des allgemeinen Begriffs oder der logischen Idee62 zu erkennen. Dem Geist gehe aber in dieser Entwicklung nicht nur die logische Idee, sondern auch die äußere Natur voran. Denn das schon in der einfachen logischen Idee enthaltene Erkennen63 sei nur der von uns gedachte Begriff des Erkennens, nicht aber das für sich selbst vorhandene Erkennen64, nicht der wirkliche Geist, sondern bloß dessen Möglichkeit. Der wirkliche Geist, der allein in der Wissenschaft vom Geist unser Gegenstand sei, habe die äußere Natur zu seiner nächsten und die logische Idee, zu seiner ersten Voraussetzung.65 Mit dem “wirklichen Geist“ meint Hegel den Begriff des Geistes, wie er sich in der Seele, im Bewusstsein, im Denken und Wollen des Einzelnen, also im subjektiven Geist (ders.), ferner in den normativen Ordnungen, also im objektiven Geist (ders.) aktualisiert, sich sodann in der Kunst darstellt und sich in der Offenbarungsreligion vorstellt, um sich schließlich in der Philosophie zu denken; es ist der Geist der Moderne - eine konkrete Totalität.
Zu ihrem Endresultat müssten, wie Hegel fortfährt, daher die Naturphilosophie und mittelbar die Logik den Begriff des Geistes als notwendig begründen. Die Wissenschaft vom Geist habe diesen Begriff, so wie sie ihn entwickelt, zu prüfen, ob er sich bewährt. Was man daher zu Beginn der Betrachtung des Geistes nur versichern könne, könne erst durch die ganze Philosophie wissenschaftlich bewiesen werden. Zunächst könne man nicht mehr tun, als den Begriff des Geistes bloß für die Vorstellungzu erläutern.
Um zum Begriff des Geistes zu kommen, sei es nötig, die Bestimmtheit anzugeben, durch die die Idee Geist ist. Alle Bestimmtheit sei aber Bestimmtheit nur gegenüber einer anderen, und die Bestimmtheit des Geistes stehe zunächst der Bestimmtheit der Natur gegenüber, und jene sei zugleich mit dieser begrifflich zu erfassen. Als die unterscheidende Bestimmtheit des Begriffs des Geistes, müsse die Idealität bezeichnet werden. Dies bedeutet, dass, so Hegel, das Anderssein der Idee (die Idee als Natur66, d. Verf.) aufgehoben wird, die Idee aus ihrem Anderen in sich zurückkehrt und so als ein Zurückgekehrtes ist.67
Auch die äußere Natur sei ebenso wie der Geist, vernünftig und göttlich, also eine Darstellung der Idee.68 Aber in der Natur erscheine die Idee im Element des Außereinanders (in Raum und Zeit, d. Verf.), sie sei nicht nur für den Geist äußerlich, sondern, weil das Wesen des Geistes in der an und für sich seienden Innerlichkeit bestehen würde, sei sie auch eben deshalb sich selber äußerlich (sie ist sich selbst weder Subjekt noch Objekt, d. Verf.). Sie wird also vom Geist nicht nur als das ihm Äußerliche gesetzt, sondern ist auch sich selber ein Äußerliches. Die Natur wird somit von Hegel, wie schon erwähnt, nicht mit dem gleichgesetzt, was uns unsere Sinnesorgane vermitteln und was unsere vor aller Erfahrung liegenden Kategorien zu Inhalten verarbeiten, sondern sie wird von ihm als eine eigenständige, auf sich beruhende Welt außerhalb des individuellen Bewusstseins, jedoch nicht als eine außerhalb der Reichweite des Geistes liegende Welt verstanden. So liegt z. B. die atomare Welt zwar jenseits des sinnlichen Bewusstseins des Einzelnen, sie liegt aber gleichwohl in der Reichweite des physikalischen und des darauf aufbauenden naturphilosophischen Denkens.69
Die Natur, so wie sie Hegel versteht, stimmt, ihm zufolge, vollkommen mit dem wie sie die alten Griechen verstanden, aber auch mit unserer gewöhnlichen Vorstellung von ihr überein.70 So sei uns geläufig, dass das Natürliche räumlich und zeitlich ist, dass in der Natur Dieses neben Diesem besteht und Dieses Diesem folgt, kurz, dass alles Natürliche ins Unendliche außereinander ist. Ferner wüssten wir, dass die Materie, diese allgemeine Grundlage aller da seienden Gestalten der Natur, uns nicht nur Widerstand leistet und außerhalb unseres Geistes besteht, sondern gegen sich selber sich auseinanderhält, in konkrete Punkte, in materielle Atome sich trennt, aus denen sie sich zusammensetzt. Die Unterschiede, zu denen sich der Begriff der Natur 71 entfalte, seien mehr oder weniger gegeneinander selbständige Existenzen. Durch ihre ursprüngliche Einheit stünden sie zwar miteinander in Beziehung, so dass keine Existenz ohne die andere begriffen werden könne, aber diese Beziehung sei eine in einem höheren oder geringeren Maße äußerliche Beziehung. Man würde daher mit Recht sagen, dass in der Natur nicht die Freiheit, sondern die Notwendigkeit herrscht. Denn diese sei eben, in ihrer eigentlichen Bedeutung, die nur innerliche und deshalb auch nur äußerliche Beziehung von gegeneinander selbständigen Existenzen. 72 So würden z. B. das Licht und seine Bestandteile als gegeneinander selbständig erscheinen, und die Planeten, obwohl sie von der Sonne angezogen werden, hätten trotz dieses Verhältnisses zu ihrem Zentrum den Schein der Selbständigkeit gegenüber demselben.
Im Lebendigen käme allerdings eine höhere Notwendigkeit zustande, als jene die im Bereich des Leblosen herrsche. Schon in der Pflanze zeige sich, dass sie ein in die Peripherie ergossenes Zentrum, eine Konzentration der Unterschiede ist, dass sie sich von innen heraus entwickelt, eine Einheit ist, die sich selbst differenziert und aus ihren Differenzen in der Knospe sich selbst hervorbringt und somit etwas sei, dem wir Trieb zuschreiben würden. Aber diese Einheit bleibe eine unvollständige, weil im Gliederungsprozess der Pflanze das vegetabilische Subjekt aus sich heraustrete, jeder Teil die ganze Pflanze, eine Wiederholung derselben sei, die Glieder also nicht in vollkommener Unterwürfigkeit unter der Einheit des Subjekts stünden.
Eine noch vollständigere Überwindung der Äußerlichkeit stelle der tierische Organismus dar. In diesem erzeuge nämlich nicht nur jedes Glied das andere, sei dessen Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck, sondern das Ganze werde von seiner Einheit so durchdrungen, dass nichts in ihm als selbständig erscheine. Jede Bestimmtheit sei zugleich eine ideelle, das Tier bleibe in jeder Bestimmtheit dasselbe, das eine Allgemeine, so dass das Außereinander am tierischen Körper sich in seiner ganzen Unwahrheit zeige. Dadurch, dass das Tier in jeder Bestimmtheit bei sich und es in und aus seiner Äußerlichkeit unmittelbar in sich reflektiert sei, sei es eine für sich seiende Subjektivität und habe Empfindung.73 Diese sei die Allgegenwart der Einheit des Tieres in allen seinen Gliedern, die jeden Eindruck unmittelbar dem einen Ganzen mitteilen, das im Tier zu werden beginne. In dieser subjektiven Innerlichkeit des Tieres liege, dass es durch sich selbst, von innen heraus, und nicht bloß von außen bestimmt ist, d. h., dass es Trieb und Instinkt hat. Die Subjektivität des Tieres enthalte einen Widerspruch und den Trieb, diesen Widerspruch aufzuheben und dadurch sich selbst zu erhalten. Selbsterhaltung sei das Vorrecht des Lebendigen und in einem noch höheren Grad des Geistes.74
Die tierische Seele sei jedoch, so Hegel, noch nicht frei; erscheine sie doch immer als eins mit der Bestimmtheit der Empfindung oder der Erregung, als an eine Bestimmtheit gebunden. Nur in der Form der Einzelheit sei die Gattung für das Tier gegeben.75 Es empfinde nur die Gattung, aber wisse nichts von ihr. Im einzelnen Tier sei noch nicht die Seele für die Seele, das Allgemeine als solches für das Allgemeine. Durch das im Gattungsprozess stattfindende Aufheben der Besonderheit der Geschlechter komme das Tier nicht zum Erzeugen der Gattung, denn das, was durch diesen Prozess hervorgebracht wird, sei wieder nur ein Einzelnes.76 So falle die Natur selbst auf der höchsten Spitze ihrer Erhebung über die Endlichkeit (der Reproduktion, d. Verf.) wieder in diese zurück und stelle somit nur einen beständigen Kreislauf dar. Auch der durch den Widerspruch der Einzelheit und der Gattung notwendigerweise herbeigeführte Tod bringe gleichfalls nicht - weil er nur die leere selbst in der Form der unmittelbaren Einzelheit erscheinende, vernichtende Negation der Einzelheit, aber eben nicht deren erhaltende Aufhebung sei - die an und für sich seiende Allgemeinheit (einen objektiven Geist, d. Verf.) oder die an und für sich seiende Einzelheit, die Subjektivität, die sich selber zum Gegenstand hat (ein Ich, der. Verf.), hervor. Auch in der am meisten vollendeten Gestalt, zu der sich die Natur erhebe, also im tierischen Leben, gelange der Begriff77 nicht zu einer Wirklichkeit, die seinem Wesen als Seele 78 entspricht, nicht zur völligen Überwindung der Äußerlichkeit und Endlichkeit seines Daseins. Dieses geschehe erst im Geist, der eben durch diese in ihm selbst zustande kommende Überwindung sich selber von der Natur unterscheide, so dass diese Unterscheidung nicht bloß das Tun einer äußeren Reflexion über das Wesen des Geistes sei.
Diese zum Begriff des Geistes gehörende Aufhebung der Äußerlichkeit ist das, was Hegel die Idealität des Geistes nennt.79 Alle Tätigkeiten des Geistes seien nichts als verschiedene Weisen, wie die Äußerlichkeit in die Innerlichkeit, die der Geist selbst sei, zurückgeführt wird. Nur durch diese Idealisierung oder Assimilation des Äußerlichen werde er Geist und sei er Geist. Die Zurückführung des Äußerlichen auf das Innerliche findet, wie sich Hegel verstehen lässt, vor allem durch die Sprache statt, und zwar durch die Alltagssprache bis hin durch die Sprachen der Wissenschaften, der Religion, der Dichtung und der Literatur.80
Betrachtet man den Geist etwas näher, so ergebe sich, Hegel zufolge, als seine erste und einfachste Bestimmung, dass er ein Ich ist. Das Ich sei ein vollkommen Einfaches und Allgemeines. Sagen wir Ich, so würden wir wohl ein einzelnes Ich meinen, weil aber jeder ein Ich sei, würden wir damit nur etwas ganz Allgemeines ausdrücken.81 Die Allgemeinheit des Ichs bedeute, dass es von allem, selbst von seinem Leben abstrahieren kann. Der Geist sei aber nicht bloß das abstrakt Einfache, wenn von der Einfachheit der Seele im Gegensatz zur Zusammengesetztheit des Körpers die Rede war, sondern er sei trotz seiner Einfachheit ein in sich Unterschiedenes-, setze doch das Ich sich selbst gegenüber, mache es sich doch zu seinem Gegenstand und kehre aus diesem jedoch erst abstrakten und noch nicht konkreten Unterschied zur Einheit mit sich zurück. Dieses Bei-sich-selbst-sein des Ichs in seiner Unterscheidung mache die Unendlichkeit oder Idealität des Ichs aus.82 Diese Idealität würde sich aber erst bewähren in der Beziehung des Ichs zu dem ihm gegenüberstehenden, unendlich mannigfaltigen Stoff. Indem das Ich diesen Stoff erfasst, werde dieser von der Allgemeinheit des Ichs zugleich “vergiftet“ und “verklärt“, verliere sein vereinzeltes, selbständiges Bestehen und erhalte ein geistiges Dasein.83 Das Ich erfasst den Stoff, wie sich Hegel verstehen lässt, nur im Medium der Sprache.84 Und je nachdem mit welchem Sprachsystem, Wort- und Bedeutungsfeld, das Ich sich einem Stoff nähert, wird dieser, in den Worten Hegels, “vergiftet“ oder “verklärt“. So “vergiftet“ ein Geschäftsmann einen Wald, indem er ihn dem System der praktischen kommerziellen Sprache unterwirft, ihn damit lediglich als Roh- oder Brennstofflieferant betrachtet, ihn folglich abholzen lässt, um ihn als Ware zu verkaufen. Mit einer ganz anderen Sprache nähert sich dagegen demselben Wald ein romantischer Dichter, erfasst ihn in seiner Sprache und “verklärt“ ihn in seinem Gedicht. Geht man davon aus, dass jede Sprache die Intention eines Subjektes, sei es einer Gruppe, eines Volkes oder sei es einer Gesellschaft, einschließt, so übernimmt jeder, der diese Sprache erwirbt, stillschweigend die Intentionen85, die in ihr enthalten sind.
Aufgrund der unendlichen Mannigfaltigkeit seiner Vorstellungen werde der Geist, so Hegel, daher nicht aus seinem Beisichsein in ein räumliches Außereinander hineingetrieben, vielmehr würde sein einfaches Selbst in ungetrübter Klarheit jede Mannigfaltigkeit durchdringen und diese zu keinem selbständigen Bestehen kommen lassen. Alles, was von außen, dem räumlichen Außereinander, auf das Individuum einströmt, wird von diesem, wie sich Hegel verstehen lässt, durch die Sprache in seine Vorstellungen aufgenommen und wird damit ein raumloser Inhalt im Prozess der geistigen Verarbeitung.
Der Geist als ein endlicher Geist (als Beispiel könnte man einen Naturforscher anführen, d. Verf.) würde sich, so Hegel, nicht damit begnügen, durch seine vorstellende (der Anschauung folgenden, d. Verf.) Tätigkeit die Dinge (eingeordnet in einen bestimmten sprachlichen Bezugsrahmen, d. Verf.) in die Sphäre seiner Innerlichkeit zu versetzen und ihnen somit ihre Äußerlichkeit zu nehmen, vielmehr würde er als religiöses Bewusstsein durch die scheinbar absolute Selbständigkeit der Dinge zu der in ihrem Inneren wirksamen, alles zusammenhaltenden, unendlichen Macht Gottes dringen. Und als philosophisches Denken würde er jene Idealisierung der Dinge dadurch vollenden, dass er die bestimmte Weise erkennt, wie die ihr gemeinsames Prinzip bildende ewige Idee sich in ihnen darstellt. Durch diese Erkenntnis komme die schon im endlichen Geist sich betätigende idealistische Natur des Geistes zu ihrer vollendeten und konkretesten Gestalt, mache sich der Geist zu der sich selbst vollkommen erfassenden wirklichen Idee und damit zum absoluten Geist. Aber auch schon im endlichen Geist, wie er z. B. in den einzelnen Naturwissenschaften herrscht, beginnt, nach Hegel, bereits eine Rückkehr des Geistes aus der Natur, seiner äußersten Entäußerung, aber erst im absoluten Geist, also in der Naturphilosophie, vollendet sie sich. Denn erst im absoluten Geist, so Hegel, erfasse sich die Idee weder nur in der einseitigen Form des (subjektiven, d. Verf.) Begriffs oder der Subjektivität noch auch in der ebenso einseitigen Form der Objektivität oder der Wirklichkeit, sondern in der vollkommenen Einheit dieser ihrer unterschiedlichen Momente, d. h. in ihrer absoluten Wahrheit.
Das Hervorgehen des Geistes aus der Natur
Was Hegel oben über die Natur des Geistes gesagt hat, müsste, ihm zufolge, allein durch die Philosophie erwiesen werden, sei ein Erwiesenes und bedürfe einer Bestätigung durch unser gewöhnliches Bewusstsein nicht.86 Insofern aber unser nichtphilosophisches Denken darauf angewiesen ist, sich vom entwickelten Begriff des Geistes eine Vorstellung zu machen, könne daran erinnert werden, dass auch die christliche Theologie Gott, d. h. die Wahrheit, als Geist auffasst und diesen nicht als ein Ruhendes, in einem leeren Einerlei Verbleibendes, sondern als ein solches betrachtet, das notwendig in einen Prozess eintritt, in dem es sich von sich selbst unterscheidet, sein Anderes setzt und erst durch dieses Andere und die Aufhebung desselben zu sich selber kommt. Die Theologie würde in der Weise der Vorstellung diesen Prozess bekanntlich so ausdrücken, dass Gott der Vater (dieses einfach Allgemeine, Insichseiende), seine Einsamkeit aufgibt und die Natur (das Sichselbstäußerliche, Außersichseiende) erschafft, sodann einen Sohn (sein anderes Ich) erzeugt, in diesem Anderen aber kraft seiner unendlichen Liebe sich selbst anschaut, sein Ebenbild erkennt und in diesem zur Einheit mit sich zurückkehrt. Diese sei nicht mehr eine abstrakte, unmittelbare, sondern eine konkrete, durch den Unterschied vermittelte Einheit, es sei der vom Vater und vom Sohne ausgehende, in der christlichen Gemeinde zu seiner vollkommenen Wirklichkeit und Wahrheit gelangende Heilige Geist. Als solcher müsse Gott erkannt werden, soll er in seiner absoluten Wahrheit, als an und für sich seiende Idee, in der vollen Übereinstimmung seines Begriffs und seiner Wirklichkeit erfasst werden.
Da die Beziehungen zwischen Natur und Geist, Hegel zufolge, häufig missverstanden worden seien, kehrt er noch einmal zu diesem Punkt zurück.87 Der Geist, so erläutert er, negiere die Äußerlichkeit der Natur, assimiliere sich die Natur und idealisiere sie dadurch. Diese Idealisierung (die Aufhebung ihrer Äußerlichkeit, d. Verf.) habe im endlichen Geist, der die Natur außer sich setze, eine einseitige Gestalt. Hier stehe nämlich der Tätigkeit unseres Willens und unseres Denkens ein äußerlicher Stoff gegenüber, der sich gegenüber der Veränderung, die wir mit ihm vornehmen, gleichgültig verhalte, mehr noch, die ihm zuteilwerdende Idealisierung als leidend erfahre. Man kann hier als Beispiel ein Rind anführen, das als Nutztier, schlimmer noch, als bloßes Produktionsmittel bezeichnet, verstanden und dementsprechend behandelt wird. Bei dem die Weltgeschichte hervorbringenden Geist aber finde dagegen, wie Hegel fortfährt, ein anderes Verhältnis statt; stehe doch dort nicht mehr auf der einen Seite eine dem Gegenstand äußerliche Tätigkeit und auf der anderen ein bloß leidender Gegenstand, sondern die geistige Tätigkeit richte sich auf einen in sich selber tätigen Gegenstand, und zwar auf einen solchen, der sich zu dem, was durch jene Tätigkeit hervorgebracht werden soll, selbst heraufgearbeitet hat, so dass in der Tätigkeit und im Gegenstand ein und derselbe Inhalt vorhanden sei. So seien z. B. das Volk und die Zeit, auf die Alexander und Cäsar als auf ihren Gegenstand handelnd einwirkten, durch sich selbst zu dem fähig geworden, was beide vollbringen wollten. Die Zeit würde ebenso sehr jene Männer hervorbringen, wie sie von diesen hervorgebracht werde. Diese Männer seien ebenso die Werkzeuge des Geistes ihrer Zeit und ihres Volkes gewesen, wie umgekehrt diesen Helden ihr Volk als Werkzeug dazu gedient hätte, ihre Taten zu vollbringen.
Ähnlich dem soeben geschilderten Verhältnis sei die Weise, wie sich der philosophierende Geist zur äußeren Naturverhält. Dieser erkenne nämlich, dass die Natur nicht bloß von uns idealisiert wird und dass das Außereinander88 derselben nicht etwas ist, was für sie selber, für ihren Begriff, durchaus unüberwindlich ist. Vielmehr bewirke die der Natur innewohnende ewige Idee, der in ihrem Inneren arbeitende an sich seiende Geist, selber die Idealisierung, die Aufhebung des Außereinander; denn diese Form seines Daseins stehe mit der Innerlichkeit seines Wesens in einem Widerspruch. Die Philosophie brauche also nur zuzusehen, wie die Natur selber ihre Äußerlichkeit aufhebt, das Sichselbstäußerliche in das Zentrum der Idee zurücknimmt oder dieses Zentrum im Äußerlichen hervortreten lässt, den in ihr verborgenen Begriff von der Decke der Äußerlichkeit befreit und damit die äußerliche Notwendigkeit 89 überwindet. Dieser Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit sei nicht ein einfacher, sondern ein Stufengang von vielen Momenten, der in der Naturphilosophie dargestellt werde.90 Auf der höchsten Stufe dieser Aufhebung des Außereinander, nämlich in der Empfindung (wie sie zunächst, wie schon erwähnt, in der Tierwelt, aber auch auf der Stufe eines Menschen gegeben ist, auf der dieser noch in seiner “natürlichen“ Seele (Hegel) gefangen ist, d. Verf.) komme der in der Natur gefangen gehaltene und an sich seiende Geist zum Beginn seines Fürsichseins und damit zu seiner Freiheit. Durch dieses aber noch mit der Form der Einzelheit und Äußerlichkeit, noch mit der Unfreiheit behaftete Fürsichsein werde die Natur über sich hinaus zum Geist als solchem fortgetrieben, und zwar zu dem durch das Denken in der Form der Allgemeinheit (der Sprache, d. Verf.) für sich seienden, wirklich freien Geist. Der nur empfindende Mensch ist also nach Hegel nur ein vereinzeltes Wesen, erst mit dem Erwerb der Sprache als einer Allgemeinheit und damit der Fähigkeit, zu denken und zu kommunizieren tritt er in die menschliche Gesellschaft ein.
Nach Hegel dürfe das Hervorgehen des Geistes aus der Natur, wie schon ausgeführt, nicht in dem Sinne verstanden werden, als ob die Natur das absolut Unmittelbare, Erste, ursprünglich Setzende, während der Geist nur ein von ihr Gesetztes ist. Vielmehr sei die Natur vom Geist gesetzt, und dieser sei damit das absolut Erste. Der an und für sich seiende Geist91 sei eben nicht das bloße Resultat der Natur, sondern in Wahrheit sein eigenes Resultat. Er bringe sich selber aus den Voraussetzungen, die er sich selbst macht, aus der logischen Idee und der äußeren Natur, hervor und sei die Wahrheit sowohl jener als auch dieser Idee, d. h. die wahre Gestalt des nur in sich (logische Idee, d. Verf.) seienden und des nur außer sich seienden Geistes (Idee der Natur, d. Verf.). Der Schein, als ob der Geist durch ein Anderes vermittelt wird, werde vom Geist selber aufgehoben, weil dieser die “souveräne Undankbarkeit“ (Hegel92) habe, dasjenige, wodurch er vermittelt erscheint, aufzuheben, zu etwas herabzusetzen, das nur durch ihn besteht, um sich auf diese Weise vollkommen selbständig zu machen.
Aus dem Gesagten gehe schon hervor, dass der Übergang der Natur zum Geist nicht ein solcher zu etwas ganz anderem, sondern nur ein Zusichselberkommen des in der Natur außer sich seienden Geistes ist. Ebenso wenig werde aber durch diesen Übergang der bestimmte Unterschied der Natur und des Geistes aufgehoben, denn der Geist gehe nicht auf natürliche Weise aus der Natur hervor. Wenn im Paragraphen § 22293 gesagt wurde, der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit sei das Hervorgehen des Geistes, so sei dieser Vorgang nicht fleischlich, sondern geistig, nicht im Sinne eines natürlichen Hervorgehens, sondern im Sinne einer Entwicklung des Begriffs zu verstehen, der die Einseitigkeit der Gattung aufhebe, die nicht zu einer angemessenen Verwirklichung komme, vielmehr im Tode sich als eine negative Macht gegenüber jener Wirklichkeit erweise.94 Zugleich hebe der Begriff die jener gegenüberstehende Einseitigkeit des an die Einzelheit gebundenen tierischen Daseins in der an und für sich allgemeinen Einzelheit auf oder, was auf dasselbe hinauslaufe, in dem auf allgemeine Weise für sich seienden Allgemeinen, das der Geist sei.95 Mit anderen Worten, der Mensch teilt mit dem Tier zwar das Schicksal, dass er Angehöriger einer natürlichen Gattung ist, die nur im Einzelnen und besonderen Menschen ihr Dasein hat, sich jedoch im Tod als die Macht über diesen erweist. Gleichwohl unterscheidet sich die menschliche von jeder tierischen Gattung, indem jene über die Sprache verfügt. Es gibt aber keine Entwicklung des Menschen von einem natürlichen Gattungswesen hin zu einem geistigen Wesen, vielmehr ist er von vornherein beides zugleich. Demgemäß leben die Menschen nicht als Vereinzelte, gleichsam wie Tiere einer bestimmten Gattung, die nur im Geschlechtsverhältnis (und in einer einfachen Arbeitsteilung) zueinander finden, sondern in einer von Sprache und normativen Ordnungen, also von einer geistigen Kultur konstituierten gesellschaftlichen Totalität (Familiengesellschaften, Stämme, Völker, Nationen, Staaten und Staatenvereine), und nur in einer solchen können sie sich individualisieren. Der Mensch, so Marx, sei im wörtlichen Sinn ein “Zoon politikon“, also nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich vereinzeln kann.96
Die Natur als solche komme, wie Hegel fortfährt, in ihrer Selbstverinnerlichung, so Hegel, nicht zu diesem Fürsichsein, zum Bewusstsein ihrer selbst. Das Tier, die vollendete Form dieser Verinnerlichung in der Natur, stelle nur die geist-lose Dialektik des Übergehen von einer einzelnen, seine ganze Seele ausfüllenden Empfindung zu einer anderen, ebenso ausschließlich in ihm herrschenden einzelnen Empfindung dar. Erst der Mensch würde sich über die Einzelheit der Empfindung zur Allgemeinheit des Gedankens erheben - durch Sprache und sprachliche Kommunikation, wie man Hegels Worte ergänzen könnte - hin zum Wissen von sich selbst, zum Erfassen seiner Subjektivität, seines Ich.97 Mit einem Wort, erst der Mensch sei der denkende Geist, und allein dadurch sei er wesentlich von der Natur unterschieden. Was der Natur als solcher angehöre, liege hinter dem Geist. Er habe zwar in sich selbst den ganzen Gehalt der Natur, aber die Naturbestimmungen seien am Geiste auf eine durchaus andere Weise als in der äußeren Natur.98 So schließt z. B. eine menschliche Handlung den natürlichen Organismus ein, das Eigentümliche und Zentrale an der Handlung sind aber Sinn, Beweggrund, Ideologie und dergleichen. Der Organismus gehört nur zur Situation, den Bedingungen des Handelns. 99 Auch bei der Hervorbringung eines Kunstwerks würde man nicht die dazu erforderlichen Materialien, die Nervenanspannung oder die physische Energie des Künstlers, sondern den Sinn als wesentlich ansehen, den dieser damit verbindet, und die allgemeine Stilrichtung als Teil der Kultur oder des “absoluten Geistes“ (Hegel).
Wenn auch Hegel Natur und Geist als zwei einander extrem entgegen gesetzte Welten setzt, um sodann diese Entgegensetzung wieder aufzuheben, um die Welt als ein Ganzes zu denken, so gibt es, ihm zufolge, wie schon angedeutet, keine Entwicklung vom Tier hin zum Menschen, also zum Bewusstsein und zum Denken. 100 Eine Entwicklung gibt es für Hegel überhaupt nur in der Welt des Geistes, mithin der menschlichen Geschichte.
Die Freiheit als das Wesen des Geistes
Das Wesen des Geistes sei deswegen101, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, formal die Freiheit, die absolute Negativität des Begriffs (mit Bezug auf die Natur, d. Verf.) als Identität mit sich.102 Gemäß dieser formalen (abstrakten, d. Verf.) Bestimmung des Geistes könne dieser von allem Äußerlichen und seiner eigenen Äußerlichkeit, seinem Dasein, selbst abstrahieren. Er könne die Negation seiner individuellen Unmittelbarkeit, den unendlichen Schmerzertragen, d. h. in dieser Negativität sich affirmativ erhalten und identisch für sich sein.103 Diese Möglichkeit sei seine Allgemeinheit (das einzelne Ich, d. Verf.), die abstrakt und für sich ist.104
Die Substanz des Geistes sei, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert, die Freiheit, was bedeute, dass der Geist nicht von einem Anderen (etwa der Natur, d. Verf.) abhängig ist, dass er sich nur auf sich selbst bezieht.105 Der Geist sei der Begriff, der für sich selbst ist, sich selbst zum Gegenstand hat (als subjektiver Geist z. B. ist er Bewusstsein, Selbstbewusstsein, theoretischer und praktischer Geist, d. Verf.) und verwirklicht ist (als objektiver Geist z. B. ist er Recht, Moralität und Sittlichkeit, d. Verf.).106 In dieser in ihm vorhandenen Einheit von Begriff und Objektivität107 bestehe zugleich seine Wahrheit und Freiheit. Die Wahrheit mache den Geist, wie Hegel Christus zitiert, frei, und die Freiheit mache ihn wahr. Die Freiheit des Geistes sei aber nicht bloß eine außerhalb des Anderen (der Natur, d. Verf.), sondern eine im Anderen errungene Unabhängigkeit vom Anderen. Der Geist komme nicht durch die Flucht vordem Anderen, sondern dadurch, dass er das Andere überwindet zur Wirklichkeit.108 Der Geist könne aus seiner abstrakten für sich seienden Allgemeinheit, aus seiner einfachen Bezogenheit auf sich, heraustreten, einen bestimmten, wirklichen Unterschied, ein Anderes, als das einfache Ich ist, somit ein Negatives in sich selbst setzen.109 Diese Beziehung auf das Andere (die Natur, d. Verf.), das er in sich setzt (z. B. als Objekt in seinem Bewusstsein, d. Verf.) sei dem Geist nicht nur möglich, sondern sogar notwendig, weil er durch das Andere und durch die Aufhebung desselben dahin komme, sich als dasjenige zu bewähren und zu sein, was er seinem Begriff nach sein soll, nämlich die Idealität des Äußerlichen (der Natur, d. Verf.), die aus ihrem Anderssein110 in sich zurückkehrende Idee. Abstrakter ausgedrückt heiße das: Der Geist soll das sich selbst Unterscheidende und in seinem Unterschied das bei sich und das für sich seiende Allgemeine sein.111 Das Andere, das Negative, der Widerspruch, die Entzweiung würden also zur Natur des Geistes gehören, und in dieser Entzweiung liege die Möglichkeit des Schmerzes. Der Schmerz sei daher nicht von außen an den Geist gekommen, wie man glaubte, wenn man sich die Frage stellte, auf welche Weise Schmerz in die Welt gekommen ist. Ebenso wenig wie der Schmerz komme das Böse, das Negative des an und für sich seienden unendlichen Geistes, von außen an den Geist heran. Das Negative sei vielmehr nichts anderes als der Geist selbst, indem er sich auf die Spitze seiner Einzelheit stellt. Selbst in dieser seiner höchsten Entzweiung, wenn er sich von der Wurzel seiner an sich seienden sittlichen Natur losreißt, in diesem vollsten Widerspruch mit sich selbst, bleibe daher der Geist doch mit sich identisch und daher frei. Der Geist habe die Kraft, sich im Widerspruch, folglich im Schmerz (sowohl über das Böse als auch über das Üble) zu erhalten. Die gewöhnliche Logik würde daher irren, indem sie meint, der Geist sei etwas, was den Widerspruch ausschließt. Alles Bewusstsein enthalte vielmehr eine Einheit und eine Getrenntheit (z. B. einerseits das Ich und andererseits den ihm gegenüberstehenden Gegenstand als das Andere, d. Verf.), somit einen Widerspruch. Denkt man in diesem Zusammenhang an die modernen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, an das Böse und den Schmerz, den sie verursacht haben, so muss man sich eingestehen, dass auch sie von dem einen menschlichen Geist, genauer noch, von einzelnen Menschen, Gruppen und Bewegungen hervorgebracht worden sind, die sich, in Hegels Worten, auf die Spitze ihrer Einzelheit stellten.
Der Widerspruch werde aber vom Geist ertragen, weil dieser keine Bestimmung in sich habe, die nichtvon ihm selbst gesetzt ist, von der er folglich nichts weiß, und die er nicht auch wieder aufheben kann. Diese Macht über allen in ihm vorhandenen Inhalt bilde die Grundlage der Freiheit des Geistes. In seiner Unmittelbarkeit (etwa als natürliche Seele, d. Verf.) sei der Geist aber nur an sich, dem Begriff oder der Möglichkeit nach, aber noch nicht der Wirklichkeit nach frei. Die wirkliche Freiheit sei also nicht etwas, was unmittelbar (etwa von der Geburt des Einzelnen an, d. Verf.) im Geist da ist, sondern etwas, was durch seine Tätigkeit hervorzubringen ist. Als denjenigen, der seine Freiheit selber hervorbringt, müssten wir in der Wissenschaft den Geist betrachten. Die ganze Entwicklung des Begriffs des Geistes stelle nur eine Selbstbefreiung des Geistes von allen Formen seines Daseins dar, die nicht seinem Begriff entsprechen. Es sei eine Befreiung, die dadurch zustande komme, dass diese Formen zu einer Wirklichkeit umgebildet werden, die dem Begriff des Geistes vollkommen angemessen ist. Wie sich der Geist von den Formen, die seinem Begriff noch nicht entsprechen, frei macht, stellt Hegel u. a. in seiner Theorie des subjektiven Geistes dar.
Manifestation des Geistes
Die abstrakte für sich seiende Allgemeinheit, worunter wir das Ich verstehen, das jedem Menschen zugeschrieben wird und das jeder sich selber zuschreibt, ist, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, auch das Dasein des Geistes. 112 Als für sich seiend, besondere sich das Allgemeine (in eine Vielfalt einzelner Ich, d. Verf.) und sei in dieser Besonderung mit sich identisch.113 Die Bestimmtheit des Geistes sei daher die Manifestation. 114 Es gebe vom Geist nicht irgendeine Bestimmtheit oder Inhalt, dessen Äußerung oder Äußerlichkeit eine von ihm unterschiedene Form hat. Demzufolge offenbart er nicht bloß etwas, vielmehr sind seine Bestimmtheit und sein Inhalt dieses Offenbaren selbst. In der Form manifestiert sich demnach, Hegel zufolge, vollständig der Inhalt, nichts von ihm bleibt jenseits der Form verborgen. Das, was im Geist möglich ist, sei daher, so Hegel, unmittelbar unendliche, absolute Wirklichkeit
Es wurde bereits, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert, die unterscheidende Bestimmtheit des Geistes in der Idealität gesehen, und zwar in der Aufhebung des Anderssein der Idee (der Natur, d. Verf.).115 Wenn nun soeben die “Manifestation“ als die Bestimmtheit des Geistes angegeben wurde, so sei die Idealität keine neue, zweite Bestimmung des Geistes, sondern nur eine Fortentwicklung der früher besprochenen Bestimmung. Denn durch Aufhebung des Anderssein der Idee (der Natur, d. Verf.) werde die logische Idee oder der an sich seiende Geist für sich, d. h. sich offenbar. Der für sich seiende Geist, d. h. der Geist als solcher, sei also - im Unterschied von dem sich selber unbekannten, nur uns offenbaren, in das Außereinander der Natur ergossenen, an sich seienden Geist - das, was sich nicht bloß einem Anderen, sondern sich selber sich offenbart. Oder, was auf dasselbe hinauslaufe, er vollbringe seine Offenbarung in seinem eigenen Element und nicht in einem ihm fremden Stoff. Diese Bestimmung komme dem Geist als solchem zu, und sie gelte daher vom Geist nicht nur, weil er sich einfach auf sich bezieht, ein Ich ist, das sich selber zum Gegenstand hat, sondern auch, weil er aus seiner abstrakten für sich seienden Allgemeinheit (seiner “Ichheit“, d. Verf.) heraustritt und eine bestimmte Unterscheidung, ein Anderes (z. B. die Natur, d. Verf.) als er ist, in sich selbst setzt. Denn der Geist verliere sich nicht in diesem Anderen, er erhalte und verwirkliche sich vielmehr darin und präge sein Inneres darin aus. Er mache das Andere zu einem ihm entsprechenden Dasein, komme also durch diese Aufhebung des Anderen, des bestimmten wirklichen Unterschiedes, zum konkreten Fürsichsein, dazu, sich offenbar zu werden. Der Geist offenbare daher im Anderen nur sich selber, seine eigene Natur, die eben darin bestehe, sich selbst zu offenbaren. So offenbart sich z. B. der Geist eines Menschen darin, dass er die Natur als sein Anderes von sich unterscheidet, dieses Andere sodann aufhebt, indem er sich darin verwirklicht oder sein Inneres darin ausprägt
Wenn der Geist sich selber offenbart, so sei das, Hegel zufolge, der Inhalt des Geistes selbst und nicht nur eine äußerlich zum Inhalt hinzutretende Form. Durch seine Offenbarung stelle folglich der Geist nicht einen von seiner Form verschiedenen Inhalt heraus, sondern seine, den ganzen Inhalt des Geistes ausdrückende Form; er offenbare sich eben ganz und gar selbst. Form und Inhalt seien also im Geist miteinander identisch. Gewöhnlich würde man sich jedoch das Offenbaren als eine leere Form vorstellen, zu der noch von außen der Inhalt hinzutreten müsste. Unter dem Inhalt verstünde man etwas, was in sich sei, sich in sich halte, unter der Form dagegen die äußerliche Beziehung des Inhalts auf ein Anderes. In der spekulativen Logik dagegen werde aber bewiesen, dass in Wahrheit der Inhalt nicht bloß ein Insichseiendes, sondern ein durch sich selbst mit Anderem in Beziehung Tretendes ist. Umgekehrt sei die Form in Wahrheit nicht ein bloß Unselbständiges, also dem Inhalt Äußerliches, sondern dasjenige, was den Inhalt zum Inhalt, zu seinem Insichseienden, von einem Anderen Unterschiedenen macht. Der wahrhafte Inhalt enthalte also in sich selbst die Form, und die wahrhafte Form sei ihr eigener Inhalt. Und so müsse man den Geist als diesen wahrhaften Inhalt und als diese wahrhafte Form erkennen.116 Als Beispiel führt Hegel die christliche Lehre an, um die im Geist vorhandene Einheit von Form und Inhalt, von Offenbarung und Offenbartem, für die Vorstellung zu erläutern. So sage das Christentum, Gott habe sich durch Christus, seinen eingeborenen Sohn, offenbart. In der Vorstellung werde jener Satz zunächst so verstanden, als ob Christus nur das Organ dieser Offenbarung, als ob das auf diese Weise Offenbarte ein Anderes als das Offenbarende sei. Jener Satz habe aber in Wahrheit den Sinn, Gott habe offenbart, dass seine Natur darin besteht, einen Sohn zu haben. Das bedeute, dass er sich unterscheidet, sich endlich macht, in seinem Unterschied aber bei sich selbst bleibt, in seinem Sohn sich selber anschaut und offenbart und durch diese Einheit mit dem Sohn, durch dieses Fürsichsein in seinem Anderen, absoluter Geist ist, so dass der Sohn nicht das bloße Organ der Offenbarung, sondern der Inhalt der Offenbarung selbst ist.
Ebenso wie der Geist die Einheit von Form und Inhalt sei, sei er auch, wie Hegel fortfährt, die Einheit von Möglichkeit und Wirklichkeit. Unter dem Möglichen sei das noch Innerlichezu verstehen, das noch nicht zur Äußerung, zur Offenbarung gelangt ist. Der Geist als solcher sei aber nur, wie schon ausgeführt, insofern er sich selber sich offenbart. Die Wirklichkeit, die eben in seiner Offenbarung bestehe, gehöre daher zu seinem Begriff. Im endlichen Geist (z. B. im Bewusstsein des Einzelnen oder in einer Verstandeswissenschaft, etwa in Gestalt der Politischen Ökonomie, d. Verf.) komme allerdings der Begriff des Geistes noch nicht zu seiner absoluten Verwirklichung. Es sei der absolute Geist, der die absolute Einheit der Wirklichkeit und des Begriffs oder der Möglichkeit des Geistes darstellt. Dieser hat die Gestalt, wie man ergänzen kann, insbesondere die Gestalt der Philosophie wie sie Hegel versteht.
Das Offenbaren, das als das Offenbaren der abstrakten (logischen) Idee unmittelbarer Übergang, Werden der Natur sei, sei, so Hegel nach diesem Zusatz, als Offenbaren des Geistes, der frei sei, das Setzen der Natur als seiner Welt.117 Es sei ein Setzen, das als Reflexion zugleich das Voraussetzen der Welt als selbständiger Natur ist.118 Das Offenbaren im Begriff sei Erschaffen der Natur als seines Seins, in dem er sich die Affirmation und Wahrheit seiner Freiheit gebe.119
Das Absolute ist, wie Hegel bekräftigt, der Geist, und dies sei die höchste Definition des Absoluten.120 Das Finden dieser Definition und das Begreifen ihres Sinns und Inhalts, dies sei die absolute Tendenz aller Bildung und Philosophie gewesen. Auf eben diesen Punkt hin hätten alle Religion und Wissenschaft hingedrängt, und aus diesem Drang allein müsse die Weltgeschichte begriffen werden. Das Wort “Geist“ und die damit verbundene Vorstellungseien früh gefunden, und der Inhalt der christlichen Religion laufe darauf hinaus, Gott als Geist zu erkennen. Das, was hier in der Vorstellunggegeben und was an sich das Wesen sei, müsse aber in seinem eigenen Element, nämlich dem (spekulativen, d. Verf.) Begriff gefasst werden, und eben dies sei die Aufgabe der Philosophie, eine Aufgabe, die so lange nicht wahrhaft und immanent gelöst sei, als der Begriff und die Freiheit nicht ihr Gegenstand und ihre Seele geworden sind.
Dass der Geist sich offenbart, das sei, wie Hegel im anschließenden Zusatz erläutert, eine ihm überhaupt zukommende Bestimmung.121 Dieser Vorgang habe aber drei unterschiedene Formen: Die erste Form122, wie sich der an sich seiende Geist oder die logische Idee offenbart, bestehe darin, dass die Idee in die Unmittelbarkeit äußerlichen und vereinzelten Daseins umschlägt und dieses Umschlagen sei das Werden der Natur.123 Auch die Natur sei, so Hegel, ein Gesetztes, aber so wie sie gesetzt sei, habe sie die Form der Unmittelbarkeit, des Seins, das der Idee äußerlich sei.124 Diese Form widerspreche aber der Innerlichkeit der Idee als sich selbst setzende und aus ihren Voraussetzungen sich selbst hervorbringende. Die Idee oder der in der Natur schlafende, an sich seiende Geist hebe deshalb die Äußerlichkeit, Vereinzelung und Unmittelbarkeit der Natur auf, schaffe sich ein Dasein, das seiner Innerlichkeit und Allgemeinheit entspricht, und werde dadurch der in sich reflektierte, für sich seiende, selbstbewusste, erwachte Geist oder der Geist als solcher.125
Mit diesem sei, wie Hegel fortfährt, die zweite Form126 der Offenbarung des Geistes gegeben. Auf dieser Stufe stelle der Geist, der nicht mehr in das Außereinander der Natur (in Raum und Zeit, d. Verf.) ergossen sei, sich als das dar, was er für sich und sich offenbar ist gegenüber der bewusstlosen Natur, die den Geist ebenso verhülle wie sie ihn offenbare. Dieser mache sich die Natur zum Gegenstand, reflektiere über sie, nehme die Äußerlichkeit der Natur in seine Innerlichkeit zurück, idealisiere die Natur und werde so in seinem Gegenstand für sich. Aber dieses erste Fürsichsein des Geistes - Hegel meint offensichtlich den Geist der modernen Naturwissenschaften - sei selbst noch ein unmittelbares, abstraktes, noch nicht ein absolutes Fürsichsein; denn durch jenes abstrakte Fürsichsein werde der Geist in seinem Außersichselbstsein (also in der Natur, d. Verf.) noch nicht absolut aufgehoben (was erst in der Naturphilosophie geschieht, d. Verf.). Der erwachende Geist erkenne hier nämlich noch nicht seine Einheit mit dem in der Natur verborgenen, an sich seienden Geist (etwa den Selbstzweck, den inneren Sinn in der Natur, d. Verf.), stehe daher zur Natur in einer nur äußerlichen Beziehung, erscheine nicht als das, was alles in allem ist, sondern nur als die eine Seite des Verhältnisses. Zwar sei er in seinem Verhältnis zu dem Anderen (zur Natur, d. Verf.) in sich reflektiert und somit Selbstbewusstsein, lasse aber diese Einheit von Bewusstsein und Selbstbewusstsein noch als eine äußerliche, leere, oberflächliche Einheit bestehen.127 Deshalb fielen die beiden Formen des Bewusstseins noch auseinander, und der Geist, obwohl er bei sich selber sei, sei zugleich nicht bei sich selber, sondern bei einem Anderen; seine Einheit mit dem im Anderen (in der Natur, d. Verf.) wirksamen an sich seienden Geist werde nämlich noch nicht für ihn.128
Der Geist setze hier die Natur als eine Sphäre, die in sich reflektiert, seine Welt ist, er nehme der Natur die Form eines ihm gegenüber Anderen und mache das ihm gegenüberstehende Andere zu einem von ihm Gesetzten. Zugleich aber bleibe dieses Andere noch ein von ihm Unabhängiges, ein unmittelbar Vorhandenes, vom Geiste nicht Gesetztes, sondern nur Vorausgesetztes; das Andere bleibe also ein solches, das (als Gegenstand des analytischen Erkennens, d. Verf.) gesetzt wird und dem reflektierenden Denken vorausgeht. Dass die Natur durch den Geist gesetzt wird, sei auf diesem Standpunkt somit noch nicht als ein absolutes, sondern nur als ein im reflektierenden Bewusstsein zustande kommendes Gesetztsein zu verstehen. Die Natur werde daher noch nicht als nur durch den unendlichen Geist bestehend, als seine Schöpfung begriffen. Der Geist habe folglich hier noch eine Schranke an der Natur und sei eben durch diese Schranke endlicher Geist.
Diese Schranke werde nun im absoluten Wissen129 aufgehoben, das, Hegel zufolge, die dritte und höchste Form130 der Offenbarung des Geistes sei. Auf dieser Stufe verschwinde der Dualismus einer selbständigen Natur oder des in das Außereinander ergossenen Geistes einerseits und des Geistes, der erst beginnt, für sich zu werden, aber seine Einheit mit jenem noch nicht begreift, andererseits. Der absolute Geist erfasse sich als selber das Sein setzend, als selber sein Anderes, die Natur und den endlichen Geist (z. B. die normativen Ordnungen der Gesellschaft oder die Einzelwissenschaften d. Verf.) hervorbringend, so dass dieses Andere jeglichen Schein der Selbständigkeit ihm gegenüber verliere; es höre vollkommen auf, eine Schranke für ihn zu sein und erscheine nur als das Mittel, durch das der Geist zum absoluten Fürsichsein, zur absoluten Einheit seines Ansichseins und seines Fürsichseins, seines Begriffs und seiner Wirklichkeit, gelange.
Die höchste Definition des Absoluten sei, so Hegel, die, dass das Absolute nicht nur überhaupt der Geist, sondern dass es der sich absolut offenbare, selbstbewusste, unendlich schöpferische Geist ist, der soeben als die dritte Form des Offenbarens bezeichnet worden sei. Wie in der Wissenschaft von den erwähnten unvollkommenen Formen der Offenbarung des Geistes zur höchsten Form derselben fortgeschritten werde, so würde auch die Weltgeschichte eine Reihe von Auffassungen, die sich auf das Ewige beziehen, hervorbringen, an deren Schluss erst der Begriff der absoluten Freiheit hervortrete.131
Hegel wendet sich dann den verschiedenen, in der Weltgeschichte aufgetretenen Religionen zu. So blieben die orientalischen Religionen, auch die jüdische Religion, noch beim abstrakten Begriff Gottes und des Geistes stehen, was sogar die Aufklärung täte, die auch von Gott dem Vater wissen wolle. Gott der Vater für sich sei das in sich Verschlossene, Abstrakte, also der noch nicht wahrhaftige Gott. In der griechischen Religion habe Gott allerdings angefangen, auf bestimmte Weise offenbar zu werden. Die Darstellung der griechischen Götter habe zum Gesetz die Schönheit, die zum Geistigen gesteigerte Natur, gehabt. Das Schöne bleibe nicht ein abstrakt Ideelles, sondern sei in seiner Idealität vollkommen bestimmt, individualisiert. Jedoch seien die griechischen Götter zunächst nur für die sinnliche Anschauung oder nur für die Vorstellung dargestellt und noch nicht in Gedanken gefasst. Das sinnliche Element könne aber die Totalität des Geistes nur als ein Außereinander, als einen Kreis individueller geistiger Gestalten darstellen. Die diese Gestalten zusammenfassende Einheit bleibe daher eine den Göttern gegenüberstehende, unbestimmte fremde Macht. Erst durch die christliche Religion sei die in sich selber unterschiedene eine Natur Gottes, die Totalität des göttlichen Geistes, in der Form der Einheit offenbart worden. Diesen zunächst nur in der Form der Vorstellungvorhandene Inhalt habe die Philosophie in die Form des Begriffs oder des absoluten Wissens zu erheben, das die höchste Form der Offenbarung jenes Inhalts sei. Das absolute Wissen ist nach Hegel ein Wissen, in dem jegliche Gegenständlichkeit (oder Dingheit) aufgehoben ist. Es sei das allgemeine Selbstbewusstsein des Geistes oder der Menschheit, das erst auftreten könne, wenn sich der Weltgeist vollendet hat.132
3.2 Einteilung der Welt des Geistes133
Nachdem Hegel den Begriff des Geistes bestimmt hat, schreitet er zur Einteilung seines Gegenstandes fort. Danach bestehe die Entwicklung des Geistes darin, erstens, dass er in der Form der Beziehung auf sich selbst ist und darin, dass innerhalb seiner die ideelle Totalität der Idee zur Entfaltung kommt; das besage, dass das, was seinen Begriff ausmacht, auch für ihn wird und ihm sein Sein eben dies ist, bei sich und damit frei zu sein. Das ist für Hegel der subjektive Geist.
Die Entwicklung des Geistes bestehe zweitens darin, dass er in der Form der Realität134 eine Welt ist, die von ihm sowohl hervorzubringen als auch hervorgebracht ist und in der die Freiheit als eine vorhandene Notwendigkeit herrscht. Das ist für Hegel der objektive Geist.
Die Entwicklung des Geistes bestehe drittens darin, dass er in an und für sich seiender und ewig sich hervorbringender Einheit der Objektivität des Geistes und seiner Idealität, seines Begriffs, also der Geist in seiner absoluten Wahrheit ist. Das ist nach Hegel der absolute Geist, und er denkt dabei u. a. offensichtlich an die Philosophie, die sich als begreifendes Erkennen der Idee des Geistes am Ende selbst reflektiert.
Der subjektive Geist
Der Geist ist, wie Hegel hierzu in einem Zusatz erläutert, immer Idee.135 Zunächst sei er aber lediglich der Begriff der Idee oder die Idee in ihrer Unbestimmtheit, in der abstraktesten Weise der Realität, d. h. nur in der Weise des bloßen Seins.136 Am Anfang hätten wir es nur mit der ganz allgemeinen, unentwickelten Bestimmung des Geistes und nicht schon mit dem Besonderen desselben zu tun. Dieses bekämen wir erst, wenn wir von einem zu einem anderen (z. B. von der Seele zum Bewusstsein, d. Verf.) übergehen; enthalte doch das Besondere Eines und ein Anderes, ein Übergang, den wir zu Anfang noch nicht vollzogen hätten. Die Realität des Geistes sei also zunächst noch eine ganz allgemeine, noch nicht eine besonderte (abgesonderte, d. Verf.) Realität. Die Entwicklung dieser Realität werde erst durch die ganze Philosophie des Geistes vollendet. 137 Die noch ganz abstrakte, unmittelbare Realität, sei aber die Natürlichkeit, das noch Un-(Vor-)geistige. So sei das Kind noch in seiner Natürlichkeit gefangen, habe nur natürliche Triebe, sei noch nicht der Wirklichkeit, sondern nur der Möglichkeit oder dem Begriff nach ein geistiger Mensch.
Die erste Realität des Begriffs des Geistes müsse demnach, eben weil sie noch eine abstrakte, unmittelbare, der Natürlichkeit angehörende sei, als die dem Geiste noch am wenigsten angemessene Realität (gemeint ist offensichtlich die „natürliche Seele“, d. Verf.) bezeichnet werden. Die wahrhafte Realität aber müsse als die Totalität der entwickelten Momente des Begriffs des Geistes bestimmt werden, der die Seele, die Einheit dieser Momente, bleibe.138 Zu dieser Entwicklung seiner Realität schreite der Begriff des Geistes mit Notwendigkeit fort; habe doch die Form der Unmittelbarkeit, der Unbestimmtheit, die die Realität des Geistes zunächst ausmache, eine seinem Begriff widersprechende Realität. Das, was unmittelbar im Geist vorhanden zu sein scheint, sei nicht ein wahrhaft Unmittelbares, sondern an sich ein Gesetztes oder ein Vermitteltes.139 Dieser Widerspruch treibe den Geist, das Unmittelbare, das Andere, als das er sich selber voraussetzt, aufzuheben. Erst dadurch komme er zu sich selbst, trete er als Geist hervor. Man könne also nicht mit dem Geist als solchem, sondern müsse von seiner ihm am wenigsten angemessenen Realität anfangen.
Der Geist sei zwar schon am Anfang der Geist, aber er wisse noch nicht, dass er das ist. Nicht er selberhabe zu Anfang schon seinen Begriff erfasst, sondern nur wir, die wir ihn betrachten, seien es, die seinen Begriff erkennen. Dass der Geist dazu kommt zu wissen, was er ist, eben diesmache seine Realisation aus. Der Geist sei im Wesentlichen nur das, was er von sich selber weiß. Zunächst sei er nur an sich Geist, und erst, indem er für sich wird, verwirkliche er sich. Für sich werde er aber nur dadurch, dass er sich besondert, sich bestimmt oder sich zu seiner Voraussetzung, zu dem Anderen (dem noch naturbehafteten Geist, der „natürlichen Seele“, d. Verf.) seiner selbst macht, sich zunächst auf dieses Andere (den “Naturgeist“, die Seele in ihm, d. Verf.) als auf seine Unmittelbarkeit bezieht, dasselbe aber als sein Anderes aufhebt.140 Solange der Geist in seiner Beziehung auf sich als auf ein Anderes dasteht, sei er nur der subjektive, der von der Natur her kommende Geist und zunächst selbst “Naturgeist“. Die ganze Tätigkeit des subjektiven Geistes laufe aber darauf hinaus, sich als sich selbst zu erfassen, sich als Idealität (als das Innerliche, d. Verf.) seiner unmittelbaren Realität zu erweisen. Wenn er sich zum Fürsichsein entwickelt hat, dann sei er nicht mehr bloß subjektiver, sondern objektiver Geist.141
Der objektive Geist
Sei der subjektive Geist wegen seiner Beziehung auf ein Anderes (also das Naturhafte, d. Verf.) noch unfrei oder nur an sich frei, so gelange im objektiven Geist die Freiheit, das Wissen des Geistes von sich, frei zu sein, zum Dasein. Im objektiven Geist sei der Einzelne Person und habe als solche im Eigentum die Realität seiner Freiheit. Denn im Eigentum werde die Sache (z. B. ein Grundstück, d. Verf.) als das, was sie ist, nämlich als ein Unselbständiges und als ein solches gesetzt, das wesentlich nur die Bedeutung habe, die Realität des freien Willens einer Person und darum für jede andere Person ein Unantastbares zu sein. Hier würden wir ein Subjektives sehen, das sich frei weiß, und zugleich eine äußerliche Realität dieser Freiheit142 hat. Der Geist komme daher hier zu seinem Fürsichsein (z. B. im allgemeinen Rechtsbewusstsein, d. Verf.), und die Objektivität des Geistes (in der Privatrechtsordnung, die sich z. B. im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch äußerlich darstellt, d. Verf.) komme zu ihrem Recht. Auf diese Weise sei der Geist aus der Form der bloßen Subjektivität (des „vernünftigen Willen des Einzelnen“ (Hegel), d. Verf.) herausgetreten. Die vollständige Verwirklichung jener im Eigentumsrecht noch unvollkommenen, noch formalen (abstrakten, d. Verf.) Freiheit, die Vollendung der Realisierung des Begriffs des objektiven Geistes, werde aber erst im Staat erreicht. In ihm entwickele der Geist seine Freiheit zu einer von ihm gesetzten, eben zu einer sittlichen Welt. Doch auch diese Stufe müsse der Geist überwinden; bestehe doch der Mangel dieser Objektivität des Geistes darin, dass sie nur eine gesetzte sei. Die Welt müsse vom Geist wieder frei entlassen werden, und das vom Geist Gesetzte zugleich als ein unmittelbar Seiendes gefasst werden. Dies geschehe auf der dritten Stufe des Geistes, nämlich auf dem Standpunkt des absoluten Geistes, d. h. der Kunst, der Religion und der Philosophie.143
Die Entwicklung des Geistes
Die beiden ersten Teile der Lehre vom Geist, also die Lehre vom subjektiven und vom objektiven Geist, beschäftigen sich, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, mit dem endlichen Geist.144 Der Geist sei die unendliche Idee, und die Endlichkeit habe hier die Bedeutung, dass die Realität dem Begriff nicht angemessen ist, und zwar mit der Bestimmung, dass die Realität das Scheinen145 innerhalb des Begriffs ist. Die Realität ist also, Hegel zufolge, ihrem Begriff nicht angemessen. Gleichwohl ist der Begriff (als Wesen) in der Realität als Schein anwesend, und sie wäre nicht ohne denselben, ebenso wenig wie der Begriff sich ohne die Formen seiner Realisierung entfalten könnte. So ist z. B. ein (historisch gewordenes) privatrechtliches Gesetzbuch als eine Realität dem Begriff der individuellen Freiheit nicht vollkommen angemessen, trotzdem wäre die Entwicklung des Begriffs der individuellen Freiheit ohne das bestehende Gesetzbuch als seine (vorläufige) Realität nicht möglich. Oder: Der Körper des Einzelnen zum Beispiel ist die Realität der Seele (des Begriffs). Ohne seinen Körper hätte seine Seele keine Realität, kein Dasein. Aber ebenso wenig hätte sein Körper Realität, ohne dass sich seine Seele (sein Wesen, sein Begriff) in seinem Körper als ein Schein zeigt und diesem, in Hegels Worten, “die Freude des Daseins gönnt“.146
Die Realität sei ein Schein, den sich der Geist an sich als eine Schranke setzen würde, um durch das Aufheben derselben für sich die Freiheit als sein Wesen zu haben und zu wissen, d. h. schlechthin manifestiert zu sein. Die verschiedenen Stufen dieser Tätigkeit, auf denen, jeweils als Schein, der endliche Geist verweilen, die er aber, seiner Bestimmung gemäß, auch durchlaufen müsse, seien Stufen seiner Befreiung. Die absolute Wahrheit in diesen Stufen sei das Vorfinden einer Welt als einer vorausgesetzten, das Erzeugen derselben als eines von ihm (dem Geist, d. Verf.) Gesetzten und die Befreiung von ihr und in ihr seien ein und dasselbe.147 Es sei eine Wahrheit, zu deren unendlicher Form der Schein als zum Wissen derselben sich reinigt.
Die Bestimmung der Endlichkeit werde vor allem vom Verstand148, bezogen auf den Geist und die Vernunft, festgesetzt. Es gelte dabei nicht nur für eine Sache des Verstandes, sondern auch für eine moralische und religiöse Angelegenheit, den Standpunkt der Endlichkeit als einem letzten festzuhalten. Es würde als eine Vermessenheit des Denkens angesehen, ja für eine Verrücktheit desselben, über ihn hinausgehen zu wollen. Es sei aber die schlechteste aller Tugenden, bei einer solchen Bescheidenheit des Denkens, die das Endliche zu einem schlechthin Festen, zu einem Absoluten macht, stehen zu bleiben und die oberflächlichste aller Erkenntnisse, bei dem zu verharren, was seinen Grund nicht in sich selbst hat.149 Die Bestimmung der Endlichkeit, die Hegel in seiner “Logik“150 behandelt, bestehe darin, dass das Endliche nicht ist, nicht das Wahre, sondern nur ein Prozess des Übergangs und des Über-sich-hinausgehens ist. Dieses Endliche der bisherigen Sphären sei die Dialektik, sein Vergehen durch ein Anderes und in einem Anderen zu haben; der Geist aber, der Begriff und das an sich Ewige, sei es selbst, dieses Vernichten des Nichtigen, das Vereiteln des Eitlen in sich selbst zu vollbringen. Die erwähnte Bescheidenheit bestehe darin, an diesem Eitlen, dem Endlichen, gegenüber dem Wahren festzuhalten und sei deshalb selbst ein Eitles. Diese Eitelkeit bedeute in der Entwicklung des Geistes, dass er sich auf das Äußerste in seine Subjektivität vertieft, er dem innersten Widerspruch anheimfällt und sich damit ein Wendepunkt, als das Böse, ergibt.
Der subjektive und der objektive Geist seien, wie Hegel hierzu in seinem Zusatz verdeutlicht, noch endlich.151 Wissen müsse man aber, welchen Sinn die Endlichkeit des Geistes hat. Gewöhnlich stelle man sich dieselbe als eine absolute Schranke, als eine feste Qualität vor, so dass der Geist aufhören würde, Geist zu sein, würde man diese Schranke wegnehmen. Man stelle sich die Endlichkeit des Geistes wie das Wesen der natürlichen Dinge vor, die an eine bestimmte Qualität gebunden seien. So könne z. B. das Gold nicht von seinem spezifischen Gewicht getrennt werden. In Wahrheit aber dürfe man die Endlichkeit des Geistes nicht als eine feste Bestimmtheit betrachten, sondern müsse sie als ein bloßes Moment erkennen. Denn der Geist sei, wie schon oben gesagt, wesentlich die Idee in der Form der Idealität (der Innerlichkeit, d. Verf.), d. h. in einer Form, in der das Endliche negiert ist. Das Endliche habe demnach im Geist nur die Bedeutung eines Aufgehobenen aber nicht die eines Seienden. Die eigentliche Qualität des Geistes sei daher die wahrhafte Unendlichkeit, d. h. diejenige Unendlichkeit, die dem Endlichen nicht einseitig gegenübersteht, sondern in sich selber das Endliche als ein Moment enthält. Es sei deshalb ein leerer Ausdruck, würde man sagen, es gebe endliche Geister. Der Geist als Geist sei nicht endlich, er habe die Endlichkeit zwar in sich, aber nur als eine aufzuhebende und aufgehobene Endlichkeit. Die echte Bestimmung der Endlichkeit, die hier nicht genauer erörtert werden könne, müsse in dem Sinne verstanden werden, dass das Endliche eine Realität ist, die ihrem Begriff nicht gemäß ist. So sei die Sonne ein Endliches, weil sie nicht ohne Anderes gedacht werden könne, weil zur Realität ihres Begriffs nicht nur sie selber, sondern das ganze Sonnensystem gehöre. Mehr noch, das ganze Sonnensystem sei ein Endliches, weil jeder Himmelskörper in ihm gegenüber dem anderen den Schein habe, selbständig zu sein. Folglich entspreche diese gesamte Realität ihrem Begriff noch nicht, stelle noch nicht dieselbe Idealität dar, die das Wesen des Begriffs ist.152 Erst die Realität des Geistes sei selber Idealität, erst im Geist finde die absolute Einheit des Begriffs und der Realität und somit die wahre Unendlichkeit statt.153 Bereits wenn wir von einer Schranke wissen, hätten wir den Beweis, dass wir über dieselbe hinaus sind, also für unsere Unbeschränktheit. Die natürlichen Dinge seien eben deshalb endlich, weil ihre Schranke nicht für sie selber, sondern nur für uns vorhanden sei, die wir die Dinge miteinander vergleichen. Zu einem Endlichen würden wir uns dadurch machen, dass wir ein Anderes (als Beispiel könnte man unsere “Natur“ oder unsere soziale Herkunft anführen, d. Verf.) in unser Bewusstsein aufnehmen. Aber, indem wir von diesem Anderen wissen, seien wir schon über diese Schranke hinausgegangen. Nur der Unwissende bleibe innerhalb seiner Schranke; weiß er doch nichts von ihr als einer Schranke seines Wissens. Wer dagegen von der Schranke weiß, der wisse von ihr nicht als eine Schranke seines Wissens, sondern als von einem Gewussten, als zu einem, was zu seinem Wissen gehört. Nur das, wovon wir nichts wissen, bilde eine Schranke des Wissens; die Schranke, von der wir wissen, sei dagegen keine Schranke des Wissens. Von unserer Schranke zu wissen, bedeute daher, von unserer Unbeschränktheit zu wissen. Werde aber der Geist für unbeschränkt, für wahrhaft unendlich erklärt, so soll damit nicht gesagt werden, dass die Schranke ganz und gar nicht im Geist vorkommt. Vielmehr müsse man erkennen, dass der Geist sich bestimmen, sich somit endlich machen, sich beschränken muss.154
Aber der Verstand habe eben darin Unrecht, diese Endlichkeit als eine starre zu betrachten, den Unterschied der Schranke und der Unendlichkeit als einen absolut festen zu betrachten und demgemäß zu behaupten, der Geist sei entweder beschränkt oder unbeschränkt. Die wahrhaft begriffene Endlichkeit sei in der Unendlichkeit, die Schranke im Unbeschränkten enthalten. Der Geist sei daher sowohl unendlich als auch endlich und weder nur das eine noch nur das andere. Er bleibe in seiner Endlichkeit unendlich; denn er hebe die Endlichkeit in sich auf. Nichts sei in ihm ein Festes, ein Seiendes, alles sei vielmehr nur ein Ideelles, ein nur Erscheinendes. So müsse Gott, weil er Geist sei, sich bestimmen, Endlichkeit in sich setzen, sonst wäre er nur eine tote, leere Abstraktion. Da aber die Realität, die er sich durch sein Selbstbestimmen gibt (indem er Mensch wird, d. Verf.), eine ihm vollkommen gemäße Realität sei, wird Gott durch diese nicht zu einem Endlichen. Die Schranke ist also nicht in Gott und im Geist, sondern sie werde vom Geist nur gesetzt, um aufgehoben zu werden. Nur momentan könne es scheinen, als ob der Geist in einer Endlichkeit verharrt. Durch seine Idealität sei er aber über dieselbe erhaben, wisse er von der Schranke, dass sie keine feste Schranke ist. Deshalb gehe er über dieselbe hinaus, befreie sich von ihr, und diese Befreiung sei nicht, wie der Verstand meine, eine niemals vollendete, eine ins Unendliche reichende, immer nur erstrebte Befreiung, vielmehr reiße sich der Geist von diesem Progress, diesem Fortschreiten ins Unendliche, los, befreie sich absolut von der Schranke, von seinem Anderen, komme somit zum absoluten Fürsichsein und mache sich wahrhaft unendlich. Dazu komme der Geist als absoluter, wenn er sich, Hegel zufolge, als “denkende Idee“ (ders.155) erkennt und das Logische die Bedeutung hat, dass es die “im konkreten Inhalt als in seiner Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit ist“156. Die Philosophie tut also nichts anderes, als, unter Einbeziehung der “endlichen“ Wissenschaften, das zu begreifen, was wirklich ist.
3.3 Der subjektive Geist157
Der Geist, der sich in seiner Idealität entwickelt, ist, so Hegel, der Geist als erkennender. Aber das Erkennen werde hier nicht nur so verstanden, wie es die Bestimmtheit der Idee als logischer Idee158 ist, sondern so wie der konkrete Geist sich zum Erkennen bestimmt.
Der subjektive Geist ist nach Hegel
A) an sich oder unmittelbar Seele oder “Naturgeist“ und als solcher Gegenstand der Anthropologie.159
B) Für sich oder vermittelt, noch als identische Reflexion in sich und in Anderes, der Geist in einem Verhältnis, ist der subjektive Geist Bewusstsein160 und Gegenstand der Phänomenologie des Geistes.
C) Als der sich in sich bestimmende Geist, als Subjekt für sich, ist der subjektive Geist Gegenstand der Psychologie
In der Seele erwache, so Hegel, das Bewusstsein. Dieses setze sich als Vernunft, die unmittelbar zur sich wissenden Vernunft erwache und sich durch ihre Tätigkeit zur Objektivität, zum Bewusstsein ihres Begriffs befreie.161
Wie im Begriff überhaupt die Bestimmtheit, die an ihm vorkommt, Fortgang der Entwicklung sei, so sei auch an dem Geist jede Bestimmtheit, in der er sich zeigt, ein Moment seiner Entwicklung.162 Und, indem er sich immer weiter bestimmt und vorwärts zu seinem Ziel hin schreitet, mache er sich zu dem, werde er für sich, was er an sich ist. Jede Stufe sei innerhalb ihrer dieser Prozess, und das Produkt der Stufe sei, dass für den Geist (d. h. die Form desselben, die er in ihr, also der Stufe, habe) das ist, was er zu Beginn der Stufe an sich oder damit nur für uns (also die Betrachtenden, d. Verf.) war. Die psychologische und die gewöhnliche Betrachtungsweise würden, wie Hegel fortfährt, das beschreiben, was der Geist oder die Seele ist, was ihr geschieht und was sie tut. Demnach werde die Seele als ein fertiges Subjekt vorausgesetzt, an dem solche Bestimmungen nur als Äußerungen zum Vorschein kämen, aus denen erkannt werden soll, was sie ist, welche Vermögen und Kräfte sie in sich besitzt. Dabei fehle es in jener Betrachtungsweise am Bewusstsein darüber, dass die Äußerung desjenigen, was die Seele ist, im Begriff dasselbe für sie setzt, wodurch sie eine höhere Bestimmung gewonnen habe.163
Von diesem Fortschreiten des Geistes, wie es hier betrachtet wird, müssten, Hegel zufolge, Bildung und Erziehung unterschieden und davon ausgeschlossen werden; denn dieser Bereich würde sich nur auf die einzelnen Subjekte als solche beziehen, in denen der allgemeine Geist zur Existenz gebracht werden soll. In der philosophischen Ansicht des Geistes als solchen werde er selbst danach betrachtet, wie er sich nach seinem Begriff bildet und sich erzieht. Seine Äußerungen würden als die Momente des Prozesses angesehen, in dem er sich zu sich selbst hervorbringt und sich mit sich selbst zusammenschließt. Erst dadurch werde er wirklicher Geist.164
Die drei Hauptformen des Geistes
Wie bereits ausgeführt, sieht Hegel den Geist in drei Hauptformen, nämlich den subjektiven, den objektiven und den absoluten Geist unterschieden und darüber hinaus die Notwendigkeit eines Fortgangs von der ersten zur zweiten und von dieser zur dritten Form.165 Was den subjektiven Geist betrifft, so ist dieser, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert, noch in seinem unentwickelten Begriff, d. h. der Geist habe sich seinen Begriff noch nicht gegenständlich gemacht. 166 Dies geschehe erst auf der Stufe des objektiven Geistes. In seiner Subjektivität sei der Geist aber zugleich objektiv, habe eine unmittelbare Realität, und durch die Aufhebung derselben werde er erst für sich, d. h. gelange zu sich selbst, zum Erfassen seines Begriffs, seiner Subjektivität.167 Daher könnte man ebenso sagen, der Geist sei zunächst objektiv und soll subjektiv werden, wie auch umgekehrt, er sei erst subjektiv und soll sich objektiv machen. Der Unterschied zwischen dem subjektiven und dem objektiven Geist sei folglich nicht als starr anzusehen.168
Schon am Anfang müsse man, so Hegel, den Geist nicht als einen bloßen Begriff, als ein bloß Subjektives, sondern als Idee im Sinne einer Einheit des Subjektiven und des Objektiven fassen, und jeden Fortgang von diesem Anfang als ein Hinausgehen über die erste einfache Subjektivität des Geistes, als einen Fortschritt in der Entwicklung der Realität oder der Objektivität des Geistes betrachten.169 Diese Entwicklung des Geistes bringe eine Reihe von Gestalten (z. B. Wahrnehmung und Verstand, d. Verf.) hervor, die zwar durch die Empirie belegt werden müssten, in der philosophischen Betrachtung dürften sie aber nicht äußerlich nebeneinander gestellt bleiben, vielmehr müsste jede Gestalt als Ausdruck einer notwendigen Reihe bestimmter Begriffe zu erkennen sein. Von Interesse für das philosophische Denken seien die Gestalten eben nur, indem sie eine solche Reihe von Begriffen ausdrücken. Zunächst könnten wir aber die sich voneinander unterscheidenden Gestaltungen des subjektiven Geistes nur vorläufig angeben; erst durch die bestimmte Entwicklung des subjektiven Geistes (wie sie die philosophische Arbeit nachvollzieht, d. Verf.) würde sich die Notwendigkeit jener Gestalten zeigen.
Die Seele
Die drei Hauptformen des subjektiven Geistes sind, Hegel zufolge, 1. die Seele, 2. das Bewusstsein und 3. der Geist als solcher. Als Seele habe der Geist die (begriffliche, d. Verf.) Form der abstrakten Allgemeinheit, als Bewusstsein die (begriffliche, d. Verf.) Form der Besonderung und als für sich seiender Geist die (begriffliche, d. Verf.) Form der Einzelheit.170 So stelle sich in der Entwicklung des subjektiven Geistes die Entwicklung des Begriffs (des Geistes, d. Verf.) dar. Weshalb die jenen drei Formen des subjektiven Geistes entsprechenden Teile der Wissenschaft die Bezeichnung Anthropologie, Phänomenologie und Psychologie erhalten haben, werde in der Wissenschaft vom subjektiven Geist verdeutlicht werden.
Den Anfang der Betrachtung müsse der unmittelbare Geist bilden, dies sei aber der Naturgeist, die Seele. Ein Fehler sei es, mit dem Begriff des Geistes zu beginnen; sei doch der Geist, wie schon erwähnt, von vornherein Idee, also verwirklichter Begriff. Am Anfang aber könne der Begriff des Geistes (als Idee im Sinne der Einheit von Subjektivität und Objektivität; Beispiel: das Bewusstsein als Einheit von abstraktem Ich und seinem Gegenstand, d. Verf.) noch nicht die vermittelte Realität haben, die sie durch das abstrakte Denken (den subjektiven Begriff, d. Verf.) erhält. Seine Realität (also der Idee des Geistes, d. Verf.) müsse am Anfang zwar auch schon eine abstrakte Realität sein, und nur dadurch würde sie der Idealität des Geistes (als einer Innerlichkeit, d. Verf.) entsprechen, sie sei aber notwendig eine noch unvermittelte, noch nicht (vom Geist als Idee, d. Verf.) gesetzte Realität, folglich eine nur seiende, dem Geist (als einem Innerlichen, d. Verf.) noch äußerliche, eine bloß durch die Natur gegebene Realität. Man müsse also bei dem noch in der Natur befangenen, auf seine Leiblichkeit bezogenen, noch nicht bei sich selbst seienden, also noch nicht beim Geist anfangen.171 Hegel spricht hierbei von der Grundlage des Menschen und sieht darin den Gegenstand der Anthropologie.172 In diesem Zweig der Wissenschaft vom subjektiven Geist sei der Geist als gedachter Begriff nur in uns, den Betrachtenden, aber noch nicht im Gegenstand (also im Seelenleben des Einzelnen selbst, d. Verf.) selber vorhanden. Den Gegenstand der Betrachtung bildet hier erst der bloß seiende Begriff des Geistes, der seinen Begriff, noch nicht erfasst hat, der noch außer sich seiende Geist. Es ist, wie sich Hegel ergänzen lässt, der von außen auf den Gegenstand, den subjektiven Geist, bezogene subjektive Begriff des abstrakten Denkens eines Betrachters, ein Begriff, der jedoch nicht beliebig, sondern objektiv ist.
Das Erste in der Anthropologie sei, so Hegel, also die qualitativ bestimmte, an ihre Naturbestimmungen gebundene Seele (zu der, ihm zufolge, z. B. die rassischen Verschiedenheiten gehören). Aus diesem unmittelbaren Einssein mit ihrer Natürlichkeit trete die Seele in den Gegensatz, in den Kampf, zu jener. Dazu würden die Zustände der Verrücktheit und des Somnambulismus gehören. Diesem Kampf folge der Sieg der Seele über ihre Leiblichkeit und die Herabsetzung der Leiblichkeit zu einem bloßen Zeichen, zur Darstellung der Seele. Auf diese Weise trete die Idealität der Seele in ihrer Leiblichkeit hervor, werde diese Realität des Geistes (also die Leiblichkeit, d. Verf.) auf eine noch leibliche Weise ideell gesetzt.
Das Bewusstsein
In der Phänomenologie des Geisteszeigt Hegel, wie sich die Seele durch die Negation ihrer Leiblichkeit, zur reinen ideellen Identität mit sich erhebt, Bewusstsein, ein Ich wird und ihrem Anderen (ihrer Leiblichkeit, d. Verf.) gegenüber für sich wird.173 Aber dieses erste Für-sich-Sein des Geistes sei noch durch das Andere, also die Leiblichkeit, von der der Geist herkomme, bedingt. Das Ich sei hier noch vollkommen leer, eine ganz abstrakte Subjektivität. Es setze allen Inhalt des unmittelbaren Geistes (gemeint ist offensichtlich der Inhalt der sinnlichen Empfindungen, d. Verf.) außer sich und beziehe sich auf den Inhalt als eine vorgefundene Welt.174 So werde dasjenige, was zunächst nur unser Gegenstand war, zwar dem Geist selber zum Gegenstand, das Ich wisse aber noch nicht, dass das, was ihm gegenübersteht, der natürliche Geist selber ist. Mit anderen Worten, das Bewusstsein des Einzelnen unterscheidet sich in ein “leeres“ Ich einerseits und eine ihm gegenüberstehende Welt als eine Vielfalt einander abwechselnder sinnlicher Eindrücke andererseits, die das Ich vollständig gefangen nehmen. Und das Ich weiß noch nicht - im Gegensatz zu dem Betrachter -, dass es der natürliche Geist im Individuum selbst ist, der diese sinnliche Welt, wie sie dem Ich unmittelbar gegenübersteht, hervorbringt.
Das Ich sei daher, wie Hegel fortfährt, obwohl es etwas für sich sei, zugleich nicht für sich, weil es nur auf ein Anderes, ein (sinnlich, d. Verf.) Gegebenes, bezogen sei. Die Freiheit des Ichs sei folglich nur eine abstrakte, bedingte und relative Freiheit. Zwar sei der Geist hier nicht mehr wie zuvor175 in die Natur versenkt, sondern in sich reflektiert176 und auf dieselbe bezogen, erscheine aber nur, stehe nur in Beziehung zur Wirklichkeit, sei aber noch nicht wirklicher Geist. Deshalb nennt Hegel den Teil der Wissenschaft, in dem diese Form des Geistes betrachtet wird, Phänomenologie, Erscheinungslehre des Geistes.177
Das Selbstbewusstsein
Indem das Ich sich in seiner Beziehung zu Anderem auf sich selbst zurückbeugt178, wird es nach Hegel Selbstbewusstsein.179 In dieser Form wisse das Ich sich zunächst nur als das unerfüllte Ich und allen konkreten Inhalt als ein Anderes (so die Dinge, die Gegenstand der Begierde sind, aber auch andere Menschen, die gleichermaßen beanspruchen, ein Ich zu sein, d. Verf.). Die Tätigkeitdes Ichs bestehe hier darin, die Leere seiner abstrakten Subjektivität zu füllen, das Objektive in sich hineinzubilden und das Subjektive dagegen objektiv zu machen.180 Dadurch hebe das Selbstbewusstsein, also das seiner selbst bewusste Ich, die Einseitigkeit seiner Subjektivität auf, trete aus seiner Besonderheit, aus seinem Gegensatz zum Objektiven, heraus, komme zu der beide Seiten umfassenden Allgemeinheit und stelle in sich die Einheitseiner selbst mit dem Bewusstsein dar. Denn der Inhalt des Geistes werde hier ein objektiver Inhalt, wie im Fall des Bewusstseins, und zugleich, wie im Fall des Selbstbewusstseins, ein subjektiver Inhalt.181 Dieses allgemeine Selbstbewusstsein sei an sich oder für uns (die Betrachtenden, d. Verf.) Vernunft, doch erst im dritten Teil der Wissenschaft vom subjektiven Geist werde die Vernunft sich selbst gegenständlich. Im Fall des Selbstbewusstseins geht es, worauf noch unten im Einzelnen eingegangen werden wird, um den Vorgang der Vergesellschaftung, d. h. den Kampf des einen Selbstbewusstseins gegen ein anderes um Anerkennung, ein Kampf, der als Resultat ein System gegenseitiger Anerkennung (das als allgemeines Selbstbewusstsein objektiv und subjektiv gegeben ist, d. Verf.) hervorbringt.
Der Geist
Die dritte Hauptform des subjektiven Geistes, die Hegel unter der Überschrift “Psychologie“ abhandelt, ist der Geist als solcher, wie er sich in seinem Gegenstand nur auf sich selber bezieht.182 Der Geist habe es dabei nur mit seinen eigenen Bestimmungen zu tun, habe seinen eigenen Begriff erfasst und komme so zur Wahrheit. Denn nun sei die in der bloßen Seele noch unmittelbare, abstrakte Einheit des Subjektiven und des Objektiven und dadurch, dass sodann der im Bewusstsein entstehende Gegensatz zwischen dem Subjektiven und Objektiven aufgehoben wird, nunmehr die Einheit als eine vermittelte wieder hergestellt. Die Idee des Geistes gelange also aus der ihr widersprechenden Form des einfachen Begriffs (also der Seele, d. Verf.) und der ihr ebenso widersprechenden Trennung ihrer Momente (also im Bewusstsein, das als Gegensatz von Subjekt und Objekt gegeben ist d. Verf.) zur vermittelten Einheit und somit zur wahren Wirklichkeit. In dieser Gestalt sei der Geist die für sich selbst seiende Vernunft. Geist und Vernunft stünden zueinander in einem solchen Verhältnis wie Körper und Schwere, wie Wille und Freiheit. Demnach gibt es nach Hegel ebenso wenig einen Geist ohne Vernunft wie es einen Willen ohne Freiheit gibt. Die Vernunft bilde, so Hegel, die substanzielle Natur des Geistes und sei nur ein anderer Ausdruck für die Wahrheit oder die Idee, die das Wesen des Geistes ausmache. Aber erst der Geist als solcher wisse, dass seine Natur die Vernunft und die Wahrheit ist.
Der Geist, der beide Seiten, nämlich die Subjektivität und die Objektivität, umfasse, setze sich, so Hegel, zum einen in der Form der Subjektivität, und so sei er Intelligenz und zum anderen in der Form der Objektivität, und so sei er Wille. Die zunächst auch selbst noch unerfüllte Intelligenz hebe ihre dem Begriff des Geistes unangemessene Form der Subjektivität auf, indem sie den ihr gegenüber stehenden, noch mit der Form des bloßen Gegebenseins und der Einzelheit behafteten objektiven Inhalt (z. B. ein gegebener Staat, d. Verf.), nach dem absoluten Maßstab der Vernunft misst, diesem Inhalt die Vernünftigkeit antut, die Idee in ihn einbildet, ihn damit zu einem konkret Allgemeinen183 verwandelt und so in sich aufnimmt.184 Dadurch komme die Intelligenz dahin, dass das, was sie weiß, nicht nur eine Abstraktion, sondern der objektive Begriff ist. Und andererseits verliere der Gegenstand dadurch die Form eines Gegebenen und bekomme die Gestalt eines dem Geist selber angehörenden Inhalts (also einer wissenschaftlichen Theorie, d. Verf.).185
Indem die Intelligenz aber zum Bewusstsein gelangt, dass sie den Inhalt aus sich selbst schöpft, werde sie zu dem nur sich selber zum Zweck setzenden praktischen Geist. Sie werde zum Willen, der nicht, wie die Intelligenz, mit einem von außen her gegebenen Einzelnen, sondern mit einem solchen Einzelnen anfängt, das er als das Seinige weiß.186 Diesen Inhalt, nämlich die Triebe und die Neigungen, beziehe er, indem er sich in sich reflektiert (sich selbst zum Gegenstand des Nachdenkens macht, d. Verf.), zunächst auf ein Allgemeines (so die Glückseligkeit, d. Verf.), um sich dann am Ende zum Wollen des an und für sich Allgemeinen, der Freiheit, eben seines Begriffs zu erheben. Einmal an diesem Ziel angekommen, sei der (subjektive, d. Verf.) Geist ebenso zu seinem Anfang, nämlich zur Einheit mit sich (wie sie in der Seele gegeben ist, d. Verf.), zurückgekehrt Zugleich sei er aber zur absoluten, zur wahrhaft in sich bestimmten Einheit mit sich fortgeschritten, und zwar zu einer Einheit, in der die Bestimmungen nicht Natur- sondern Begriffsbestimmungen seien. 187 Hegel sieht demnach die Entwicklung des subjektiven Geistes als “dialektisch“ an. So beginnt sie bei der Seele, der Einheit des Geistes mit sich, setzt sich mit dem Bewusstsein fort, in dem der Geist sich in Subjekt (Ich) und Objekt (Welt) unterscheidet, und schließlich kehrt der Geist zu seiner Einheit mit sich selbst, aber auf einer höheren Stufe, zurück.
51Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 17 ff.
52Nur dem sinnlichen Bewusstsein erscheine die Natur als das Erste, Unmittelbare, Seiende. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, in: Hegel Werke, Bd. 9, Frankfurt a. Main 1970, S. 28.
53Es versteht sich, dass Hegels Naturphilosophie nicht unser Thema ist. Doch kann das Thema „Natur“ bei der Behandlung des „Geistes“ nicht ganz übergangen werden; erlaubt es doch ein umfassenderes Verständnis Hegelschen Denkens. Im Übrigen dürfte derjenige, der sich mit Hegels Philosophie des Geistes beschäftigt, neugierig sein, wie er die Natur einordnet, mit der der Mensch mit seinem Organismus und seinen Bedürfnissen, seiner ganzen materiellen Existenzweise, unlösbar verbunden ist.
54In der Äußerlichkeit, die nach Hegel die Bestimmung der Natur ausmacht, hätten die Bestimmungen des Begriffs den Schein eines gleichgültigen Bestehens und der Vereinzelung gegeneinander, und der Begriff sei deshalb ein Innerliches. Die Natur zeige daher in ihrem Dasein keine Freiheit, sondern Notwendigkeit und Zufälligkeit. Die Natur sei an sich (ihrem Begriff nach, d. Verf.) in der Idee göttlich, aber so wie sie sei, entspreche ihr Sein nicht ihrem Begriff; sie sei der unaufgelöste Widerspruch. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, ebenda., S. 17.
55Ebenda, S. 27 u. 28.
56 Auch die Natur ist „Idee“, doch sie kommt als solche nicht zu ihrem „Fürsichsein“, zum Bewusstsein ihrer selbst oder zur Selbsterkenntnis. Dorthin kommt sie erst in den einzelnen Naturwissenschaften, vollends in der Naturphilosophie, also im Geist.
57Die Idee des Geistes ist zwar Objekt, jedoch kein Objekt des Bewusstseins, sondern ein vom philosophischen Denken konstituiertes Objekt. Somit steht diesem Objekt nicht ein ihm äußerliches Subjekt gegenüber, sondern es ist mit diesem als einem begreifenden identisch. Wenn z. B. der Staat vom Philosophen Hegel als Idee gefasst und als solche denkend zu einem Ganzen entfaltet wird, dann ist dieser Vorgang identisch mit der Staatsphilosophie. Doch diese setzt die Vorarbeit der empirischen und theoretischen Staatswissenschaften voraus, sonst wäre die Staatsphilosophie als „Fürsichsein“ der Idee des Staates bloß eine willkürliche Konstruktion.
58Hegel denkt dabei nicht, wie angedeutet, an die Natur, wie sie uns das sinnliche Bewusstsein vermittelt, sondern an die Natur, wie sie uns die modernen Naturwissenschaften vermitteln, z. B. an die Bewegungen der Himmelskörper (Mechanismus), an Reaktionen von Stoffen, die aufeinandertreffen (Chemismus) oder an Prozesse von Wachstums und Entwicklung pflanzlicher Organismen (Teleologie) und tierischer, Subjektivität einschließender Organismen („Idee des Lebens“, ders.). Bei vielen Ereignissen und Zuständen in der Natur handelt es sich für Hegel um für den menschlichen Geist äußerliche, fremde, ihm zum Teil geradezu drastisch widersprechende, sinnlose, gesetzlose, ja unlogische Vorgänge. Dabei kann man z. B. an Erdbeben oder an Himmelskörper denken, die auf die Erde stürzen. „Absolute Negativität“ bedeutet - so Thomas Sören Hoffmann -, „daß er (der Geist, d. Verf.) die Negation und Aufhebung seiner selbst, die die Natur ist, seinerseits aufhebt und sich als sich selbst gegen die Natur affirmiert …“ Ders., Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wiesbaden 2004, S. 406. Indem Hegel die Natur als eine „äußerliche Objektivität“ begreift, grenzt er sich offensichtlich vom Naturbegriff der Romantiker ab. „Der wahre Inhalt des Romantischen ist die absolute Innerlichkeit, die entsprechende Form die geistige Subjektivität, als Erfassen ihrer Selbständigkeit und Freiheit. Dies in sich Unendliche und an und für sich Allgemeine ist die absolute Negativität von allem Besonderen, die einfache Einheit mit sich, die alles Außereinander, alle Prozesse der Natur und deren Kreislauf des Entstehens, Vergehens und Wiedererstehens, alle Beschränktheit des geistigen Daseins verzehrt …“ Ders., Vorlesungen über die Ästhetik, 2. Teil, Hegel Werke, Bd. 14, Frankfurt a. M. 1970, S. 129-130.
59„Die Naturphilosophie gehört selbst zu diesem Wege der Rückkehr; denn sie ist es, welche die Trennung der Natur und des Geistes aufhebt und dem Geiste die Erkenntnis seines Wesens in der Natur gewährt.“ Wie sehr auch immer der denkende Geist die geistige und die natürliche Welt voneinander trennt, es ist doch immer der Geist, der diese Trennung vornimmt. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil., in: Hegel Werke, Bd. 9, a. a. O., S. 24.
60Letztlich ist es nach Hegel nur die eine Idee (Weltvernunft), die die Welt der Natur und die des Geistes miteinander verbindet, und die sich in der Philosophie selbst begreift. „Das Ziel, auf das Hegel hinsteuert … ist der Primat des Geistes über die Natur, die Eingliederung der Naturphilosophie in eine Natur und Geist in sich befassende Geistphilosophie …“ Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, 2. Bd., 3. Aufl., Tübingen 1977, S. 230.
61Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 17 ff.
62Bei der „logischen Idee“ geht es, wie erwähnt, um die allgemeinen Formen des Seins (Ontologie), des Denkens (Logik) und Erkennens (Erkenntnistheorie), wie sie in der natürlichen, der wissenschaftlichen und der philosophischen Sprache enthalten sind, und die Hegel in seiner „Wissenschaft der Logik“ reflektiert und miteinander zu einem System durch „reines Denkens“ zusammenfügt. Die „logische Idee“ und ihre Formen sind die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt die Natur und die Welt des Geistes einerseits als uns gegenüberstehend konstituieren und wir ihnen andererseits als bewusste, selbstbewusste und erkennende Subjekte gegenübertreten können. Dazu: Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, Hegel Werke Bd. 8, a. a. O. S. 1970.
63Ebenda., S. 377 ff.
64Gemeint ist offenbar das Erkennen, wie es in den Wissenschaften bis hin zur Philosophie „wirklich“ ist.
65Die Philosophie des Geistes ist nach Hegel die Idee, die aus ihrem „Anderssein“, der Natur, in sich zurückkehrt. Die Unterschiede der besonderen philosophischen Wissenschaften sind nach Hegel jeweils nur Bestimmungen der einen Idee. In der Natur werde nichts Anderes als die Idee dargestellt, aber sie sei in der Form der Entäußerung. Im Geiste sei eben die Idee als für sich (etwa im Bewusstsein des Einzelnen, d. Verf.) und als an und für sich seiend (in der Philosophie des Geistes, d. Verf.). Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 64.
66Die Natur ist nach Hegels Naturphilosophie die „Idee in der Form des Anderssein“ (ders.). Die Idee als das Negative ihrer selbst sei sich äußerlich. Die Natur sei nicht nur ein Äußerliches gegenüber dieser Idee und ihrer subjektiven Existenz, dem Geist, sondern die Äußerlichkeit sei die Bestimmung, in der sie als Natur ist. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, a. a. O., S. 24.
67Natur und Geisteswelt sind zunächst, wie schon erwähnt, als einander gegenüberstehende, z. T. als extrem gegensätzliche Welten zu betrachten - so der „gesunde Menschenverstand“ und so erst recht der Standpunkt der Geisteswissenschaften. Und doch hängen diese Welten, wie jeder ahnt, irgendwie zusammen, so dass die dualistische Weltbetrachtung in den „endlichen Wissenschaften“ zwar berechtigt ist, aber von der Philosophie überwunden werden muss.
68„Die Idee ist das das Wahre an undfür sich, die absolute Einheit des Begriffs und der Objektivität. Ihr ideeller Inhalt ist kein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ist nur seine Darstellung, die er sich in der Form äußerlichen Daseins gibt …“ Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil., a. a. O, S., 367. Die Objektivität, wie sie Hegel versteht, darf nicht mit dem unmittelbar Daseienden verwechselt werden; denn sie setzt, anders als ein Daseiendes, ein sich im Begreifen, sich rein im Begriff bewegendes Subjekt voraus. Die „Weltkategorien“ (N. Hartmann), in denen sich „Objektivität“, die Welt der Natur oder des Geistes, darstellt, sind nach Hegel der Mechanismus, der Chemismus und die Teleologie - allgemeine Systemmodelle der Wissenschaft. Dazu auch: T. S. Hoffmann, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a. a. O., S. 374 ff. Wenn die Objektivität, also die Teleologie, in die Idee übergeht, so bedeutet das nach Hegel offenbar, dass sich der Begriff, z. B. die Seele, sich der Objektivität bemächtigt, und man es nunmehr mit dem „Leben“ als solchem zu tun hat, dass Subjektivität: Seele und beim Menschen Bewusstsein und Geist, einschließt.
69Dazu T. S. Hoffmann: „… die Naturphilosophie dagegen versucht zunächst zu denken, was es macht, daß etwas qualitativ ein Naturgebilde und kein logischer Gedanke oder kein geistiges Selbst ist; sie nimmt den Naturgegenstand als ein unableitbar differentes Sein, an dem sich jedoch gleichwohl eine Art Innerlichkeit, ein Selbst melden kann, das allerdings nicht darin aufgeht, in eine Formel eingesetzt werden zu können.“, „… Für das Verständnis der Naturphilosophie Hegels ist viel gewonnen, wenn man sich bewußt ist, daß es hier darum geht, einen Blick auf Natur einzuüben, der diese nicht nur als dem Baconschen „regnum hominis“ schon anverwandelte, sondern als in ihrer ursprünglichen Fremdheit gewahrte nimmt und stehen läßt.“, „Die Natur ist nicht nur das, was von uns hier ein Äußeres (Nicht-Ich) ist; sie ist vielmehr in einem absoluten Sinne äußerlich, was einschließt, daß sie sich selbst gegenüber ebenfalls äußerlich ist und sich nach einem Gesetz der Äußerlichkeit oder äußeren Beziehung bestimmt.“ Ders., Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a. a. O., S. 393 ff.
70Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 18 ff.
71Wie schon erwähnt, wohnt der Natur nach Hegel ein Selbstzweck (ihr Begriff), wenn auch nicht ein absoluter Selbstzweck inne, so dass sie einen Widerspruch einschließt. (N. Hartmann) Die Schwierigkeit, die sich aus einer teleologischen Naturbetrachtung ergibt, habe Hegel, so N. Hartmann, deutlich gesehen. Ders., G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 284.
72So kann man z. B. auch in einer Marktwirtschaft eine äußere Notwendigkeit am Wirken sehen. So haben private Haushalte einen laufenden Bedarf an Konsumgütern aller Art und verfügen über Kaufkraft in Form von Geld. Demgegenüber stehen die Betriebe, die laufend für den Markt produzieren und darauf angewiesen sind, dass ihre Güter gekauft, so dass ihre Produktionskosten gedeckt werden, in denen auch die Arbeitslöhne von Arbeitnehmern als (Mit-)Inhaber privater Haushalte enthalten sind. Es liegt nahe, hierbei von einer „äußeren“ Notwendigkeit zu sprechen. Als eine „innere“ Notwendigkeit könnte man dagegen die der Marktwirtschaft zugrunde liegende strukturelle Differenzierung verstehen, nämlich die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Produktionsmitteln, die Trennung von Haushalt und Betrieb und die Produktivkraftentwicklung.
73Das Tier ist, wie sich Hegel verstehen lässt, in seiner Bestimmtheit (in jedem seiner Glieder) bei sich, und es ist ein Selbst (eine für sich seiende Subjektivität), das gegenüber seiner organischen Natur (seinem Organismus) und seiner unorganischen Natur (seine natürliche Umgebung) steht, die ihm durch seine Empfindungen vermittelt werden. Die organische Individualität des Tieres, so Hegel in seiner Naturphilosophie, existiere als Subjektivität, und zwar insofern die eigene Äußerlichkeit der Gestalt (also der Körper des Tieres, d. Verf.) zu Gliedern idealisiert sei und der Organismus in seinem nach außen gerichteten Prozess die auf ein Selbst bezogene Einheit in sich erhalte. Dies sei die animalische Natur, die in ihrer Wirklichkeit und in ihrer Äußerlichkeit der unmittelbaren Einzelheit ebenso dagegen ein in sich reflektiertes Selbst der Einzelheit, eine in sich seiende subjektive Allgemeinheit sei. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, a. a. O., S. 430. Was die „Allgemeinheit“ betrifft, so verweist Hegel darauf, dass es sich dabei nicht um das handelt, was allem Besonderen gemeinschaftlich ist, sondern um die Allgemeinheit, die sich selbst besondert, spezifiziert. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 311 ff. In der Seele des Tieres bildet sich, ein „in sich reflektiertes Selbst“ (ders.) heraus, also wie sich Hegel verstehen lässt, eine auf ein Selbst bezogene Welt, der sich das Selbst zugleich, dadurch für sich werdend, entgegensetzt.
74Hegel stellt dann im Einzelnen die widersprüchliche Interaktion des Tieres mit seiner natürlichen Umgebung dar, in der es die Mittel zu seiner Selbsterhaltung sucht, findet und diese verzehrt sowie seine Interaktion mit seinesgleichen, also mit einem anderen Tier derselben Gattung - das Geschlechtsverhältnis. Dazu: Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a O., S. 20.
75Demnach bilden Tiere keine sittlichen Gesellschaften, und jedes einzelne Tier kehrt, sobald seine flüchtige Beziehung mit seinesgleichen im Geschlechtsverhältnis beendet ist, in den Zustand der Einzelheit zurück.
76Im Gattungsprozess, also mit der Zeugung, wird, wie sich Hegel verstehen lässt, die Besonderung der Tiere einer Gattung in weibliche und männliche Tiere aufgehoben, aber dadurch komme es nicht zur Gattung im Sinne einer Familiengesellschaft, eines übergeordneten Allgemeinen, vielmehr finde sich jedes neugeborene Exemplar wieder nur im Zustand der Einzelheit..
77„Der Selbstzweck im lebendigen Individuum ist „Seele“ - in jenem Sinne des Wortes, den man aus des Aristoteles Definition als „erste Entelechie des organischen Körpers“ kennt. Der „Begriff, der als subjektiver früher auftritt, ist die Seele des Lebens selbst; er ist der Trieb, der sich durch die Objektivität (Mechanismus, Chemismus, Teleologie, d. Verf.) hindurch seine Realität vermittelt“ (zitiert bei Hegel). N. Hartmann, G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 277.
78Als Ausgangspunkt einer geistigen Entwicklung.
79Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 21.
80Als ein Beispiel für die Zurückführung des Äußerlichen in das Innerliche lassen sich Dichtung und Literatur der Romantik anführen.
81„Wir werden in aller Regel keine Schwierigkeit dabei empfinden, mit „Ich“ zugleich das Allerallgemeinste wie das Allerindividuellste, das ein Mensch von sich sagen kann, zu verknüpfen, zugleich aber auch in dem Wort „Ich“ das Moment der Selbstbestimmung, d. h. der Entgegensetzung und Besonderung, zu hören. „Ich“ sind alle und jeder, und „ich“ ist jeder in seinem bestimmten Verhältnis zu allen. Mit der Bestimmung Ich präsentiert sich also ein selbstbewusstes Wesen einerseits als das, was alle selbstbewussten Wesen sind, als etwas Allgemeines; andererseits zeigt es sich als differentes, sich dem Nicht-Ich entgegensetzendes Wesen; schließlich bestimmt es sich zu unverwechselbarer Einzelheit, dazu, der Mensch als dieser Mensch zu sein …“ T. S. Hoffmann, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a. a. O., S. 353.
82Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 21
83Ebenda, S. 21 ff.
84Die Sprache ist nicht nur eine der Ausstattungen, die dem Menschen, der in der Welt ist, zukommt, sondern auf ihr beruht, und in ihr stellt sich dar, daß die Menschen überhaupt Welt haben. Für den Menschen ist die Welt als Welt da, wie sie für kein Lebendiges sonst Dasein hat, das auf der Welt ist. Dies Dasein der Welt aber ist sprachlich verfaßt.“ Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1975, S. 419.
85„Wenn man das Element der Intention aus der Sprache entfernt, so bricht ihre ganze Funktion zusammen.“ Ludwig Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1964, S. 11.
86Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S.22 ff.
87Ebenda, S. 23 ff.
88Hegel unterscheidet das ganz „abstrakte Außereinander in Raum und Zeit“ und das „vereinzelte Außereinander in jener Abstraktion“. Darunter versteht er offensichtlich die Beziehungen zwischen den vereinzelten Atomen und Körpern. So sind Materieteilchen als Vereinzelte in der Bewegung in Zeit und Raum aufeinander bezogen. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil., a. a. O., S. 41.
89Hegel unterscheidet die äußere von der inneren Notwendigkeit. Die äußere Notwendigkeit besteht offensichtlich in den Gesetzen, die sich z. B. in den Beziehungen zwischen vereinzelten Materieteilchen, Körpern oder auch zwischen vereinzelten Individuen auf einem kapitalistischen Markt ergeben, die innere Notwendigkeit besteht dagegen in dem inneren, sich durchsetzenden Zweck oder Sinn zum Beispiel in der Natur oder auch in einer bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaft.
90Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 24 ff.
91Gemeint ist offensichtlich die Idee des Geistes, wie sie für die Welt des Geistes, z. B. ihre Institutionen, konstitutiv ist und in den Geisteswissenschaften, vollends in der Philosophie des Geistes sich selbst erkennt.
92Ebenda, S. 25.
93Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, § 222, a. a. O., S. 377.
94„Das seelische Sein in seiner organischen Form läßt den Begriff (in der Form der Seele, d. Verf.) nicht zum einfachen Fürsichsein kommen, welches er als Idee ist. Das geschieht erst auf der Stufe des geistigen Seins. Der Tod des Individuums ist nicht nur das Leben der Gattung als der objektiv allgemeinen Idee, sondern auch das „Hervorgehen des Geistes“. Und damit erst kommt die Seite des Fürsichseins in der Idee zu ihrem Recht. Sie hat notwendig wieder die Form der Subjektivität. Subjektiver Geist ist Bewusstsein, denkende Vernunft, oder die ihrer selbst bewusste Idee.“ N. Hartmann, G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 278-279.
95Das Lebendige sei zwar, so Hegel, die höchste Weise der Existenz des Begriffs in der Natur, aber hier sei der Begriff (in der Form der Seele eines Tieres) nur an sich, weil die Idee in der Natur jeweils nur als ein Einzelnes existieren würde. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, a. a. O., S. 538. Die Menschenwelt steht zwar, wie sich Hegel verstehen lässt, der Tierwelt in vieler Hinsicht nahe, unterscheidet sich aber in einer Hinsicht grundsätzlich von ihr, nämlich darin, dass sie an sich, aus bewussten und denkenden, also aus geistigen Wesen besteht. Es ist also der Geist, der die Menschen vereinigt und nicht, wie bei den Tieren, bloß die Macht der Gattung. Insofern ist die Menschheit als eine „freie Gattung“ (Hegel) unter den Lebewesen einzigartig.
96Ders., Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 6.
97Als das entscheidende Moment muss die Sprache angesehen werden, die nach Hegel dem objektiven Geist zuzurechnen ist und die man mit Hegel als ein im Einzelnen für sich seiendes Allgemeines verstehen könnte.
98„Alles ist Idee, auch die Natur ist Idee. Aber dass die Idee hier unbewußt ist, ist nur die Hälfte der Wahrheit. … Sie ist es deswegen, weil das Bewußtsein, oder die „Subjektivität“, außer ihr ist, ihr gegenüber. Das Erkennende zu ihr als Erkanntem ist erst Geist. Weil aber andererseits die Idee selbst wesenhaft Subjektivität und Geist ist, so ist in der Natur der Geist „außer sich“. Und die Idee ist „in ihrem Anderssein“. Natur ist gleichsam nur ein Halbes, und deshalb nicht das Wahre. Denn Wahrheit ist nur das Ganze. Teleologisch bedeutet dies, „dass die Natur den absoluten Selbstzweck nicht in ihr enthält“ (zitiert bei Hegel). Gleichzeitig aber, weil sie Idee ist, hat sie den Begriff dennoch in sich. Denn der Begriff ist seiner Natur nach überhaupt immanent „und damit der Natur als solcher immanent“ (zitiert bei Hegel). Also schließt sie den Widerspruch ein, den Selbstzweck in sich und nicht in sich zu haben.“ N. Hartmann, G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 284. Für Ch. Taylor ist denn auch die Naturphilosophie Hegels eine hermeneutische Dialektik. Ders., Hegel, a. a. O., S. 459.
99Dazu: Talcott Parsons, The Structure of Social Action, 3. Aufl., Glencoe 1964, S. 43 ff.
100Bei dem Anthropologen Adolf Portmann finden wir eine Bekräftigung dieses Standpunktes. Dazu die Einleitung zu seinem Buch „Zoologie und das neue Bild des Menschen“, Rowohlts deutsche Enzyklopädie, Basel 1951.
101Hegel schließt hier an den zum Begriff des Geistes eingangs zitierten Satz an, wonach die Identität des Geistes nur als Zurückkommen aus der Natur ist.
102Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 25-26.
103„Die Entwicklung des Geistes ist die Realisierung seines Wesens, und dieses ist die Freiheit. Tiefsinnig bestimmt Hegel als Wesen der Freiheit die Unabhängigkeit des Geistes von allem Äußeren, vermöge deren er von seinem eigenen Wesen abstrahieren (…) kann. So wird auch an diesem Punkte begreiflich, wie fern diese Entwicklungslehre von jeder Unterordnung des Geistes unter Naturbegriffe ist. … Nachdem nun aber einmal der Geist in die Existenz getreten ist, tritt die ganze Geschichte unter den Begriff einer Entwicklung, in welcher derselbe, was er an sich ist, für sein eigenes Bewusstsein wird, und was er als Anlage in sich trägt, durch seine Arbeit verwirklicht.“ Wilhelm Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, Gesammelte Schriften, Bd. IV, 5. Aufl., Stuttgart 1974, S. 248.
104Wenn der Geist seinem Wesen nach sogar auch von seinem äußerlichen Dasein (seiner Körperlichkeit) abstrahieren und so seine Unmittelbarkeit negieren kann, so zielt Hegel offenbar auf das Ich des Einzelnen ab. Die Negation seiner Unmittelbarkeit ist, wie sich Hegel verstehen lässt, dadurch möglich, dass er sich zunächst dessen gewiss wird, ein „Ich“ zu sein, indem er sich als ein solches mit dem Wort „Ich“, samt seinem allgemeinen Sinngehalt, ausspricht. Wenn der Einzelne, einmal zum „wirklichen Ich“ aufgestiegen, lieber den Schmerz des Todes erträgt, als z. B. andere Menschen zu verraten, so bekräftigt er das, was er geworden ist, nämlich ein Ich im nachdrücklichen Sinne des Wortes. Anders ausgedrückt: Das Ich als Begriff ist in diesem Einzelnen zum Dasein gekommen.
105Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 26 ff.
106Der subjektive Geist ist nicht denkbar, trennt man ihn vom objektiven Geist, zu dem u. a. die Sprache zählt, und der objektive Geist ist nicht denkbar, trennt man ihn von der Subjektivität, der Gesinnung und dem Willen des Einzelnen.
107Diese Einheit ist für Hegel die Idee, sein philosophisches Grundkonzept. Sie ist für ihn kein subjektiver Plan, sondern etwas, was in der Wirklichkeit enthalten, für sie konstitutiv ist. Nur das ist nach Hegel „wirklich“, was die Idee in sich trägt. Ihr jeweiliger Inhalt, z. B. ein bestimmter Freiheitsbegriff, gibt sich zudem die Form äußerlichen Daseins, z. B. in Gestalt eines bestimmten Staatsrechts. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 367.
108Das Andere könnte wohl auch ein geistloser, nur auf physischer Gewalt beruhender „Staat“ sein.
109Mit dem Anderen ist offensichtlich an dieser Stelle die Natur gemeint, die sich das Subjekt (das Ich) als ein ihm äußerliches, fremdes Objekt, eben als ein Anderes, in sich setzt, um sodann diese Setzung stets von neuem aufzuheben. Nur so ist eine Entwicklung des Geistes möglich.
110Gemeint ist offensichtlich die Natur, die für Hegel die „Idee in der Form des Anderssein “ ist Die Äußerlichkeit mache die Bestimmung aus, in der die Idee als Natur ist. Sie sei sich selbst äußerlich, d. h. sie ist nicht nur für das Subjekt des einzelnen Bewusstseins äußerlich. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, a. a. O., S. 14.
111Es ist der Geist, der sich, wie sich Hegel verstehen lässt, von der Natur als sein von ihm gesetztes Äußerliches unterscheidet und, in diesem seinem Unterschied von ihr, sich als eine Allgemeinheit (eine Totalität) setzt, die eigenständig und für sich ist, d. h. im Bewusstsein, der Subjektivität des Einzelnen überhaupt, gegeben ist.
112Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 27 f.
113In jedem Menschen ist das Ich als ein erworbenes Innerliches, als ein Geistiges, als ein Begriff, gleichermaßen enthalten, so sehr sich auch sein besonderes Ich von dem besonderen Ich jedes der anderen Menschen unterscheidet.
114Der Geist als ein konkret Allgemeines, ein Überindividuelles, manifestiert sich, wie sich Hegel verstehen lässt, u. a. in der Form des einzelnen Ich.
115Ebenda, S. 27 ff.
116So ist der Sinngehalt des Wortes „Ich“ unlösbar mit seiner Form, dem Wort, verbunden, oder kann man sich jenen Sinngehalt, losgelöst von seiner sprachlichen Form, oder diese ohne seinen Inhalt vorstellen?
117Ebenda, S. 29 f.
118Im Werden, also in den Kreisläufen der Natur, offenbart sich, wie sich Hegel verstehen lässt, die abstrakte Idee, das System logischer Kategorien, wie es Hegel in seiner Wissenschaft der Logik (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil) darstellt. Am Schluss seiner Darstellung (§ 244, a. a. O., S. 393) ist, ihm zufolge, die Idee, die für sich ist, nach ihrer Einheit mit sich Anschauen, und die anschauende Idee ist Natur. So gesehen, fällt die Natur zunächst mit der Anschauung zusammen, wie sie Ausgangspunkt der Naturwissenschaften ist. Als Anschauen ist aber, so Hegel, die Idee in einseitiger Bestimmung der Unmittelbarkeit durch äußerliche Reflexion gesetzt und damit noch nicht wahrhaft begriffen, auch nicht im „endlichen Erkennen“ der einzelnen Naturwissenschaften. Wahrhaft begriffen wird sie erst in der Naturphilosophie. In dem Zusatz zum § 244 erläutert Hegel, dass am Anfang der Logik das abstrakte Sein behandelt worden sei, und nunmehr ginge es um die Idee als Sein, und diese seiende Idee sei die Natur. Gemeint ist offensichtlich die Natur, wie sie zweifelsfrei in der allgemein gebildeten Anschauung jedes Naturforschers als notwendiger Ausgangspunkt seiner Disziplin und darüber hinaus im allgemeinen Bewusstsein gegeben ist. Feststeht jedenfalls, dass es bei Hegel keine Natur jenseits menschlicher Anschauung und menschlichen Denkens (Sprache) gibt. Die Idee der Natur als Sein wird, wie angedeutet, unmittelbar noch nicht in der Naturphilosophie entfaltet, vielmehr ist sie erst im Bewusstsein des Einzelnen enthalten und wird auf einer weiteren Stufe in den Naturwissenschaften, im endlichen Erkennen, reflektiert, aber dort wird sie eben noch nicht als das begriffen, was sie nach Hegel ist, nämlich als Idee, und dies geschieht erst in der Naturphilosophie, die allerdings auf den Resultaten, etwa der Physik, aufbaut.
119Das Offenbaren der Natur im Begriff besagt offensichtlich, dass die Natur sich im Begriff, d. h. sich im naturphilosophischen Erkennen, manifestiert. In dieser durch das begreifende Erkennen geschaffenen Natur sei diese, wie sich Hegel verstehen lässt, das Sein des Begriffs, und in diesem Sein gebe er sich die Affirmation und Wahrheit seiner Freiheit. Entgegen der gewöhnlichen Vorstellung gibt es nach Hegel außerhalb des begreifenden Erkennens oder neben ihm keine Welt der Natur. Die Aufgabe der Philosophie besteht, ihm zufolge, darin, diese Behauptung im Einzelnen zu begründen.
120Ebenda, S. 29 ff.
121Ebenda, S. 30 ff.
122Gemeint ist offensichtlich die Natur in der Form der Anschauung.
123Das Umschlagen der logischen Idee in die Natur als ihr diametral Entgegengesetztes geschieht nur in der Philosophie und ist nur denkbar, weil das Identische in beiden völlig Entgegengesetzten nach Hegel der Geist ist. Dazu: R. Kroner: „Die Logik könnte nicht in die Naturphilosophie übergehen, der Logos könnte sich nicht „entlassen“, d. h. sich als sein Gegenteil und in seinem Gegenteile sich setzen, er könnte sich nicht sich entgegensetzen, wenn nicht die Logik schon Philosophie des Geistes, der Logos nicht an sich Geist wäre.“ Von Kant bis Hegel, Bd. 2, a. a. O., S. 511.
124Bei Hegel steht: „… des Seins außer der Idee“. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 30.
125Es ist, wie sich Hegel verstehen lässt, der Geist, der sich in den modernen, analytischen Naturwissenschaften, insbesondere in der Physik, offenbart. Dieser Geist, diese Disziplinen, sind der Ausgangspunkt der Naturphilosophie, die „den Stoff, den die Physik ihr aus der Erfahrung bereitet, an dem Punkte (aufnimmt), bis wohin ihn die Physik gebracht hat, und bildet ihn wieder um, ohne die Erfahrung als die letzte Bewährung zugrunde zu legen; die Physik muß so der Philosophie in die Hände arbeiten damit diese das ihr überlieferte verständige Allgemeine in den Begriff übersetze, indem sie zeigt, wie es als sich selber notwendiges Ganzes aus dem Begriff hervorgeht“. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. Teil, a. a. O., S. 20.
126Gemeint ist offensichtlich die Natur in der Form naturwissenschaftlicher, zumal physikalischer Theorien.
127Das Selbstbewusstsein oder das tätige selbstbewusste Ich sei, so Hegel an späterer Stelle, der Grund des Bewusstseins, so dass das Bewusstsein eines anderen Gegenstandes Selbstbewusstsein sei. Das Ich des Selbstbewusstseins wüsste von dem Gegenstand als dem seinigen - er sei seine Vorstellung, und es wüsste darin etwas von sich selbst. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 213.
128Die nicht mehr äußerliche, leere, oberflächliche Einheit des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins, ist erst, wie sich Hegel verstehen lässt, in der Naturphilosophie gegeben, in der Erkennen, Wollen und Vernunft eine Synthese bilden. Hat sich ein Individuum zu einem solchen Standpunkt emporgearbeitet, dann begreift es sich als in einer Welt lebend, in der ihm nichts Fremdes, Unerkanntes, mehr gegenübersteht, eine Welt, die es als eine Vernünftige erkannt hat, deshalb will und demgemäß auch handelt.
129Das absolute Wissen ist die höchste und abschließende Stufe in Hegels „großer Phänomenologie des Geistes“ von 1807. Hier kommt der Geist zur (philosophischen) Einsicht, dass er es ist, der die gegenständliche Welt setzt wie sie zunächst im Bewusstsein erscheint. Doch bis er zu dieser Einsicht vordringt muss er noch weitere von ihm hervorgebrachte Formen und Gestalten überwinden, so am Ende noch die christliche Religion, als die Form des absoluten Wissens an sich. Von dort aus ist es nach Hegel, der diesen Aufstieg des Geistes denkend nachvollzieht, nur noch ein Schritt hin zu dem Wissen, in dem sich der Geist als absolut weiß und sich nunmehr dem „grundlegenden Gliede“ (N. Hartmann), der Philosophie, der Wissenschaft vom Absoluten, nämlich der Logik, zuwenden kann. Ders., G. W. Fr. Hegel, a. a. O. S. 141. In ihr werden, wie erwähnt, die ontologischen Kategorien, die Formen der subjektiven Logik sowie der Objektivität (in Gestalt der allgemeinen Weltmodelle) und das zentrale philosophische Konzept der Idee mittels der philosophischen Methode zu einem umfassenden System verknüpft.
130Gemeint ist offensichtlich die Natur, wie sie in der Naturphilosophie zur Darstellung kommt.
131Gemeint ist hier der Geist in der Weltgeschichte, der, anders als die Natur, die „Idee in der Form des Andersseins“ (Hegel), sich selbst erkennt.
132Ders., Phänomenologie des Geistes, in: G. W. F. Hegel Werke in zwanzig Bänden, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1970, S. 585. Nach Hegel hat sich der Weltgeist mit dem Hervorbringen der Moderne und vollends mit dem Begreifen seiner selbst in der Philosophie vollendet.
133G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 32 f.
134Was die „Realität“ betrifft, so spreche man, so Hegel, z. B. von der Realität eines Plans oder einer Absicht und verstehe darunter, dass beide nicht nur ein Inneres, ein Subjektives, sind, sondern in das Dasein hinausgetreten sind. In diesem Sinne könne man dann auch den Leib als die Realität der Seele, das Recht als die Realität der Freiheit oder die Welt als die Realität des göttlichen Begriffs betrachten. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 196.
135Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 32 ff.
136Offenbar meint Hegel die Phase in der Entwicklung des Einzelnen, in der seine Seele sich noch in der Phase des Übergangs von der Natur zum Geist befindet, sie noch „Naturgeist“ („schlafender Geist“) und dazu bestimmt ist, Geist im nachdrücklichen Sinn des Wortes zu werden. Hegel spricht hier, wie noch ausgeführt werden wird, von der „natürlichen Seele“. Nahe liegt es, an die noch embryonale Entwicklungsphase eines Kindes oder ganz an den Anfang seiner Entwicklung nach seiner Geburt zu denken.
137Statt des Wortes „vollendet“ bieten sich die Wörter „enthüllt“ oder „vollzogen“ an.
138Der Begriff ist, wie N. Hartmann Hegel zitiert, die Seele des Lebens selbst; er sei der Trieb, der sich durch die Objektivität (Leiblichkeit des Lebendigen, d. Verf.) hindurch seine Realität vermittele. Ders., G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 277. Die „wahrhafte Realität“ des Geistes ist offenbar dann erreicht, wenn der Einzelne die Stufe des freien Geistes betreten hat und damit in den objektiven Geist (Recht, Moralität, Sittlichkeit: Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat) übergeht.
139Das, was unmittelbar im Geist als Seele vorhanden zu sein scheint, ist seine Naturbestimmtheit; diese ist aber, wie sich Hegel verstehen lässt, nicht ein wahrhaft Unmittelbares. Ein solches ist vielmehr der Geist selbst, der das andere seiner selbst, seine Bestimmtheit als Natur, setzt, um sich zugleich dieser entgegenzusetzen und sich sodann über sie hinauszusetzen. Jene Naturbestimmtheit des Geistes ist also an sich (ihrem Begriff nach) von ihm selbst als sein Anderes gesetzt oder von ihm vermittelt. Der Mensch sei, so T. S. Hoffmann, existierender aktualer Geist und habe deshalb gar nicht die Wahl, ob er sich mit seiner natürlichen Unmittelbarkeit identifizieren will oder nicht. Er könne es nicht, habe er sich doch als Geist an sich schon über die Natur hinaus dazu bestimmt, ein geistig selbständiges Wesen zu sein. Ders., Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a. a. O., S. 403.
140 Der naturbehaftete Geist ist, wie Hegel später noch im Einzelnen im Zusammenhang mit der „natürlichen Seele“ ausführen wird, als Geist zwar nicht mehr Natur, aber auch noch nicht (subjektiver) Geist im vollständigen Sinn des Wortes. Dazu steigt er auf, indem er seine natürliche Geistigkeit selber als sein anderes setzt und sie sich gegenüberstellt. Wäre der einzelne Mensch nicht von seiner Anlage her dazu bestimmt, ein geistiges Wesen zu werden, so wäre eine Entwicklung von seiner „natürlichen Natur“ hin zum Bewusstsein usw. nicht denkbar. Das Aufheben des Anderen, also des „Naturgeistes“, bedeutet offensichtlich nicht nur ein Negieren, sondern auch ein Bewahren und ein Erhöhen.
141Indem der Einzelne die Stufe des „freien Geistes“ (Hegel) erreicht hat, er als subjektiver Geist das „für sich geworden, was er an sich ist“, dann geht sein Geist in den objektiven Geist über. Oder, anders ausgedrückt: Indem der Einzelne die Normen des Rechts und der Sittlichkeit verinnerlicht und sie somit zum Bestandteil seiner Persönlichkeit gemacht hat, dann ist sein subjektiver Geist in den objektiven übergegangen. Vom Einzelnen wird nicht nur erwartet, dass er sich in seinem Handeln an den Normen der modernen Gesellschaft orientiert, sondern sich diesen auch innerlich verpflichtet fühlt, was ihn nach Hegel frei macht. Der Begriff des objektiven Geistes ist, so N. Hartmann, „ein schlicht deskriptiver Begriff, philosophische Formulierung eines Grundphänomens, das sich unabhängig vom Standpunkte jederzeit aufzeigen und beschreiben läßt.“ Ders., G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 298-299.
142In Gestalt des privaten Rechts oder des Individualrechts.
143Indem die Philosophie den objektiven Geist als eine sittliche Wirklichkeit, z. B. in Gestalt des modernen Staates, begriffen und dargestellt hat, muss sie als die sich denkende Idee diese Welt wieder „frei entlassen“ (Hegel); gibt es doch für den Philosophen nunmehr keine andere Wirklichkeit als die durch sein Erkennen gesetzte, so dass diese als ein „unmittelbar Seiendes“ (ders.) gefasst werden muss. Dieser sittlichen und wirklichen Welt stehen Kunst und geoffenbarte Religion, so der Geist des Christentums, scheinbar unvermittelt gegenüber, und zwar so, als ob die eine Seite mit der anderen nichts zu tun hat. Diese Trennung muss das philosophische Erkennen als einen Mangel ansehen; ist doch für dasselbe die Idee des Geistes eine Totalität und sagt doch die gewöhnliche Vorstellung über die Beziehungen zwischen dem weltlichen und dem religiösen Leben, dass Sittlichkeit in jenem auf religiösen, zumal christlichen Normen und Prinzipien beruht. Folglich besteht nun die weitere Aufgabe des philosophischen Geistes darin, sich in seiner Tätigkeit der Idee als Religion zuzuwenden, um das voneinander anscheinend Getrennte begrifflich-theoretisch wieder zu vereinigen. Er muss sich also von der wirklichen, von ihm gesetzten und einer so als unmittelbar seiend gefassten Welt erst einmal verabschieden und sich der Welt des Glaubens zuwenden, um in der Folge diese Welt mit der Welt des wissenschaftlichen Wissens zu vermitteln, um sodann auch diese selbst zum Gegenstand seiner Reflexion zu machen. Doch hier gibt es nichts Neues; denn das Ganze des Systems der Philosophie, so N. Hartmann, sei schon da, und sie brauche sich nicht zu wiederholen. Es gebe keine andere Entwicklung der Philosophie als die inhaltliche. Ders., G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 386.
144G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 34 ff.
145Das „Scheinen“ ist nach Hegel die Bestimmung, wodurch das Wesen nicht Sein, sondern Wesen ist, und das entwickelte Scheinen sei die Erscheinung. Das Wesen sei daher nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern dadurch, dass das Wesen es ist, das existiert, sei die Existenz Erscheinung. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O. S. 261-262. Die Erscheinung sei, wie Hegel dazu in seinem Zusatz erläutert, nicht mit dem bloßen Schein zu verwechseln. Der Schein sei die nächste Wahrheit des Seins oder der Unmittelbarkeit. Das Unmittelbare sei nicht dasjenige, was wir an ihm zu haben meinen, also nicht ein Selbständiges und auf sich Beruhendes, sondern eben nur Schein, und als solcher sei das Unmittelbare zusammengefasst in die Einfachheit des in sich seienden Wesens. Dieses sei zunächst die Totalität des Scheinens in sich, es bleibe jedoch nicht bei dieser Innerlichkeit stehen, sondern trete als Grund in die Existenz hinaus, die ihren Grund nicht in sich selbst, sondern nur in einem Anderen habe, eben nur Erscheinung sei. Das Wesen bleibe nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern habe „die unendliche Güte“ (ders.), seinen Schein in die Unmittelbarkeit zu entlassen und ihm „die Freude des Daseins“ (ders.) zu gönnen. Ebenda, S. 262. „… ein Geldschein beispielsweise ist ein Stück Papier, an dem das „Wesentliche“ nicht ist, wie dieses Papier qualitativ oder quantitativ bestimmt ist, das heißt, was es in seiner Unmittelbarkeit ist, sondern das, für das dieses Stück Papier steht, nämlich der für sich als Wert unsichtbare Geldeswert, den dieses Papier hat.“ T. S. Hoffmann, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a. a. O. S. 320.
146Erst mit der Vollendung der Entwicklung von Körper und Seele wird der Körper Erscheinung oder Manifestation der Seele als Wesen und Begriff.
147Die absolute Wahrheit in den Stufen der Befreiung des Geistes, auf denen er zunächst nur als endlicher Geist waltet, ist das Vorfinden z. B. einer institutionellen Welt in Gestalt eines modernen Staates, sodann das (gedankliche) Erzeugen/Reproduzieren dieser Welt als eine von ihm selbst gesetzte und darauf die Befreiung von ihr und in ihr ist - das ist ein und dasselbe. Mit anderen Worten, die Menschen finden z. B. eine Welt normativer Ordnungen vor, machen diese zum Gegenstand der Reflexion, d. h. sie schreiten zu einer begrifflichen Reproduktion dieser Welt, und befreien sich sodann von ihr und in ihr. Die begrifflichtheoretische Erfassung der vorgefundenen Welt und die Befreiung von derselben sind also ein und derselbe Vorgang.
148Der Geist kann sich, wie sich Hegel verstehen lässt, nicht entwickeln, ohne sich endlich zu machen, d. h. sich zu beschränken. So beschränkt z. B. die Politische Ökonomie ihren Bezugsrahmen auf die bürgerliche Marktgesellschaft, also auf eine Sphäre, die sich im modernen Staat als eine relativ selbständige herausgebildet hat, und entwickelt von diesem Ausgangspunkt aus ihr theoretisches System. Nach Hegel handelt es sich dabei zwar nur um eine „endliche“, eine „Verstandeswissenschaft“, die er aber als eine notwendige Stufe hin zu seiner Staatsphilosophie betrachtet.
149So hat z. B. der vor mir liegende Euroschein als ein geltendes Zahlungsmittel seinen Grund weder in seiner äußeren Beschaffenheit noch in der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihn zu drucken und in Umlauf zu setzen, sondern in einer ökonomischen Struktur, die eine gesellschaftliche Arbeitsteilung einschließt und in der die unterschiedlichen Arbeitsprodukte von Privatproduzenten im Austausch als Werte gleichgesetzt werden, die sich dann in den Geldpreisen ausdrücken.
150Ders. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, § 94, S. 199.
151Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 35 ff.
152Die Sonne und das Sonnensystem, so lässt sich Hegel verstehen, sind für jeden geistig gesunden Menschen zweifellos eine Realität, etwas, was unbestreitbar da ist. Nun kann man diese dingliche und komplexe Realität unter verschiedenen Gesichtspunkten wahrnehmen, beobachten und beschreiben und am Ende kann der Verstand Theorien dazu entwickeln. Doch die Sonne kann sich, Hegel zufolge, nicht selber entwickeln, weil ihre Schranke nicht für sie selber, sondern nur für den Betrachter gegeben ist, und somit sind und bleiben Sonne und Sonnensystem als natürliche Dinge endlich. Und begriffen im nachdrücklichen Sinn des Wortes werden beide erst in der Naturphilosophie. Wie schon angedeutet, behandelt Hegel die „Realität“, als eine Kategorie der objektiven Logik, in seiner Wissenschaft der Logik (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O. S. 195 ff.).
153Im Geist findet, anders als in der natürlichen Dingwelt, eine Entwicklung, und zwar eine Entfaltung des Begriffs nach außen bis hin zu seiner vollendeten Darstellung statt, in der, Hegel zufolge, Begriff und Realität eine absolute Einheit bilden und damit die wahrhafte Unendlichkeit gegeben ist. Eine solche Entfaltung ist nur möglich, weil die jeweils auftretenden Schranken der Begriffsentwicklung stets in das Bewusstsein des Individuums oder der Individuen aufgenommen werden, so dass eine sukzessive Überwindung der einzelnen Schranken durch dasselbe/dieselben möglich wird. Als Beispiel könnte man die Entwicklung einer Staatsverfassung anführen, in der sich fortschreitend der normative Begriff der Freiheit entfaltet und sich schließlich mit der staatsphilosophischen Reflexion à la Hegel vollendet.
154Die Politische Ökonomie zum Beispiel konnte deshalb große Fortschritte machen, weil sich ihre Denker in der Definition ihres Gegenstandes auf die wirtschaftliche oder kommerzielle Sphäre der modernen Gesellschaft oder des Staates, beschränkten. Die Geistes- und Sozialwissenschaften überhaupt konnten nur erfolgreich sein, indem sie als Bezugsrahmen die menschliche Sinnwelt wählten und dabei von der „Natur“ abstrahierten.
155Ebenda, S. 393. Der Geist, der sich als „denkende Idee“ erkennt, ist offensichtlich die Philosophie, wie Hegel sie versteht.
155Ebenda. Der „konkrete Inhalt“ ist, wie sich Hegel auslegen lässt, z. B. ein einzelner moderner Staat. Seine „in seiner Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit“ wäre die sittliche Idee, so der Begriff der Freiheit in seiner Einheit mit der modernen Staatsverfassung.
156Hier definiert Hegel erneut seinen Gegenstand: den subjektiven Geist, und teilt ihn, wie schon erwähnt, in die Gebiete, mehr noch, in die miteinander zusammenhängenden Stufen ein, und zwar a) in die (philosophische) Anthropologie, b) in die Phänomenologie des Geistes und c) in die Psychologie (wie er sie versteht).
157Hegel verweist hier auf den § 223 in seiner „Wissenschaft der Logik“ im 1. Teil der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, a. a. O. S. 377, wo es ganz allgemein um die „Idee des (wissenschaftlichen) Erkennens“ geht. Hier geht es aber darum zu zeigen, wie der Geist des Einzelnen als konkreter Geist, sich zu einem erkennenden Geist entwickelt.
159Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 38 ff.
160Innerhalb des Bewusstseins stehen sich Subjekt (Ich) und Objekt (Nicht-Ich) oder das Ich als Subjekt und als Objekt zugleich, im Fall des „Selbstbewusstseins“, gegenüber.
161In der Seele erwacht das Bewusstsein, das sich als Vernunft setzt und unmittelbar zur sich wissenden Vernunft erwacht, und zwar indem, wie sich dieser Absatz durch Vorgriff auf spätere Ausführungen verstehen lässt, das Ich im sinnlichen, wahrnehmenden und verständigen Bewusstsein sich einer durch die Sprache (u. a. durch die darin implizit enthaltenen logischen Kategorien) geordneten, vernünftig erscheinenden Objektwelt gegenübersieht. Erzeugt durch die Tätigkeit selbstbewusster Subjekte, wird die Vernunft im allgemeinen Selbstbewusstsein zu einem Objektiven in Gestalt des sittlichen Grundgebots, wonach alle Menschen ebenso füreinander frei und selbständig wie sie auch miteinander identisch sind, und zu einem Subjektiven wird die Vernunft in Form des individuellen sittlichen Bewusstseins. Zum Bewusstsein ihres Begriffs befreit sich die Vernunft im Übergange zum theoretischen und zum praktischen Geist und vollends zum freien Geist, der beide Formen des Geistes miteinander vereinigt.
162Gemeint ist der spekulative Begriff (und nicht der Begriff als eine abstrakte Vorstellung) als ein aktives Prinzip, das im Denken des Philosophen erkannt wird.
163 Die Äußerungen der Seele, aus denen die psychologische wie auch die gewöhnliche Betrachtungsweise ihre Vermögen und Kräfte zu erkennen glauben, sind auch, wie Hegel sich verstehen lässt, für die Seele, d. h. der Einzelne fühlt, nimmt selbst wahr und versteht welche Vermögen und Kräfte in ihm tätig sind, und am Ende werden diese vom (spekulativen) Begriff enthüllt. Mit anderen Worten, jene Vermögen sind nicht nur für die fremden Beobachter der Seele eines Menschen manifest, sondern auch für diesen selbst.
164Daraus geht hervor, dass nach Hegel die Entwicklung des Einzelnen in erster Linie als ein Prozess verstanden werden muss, in dem der Begriff als ein inneres geistiges Prinzip sich stufenweise entfaltet. Von diesem von Innen kommenden Vorgang müssen die von außen kommenden Einwirkungen, etwa Erziehung und Bildung, unterschieden werden, die gewiss von großer Bedeutung für die seelische und geistige Entwicklung des Einzelnen, aber eben nicht ausschlaggebend sind. Pädagogisch verfehlt wäre es demnach, würde man für die Entwicklung des Einzelnen Erziehung und Bildung für allein entscheidend halten.
165Ebenda, S. 39 ff.
166Dies geschieht erst auf der Stufe des objektiven Geistes in Gestalt von Recht, Moralität und Sittlichkeit.
167In der Entwicklung seiner Subjektivität ist der (subjektive) Geist des Einzelnen, wie sich Hegel verstehen lässt, zugleich objektiv, hat eine unmittelbare Realität in Gestalt des körperlichen Entwicklungsstandes, und, indem der Geist diese seine Realität als seine Schranke aufhebt, wird er für sich, gelangt er dazu, seinen Begriff, seine Subjektivität zu erfassen.
168Auch der objektive Geist, z. B. eine Verfassungsordnung, ist nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv, z. B. in Gestalt eines allgemeinen Verfassungsbewusstseins.
169So sind die Stufen: sinnliches, wahrnehmendes und verständiges Bewusstsein, sowohl subjektiver als auch objektiver Natur.
170Hegel entwickelt hier den Begriff des subjektiven Geistes. Dabei geht er von den drei Momenten des (subjektiven) Begriffs aus, nämlich der Allgemeinheit, der Besonderheit und der Einzelheit. Das Allgemeine ist, ihm zufolge, das mit sich Identische „ausdrücklich in der Bedeutung“ (ders.), dass in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten ist. Das Besondere ist das Unterschiedene oder die Bestimmtheit in der Bedeutung, dass es allgemein in sich und als Einzelnes ist. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, dass es Subjekt, Grundlage ist, die die Gattung und Art in sich enthält und selbst substanziell ist. (Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 314.) Auf den Geist bezogen, hat dieser als Seele die Form der (abstrakten) Allgemeinheit, und zwar, wie sich Hegel verstehen lässt, in dem Sinne, dass die Seele die Substanz, die absolute Grundlage jeglicher Besonderung und Vereinzelung, ist (Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S 43). Als Seele hat der Geist deshalb die Form der „abstrakten Allgemeinheit“, weil er so nur im abstrakten Denken eine Realität hat. Diese Form ist jedoch damit kein beliebiger Gedanke, sondern in ihr ist die Form der Besonderung des Geistes, also nach Hegel die Form des Bewusstseins, und ferner die der der Einzelheit, der für sich seiende Geist, enthalten. Im Bewusstsein, das sich in ein Ich und seinen Gegenstand und im Selbstbewusstsein, das sich in mehrere Ich unterscheidet, manifestiert sich der Geist, aber er ist dort noch nicht für sich, nicht in der Subjektivität des Individuums enthalten. Für sich ist der Geist erst in der Form der Einzelheit, in der er nicht mehr Seele und nicht mehr mit einem Gegenstand behaftetes Bewusstsein, sondern, beide Seiten als Aufgehobene in sich enthaltend, seinen eigenen Begriff erfasst und reflektiert und damit zu sich selber, zu seiner „wahren Wirklichkeit“ (Hegel), gelangt. Dazu auch: H. Drüe, Die Philosophie des Geistes, in: Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ (1830), H. Drüe. u. a., a. a. O., S. 213. „Wahrhaft wirklich“ ist demnach nicht der einzelne Mensch als bloße Seele, auch nicht als abstraktes Ich des Bewusstseins oder als Selbstbewusstsein, sondern nur als sich selbst erfassender und denkender Geist. Der Begriff des Geistes, wie ihn Hegel hier verwendet, ist zugleich subjektiv und objektiv, er ist aber noch nicht die Idee; ist er doch nicht im Seelenleben des Einzelnen, sondern nur in dessen Betrachter vorhanden und schließt doch die Idee, Hegel zufolge, die Einheit von Subjektivität und Objektivität ein. Hegel zufolge höre man oft, der subjektive Begriff (der hier auf den subjektiven Geist bezogen wurde, d. Verf.) sei etwas Abstraktes, was insofern richtig sei, als das Denken und nicht das empirisch konkrete Sinnliche sein Element sei; er sei auch noch nicht die Idee. Insofern sei der subjektive Begriff noch formal (abstrakt, d. Verf.), aber nicht in dem Sinne, dass er einen anderen Inhalt haben oder erhalten sollte als sich selbst. Als die absolute Form sei er alle Bestimmtheit wie sie in ihrer Wahrheit ist. Obwohl er also abstrakt sei, sei er das Konkrete, das Subjekt als solches. Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a. a. O., S. 314.
171„Der subjektive menschliche Geist, der im Selbstbewusstsein für sich ist, erscheint auch schon in den leibgebundenen Empfindungen. Wir sind nicht einfach unser Leib, wir haben ihn, d. h., wir haben zu ihm ein eigenes und wandelbares Verhältnis. Der Geist ist zwar von der Natur wesensverschieden, aber in seinem primitiven Dasein doch so mit ihr eins, daß die natürlichen Bestimmtheiten zugleich auch Qualitäten des Geistes sind.“ Karl Löwith, Mensch und Menschenwelt, hrsg. v. Klaus Stichweh, Stuttgart 1981, S. 334, in: K. Löwith, Sämtliche Schriften, hrsg. v. K. Stichweh u. Marc B. Launay, Bd. 1.
172„Der subjektive Geist, wie ihn Rosenkranz im Anschluß an Hegel verstand, ist als subjektiver ein endlicher Geist und in seiner Erscheinung - aber nicht in seinem Wesen - an die Natur gebunden. Er äußert sich im seelischen und geistigen Leben des Individuums als einer endlichen Person. Als subjektiver Geist ist der Mensch zugleich schon immer über seine Naturbestimmtheit hinaus, und Rosenkranz‘ Anthropologie will den Prozeß aufweisen, in dem der subjektive Geist für sich wird, was er an sich, seiner Anlage nach, schon von Anfang an ist.“ Ebenda, S. 331.
173Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil, a. a. O., S. 41.
174Der Inhalt der vom Ich vorgefundenen Welt ist nicht nur ein Ensemble von Empfindungen aller Art, die einander abwechseln, sondern er ist durch Kategorien, wie „Seiendes“, „Etwas“, „existierendes Ding“, „Einzelnes“ usw. strukturiert (sinnliches Bewusstsein), ohne dass das (abstrakte, leere) Ich des Bewusstseins sich darüber Rechenschaft ablegt. Ebenda, S. 206.
175Vor der Stufe des Bewusstseins.
176Hier geht es um einen Erfahrungsprozess des Ich (Subjekt) mit einem Nicht-Ich (Objekt) und mit sich selbst, also um den Bewusstseinsprozess. So macht das Subjekt, das mit seinem Objekt identisch ist, die Erfahrung, dass „es im Wandel seines Objektes sich selbst wandelt. Und der Philosoph, der den Wandel verfolgt, braucht zu dieser „Erfahrung“ des Subjekts nicht mehr hinzufügen als das Wissen um sie“. N. Hartmann, G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 80. Der Wandel des Bewusstseins vom sinnlichen über das wahrnehmende bis hin zum verständigen Bewusstsein setzt die Sprache voraus. Es geht hier also um die Konstitution dessen, was von der Natur als einem Äußeren in den Empfindungen aufgenommen und durch Kategorien geordnet wird, zu einem Gegenstand des Bewusstseins, dem das Ich des Bewusstseins als ein ihm Äußerliches gegenübersteht und sich nicht darüber Rechenschaft ablegt, dass es selbst den Gegenstand konstituiert. Dieser Sachverhalt widerspricht diametral seinem „natürlichen Bewusstsein“. Gleichwohl macht das Ich, so in der Wahrnehmung, die Erfahrung, dass es und sein Gegenstand aufeinander bezogen sind und sich miteinander verändern.
177In der Phänomenologie Hegels werden, wie soeben erwähnt, die sukzessiven Erfahrungen, die das Subjekt mit dem Objekt und damit zugleich mit sich selbst macht, nachvollzogen. Dies geschieht zum einen in seiner „Phänomenologie des Geistes“ (1806) und zum anderen in seiner „Philosophie des Geistes“ als Teil seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, der hier im Mittelpunkt steht.
178Bei Hegel steht „in sich reflektiert“. Zumal im Fall des sinnlichen Bewusstseins wird das Ich vom Nicht-Ich „absorbiert“, im Fall des Selbstbewusstseins ist das Ich dagegen ein „praktisches, aktives, und die Erfahrung, die es macht, gehört einer anderen Problemschicht an“. N. Hartmann, G. W. Fr. Hegel, a. a. O., S. 105. Jedenfalls ist das Ich als ein nunmehr handelndes (und begehrendes) nicht mehr, wie in der Form des Bewusstseins, auf einen anderen, ihm gegenüberstehenden Gegenstand, sondern auf sich selbst und in seiner weiteren Entwicklung auf andere, gleichermaßen selbständige Ich bezogen. Soweit dieses Ich des Selbstbewusstseins einem anderen Gegenstand als sich selbst gegenübersteht, ist dieser in erster Linie Objekt seiner Begierde und nicht seiner (neutralen) Wahrnehmung oder seines Verstandes.
179Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 41 ff.
180Hegel denkt hierbei offensichtlich sowohl an die materielle Arbeit - die definitionsgemäß den Zweck einschließt, den Arbeitsgegenstand gemäß einer bestimmten Zweckvorstellung umzuformen, eine Tätigkeit, die nur erfolgreich sein kann, wenn der Arbeitende über das erforderliche Wissen und die notwendigen Fertigkeiten verfügt - als auch an den Kampf des Menschen mit dem Menschen um gegenseitige Anerkennung als ein Ich.
181Die allgemeine Anerkennung jedes Menschen als ein Ich, als Ergebnis eines Kampfes des Menschen mit dem Menschen, ist, wie sich Hegel verstehen lässt, eine Grundnorm, die sowohl jedem Einzelnen als ein Objektives gegenübersteht (Bewusstsein) als auch in jedem Einzelnen als ein Subjektives (Gesinnung) vorhanden ist.
182Ebenda, S. 41 ff. Hier legt sich der Einzelne als subjektiver Geist fortschreitend darüber Rechenschaft ab, dass er sich, so in seinem Erkennen der Welt, ausschließlich in der Sphäre des Geistes bewegt. In allem, was er zum Gegenstand seiner Anschauung, Vorstellung und seines Denkens macht, weiß er zunehmend sich selbst als Geist anwesend und tätig. Kurz, die dem Ich gegenüberstehende Welt ist für dieses in letzter Analyse nichts als Geist.
183Kurz gefasst ist das konkret Allgemeine die Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere. Theodor W. Adorno, Einleitung in die Soziologie, a. a. O., S.61. Gemeint ist auch „Totalität“ (d. Verf.).
184So begreift Hegel z. B., wie schon erwähnt, den Staat als „Wirklichkeit der sittlichen Idee“ und geht dabei nicht von einem in der Anschauung und der Vorstellung eines Staatswissenschaftlers gegebenen Staat, sondern von der „Idee des Staates“ aus. Doch dieses Konzept als Ausgangspunkt der philosophischen Theoriebildung setzt die Vorarbeit der einzelnen empirischen und theoretischen Staatswissenschaften voraus. Der moderne Staat, als eine sittliche, eine Vernunftidee verstanden, schließt, Hegel zufolge, die Einheit von Subjektivität, das Wissen des einzelnen Staatsbürgers von der Verfassungsordnung und das Wollen derselben (Verfassungsbewusstsein), und von Objektivität. die Verfassungsordnung, ein. Und, indem die Staatsbürger und Staatsdiener gemäß ihrem Verfassungsbewusstsein handeln, setzen sie den Staat als (Verfassungs-)Wirklichkeit. Ders., Grundlinien der Philosophie des Rechts, a. a. O., S. 398 u. 292. Die Idee des Staates ist nach Hegel eine Totalität.
185So geht z. B. die Soziologie bei der Konstruktion des Gesellschaftsbegriffs nicht von einer empirischen Gesellschaft, sondern von einer Handlungs-, einer Struktur- oder von einer Handlungs- und Strukturtheorie aus, jedenfalls von einem theoretischen Konzept.
186Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. Teil., a. a. O., S. 42 f.
187Hegel meint hier offenbar den „wirklichen freien Willen“ (ders.), den Willen, der auch für sich ein freier ist, weil sich die Zufälligkeit und die Beschränktheit des praktischen Inhalts aufgehoben hat. Dieser Wille habe die Freiheit als allgemeine Bestimmung, Gegenstand und Zweck, indem er sich denkt, seinen Begriff wisse, Wille als freie Intelligenz ist. Ders., ebenda, S. 300.