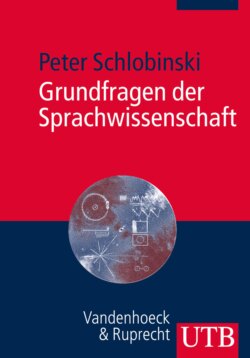Читать книгу Grundfragen der Sprachwissenschaft - Peter Schlobinski - Страница 10
ОглавлениеSprache und Sprachen
9 Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?
Die meistgenannte Zahl ist ca. 6500. Eine genaue Festlegung ist allerdings kaum möglich, da zum einen nicht alle Sprachen erfasst sind (z.B. im Amazonasgebiet) und zum anderen sich die Frage stellt, was eine Sprache und was eine Sprachvariante ist. Ist das Schweizerdeutsche eine eigene Sprache oder eine Variante des Deutschen?
Die für Sprachwissenschaftler wichtigste Quelle ist die nunmehr in 16. Auflage vorliegende Ethnologue-Enzyklopädie (Lewis 2009). Dort sind 6909 Sprachen aufgelistet, 473 der Sprachen gelten als stark bedroht. Das Chinesische (Mandarin) ist die Sprache mit den meisten Muttersprachlern, das Deutsche steht an 10. Stelle (vgl. Tab. 1).
| Sprache | Anzahl Muttersprachler |
| 1. Chinesisch | 1.213.000.000 |
| 2. Spanisch | 329.000.000 |
| 3. Englisch | 328.000.000 |
| 4. Arabisch | 221.000.000 |
| 5. Hindi | 182.000.000 |
| 6. Bengali | 181.000.000 |
| 7. Portugiesisch | 178.000.000 |
| 8. Russisch | 144.000.000 |
| 9. Japanisch | 122.000.000 |
| 10. Deutsch | 90.300.000 |
Tab. 1: Verteilung der Sprachen nach Muttersprachlern (nach Lewis 2009)
Die meisten Sprachen gibt es in Papua-Neuguinea (890), an zweiter Stelle steht Indonesien mit 790 Sprachen, an dritter Nigeria mit 514 Sprachen, es folgt Indien mit 445 Sprachen. Da die meisten Sprachen von weniger als 5000 Menschen gesprochen werden, geht man davon aus, dass ein Großteil der Sprachen aussterben wird und in 100 Jahren vielleicht nur noch 600 Sprachen existieren. Gründe hierfür liegen in Nationalisierungs- und Globalisierungsprozessen. In Deutschland gelten 13 Sprachen als gefährdet, darunter das Sorbische und Saterfriesische. In der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen von 1992 haben sich die europäischen Staaten verpflichtet, ihre Regional- und Minderheitensprachen zu wahren und zu fördern.
10 Welche sprachlichen Grundtypen gibt es?
Seit Wilhelm von Humboldt (1767–1835) und August Wilhelm von Schlegel (1767–1845) gibt es den Versuch, die Sprachen der Welt in Grundtypen einzuteilen. Die entscheidenden Kriterien, nach denen Sprachen grundlegend klassifiziert wurden, sind der Formenreichtum, der Reichtum an Strukturen und die Art und Weise, wie diese Strukturen aufgebaut werden. In neueren Arbeiten ist dies insbesondere von Josef Greenberg (1915–2001) verfeinert worden (s. auch Kap. 16), an dieser Stelle soll es allein um die sprachlichen Grundraster gehen.
Eine erste Unterscheidung ist die in analytische bzw. isolierende Sprachen und synthetische Sprachen. Eine isolierende Sprache weist keine oder geringe Formenbildung auf. Der Prototyp einer isolierenden Sprache ist das klassische Chinesisch, wie Beispiel (1) von Sīm Qiān (145 v. Chr.–90 v. Chr.) zeigt. Auch das moderne Chinesisch ist weitgehend isolierend (2).
| (1) | Lo | rén | ér | tí |
| alt | Mensch | Kind | wein | |
| Die alten Menschen weinten wie Kinder. | ||||
| (2) | Tā sòng | tā yī | běn | shū |
| er schenk er ein KL Buch [tā = ›er‹] | ||||
| Er schenkt ihm ein Buch. |
Die Wörter treten im Satz ›isoliert‹ auf, d.h. es gibt – anders als im Deutschen – keine Endungen, die Kasus, Numerus, Tempus oder Aktiv/Passiv anzeigen (vgl. 3).
| (3) | Er | schenk-t-e | ihm | ein | Buch |
| er.Nom | schenk-Prät-3s | er.Dat | ein.Akk | Buch.Akk |
Sprachen wie das Deutsche nennt man flektierende (›beugende‹, von lat. flectere ›beugen, biegen‹) Sprachen. Sie verändern sich in Abhängigkeit von Parametern wie Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) beim Substantiv und z.B. nach Tempus und Numerus beim Verb. Es tritt eine Reihe von Endungen auf, die grammatische Informationen tragen, wobei meistens keine Eins-zu-eins-Beziehung von Form und Funktion besteht. Ein Buch in (3) hat den Akkusativ, da die Wortgruppe als direktes Objekt auftritt, aber in dem Satz Ein Buch ist etwas Großartiges hat die gleiche Wortgruppe den Nominativ, denn sie nimmt die Funktion des Subjekts im Satz ein. Nominativ und Akkusativ sind hier also nicht zu unterscheiden, es liegt Formengleichheit vor (Fachterminus: Synkretismus). Zu den flektierenden Sprachen gehören u.a. die germanischen, romanischen und slawischen Sprachen.
Sprachen, bei denen eine eindeutige Beziehung zwischen Form und Funktion der Endungen vorliegt, nennt man agglutinierende Sprachen (lat. agglutinare, ›zusammenkleben‹). Sie gehören wie die flektierenden Sprachen zu den synthetischen Sprachen. Das Türkische ist eine typische agglutinierende Sprache (s. Tab. 2). Die besitzanzeigenden Endungen haben nach Person und Numerus eine eindeutige Form, das -i in evi (›sein/ihr Haus‹) kodiert die Information 3. Person Singular Possessivum, das -m in evim ›1. Person Singular Possessivum‹; das -i zwischen ev und -m ist ein Bindevokal, der die Aussprache erleichtert und die einfache Silbenstruktur des Türkischen aufrechterhält (zur Silbenstruktur s. Kap. 41). Im Türkischen gibt uns die Endung -lar die Information Plural, wir können nun bilden: okul (Schule) + lar + i-m → okullarim ›meine Schulen‹.
| Singular | Plural | |
| 1. Person | ev-i-m | ev-i-miz |
| 2. Person | ev-i-n | ev-i-niz |
| 3. Person | ev-i | ev-leri |
Tab. 2: Possessivendungen im Türkischen ( ev = Haus)
Zum vierten Sprachbautyp gehören die polysynthetischen Sprachen. Sie sind den flektierenden ähnlich, aber es werden noch mehr Endungen (genauer: Affixe, s. Kap. 43) gebunden, die häufig weiter verschmelzen. Die einzelnen Wörter sind extrem komplex und dicht gepackt. Sätze haben die Tendenz, aus wenigen komplexen Wörtern zu bestehen. Die Indianersprachen der Nordwestküste Amerikas, wie das Nuu-chah-nulth (4,5), sind typische polysynthetische Sprachen. (In der obersten Zeile ist die gesprochene Form gegeben, die in der zweiten Zeile nach Bedeutungsbausteinen aufgelöst ist.)
| (4) | qašiama | atuši |
| qa-ši-‘a-ma | atuš-i | |
| tot-Perf-Temp-Ind | Hirsch-ART | |
| Der Hirsch starb. | ||
| (5) | ičiama | qwayaċiki |
| i-či-’a-ma-ah | qwayaċik-i | |
| schieß-Perf-Temp-Ind-1s | Wolf-ART | |
| Ich schoss (auf) den Wolf. |
Polysynthetische Sprachen haben eine Tendenz zur Inkorporation (s. 6). Damit ist gemeint, dass freie Wörter in ein anderes Wort integriert werden, insbesondere Substantive in das Verb. Im Deutschen tritt dieses Phänomen auch auf, z.B. wird aus der Verbindung die Ehe brechen das Verb ehebrechen. Das Bella Coola, das an der Pazifikküste Kanadas in British Columbia noch von etwa hundert älteren Personen gesprochen wird, ist eine polysynthetische Sprache, die zudem stark inkorporierende Züge aufweist. So können Körperteilbezeichnungen als Endungen in das Verb integriert werden (6):
(6) kma-ank-uik-ak--tx
schmerzen-Seite-Rücken-Hand/Arm-ich/mein-ART
Die Seite meines Handrückens schmerzt.
Sprachen, die stark inkorporieren, heißen inkorporierende Sprachen. Die unterschiedlichen Grundtypen treten praktisch nie in ›reiner‹ Form auf. Es handelt sich um eine Grobklassifizierung mit prototypischen Eigenschaften. Dennoch bilden sie ein ganz gutes Raster, und wenn man sich jeweils eine typische Sprache aus diesen Grundtypen genauer angesehen hat, dann kann einen im Hinblick auf linguistische Strukturen kaum noch eine Sprache überraschen.
11 Welche ist die schwierigste Sprache der Welt?
Wenn man unter ›schwierig‹ versteht, dass etwas viel Kraft, Mühe, große Anstrengung erfordert, und wenn man Mark Twains Ausführungen in seinem Reisebericht Die schreckliche deutsche Sprache folgt, dann ist das Deutsche die am schwersten zu erlernende Sprache. Denn: »Nach meiner Erfahrung braucht man zum Erlernen des Englischen 30 Stunden, des Französischen 30 Tage, des Deutschen 30 Jahre. Entweder reformiere man also diese Sprache, oder man lege sie zu den toten Sprachen, denn nur die Toten haben heutzutage noch Zeit genug, sie zu erlernen« (Twain o.A.: 161).
Ob eine Sprache schwer oder leicht zu erlernen ist, hängt von ihrer Komplexität ab und von den Ausgangsvoraussetzungen. Für jemanden, der Latein gelernt hat, ist es leichter, eine romanische Sprache zu lernen, als für jemanden, der es nicht gelernt hat. Ein Muttersprachler des Dänischen wird das auf dem Dänischen basierende Bokmål, eine der beiden Standardsprachen Norwegens, leichter erlernen als ein Muttersprachler des Tibetischen. Von daher kann man nicht bestimmen, welche die schwierigste Sprache der Welt ist. Aber als Faustregel kann man festhalten: Je stärker eine zu erlernende Sprache von den muttersprachlichen Strukturen abweicht, desto schwieriger ist es, sie zu erlernen.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der zu berücksichtigen ist: die Komplexität. Eine Sprache, die statt vier Kasus wie das Deutsche (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) 15 Kasus hat wie das Finnische, ist im Hinblick auf diese Kategorie komplexer, und höhere Komplexität erfordert in der Regel eine erhöhte Lernanstrengung. Allerdings gibt es nicht die komplexeste Sprache, da immer nur einzelne Teilstrukturen komplexer oder weniger komplex sind. Also auch von daher gibt es nicht die schwierigste Sprache der Welt – vielleicht mit einer Ausnahme: das Ithkuil.
Das Ithkuil ist eine von dem Amerikaner John Quijada konstruierte Sprache (s. auch Kap. 18), die linguistisch so komplex ist, dass sie schwer zu erlernen ist. Das Ithkuil verfügt über 65 Konsonanten, 17 Vokale, 13 Diphthonge (wie au) und 7 Töne. Es gibt 81 Kasus, 200 konsonantische Suffixkategorien mit neun Graden, sodass 1800 unterschiedliche Suffixkategorien gebildet werden können. Das Basislexikon besteht aus 16200 Stämmen, die aus 900 Wurzeln abgeleitet sind (1). Im Schriftsystem ist lautliche und morphologische Information kodiert, die Schreibrichtung ist wie bei alten griechischen Inschriften bustrophedonal (von gr. bous ›Ochse‹ und strephein ›wenden‹ = wie der Ochse pflügt), d.h. sie geht von links nach rechts und von rechts nach links. So weit nur einige Punkte.
(1) Ai’tilafxup embuliëqtuqh.
DYN-CTX/ASR/PPS-RCP-‘sprech-NRM/PRX/N/ASO/CST-SIM1/9-IFLSTA-‘land’-IND-NRM/DEL/M/CSL/UNI-MET1/6-INL1/9-IFL
Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.
[wörtlich: Jede Person im Land sprach die Sprache in gleicher Art zueinander.]
Der feinen Differenzierung und Detaillierung sowie dem logischen Aufbau des Ithkuil liegt die Idee zugrunde, eine Sprache zu konstruieren, die möglichst eindeutig ist und in der Vagheit so weit als möglich ausgeschlossen werden kann: »Natural human languages are notorious for their semantic ambiguity, polysemy (multiple meanings for a given word), semantic vagueness, inexactitude, illogic, redundancy, and overall arbitrariness. Theoretically, it should be possible to design the language to minimize these various characteristics in favor of greater semantic precision, exactitude, and specification of a speaker’s cognitive intent« (Quijada 2011: Introduction5). Das Ithkuil ist eine formalisierte Sprache auf der Folie linguistischer Prinzipien natürlicher Sprachen. Ob es überhaupt möglich ist, eine ›exakte‹ Sprache zu konstruieren, ist ein Problem, das eine lange Tradition hat (s. hierzu Kap. 99).
Abb. 4: Ornamentalschrift des Ithkuil4
12 Hat nur der Mensch Sprache?
In dem Science-Fiction-Roman Sternenflut von David Brin werden Delfine genetisch manipuliert (»geliftet«), um in Koexistenz mit den Menschen spezifische Aufgaben übernehmen zu können. Die Delfine beherrschen drei Sprachen: das Primal, die Ursprache der Delfine, eine einfache Sprache, die die Spezies untereinander und in bestimmten Situationen (Gefahr: Hilferufe) ›spricht‹. Das Trinär ist eine Haiku-artige Sprache, deren Symbolhaftigkeit sich einer sachlichen Logik entzieht und die primär in der Kommunikation mit den Menschen angewandt wird, mit entsprechenden Interpretationsproblemen. Das Anglische als die Englisch-Variante der zukünftigen Menschen ist die dritte Sprache, die von den Delfinen allerdings nur rudimentär ›gesprochen‹ wird.
So weit die Fiktion. Doch auch wenn sich die Spezies der Delfine vom Menschen und an Land lebenden Säugetieren stark unterscheidet und folglich die Kommunikationsformen abweichen – Delfine und andere Walarten verfügen über keinen Gesichtsausdruck und mimische Gesten –, so zeigen Untersuchungen (Lilly 1969), dass Delfine über hochfrequente Signale Informationen austauschen und durch ihre Körpersprache Gemütsverfassungen mitteilen. Delfine haben multimodale Imitationsfähigkeiten. Die akustischen Signale, die vom Menschen als Pfeif-, Grunz- und Quietschlaute wahrgenommen werden, dienen zur Koordinierung der Jagd, der Kommunikation beim Paarungsverhalten, zur Abwehr von Feinden etc. Jeder Delfin verfügt über einen Idiolekt und Delfingruppen entwickeln eigene Dialekte. Und Delfine sind wie Schimpansen in der Lage, eine Zeichensprache zu lernen. Bei Experimenten konnte bewiesen werden, dass Delfine bis zu 60 Einzelzeichen erlernen, die sie zu drei Zeichenverbindungen kombinieren können. Ein Delfin ist in der Lage, die Einzelzeichen ›Ball‹, ›Reifen‹, ›holen‹ in der Zeichenfolge ›Ball – holen – Reifen‹ als Befehl ›Hole den Ball und bringe ihn zum Reifen‹ und die Zeichenfolge ›Reifen – holen – Ball‹ als ›Hole den Reifen und bringe ihm zum Ball‹ zu interpretieren. Offensichtlich werden die Zeichensequenzen als eine Handlungsanweisung des Typs ›Bewege das Objekt X zum Zielpunkt Y‹ verstanden. In einer jüngsten Studie konnte bei einem Weißwal erstmals das Nachahmen menschlicher Stimmen nachgewiesen werden. Die um Oktaven tiefer liegenden menschlichen Lautstrukturen erzeugte der Wal »by varying his nasal tract pressure and making concurrent muscular adjustments of the vibrating phonic lips while over-inflating vestibular sacs« (Ridgway et al. 2012: R861).
Neben den Walen sind Schimpansen kleine Sprachkünstler, die nicht nur durch die Fähigkeit des Nüsseknackens und Termitenangelns beeindrucken, sondern vermutlich gerade wegen des Gebrauchs von Werkzeugen auch Sprachfähigkeiten entwickelt haben. Motorisch sind Schimpansen nicht in der Lage zu sprechen, da die Anatomie des Kehlkopfs, der Zunge und des Gaumens nicht zur Artikulation der Sprache geeignet sind. Wie aber Untersuchungen seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts beweisen, sind Schimpansen kognitiv in der Lage, sprachlich, wenn auch nicht lautsprachlich zu kommunizieren. Berühmt ist die Schimpansin Washoe, die in der ›American sign language (ASL)‹ unterrichtet wurde. Washoe erlernte innerhalb von vier Jahren 132 ASL-Zeichen und konnte diese in neue Kontexte sinnvoll einsetzen.
Eine zweite Berühmtheit ist Sarah, die 130 Wortsymbole unterscheiden und diese auf einer Magnettafel zu sinnvollen Einheiten zusammensetzen konnte. Die Psychologen, die Sarah trainiert hatten, stellen fest: »Verglichen mit einem zweijährigen Kind kann Sarah sich in der Sprachfähigkeit durchaus behaupten« (Premack/Premack 1972: 430). Ein wesentlicher Einwand gegen Schlussfolgerungen dieser Art war jedoch die Tatsache, dass die Schimpansen in Experimenten und über Belohnungssysteme die Sprache antrainiert bekommen hatten, sie waren konditioniert. Dies wäre mit keinem natürlichen Spracherwerb wie bei Kindern vergleichbar. Und diese berechtigte Kritik relativiert die Ergebnisse in der Tat. Doch dann erscheint Anfang der 80er Jahre Kanzi auf der Bildfläche der Primatenforschung.
Kanzi, Sohn eines sprachtrainierten Bonoboweibchens namens Matata, kam im Alter von sechs Monaten mit graphischen Symbolen, Gesten und gesprochener Sprache in Kontakt. Anders als in den Vorgängerstudien wurde er jedoch nicht konditioniert, sondern es blieb bei Angeboten und Ermunterungen. Das Ergebnis war überraschend. Kanzi erwarb die Kompetenz, Einwort- und Mehrwortsätze zu produzieren, und ein Vergleich mit den rezeptiven sprachlichen Fähigkeiten eines zweijährigen Mädchens ergab Ähnlichkeiten (Savage-Rumbaugh et al. 1993). Savage-Rumbaugh, die Primatologin, die mit Kanzi arbeitete, zog daraus die Schlussfolgerung, dass wir unsere Sichtweise auf das »Lebewesen Affe revidieren müssen. Wenn Affen Sprache auf die gleiche Art wie Menschen – das heißt ohne besonderen Unterricht – erwerben können, dann bedeutete das, daß der Mensch keine einzigartige Form von Intelligenz besitzt, die sich grundlegend von der aller Tiere unterscheidet. Vielleicht war es für den Homo sapiens ein besonderes Geschehen, daß er sprachähnliche Laute hervorbringen oder Werkzeuge herstellen konnte, aber das bedeutet nicht, daß er die Dinge auf einer ganz anderen Ebene verstand als die übrigen Lebewesen« (Savage-Rumbaugh/Lewin 1995: 159).
Trotz Kanzis Sprachfähigkeiten besteht zwischen diesen und der menschlichen Sprachfähigkeit nicht nur ein gradueller, sondern ein qualitativer, kategorialer Unterschied. Aber dennoch: Das sprachliche Potenzial bei Affen lässt den Schluss zu, dass subhumane Primaten über protosprachliche Fähigkeiten verfügen. Diese können als ein wichtiger Aspekt der Sprachevolution und als Ausgangspunkt der Phylogenese der menschlichen Sprache gesehen werden.
13 Über den Ursprung der Sprache
Dass Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen habe, dies nachzuweisen war der Versuch des deutschen Pfarrers Johannes Peter Süßmilch (1707-1767) in seiner 1766 publizierten Schrift Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, in der academischen Versammlung vorgelesen und zum Druck übergeben. Ausgangspunkt seiner Argumentation bildet die Überlegung, dass die Sprache so vollkommen sei, dass nur der Schöpfer dieses Wunderwerk habe vollbringen können. Mit und seit der natur- und sprachwissenschaftlichen Betrachtung von Sprache wird nicht Gott als Schöpfer, sondern die Evolution als zentraler Entwicklungsfaktor von Sprachfähigkeit gesehen. In einer modernen Fassung lautet die evolutionstheoretische Hypothese wie folgt: »Social communication has been around for as long as animals have interacted and reproduced sexually. Vocal communication has been around at least as long as frogs have croaked out their mating calls in the night air. Linguistic communication was an afterthought, so to speak, a very recent and very idiosyncratic deviation from an ancient and well-established mode of communicating« (Deacon 1997: 52). Sprachentwicklung wird als ein Adaptions- und Selektionsprozess begriffen: »Instead of approximating an imaginary ideal of communicative power and efficiency, or following formulae derived from an alleged set of innate mental principles, language structures may simply reflect the selection pressures that have shaped their reproduction« (ebd. S. 111).
Es sind besondere Entwicklungsschritte, die in Zusammenhang mit der Sprachentwicklung, der Phylogenese von Sprache gesehen werden:
1. Die Vergrößerung des Gehirns auf 700 bis 1300 Kubikzentimeter beim Homo erectus gegenüber dem Homo habilis. Eine Hypothese lautet, dass die Sprachentwicklung die Ursache für das Gehirnwachstum sei, eine andere, dass das Gehirnwachstum Sprachentwicklung bedingt (vgl. Kap. 74), eine dritte, dass Gehirnwachstum und Sprachentwicklung interdependent verliefen.
2. Der Nachweis des motorischen Sprachzentrums (Broca-Zentrum) durch Endocraniumabdruck eines Homo-erectus-(Sinanthropus-)Schädels (Zhoukoudian).
3. Die Veränderung des Stimmtrakts, nämlich eines tief liegenden Kehlkopfs. Der Stimmtrakt des Steinheim-Menschen (vor 300 000 Jahren), so zeigt die Rekonstruktion, ist unserem heutigen sehr ähnlich. Damit sind gegenüber anderen Primaten alle Voraussetzungen für artikulierte Sprache gegeben.
4. Die Rückbildung der Kiefermuskulatur hat dazu beigetragen, dass »die für das Sprechen erforderlichen Bewegungen des Unterkiefers im Laufe der Evolution immer besser kontrolliert werden konnten« (Carroll 2008: 262).
5. Die Schimpansenforschung zeigt, dass auch andere Primaten über Sprachfähigkeit verfügen (s.u. und Kap. 12). Dieser Punkt ist besonders interessant, da in der Primatenforschung die Schnittstelle von menschlicher und nicht-menschlicher Sprachfähigkeit besonders gut untersucht werden kann und zahlreiche Ergebnisse aus empirischen Studien vorliegen.
Johann Gottfried von Herder (*25.8.1744 in Mohrungen, †18.12.1803 in Weimar)
Herder hat als Philosoph, Dichter und Übersetzer zusammen mit Goethe, Schiller und Wieland das ›Viergestirn‹ der Weimarer Klassik bildend, die deutsche Klassik und Romantik wesentlich beeinflusst, und er hat die deutsche Sprach- und Geschichtswissenschaft mit begründet.
Neben seinem Frühwerk Fragmente über die neuere deutsche Literatur (1766/67) und der 1773 herausgegebenen Sammlung programmatischer Schriften unter dem Titel Von deutscher Art und Kunst, die für die deutsche Literatur von großer Bedeutung waren, ist es seine Abhandlung Über den Ursprung der Sprache (1772), die für die Sprachwissenschaft paradigmenbildend war. Gegen Süßmilchs Position, die Sprache sei von Gott gegeben (s. Text), vertritt Herder die Meinung, dass »Gott durchaus für die Menschen keine Sprache erfunden [hat], sondern diese haben immer noch mit Würkung eigner Kräfte, nur unter höherer Veranstaltung, sich ihre Sprache finden müssen« (Herder 1772: 63). Vielmehr finde sich der Ursprung der Sprachen in den »wilden Tönen freier Organe« (ebd. S. 18), wie sie auch bei Tieren zu finden sind.
Was aber unterscheidet die menschliche Sprache von der tierischen Lautgebung? »Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal frei würkend, hat Sprache erfunden« (ebd. S. 52). Und: « − die Sprache ist erfunden! Eben so natürlich und dem Menschen nothwendig erfunden, als der Mensch ein Mensch war« (ebd. S. 56).
Der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, vertritt die These, dass erste Formen menschlicher Kommunikation in Zeigegesten und in der Nachahmung liegen und dass Gesten von Affen »are the original font from which the richness and complexities of human communication and language have flowed« (Tomasello 2008: 55). Der symbolischen Kommunikation geht die gestische, deiktische Kommunikation voraus, und sie kann rückgebunden werden auf nichtmenschliche, gestische Kommunikation der höheren Primaten. Es gibt zwei grundsätzliche Typen von Affengesten: Intentionalitätsgesten, z.B. Arm-Heben, um das Spiel zu initiieren, und Aufmerksamkeitsgesten. Der kommunikative Akt von Affengesten ist der folgende: »check the attention of other > walk around as necessary > gesture > monitor the reaction of other > repeat or use another gesture« (ebd. S. 33). Während Intentionalitätsgesten eine soziale Intention ausdrücken im Sinne von ›Gestengeber (G) will, dass der Rezipient (R) die durch die Geste ritualisierte Bedeutung tut‹, drücken Aufmerksamkeitsgesten aus, dass G will, dass R etwas sieht, und dies hat möglicherweise die Bedeutung, dass G R etwas tun lassen will. Über die gestische Kommunikation hinaus, die auch für die menschliche Kommunikation basal ist – der Leser achte einmal darauf, wie oft er mit dem Finger auf etwas zeigt, um bestimmte Intentionen auszudrücken, z.B. beim Einkauf –, sind Affen in der Lage, mit Menschen symbolisch zu kommunizieren. Die Forschungen von Susan Savage-Rumbaugh zu Zwergschimpansen (Bonobos) zeigen (s. Kap. 12), dass diese einen Wortschatz von 150 Wörtern erwerben können und Wörter in Form von Bildsymbolen zu Zwei- und Dreiwortsätzen kombinieren können, und sie sind dabei kreativ. Bonobos also haben die Fähigkeit, einfache sprachliche Systeme zu lernen, sie entwickeln aber diese nicht spontan. Was unterscheidet qualitativ die Sprachfähigkeit des Menschen von anderen Primaten und anderen Tieren (Delfinen, Papageien)? Was sprachliche Kommunikation einzigartig macht, ist nach Tomasello die Fähigkeit der kooperativen Kommunikation, der Wir-Intentionalität. Sowohl Sprecher als auch Hörer wissen, dass sie die gleiche Konvention in der gleichen Art und Weise gebrauchen, sie (glauben zu) verfügen über ein gemeinsam geteiltes Wissen: A weiß, dass B weiß, dass A weiß, dass X. Wenn A B auffordert, Y zu tun, dann glaubt er zu wissen, dass B weiß, dass A weiß, was die Aufforderung umfasst. Und in Bezug auf das sprachliche Zeichensystem (s. hierzu Kap. 19) ist entscheidend der Übergang zur symbolischen Kommunikation, zur Kommunikation mit arbiträren Zeichen.
Für Tomasello ist Sprache entstanden im Prozess der Soziogenese, im Prozess der ›kumulativen kulturellen Evolution‹. Hier gibt es zwei Grundformen, wodurch in sozialen Interaktionen etwas Neues entstehen kann. Die erste umschreibt Tomasello mit dem Begriff ›Wagenhebereffekt‹. Eine Innovation, sei es bei der Werkzeugherstellung bzw. dem Gebrauch von Werkzeugen oder der symbolischen Kommunikation, wird an spätere Benutzer weitergegeben, und die soziale Tradierung verhindert (stützend wie ein Wagenheber), dass die Benutzer hinter die neue Praxis zurückfallen. Die Innovation kann durch einen Einzelnen oder, und dies wäre die zweite Art der Soziogenese, durch die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Individuen entstehen. Konstruieren wir ein Szenario, in dem beide Formen der Zusammenarbeit gemeinsam auftreten. Nehmen wir an, eine Gruppe von Hominiden gebrauchte eine Zeigegeste kombiniert mit der Lautgeste ko, um vor einer größeren Raubkatze zu warnen. Aufgrund des Stadiums der Werkzeugherstellung waren sie zunächst nicht in der Lage, sich gegen Löwen zu verteidigen oder gar sie zu jagen. Eines Tages kommt ein Individuum auf die Idee, einen Steinabschlag und einen Stock zu einem Speer zu kombinieren, um Tiere zu jagen, nachdem es vergeblich versucht hatte, eine Schlange zu erlegen. Es stellt also den Speer her und zeigt den anderen Gruppenmitgliedern, wie seine neue Erfindung funktioniert. Die anderen imitieren sein Handeln, so dass sich eine kulturelle Praxis des (zunächst) Kleintierjagens per Speer entwickelt, die auch von den Jüngeren gelernt und später an ihre Kinder weitergegeben wird. Über einen gewissen Zeitraum wird der Speer verbessert, so dass auch größere Tiere gejagt werden können, um den Stamm ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Auf der Suche nach Wild hört eine Gruppe von Jägern einen Löwen, von dem sie glauben, dass er derjenige sein muss, der bereits zwei ihrer Stammesmitglieder getötet hat. Die Jäger, die gelernt haben, ihre Jagdhandlungen zu koordinieren, flüstern ko und schauen in die Richtung, wo sie den Löwen vermuten. Durch Handzeichen koordinieren sie ihr gemeinsames Handeln, pirschen sich an und erlegen den Löwen. Sie ziehen dem Löwen das Fell ab und nehmen es mit zurück zu dem Platz, wo der Stamm lagert. Die Jäger legen das Löwenfell auf den Boden, tanzen im Kreis um das Fell herum, stoßen immer wieder mit den Speeren in Richtung des Löwenfells und rufen ko, ko.
Mit dieser – zugegebenermaßen klischeeartigen und konstruierten – Darstellung soll verdeutlicht werden, wie sich im Sinne von Tomasello der Vorgang kumulativer kultureller Evolution denken lässt:
1. Das oben bezeichnete Individuum (I) löst ein Problem, indem es den Nutzen zweier Artefakte (Steinabschlag, Stock) zu einem neuen Gebrauch und Nutzen kombiniert. Dabei muss sich I deren Gebrauch und Nutzen vorstellen und im Hinblick auf die gegenwärtige Problemlösung modifizieren. Die Erfindung wird durch Imitationslernen weitergegeben und durch soziale Praxis (Jagen) tradiert. Nachdem diese etabliert ist, wird das Artefakt verbessert für eine modifizierte soziale Praxis (Jagen von Großtieren).
2. Das Artefakt wird für eine weitere Problemsituation genutzt, nämlich nicht mehr allein für das Erjagen von Tieren zur Nahrungsbeschaffung, sondern um sich eines gefährlichen Tieres zu erwehren. Hierbei wird die soziale Praxis durch ein gemeinsames Handeln in der Gruppe modifiziert. Das gemeinsame Handeln erfolgt auch
3. auf der Ebene der sprachlichen Kommunikation. Im Ursprung war das Lautzeichen ›ko‹ eine vokalische Geste, ein indexikalisches Zeichen (s. Kap. 19) für von Raubkatzen ausgehende Gefahr. In der Jagdsituation findet eine leichte Modifikation statt: Durch ko wird der Löwe thematisiert und durch die Blickgeste lokalisiert. In der rituellen Verarbeitung schließlich wird zwischen dem Löwenfell (partonym für Löwe) und ko eine Verbindung hergestellt. In dem fiktiven Szenario entsteht eine Verbindung zwischen einem Inhalt (Löwe) und einer Lautform (ko). Anders formuliert: Es entsteht symbolische Kommunikation.
Dass neue Formen des kulturellen Lernens und der Soziogenese möglich wurden, die kulturelle Artefakte und Verhaltensweisen hervorbrachten, in denen sich Veränderungen über eine historische Zeitspanne akkumulieren konnten, dies sieht Tomasello in folgendem zentralen Faktor: »Der moderne Mensch entwickelte die Fähigkeit, sich mit seinen Artgenossen zu identifizieren, was dazu führte, daß er sie als intentionale geistbegabte Wesen wie sich selbst auffaßte« (Tomasello 2006: 22). Die in der fiktiven Geschichte dargestellten Lernprozesse setzen eine Form sozialer Kognition voraus, nämlich dass die Mitglieder der Stammesgemeinschaft »nicht nur vom anderen, sondern auch durch den anderen lernen können« (ebd., S. 17). Sprachliche Symbole seien nun besonders geeignete symbolische Artefakte, um Kategorisierungen und Perspektiven auf die Welt vor- bzw. einzunehmen.
Für Tomasello ist entscheidend die kulturelle Weitergabe, die kulturelle und nicht die biologische Vererbung: Sprache ist eine aus sozio-kommunikativen Handlungen entwickelte symbolisch verkörperte soziale Institution. Anders als Chomsky (s. auch Kap. 4) geht er nicht von angeborenen Prinzipien der Sprache, ›verborgenen Prinzipien und Parametern‹ und kognitiven Modulen aus, sondern von allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Das Inventar von Symbolen und Konstruktionen einer Sprache »gründet in universalen Strukturen menschlicher Kognition, menschlicher Kommunikation und den Mechanismen des Stimm- und Hörapparates. Die Eigenarten einzelner Sprachen rühren von Unterschieden zwischen den Völkern der Erde her und beziehen sich auf Dinge, über die zu sprechen sie für wichtig halten, und auf das, was sie hinsichtlich dieser Dinge als nützliche Informationen ansehen« (ebd., S. 60). Indem Tomasello die verschiedenen Sprachen auf Völkerunterschiede und die sprachliche Variation auf grundlegende kognitive Fähigkeiten zurückführt, ist die Annahme einer Protosprache logisch konsequent (s. hierzu Kap. 14). Deren Ursprung sieht er bei den frühesten modernen Menschen, »die ihren Ursprung vor etwa 200 000 Jahren in Afrika hatten [und] die als Erste symbolisch zu kommunizieren begannen, indem sie möglicherweise einfache symbolische Formen verwendeten, die analog zu denen sind, die von Kindern verwendet werden« (ebd., S. 63).
Kooperative Kommunikation und in Folge symbolische Kommunikation ist also das Resultat von Anpassungsprozessen an veränderte soziale Handlungsmuster. Sprache hat sich ausgebildet als Mittel der sozialen Kommunikation auf der Folie spezifischer kognitiver Fähigkeiten.
14 Wie haben sich Sprachen entwickelt?
Heute gibt es ungefähr 6500 Sprachen auf der Welt (vgl. Kap. 9). Zudem gibt es zahlreiche Regio- und Dialekte. Nun mag man (gelegentlich) darüber streiten, ob eine Sprache B eine eigene Sprache oder eine Variante der Sprache A sei, z.B. beim Saterfriesischen, das gelegentlich als niederländischer Dialekt klassifiziert wird. Tatsache ist, dass die sprachliche Vielfalt heute sehr hoch ist, und es stellt sich die Frage, wie sich diese Vielfalt entwickelt hat und sich erklärt. Im Hinblick auf die Sprachenevolution gibt es zwei grundsätzliche Ansätze, den Ansatz der Monogenese und den der Polygenese. Favorisiert wird das monogenetische Modell, nach dem unsere Sprachen Folgen der Migration des Homo sapiens sapiens aus Afrika sind. Dies ist die sog. Out-of-Africa-II-Hypothese. Für dieses Modell sprechen auch Forschungsergebnisse aus der Genetik, speziell vergleichende mtDNA-Analysen (Krings et al. 1997, Fagan 2012: 92 ff.).
Der Homo sapiens hatte vor ungefähr 170 000 Jahren seinen Ursprung im südlichen Afrika, die Wanderung des modernen Homo sapiens von Nordostafrika nach Norden begann vor etwa 110 000 Jahren. Von Nordafrika aus und über die Arabische Halbinsel breitete sich der Homo sapiens in die ganze Welt aus. In der Levante (östlicher Mittelmeerraum) wurden älteste Relikte vom modernen Menschen auf etwa 80 000 Jahre datiert, in Asien sind die frühesten Funde ca. 40 000 Jahre alt. In Europa tritt der sog. Cro-Magnon-Mensch vor ungefähr 40 000 Jahren auf, vor ca. 30 000 Jahren lebte Homo sapiens in Australien. Über die Behringstraße drang der moderne Mensch schließlich auch nach Amerika vor. Auf der einen Seite haben wir also ein kleines Populationssubstrat der afrikanischen Völker und Sprachen, andererseits Migrationspopulationen und -sprachen.
Nun ist die Lage hinsichtlich früher Sprachstadien insofern schwierig, als wir nur über schriftsprachliche Quellen verfügen und somit über Daten für einen Zeitraum von ca. 5000 Jahren. Um ältere Stadien oder gar Protosprachen zu rekonstruieren, muss man über Sprachvergleichung und Rekonstruktion versuchen, ältere Sprachstufen zu extrapolieren. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von Cavalli-Sforza et al. (1998) interessant und von grundsätzlicher Bedeutung: Danach sind genetische und sprachliche Verwandtschaft der Weltbevölkerung korreliert, ein Zusammenhang, der im Detail allerdings nicht klar nachzuweisen ist. Wir wollen an dieser Stelle nur einen Aspekt und Gedanken weiterverfolgen: Wenn die Völker Südafrikas den Ausgangspunkt der weltweiten Wanderungsbewegungen bilden, dann ist es plausibel und interessant, sich die Sprachen ihrer Nachkommen anzusehen. Unter den Völkern Südafrikas sind die Khoisan besonders interessant, da sie über ein breites Siedlungsgebiet verteilt lebten und stammesgeschichtlich zu den ältesten Völkern zählen. In den Khoisan-Sprachen finden sich zahlreiche Schnalzlaute, die in anderen Sprachen nicht oder nur rudimentär auftreten (s. Kap. 39). Eine Hypothese lautet nun, dass die Schnalzlaute in den Khoisan-Sprachen Relikte einer alten Sprachform sind, ja, Relikte einer Protosprache, die in den Migrationssprachen dann aufgegeben wurden.
Wenn wir von der Monogenese der sprachlichen Entwicklung ausgehen, dann stellt sich die Frage, warum es so viele unterschiedliche Sprachen gibt. Warum so unterschiedliche grammatische Strukturen und nicht nur einen Bauplan für alle Sprachen? Warum unterschiedliche Lautstrukturen, warum unterschiedliche Benennungsstrategien? Das Stichwort lautet Sprachvariation und Sprachwandel, und der Schlüssel zur Beantwortung der Fragen liegt wiederum in der Evolution und in Adaptions- und Selektionsprozessen. Mit veränderten Umweltbedingungen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Existenzbedingungen ändern sich kommunikative Notwendigkeiten. Sprache als ein Werkzeug, wie es Karl Bühler gesehen hat (s. Kap. 21), stellt für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche konkrete Werkzeuge zur Verfügung. Sprachliche Differenzierung und Variation ist Resultat sich ändernder und veränderter Umweltbedingungen. Die Anpassungsprozesse haben für die Sprecher einen wie auch immer motivierten kommunikativen Mehrwert. Stellen wir uns vor, dass in einer kleinen Sprachgemeinschaft von Jägern und Sammlern bestimmte Laute bei der gemeinsamen Jagd eine bestimmte Funktion haben, z.B. um leise und sprachlich maskiert zu interagieren. Wenn Sprecher dieser Sprachgemeinschaft nun sesshaft werden und Viehzucht betreiben, sind diese spezifischen Laute funktional nicht mehr notwendig und können (müssen aber nicht) aufgegeben werden. Stellen wir uns weiter vor, dass die Sprechergruppe S auf eine andere Sprechergruppe S’ trifft, die ähnlich spricht, aber die spezifischen ›Jagdlaute‹ nicht im Lautrepertoire hat. Im Zusammenleben beider Sprechergruppen und wegen der funktionalen Überflüssigkeit der Laute gibt die Sprechergruppe S in der neuen, vereinheitlichten Sprachgemeinschaft nun (möglicherweise) die Laute auf. Nehmen wir weiter an, dies wäre so. Der Wegfall der Laute führt sprachsystematisch zu Lücken, die nun in einer bestimmten Art und Weise mit lautlichem Material gefüllt werden, z.B. wenn die Laute vor einem Vokal stehen und eine Silbe bilden und bei Wegfall der Silbenanfangsrand durch einen spezifischen Laut aus dem eigenen Lautsystem besetzt wird. Fassen wir unser fiktives Beispiel zusammen und konkretisieren es:
1. Im System der Sprechergruppe S gibt es die ›Jagdlaute‹ /k/, /kh/, /g/, die am Silbenanfang stehen, z.B. /ka/, /ko/, /kha/, /khe/, /ga/.
2. Aufgrund äußerer Bedingungen werden diese Laute aufgegeben.
3. Die phonologische Lücke wird ersetzt durch /q/, also /qa/, /qe/, /qo/.
Nehmen wir nun weiter an, Sprechergruppe S’ hat ebenfalls den Laut /q/ im Sprachsystem und der Silbenanfang wird ebenfalls konsonantisch (durch die Plosive k, t, p) besetzt, allein vor den Lauten /e/ und /i/ nicht, dort besteht eine Lücke. Sprecher von S’ übernehmen nun den Ersetzungsprozess von S, allerdings nur vor den Lauten /e/ und /i/. Oder anders formuliert: Am Silbenanfang und vor den Vokalen /e/ und /i/ wird der Konsonant /q/ inseriert. Da wir angenommen haben, dass die Lücke silbeninitial nur vor /e/ und /i/ besteht, lässt sich die Ersetzungsregel vereinfachen: Am Silbenanfang wird die Lücke durch /q/ ersetzt.
Aus dem zugegebenermaßen stark konstruierten Beispiel lässt sich ableiten, dass zwei Aspekte für Veränderungsprozesse eine Rolle spielen: 1. sprachexterne Faktoren und 2. sprachinterne Faktoren. Wir müssen also sprachliche Veränderungen in Beziehung zur Umwelt sehen (Sprachsystem – Umweltsysteme) und auch reflexive Veränderungen im Sprachsystem selbst. Wir werden auf diese Punkte in Kap. 66 genauer eingehen und an Beispielen verdeutlichen.
15 Sprachen und Sprachfamilien
Werfen wir einen Blick auf die heutigen Sprachen der Welt, so stellen wir fest, dass diese so unterschiedlich sind, dass ein Sprecher der Sprache A (z.B. Deutsch) einen Sprecher der Sprache B (z.B. Chinesisch) nicht verstehen kann, partiell aber einen der Sprache C (z.B. Niederländisch). Die Unterschiede bestehen im Lexikon und im Sprachbau. Prüfen wir in einem deutsch-englischen und deutsch-niederländischen Wörterbuch den Eintrag ›Buch‹ so finden wir ›book‹ und ›boek‹. Auch wenn die Wörter unterschiedlich sind, springen einem die Parallelen ins Auge, und man könnte die Hypothese aufstellen, dass, wenn man weiß, wie die Wörter ausgesprochen werden, alle drei Einträge systematisch den Laut b gemeinsam haben, dass der ch-Laut dem Laut k entspricht und das dt. u dem engl. und ndl. u-Laut, geschrieben oo bzw. oe. Es könnte Zufall sein – aus einem Beleg kann man noch nichts schließen –, es könnte aber auch ein systematischer Zusammenhang bestehen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Sprachen regional benachbart sind. Im chinesischen Wörterbuch finden wir den Eintrag, ausgesprochen wie dt. ›Schuh‹, aber mit einem Hochton verbunden, orthografisch auch <shū>. Anders als im Deutschen, Niederländischen und Englischen gibt es (a) keinen Silbenendrand, die Silbe ist offen; (b) ist der Anfangslaut ein anderer und (c) liegt zwar ein gemeinsamer Vokal vor, aber dieser ist mit einem Hochton verbunden (und dieser Ton hat sogar eine bedeutungsdifferenzierende Funktion). Die sprachlichen Gemeinsamkeiten sind deutlich geringer, die regionale Distanz zwischen dem Verbreitungsgebiet China einerseits und Europa andererseits ist groß. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass das Chinesische nur wenig oder gar nicht in einem systematischen Zusammenhang zu sehen ist mit den drei europäischen Sprachen, aber wiederum gilt: Aus dem wenigen Sprachmaterial kann man keine weitreichenden Folgerungen ziehen.
Vergleicht man den Sprachbau der Sprachen der Welt und ihre diachronen Entwicklungen, so haben die evolutionär bedingten Aufspaltungsprozesse dazu geführt, dass es heute Sprachen gibt, die isoliert auftreten (das Baskische), und solche, die aufgrund von Verwandtschaftsverhältnissen zu größeren Gruppierungen zusammengefasst werden können, die miteinander genetisch verwandt sind. Man nennt die Makrogruppierungen Sprachfamilien. Man nimmt etwa 25 größere Sprachfamilien an, z.B. die indoeuropäische Sprachfamilie, die sinotibetische, Austroasiatisch, Uto-Aztekisch usw. (s. auch Tab. 3). Ziel der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft ist es u.a., aus Verwandtschaftsbeziehungen Stammbäume zu rekonstruieren bis zu einer Protosprache, aus der sich die Sprachen einer Sprachfamilie ableiten lassen. Es gibt sogar den Versuch, bis an die Wurzel eines Stammbaumes aller Sprachen eine Ursprache zu rekonstruieren, eine allen Sprachen gemeinsame Vorgängersprache.
| Sprachfamilie | Sprachen | Sprecherzahl (N in Mio.) | Verbreitung |
| Indogermanisch | 220 | 3000 | Europa, Südasien, heute weltweit |
| Sinotibetisch | 335 | 1288 | China, Südostasien |
| Niger-Kongo | 1364 | 354 | West-, Zentral-, Südafrika |
| Afroasiatisch | 311 | 347 | Nordafrika, Naher Osten |
| Austronesisch | 1119 | 296 | Taiwan, Philippinen, Indonesien, Pazifischer Ozean, Madagaskar |
| Dravidisch | 27 | 220 | Süd, Zentral-, Nordindien, Pakistan |
| Turkisch | 37 | 160 | West-, Zentralasien, Osteuropa, Sibirien |
| Japanisch-Ryukyu | 4 | 125 | Japan, Okinawa |
Tab. 3: Sprachfamilien mit N > 100 Mio.
Die Ausdifferenzierung der heutigen Sprachen und Sprachfamilien ist maximal bis zu Beginn des Holozän (um 11 700 v. Chr.) rekonstruierbar, so meinen die einen, andere glauben, dass die untere zeitliche Grenze bei 8000 v. Chr. liegt. Allgemein wird angenommen, dass die Ausdifferenzierung der Sprachen auch in diesem Zeitraum liegt. Gemessen an dem Alter der Sprache des Homo sapiens (s. Kap. 13) ist dies eine vergleichsweise junge Entwicklung. Am besten untersucht ist die indoeuropäische Sprachfamilie, die auch zugleich mit 3 Milliarden Sprechern die meistverbreitete Sprachfamilie ist. Auf der Basis sprachwissenschaftlicher, archäologischer, historischer und genetischer Untersuchungen wird angenommen, dass sich die erste Aufspaltung des Proto-Indoeuropäischen vor maximal 9500 Jahren vollzog.
August Schleicher (*19.2.1821 in Meiningen, †6.12.1868 in Jena)
August Schleicher wurde im thüringischen Meiningen geboren und studierte zunächst einige Semester Theologie und anschließend orientalische Sprachen, wobei er auch Hebräisch, Sanskrit, Arabisch und Persisch erlernte. Er promovierte und habilitierte in Bonn und wurde dort Privatdozent, bis er 1850 eine Professur für klassische Philologie und Literatur in Prag erhielt. Von 1857–1868 hatte er eine Professur für deutsche und vergleichenden Sprachwissenschaft und des Sanskrit in Jena inne, wo er am 6. Dezember 1868 verstarb.
Schleicher zählt zu den Mitbegründern der Indogermanistik und gilt als Vater der sog. Stammbaumtheorie in der vergleichenden Sprachwissenschaft. Aufgrund von Sprachvergleichung und parallel zur Evolutionstheorie in der Biologie rekonstruiert er die Sprachen der indoeuropäischen Sprachfamilie in Form eines Abstammungsbaumes. Die Ergebnisse finden sich in seinem 1861 publizierten berühmten Werk Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. In der Einleitung heißt es: Die Methodik der Sprachwissenschaft »ist im wesentlichen die der naturwißenschaften überhaupt; sie besteht in genauer beobachtung des objectes und in schlüßen, welche auf die beobachtung gebaut sind. Eine der hauptaufgaben der glottik [Sprachwissenschaft, P.S.] ist die ermittelung und beschreibung der sprachlichen sippen und sprachstämme, d.h. der von einer und der selben ursprache ab stammenden sprachen und die anordnung dieser sippen nach einem natürlichen systeme« (Schleicher 1961: 2). Interessant, wenn auch heute (zu) wenig beachtet, ist sein 1873 erschienenes Werk Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft.
Die Komponenten indo- und -europäisch in der Bezeichnung der Sprachfamilie als indoeuropäisch oder auch indogermanisch deuten auf das Verbreitungsgebiet hin: die indische Gruppe im Osten und die europäische/germanische im Westen. Bereits 1786 wies der Indologe William Jones (1746–1794) Ähnlichkeiten des Sanskrit (Altindisch, hervorgegangen aus der Sprache der Veden) mit Griechisch und Latein nach. Das deutsche Wort ›Mutter‹ ist altindisch ma:tár-, gr. mé:te:r, lat. ma:ter. Als indoeuropäische Wurzel wird *ma:tér- angesetzt – der * gibt an, dass es sich um eine rekonstruierte Protoform handelt. Die Farbbezeichnung ›rot‹ geht zurück auf idg. *roudh-/ *rudh-. Aufgrund bestimmter lautlicher Merkmale wird die indoeuropäische Sprachfamilie traditionell in zwei Sprachzweige aufgeteilt, die Kentum- und die Satemsprachen nach (lat. centum und altiranisch satem für ›hundert‹), eine Unterteilung, die heute höchst umstritten ist. Zu den Satemsprachen sollen neben einer Reihe von indischen, iranischen und slawischen Sprachen die baltischen Sprachen, das Albanische und Armenische, zu den Kentumsprachen die germanischen Sprachen, keltische, italische Sprachen, Griechisch, Anatolisch, Tocharisch gehören.
Das Deutsche gehört wie das Englische und Niederländische zu den westgermanischen Sprachen. Man nimmt aufgrund vergleichender Studien an, dass das heute nicht mehr existierende Tocharische sich vor knapp 8000 Jahren abgespalten hat, das Griechisch-Armenische vor 7300 Jahren, das Albanisch-Persisch-Indische vor 7000 Jahren, das Keltische vor 6000 Jahren und das Italische und Germanische vor 5500 Jahren. Die Spaltungsprozesse hängen mit Migrationsbewegungen von Populationen zusammen und diese wiederum mit ökologischen (z.B. Klimaänderungen), ökonomischen und sozialen Veränderungen, insbesondere Ausbreitung der Landwirtschaft. Wie die indoeuropäischen Sprachen die alteuropäischen Sprachen (Baskisch ist eine solche, s.u.) ablösten, darauf gibt es bisher keine klare Antwort, weder seitens der Archäologie noch seitens der Paläogenetik und Linguistik. Aber die Herkunft scheint geklärt: Nach neuesten Forschungen sind Bauern aus Anatolien für den Sprachimport in Europa verantwortlich, sie brachten zusammen mit der Landwirtschaft und bäuerlichen Lebensweisen ihre Sprache aus Anatolien mit.
Der europäische Raum ist indoeuropäisch, wenn wir von Zuwanderersprachen wie Türkisch etc. absehen, doch eine Sprache hat der indoeuropäischen Invasion getrotzt: das Baskische. Auf der Basis von Genom-Untersuchungen kommt der Humangenetiker Cavalli-Sforza zu dem Schluss: »Die baskische Region erstreckte sich vormals (im Paläolithikum) fast auf das ganze Gebiet, in dem man die großen Felsmalereien und -skulpturen gefunden hat. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die baskische Sprache von den Sprachen abstammt, die die modernen Cro-Magnon-Menschen (vor fünfunddreißig- bis vierzigtausend Jahren) bei ihrem ersten Eindringen in Südfrankreich und Nordostspanien gesprochen haben, und daß die großen Künstler der Grotten in der Region eine von den ersten Europäern herkommende Sprache redeten, aus der sich das moderne Baskisch ableitet« (Cavalli-Sforza 2001: 135 f.). Das Baskische, das sich in seiner linguistischen Struktur von den anderen indoeuropäischen Sprachen deutlich unterscheidet (z.B. kein Genussystem), ist das Überbleibsel einer vor-indoeuropäischen Sprachfamilie, dem Vaskonischen, das seine sprachlichen Spuren in topografischen Bezeichnungen (Flüsse, Berge, Täler und Siedlungen) hinterlassen hat. Ein heiß diskutierter Fall ist die Städtebezeichnung München, die üblicherweise von lat. monachus ›Mönch‹ bzw. ital. monaco, mhd. munich abgeleitet und, da in der ersten urkundlichen Erwähnung apud Munichen steht, mit ›bei den Mönchen‹ interpretiert wird; im Stadtwappen von München ist schließlich auch ein Mönch abgebildet. Der Sprachwissenschaftler Theo Vennemann ist jedoch anderer Meinung, was in der Münchner Presse für große Aufregung sorgte: mun- bedeutet im heutigen Baskisch ›Ufer, Böschung, Bodenerhebung‹, -ic- ›Örtlichkeit‹ und -a drückt den bestimmten Artikel aus. Die Zusammensetzung ergäbe deshalb die Lesart ›der Ort auf der Uferterrasse‹, und das ursprüngliche München befand sich auf einer Uferterrasse (vgl. Vennemann 1997).
Das Baskische ist eine im indoeuropäischen Sprachengebiet isolierte Sprache, aber sie ist heute nicht isoliert von romanischen Sprachen, im Baskenland herrscht Mehrsprachigkeit. Das Spanische und Französische als Kontaktsprachen haben das moderne Baskisch erheblich beeinflusst, sodass Interferenzen, Entlehnungen, bestimmte Reduktionen usw. zu beobachten sind. Sprachkontakt ist eine zentrale Konstante in der Entwicklung der Sprachen (s. auch Kap. 70).
16 Was haben Sprachen gemeinsam?
Worin sind Sprachen typischerweise gleich und worin unterscheiden sie sich? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt der so genannten Sprachtypologie. Der Begriff ›Sprachtypologie‹ geht zurück auf den Sprachwissenschaftler Georg von der Gabelentz (1840–1893), der mit seinem 1891 erschienenen Buch Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse wesentliche Grundlagen der allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft gelegt hat. In seinem Buch heißt es: »welcher Gewinn wäre es auch, wenn wir einer Sprache auf den Kopf zusagen dürften: Du hast das und das Einzelmerkmal, folglich hast du die und die weiteren Eigenschaften und den und den Gesamtcharakter! – wenn wir, wie es kühne Botaniker wohl versucht haben, aus dem Lindenblatte den Lindenbaum construiren könnten. Dürfte man ein ungeborenes Kind taufen, ich würde den Namen Typologie wählen« (Gabelentz 1984: 481). Was Gabelentz hier skizziert, ist ein Erkenntnisprinzip, demnach Eigenschaften einer Sprache so aufeinander bezogen sind, dass aus der einen Eigenschaft einer Sprache auf andere Eigenschaften derselben und dass aus einer Summe von Eigenschaften auf den Typ einer Sprache rückgeschlossen werden kann. Dahinter steckt die Idee, über Gemeinsamkeiten allgemeine Strukturen von Sprachen feststellen zu können. Solche allgemeinen Strukturen werden als sprachliche Universalien bezeichnet.
Unter den aus dem systematischen Vergleich von Sprachen ermittelten Universalien gibt es solche, die ausnahmslos und uneingeschränkt gelten, und solche, die nur partiell gelten. Man spricht von absoluten und relativen Universalien. Die Universalie ›Eine Sprache hat mindestens drei Vokale‹ gilt absolut. Für alle Sprachen gilt auch, dass sie den Silbentyp Konsonant-Vokal (z.B. dt. Vo-ka-le oder jap. na-ka-ma = Freund, Kamerad) aufweisen.
Ein anderes Beispiel ist die Wort- und Satzgliedstellung. Betrachtet man den einfachen Aussagesatz und prüft die Stellung von Subjekt (S) und Objekt (O) in Bezug zum Verb (V), so lassen sich zwei zentrale Stellungstypen finden, nämlich SVO und SOV:
| 1 | Englisch (SVO) | ||
| The man hit the ball. | |||
| 2 | Japanisch (SOV) | ||
| Taro-ga | tegami-o | kakimasu | |
| Name-Subj | Brief-dO | schreiben | |
| Taro schreibt einen Brief / Briefe. |
Nach verschiedenen Untersuchungen zeigt sich, dass die Sprachen der Welt zwischen 85 % und 90 % SOV oder SVO aufweisen, der erste Typ tritt dabei ein wenig häufiger auf. Die Stellungstypen VSO, VOS kommen demgegenüber selten, OVS und OSV extrem selten vor.
Eine kleine Nebenbemerkung zu den exzeptionellen Mustern OVS und OSV: In der Star-Wars-Saga weist der Jedi-Meister Yoda in seiner Sprache eine besondere Wortstellungsvariante auf. Yoda gehört zu einer nicht weiter bezeichneten Spezies, ist 66 cm groß und mehrere Jahrhunderte alt und hat zahlreiche Schüler im Gebrauch der ›Macht‹ ausgebildet. Seine Sprache ist durch eine stark markierte Wortstellung gekennzeichnet, nämlich OSV, z.B.: ›Ein seltsames Gesicht du machst.‹ Es ist der Stellungstyp, der in den Sprachen der Welt am seltensten vorkommt. Die Macher der Saga haben also (bewusst oder intuitiv) jene Stellungsvariante gewählt, die am stärksten vom Normalen abweicht. Dadurch wird das Fremde auch sprachlich markiert. Auch das Klingonische, eine voll ausgearbeitete fiktionale Sprache (Star Trek), hat eine stark markierte Wortstellung, nämlich OVS (3a, b).
| 3 | Klingonisch (OVS) | |||
| (a) | puq | legh | yaS | |
| Kind | 3s.sieht.3s | Offizier | ||
| Der Offizier sieht das Kind. | ||||
| (b) | yaS legh puq | |||
| Das Kind sieht den Offizier. |
Das Deutsche stellt einen Mischtyp von SVO und SOV dar, genauer: Es gibt beide Muster in Abhängigkeit von der Satzstruktur. Zunächst ist zwischen Hauptsatz und Nebensatzstellung zu unterscheiden. Im Hauptsatz liegt SVO vor, z.B. Er betritt das Haus, im Nebensatz hingegen SOV Ich beobachte ihn, während er das Haus betritt. Ändert sich der Satzmodus, kann das Verb in Spitzenposition stehen, z.B. Betritt er das Haus? Das Subjekt steht aber in allen Fällen vor dem Objekt (wie bei 99 % aller Sprachen). Zudem kompliziert sich das Stellungsverhalten dadurch, dass das Deutsche die sog. Satzklammer bildet (s. hierzu Kap. 48).
Joseph Harold Greenberg (*28.5.1915 in New York; † 7.5.2001 in Stanford) Joseph Greenberg wurde am 28. Mai 1915 in Brooklyn geboren. Über die Musik kam er zur Sprachwissenschaft, bereits mit 14 Jahren gab er ein Klavierkonzert in der Steinway Hall. Er studierte an der Columbia University in New York, u.a. bei Franz Boas (1858–1942), und später an der Northwestern University in Chicago, wo er auch die Hausa-Sprache lernte. Nach der Dissertation studierte er in Yale, unterrichtete ab 1948 Anthropologie an der Columbia University und ab 1962 an der Stanford University.
Berühmt wurde Greenberg durch seine sprachtyplogischen Arbeiten, seine Arbeiten zur Sprachklassifikation und insbesondere durch sein 1966 erschienenes Buch Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. Roman Jakobson hat bereits 1963 die Bedeutung der Greenberg’schen Universalienforschung erkannt und hervorgehoben: »Auf der grammatischen Ebene ist J.H. Greenbergs Auflistung von 45 implikativen Universalien eine eindrucksvolle Leistung. […] diese Daten (bleiben) unschätzbare und unentbehrliche Voraussetzungen für eine neue Sprachtypologie und für eine systematische Übersicht der universalen Gesetze der grammatischen Schichtung« (Jakobson 1992: 499).
Neben rein statistisch verteilten Universalien und absoluten gibt es solche, die eine hierarchische Ordnung angeben, sie werden als implikative Universalien bezeichnet. Die Ordnungsrelation hat das Grundmuster ›Wenn A gilt, dann folgt daraus B‹. Hierunter fallen Aussagen wie ›Wenn eine Sprache einen Plural hat, dann hat sie einen Singular‹, ›Ein Genusunterschied beim Nomen impliziert einen Genusunterschied beim Pronomen‹ oder ›In Sprachen mit Präpositionen folgt fast immer die Genitivphrase der Nominalphrase‹, z.B. dt. das Buch des Lehrers. Dies gilt aber eben nicht immer, z.B. Peters Buch oder des Kaisers neue Kleider. Hier liegt eine präferierte, statistisch wahrscheinliche Implikation vor. Ein anderes Beispiel ist die folgende Korrelation von Wortstellungstyp und Präpositional-/Postpositionalgruppe. Sprachen mit VSO-Stellung sind fast immer präpositional (P-NGr, entspricht dt. entlang des Weges), Sprachen mit SOV-Stellung fast immer postpositional (NGr-P, entspricht dt. den Weg entlang). In der SOV-Sprache Japanisch steht naka (dt. in) nach dem Nomen: Biru no naka ›in dem Hochhaus‹. Es gibt auch semantische implikative Universalien: Eine Sprache, die die Farbbezeichnungen rosa oder orange hat, hat ebenso Bezeichnungen für braun, blau, grün, gelb und rot.
Der Gelehrte und Politiker James Harris (1709–1780) definiert in seinem erstmals 1751 erschienenen Buch Hermes, or a philosophical inquiry concerning language and universal grammar Universalgrammatik (universal grammar) als »that Grammar, which without regarding the several Idioms of particular Languages, only respects those Principles, that are essential to them all« (Harris 1771: 100). Dieser Satz könnte von Noam Chomsky stammen und wie Chomsky (s. Kap. 4) glaubt Harris, dass »MIND [is] ultimately the Cause of all« (ebd., S. 306). Universalien und Universalgrammatik sind in dieser Perspektive mental verankert, bei Chomsky sind es Prinzipien in der biologischen Grundausstattung des menschlichen Gehirns, bei Harris angeborene Ideen, die letztlich archetypische Formen des Geistes Gottes sind.
Die Universalgrammatik (UG) nach Chomsky befasst sich mit der Untersuchung der sog. ›language faculty’, die als biologische Komponente angesetzt wird, wir hatten dies in Kapitel 4 bereits ausgeführt. Die Universalgrammatik als mentale Grundausstattung ist angeboren und genetisch festgelegt. Sie besteht aus abstrakten, universellen Prinzipien, die allen menschlichen Sprachen gemein sind, und einer beschränkten Menge von Parametern zu den Prinzipien. »Wir wollen die ›Universale Grammatik‹ (UG) als das System von Prinzipien, Bedingungen und Regeln definieren, die Elemente bzw. Eigenschaften aller menschlichen Sprachen sind […]. Die UG kann man somit als Ausdruck des ›Wesens der menschlichen Sprache‹ verstehen. Die UG ist bezüglich aller Menschen invariant. Die UG spezifiziert, was beim Spracherwerb erlangt werden muß, damit dieser erfolgreich ist. […] Jede menschliche Sprache stimmt mit [der] UG überein; Sprachen unterscheiden sich in anderen, zufälligen Eigenschaften« (Chomsky 1977: 41). Die UG geht damit über eine rein deskriptive Sicht hinaus, sie erklärt, warum es sprachliche Universalien gibt.
17 Ist Gebärdensprachen eine Sprache?
Gebärdensprachen sind wie das Deutsche oder Englische natürliche Sprachen, mit denen gehörlose oder hörgeschädigte Menschen kommunizieren. Es gibt verschiedene Gebärdensprachen; z.B. sind die englische und amerikanische Gebärdensprache sehr unterschiedlich, obwohl gesprochensprachlich das britische und amerikanische Englisch sehr ähnlich sind. Gebärdensprachen haben eine Grammatik wie andere Sprachen auch, und sie können folglich wie diese auch linguistisch untersucht werden. Für die deutsche Gebärdensprache (DGS) gibt es eine ausgezeichnete Analyse und Darstellung von zwei Sprachwissenschaftlern (Happ/Vorkörper 2006), die beide die Gebärdensprache aktiv beherrschen.
Auf der Ausdrucksebene besteht die deutsche Gebärdensprache aus zwei Komponenten: (a) den durch eine Hand oder durch zwei Hände dargestellten Gebärden und (b) der nicht-manuellen Komponente, die Mimik, Kopfbewegungen, Kopf- und Körperhaltung umfasst; so werden z.B. bei Entscheidungsfragen die Gebärden durch hochgezogene Augenbrauen und einen leicht nach vorn geschobenen Kopf markiert.
Eine Gebärde selbst setzt sich aus vier Grundelementen zusammen: der Handform, der Handstellung, der Ausführungsstelle und der Bewegung. Bei der Gebärde für gebärden (s. Abb. 5) beispielsweise sind beide Hände beteiligt und die kreisförmige Bewegung der Hände wird wechselseitig ausgeführt. Wenn wir die Gebärde für gebärden nicht als Bild wie in Abb. 5 darstellen wollen, sondern in Alphabetschrift, dann schreiben wir den Stamm in Kapitälchen, also: GEBÄRD. Nebenbei: Es gibt verschiedene Gebärdenschriften, die Darstellung des Wortes Gebärdensprache in der Kapitelüberschrift ist eine typografische Umsetzung des Fingeralphabets.
Abb. 5: Gebärde für gebärden6
Es gibt ca. 30 Handformen, 5 Grundhandstellungen wie Handfläche nach oben oder unten, unterschiedliche Ausführungsstellen (am Kopf, an der Hand usw.) und viele verschiedene Bewegungen (kreisförmig, gerade nach oben / nach unten usw.). Aus der Kombination der Grundelemente mit ihren verschiedenen Realisierungen setzen sich die einzelnen Gebärden zusammen, die dann lexikalische oder grammatische Bedeutungen kodieren.
Das Deutsche ist eine flektierende Sprache (s. Kap. 10), aber die deutsche Gebärdensprache ist eine polysynthetische und sie weist gegenüber dem Deutschen eine Reihe von Eigenheiten auf. Wie die Beispiele (1, 2) zeigen, steht der Artikel bzw. das Demonstrativpronomen nach dem Nomen und nicht wie im Deutschen davor. Auch das Adjektiv steht postnominal. Die Position des Artikels ist ebenfalls entscheidend. In (1) bilden wie im Deutschen der Artikel / das Demonstrativpronomen und das Nomen eine Klammer (s. auch Kap. 48), nur ist der Artikel eben nachgestellt, das Adjektiv steht direkt nach dem Nomen und hat eine attributive Funktion. In (2) bilden Nomen und Artikel eine Einheit, über die etwas ausgesagt wird (,ist klein‹), man nennt dies die prädikative Funktion. Attributive und prädikative Funktion sind also durch die unterschiedliche Gebärdenfolge ausgedrückt. Anders als im Deutschen ist auch der Kasus nicht angegeben.
(1) HUND KLEIN DER / DIESER
Der/dieser kleine Hund
(2) HUND DER KLEIN
Der Hund ist klein.
Während der unbestimmte Artikel nicht ausgedrückt wird, gibt es zwei Gebärden für den bestimmten Artikel: »Der bestimmte Artikel für Personen wird stets mit der G-Handform ausgeführt. Dabei ist die Handfläche nach unten orientiert, die Bewegung ist waagerecht und die Gebärde endet sanft. Die Spitze des Zeigefingers verweist auf den Raumpunkt. Der bestimmte Artikel für Gegenstände, kleine Personen und Tiere wird mit der gleichen Handkonfiguration (Handform und Handstellung) wie der bestimmte Artikel für Personen ausgeführt. Die Bewegung ist jedoch leicht nach unten. Die Spitze des Zeigefingers zeigt auf das Referenzobjekt« (Happ/Vorkörper 2006: 96). Die Gebärde für das Demonstrativpronomen ist fast identisch mit der für den Artikel, allerdings endet die Bewegung nicht sanft, sondern abrupter, und die Gebärde wird durch eine Mundmimik begleitet.
Ein interessantes Phänomen in der deutschen Gebärdensprache ist das der sog. Klassifikatoren. Klassifikatoren (KL) sind sprachliche Mittel, mit denen der Wortschatz strukturiert und organisiert wird. Im Deutschen sind es (a) das Genussystem, wo Substantive nach drei Kategorien (Neutrum, Maskulinum, Femininum) strukturiert und (b) quantifizierende Ausdrücke (vgl. 3), mithilfe derer Mengen spezifiziert werden. Welche Maßangaben prototypisch gebraucht werden können, ist abhängig von den Objekten, auf die sich beziehen.
(3a) zwei Tassen Kaffee, drei Tassen Tee, ?drei Tassen Wein, ?drei Tassen Bier
(3b) ?zwei Gläser Kaffee, drei Gläser Tee, drei Gläser Wein, drei Gläser Bier
(3c) ?eine Flasche Kaffee, ?eine Flasche Tee, eine Flasche Wein, eine Flasche Bier
In vielen Sprachen gibt es Klassifikatoren (KL), die eine klassifizierende bzw. kategorisierende Funktion haben. Dabei spielen Faktoren wie Ausdehnung, Dimensionalität, Größe, Funktion, Richtung, Konsistenz der Referenten eine entscheidende Rolle. Im Chinesischen gibt es eine Reihe von Klassifikatoren (4), die immer mit einem Substantiv in Verbindung auftreten müssen, wie zhāng in Verbindung mit Substantiven flache, dünne Objekte bezeichnet. Für stockartige Dinge, die man mit der Hand greifen kann, steht der Klassifikator b, z.B. y b sn ›ein Regenschirm‹.
(4)
yī zhāng zh
ein KL Papier
ein Stück Papier
In der Gebärdensprache gibt es ebenfalls zahlreiche kategorisierende Klassifikatoren (5,6). Die Gebärde für den Klassifikator für zweidimensionale, eckige Objekte in Verbindung mit Papier hat die Bedeutung ›ein Blatt Papier‹. Wird stattdessen der Klassifikator für dreidimensionale, eckige Objekte gebärdet, dann entsteht die Bedeutung ›ein Block Papier‹.
(5) PAPIER KL: 2D-ECKIG
ein Blatt Papier
(6) PAPIER KL: 3D-ECKIG
ein Block Papier
Gebärdensprachen haben also eine Grammatik wie jede andere Lautsprache auch. Und: Untersuchungen zeigen, dass der Erstspracherwerb in der Gebärdensprache genauso verläuft wie in einer Lautsprache und dass die Sprachverarbeitung im Gehirn in den gleichen Regionen stattfindet.
18 Was sind Plansprachen?
Plansprachen sind für die menschliche Kommunikation konstruierte Sprachen; es gibt in der Regel eine Person, die die Sprache erfunden hat. In den meisten Fällen ist die dahinter liegende Idee, eine einfache Sprache zu entwickeln, die jeder Mensch auf der Welt nutzen kann. Erleichterung der Kommunikation bei Sprechern unterschiedlichster Sprachen, internationale Verständigung über Sprachgrenzen hinweg, dies sind die primären Motive für eine Plansprache. Es hat in der Geschichte unterschiedlichste Versuche gegeben, eine Plansprache zu etablieren – natürlich von Linguisten, berühmt sind Rasmus Christian Rask (1787–1832) und seine Linguaz Universale sowie Otto Jespersen (1860–1943) mit seinem Novia-Projekt –, aber Erfolg hatte nur der Augenarzt Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917). Sein 1887 zunächst auf Russisch erschienenes Werk Lingvo Internacia sollte unter jenem Begriff Karriere machen, den er als Pseudonym für die Veröffentlichung gewählt hatte: Dr. Esperanto (Dr. Hoffender). Nicht zuerst linguistisches Interesse, sondern seine Erfahrungen als Jude waren Zamenhofs Hauptbeweggründe für die Schaffung des Esperanto, wie aus einem Brief an den Juristen Alfred Michaux aus dem Jahre 1905 hervorgeht: »Niemand kann das Unheil der menschlichen Spaltung so stark empfinden wie ein Jude des Ghettos. Niemand kann die Notwendigkeit einer menschlich neutralen, anationalen Sprache so stark empfinden wie ein Jude, der gezwungen ist, zu Gott zu beten in einer seit langem toten Sprache eines Volkes, das ihn ablehnt, und der Leidensgenossen hat auf der ganzen Welt, mit denen er sich nicht verständigen kann. […] Ich sage Ihnen nur einfach, dass mein Judentum der Hauptgrund war, weshalb ich mich seit meiner frühesten Kindheit einer Idee und einem großen Traum verschrieben habe – dem Traum, die Menschheit zu einigen« (zitiert nach Janton 1978: 22).
Esperanto wird heute weltweit gesprochen und auch geschrieben, von wie vielen Menschen, ist schwer zu bestimmen, es sind sicherlich mehr als eine Million. Ein Blick auf das Esperanto zeigt (s.u.), dass einem Sprecher des Deutschen und Englischen oder gar einer romanischen Sprache der Text nicht fremd vorkommt. Eine Wortgruppe wie ›apud sia fratino’ ist uns orthografisch vertraut und wirkt irgendwie lateinisch (lat. apud = bei; suum, -a, -um = sein; frater = Bruder). Merkwürdig ist, dass im englischen Original sister (Schwester) steht und nicht brother (Bruder).
Alicio, jam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuiĝis pro senokupo. Unu, du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn nek konversaciojn, kaj »por kio utilas libro,« pensis ŝi, »enhavanta nek desegnojn nek konversaciojn?«
Ŝi do ekpripensis ‒ ne tre vigle ĉar la tago estis varma, kaj ŝi sentis sin tre dormema ‒ ĉu la plezuro fari ĉenon el lekantetoj valorus la laboron sin levi kaj kolekti lekantetojn, kiam tutapude preterkuris Blanka kuniklo kun paleruĝaj okuloj.7
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, ›and what is the use of a book‹, thought Alice, ›without pictures or conversation?‹
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.8
Das Esperanto hat eine einfache Grammatik und ist wie eine agglutinierende Sprache aufgebaut (s. auch Kap. 9), d.h. grammatische Kategorien wie Kasus oder Numerus werden durch eine Endung, genauer: durch ein Suffix, oder durch andere, eindeutige Mittel ausgedrückt. Sehr verkürzt gesagt: Esperanto ist ein agglutinierendes Latein.
Schauen wir uns das Nomen fratino genauer an. Das Nomen bekommt immer die Endung -o, an die Wurzel frat wird also die Endung -o angehängt: frato (Bruder), bei einem Adjektiv die Endung -a: frata (brüderlich). Bei der Femininform wird an die Wurzel die Endung -in angefügt, also frat-in-o (weiblicher Bruder = Schwester). Wollten wir den Plural bilden, so hängen wir an das ganze Wort ein -j: fratinoj (die Schwestern). Und wie wird der Kasus gebildet?
Die -o-Form entspricht dem Nominativ, es gibt aber keine eigentliche Nominativendung. Denn der Akkusativ wird dadurch gebildet, dass dem Nomen zum Schluss ein -n hinangefügt wird (s. auch Tab. 4), also fraton (den Bruder), fratinon (die Schwester), fratinojn (den Schwestern). [Nebenbei: Der Akzent liegt immer auf der vorletzten Silbe, das ist die sog. lateinische Pänultimaregel.] Die anderen Kasus werden wie im Englischen durch Präpositionen angegeben: der Genitiv durch de (von), der Dativ durch al (zu) und der aus dem Lateinischen bekannte Ablativ9 durch kun (mit). Das Possessivpronomen sia ist aus dem Personalpronomen si (sie) gebildet, indem -a angehängt wird. Die Präposition apud wird wie im Lateinischen nicht flektiert.
| Wurzel | Wortbildungsendung | Nominalisierungsendung | Pluralendung | Akkusativendung |
| frat | -in | -o | -j | -n |
Tab. 4: Formenbildung beim Nomen im Esperanto am Beispiel von fratinojn
Die meisten Wörter entstammen romanischen Sprachen, aber es gibt auch zahlreiche Wörter aus dem Deutschen und Englischen. Es sollte dem Leser nicht schwer fallen, en la šranko und La knabo similas sian patron zu übersetzen.