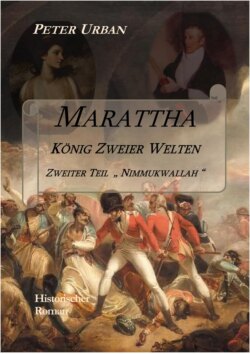Читать книгу Marattha König Zweier Welten Teil 2 - Peter Urban - Страница 3
Kapitel 1 Kriegstreiben
ОглавлениеOberstleutnant John Sherbrooke hatte das 33. Infanterieregiment von Oberst Wesley übernommen und von Madras nach Wallajabad geführt. Henry Harvey Ashtons 12. Regiment unter Major John Picton stand bereits bei Arnee in der Nähe des Baramahal. Die beiden Kommandeure der Einheiten waren zum Stab von General Lord Harris abkommandiert worden. Während Ashton sich anschickte, die Probleme der Eingliederung einer elftausend Mann starken Armee des Nizam von Hyderabad zu lösen und mit dem verbündeten Herrscher zu einer Übereinkunft zu gelangen, was Kommandostruktur und Subordination der indischen Offiziere betraf, erfüllte Arthur die gleichen Aufgaben wie bei der Vorbereitung der Operation gegen Penang. Gemäß der britischen Order of Battle war er erneut Generalquartiermeister, doch für jeden, der sich ein wenig mit der verschlüsselten Sprache kämpfender Truppen auskannte, bedeutete dies, dass er den militärischen Nachrichtendienst leitete.
Außer seinem ältesten und bewährtesten Netzwerk um Lutuf Ullah verfügte er inzwischen auch über mehrere »hirrcarrahs« – indische Berufsagenten und Meldereiter, die der Kaste der Brahmanen angehörten. Arthur hatte sich Lutuf Ullahs Rat über die Sprachunterschiede im Lande zu Herzen genommen und ausschließlich Männer im Karnataka und an der Grenze zu Mysore rekrutiert. Seine eigenen Sprachkenntnisse – wenngleich seit der langwierigen Operation gegen Spanisch-Manila erheblich verbessert – reichten noch nicht aus, um alleine zu arbeiten. Da Montstuart Elphinstone in anderem Auftrag unterwegs war – er organisierte die Versorgung des Expeditionskorps und warb »brinjarries« an – kastenlose Getreide- und Viehhändler, die der Truppe mit ihren Vorräten und Herden folgen sollten –, gestattete er Charlotte, ihn zu begleiten. Wie stets bei solchen Ausflügen trug sie Landestracht und verkleidete sich als Mann. Arthur war nicht ganz wohl dabei, seine junge Verlobte Gefahren auszusetzen; ihm wäre es lieber gewesen, wenn sie bei den Smith-Schwestern geblieben wäre, um sich in Madras zu vergnügen, statt ihn auf halsbrecherischen Ritten über Land zu begleiten und oftmals die Nächte unter freiem Himmel zu verbringen. Doch die Logik der jungen Frau hatte ihn überzeugt: Er brauchte Informationen und Agenten. Die Männer, die am interessantesten für ihn waren, würden sich einem Mann wie ihm niemals anvertrauen, den sie auf den ersten Blick als »pardesi« erkannten, als Fremden. Deshalb musste er von jemandem begleitet werden, der die Rolle des Einheimischen so überzeugend zu spielen vermochte, dass niemand misstrauisch und verschlossen reagierte.
Charlotte hatte Arthur überredet, die rote Uniform abzulegen und sich ebenfalls zu tarnen. Überdies ließ er Eochaid im Stall und wählte ein unauffälligeres Reittier. Sie hatte ihn sogar dazu gebracht, seinen männlichen Stolz und die Soldatenehre hintan zu stellen und es ihr zu überlassen, sich in den schaurigen Spelunken und finsteren Serais umzuschauen, während Arthur sich meist darauf beschränkte, das Gold von »John Company« zu zücken, wenn Charlotte ihm Zeichen gab, oder drohend die Hand an die Waffe zu legen, wenn man ihnen irgendwo zu nahe kam.
Sie waren ein sonderbares Gespann in diesen Tagen, doch irgendwie schien der Plan aufzugehen; General Harris erfreute sich eines Informationsflusses aus Mysore, den die anderen Stabsoffiziere kaum bewältigen konnten. Barrak ben Ullah war bereits weit hinter den »feindlichen« Linien. Als Sohn des größten Pferdehändlers auf dem Subkontinent konnte er ungehindert durchs Land reisen. Dass er genau in dem Augenblick in Seringapatam eintraf, da die Briten und der Nizam sich anschickten, gegen Tippu zu ziehen, verwunderte keinen. Für den Krieg brauchte man Pferde, und die besten Pferde bekam man von Lutuf Ullah. Allerdings gehörte die Herde, mit der er in Mysore eintraf, nicht seinem Vater, sondern der britischen Armee. Über den Residenten des Hauses Ullah in Seringapatam, N Govinda Bhat, sprach Barrak beim Sultan vor und wurde herzlich empfangen. Tippu schätzte es, die Pferde des Afghanen zu kaufen – gute Tiere zu fairen Preisen –, und einmal im Jahr kam der Händler ohnehin nach Mysore. Mit vor der Brust gekreuzten Armen verbeugte Barrak sich tief vor dem Herrscher. Dem »heresi« in französischer Uniform, der neben Tippu stand, schenkte er keinen Blick. »Salam aleikkum! Ich überbringe dem Sultan die ehrerbietigen Grüße meines Vaters und ein Geschenk des Hauses Ullah. Möge Allah Euch gewogen sein, Herr, und Euch Reichtum und Gesundheit im Übermaß schenken.«
Der junge Afghane klatschte in die Hände, und einer seiner Diener eilte mit einer prachtvollen, mit Perlmutt und Silber verzierten Kiste herbei. Barrak öffnete sie, und der Sultan blickte zufrieden auf ein edles, afghanisches Schwert, dessen Scheide und Knauf über und über mit kostbaren Steinen eingelegt waren.
»Du bringst gute Pferde und hoffst, mir alle Tiere zu verkaufen, ibn Ullah. Die Ungläubigen bereiten einen neuen Kriegszug gegen Mysore vor. Dein Vater hat seine Augen und Ohren überall und schickt dich im richtigen Augenblick. Ich hoffe, ihr lasst euch von den üblen Absichten der >heresi< nicht dazu verleiten, Tippu zu betrügen und überhöhte Preise zu fordern.«
Die Stimme des Herrschers klang vergnügt. Das Geschenk hatte ihn gefällig gestimmt, und er wusste, dass die Männer aus Afghanistan immer nur die besten und teuersten Tiere in sein Reich trieben.
Barrak verbeugte sich erneut tief vor dem Sultan. »Herr, die Preise entsprechen wie immer der Qualität unserer Tiere. Lutuf Ullah hat Euch noch nie betrogen.«
Munter schlug Tippu dem jungen Afghanen auf die Schulter. »Wenn er es je versucht hätte, mein Freund, würdest du deinen klugen Kopf nicht mehr auf den Schultern tragen ... Sprich morgen bei meinem Dewan Purneah vor. Er wird einen Offizier schicken, um Pferde für meine Kavallerie auszuwählen.« Tippu klatschte in die Hände und gab Barrak ben Ullah damit zu verstehen, dass die Audienz beendet war. Ein Offizier begleitete ihn aus dem Dowluth Baugh. Vor dem Palast des Sultans herrschte reges Treiben. Einheimische Soldaten und europäische Truppen tummelten sich in der brütenden Hitze; Geschütze rollten vorbei, schwerbeladene Proviantwagen bewegten sich auf das Fort zu, das sich etwa eine halbe Meile östlich bedrohlich gegen den gleißenden Sommerhimmel abhob.
Barrak gab vor, sich nicht sonderlich für diese Dinge zu interessieren. Doch während er munter mit dem Offizier plauderte und dabei überschwänglich die Schönheit und Qualität seiner Pferde rühmte, registrierten seine Augen jeden Wagen, jede Waffe, jede Regimentsfahne. Morgen würde er seinen Handel mit dem Dewan zu einem Abschluss bringen. Anschließend wollte er – aus Gründen der Tarnung – noch ein paar Tage in Seringapatam verbringen und die Offiziere des Sultans zu teuren und ausschweifenden Abendessen einladen. Dann musste er sich so schnell wie möglich auf den Weg nach Madras machen. Wesley hatte ihn wissen lassen, dass die Truppenkonzentrationen am Baramahal und zwischen Arnee, Vellore, Arcot und Wallajabad fast abgeschlossen waren.
Die feinen, hellblauen Baumwollvorhänge bewegten sich leise in der Brise, die an diesem Nachmittag vom Golf von Bengalen aus landeinwärts wehte. Sie brachen das Sonnenlicht und ließen die Veranda des kleinen Hauses, das Lord Clive Wesley und Charlotte Hall zur Verfügung stellte, seltsam unwirklich erscheinen.
Henry Wellesley stellte seine Teetasse auf einen kleinen Tisch und räkelte sich behaglich in seinem Rattansessel. Eigentlich hatte er sich mit Arthur aussprechen wollen, denn der frostige Empfang in Sir Charles’ Haus steckte dem empfindsamen jungen Mann noch in den Knochen. Doch statt auf Arthur war er nur auf dessen Verlobte gestoßen. Sie hatte den Soldaten ausnahmsweise nicht auf einem seiner »Ausflüge« begleitet, sondern es vorgezogen, ein paar Tage in Madras zu bleiben und sich endlich darum zu kümmern, dass ihre Hochzeit ausgerichtet wurde. Sie war beim Schneider gewesen, um sich ihr weißes Kleid nähen zu lassen, und sie hatte mit Jemima und Henrietta Smith herumgestöbert und sich eine kleine Aussteuer zusammengestellt, die ihrem künftigen Leben als Offiziersfrau entsprach: praktische Dinge, leicht zu transportieren und leicht zu verpacken; Geschirr für die Offiziere des 33. Regiments, denn man erwartete von einem Obersten des Königs, dass er seine jungen Offiziere täglich an seinem Tisch empfing; sowie ein paar praktische Kleider, denen auch das raue Garnisonsleben nichts ausmachte und die als Heilmittel gegen Charlottes chronisches Leiden dienen sollten, tagein, tagaus in Hosen und Stiefeln herumzulaufen. Schließlich hatte Lady Hall ihrer Tochter in einem langen Brief energisch zu verstehen gegeben, dass sie Arthur keine Schande machen dürfe, sondern ihn im Kreis der Soldaten Englands ordentlich repräsentieren müsse.
Henry Wellesley hatte Charlotte dabei überrascht, wie sie von ihren Einkäufen völlig erschöpft auf der Terrasse ausruhte und sich von Arthurs indischem Diener Vingetty Tee servieren ließ. Er hatte sich höflich vorgestellt, und obwohl er mit einer herben Abfuhr gerechnet hatte, rief Charlotte nach einer weiteren Tasse und nach Gebäck und forderte ihn zum Bleiben auf. Henry wusste nicht, dass die junge Frau von ihrem Vater den Inhalt seines vertraulichen Gespräches in Kalkutta mitgeteilt bekommen hatte. Sir Edwin war nach dem Abend, den der junge Wellesley in seinem Haus verbracht hatte, auf die Idee gekommen, dass seine Tochter einen Versuch unternehmen sollte, Frieden zwischen Henry und Arthur zu stiften.
»Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen«, sagte Henry entspannt. »Wie lange bin ich eigentlich schon da?«
»Fast drei Stunden. Sie haben wohl nicht viel Gelegenheit, sich von Ihren Pflichten zu erholen, Henry? Nun sind Sie schon seit sechs Monaten in Indien und immer noch leichenblass.«
Charlotte fand Arthurs kleinen Bruder ausgesprochen liebenswürdig. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, weshalb ihr Verlobter eine so tiefe Abneigung gegen seine Familie hegte.
»Ich hoffe, ich belästige Sie nicht, Miss Charlotte. Ich wollte eigentlich nur mit meinem Bruder sprechen ...«
»Reden Sie keinen Unsinn, Henry. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, uns kennenzulernen, ohne dass mein rotberockter Zerberus Ihnen böse Blicke zuwirft. Bitte halten Sie mich nicht für unverschämt, aber ... was ist eigentlich mit Ihrer Familie los? Ihr scheint euch alle auf den Tod nicht ausstehen zu können.«
Henry zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung, warum Arthur sich mir gegenüber so benimmt. Wir haben uns aus den Augen verloren, als er an die Akademie nach Angers ging. Damals war ich acht Jahre alt, und er war zwölf oder dreizehn. Er hat sich nie mit Lord Mornington verstanden. Soviel ich weiß, hängt das mit dem Tod unseres Vaters zusammen, aber weder Richard noch Mutter haben mir erzählt, was damals geschehen ist, und Arthur hatte über Jahre hinweg nur Kontakt zu unserem jüngsten Bruder William. Der hat einmal angedeutet, dass es etwas mit dem Besitz der Familie in Irland und mit Vaters Schulden zu tun hat.«
Weder Charlotte noch Henry hatten bemerkt, dass eine weitere Person auf die Terrasse getreten war. Arthur hatte eine Zeitlang schweigend zugehört. Während sein Bruder berichtete, verfinsterte seine Miene sich zusehends. Er war schlecht gelaunt, denn er hatte einen schlimmen Tag hinter sich. Sein Rücken schmerzte von den langen Stunden im Sattel, und in Ashtons Hauptquartier in Vellore war General Sir John Baird aufgetaucht und hatte Unfrieden gestiftet. Der Kommandeur des 12. Infanterieregiments und der schottische Generalmajor hatten so heftig gestritten, dass nur Wesleys Eingreifen eine Forderung zum Duell durch einen der beiden Männer verhindert hatte.
Wesley nahm seinen Säbel ab und legte die Waffe auf ein Kanapee. In diesem Augenblick bemerkte Charlotte ihren Verlobten.
»Arthur!«
Er lächelte sie traurig an. »Lass es gut sein, kleine Lady! Du hast Recht gehabt, Henry zum Tee zu bitten. Ich bin der Vollidiot.«
Er ging auf seinen jüngeren Bruder zu und umarmte ihn. »Es tut mir leid. Der Abend in Sir Charles’ Haus und die letzten zwanzig Jahre ... Du hattest nie etwas damit zu tun, nur ... Du warst Richard immer so nahe und ich ...«
Der Offizier ließ sich in einen Sessel fallen und fuhr sich mit der Hand müde über die Augen. »Er hat sich damals geweigert, Vaters Schulden zu begleichen. Ihm war es gleich, was sie über Papa sagen würden ... seine Ehre, alles. Für ihn war es bedeutungslos, was aus Dungan und Killdare wurde. Er wollte nur so schnell wie möglich zu Geld kommen und mit diesem Geld seinen eigenen Weg gehen ...« Charlotte schaute ihren Verlobten bedrückt an. Sie wusste um seine kritische finanzielle Situation, doch sie hatte nie ergründen können, ob es sich dabei um die Folgen jugendlichen Leichtsinns handelte oder um Probleme, die tiefer gingen.
Arthurs Blicke wurden kalt, und seine Stimme hatte einen zynischen und bösen Klang, als er erwiderte: »Glaubst du, ich hätte meinen Sold beim Glücksspiel durchgebracht?«
»Arthur!« fauchte sie ihn an. »Wage es nicht ...«
»Tut mir leid, Charlotte! Du hast in dieser traurigen Geschichte nichts zu suchen, aber dieses dürftige Haus, der bescheidene Verlobungsring ... Alles, was ich dir außer einem Offizierspatent, meinem Herz und meiner ewigen Treue und Liebe bieten kann, sind die Schulden meines Vaters.«
Henry Wellesley hatte es tunlichst vermieden, sich in das Gespräch einzumischen. Nur sein Gesicht verriet, was er dachte. Zu Hause hatten Richard und seine Mutter Arthur stets als Taugenichts und Schandfleck der Familie hingestellt, der durch seinen Lebenswandel und mit seinen Schulden nichts als Ärger bereitete und bei dem gute Worte nichts halfen. Stets hatten sie behauptet, Arthur wäre aus diesem Grund von der Familie verstoßen worden, und es sei nicht angebracht, den Kontakt zu dieser »Katastrophe« für den Ruf der Morningtons’ zu suchen. Nun aber erkannte Henry die Haltlosigkeit dieser Vorwürfe gegenüber seinem Bruder. Arthur war weder feige noch ehrlos, und er weigerte sich auch nicht, für die Schulden des Vaters geradezustehen. Im Gegenteil, er hatte sich wie ein wahrer Gentleman verhalten.
»Hast du Mornington aus diesem Grund nie um Hilfe gebeten, Arthur?« fragte er den Älteren.
Wesley zuckte mit den Schultern. »Ich brauche niemandes Hilfe, Henry, und ich erwarte nichts. Es wird Krieg geben, und wir werden kämpfen ... Es sind noch knapp tausend Pfund Sterling. Ich brauche Richard nicht, um die Ehre meines Vaters wiederherzustellen. Und wenn die Schulden bezahlt sind, werde ich Killdare zurückkaufen. Entschuldigt mich jetzt bitte.«
Er verließ die Veranda, ohne ein weiteres Wort an Henry und Charlotte zu richten. Augenblicke später klang die Melodie einer irischen Volksweise durch das kleine Haus. Charlotte wollte nachsehen, wer da spielte, doch Henry hielt sie am Arm fest. »Ich glaube, Sie sollten nicht gehen, Miss Charlotte. Lassen Sie Arthur ein wenig in Ruhe ...« Dann erzählte er ihr von seinem Vater, dem ersten Lord Mornington, diesem Schandfleck des anglo-irischen Adels, der sein Geld damit verdient hatte, am Trinity College in Dublin Musik zu lehren. Er hatte ihnen nichts hinterlassen, außer den wunderschönen irischen Weisen, die sein älterer Bruder gerade auf dem Klavier spielte. In diesem Augenblick erinnerte Henry sich wieder genau an ihre Jugend auf Dungan Castle und daran, wie abgöttisch Arthur den Vater geliebt hatte, der ihm beigebracht hatte, Geige und Klavier zu spielen. Arthur wiederum war der Liebling des alten Lord Mornington gewesen, denn er hatte die Begabung und Liebe für die Musik geerbt wie auch den Hang zur Poesie und zur Träumerei. Von den vier Söhnen war Arthur ihrem Vater am ähnlichsten gewesen. Vielleicht hatten seine Mutter und Richard ihn deswegen so sehr gehasst und ihn nach dem Tod des Vaters aus dem Haus gejagt.
Baird hatte bis zum Morgengrauen kein Auge zugetan. Unruhig warf er sich auf dem Feldbett hin und her. Kurz nach fünf Uhr stand er auf und steckte den Kopf in einen Eimer mit kaltem Wasser. Henry Harvey Ashton hatte ihn aufgefordert, sich nicht in die Organisation der Truppen des Nizam einzumischen und seiner Wege zu ziehen. Mit
Lord Clives Befehl in der Hand hatte er es gewagt, dem Generalmajor zu erklären, dass dieses Kommando seines wäre und dass Baird besser daran täte, sich wieder aus Vellore zu verabschieden und nach Madras zurückzureiten. Bereits beim Zusammentreffen von General Harris’ Stab hatte Sir Davie lautstark sein Missfallen darüber kundgetan, dass das faktische Kommando über eine fast elftausend Mann starke Streitmacht an einen Offizier gefallen war, der gerade halb so alt war wie er selbst, und der auf den Dienstlisten der Horse Guards weit hinter ihm stand. Lord Clive hatte damals nur kühl erklärt, die Zusammenarbeit mit den indischen Verbündeten erfordere ein diplomatisches Geschick, das Baird fremd sei. Dem Gouverneur von Madras gegenüber hatte der Schotte sich nicht durchzusetzen vermocht. Er hatte einen bitteren Brief an Lord Mornington gesandt, den neuen Generalgouverneur von Britisch-Indien. Morningtons Antwort war enttäuschend ausgefallen. Er verschanzte sich hinter der Entscheidung Sir Alured Clarkes und bedauerte, dass er für Baird nicht viel mehr tun könne als zu empfehlen, ihm die schottischen Regimenter zu unterstellen, falls dies in General Harris’ Sinn sei.
Seit Baird in den Kerkern des Sultans drei Jahre lang durch die Hölle gegangen war, wartete er auf eine Gelegenheit, Rache zu nehmen. Nun plante man einen Kriegszug gegen Mysore und schloss ihn von dieser Operation aus. Er zog sich Hemd und Uniformrock über, nahm seine Waffe und verließ zornig das Zelt. Es gab Dinge, die ein Offizier und Gentleman in dieser Zeit nicht hinnehmen konnte. Henry Harvey Asthon unziemliche Worte – vor dem gesamten Offizierskorps des 12. Regiments und den Generalen des Nizam – waren ein Affront, der Blut forderte. Hätte sich dieser verdammte irische Buchhalter, dieser Wesley, am Vorabend nicht so energisch zwischen ihn und diesen Schnösel Ashton geworfen, hätte Baird das Problem bereits bereinigt – mit der Waffe in der Hand. Grob trat er seiner Ordonnanz ins verlängerte Rückgrat und herrschte den Soldaten an, ihm Brandy und sein Frühstück zu bringen. Dann ließ er sich in einen Stuhl vor dem Zelt fallen und grübelte.
Henry Harvey Ashton war bereits seit einer Stunde auf den Beinen. Es war ihm endlich gelungen, den indischen General Meer Allum zu überzeugen, dass es besser sei, die Regimenter aus Hyderabad dem britischen Oberkommando direkt zu unterstellen. Meer Allum war an sich kein Problem gewesen. Der Mann war ein erfahrener Soldat und ein vernünftiger Bursche. Er hatte eingesehen, dass es einfacher war, wenn alle nach derselben Pfeife tanzten. Nur der Nizam hatte sich anfangs gesträubt: Es war ihm seit langem bewusst, dass er nicht viel mehr als eine Marionette in britischer Hand war und seinen »muzznud« lediglich den Truppen verdankte, die »John Company« ihm finanzierte. Aus reiner Selbstachtung und um zumindest den Schein einer gewissen Unabhängigkeit zu wahren, hatte er einige Zeit mit Ashton und damit indirekt auch mit Lord Clive und Lord Mornington gerungen. Doch ohne den Gouverneur in Madras und den Generalgouverneur in Kalkutta konnte er nichts gegen die Marattha unternehmen, die regelmäßig die Grenzen seines Reiches bedrohten. Seit 1795 existierte ein Schutzvertrag, in dem England seine Sicherheit garantierte und Militärhilfe zusicherte, falls die Lehnsfürsten des Bajee Rao II. sich zu weit vorwagten. Aus diesem Grunde hatte er Mornington auch ein elftausend Mann starkes Kontingent zugesichert, um mit Tippu Sultan, dem Tiger von Mysore, zu einer Einigung zu kommen, obwohl gar keine unmittelbare Feindschaft zwischen ihm und dem Herrscher in Seringapatam bestand.
Henry Harvey Ashton konnte mit sich und der Welt zufrieden sein. Der Nizam hatte am Ende doch nachgegeben, ohne sich von England brüskiert zu fühlen, und die Truppen von General Meer Allum würden ausgezeichnet mit den britischen Einheiten zusammenarbeiten. Als er seinen hellgrauen Araberhengst Diomed vor dem Eingang seines Zeltes zügelte, dachte der Offizier nur an den Erfolg seiner Mission, den aufregenden Feldzug, der nun bald beginnen würde, und ein reichhaltiges Frühstück. Den heftigen Streit mit Sir Davie Baird am Vortag hatte er fast schon vergessen. Er öffnete den Rock und rieb sich den schweißnassen Hals trocken. Ein leichter Wind streichelte seine erhitzte Haut. Wohlbehagen durchrieselte seine Glieder.
»Das Leben ist eine feine Sache, wenn es Krieg gibt und man fernab der Zivilisation im Felde steht«, ging es ihm durch den Kopf, während er seinem indischen Diener zuschaute, der ihm eine Tasse mit heißem, starkem Tee füllte.
Sir Davie Baird spuckte den Kautabak aus und nahm noch einen großen Schluck aus der Brandyflasche, der er seit dem Frühstück bereits große Aufmerksamkeit gewidmet hatte. »Verdammter Ashton!« zischte er zwischen den Zähnen hindurch. Seine Miene drückte eine gewisse Selbstgefälligkeit aus, als er aufstand und nach seinem Schwert griff. »Verdirbt mir die Stimmung mit seinem Geschwätz, dieser Rotzbengel.« Er warf einen Blick in Richtung des Zeltes des Kommandeurs des 12. Regiments. Ashton war allein. Außer seinem Boy würde niemand Zeuge dessen sein, was nun folgen sollte. Und wer würde einem indischen Boy schon Glauben schenken? Entschlossen stiefelte Baird los.
Lord Clive hatte den Kurier sofort empfangen. Der Mann war aus Vellore nach Madras geeilt und hatte bei diesem halsbrecherischen Ritt zwei gute Pferde lahm geritten. Doch General Meer Allums Depesche war so wichtig, dass die Pferde nicht zählten. Baird und Ashton hatten sich in den frühen Morgenstunden duelliert. Ashton war von einer Kugel in die Seite getroffen worden. Der Arzt des 12. Regiments und der Leibarzt des Nizam hatten alles versucht, doch es war aussichtslos: Ashton würde nicht mehr lange leben. Meer Allum hatte Baird unter Arrest gestellt, obwohl er nicht dazu befugt war, und wollte jetzt wissen, wer denn nun die Kontingente aus Hyderabad befehligen würde, und was er mit dem heißblütigen schottischen Generalmajor anfangen sollte.
»Baird behauptet, dass Ashton ihn angegriffen und er sich nur verteidigt hat?« Lord Clive konnte der Geschichte Meer Allums keinen Glauben schenken. Er kannte sowohl den Generalmajor als auch den Kommandeur des 12. Regiments.
»Unser General hat nach Zeugen gesucht, aber es gibt keine. Ashtons Boy ist spurlos verschwunden. Wir haben nur Sir Davies Wort. Das alles hat sich in den frühen Morgenstunden abgespielt, Mylord«, antwortete der Offizier des Nizam in korrektem Englisch.
»Man wird Ihnen ein neues Pferd und eine Eskorte geben, Sir. Richten Sie Meer Allum meinen Dank aus, dass er sich um diese traurige Geschichte gekümmert hat. Er soll Baird nach Madras schicken. Ich werde sofort einen neuen Offizier nach Vellore entsenden. Der General soll mir nur ein paar Stunden zum Nachdenken lassen, damit ich den richtigen Mann abkommandieren kann.«
Im Geiste hatte Lord Clive seine Entscheidung bereits getroffen. Er würde Arthur Wesley von seinem Posten des Generalquartiermeisters abberufen und ihn zur Armee des Nizam entsenden. Der Junge sprach nicht nur Hindi, auch sein Vernacular war mehr als respektabel. Außerdem verfügte er über das nötige Feingefühl, einen problematischen Verbündeten nicht zu brüskieren, und über beachtlichen militärischen Sachverstand. Damit musste die Armee in nächster Zeit zwar auf eine ihrer besten Nachrichtenquellen über Mysore verzichten, doch der Gouverneur war sicher, dass Elphinstone und der Afghane Barrak ben Ullah den Verlust von Oberst Wesley wettmachen konnten. Eilig schrieb Clive eine Depesche an Meer Allum. Dann informierte er den Kommandeur des 33. Regiments, dass er das Kontingent aus Hyderabad de facto befehligen musste, weil sein bester Freund einem unsinnigen Ehrenkodex zum Opfer gefallen war.
Arthur verlor keine Zeit. Er verließ Madras alleine, ohne irgendeine Eskorte in Anspruch zu nehmen. Er kannte den Weg nach Vellore gut, und es störte ihn nicht, durch die Nacht zu reiten. In den frühen Morgenstunden des 18. Dezember erreichte er die Grenze zum Karnataka. Ashton war blass und augenscheinlich schwer verletzt; trotzdem machte er einen ruhigen und überlegten Eindruck. Zuerst hofften alle, er würde sich erholen, und sogar die Ärzte zeigten sich optimistisch. Arthur verbrachte viel Zeit am Krankenlager des Freundes. Irgendwie glaubte auch er daran, dass Ashton eines Morgens aufstehen würde und alles wieder so war, wie vor dem Duell mit Baird. Alles, was die Ärzte tun konnten, war für den Kommandeur des 12. Regiments getan worden. Doch trotz aller Hoffnung geschah am Ende doch, was in einem so unbarmherzigen Klima wie dem Indiens passieren musste. Ashtons Wunde entzündete sich, und aus der Entzündung entwickelte sich in nur wenigen Stunden eine Peritonitis. Arthur konnte nicht viel mehr tun, als die Hand des Freundes zu halten und darüber nachzudenken, wie sinnlos dieser Tod doch war.
Am 23. Dezember 1798 starb Henry Ashton. Er hinterließ Wesley das Kommando über die Armee des Nizam und Diomed, seinen schönen hellgrauen Araberhengst. Doch Arthur konnte sich weder über das eine noch über das andere freuen: Mit Henry und dessen guter Laune und Unbekümmertheit war auch ein Teil seiner eigenen Jugend gestorben. Doch der Nizam nahm keine Rücksicht auf den Gemütszustand eines britischen Obersten. Darum blieb ihm nicht viel übrig, als sich in seine neue Verantwortung zu fügen und das Beste aus dieser traurigen Situation zu machen. Das 33. Regiment erhielt Befehl, von
Wallalabad nach Arnee zu marschieren. Zusammen mit Sir John Sherbrooke und dem Regiment kam auch Charlotte an die Grenze des Bramahal und tat das ihre, um Arthurs trübe Gedanken zu vertreiben, die sich nach Ashtons Tod eingeschlichen hatten.
Nach dem Zwischenfall um Ashton und Baird war Henry Wellesley umgehend nach Kalkutta geeilt, um den Generalgouverneur darüber zu informieren, dass das Expeditionskorps gegen Tippu einsatzbereit war.
Richard Lord Morningtons Miene hellte sich schlagartig auf, als sein Bruder und Privatsekretär ihm eine Zusammenfassung der nachrichtendienstlichen Informationen über Mysore auf den Tisch legte. Er hatte seine Wahl längst getroffen, doch gegenüber der Krone und dem Aufsichtsrat der Ostindischen Kompanie war es immer besser, ein schlagendes Argument in der Hand zu halten, wollte man sich großer finanzieller Mittel bedienen. Der Krieg gegen Tippu war sein erster Schritt, einen Plan umzusetzen, an dem er schon in England jahrelang gearbeitet hatte: Es war gut, dass die Handelsherren aus der Leadenhall Street in Britisch-Indien fürstliche Gewinne machten und sämtliche Schätze des Orients nach Hause transportierten, um dort noch höheren Profit zu erzielen.
Doch für England und den König war außer vollen Geldtruhen nicht viel zu gewinnen. Großbritannien war eine maritime europäische Großmacht, die durch ihre Insellage in ihren Expansionsbestrebungen behindert wurde, sich aufgrund ihrer Transportkapazitäten jedoch auf allen Meeren der Welt ausdehnen konnte. Außer den Territorien um Kalkutta, Madras und Bombay strebte der Generalgouverneur an, die reichen Gebiete in Südindien für seinen König zu erobern. Es gab einen Schutzvertrag mit Hyderabad, der – geschickt manipuliert – den Nizam immer stärker in die Abhängigkeit von London treiben würde. Mysore würde nach dem Sieg über den Sultan das nächste Juwel in Englands indischer Krone werden; dann – Morningtons Augen glitten über eine riesige Landkarte an der Wand seines Arbeitszimmers – würde er sich Bajee Rao und den Marattha zuwenden. Er musste nur einen Grund finden, um die Soldaten König Georgs über die Grenze marschieren zu lassen.
Ein wenig unsanft riss Henry Wellesley seinen Bruder aus seiner Tagträumerei. »Richard, Sir Edwin Hall ist mit der juristischen Expertise eingetroffen, und der Rat tagt in zwei Stunden, um über die Kriegserklärung gegen Tippu zu befinden.«
Mornington blickte von dem Papier auf und lächelte seinen Bruder an. »Ausgezeichnet, Henry. Richte Sir Edwin aus, dass ich ihn in zehn Minuten empfange. Und ...« Der Generalgouverneur stockte kurz. Inzwischen war sogar zu ihm durchgedrungen, dass sein unmöglicher Bruder Arthur die unmögliche Tochter von Lord Hall zu heiraten gedachte. Zu Anfang hatte ihn dieser Gedanke belustigt. Sie würden ein feines Gespann abgeben, der kränkliche, magere Buchhalter im roten Rock und die kleine, ungezogene Brillenschlange...
»Einen Augenblick noch, Henry!« Mornington deutete mit dem Finger auf den Papierberg auf seinem Schreibtisch. »Willst du mir weismachen, unser dummer Bruder Arthur hat das alles bewerkstelligt?« Henry Wellesley mochte es nicht, dass Richard so abfällig über Arthur sprach, denn er hatte ihn während der langen Wochen in Madras kennen und schätzen gelernt. Doch seine Angst vor Richard saß zu tief, als dass er gewagt hätte, offenen Widerstand zu zeigen. »Ja, Richard. Er hat diesen Dienst auf Geheiß von Sir John Shore aufgebaut. Lord Clive und Sir Alured Clarke sagten mir, dass er ausgezeichnet funktioniert und für die Armee geradezu unabkömmlich geworden ist.«
Mornington grinste hinterhältig. Beinahe wie im Selbstgespräch murmelte er: »Sieh mal einer an. Vielleicht hat Papas Liebling außer Notenpapier und Musik ja doch noch etwas anderes im Kopf. Erstaunlich! Ich werde mir unseren kleinen, dummen Arthur irgendwann mal ansehen müssen. Falls er den Feldzug gegen Mysore aus Versehen überlebt...« Er wandte sich wieder an Henry. »Bitte Sir Edwin herein!«
Oberst Allessandro Cappellini war bis an die Grenze geritten, nur von einem »Pathan«-Offizier des Sultans begleitet. Die beiden Männer hatten die kühle Nacht dem Tageslicht vorgezogen. Als sie in der reichen, fruchtbaren Ebene ankamen, konnten sie am fernen Horizont unzählige Dörfer, Zisternen und ordentlich bestellte Felder im Abendrot sehen. Cappellini hatte als Treffpunkt einen alten Hindutempel ausgewählt. Der Tempel war Balarama geweiht, einem der Brüder Krishnas. Manche glaubten, Balarama sei die siebte »avatar« Vishnus. Die Menschen kamen an hohen Festtagen zum Tempel und opferten der Gottheit, damit diese sie vor Krieg und Verwüstung beschützte und ihnen Regen und eine reiche Ernte bescherte.
Cappellini schmunzelte, als er an diesen Aberglauben dachte. Er war hierhergekommen, um Feuer und Eisen über das Land zu bringen und einen Krieg, der Frankreichs Macht im Herzen von Britisch-Indien derart stärken würde, dass die verfluchten Engländer über kurz oder lang an diesem Dorn in ihrer Ferse verrecken mussten. Die Armee des Sultans war gigantisch; die Waffen und Ausrüstung seiner Soldaten entsprachen dem neuesten Stand der Militärtechnik; Seringapatam, die Hauptstadt von Mysore, war eine fast unbezwingbare Festung, und er, Allessandro Cappellini, war der beste Berater, den das Direktorium auf diesen Posten hatte entsenden können. Interessiert glitten seine Augen über die reichverzierten Altäre. Wenn kein religiöser Festtag war, beherbergten sie Affen, Schlangen, Skorpione und anderes Ungeziefer, das sich an den Opfergaben gütlich tat. Es war ihm unverständlich, wie eine dermaßen ausgebeutete Bauernschaft wie die von Mysore bereit sein konnte, Reis, Früchte und Eier in der Hoffnung auf ein besseres Morgen diesem Viehzeug zu überlassen, statt sich die leeren Bäuche damit zu füllen.
»Sahib, da kommt unsere Kontaktperson!« unterbrach der Offizier des Sultans die Gedanken des Franzosen. Am Horizont konnte man eine Staubwolke ausmachen, die sich im Abendrot dem verlassenen Tempel näherte.
»Und Ihr seid davon überzeugt, Oberst Wao, dass diese Person Licht in das Dunkel des britischen militärischen Nachrichtendienstes bringt?«
Dhoondia Wao nickte zufrieden. Er hatte viel Zeit, Mühe und Geld seines Herrn investiert, um im Herzen von Fort St. George selbst einen Spion unterzubringen, dessen Augen und Ohren nichts verborgen bleiben konnte. Natürlich war es teuer, das feinste Hurenhaus von Madras zu unterhalten, doch in den Armen der teuren und gefügigen Schönen war so mancher britische Offizier weitaus gesprächiger als bei einem Glas Brandy.
Der »Pathan« bedeutete seinem französischen Gefährten, ihm zu folgen. Die Staubwolke hatte sich derweil in einen einsamen Reiter verwandelt, der sein Tier an den Stufen des Tempels zügelte und behände aus dem Sattel sprang. Als er des Mannes neben Dhoondia Wao gewahr wurde, wollte er zur Waffe greifen, doch ein paar knappe Worte des »Pathans« beruhigten den Reiter wieder. Oberst Cappellini war erstaunt, als ein prächtiger, schwarzglänzender Zopf und die feinen Züge einer Frau unter dem staubigen Turban zum Vorschein kamen. »Lakshmi, ich möchte dir den Sahib vorstellen, der unserem Herrscher als Militärberater dient«, erklärte Wao in der Landessprache. Die Frau lachte verächtlich. »Spar dir dein Gerede von >unserem Herrscher<! Wenn du das Geld hast, können wir reden. Wenn nicht, soll dich der Teufel holen, Dhoondia.«
Cappellini verstand ausreichend Kannada, um die Worte Lakshmis auch ohne Dolmetscher zu verstehen. Er lächelte freundlich und zeigte auf einen prallen Beutel, der an seinem Gürtel hing. Oberst Wao wollte seinen Agenten bereits zur Ordnung rufen, doch ein Zeichen des Franzosen überzeugte ihn davon, dass in diesem Augenblick die Informationen aus Madras wichtiger waren als sein Stolz und seine Ergebenheit dem Sultan gegenüber.
»Also, Madame! Erzählen Sie! Wenn Ihre Geschichte gut ist, werde ich Sie fürstlich entlohnen.«
Lakshmi blickte Dhoondia Wao triumphierend an. Fürs erste hatte sie gewonnen. Tippu war ihr gleichgültig, doch der Beutel am Sattel des Franzosen besaß Überzeugungskraft genug, um ihre Zunge zu lösen. »Der Mann, der die Spione der britischen Armee anwirbt und führt, heißt Wesley! Ein junger Oberst, der vor gut zwei Jahren in Kalkutta aufgetaucht ist. Er hat genug Geld, um unzählige >hirrcarrahs< aus dem Karnataka für sich arbeiten zu lassen. Doch der Mann verlässt sich nicht nur auf bezahlte Berufsspione. Ich habe gehört, dass er außer den >hirrcarrahs< noch über weitere, unabhängige Agentennetze verfügt. Es geht das Gerücht, dass Ihr die Schlange in Mysore direkt am Busen liegen habt. Ihr solltet Euch bei den Kaufleuten und Pferdehändlern umtun, die regelmäßig in Seringapatam erscheinen.« Dhoondia Wao übersetzte für Cappellini. Lakshmis Augen waren gierig auf den Franzosen gerichtet.
»Interessant, Madame, aber noch nicht den Inhalt meines Beutels wert. Ich kann mir auch ohne Eure liebenswürdige Hilfe denken, dass er sich der >hirrcarrahs< bedient. Das tut schließlich jeder in diesem Land. Und was Kaufleute und Pferdehändler betrifft ...« Cappellini machte Anstalten, sich umzudrehen und davonzugehen. Auf Dhoondia Waos Miene spiegelte sich Entsetzen. Wenn der Franzose dem Sultan berichtete, dass seine Spione in Fort St. George nichts taugten, konnte er bestenfalls damit rechnen, die Abendmahlzeit für die Tiger des Sultans abzugeben.
Lakshmi reagierte schneller als der »Pathan«. »Was wollt Ihr noch wissen?« rief sie Cappellini in passablem Französisch nach.
»Gebt mir Namen, Madame, und ich gebe Euch reichlich Gold.« Der Franzose verbarg sein triumphierendes Grinsen in der Abenddämmerung. Seine Stimme klang unbeteiligt.
»Ein Offizier aus dem Stab von General Harris, der zu meinen guten Kunden gehört, hat erzählt, dass Oberst Wesley sich eines afghanischen Pferdehändlers bedient. Er kannte den Namen nicht, doch er erzählte mir, dass dieser Afghane ein Kontor in Seringapatam betreibt und einmal im Jahr nach Mysore kommt.«
»Es gibt zwei Paschtune, die ihre Herden ins Reich Tippus treiben«, flüsterte Dhoondia Wao Cappellini zu. »Wir knöpfen uns die Residenten vor. Dann erfahren wir, wer der Spitzel ist!«
Der Franzose nickte zustimmend. Dann wandte er sich an Lakshmi. »Was noch? Denkt nach! Ich habe das Gold, das Ihr begehrt.«
Die Frau wischte sich mit einer fahrigen Bewegung den Schweiß von der Stirn. »Er schnüffelt selbst in der Gegend herum. Dieser britische Oberst spricht die Landessprachen, und ein junger >pardesi< begleitet ihn. Wenn Ihr ihn hört, glaubt Ihr, ein Inder steht vor Euch. Er hat keinen Akzent und kennt alle Sitten und Bräuche. Ich weiß nicht, wer er ist, und es gibt auch keine Gerüchte über ihn, aber ich will mich gern erkundigen ... Vergesst nicht, Oberst, diese Briten wissen ihre Zungen zu hüten, selbst dann, wenn sie im Arm einer dunkelhäutigen Schönheit ihre Selbstbeherrschung verlieren.«
»Gut!« Cappellini schnürte den Beutel Gold los und zählte ein paar Münzen in Lakshmis geöffnete Hand. »Das hier ist für den Anfang und die Afghanen. Wenn die Armee abmarschiert, erwarte ich von Euch, dass Ihr mit Euren Huren den Rotröcken folgt. Sobald Ihr etwas wisst, informiert Ihr Oberst Wao. Solltet Ihr versuchen, wegen dieser hübschen, glänzenden Münzen ein doppeltes Spiel zu treiben ... Indien ist nicht groß genug, als dass Ihr Euch vor mir verstecken könntet. Habt Ihr verstanden?«
Lakshmis Hand schloss sich fest um die Münzen. Trotzig blickte sie Cappellini in die Augen. Dann aber nickte sie.
Dhoondia Wao bedeutete seiner Agentin, zu verschwinden. Dann schlugen er und Oberst Cappellini wieder den Weg nach Mysore ein.
Die offensichtlichste Schwachstelle der britischen Truppen in Indien war ihr Transport- und Versorgungssystem. Der Grund dafür war, dass in England meist die Marine für die Lösung solcher Probleme herangezogen wurde und man sich nur wenig mit Ochsenkarren und ähnlichen Hilfsmitteln auskannte. Dank Montstuart Elphinstones phantastischer Kenntnis des Landes und seiner unglaublichen Ressourcen war die Transportfrage für General Harris’ Expeditionskorps gegen Mysore jedoch mehr als zufriedenstellend gelöst worden. Er hatte »brinjarries« angeworben, eine Art indischer Zigeuner, die keiner Kaste und Religionsgemeinschaft angehörten und ihren Lebensunterhalt als Vieh- und Getreidehändler verdienten. Ein bemerkenswerter Tross – alle Händler hatten ein Patent von Lord Clive erhalten und waren autorisiert, an die Truppe zu verkaufen – würde der Armee folgen, ohne dass die Offiziere und der Stab sich um die Versorgung kümmern mussten. Die »brinjarries« hatten im Gegenzug für ihre Patente und eine feste Preisabsprache zugesagt, eigenständig alles heranzuschaffen, was Harris’ Rotröcke und Sepoys benötigten. Lediglich ein Offizier wurde als Trossmeister abgestellt und sollte den geregelten Ablauf dieser neuen Beziehungen überwachen.
General Harris war mit Wesleys Idee und Elphinstones Umsetzung des Planes so zufrieden, dass er sich für einen Abend Anfang Januar 1799 im Hauptquartier der Armee des Nizam bei Arnee angekündigt hatte. Neben dem »brinjarry«-Tross, über den ihm sein Adjutant, Oberstleutnant Barry Close von der Ostindischen Kompanie, wahre Wunderdinge berichtet hatte, wollte er auch die militärische Organisation seines Ersatzmannes für den verstorbenen Henry Harvey Ashton in Augenschein nehmen. Obwohl Arthur sich als Nachrichtendienstoffizier schon seit langem bewährt hatte und die Achtung aller besaß, fragte Lord Harris sich dennoch, wie ein so junger Mann, dessen einzige Erfahrung mit dem Krieg der unglückselige Flandernfeldzug gewesen war, plötzlich mit elftausend einheimischen und fast zweitausend britischen Soldaten zu Rande kam. An sich mochte er diesen jungen Offizier und vertraute auf dessen gesunden Menschenverstand. Doch schien es ihm vernünftiger, die ganze Sache persönlich in Augenschein zu nehmen.
Wenngleich Oberst Wesley und sein kleiner Stab nach außen hin vorgaben, die Ruhe selbst zu sein und sogar General Meer Allum erfolgreich ihre kleine Komödie vorspielten, musste Arthur sich im Stillen eingestehen, dass General Harris’ freundschaftlicher Besuch ihm wie ein Stein im Magen lag. Natürlich hatten sie alle ihr Bestes gegeben und waren überzeugt, dass ihr Teil des Expeditionskorps perfekt war. Doch würden sie vor dem kritischen Auge eines Mannes bestehen können, der mehr als fünfundzwanzig Dienstjahre auf dem Buckel und sich seinen Ruf im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erkämpft hatte, bei Bunker Hill, als sie alle noch in den Windeln lagen?
»Sir, wenn ich Sie darum bitte, die Männer noch einmal auf den Exerzierplatz zu holen und scharf schießen zu lassen, dann liegt es nicht daran, dass ich Sie in dieser Hitze quälen will«, sagte er aufgeregt zu seinem Freund Connor McLeod.
Der Schotte hob die Augen gen Himmel und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Gütiger Himmel, Wesley! Harris will uns nicht fressen. Der Alte inspiziert bloß die Armee des Nizam – und das war’s dann schon.«
Der Kommandeur des 33. Regiments warf einen kurzen Blick über die Schulter. Als er feststellte, dass er und McLeod von niemandem belauscht wurden, packte er den Hochländer am Arm und zischte ihm zu: »Connor, in Gottes Namen, lasse das Vierundsiebzigste antanzen und schießen, und wenn es nur um meinen Seelenfrieden geht. Willst du etwa, dass Harris uns eine alte Kröte wie St. Leger aufs Auge drückt, nur weil er meint, wir könnten mit dieser Geschichte nicht alleine fertig werden?«
Noch bevor McLeod etwas erwidern konnte, hatte Wesley die Zügel von Eochaid gepackt und war in den Sattel gesprungen, ohne die Steigbügel zu benutzen. Er hatte bei den Einheiten der Madras-Artillerie ein paar Geschütze ausgemacht, die ihm nicht gefielen. Eine Staubwolke hüllte den Schotten ein, als sein Freund vom 33. Infanterieregiment über den Exerzierplatz stob, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Grinsend beobachtete McLeod, wie ein Hauptmann der Ostindischen Kompanie immer kleiner wurde, als sein irischer Kamerad wie der Erzengel Gabriel mit seinem Racheschwert über ihn herfiel. Natürlich war es eine große Ehre, dass dreizehntausend Mann mit insgesamt vierzig großen Feldgeschützen einem achtundzwanzigjährigen Offizier anvertraut worden waren, den sie alle schätzten und achteten. Doch dass Wesley glaubte, der alte Harris wolle ihn auffressen, falls er am Huf eines Gauls auch nur einen Strohhalm entdeckte, grenzte an Verfolgungswahn.
Während ihr Verlobter seine Soldaten und Sepoys drillte, als würde die Ehre Englands davon abhängen, ließ Charlotte alles ruhiger angehen. Natürlich war es schwierig, Harris und seinen riesigen Stab zu bewirten und in einem Zelt, dessen Fläche gerade mal die Ausmaße der Bibliothek ihres Vaters in Kalkutta besaß, fünfzig hungrige Gäste zu empfangen, doch man durfte das alles nicht so eng sehen. Charlotte hatte ein paar Soldatenfrauen aus dem 33. Regiment eingespannt, ihr zur Hand zu gehen. Arthurs indischer Diener Vingetty war für den großen Abend mit Harris zum »Maître des Ceremonies« ernannt worden; er schlug sich leidlich mit den »brinjarries«, dem Gemüse und einem Haufen indischer Köche, die alles vorbereiten mussten. Außerdem war es Charlotte gelungen, Wesley einen Mann abzuschwatzen, in den sie ihr ganzes Vertrauen setzen konnte: Zahlmeister Dunn – ausnahmsweise nicht mit den betrüblichen Konten des 33. Regiments befasst – stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. Wenn es ihr nun noch gelingen würde, diesen nichtsnutzigen Adjutanten, Major Francis West, ins Geschirr zu spannen...
»Francis, falls es Ihnen gelingt, dieses Sherryglas aus der Hand zu stellen«, sagte sie hinterlistig, »und statt dessen darüber nachzudenken, wie wir hundertzwanzig Flaschen Champagner kalt gestellt bekommen ... Denken Sie an England! Denken Sie an das 33. Regiment!« West verschluckte sich vor Lachen an dem Porto Fino, den er gerade erfolgreich aus den Vorratskisten seines Chefs entwendet hatte. »Miss Charlotte, wenn es um Champagner geht, verlassen Sie sich auf den alten Francis. Er steht gut gekühlt in eiskaltem Wasser und wartet nur darauf, durch durstige Soldatenkehlen zu fließen.«
»Dieser kleine Halunke!« ging es Charlotte durch den Kopf. Stets drückte er sich, doch wenn man ihm irgendeine Aufgabe anvertraute, gab es niemals Probleme. Wie konnte ihr armer Arthur nur mit diesem Schlitzohr West arbeiten, ohne dabei die Geduld zu verlieren? »Francis, Sie sind schrecklich ungezogen«, sagte sie spitzbübisch. »Ich mache das heute zum ersten Mal, und statt mir Mut zuzusprechen, amüsieren Sie sich.«
West nahm einen großen Schluck von dem exzellenten, sündhaft teuren Porto Fino, den sein Chef sich zuweilen gönnte. Dann setzte er sein gewinnendstes Lächeln auf. »Miss Charlotte, wenn es um das 33. Regiment geht, kennen mein Enthusiasmus und mein Eifer keine Grenzen.«
»Sehr gut!« konstatierte Zahlmeister Dunn mit einem zufriedenen Blick auf das strahlend weiße Leinen, die Kristallgläser und das hübsche Porzellan auf dem Tisch. »Nachdem wir jetzt alles fertig haben und nur noch auf den alten Harris und unseren Chef warten müssen ...«, er griff zu einem Taschentuch und wischte Charlotte mit einer väterlichen Geste den Schweiß von der Stirn, »... wird die kleine Lady sich ausruhen und sich dann für den Abend feinmachen. Mary, schenke Miss Charlotte doch eine Tasse Tee ein und sorge dafür, dass sie sich ein paar Minuten hinlegt.«
Sergeant Sewards junge Frau nickte dem alten Zahlmeister ergeben zu und packte dann energisch Wesleys Verlobte, um sie aus dem Zelt zu bugsieren.
General Sir George Harris war ein warmherziger, gutmütiger und reger Mensch, dem jegliche Arroganz und Selbstgefälligkeit abgingen. Er hatte als junger Offizier ebenfalls sein Quantum an Erfahrungen mit spitzfindigen und kleinkrämerischen Vorgesetzten gesammelt und verstand aus diesem Grunde Oberst Wesleys Sorge und innere Unruhe. Nachdem er die Truppen des Nizam und die britischen Regimenter bei Arnee inspiziert und in voller Kampfbereitschaft vorgefunden hatte, vermied er es sorgfältig, seinen jungen Untergebenen zu ängstigen. Es hatte ihm gefallen, was er auf dem Exerzierplatz gesehen hatte. Das Diner, zu dem Oberst Wesley geladen hatte, sollte aus diesem Grunde lediglich ein familiäres Vergnügen und keine Manöverkritik werden. Gemütlich nahm der alte General seinen Platz zwischen Wesleys Verlobter und dem indischen General Meer Allum ein, während Arthur sich mit Ameisen im Magen und Angstschweiß auf der Stirn auf den Platz gegenüber von Lord Harris begab. Als Rückendeckung hatte er Elphinstone und Barclay dabei.
»Nun«, begann der Oberkommandierende des Expeditionskorps, »ich muss zugeben, dass ich es nach diesem Tag fast bedaure, dass ich ein paar Herren mitgebracht habe« – er winkte den Generälen Floyd, Stuart und Baird fröhlich zu –, »die ein wenig länger auf den Dienstlisten unseres guten König Georg stehen als einige andere, die sich viel Mühe gemacht haben, hier alles in Gang zu bringen.« Dann wandte er sich direkt an Arthur. »Dennoch möchte ich sagen, dass ich für die meisterlichen Arrangements von Oberst Wesley und seinem Stab und für die hervorragende Disziplin hier in Arnee kaum die passenden Worte finde.«
Während Harris sein Glas hob und die Generäle Floyd und Stuart es ihm gleichtaten, suchte Arthur ein Mauseloch, in dem er verschwinden konnte, denn auf seinen braunen Wangen hatte sich ein feuriges Rot ausgebreitet, das nicht vom Champagner, sondern der Verlegenheit über so viele gute Worte herrührte. Charlotte und die Herren Offiziere grinsten vergnügt. Der alte Harris hob seinen schweren Körper aus dem bequemen Stuhl.
»Gentlemen, ich möchte mein Glas auf den Kommandeur unseres 33. Regiments erheben und ihm für seine Arbeit danken. Selbstverständlich wird der Nizam von Hyderabad, repräsentiert durch General Meer Allum, nicht auf seinen bewährten militärischen Berater verzichten müssen.«
Arthur versank immer tiefer in seinem Stuhl. Vor Verlegenheit und Freude wurde ihm so heiß, dass er sich am liebsten in den nächsten Fluss gestürzt hätte. Er bemerkte nicht einmal, wie die Miene von Sir Davie Baird immer finsterer und bösartiger wurde. »Oberst Wesley, gestatten Sie mir, auf einen erfolgreichen Feldzug gegen Mysore zu trinken und Ihnen und Ihrem Stab viel Glück zu wünschen. Ich habe den Marschbefehl des Generalgouverneurs vor zwei Tagen erhalten. Am 29. Januar geht es los. Gott schütze England und König Georg!« Alle Offiziere erhoben sich und stimmten in Sir Georges Trinkspruch ein. Arthur konnte sich nur mit Mühe auf seinen butterweichen Knien halten. Das Champagnerglas zitterte in seinen Händen. Er hätte nie geglaubt, dass es so weit kommen würde. De facto hatte man ihm das Kommando über eine Armee von 13 000 Mann anvertraut, obwohl er gerade erst achtundzwanzig Jahre alt war und noch viel zu jung, um über wirkliche militärische Erfahrung zu verfügen.
Als Wesley gemeinsam mit den anderen sein Glas leerte, schwor er sich, Lord Clive und General Harris nicht zu enttäuschen. Seringapatam und Tippu sollten nur kommen! Die schlimmen Tage des Flandernfeldzugs lagen weit zurück, und zwischen den Düften des Orients und den weichen Armen der kleinen Charlotte hatte Wesley alle Schrecken und Ängste vergessen, die er an einem nebligen Novembertag auf den Schanzen von Boxtel durchlitten hatte.