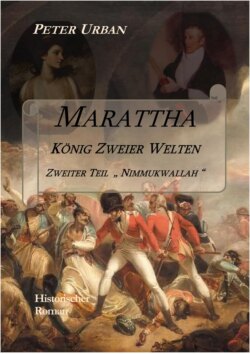Читать книгу Marattha König Zweier Welten Teil 2 - Peter Urban - Страница 4
Kapitel 2 Erste Gefechte
ОглавлениеDie Armee bestimmte, wann Major John Shee aufwachte und wann er sich schlafen legte. Oberst Wesley bestimmte, ob der Major sich besaufen oder seinen natürlichen Trieben in den Armen einer der »bibbies« von Lakshmi nachgeben durfte. Doch – o Wunder – inzwischen war es Major Shee selbst, der darüber entscheiden konnte, wer in seinen Kompanien des 33. Regiments nach welcher Pfeife tanzen musste. Seit dem geschichtsträchtigen Abend in Arnee, an dem der alte Schwachkopf Harris dem staubigen Buchhalter Wesley die Truppen des Nizam in den Rachen warf, hatte Shee Ruhe vor seinem Kommandeur. Und Oberstleutnant Sir John Sherbrooke war viel zu sehr mit dem Regiment beschäftigt, als dass er sich großartig um Shee und die Kompanien hätte kümmern können. Sir John hatte Shee sogar die Schützen anvertraut – was Wesley, dieser bornierte Buchhalter, sicher nie getan hätte. Wesley hätte seinen kleinen Freund West damit beglückt ... Aber West spielte ja inzwischen den Laufburschen für Atty, wenn er nicht gerade mit der Brillenschlange Tee trank oder diesem fetten indischen Bock Meer Allum in den Hintern kroch.
Major Shee blickte vom Rücken seines Pferdes zufrieden in die weite Ebene des Karnataka. Es war schön, Soldat zu sein, wenn ein Krieg bevorstand, Preisgelder lockten und Brandy und geile »bibbies«, die für jedermann erschwinglich waren. Nur zu schade, dass die verdammte Brillenschlange seines verdammten Obersten sich die kleine Seward unter den Nagel gerissen hatte. Schon seit der Überfahrt aus England hatte Shee immer wieder einen Blick auf ihren hübschen Hintern geworfen. Zahlmeister Dunn, dieser bigotte alte Trottel, musste ihn bei Wesley verpetzt haben: Zuerst war Sergeant Seward aus seiner Kompanie verschwunden und in die unendlichen Höhen der Regimentsbuchhaltung entsandt worden, und dann hatte die Brillenschlange Mary entdeckt und ihr ihre Gunst geschenkt.
Doch Shee war sicher, dass der Krieg ihm Gelegenheit bieten würde, sich ungestraft mit der Kleinen zu amüsieren. Vorerst jedoch musste er mit Lakshmi und ihren Mädchen vorliebnehmen. Immerhin hatte er inzwischen genug Geld in der Tasche, um sich seinen kleinen Zeitvertreib leisten zu können, und sein verdammter Kommandeur war weit weg und Sir John Sherbrooke zu beschäftigt, um ihm Aufmerksamkeit zu widmen. Es war eine feine Sache, wenn nur ein Brite sich um den Haufen stinkender »brinjarries« kümmerte – und der war strohdumm und blind und bemerkte nicht einmal, wie Shee sich still und heimlich die Taschen füllte, weil er entdeckt hatte, dass nicht nur die Soldaten König Georgs an Getreide, Pulver und Munition interessiert waren.
Harris’ Teilstreitmacht erreichte Amboor am 18. Februar 1799 und schloss sich dort mit der Hyderabad-Armee zusammen. Außer den Sepoys hatte der Nizam noch sechs Regimenter der Ostindischen Kompanie bereitgestellt. Die Maratthas bedrängten seine Grenzen. Der Nizam setzte alles daran, Mornington-Sahib zu zeigen, was für ein guter Verbündeter er war. Wenn sie mit Tippu abgerechnet hatten, würde er auf sein Recht pochen und als Gegenleistung für seine Militärhilfe königliche Regimenter fordern – und einen Kriegszug gegen Scindia und Holkar!
General Meer Allum – der Premierminister des Nizam und einer seiner zahllosen unehelichen Söhne – war glücklich mit seinem britischen Obersten. Wesley sprach seine Sprache; er besaß Taktgefühl und Diplomatie und drängte sich nie in den Vordergrund. Und Wesley kam mit allen klar, auch mit Generalmajor Baird. Und der war ein Problem, seit er drei Jahre in den Kerkern von Hyder Ali zugebracht hatte.
Baird befehligte jene drei europäischen Bataillone, die die rechte Flanke der Armee des Nizam bildeten. Tag für Tag versuchte er, sich in Meer Allums Angelegenheiten einzumischen. Meer Allum konnte diesen Kerl nicht ausstehen. Ihm kam schon die Galle hoch, wenn Baird ihm näher war als fünfzig Meter. Der Inder dankte General Harris und den Göttern, dass zwischen ihm und diesem schottischen Teufel Baird der junge Wesley stand. Arthur war ein feiner Soldat. Arthur liebte Indien und hatte keine Vorbehalte gegen die Einheimischen.
Der Vormarsch gegen Mysore begann am 21. Februar 1799 von Amboor aus. Das Tal war breit und flach wie eine Suppenschüssel. Die britischen Truppen marschierten in Kolonne an der rechten Flanke. Die Soldaten des Nizam bewegten sich in gleicher Formation auf der linken Seite. Zwischen den beiden Teilstreitkräften floss gemächlich ein Strom von mehr als 50000 Zivilisten: Kaufleute, Huren, Familienangehörige britischer und Sepoy-Soldaten ... und mittendrin, zahlreicher noch als die menschliche Flut, fast 100000 Ochsen, Tausende von Maultieren, unzählige Elefanten, Pferde und Kamele.
Bei seinem Vorstoß durch den Baramahal glich das Expeditionskorps mehr einem Wandervolk als einer Armee. Das Fortkommen war beschwerlich und beschränkte sich jeden Tag auf spärliche zehn Meilen. Doch so langsam alles auf den ersten Blick auch schien, so unaufhaltsam walzte General Harris’ Armee in Richtung der Grenzen von Mysore. Der Oberbefehlshaber hatte aus den Fehlern von Lord Cornwallis gelernt und folgte dem Rat von Lutuf Ullah, dem afghanischen Pferdehändler und Wesleys Kopf im militärischen Nachrichtendienst der Briten. Statt durch Kistnagherry zu ziehen, überquerte das Expeditionskorps den Ryacotta-Pass. Lediglich für die schweren Geschütze, die von sechzig Ochsen in Viereranspannung gezogen wurden, wählte man die schmale befestigte Straße über die Höhe. Alle anderen suchten sich ihren Weg entlang der Schlucht, nördlich und südlich von Ryacotta. Am 5. März schlug Harris sein Feldlager auf. Leichte Schützeneinheiten hatten Befehl, gegen die Grenzposten von Mysore vorzustoßen und sie zu vertreiben. Wesleys Nachrichtendienst hatte dem Hauptquartier übermittelt, dass der Sultan – über die Ankunft der Briten und ihrer Verbündeten bestens unterrichtet – Bangalore und das Umland in Schutt und Asche gelegt hatte, um dem Feind Vorratslager und Nachschubbasen zu entziehen. Somit musste die Truppe von nun an direkt durch das feindliche Territorium auf die Hauptstadt Seringapatam marschieren. Um dem Monsun auszuweichen und die Niederlage von Cornwallis im Jahre 1791 nicht zu wiederholen, wurde es unabdingbar, Seringapatam noch vor Mitte Mai zu nehmen, wenn der Monsunregen einsetzte.
Oberst Dhoondia Wao hatte sein Versprechen eingelöst. In der Hauptstadt von Mysore hatte er sich der beiden Repräsentanten afghanischer Pferdehändler mit dem gleichen Maß an Freundlichkeit angenommen. Der erste Mann hatte offenbar wirklich nichts zu verbergen gehabt, denn er war unter der Folter gestorben, ohne ein vernünftiges Wort über die Lippen zu bringen. Man hatte ihm die Haut in dünnen Streifen vom Leib gezogen, hatte ihn gepeitscht und mit glühenden Eisen gebrannt. Trotzdem hatte er nichts Interessantes von sich gegeben.
Der andere Mann war ein schwierigerer Fall gewesen: N Gowinda Bath gehörte einer einflussreichen Hindu-Familie an, die mit dem ehemaligen Herrscherhaus von Mysore, Wodeyar, eng verwandt war. Außerdem besaß der Mann die Gunst von Purneah, dem »Dewan« des Sultans von Mysore. Purneah war auch ein Hindu der obersten Kaste. Doch Oberst Wao war ein gerissener Fuchs: Anstatt N Gowinda Bath ernsthaft ins Gebet zu nehmen, ließ er ihn beschatten. Oft war ein lebender Verräter aussagekräftiger als ein lebloses Stück Fleisch, das nicht einmal mehr für die Tiger des Sultans gut genug war.
Als N Gowinda Bath das Kontor der Familie Ullah in Seringapatam verließ, fühlte er sich ausgesprochen unwohl. Die ganze Stadt rüstete sich für die Ankunft der britischen Truppen und glich mehr einem befestigten Heerlager als einem Handelsknotenpunkt im Herzen des Subkontinents. Soldaten des Sultans tauchten an allen Ecken und Enden auf; die indischen und ausländischen Offiziere schienen misstrauischer und wachsamer als sonst. N Gowinda kam am Tempel des Sri Ranganathaswamy vorbei und konnte beobachten, wie ausländische Offiziere auf den Wällen des Forts Geschütze in Stellung brachten. N Gowinda wusste in diesem Augenblick nicht, vor wem er mehr Angst haben sollte: vor den Augen und Ohren des Sultans oder dem Zorn seines afghanischen Herrn Lutuf Ulla und dem scharfen Schwert des »jawan« Bedi ben Haleff ibn Ullah.
Als er die Stadtmauern hinter sich gelassen hatte, siegte die Treue zum Hause Ullah über seine Angst. N Gowinda beschleunigte seine Schritte. Er bemerkte nicht, wie ein Paar aufmerksamer brauner Augen jede seiner Bewegungen durch ein französisches Fernrohr beobachtete.
Dhoondia Wao stieß Oberst Cappellini leicht in die Seite und hielt ihm seine »longue-vue« hin. »Hier, Sahib, seht selbst! Der da ist ein Verräter. Er hat etwas zu verbergen. Er paktiert mit den >inglis<, wägt jeden Schritt ab und bebt vor Angst.«
»Lassen Sie ihn nicht aus den Augen, Oberst Wao. Aber tun sie ihm nichts. Ich will an seine Auftraggeber herankommen und das Übel an der Wurzel ausreißen.« Allessandro Cappellini verließ seinen Aussichtsposten auf dem Festungswall und kehrte zu seinen militärischen Pflichten an der Seite Tippus zurück.
Die Hitze in General Harris’ Zelt war erdrückend. Obwohl es ein großes Zelt war und man beide Seitenwände hochgeschlagen hatte, bewegte kein Windstoß die schwüle, feuchte Luft. Das Licht im Innern wurde durch den Zeltstoff zu einem schalen Gelb gebrochen, das dem Gras auf dem Boden eine ungesunde bräunliche Farbe verlieh. Sechs Männer warteten im Zelt des Oberkommandierenden auf eine Entscheidung. Der unruhigste von ihnen schien Montstuart Elphinstone zu sein. Er war nach einem halsbrecherischen Ritt über die Ebene erst vor einer knappen Stunde aus dem Herzen von Mysore zurückgekehrt. Ein Teil seiner Unruhe war darauf zurückzuführen, dass N Gowinda Bath ihm sehr genaue Informationen über die Truppenstärke des Sultans und die Positionen der Geschütze auf den Wällen von Seringapatam überbracht hatte. Oberst Arthur Wesley saß Elphinstone gegenüber. Von Zeit zu Zeit zog er seine Uhr aus der Tasche, ließ den Deckel aufschnappen, starrte aufs Zifferblatt und steckte die Piaget kommentarlos zurück. Immer wieder trafen seine Blicke die von Elphinstone, und in diesem stummen Austausch spiegelte sich eine schreckliche Spannung.
General Harris starrte auf die Landkarte, die vor ihm ausgebreitet lag. Mit einem hellblau karierten Taschentuch wischte er sich immer wieder den Schweiß von der Stirn, während sein Hirn unablässig arbeitete und abwägte, was er nun tun sollte: Der Weg, den das Expeditionskorps nach Seringapatam wählte, war von kriegsentscheidender Bedeutung. Stieß er berechenbar gegen die Hauptstadt des Sultans vor, bestand die Gefahr, dass seine schwerfälligen Truppen und der riesige Tross von der beweglichen Reiterei des Sultans bedrängt wurden, oder – schlimmer noch – dass das trockene Gras auf den Ebenen in Brand gesetzt und dem Expeditionskorps auf diese Weise unermesslicher Schaden zugefügt wurde.
Doch eben dieses Gras, das die Ebene so gefährlich machte, benötigte Harris, um die Zugochsen, Elefanten und Maultiere seines Trosses mit Futter zu versorgen. Teilte er sein Heer, wie Oberst Wesley es ihm empfohlen hatte, konnte er die Aufmerksamkeit der Reiterei des Sultans ablenken und seine Zugtiere mit den Vorräten und dem Belagerungsapparat gefahrlos bis vor Seringapatam bringen. Doch Teilung bedeutete Schwächung, und niemand konnte ihm in diesem wilden, kaum kultivierten Landstrich dafür garantieren, dass die Wiedervereinigung beider Heere pünktlich vollzogen werden konnte. Der Bericht, den Montstuart Elphinstone soeben aus Seringapatam mitgebracht hatte, erleichterte dem General seine Entscheidung auch nicht gerade.
»Viertausend Mann unter General Read haben wir bereits verloren. Natürlich sind die Getreideversorgung und das Depot in Cauveryporam strategisch sehr wichtig, aber ...«, dachte Harris laut nach.
»Mit Verlaub, Mylord! Sie müssen das Expeditionskorps teilen.« Meer Allum, der General des Nizam, war der gleichen Ansicht wie Oberst Wesley. Die Armee aus Hyderabad war durch ihre starken Kavallerie-Einheiten sehr mobil. Die Reiter des Nizam würden schneller ins Feindesland vorstoßen als die britischen und einheimischen Fußsoldaten, die durch den riesigen Tross zusätzlich behindert wurden. Harris nickte Meer Allum zu. »Sie haben Recht, mein Freund! Das Gelände hier ist ideal, um uns übel zuzusetzen. Die bewaldeten Hügel bieten besten Schutz für die Kavallerie des Sultans.«
»Nicht nur für seine Kavallerie«, meinte Wesley finster. »Aus dem Tross verschwinden schon seit Tagen Munition, Kanonenkugeln, Getreide ... Sogar die >brinjarries< haben ihre Probleme. Uns sind bereits mehr als zweihundert Zugtiere abhandengekommen.«
Harris zog die Brauen hoch. »Also gut, Wesley. Wir teilen das Expeditionskorps auf. Bis Achel rücken wir so vor, als wäre unser eigentliches Ziel Bangalore. Dann schwenken wir nach Südwesten. Der Weg über Cankelli nach Seringapatam ist zwar schwierig, aber kurz. Außerdem melden die >hirrcarrahs<, dass die Kavallerie des Sultans dort noch nicht alles dem Erdboden gleichgemacht hat.«
Der Oberkommandierende bemerkte den finsteren Gesichtsausdruck von Sir Davie Baird. Baird hatte sich wiederholt bei ihm beschwert, dass Oberst Wesley, obwohl er auf den Dienstlisten der Horse Guards weit hinten stand, mit einem ebenso wichtigen Posten betraut worden war wie er selbst. Nun hatte Harris auch noch den Plan Wesleys akzeptiert und Bairds Einwände nicht einmal in Betracht gezogen. Nach dem leidigen Zwischenfall um Ashtons Tod schien sich ein neuer Konflikt um den schottischen Offizier anzubahnen, was Harris nicht entging. Der Oberkommandierende nahm sich vor, sowohl Baird als auch Wesley in den nächsten Tagen genau im Auge zu behalten. Im Angesicht des Feindes konnte er es sich nicht leisten, zwei wertvolle Offiziere wegen eines unsinnigen Ehrenkodex’ zu verlieren. In Madras hatte man die Affäre Ashton wegen des Feldzuges bereits heruntergespielt und vertuscht. Sollte Baird nun allerdings versuchen, sich auch noch Wesley vorzunehmen, wurde ein Kriegsgerichtsverfahren unausweichlich. Harris verabschiedete seine Stabsoffiziere und blieb nachdenklich in seinem Zelt zurück.
»Und du bist ganz sicher, Mary?« Charlotte hielt die Hände von Sergeant Sewards zitternder junger Frau fest in den ihren. Barrak ben Ullah goss ihr ein kleines Glas Brandy ein, um sie zu beruhigen.
»Natürlich, Madam! Ich war heute schon sehr früh hinten bei den >brinjarries<. Sie wollten doch, dass ich Gemüse und ein paar Hühner zum Abendessen besorge. Vingetty verhandelte gerade mit einer der Frauen, als ich Major Shee gesehen habe. Er kam mit einem dicken Inder aus einem der Zelte. Der Inder drückte ihm einen Beutel in die Hand, und ich hörte ihn sagen, dass er in der Nacht seine Männer mit Zugtieren schicken würde, um das Pulver abzutransportieren.«
Barrak ben Ullah runzelte die Stirn. Er wusste von Arthur Wesley, dass seit ungefähr zwei Wochen regelmäßig Pulver und Munition verschwanden. Sogar aus der Pferdeherde der Ullahs waren schöne, teure Tiere auf unerklärliche Weise verschwunden, obwohl die Paschtunen seines Vaters die Tiere kaum eine Sekunde aus den Augen ließen. Zuerst hatte Barrak seinem jungen Cousin Moukthar vorgeworfen, er habe die Tiere verloren und nicht den Mut, dies zuzugeben. Der Zug gegen Mysore war Moukthars erste große Reise, und dreihundert Vollblüter stellten für einen Mann von gerade erst zwanzig Jahren eine große Verantwortung dar. Doch Moukthar respektierte Barrak viel zu sehr, als dass er ihn belogen hätte.
Der Afghane drückte Mary Seward das Glas in die Hand und sagte leise zu ihr: »Trink, mein Kleines! Du brauchst dich nicht zu fürchten. Erzähl uns nur ganz genau, was du gesehen und gehört hast. Aus welchem Zelt kam der Major mit dem Inder?«
Mary schlug die Augen nieder. »Es war das Zelt der schlechten Frauen ...« Sie errötete beim Gedanken an Lakshmi und deren Mädchen, die sich jedem hingaben, der dafür bezahlte. Dann nippte sie vorsichtig am Glas. Sie war sehr streng erzogen worden; es war der erste Schluck Brandy ihres Lebens. »Wird Oberst Wesley dann nicht böse auf meinen Rob sein?« fragte sie Charlotte Hall schüchtern. »Und mich aus dem Dienst verjagen?«
»Ach, Unsinn! Du hast doch nichts Böses getan.«
»Wenn Major Shee erfährt ...« Die Stimme von Sergeant Sewards Frau zitterte. Bereits auf der Überfahrt von England nach Indien hatte Shee ihr übel nachgestellt; die Soldatenfrauen hatten Mary regelrecht verstecken müssen. Sie hatte schreckliche Angst vor Shee. »Shee wird nichts erfahren. Hat Vingetty auch irgendetwas von dieser Sache mitbekommen?«
»Nein, Mister Ullah, er war doch dabei, die Hühner für die Offiziersmesse einzukaufen.«
»Hast du ihm davon erzählt?«
»O nein, ich bin gleich zu Madam gelaufen, Sir.« Mary schien sich ein wenig zu beruhigen.
Charlotte strich ihr besänftigend über die Schultern. »Keine Sorge, meine Liebe! Ich werde mit dem Oberst reden, wenn du Angst vor ihm hast. Er wird dir nicht böse sein. So, und jetzt geh wieder an die Arbeit und ängstige dich nicht. Mister Ullah und ich, wir werden uns um Major Shee kümmern.«
Mary stand auf, strich ihre Schürze glatt und machte einen kleinen Knicks vor Charlotte. Dann verschwand sie aus Wesleys Zelt.
Barrak ben Ullah nahm ihren Platz ein. Seine Augen suchten die von Charlotte. »Weißt du, meine Liebe, ich glaube, Arthur hat im Augenblick andere Sorgen als diesen versoffenen Shee. Ich werde dafür sorgen, dass meine Paschtunen die Augen offen halten. Vielleicht gelingt es uns ja, den Tunichtgut in flagranti zu erwischen. Shee treibt sich also bei Lakshmi und ihren Huren herum. Das macht die Sache leichter.«
Er hatte Farsi gesprochen, denn man wusste ja nie, wessen Ohren an dünnen Zeltwänden lauschten. Und einen königlichen Offizier auf einem Kriegszug der Veruntreuung und der Beihilfe zum Diebstahl anzuklagen, war eine schwerwiegende Sache. Ohne handfeste Beweise gegen den Major konnte nicht einmal General Harris etwas ausrichten. Barrak ben Ullah hatte die Affäre Ashton-Baird miterlebt. Er wunderte sich ein bisschen über die Mühlen der britischen Militärjustiz, die offensichtlich sehr langsam mahlten.
Am 5. März erreichte ein Meldereiter des Rajahs von Koorg das Expeditionskorps. Der Rajah war ein alter und treuer Verbündeter der Briten. Er hatte nicht nur irreguläre Kavallerie zu General Stuart und dessen Bombay-Armee geschickt, sondern auch Aufklärer ausgesandt, die den Briten über die Truppen des Sultans im Grenzgebiet berichteten. Man hatte ungewöhnliche Aktivitäten zwischen Periapatam und Seringapatam beobachtet. Der Rajah von Koorg selbst hatte in der Tiefebene ein grünes Zelt erkennen können, auf dem die Standarte des Sultans aufgepflanzt war. Es schien offensichtlich, dass der Sultan von Mysore für den nächsten Tag einen Angriff gegen General Harris’ Expeditionskorps plante, das sich im Schneckentempo einen steilen Pass unweit des Cauvery hinaufplagte. Der Oberkommandierende schickte eilig zwei Bataillone der Ostindischen Kompanie und Oberstleutnant Montresor in Richtung der feindlichen Truppen. John Montresor war einer der besten und begabtesten Offiziere im Dienste von »John Company«. Er kannte Indien in- und auswendig. Nachdem er die Soldaten des Sultans vom Aussichtsposten auf der Feste Koorg einige Zeit beobachtet hatte, brachte er seine Männer in Stellung. Er wollte Tippu den direkten Weg gegen die Flanke des Hauptheeres verbauen. Natürlich hatte der Offizier in so kurzer Zeit keine Möglichkeit, seine Position zu festigen. Doch er ließ eine Lichtung ausschlagen und formierte die zwei Bataillone. Sie waren gut ausgebildet und sehr beweglich.
In den frühen Morgenstunden des 6. März griff Tippu an. Er hatte nicht erwartet, an dieser Stelle auf einen so verbissenen Widerstand zu stoßen. Das Gefecht zog sich über Stunden hin. Montresor und seine Männer kämpften gegen eine riesige Übermacht. Bis drei Uhr am Nachmittag hielt Montresors Linie. Dann aber ging den Männern die Munition aus. Genau in diesem Augenblick stürmte General Stuart persönlich mit dem 77. Infanterieregiment den Pass hinauf und fiel den Soldaten des Sultans in den Rücken. Die Männer aus Mysore waren so überrascht worden, dass viele ihre Waffe fortwarfen und ihr Heil in der Flucht suchten. Der Weg für General Harris’ Hauptstreitmacht war frei. Nur die mehr als zweitausend Gefallenen, die das blutige Feld bedeckten, ließen die Nachzügler erkennen, was an diesem 6. März am Pass von Periapatam in der Nähe von Sedaseer geschehen war.
Charlotte ritt auf ihrem kleinen, dunkelbraunen Vollblut langsam neben Arthur. Sie konnte die Augen nicht von dem schrecklichen Schauspiel abwenden, das sich ihr bot. Über dem Pass kreisten laut schreiend Hunderte von Aasgeiern. Die Hitze in der Vormonsunzeit war so drückend, dass bei den meisten Kadavern bereits der Verwesungsprozess eingesetzt hatte. Ein süßlicher Geruch hing in der Luft. »Bereust du es nicht, dass du mitgekommen bist, kleine Lady?« fragte der Oberst seine junge Verlobte. Ihm lag der Geruch genauso schwer im Magen wie Charlotte, doch als Berufssoldat durfte er so etwas natürlich nicht zugeben.
Charlotte betrachtete den roten Rock an ihrer Seite nachdenklich und antwortete mit einer Gegenfrage. »Und du? Bereust du es nicht, dass du bei den Soldaten geblieben bist?«
Wesley hob die Augen zum Himmel. »Wenn ich das nur wüsste!« In diesem Augenblick sprengte ein Reiter auf Wesley zu. Es war ein Sepoy-Offizier aus dem Stab General Meer Allums. »Wesley-Sahib! Harris-Sahib hat endlich den Befehl zum Einschwenken erteilt. Die Hauptarmee hat die große Straße von Bangalore nach Seringapatam sicher erreicht.«
Arthur entschuldigte sich bei Charlotte und stieß Eochaid die Sporen in die Flanken. Das Tier hatte lange unruhig unter seinem Reiter getänzelt und galoppierte nun die Marschkolonnen entlang. Meer Allums Offizier auf seinem »Kathiawari« konnte kaum mit dem goldfarbenen Hengst mithalten. Als Arthur Eochaid vor Meer Allum zügelte, hatten sich seine Gedanken über die Toten von Sedaseer und Charlottes sonderbare Frage bereits verflüchtigt. Er war wieder ganz und gar in diesem großen Spiel gefangen, das Krieg hieß.
Am 21. März hatte General Harris Cankanelli erreicht. Am 26. März war die Hauptarmee aus dem unwegsamen Dschungel ins flache Land vorgestoßen und konnte bereits die großen Getreidespeicher von Malavelly am Horizont erkennen. Sechs oder sieben Meilen trennten die Teilheere noch. Zufrieden bemerkte der Oberkommandierende die lange Reihe ordentlich errichteter Zelte, die davon kündeten, dass Meer Allums Hyderabad-Armee pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt gekommen war.
Arthur Wesley und Connor McLeod beobachteten von einem Hügel aus besorgt die schweren Zugelefanten des Sultans. Noch befanden die Tiere und Geschütze sich am anderen Ufer des Cauvery, doch es würde nicht mehr lange dauern, dann würde Tippus Armee den Fluss an den drei großen, flachen Furten durchqueren. Ein Sowar trabte den Hügel hinauf. »Oberst-Sahib, eine Meldung von Oberstleutnant Sherbrooke!«
Arthur öffnete den Umschlag. Mit zusammengekniffenen Lippen las er die Meldung. Sherbrooke und die leichten Kompanien des 33. Regiments befanden sich gut versteckt im Dschungel entlang des Cauvery. Sie hatten die Aufgabe, Tippus Truppen zu beobachten und Alarm zu schlagen, sobald der erste Elefant seine gewaltigen Füße ins seichte Wasser setzte. »Bei Sirsoli haben die Aufklärer fast 10000 Reiter des Sultan gezählt ... vierunddreißig riesige Feldgeschütze entlang des Cauvery ... 14000 Fußsoldaten, ein Teil davon Europäer. Verdammt, Connor, das wird knapp. Wir haben 21000 Mann und vierzig Geschütze, aber nur dreitausend Mann Kavallerie. Die anderen sind noch zwischen Harris und der Hyderabad-Armee, und ich kann sie auch nicht zurückpfeifen, weil Baird und die Schotten sonst Probleme bekommen.«
Connor McLeod drehte sich im Sattel um, holte sein Fernrohr hervor und starrte auf die riesige Staubwolke in Richtung Cankanelli. »Harris ist noch fast einen Tagesmarsch entfernt. Es dürften sieben oder acht Meilen sein.«
»Sechs!« verbesserte Wesley den Freund. »Aber das hilft uns nicht weiter. Harris hat den ganzen Tross dabei, und selbst wenn er den Männern befiehlt, schneller zu marschieren ... Du kannst mitten im Feindesland nicht einfach Munition, Proviant und Viehherden unbewacht zurücklassen.« Mit einer heftigen Bewegung stieß der Offizier sein eigenes Fernrohr zusammen und warf es in die Satteltasche. »Was soll’s. Wir wollten unseren Krieg, jetzt haben wir ihn.« Er spornte Diomed zu einem halsbrecherischen Tempo an und galoppierte den Aussichtshügel hinunter in Richtung Feldlager des Nizam. Meer Allum erwartete den britischen Offizier bereits aufgeregt. Seine Offiziere hatten ihm eine Kopie von Sherbrookes Meldung vom Cauvery gebracht; während Arthur auf dem Hügel ausgeharrt hatte, war er durch den Dschungel bis fast an den Fluss geritten. Meer Allum war ein guter, tapferer Soldat. Er konnte es kaum noch erwarten, mit den Männern des Sultans die Waffen zu kreuzen.
»Nun, Wesley-Sahib! Ich habe Sherbrookes Meldung bereits gelesen.« erklärte der General ausgelassen und zeigte dabei fröhlich auf einen Feldstuhl in seinem Zelt.
Arthur schüttelte den Kopf und grinste. »Dann, mein ehrenwerter
Freund, werden wir sie angreifen. Eure Zustimmung vorausgesetzt natürlich.«
Meer Allum schlug Wesley herzhaft auf die Schulter. »Das gefällt mir, Wesley-Sahib! Kein Zögern mehr und kein Taktieren, keine faulen Ausreden und lauen Verhandlungen mit dem Tiger. Warten wir auf Harris?«
»Wozu, Mylord? Der Befehl ist eindeutig. Die Hyderabad-Armee sichert den Vormarsch von Hauptheer und Tross.«
Der junge Offizier hatte allerdings vergessen, dass die Armee aus Mysore über eine doppelt so starke Kavallerie verfügte wie er selbst. Er hatte von seinem Hügel aus die Gegend betrachtet: Sie war für einen Angriff bestens geeignet. Während er mit Connor McLeod diskutierte, hatte sich vor seinem inneren Auge bereits ein Angriffsplan gebildet. Mit seinen achtundzwanzig Jahren war Arthur noch viel zu sorglos und unbekümmert, um sich von einer feindlichen Armee einschüchtern zu lassen. Er wollte endlich kämpfen. Nicht dass Wesley seinem Bruder, dem Generalgouverneur in Kalkutta, oder sich selbst irgendetwas beweisen musste, aber die Gelegenheit war einfach zu günstig...
Charlotte Hall war kreidebleich, als sie die Schärpe um Arthurs Hüften legte und das Schwertgehänge schloss. Sie hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Zum ersten Mal seit Wochen war sie in dem großen Zelt alleine gewesen. Keine Schulter, an die sie sich hätte lehnen können, um einzuschlafen; keine beruhigenden Worte, wenn sie trotz ihrer Abenteuerlust doch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekam; keine zärtliche Berührung und die Nähe seines lebendigen, warmen Körpers, bevor sie die Augen schloss, um sich von einem langen und anstrengenden Tag auszuruhen.
Arthur hatte die Nacht mit den Offizieren des Stabes und Meer Allum zugebracht. Sie hatten an ihrem Plan gefeilt, Einheiten in Stellung gebracht, Geschütze bewegt, Palisadenzäune errichten lassen. Als er Charlotte zum Abschied umarmte und sich ihre Lippen zu einem innigen Kuss trafen, schaute sie in die Augen ihres Verlobten. Sie waren anders als sonst – kalt und berechnend. Sie erinnerten Charlotte an den Blick des großen bengalischen Königstigers, dem sie vor langer Zeit gemeinsam in den Sunderbans begegnet waren. Alles schien nur noch Jagdtrieb und Mordlust. Irgendwie fehlte seinen Augen an diesem kühlen Märzmorgen die Menschlichkeit.
Mary Seward hatte die ganze Nacht geweint und Rob bittere Vorwürfe gemacht, weil er damals in Schottland den Trommeln des Anwerbungssergeanten gefolgt war, statt sich brav in sein Schicksal zu fügen und wie seine Väter und Vorväter Schafe zu züchten. Irgendwann war Rob die Heulerei auf die Nerven gegangen, und er hatte sich zu seinen Kumpels verzogen, um die Nacht friedlich an einem Lagerfeuer zu verbringen, Karten zu spielen und nicht an den nächsten Tag und den Kampf zu denken, der sie erwartete. Als Rob schließlich um fünf Uhr früh seinen Tornister und sein Gewehr aus dem Zelt holte, hatte Mary so getan, als würde sie tief und fest schlafen, und hatte sich nicht gerührt. Seine Worte klangen ihr jetzt noch in den Ohren. »Albernes Weibervolk!« hatte er geschimpft und war in der aufgehenden Sonne des indischen Morgens verschwunden. Mary hatte sich um sechs Uhr früh schließlich aus ihrer Decke geschält und war wie ein geprügelter Hund zum Zelt von Oberst Wesley und Madam Hall geschlichen. Erst als sie Charlottes rotgeweinte Augen sah, fasste die junge Frau von Sergeant Seward sich wieder.
»Ist das eigentlich immer so, wenn die Männer in den Krieg ziehen?« fragte Charlotte verschämt ihr Mädchen. Sie flüsterte, denn irgendwie hatte sie Angst, Arthur könne sie hören und würde sie zurück nach Kalkutta schicken, weil er keine Lust hatte, seine Zeit mit einer Heulsuse zu vergeuden. Charlotte war überzeugt, dass Mary einen reicheren Erfahrungsschatz als Soldatenfrau besaß als sie selbst.
Mary Seward blickte verlegen zu Boden. »Weiß nicht, Ma’am! Ist das erste Mal, dass mein Rob in den Kampf zieht. Wir sind noch nicht lange bei den Soldaten.«
Ein dumpfes Dröhnen ließ das Zelt erzittern, und Mary warf sich hilfesuchend in Charlottes Arme. Tränen rannen ihr über die Wangen. »Wenn sie mir meinen Rob totschießen, was soll ich dann bloß machen? Wie soll ich dann bloß zurück nach Hause kommen?« schluchzte sie.
»Pssst, Mary! Was soll denn das?«
»Sie schlagen sich gegenseitig tot!« rief die Kleine verzweifelt. »Und Johnny hat mir gesagt, man würde sich nicht um uns kümmern, wenn unsere Männer fielen. Dann müssten wir selbst sehen, was aus uns wird, oder zu Hause bleiben und den Priester um Almosen bitten. Denn den Sold bekämen wir nicht im Hochland.«
Charlotte wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Angesichts der
Verzweiflung Marys kamen ihr die eigenen Sorgen um Arthur lächerlich und unerheblich vor. Sie war die Tochter von Sir Edwin Hall. Sollte ihrem Verlobten etwas zustoßen, würde sie als »Witwe« eines Helden zu ihren Eltern zurückkehren und genauso weiterleben wie früher, bevor sie Arthur kennengelernt hatte. Geld besaßen die Halls im Überfluss, und als »Witwe« eines toten Helden würden Englands Soldaten sich – nach einer angemessenen Trauerzeit – um Charlottes Hand reißen. Sie hatte nichts zu befürchten, außer Trauer und Tränen. Aber Tränen trockneten wieder, wenn man gerade erst zwanzig Jahre alt und viel zu unbekümmert und sorglos war.
Bei Mary Seward sah die Sache anders aus. Sie überlebte nur deshalb, weil Zahlmeister Dunn ihrem Mann einmal im Monat den Shilling des Königs in die Hand drückte. Sollte Rob fallen, stand sie ohne einen Penny da – neun Monate und eine teure Seereise von zu Hause entfernt. Viele Soldatenfrauen fanden ihr Heil nur darin, sich am Abend nach der Schlacht dem Erstbesten an den Hals zu werfen, der heil zurückgekommen war. Die Frauen, die zu alt oder hässlich waren, um einen neuen Versorger aufzutreiben, verhungerten oder verkauften sich in finsteren Löchern an Inder, die Lust auf weißes Fleisch hatten. Es war eine grausame Welt.
»Mary, deinem Rob wird nichts passieren!« versuchte Charlotte zu trösten, während von draußen der Lärm des Kampfes ins Zelt drang. Die Worte kamen der jungen Frau hohl und leer vor, aber sie konnte in diesem Augenblick nichts anderes tun, als zu warten, bis das Donnern der Geschütze und das Geschrei der Männer sich legte – und dann zu hoffen, dass niemand kam, der ihr eine schreckliche Nachricht überbrachte ...
Die sieben Bataillone marschierten auf die Anhöhe zu. Sie waren in Kolonne formiert, jeweils eine halbe Kompanie stark. Aus der Vogelperspektive hätten sie wie einhundertundvierzig kleine, scharlachrote Rechtecke im grünen Feld ausgesehen, als sie sich zielstrebig auf die feindlichen Kanonen zubewegten. Neben jeder halben Kompanie marschierte ein Sergeant. Die Offiziere ritten oder marschierten voraus. Aus der Ferne sahen die Rechtecke ordentlich aus, wie mit dem Lineal gezogen, denn die Männer trugen ihren scharlachroten Rock mit weißem Lederzeug und schwarzem Tschako. Aus der Nähe betrachtet konnte der aufmerksame Beobachter allerdings feststellen, wie staubig und zerrissen alle waren. Der lange Marsch von Madras zum ersten Treffen mit Tippu hatte seinen Tribut gefordert. In den Haaren der Männer, die gefettet und gepudert worden waren, tummelten sich die Läuse. Viele hatten blutigen Ausschlag im Nacken, der von dem hohen, harten Lederkragen und dem Schweiß stammte, den kaum einer abwischte, obwohl Indiens Hitze die Hölle war.
Die Sepoys der Ostindischen Kompanie wuselten durchs hüfthohe Gras. Endlich fand eine feindliche Kanonenkugel ihr Ziel, und eine halbe Kompanie des Dreiunddreißigsten stob auseinander wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Niemand war getötet oder verletzt worden, lediglich die Marschordnung war durcheinander.
»Zurück in die Formation, ihr feigen Säcke!« brüllte Major Shee aufgebracht zu Sergeant Seward und seinen Männern hinüber. Die Trommlerjungen schwangen ihre Stöcke, und von neuem übertönte schon bald der tiefe, durchdringe Klang das dumpfe Grollen der Kanonen.
»Wann können wir endlich laden?« fragte Soldat Coley den Sergeanten Seward mit zitternder Stimme.
»Bald, Junge, bald! Bleib nur ganz ruhig und befolg die Befehle der Offiziere.« Rob lächelte den jungen Soldaten an. Er machte sich vor Angst zwar selbst in die Hose, doch er war Sergeant, und seine Aufgabe bestand darin, die Jungs heil in die Schlacht und heil nach Hause zu bringen.
»Maul halten, ihr Säcke, oder ich lasse dem Erstbesten, der mir in die Finger kommt, Disziplin einprügeln!« brüllte Shee von seinem grobknochigen Schimmel aus die halbe Kompanie an. Er war überzeugt, dass die Soldaten nur nach vorn gingen, weil ihnen die Angst vor der Neunschwänzigen und ihren eigenen Offizieren im Nacken saß.
Oberst Wesley hatte den heftigen Wortwechsel in seinem Regiment mitbekommen, obwohl er in diesem Augenblick alle Hände voll zu tun hatte. Er stieß seinem Pferd die Sporen in die Flanken und sprengte zu Shee hinüber. »Zügeln Sie sich! Diese Männer müssen kämpfen!« fauchte er den Major böse an. Er konnte Shee auf den Tod nicht ausstehen. Der launische und ständig betrunkene Offizier war ihm schon seit Jahren ein Dorn im Auge.
Shee senkte die Augen, damit sein Kommandeur nicht den Hass darin lesen konnte. Wie sehr wünschte er sich in diesem Moment, dass es Nacht wäre und er sich mit diesem Buchhalter allein an irgendeinem abgelegenen Ort befände. Er hätte ihm eine Kugel in den Kopf gejagt. Seit Wesley das 33. Regiment von Cornwallis übernommen hatte, hackte er nun schon auf ihm herum. An allem, was Shee tat oder sagte, hatte Wesley etwas auszusetzen. Und dann war da dieser Beiklang in seiner Stimme ... herablassend und verächtlich. In diesem Augenblick eilte ein Sepoy heran, und der Kommandeur des 33. Regiments wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Kampfgeschehen zu.
»Dreiunddreißigste – in Linie nach links!« hörten die Männer ihren Kommandeur über das Kanonengrollen hinweg brüllen. Sie gehorchten.
»In Zweierreihe!« befahl Wesley. Die Führungskompanie des Regiments hielt. Alle anderen halben Kompanien beschleunigten ihren Schritt und schlossen von der linken Seite zu ihren Kameraden auf. Die Männer rissen noch im Laufen die Pulverhülsen mit den Zähnen auf und stießen ihre Kugeln mit den Ladestöcken tief in den Rachen ihrer Brown Bess. Ein scharfes, metallisches Klicken bedeutete Arthur, dass alle Männer ihr Bajonett aufgepflanzt hatten.
»Nach rechts! Langsam, Jungs!« befahl Major Francis West. »Sergeant Howard! Erste Reihe – kniet!«
»Feuer!« rief Arthur Wesley den Männern zu. Dann sahen sie, wie ihr Kommandeur sein Pferd zur Seite trieb und ihnen das Schussfeld frei machte.
»Laden! Feuer! Laden! Feuer! Laden! Feuer!« brüllten sämtliche Sergeanten ihren Männern zu, bis Wesley schließlich den erlösenden Befehl gab: »Feuer frei! Vorwärts, Männer!«
Er hatte die beiden Pistolenhalfter vorn an Diomeds Sattel geöffnet. Wesley hatte eine etwa 3000 Mann starke Kolonne Infanterie ausgemacht, die über eine Anhöhe aus den Linien des Sultans direkt auf sein Regiment und das 11. Regiment der Madras-Infanterie zukam ... und in diesem Augenblick begriff der junge Offizier, dass dies sein Moment der Wahrheit war. Jeder Soldat des 33. Regiments und die Sepoys, die an ihrer Seite kämpften, schienen es ebenfalls zu erkennen. Sechs lange Jahre hatte er diese Männer gedrillt, hatte sie Tag für Tag immer wieder mechanisch die gleichen Bewegungen ausführen lassen, ihnen Mut zugesprochen, wenn sie niedergeschlagen waren und sie gelobt, wenn sie seinen hohen Anforderungen gerecht wurden ...
Arthur zog den Säbel. Der Feind marschierte geradewegs auf die Regimentsfahnen zu. »Dreiunddreißigstes! Halt! Schwenkt halbrechts! Fertig machen!«
Der Feind war mindestens dreimal so stark und schien diszipliniert und siegessicher zu sein. Vor vier Jahren hatten die Veteranen seines Regiments zum letzten Mal das Feuer auf einen Feind eröffnet – damals, während des grauenvollen Flandernfeldzugs, als sie gemeinsam die Schanzen von Boxtel stürmten. Es war eiskalt gewesen, und starkes Schneetreiben hatte ihnen die Sicht verwehrt. Heute fiel kein Schnee, und die Finger der Männer waren nicht steif gefroren. Sie waren ausgeruht, und jeder hatte sich am Vorabend den Bauch vollgeschlagen. Stolz leuchteten die Augen des jungen Offiziers, als er auf die ruhige rote Linie blickte, die sich hinter ihm aufgebaut hatte. Das Kriegsgebrüll der Soldaten des Sultans war ohrenbetäubend.
Nach außen hin war Arthur gelassen. Er war der Fels in der Brandung, um den das 33. Regiment sich geschart hatte. Innerlich stellte er sich allerdings beunruhigt die Fragen: Ist der Feind nahe genug? Soll ich feuern lassen? Sie werden keine Zeit mehr haben, nachzuladen! Kann ich den Bajonettangriff wagen? Arthur konnte die wilden, dunklen Gesichter der Männer aus Mysore deutlich erkennen. Keine sechzig Meter trennten das 33. und das 11. Regiment aus Madras vom Feind. Mit einer heftigen Bewegung zischte Arthurs Säbel durch die Luft, während er gleichzeitig den Feuerbefehl brüllte. 733 Abzüge wurden gedrückt. Flammen sprangen aus jeder Pulverpfanne. Ein scharfes, metallisches Klicken. Die ersten Reihen der Infanteriekolonne des Sultans stürzten in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Sie waren frontal in die eiserne Wand der britischen Kugeln hineingelaufen. Kaum einer der Getroffenen regte sich noch auf dem blutigen Gras.
Das 33. Regiment war genauso ruhig wie ihr Kommandeur. Niemand geriet außer Kontrolle. Die beiden Flanken des Regiments bewegten sich lediglich etwas schneller in Richtung der überlebenden Feinde. Die Sepoys von der Madras-Infanterie taten es ihren Kameraden gleich. Nach dem undurchdringlichen Kugelhagel bohrte sich kalter Stahl in die Körper der überlebenden Soldaten aus Mysore. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass in den Augen ihrer Gegner die pure Mordlust geschrieben stand.
Als der Sultan sah, wie seine Infanterie zwischen den Zähnen der
Briten zermahlen wurde, hob er die Augen zum Himmel und fragte Allah um Rat. Oberst Cappellini, der neben ihm auf dem Pferd saß und auf Französisch vor sich hin schimpfte, dass man nun endlich die Kavallerie zum Einsatz bringen sollte, um die schwer bedrängte Infanterie zu entsetzen, hörte der Sultan überhaupt nicht. Dann sprach Allah zu ihm: Der Gott aller Gläubigen befahl seinem Diener Tippu, diese feigen Hunde ihrem Schicksal zu überlassen, denn das »baraka« war an diesem Tag nicht mit ihnen. Allah befahl dem Sultan, nach Seringapatam zurückzukehren und sich dort darauf vorzubereiten, die Ungläubigen würdig zu empfangen.
Sherbrooke und Stapelton Cotton hatten beide den gleichen Gedanken, als sie mit ansehen mussten, wie Wesley den konzentrierten Angriff des Gegners abwehrte. Auf der linken und rechten Seite führten sie rasch frische Einheiten um die fliehenden Männer des Sultans herum, um diesen dann am Cauvery in den Rücken zu fallen. Doch die Soldaten aus Mysore rannten so schnell, dass ihre britischen Gegner sie nicht einholen konnten. Als die Nacht sich über das blutige Schlachtfeld von Malavelley senkte, gaben Sherbrooke und Cotton die Verfolgung auf. Sie hatten gewonnen! Und was für ein Sieg es war! Außerdem konnten die beiden Offiziere ihre Soldaten nicht mehr im Zaum halten. Viele machten sich bereits über die Toten und Sterbenden her, um zu plündern, was diese am Leib trugen. Gerüchte von sagenhaftem Reichtum, von Edelsteinen, die die Männer des Sultans in ihren Schärpen oder unter ihren Turbanen versteckt trugen, hatten die Runde gemacht. Wer nur den mageren Shilling des Königs und seine Autorität gegen sie zu setzen vermochte, war verloren. So diszipliniert Englands Soldaten und ihre indischen Verbündeten am Tag gekämpft hatten – im Schutze der Nacht entwickelten sie sich zu einem wüst plündernden, unkontrollierbaren Haufen.
General Harris war außer sich vor Freude über diesen ersten großen Erfolg gegen den Sultan. Und nicht nur die Hyderabad-Armee hatte sich glänzend geschlagen. Davie Baird, der griesgrämige Schotte, war an der Flanke von irregulärer Kavallerie angegriffen worden. Sein Zorn und sein Hass – über viele Jahre aufgestaut, aber nie verdrängt – hatten sich entladen wie ein Donnersturm: Für nur siebenundzwanzig tote britische Soldaten schrieb der Generalmajor sich fast vierhundert tote Reiter aus Mysore auf die Fahnen.
Natürlich war Oberst Wesley stolz auf den Sieg, doch der gute Ton und die herausragende Stellung von Meer Allum geboten es, dass er sich in dem Augenblick zurückzog, als General Harris zum großen Schulterklopfen und Lobpreisen ansetzte. Offiziell war er ja nur Berater des Generals aus Hyderabad. Außerdem war er hundemüde, schmutzig und durchgeschwitzt, und sein Nervenkostüm, das den ganzen Tag im Feld so bemerkenswert robust gewesen war, begann sich nun in einer Woge von Emotionen und Ängsten aufzulösen. Statt sich an eine festlich gedeckte Tafel im Hauptquartier zu begeben und dabei zu riskieren, dass seine Selbstbeherrschung in sich zusammenfiel wie ein Kartenhaus, wollte er sich lieber bei Charlotte verkriechen.
Die junge Frau hatte schon lange vor Wesleys Rückkehr von diesem Sieg gehört und davon, wie tapfer ihr Verlobter sich geschlagen hatte. Mit dieser Neuigkeit und der Gewissheit, dass Wesley heil aus der Schlacht zu ihr zurückkehrte, war ihre seltsam pessimistische Stimmung vom frühen Morgen in das genaue Gegenteil umgeschlagen. Sie hatte zwei Gläser und eine Flasche Champagner auf den kleinen Tisch gestellt und ein ausgezeichnetes Diner auftragen lassen, bei dem sich ausnahmsweise einmal Fleisch im gedünsteten Reis befand. Charlotte hatte eine Kerze angezündet, ihr schönstes Kleid angezogen und wartete nun ungeduldig wie ein Kind auf ihren Helden.
Bevor Arthur die Zeltplane zurückschlug, fuhr er sich mit der Hand über die Augen, um sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen. Es waren Tränen der Erschöpfung und der Erleichterung gewesen, die ihn überfallen hatten, als er langsam vom Cauvery ins Feldlager bei Malavelley zurückgeritten war, doch er schämte sich trotzdem. Was würde seine kleine Lady von ihm denken, wenn er nach einer siegreichen Schlacht mit rotgeweinten Augen bei ihr auftauchte?
Er setzte seine tapferste Miene auf und umarmte Charlotte mit gespielter Fröhlichkeit. Beim endlos langen Abendessen zwang er sich, amüsant zu sein und in lockerem, unbefangenem Tonfall auf ihre neugierigen Fragen zu antworten. Natürlich konnte auch er aufrichtig darüber lachen, dass die Soldaten des Sultans gerannt waren wie die Hasen, und er bedachte sogar die kleine Seward mit einer erfundenen Anekdote über ihren heldenhaften Sergeanten, nachdem sie brav das Geschirr abgetragen und den Kaffee serviert hatte. Erst als Charlottes warmer, weicher Körper sich in der Vertrautheit und Stille ihres schmalen Feldbettes an ihn kuschelte und ihre Hände ihn sanft liebkosten, verlor er die Selbstbeherrschung.
Eine Armee gegen einen übermächtigen Gegner zu führen, ohne wirklich zu wissen, wie so etwas eigentlich ging, und dabei jede Sekunde gewahr zu sein, dass der kleinste Fehler den Tod Hunderter guter Männer bedeuten konnte, war viel Verantwortung auf einen Streich für einen jungen Offizier, der erst ein einziges Mal im Leben Pulverdampf gerochen hatte. Jeden Augenblick während des Waffengangs von Malavelley war Wesley sich dessen bewusst gewesen: Sein kluger Kopf hatte immer nur großartige Theorien in sich aufgenommen und wunderbare Memoranden verfasst. Von der Quintessenz des Krieges aber wusste Arthur nur wenig. Er hatte Cäsar gelesen und die »Träumereien« des Marschalls von Sachsen; er hatte kluge Bücher über Friedrich den Großen verschlungen und in seiner Phantasie schon hundertmal auf dem Feld von Ephesus gestanden, doch im Grunde wusste er nichts. Er war ein Schüler, ein Dilettant, ein Spieler, bestenfalls ein Theoretiker, der brav seinen Lloyd auswendig gelernt hatte. Vor allem aber war Arthur ein Regimentsoffizier, ein Oberst, wie viele andere auch. Nun ja, vielleicht kein gewöhnlicher Oberst, denn er besaß diesen seltenen Charakterzug der Bescheidenheit und des Lerneifers, der so vielen seiner Waffenbrüder abging ... Während Charlottes kleine, warme Hände sanft über seinen müden Rücken strichen, wurde Arthur plötzlich klar, wie überheblich es doch gewesen war, General Meer Allum den frontalen Angriff gegen einen übermächtigen Feind zu empfehlen. Mit einem Mal wurde ihm klar, was alles hätte passieren können, wenn ... und dann sah er in seinem Halbschlaf ein Feld vor sich, auf dem tote Rotröcke lagen, und er hörte die Frauen der Soldaten jammern und sah Mary Seward, die sich schluchzend über die Leiche eines toten Sergeanten seines Regiments beugte, und irgendwie gingen ihm diese anklagenden, tieftraurigen Augen nicht aus dem Sinn ...
»Arthur«, flüsterte Charlotte ihrem Verlobten ganz leise ins Ohr. »Warum hörst du nicht auf, dich so zu quälen? Es ist vorbei! Keiner von deinen Jungs liegt da draußen. Ihr habt hoch gespielt und gewonnen. Was ist schon dabei?«
Wesley rollte sich auf den Rücken und starrte auf die schmutziggelbe Zeltplane. »Was ist schon dabei?« wiederholte er leise Charlottes Worte. »Wenn ich das nur wüsste, Liebste. Irgendwie ist es seltsam.« Er setzte sich auf, zog Charlotte in seine Arme und spielte mit ihren langen braunen Locken. »Aber es macht mir Spaß, Soldat zu sein. Heute früh, als du mir adieu sagtest, hat es mich eigentlich nicht gekümmert, dass ich dich allein zurücklassen musste. Irgendwie wollte ich nur raus, wollte mit den Männern des Sultans kämpfen, auf die Jagd gehen ... Vielleicht wollte ich meinem Bruder Mornington etwas beweisen, oder mir selbst, aber es ist ein ganz sonderbares Gefühl, wenn du plötzlich dastehst und es zwischen Leben und Tod nur noch deinen Befehl gibt. Es ist schrecklich! Große unvernünftige Jungen, die Krieg spielen und sich dabei königlich amüsieren ... der Klang der Trompeten, das Dröhnen der Kanonen, die Trommler, die Regimentsfahnen, schreiende Männer, die übereinander herfallen, obwohl sie einander nicht kennen und hassen ...«
Charlotte wand sich aus Arthurs Umarmung und presste ihre Lippen auf die seinen. »Hör auf mit deinem Philosophieren und deinen Gedankenspielereien, Wesley! Akzeptiere einfach, dass du mit Leib und Seele Soldat bist, und such nicht irgendeine laue Entschuldigung dafür. Mich stört’s nicht. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich verdammt stolz auf meinen Arthur war, als die Männer mir in den leuchtendsten Farben geschildert haben, wie ihr die Truppen des Sultans fertiggemacht habt. Du wolltest deinen Krieg. Jetzt hast du ihn und ... zum Teufel, wenn du dich auf den Feldern der Ehre schon wacker für König Georg und England schlägst, dann schlag dich hinterher wenigstens auch wacker mit mir ...«
Sie rollte sich energisch über ihn und krallte ihre kleinen Finger in seine breiten Schultern, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob der hehre Ritter in Kampfesstimmung war oder nicht. Zwölf Stunden hatte sie gezittert und gebangt, und nun lag er neben ihr – lebendig, warm und unversehrt, und sie wollte diese Stunde genießen und nicht über den Krieg nachdenken oder über die Moral oder Tippu. Charlotte war gerade erst zwanzig Jahre alt geworden, doch an diesem 27. März bei Malavelley hatte sie begriffen, dass man das Leben nehmen musste, wie es kam, denn manchmal war es kurz...