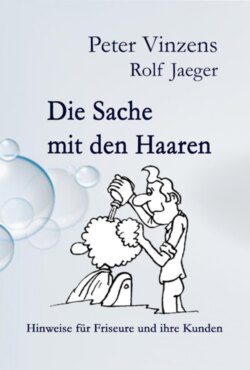Читать книгу Die Sache mit den Haaren - Peter Vinzens - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Haar als Solches
ОглавлениеEs gibt Menschen, die haben auf ihrem Haupte überhaupt keine Haare. Diese nennt man Glatzköpfe. Die bekanntesten Vertreter der Neuzeit sind Telly Savalas, alias Kojak und Jul Brunner. Beide waren Schauspieler, Amerikaner und in der Lage aus ihrem Mangel einen Kult zu machen. Zu ihren Gunsten versteht sich. Hinzu kommt natürlich als Aspirant heute der Politiker Peter Altmeier. Aspirant deshalb, weil Peter Altmeier noch Reste seiner Haupthaare als Kränzchen trägt. Bald aber schon wird er sich in die Reihe der genannten Berühmtheiten einreihen können. Das lassen zumindest die Gesetze der Biologie vermuten.
Nun mag es befremdlich, ja widersinnig erscheinen ein Traktat über Haare ausgerechnet mit Glatzköpfen zu beginnen. Ein Blick zurück in die Geschichte des Haupthaares allerdings lässt diesen Beginn in ganz anderem Licht erscheinen.
Da war zum Beispiel Simson, auch Samson genannt, der bekanntlich (Altes Testament, Richter 13 – 16) übermenschliche Kraft aus seinen Haaren bezog. Aus Liebe zu der Philisterin Delila verriet er dieser sein Geheimnis und dann, der wallenden Pracht beraubt, wurde er versklavt und geblendet. Schließlich kam er um. So geht es einem, wenn die Haare weg sind.
Ähnlich die Informationen über Absalom. Der arme Kerl verheddert sich bei der Flucht vor seinen Häschern mit seiner prachtvollen Mähne in einem Baum, wird gefangen und umgebracht. Mit kurzen Haaren wäre das nicht passiert. Mit den langen Haaren hatte es also schon vor langer Zeit seine besondere Bewandtnis. Hätten die Gegner der Beatles-Behaarung dieses Argument früher vertreten, wer kann ermessen, wie die Pop-Geschichte ausgegangen wäre. Aber das ist jetzt eine unzulässige Spekulation.
Noch heute können wir dieses Phänomen allerdings nachvollziehen. Man stelle sich eine Wagner-Oper vor: Gewichtige Klänge aus dem Orchestergraben, blaues Licht von hinten, dunkle Dekoration, gewaltige Stimmen berichten von drohendem Untergang und dann tritt einer der Hauptprotagonisten, natürlich ein Bass, mit Glatze auf. Unmöglich! sagen da die Theaterkritiker, und natürlich, der Regisseur verstünde sein Handwerk nicht. Recht hätten sie, diese Besserwisser der schreibenden Zunft, gleichgültig wie stimmgewaltig der Sänger auch sein möge. Schließlich schleppen wir eine Jahrtausende alte Kultur der Haartracht mit uns herum. Die kann man nicht so einfach von heute auf morgen in den künstlerischen Orkus werfen.
Kelten und Germanen trugen ihr Haar lang, vorausgesetzt sie waren Freie. Knechten und Leibeigenen wurden die Haupthaare geschoren, auf dass jeder erkennen konnte, wo wer in der Hierarchie hingehörte. Auch noch viel später wurden Menschen die Haare abgeschnitten, um sie zu demütigen, um sie quasi öffentlich unfrei zu machen. Das hat sich in einigen Köpfen sogar bis heute noch gehalten, auch in Glatzköpfen. Woraus man ersehen kann: Die Haartracht ist eine durchaus politische Angelegenheit.
Nun galten Kelten und Germanen bei den Machthabern im mediterranen Raum durchaus als Barbaren. Irgendwie bedeutet Barbaren ja auch „die Bärtigen“, die Ungepflegten, die Kulturlosen. Und da hatten die Römer wohl auch recht. Auf die Barbaren wurde deshalb – zumindest solange sie das Römische Reich noch nicht erobert hatten – einfach herabgesehen. Ihre lange Haartracht galt als unappetitlich und abstoßend.
Trotz dieser kulturellen Erfahrung: Diese Unterschiede in der Betrachtungsweise der Haarlänge sollten auch unter statistischen Gesichtspunkten gesehen werden:
Der Mensch als Solcher hat im Schnitt zwischen 300-Tausend und 500-Tausend Haare am ganzen Körper. Glatzköpfe ausgenommen. Davon entfallen rund 25% auf die Kopfbehaarung, also maximal 125-Tausend Haare. Jedes dieser winzigen Haarkleid-Teile wächst jeden Tag zwischen 0,25 und 0,40 Millimeter. Rechnet man diesen Wert hoch, dann kommt der Beobachter auf erstaunliche Werte, statistisch gesehen versteht sich: Somit wächst das Haar jedes Jahr um 118 Millimeter. Bei einer statistischen Lebenserwartung von 70 Jahren wächst jedes Haar also gut 8 Meter, vorausgesetzt sie fallen dem statistisch Berechneten nicht vorher aus. Bei 125- Tausend Haaren auf dem Kopf ergibt das eine Gesamtlänge von rund 1.000 Kilometern. Die Strecke von Oslo nach Frankfurt am Main, knapp. Aus dieser Länge müsste sich doch im Prinzip was machen lassen.
Aber, treiben wir – um der kulturhistorischen Betrachtung willen – die Rechnerei noch weiter: Die mittlere Temperatur im Januar des kühlen Nordens liegt im Mittel rund 15 Grad Celsius unter den Temperaturen Italiens. Da sollte es doch niemanden verwundern, dass die Barbaren des Nordens ihr Haarkleid länger wachsen ließen als die Schöngeister in den warmen Gefilden des Mittelmeeres. Deshalb bestand weder bei Römern noch bei Griechen, die Notwendigkeit, sich vermittels langer Haupthaare gegen die Kälte zu schützen. Die störten in der Hitze des Mittelmeers nur. Insofern müssen wir heute die Barbaren des kalten Nordens in Schutz nehmen.
Somit bleibt festzuhalten, dass das Haar eine besondere Aufgabe besitzt und nur sekundär Modeerscheinungen untertan gemacht wird. Die Natur hat vorgesehen, dass Haare wärmen, dass sie vor Sonne schützen, dass sie – je nach Beschaffenheit- die Transpiration fördern oder unterbinden sollen. Weiter nichts.
Was aber wäre der Mensch, hätte er nicht seine Eitelkeiten und besonderen Vorstellungen. „An den Haaren sollt ihr sie erkennen...“, hat, aus welchen Gründen auch immer, keiner jener weltberühmten Dichter niedergeschrieben und damit der Nachwelt eine Weisheit hinterlassen. Verwunderlich eigentlich, hat sich die Gestaltung des Haupthaares doch zu einem in der Geschichte besonderen Merkmal der gegenseitigen Einschätzung entwickelt. Als erstes galt es doch (und gilt wohl noch immer) säuberlich zu unterscheiden zwischen Reichen und Armen, Besitzenden und Besitzlosen, Einflussreichen und Null- Nummern.
Unter Ludwig dem XIV, um nur ein Beispiel zu nennen, gelangte das Erkennungszeichen „Haartracht“ zu einem seiner vielen Hoch-Zeiten. Vor seiner Regentschaft waren die französischen Edelleute renitent, nur schwer dem Einfluss des Königshauses zu unterziehen und selbständig. Mit Ludwig 14 sollte sich das ändern: An seinem Hofe herrschte eine rigide Kleiderordnung. Wertvolle Stoffe und aufwendige Schnitte waren gefordert. Je prachtvoller das Gewand, je teurer, desto höher die Aufmerksamkeit. Bei den Damen ebenso wie bei den Herren. Ludwig immer vorneweg in der Mode, denn der konnte sich das finanziell leisten. Da das natürliche Wachstum der Haare allerdings schnell Grenzen aufzeigte, wurde die Perücke modern. Auch hier: Je verrückter, desto besser. Zwar tummelten sich ganze Heerscharen kleiner Tierchen in den prachtvollen Gebilden. Sogar Flohfallen mussten in die Haarpracht eingebaut werden. Besondere Stäbchen zum Kratzen wurden entwickelt. All dies aber tat dem Diktat der Mode keinen Abbruch. Man muss sich das mal vorstellen: Ludwig 14 hält Audienz, niemand außer dem König darf sich kratzen und alle warten darauf, dass sich der Monarch endlich abwendet, um diesem drängenden Bedürfnis nachzukommen. Eine schreckliche Vorstellung, die Politiker auch heutzutage noch plagt.
Immerhin schaffte Ludwig der XIV es auf diesen Dreh den Adel des Landes an sich zu binden, ihn in Schulden zu treiben und so seinen Einfluss auf ihn durchzusetzen. Da sage noch einer, Mode hätte nichts Politisches an sich. Auf jeden Fall war es alsbald aber nicht nur dem Adel, sondern auch dem gehobenen Bürgertum klar, dass Aussehen in Form von Gewand und Haartracht etwas mit der sozialen Stellung zu tun hatte. Später wurden sogar gesetzliche Regeln aufgestellt, wer was, zu welchem Anlass tragen durfte und welche Frisur dazu notwendig war. Da könnte ja sonst jeder kommen, nur weil er Geld in Verkleidung und Haare investiert. Wo kommen wir da denn hin? Nicht umsonst tragen deshalb Dirigenten heute noch Frack, Politiker Stresemänner, Richter Roben und Pfarrer Talare. Ein bisschen Unterschied zum Normalvolk muss schon sein. Aber nur noch Richter in einigen Staaten haben auch heute die Pflicht Perücken zu tragen. Ein Relikt aus der Zeit, als die Haare noch den Stand vermittelten.
Wer allerdings meint, diese Zeit sei endgültig vorbei, der irrt oder schaut nicht so genau hin: Als in den 60ger-Jahren die „Beatles“ als Pilzköpfe ihr „All you need is Love...“ sangen, war dies mehr als ein Lied. Es war eine neue Weltanschauung. Der Protest richtete sich gegen ein verkrustetes, festgefahrenes und als spießig angesehenes europäisches Gesellschaftssystem. Die Haare hatten dort gefälligst kurz zu sein, Fasson-Schnitt war angesagt. Ein Überbleibsel aus den Erfordernissen der Weltkriege. Unter den Einheitsstahlhelm gleich welcher Nation passte kein Langhaar. Obere des Militärs hatten Langes verboten, weil es unpraktisch war, und all die, die patriotisch zu Hause bleiben durften, wollten sich von der kämpfenden Truppe nicht durch nachlässiges Aussehen absetzen. Eine ganze Generation verlor ihre Jugend, und das, was sie nach den Kriegshandlungen dafür hielt, war zwangsläufig militärisch geprägt. So schnell bekam man halt den Drill der Obrigkeit nicht aus den Knochen der Untergebenden hinaus.
Dann aber kommen diese Beatles und all die anderen Taugenichtse daher und lassen sich die Haare wachsen. Im Nachhinein gesehen waren die Pilzköpfe noch harmlos im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Damals aber verfuhren sie wie Eisbrecher in der Arktis und setzten neben ihr aufmüpfiges Geschrei auch noch schulterlange Haare. Ungepflegt seien sie, schrieb die konservative Presse damals, sie sähen aus wie Weiber, zwangsweise müssten ihnen die Haare geschnitten werden. Wie es damals im sogenannten „Tausendjährigen Reich“ gemacht wurde, das Gott sei Dank dreizehn Jahre später untergegangen war. Die Freiheit die Haartracht zu gestalten, wurde auf einmal ein gesellschaftliches Problem. Krach in vielen Familien Europas, Beschimpfungen von und gegen Friseure, weil die einen dafür und andere dagegen waren. Dabei war die Auseinandersetzung um das Aussehen lediglich die Spitze des Eisberges einer gesellschaftlichen Wandlung. Den wenigsten der Langhaarigen wird es damals bewusstgeworden sein: Hier fand europaweit eine kleine „Revolution“ statt, hinter der weit mehr als nur das Haar stand. Unterscheiden wollten sie sich von ihren Eltern, frei sein vom Einfluss des Vergangenen, anders sollte es werden. Lange Zeit war es nicht so ganz klar wie anders, aber anders musste es schon sein.
Aber wie das nun mal so ist im menschlichen Leben: Eine Reihe von denen, die damals protestierend und langmähnig auf die Straße gingen, haben sich inzwischen angepasst, tragen Designer-Klamotten, lassen sich in schweren Limousinen chauffieren und haben – wen wunderts - kurze Haare. Und sollte tatsächlich mal einer gegen sie aufmucken, dann reagieren sie brüskiert. Wie vergesslich doch Macht macht.
Aber bleiben wir bei den Haaren und bei den Vorbildern: Cäsar war einer, Ludwig der XIV, die deutschen Kaiser, Stalin, Hitler, die Beatles, all die, von denen die Zeitgenossen meinten sie seien die ganz Großen, sie wurden nachgeäfft. Im Kleineren trifft das auch heute noch zu, allerdings in veränderter Qualität. Altkanzler Kohl gab sich eher konservativ unauffällig und war deshalb als Vorbild ungeeignet. Altkanzler Schröder gab zwar in der Affäre „gefärbt“ oder „nicht gefärbt“ Anlass zu Presseberichten, ist aber als Vorbild für die Gestaltung der Haarpracht auch nicht geeignet. Besser geht’s da den Damen und Herren, die durch Film und Fernsehen bekannt gemacht wurden.
Dieter Bohlen mit Sicherheit nicht, der muss Bücher über sich schreiben lassen, aber seine ExEx Feldbusch/Poth ist da schon pfiffiger. Als das „Dummchen der Nation“ (...hier werden Sie geholfen...) konnte sie nicht nur viel Geld verdienen und ihren Marktwert festigen, sie hatte auch dem „Fräulein-Wunder“ der 50ger Jahre ein aktuelles, ein neues Gesicht verpasst. Ihrer „Intimfeindin“, der Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, war dies nicht vergönnt. Diese hatte sich auf eine modisch äußerliche Vorbildfunktion aber auch nie kapriziert. Gottlob, denn das wäre auch schiefgegangen.
Die langjährige Kanzlerin Angela Merkel taugt auch nicht als visuelles Vorbild, dazu sind ihre Kostümberater zu konservativ. Der junge europäische Adel indes befriedigte und befriedigt wiederum die Vorstellungen des Marktes. Angefangen von Lady Di, der ehemaligen britischen Nachfolgeadeligen, über ihre Söhne, bis hin zu deren Angetrauten und noch demnächst Anzutrauenden, sie alle dienen den Medien als Stilikonen, selbst wenn sie an Magersucht leiden.
Von Zeitungskiosken, im Internet und den Filmplakaten lächelt es uns immer wieder entgegen: Das „neue“, alte Frauenbild des angebrochenen Jahrtausends: Blond, langhaarig, schmal, hochbeinig ist wieder mal angesagt. Neu ist‘s eigentlich nicht. Barbie lässt grüßen. War halt alles schon mal da.
Was die Körpergröße betrifft, treten - gewissermaßen natürliche – Grenzen auf, die das Idealbild beeinträchtigen. Aber egal, ob dick oder dünn, ob zu klein oder zu groß, an der Haarfarbe lässt sich arbeiten und an der Haarlänge neuerdings auch. Die Industrie und der Künstler im Salon werden es schon richten.
Damit sind wir bei den fachlich hochqualifizierten Spezialisten in Sachen Haartracht. Den Friseuren, den Coiffeuren, den Haarkünstlern. In Krisenzeiten und als es lediglich um das „kurz machen“ ging, war der Job ein Einfacher. Zu Zeiten, bei denen die Kunden sich für die Gestaltung Zeit und Geld nehmen können, wird die Angelegenheit dagegen viel schwieriger.
So stellt sich die Frage, woher der Beruf des Friseurs eigentlich kommt. Geschichtlich bildeten sie zusammen mit den Badern eine Zunft. Ihre Aufgabe umfasste die Haarpflege, die Pflege von Händen, Füßen und Haut, die Herstellung von Perücken und Haarersatz, sowie die den Badern zugedachte Betreuung bestimmter Krankheiten. Im Mittelalter waren diese Aufgaben gemischt. Der kranke Mensch unterlag, besonders wenn er arm, nicht adelig und ohne Hilfe der Hierarchie war, der Betreuung von Heilkundigen und Badern. Zwar gab es bereits seit langem Mediziner, das Mittelalter aber war keine besonders günstige Zeit für die medizinische Ausbildung. Der „Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen...“ und die allmächtige Kirche musste alles absegnen. Da war es bisweilen besser, man kam an einen halbwegs gut ausgebildeten Bader, der am Rande der Legalität und leicht außerhalb der Kontrolle der Inquisition, Kranken helfen konnte. Beim Frisieren indes, einem der Berufsfelder der Bader, konnte nur wenig passieren. Mittelalterliche Gemälde zeigen Herren mit wallendem, vielleicht auch ungepflegtem Haupthaar. Die Damen wirken allerdings wohl hergerichtet. Wenn wir den Malern nicht unterstellen alle Damen schöner dargestellt zu haben als sie waren, dann begründeten die Friseure des Mittelalters den Ruf der Haarkünstler heute. Die Spezialisten in Sachen Haare bei den Griechen, den Römern, den Ägyptern und anderen Hochkulturen wollen wir erst einmal unberücksichtigt lassen.
Aufgrund der vorliegenden Informationen waren Kämme, Brennscheren und Haarteile den damaligen Spezialisten am Haar durchaus bekannt. Was im Dunkel der Zeit allerdings unklar bleibt, ist, ob die Friseure männlichen oder weiblichen Geschlechts waren. Wahrscheinlich ist, dass die Damen von Rang von ihren Mägden und Dienerinnen frisiert wurden. Dem überwiegenden Teil der Herren war es anscheinend egal, wie sie aussahen. Mittelalterliche Modefrisuren der Männer sind heute nur noch schwer festzustellen. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass der edle Ritter – wenn überhaupt – nur in Harnisch und Helm abgebildet wurde. Da ist die Haartracht schwer zu erkennen.
Mit dem ausgehenden Mittelalter scheinen die Friseure ausschließlich männlichen Geschlechts zu sein; so die Überlieferung. Eine Geschichtsschreibung über dieses Problem, die diesen Namen verdienen würde, gibt es allerdings nicht. Es ist anzunehmen, dass die Mehrzahl der Menschen sich entweder selbst zu frisieren wusste, oder sensible Kräfte beiderlei Geschlechts ihnen zu schönem Aussehen verhalfen. Kämme, Scheren und Messer, die sich für diesen Zweck eignen, sind in jedem besseren Museum zu finden.
Die hohe Zeit der Coiffeure kam erst danach. Überliefert sind ausschließlich Männer, was aber eigentlich nichts sagt, denn die Aufgaben von Frauen wurden viele Jahre schlicht unterschlagen. Wer also wollte sich da festlegen, insbesondere, da unsere Geschichtsschreibung ja auch lediglich die Herrschenden betrachtet, und die hatten einen Bevölkerungsanteil von weit unter 5 Prozent.
Betrachten wir also das 19te Jahrhundert: Der Bund deutscher Friseure wurde 1871 gegründet. Ein reiner Männerbund, der pingelig darauf achtete, dass nur Herren in diesem Handwerk zu Meisterehren kamen. 1876 kam dann auch das erste Presse-Organ heraus: Die „Offizielle Haarformer-Zeitung“. Hier war nachzulesen, was, wie und warum der Friseur seine Arbeit zu tun und zu lassen hatte. Diesem Blatt war auch zu entnehmen, was „Mode“ war und wie „der Herr von Welt“ und „die gesittete Dame“ – man beachte den Unterschied - auszusehen hatten. Die Anweisungen waren zwar nicht bindend, aber prägend, wie vieles im 19ten Jahrhundert.
Nur zur Information: Zu dieser Zeit wurde die Photographie in ihrer ersten Form erfunden, erste motorgetriebene Fahrzeuge verpesteten die Luft, der Krieg gegen Frankreich war gerade eben erst gewonnen worden und die ersten Automobile entstanden auf den Reißbrettern. Über eine allgemeine Sozialversicherung wurde von Bismarck nachgedacht. Die industrielle Revolution begann und 1888, im Drei- Kaiser- Jahr wurden die verschiedenen Länder-Eisenbahnen zur Deutschen Reichsbahn zusammengelegt. Wir beginnen gerade die sogenannten „Gründerjahre“. Das Reich nimmt Aufschwung. Gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Die Friseure erfinden keine neuen Frisuren, es herrscht gerade deutschnationaler Gleich-Schnitt. Offiziere und Gemeine verstecken ihre Haartracht unter Helmen, Normalmenschen tragen Hut, Mütze oder Tuch. Haartechnisch gesehen eine Hausse.
1914/18 verkommt der Haarkünstler zum Frontsoldaten. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen und die Haartracht ist wieder einmal kurz. Passend zum Einheits-Stahlhelm, denn die Helme mit Pickel oder Federbusch erweisen sich in diesem modernen Vernichtungskrieg als hinderlich. Zwei Zentimeter Haarlänge fordern auch den besten Friseur nicht mehr zu kreativem Handeln heraus. Das kriegführende Volk an der Front hat nun anderes zu tun und die hungernde Bevölkerung zu Hause auch. Haareschneiden im künstlerischen Sinne ist nur noch für einen winzig kleinen Teil von Kriegsgewinnlern und dem Adel von Bedeutung.
Als der schreckliche Krieg endlich vorbei ist bleibt’s bei kurzem Haar. In den Zwanzigern – die später die Goldenen genannt werden – kommt der Bubikopf. Der Kurzschnitt auch für die Damen. Die Emanzipation der Frauen gewinnt Gestalt.
In den Rüstungsfabriken, in der Landwirtschaft, in den Büros hatten Frauen die Aufgaben der Männer an der Front übernehmen müssen. Nun, nach Kriegsende, wehrten sie sich dagegen, dass sie diese Aufgaben auf einmal beenden sollten. Aufs Neue eine kleine, gesellschaftliche Revolution. Ein Nebenprodukt des Krieges. Warum sollten sie nun, verloren die Auseinandersetzung der Männer, ihren Beruf, ihre Aufgaben in Kontoren und Fabriken wieder aufgeben und zum Herd zurückkehren?
Ein Teil dieser Frauen, zugegeben ein kleinerer Teil, protestierte durch Aussehen. Die Haare wurden abgeschnitten, die Röcke wurden kürzer, modebewusst wurden wieder die Damen. Sie wollten auffallen und einige unter ihnen sahen diese Auffälligkeit auch als Protest an, dass sie erneut zurücktreten sollten in die Unselbständigkeit. Zurück zu Heim, Herd, Bett und finanzieller Abhängigkeit.
Friseurinnen hatten, wie Schaffnerinnen in Bahnen und Arbeiterinnen in Fabriken, während des Krieges die Aufgaben der Männer übernommen. Vorher waren sie in diesem Handwerk, in den Theatern und Salons, noch die Ausnahmen gewesen. Jetzt hatten sie einen starken Anteil am Berufsleben. Den sollten und wollten sie nie mehr aufgeben.
Inzwischen war der Farbfilm erfunden worden. Jetzt waren im Kino nicht nur die Formen der Frisuren erkennbar, sondern auch die Farbgebung. Zwar wurden in erster Linie Schinken a’ la „Der Kongress tanzt“ gedreht, aber diese Ausstattungsorgien waren genau das, was das Publikum nach der schweren Zeit sehen wollte. Die großen Vorbilder fanden jetzt auf der Leinwand statt. Im Prinzip hat sich bis heute also nicht viel geändert.
Den nächsten diktatorischen Machthabern sollte dies recht sein. Da die Nazis ohnehin ein eigenes Konzept für „Kultur und Propaganda“ hatten, bereitete es ihnen kein Problem ihre Vertreter auf die Leinwand zu bringen. Da war der Führer, sie bezeichneten ihn auch gerne als GröFaZ, als den „größten Feldherren aller Zeiten“, und der hatte - wieder mal ein Vorbild – einen langweiligen, schmalen Oberlippenbart und den üblichen Fasson-Schnitt. Wieder mal passend für den Einheits-Stahlhelm. Es fanden sich viele, aus Opportunismus und bei manchen vielleicht sogar aus Überzeugung, die ihm nachäfften. Das Hitler-Aussehen wurde zum Vorbild, später zum Sinnbild. Einfach nur, weil er Macht hatte. Nicht, weil die Haartracht allen gefiel.
Das ist übrigens überhaupt nicht die Fragestellung beim Nachmachen, beim Kopieren eines Vorbildes. Die Ausgangsposition des Kopierens ist eine ganz andere: Da ist jemand, der Macht, Ansehen, Reputation hat, und jedermann glaubt – flach gesehen – diese Reputation läge allein am Äußeren. Kopiere nun ein jeder das Aussehen, dann – so die fälschliche Meinung – überträgt sich die Reputation, die Macht, der Einfluss auch auf die Kopisten. Das ist natürlich Blödsinn, aber so funktioniert auch das, was wir heute FAN-Kultur nennen. Und was heute – aufgeklärt wie wir nun mal sind – funktioniert, hat schon immer geklappt und wird auch immer weiter klappen. Dabei ist der Kopist nicht einmal von eingeschränkter Intelligenz, das wäre zu einfach. Der Kopist ist einfach nur unkreativ und meint, was einmal funktioniert hat, wird immer wieder funktionieren. Ob das Haare, Gesang, Verhalten, Auftritte, Aussehen oder was auch immer betrifft, ist völlig gleichgültig. Das Vorbild hatte Erfolg, also muss das Abbild auch Erfolg haben, so die einfache Meinung. Leider falsch. Unikate funktionieren nur einmal. Dann sind sie zerschlissen. Aber, das muss man erst einmal begreifen.
Beim GröFaZ war es auch nicht anders und seine Protagonisten waren die Ersten, die sich – draußen fielen noch die letzten Bomben – den schmalen Oberlippenbart schnell abrasieren ließen, um sich der aktuellen Veränderung anzupassen. Natürlich hatten sie hinterher von nichts gewusst, aber das kennen wir ja. Ein paar, wenn man so will, „Dumme“, kamen wieder mal zu spät und begriffen erst was passiert war, als alles schon vorbei war. Sie wurden dann aber als „Mitläufer“ eingestuft, und dies erwies sich langfristig als überhaupt nicht hinderlich.
Ganz nebenbei: Es gab natürlich auch eine Vereinigung der „NSDAP“-treuen Friseure. Das aber zeugt nur von ihrem damals „modernen“ Zeitgeist, denn es gab ähnliche Vereinigungen unter deutschen Professoren, Ärzten, Pfarrern, Kraftfahrern, Architekten, Handwerkern, Bauern und vielen anderen auch. Sie waren also in „guter Gesellschaft“. Genutzt hatte das nur wenigen Friseuren. Die, die unbeschadet das Chaos überlebt hatten, waren in der Minderzahl. Der „Friseur“ galt nämlich nicht als „kriegswichtig“, wurde also ganz normal zum „Barras“ eingezogen, geschliffen, gefügig gemacht und – kriegswichtig versteht sich – verheizt. Tausende von toten „Helden“. Zu Hause waren die Frauen. Sie mussten weitermachen. Ihre Arbeit wurde als kriegswichtig angesehen. Der weibliche Soldat war zwar noch nicht erfunden. Aber, so die damalige Terminologie, die Front und die Heimatfront mussten gehalten werde. Koste es, was es wolle. Menschenverachtung pur. Aufrechterhalten vom sinnlosen Geschwätz der „Goldfasane“, von Verbrechern in Uniform, meist schlichten, kleinbürgerlichen, eigennützigen Gaunern.
Damit war’s dann aber 1945 aus. So schien es.
Die Alliierten hatten den Krieg gewonnen, das Tausendjährige Reich war schnell am Ende und die Demokratie wurde ausgerufen. Dem Volk, und damit auch den Friseuren, konnte das erst mal egal sein, denn sie hatten andere Probleme. Die Häuser, ihre Salons, waren zerstört. Die Frauen waren mehr damit beschäftigt Trümmer zu sortieren, als sich mit Haar- und Kosmetikproblemen herumzuschlagen. Es fehlte der Strom, der Wasserhahn sagte keinen Ton mehr und das tägliche Leben entwickelte sich zur Hamsterfahrt. Deutschland zur „Stunde Null“.
Aber: Handwerker wissen sich zu helfen. Schere und Kamm, kaltes Wasser, ein Feuer und von der Großmutter eine Brennschere. Weiter: Ein Bretterverschlag im Keller, Kerzen oder Laterne. Fertig ist der Nachkriegssalon. Haare trocknen nur nachts. Dann, wenn das Elektrizitätswerk Strom liefert. Elektriker reparieren die Trockenhauben aus der Vorkriegszeit. Die Zeit der Improvisation und der „Kompensation“ ist angebrochen. Das ist die freundliche Übersetzung damals für: „Zaubern, klauen, schieben, tauschen.“ Wer das nicht will oder kann, verhungert. Ganz einfach. Tausende verhungern und erfrieren in den Jahren 45/ 46.
Dann, ganz plötzlich für „Otto Normalverbraucher“: Die „Deutsche Mark (West)“ ist da. Auf einmal sind die Regale wieder voll. Über Nacht. Einfach so. Niemand hatte damit gerechnet. 40,- Mark gibt’s für jeden, mehr nicht. Für Nahrung und Kleidung wird das Geld zuerst ausgegeben, nicht für Haare und Kosmetik. Das kommt erst später. Das Friseurhandwerk wird zu Beginn der „Bonner Bundesrepublik“ noch vom Tauschhandel beherrscht. Kohlen, Briketts, Brot, Fett, Zigaretten und vieles mehr, alles, was sich zum Überleben und Tauschen eignet, nehmen die ersten Salons an. Eines wird schnell klar: Friseur zu sein, Haare zu schneiden, Wellen zu legen, Menschen zu verschönern, sie in ihrem Wohlbefinden zu begleiten, ihnen Selbstsicherheit zu geben, dies alles ist auch eine Frage des Wohlstandes eines breiten Teils der Bevölkerung. Anfang der 50ger-Jahre ist es endlich erreicht. Vollbeschäftigung in der Wirtschaft. Ende der Demontage. Der Marschall-Plan greift. Adenauer macht eine stabile Wirtschaftspolitik. Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister, ruft die soziale Marktwirtschaft aus.
Die Einrichtung im Friseursalon beginnt sich zu ändern. Zwischen Häuserruinen werden Flachbauten errichtet. Die Industrie liefert wieder Trockenhauben, Haarschneidegeräte und Chemie. Frauen verwandeln sich bei besonderen Gelegenheiten zu Damen. Die Hochfrisur hält Einzug. Es wird toupiert was das Haar aushält. Aus den Vereinigten Staaten schwappt der Boogie-Woogie herüber. Mädchen tragen Petticoats, die Jungs „Blue-Jeans“. In der Wochenschau werden diese amerikanischen Tänze mit Argwohn kommentiert. Der deutsche Mann, die deutsche Frau fühlt sich wieder als Privatfrau und Privatmann. Man beginnt wieder „wer“ zu sein. Es ist die Zeit des wiedererwachenden Selbstbewusstseins. Und die der „Fresswelle“. Die Frisur soll es wieder wettmachen. Spezialisten sind gefordert. In der Wochenschau des Kinos werden die neusten Frisuren vorgestellt, und Nachrichtenbilder aus aller Welt zeigen die neuen Vorbilder aus der Neuen Welt. Denen wird wieder einmal nachgeeifert. Es werden nicht die letzten Vorbilder gewesen sein.
Wer die Zeit damals bewusst erlebt hat wird sich erinnern: In den Tanzschulen wurde Foxtrott und Walzer gelehrt, Jazz wurde in Kellerkneipen gespielt und der Begriff „Bar“ hatte noch etwas Anrüchiges an sich. Hineingegangen sind damals alle. Auch, wenn sie es später bestritten haben. Es war die neue Freude am Leben. Die einen sagen: Wir haben es überlebt, die anderen: wir wollen leben. Jetzt und hier. Wer weiß, was kommt. Es kam der Krieg in Korea. Der aber war weit weg und niemand bei uns hat sich ernsthaft darum gekümmert. Das war die Sache der Amerikaner und anderer.
Beim Friseur wandelte sich das Mobiliar: Bei den Damen, streng getrennt vom Bereich der Herren versteht sich, kamen höhenverstellbare Stühle in Mode. Bei den Herren war noch lange Jahre eine besondere Form des lederbezogenen Klappstuhls in Gebrauch. Verließ ein Herr den Frisierplatz, klappte der Friseur die Sitzfläche einfach herum. Niemand sollte auf dem warmen Sitzleder des Vorgängers Platz nehmen. Ob aus Gründen der Pietät oder aus Gründen der Hygiene blieb dem Kunden verschlossen. Es war einfach so. Ansonsten war alles ganz normal. Platz nehmen, Haare schneiden, abbürsten, Ende der Behandlung. Auf Wiedersehen und bezahlen.
In dieser Zeit machten sich die Herrensalons bei ihren Kunden noch durch eine Dienstleistung besonderer Art beliebt. Sie verkauften Kondome. Damals ein Teil, über das nur in abgeschlossenen Herrenrunden gezotet werden durfte. Eigentlich gab es Kondome nicht, jedenfalls nicht öffentlich. Erst viel später wurden Automaten aufgestellt, an denen sich auch Verklemmte und Schüchterne bedienen konnten. Nicht so in den 50gern. Da galt es noch, ein verhalten offenes Wort an den Meister zu richten und der langte dann, mit schnellem Blick nach rechts und links, unter den Tresen, wo die Pariser unter Verschluss gehalten wurden. Hatte der Kunde das erforderliche Alter allerdings noch nicht erreicht, dann betätigte sich der Friseurmeister als Sittenwächter und wies den Aspiranten ab. So einfach war das. Heute würde sich niemand mehr wundern; jeder bessere Supermarkt verkauft eine ganze Palette und im Fernsehen läuft die Werbung für die Überzieher.
An dieser Stelle sei auch mir mal ein Wort in eigener Sache gestattet:
Als Kind musste ich für einmal Haareschneiden genau 50 Pfennige bezahlen. Eine halbe Deutsche Mark also. Ein Facharbeiter der Stahlindustrie verdiente damals rund 150 Mark im Monat, ohne Überstunden. Die aber waren normal und von der Gewerkschaft abgesegnet. Der Lohn für eine Frisur eines Herren kostete damals rund 1,50 Mark, die einer Dame 4 Mark. Woraus man ersehen kann, dass die Damen den Friseuren schon immer wertvoller waren als die Herren. Das aber wollen wir hier jetzt nicht näher ergründen.
Für mich als Kind waren Friseurbesuche immer schrecklich. Immer fielen mir Haare ins Hemd, immer musste ich mich kratzen und immer war die Aufforderung hinzugehen mit weitreichenden Verzögerungsversuchen verbunden. Bis dann der väterliche Donner ein endgültiges „Aus“ bedeutete. Damals wurde sich noch nicht angemeldet, damals war noch nicht „Wellness“ angesagt, man hatte lediglich ordentlich auszusehen. Sich meiner Haare zu entledigen war im Prinzip für mich eine schreckliche Sache, denn ich hielt es für vergeudete Zeit. Aber so ist das halt, wenn man klein ist und den Tribut an die Schönheit noch nicht zu würdigen weiß.
Mitte der 60ger- Jahre kamen die Friseure zwischendurch mal in Verruf. Nur für eine kleine Gruppe, der ich nun auch angehörte. Nicht etwa, dass ich dem Haareschneiden grundsätzlich abgetan gewesen wäre, sondern vielmehr aus gesellschaftlicher Überzeugung. Dies ließ sich nur durch langfristige Suche nach einem verständnisvollen Fachmann ändern. Die Haare sollten länger sein, die Beatles ließen grüßen. Trotzdem sollte die Länge den Vorstellungen der Eltern – gerade eben so - entsprechen. Die hatten schließlich ihre eigenen Vorstellungen von „gepflegt“. Lang, aber ordentlich war angesagt. Ein gesellschaftlich, haartechnischer Kompromiss eben. Gut war nur, dass der Aspirant – ich eben – meist aushäusig war, weit weg, und von den Eltern nur selten gesehen wurde. Dann war der Besuch beim Haarkünstler eben kurzfristig als „Reparaturbetrieb“ nötig. Später, also nach dem elterlichen Treffen, durfte bis auf Weiteres das Haar machen was es wollte. Auf dem Kopf und im Gesicht eben, Haupthaar und Bart genauer gesagt. So wie mir ist es einer ganzen Generation aushäusig wohnender elterngebundener Söhne ergangen. Über die Probleme von „Töchtern“ habe ich damals zugegebenermaßen nicht nachgedacht. Deshalb können diese auch hier nicht dargestellt werden.
Wenig später begann ich meine Arbeit als Reporter beim deutschen Fernsehen. Das aber ist eine ganz andere Geschichte.