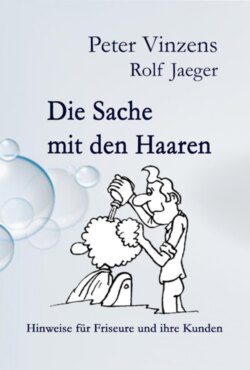Читать книгу Die Sache mit den Haaren - Peter Vinzens - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bühnen für Haare
ОглавлениеEs ist das Jahr 1989. Ein großes Hotel in Ost- Berlin. Draußen stehen die Stasi-Leute, im Saal rund zweitausend Zuschauer. Die Wende. Gorbatschow unterstützt die DDR-Regierung nicht mehr. Ihr vierzigster Jahrestag ist gerade vorbei. Das Land ist am Ende.
Am Tag zuvor hatten wir in Berlin/Ost noch einen Vertreter der evangelischen Kirche zur aktuellen Situation in der DDR befragt. Er äußerte sich skeptisch. Ich war mir sicher, dass die Staatssicherheit das Interview mithörte. Sie war überall.
Über die Straßen Dresdens und Leipzig bewegen sich Menschenmassen und rufen „Wir sind das Volk“. Die bundesrepublikanische Botschaft in Prag ist voller Menschen, die ihre Ausreise in den Westen erzwingen wollen. Genscher verhandelt. Kohl reist nach Polen. Mit der Wiedervereinigung rechnet niemand.
Dann werden die Grenzen geöffnet, ganz plötzlich. Verkündet am 9. November 1989 vom Mitglied des Zentralkomitees der SED Günter Schabowski. Auf einmal ist die Mauer durchlässig. Unkontrolliert strömen die Menschen nach West-Berlin und nachts wieder zurück. Die ersten Mauerspechte nehmen den sogenannten „Antifaschistischen Schutzwall“ auseinander.
Für eine Sendung über die Grenzöffnung in Nordhessen sollte ich ganz schnell über Kassel nach Eschwege kommen. Kaum war ich im Studio in Kassel angekommen, da wusste der Produktionsleiter dort, dass ein Durchkommen mit dem Auto nach Eschwege unmöglich war. Er hatte bereits einen Hubschrauber bestellt. So flog ich also über nordhessische Landstraßen und sah Trabis. Unendlich viele qualmende Trabis, die über viele Kilometer alle Landstraßen verstopften. Dort unten passierte erst einmal nichts mehr.
In Eschwege dann viele Leute aus der DDR, die bei uns so lange in Anführungszeichen stand. Im Prinzip sahen die Leute genauso aus wie wir, vielleicht nicht ganz so viel Jeans, vielleicht nicht ganz so modern in der Ausstattung, anders aber waren sie in ihrem Verhalten. Verblüffter, zurückhaltender, aber oftmals auch zufriedener. Die Damen hatten häufig toupierte Hochfrisuren, zurechtgemacht wie für einen Theaterbesuch. Die Herren unterschieden sich auf dem Kopf wenig bis gar nicht von ihren westlichen Geschlechtsgenossen. Der Mann an sich war haartechnisch anscheinend weniger modebewusst. Aber schnell gab es eine große Gruppe in der westdeutschen Industrie, die das ändern wollte.
In das prachtvolle Hotel in Berlin Ost hat eine große westdeutsche Firma geladen. Sie stellt Haarkosmetika und Friseurbedarf her. Die will nun auf den ostdeutschen Markt drängen. Ein Milliarden-Geschäft. Wie aber soll man dem Friseur aus der „Noch“-DDR die Produkte schmackhaft machen?
Wie immer, wenn Westler im Osten auf Ostler stoßen in jener Zeit: Misstrauen der Staatsregierung der Noch-DDR. Sie weiß, sie ist am Ende, will sich aber weiterhin halten. Wie auch immer. So demonstriert die Staatsmacht – ebenfalls wie immer – Präsenz. Wie hoch der Anteil an Staatssicherheitsleuten unter den Besuchern in dem prachtvollen Hotel ist lässt sich nicht sagen, viele der Beobachter aber schauen bedrohlich ernst drein, interessieren sich nicht für die Präsentationen, wirken ablehnend.
Aus dem Westen waren sie im Bus angereist. An der inner-Berliner Grenze fast das übliche Spiel. Hineinfahren in den Drahtkäfig der Grenzstation, warten auf die Papiere, misstrauische Blicke. Besucher aus dem kapitalistischen Westen sind unerwünscht in jenen Tagen. Aber: Visum oder Besuchsgenehmigung ist nicht mehr nötig. Die DDR muss sich öffnen. Pläne diese kapitalistische Übernahme abzuwenden, liegen in der Schublade. Bewaffnete Kräfte stehen in den Bereitstellungsräumen. Deutschland in der Vorstufe zum Bürgerkrieg.
Peter Ochs hat den Auftrag, die Firma zu repräsentieren. Ein erster Versuch. Ochs besitzt eine Kette von Friseurläden, europaweit. Er gehört dem exklusivsten Coiffeur-Verband an, den der Westen zu bieten hat, und er besitzt eine seltene Fähigkeit. Er kann gleichzeitig arbeiten und reden. Er ist der Chef der Show.
Zusammen sind sie rund 30 Leute. Friseure, Models, Techniker. Dazu die Firmenvertreter. Die wollen hinein in den Markt, ran an die Spezialisten für Haare im postsozialistischen Ausland. Viele Friseure, sollte sich die politische Situation weiter entspannen, könnten sich selbständig machen, könnten Kunden werden. Der Markt wird sich dann unter den drei großen Zulieferern aufteilen. Wie im westlichen Europa auch. Es ist die Zeit der schnellen Entscheidungen und die der jungen, alerten Herren mit den Lederkoffern, die gekommen waren um die Leute im Osten zu bescheißen.
Um 19 Uhr ist der Saal bereits brechend voll. Noch bauen die Techniker Friseurgerät und Fernsehequipment auf. Die Lichtleitungen reichen nicht aus. Aggregate werden aus West- Berlin herangeschafft. Wer jetzt die bessere Show liefert, wer zu diesem Zeitpunkt sich Zugang zu den Haarkünstlern verschafft, wer jetzt die „Noch“-Machthaber zu Verträgen bewegen kann, der hat es geschafft. Derweil blickt die Stasi misstrauisch auf das eigene Volk.
Ochs ist ein Künstler nicht nur in Sachen „Haaren“. Er beherrscht den Tanz auf der Bühne. Das Spiel mit dem Publikum. Schere und Chemie, er hat den Blick für das Außergewöhnliche. Normalität interessiert ihn nicht.
In seinem Team Rolf Jaeger. Damals noch ein junger Kerl. Geboren 1954. Aufgewachsen in kinderreicher Familie. Zusammen waren sie acht. Noch heute, als Friseurmeister, erinnert er sich wie das damals war. Im kleinen Haus in der Frankfurter Vorstadt Bonames. Elvis Presley hatte damals die Bühnen der Welt erobert und hielt als „The King“ Publikumsrekorde. Ein Vorbild der Jugend. Ein Trendsetter. Und das Schreckgespenst der Erwachsenen. Rock‘n Roll war zur Weltanschauung geworden. „Halbstarke“ erschreckten das Establishment. Ihre Art sich zu geben, sich zu bewegen, sich zu kleiden und ihre Frisuren zu gestalten widersprach der biederen Art der Nachkriegseltern. Presley war ihre zentrale Figur, musikalisch, weltanschaulich, sozial. Scheinbar unabhängig.
In Berlin nahmen Rock‘n Roll-Fans die Waldbühne auseinander und Regierungsvertreter dachten darüber nach, wie schädlich diese Musik wohl für die Jugend sei. Fernsehen und Wochenschau berichteten. Der Kommerz aber hatte die Zielgruppe längst erkannt. Musik und Mode gehörten wieder einmal zusammen. Und zur Mode natürlich auch die Haartracht.
Rolfs ältere Brüder Eckart und Hans entdeckten Elvis als Vorbild. Und die Friseurindustrie lieferte das Stylingmittel dazu: Das Zauberwort hieß damals „Brisk“. Eine Frisiercreme die Haarwellen á la Elvis in Form hielten. Der „King“ hatte sie, James Dean hatte sie, eigentlich hatten sie sie alle. Diese Haarwelle.
Das Vertrackte war nur, dass diese schwungvolle Welle nicht von alleine hielt. „Brisk“, eine Art Pomade und gerade neu auf dem Markt, konnte da weiterhelfen. Wann immer eine Party angesagt war, Rolfs Brüder setzten den Erfolg bei den jungen Damen auf eben jenes Zaubermittel. Leider war es nur beim Friseur zu bekommen, es war teuer und außerdem natürlich auch schnell weg, denn es wurde eine ganze Menge gebraucht um die Welle haltbar zu machen. Manchmal kamen dann die Tuben durcheinander und die Brüder stritten darum, wer nun wessen „Brisk“ aufgebraucht hatte. Und draußen warteten die Mädchen. Im Badezimmer spielten sich Dramen ab, so wird gesagt.
Solche lautstarken Auseinandersetzungen prägten natürlich den kleinen Rolf. Trotzdem herrschte erst einmal Ratlosigkeit, als 1968 die Berufswahl anstand. In der Stadt, nur wenige Kilometer entfernt, prügelten sich Studenten, Hausbesetzer und Freidenker mit der Staatsmacht. Die Auseinandersetzung war heftig, schließlich ging es allen Beteiligten um die Veränderung der Gesellschaft, oder auch nicht. Einer, der später deutscher Außenminister werden sollte, wurde dabei fotografiert und hatte – eben später – einige Probleme Erklärungen für seine Renitenz abzugeben. Andere, die auf der Seite der Staatsmacht Knüppel schwingen ließen, brauchten dagegen niemals Erklärungen abgeben. Es kam also schon damals darauf an, auf welcher Seite des Knüppels man stand.
Rolf wurde Friseur. Nicht aus Überzeugung, eigentlich mehr durch Zufall. Sein Trainer im Sportverein von Bonames für Leichtathletik war Friseurmeister, brauchte einen Lehrling und gewann Rolf.
Ganz verwegene unter den Jung-Meistern bedienten ihre Kunden und Kundinnen schon damals gemeinsam. Die strikte Trennung der Geschlechter wurde von ihnen aufgehoben. Einige mussten diese Neuerung allerdings schnell wieder zurücknehmen. Damen und Herren gemeinsam in einem Raum, unter der Haube, über dem Waschbecken, mit Lockenwicklern im Haar, das war nicht im Sinne des rollengerechten Verhaltens. Trotzdem veränderte sich langsam die Architektur der Salons. Inseln bildeten sich heraus, es verschwanden die geschlossenen Kabinen, auf einmal wurden selbst wasserführende Becken fahrbar.
Rolfs Lehrbetrieb war für damalige Verhältnisse konservativ-fortschrittlich. Es fand eben das statt, was die Kundschaft noch so mitmachte. In Rolfs Erinnerung waren die Damen recht zickig und beschwerten sich wegen jeder Kleinigkeit bei seinem Chef. Das aber kann auch an seiner Erinnerung liegen.
Die Ausbildung war streng, aber nicht unmittelbar gut. Fielen Klammern auf die Erde, gab’s Krach. Wurden Haare nicht sogleich zusammengekehrt, gab’s Krach. Dauerte etwas zu lang, gab’s Krach. Spezielle Kurse, Fortbildung, Betrachtungen der aktuellen Mode dagegen waren ein Fremdwort. Es wurde gemacht, was der Friseur konnte, was er mochte und was immer schon so gemacht worden war. Noch hatte die Behandlung im Frisiersalon wenig Demokratisches an sich. Dem Kundenwunsch wurde bisweilen nur widerwillig nachgekommen.
In der Innenstadt Frankfurts war das Angebot anders. Wer das Geld und die Zeit hatte, wer eigene Vorstellungen verwirklicht sehen wollte, der fuhr die paar Kilometer mit der Straßenbahn hinein ins Getümmel. Beratung und Dienst am Kunden bekamen eine neue Qualität. Ein Meister, der die Idole und Vorbilder seiner Zeit nicht kannte, der nicht wusste was die Modemacher in Paris, Mailand und London vorhatten, der fiel sehr schnell wirtschaftlich hinten herunter. Sie begannen, sich auseinander zu entwickeln: die Haarabschneider und die Haargestalter. Hatten seit dem Krieg Haare häufig lediglich eine schlichte technische Funktion, bekamen sie nun in einer breiten Schicht der Bevölkerung die Aufgabe der eigenen Außendarstellung.
Elvis, Beatles, Stones, Bogart, die Monroe, selbst die Brüder Kennedy, sie wurden zu Idolen von Generationen, über Ländergrenzen hinweg. Ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre Haartracht, ja sogar Bewegungen wurden kopiert und übernommen. Selbst die Stimme des deutschen Synchronsprechers Humphrey Bogarts wurde kopiert, um ebenso lässig wie Bogart zu erscheinen, obwohl diese Leihstimme nun wirklich nichts mit dem Original gemein hatte.
Es kam zur gegenseitigen Beeinflussung, ja zu einer Abhängigkeit zwischen Idol und Modeindustrie. Waren die Vorbilder im Modeangebot nicht wiederzufinden, dann lehnte die Jugend das Angebot ab. Gegebenenfalls griffen die jungen Damen und Herren lieber selbst zu Schere und Faden, um zum Beispiel in normale Hosen einen weiten Schlag einzubauen. Abba und andere hatten es schließlich vorgemacht. Natürlich lernte die Industrie – und mit ihnen Modemacher, Friseure, Kosmetiker – schnell diesem Trend zu folgen. Schließlich ging es um viel Geld.
Umgekehrt bestand auch die Abhängigkeit der „Stars“ vom Angebot der Modemacher: Kamen bei ihnen die aktuellen Trends in Ausstattung und Haartracht nicht vor, dann konnte es leicht zu Verwerfungen kommen. Die Fans waren verunsichert und orientierten sich anderweitig. Hilfe bot in diesem Zusammenhang die gedruckte Presse:
Lehrlinge und Mittelschüler kauften „Bravo“. Gymnasiasten und Studenten die Zeitschrift „Twen“. Das Bürgertum griff auf „Stern“, „Bunte“ und „Neue Revue“ zurück. Damen im mittleren Alter bevorzugten das „Burda“-Modeheft oder „Für Sie“. Ältere Damen bezogen ihre Informationen über die Königshäuser der Welt, und damit ihrer Idole und Vorbilder, aus dem „Grünen Blatt“. All diese Publikationen lagen natürlich auch in den Friseursalons Westdeutschlands und Berlins aus und prägten das Erscheinungsbild der jeweiligen Leserschaft. Und traf man auf einen besonders progressiven Haarkünstler, dann lag zu allerunterst im Stapel – wenn auch nur in der Warteecke der Herren - Hefners „Playboy“. Die Presselandschaft begann ihre Zielgruppen zu erkennen und sich spartenspezifisch zu orientieren. Das gemeinsame Interesse war erkannt.
Unter den Politikern befanden sich in den Sechzigern keine vorbildtauglichen Personen für Jugendliche. In den Parlamenten saßen – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – ältere Herren. Viele von ihnen waren nicht nur an Jahren alt, sondern auch im Kopf. Veränderungen waren ihnen zuwider. Vor Neuem hatten sie Angst. Und wenn sie denn jünger waren, dann hatten sie häufig auch Probleme mit ihren Parteioberen. Helmut Schmidt gehörte dazu, der junge Helmut Kohl, Walter Scheel. Als Vorbilder in Sachen Mode und Haartracht aber kamen sie ebenfalls nicht in Betracht. Sie waren ordentlich angezogen, ihre Haare ordentlich geschnitten. Ordentlich eben. Das war’s dann aber auch. Sie kamen alle aus der Tradition der Stahlhelmträger.
Die Notstandsgesetze werden im Bundesparlament in Bonn durchgezogen. Gegen den Widerstand weiter Kreise, besonders bei Jüngeren. In Frankreich drehen Truffaut und Godard sozialkritische Filme und das Deutsche Fernsehen sendet die Dokumentation „Herbst der Gammler“. Eine Geschichte über ungepflegte Nichtstuer in München. Ein Skandal. Im Film selbst macht sich Volkes Zorn Luft und wettert gegen die Gammler. Auf den Kameras der Filmteams steht „Radio Bremen“, was den gedrehten Personen zuerst entgeht. Erst bei der Sendung wird der Spieß herumgedreht, die angesammelte Menge der Vorurteile und Urteile macht Angst. Zwangsrasieren, Zwangshaareschneiden, Zwangswaschen und dann ab ins Lager. Zwang als Überzeugungsmittel. Aber das hatten wir doch schon mal. Erziehung wie unter Hitler. Da sei so etwas nicht vorgekommen, sagen Damen und Herren. Man trägt den Scheitel links. Immer noch. Das deutsche Demokratieverständnis steckt noch in den Kinderschuhen, auch und besonders gegenüber den eigenen Kindern. Die Kritik zerreißt den Film, wenige loben ihn und Radio Bremen hat seinen Ruf als kommunistischen Sender weg. Das Phänomen der „Gammler“ bleibt.
Erst später werden die Verweigerer, die die Zwänge und Pressionen der damaligen deutschen Gesellschaft auch äußerlich ablehnen, rehabilitiert. Oder besser: die „Gammler“ rehabilitieren sich selbst. Sie gehen in Politik und Hochschule und untersuchen das Phänomen „Westdeutschland“, das seine Kinder nicht verstand und in die totale Verweigerung trieb. Wer lange Haare trug, war in den Sechzigern asozial, durfte von jedem Klippschüler als dumm verunglimpft werden, auch wenn der Langhaarige einen Intelligenzquotienten von 150 und mehr hatte. Dabei, wie war das bei Kelten und Germanen, hatten doch früher die freien, die eigenständigen Bürger langes Haar und die Knechte kurzes. Wie schnell sich Verhaltensmuster durch Intoleranz doch ändern können.
Die sogenannten „Gammler“ waren also für die Friseure damals eine unbefriedigende Zielgruppe. Aber: An den Haaren sollt ihr sie erkennen! Die Grenzen waren deutlich gezogen. Auf der einen Seite „Fasson“, auf der anderen, Wellen und Locken. Und alles, was über 3 Zentimetern lag, war, theoretisch zumindest, revolutionär. Die RAF wurde immer militanter, der Staatsapparat immer misstrauischer gegenüber allem was längerer Haare hatte und jung war. Nur noch alte Philosophen konnten es sich leisten mit voller Haarpracht herumzulaufen. Im Bundestag: Herren mit ausrasiertem Nacken, kurzen Kotletten und glattgekämmten Haaren. Ein paar exotische Vögel gab es allerdings. Erich Mende, FDP, zum Beispiel. Mit wallendem, für damalige Verhältnisse beängstigend langem Haupthaar, hielt er flammende Reden gegen den Verfall des Abendlandes und hängte sich bei besonderen Anlässen auch mal Hitlers „Eisernes Kreuz“ um den Hals. Wie im Kino. Die Gefahr der Linksradikalität bestand indes bei ihm nicht. Und ein Wallewallebart, wie ihn der ehemalige Bundestagspräsident Thierse später haben sollte, war völlig undenkbar. Der Abgeordnete an sich hatte sauber, aber unauffällig auszusehen, normgerecht, von gelegentlichen schmalen Oberlippenbärtchen einmal abgesehen.
Auf der anderen Seite war da die meist jugendliche Bevölkerung. Diese unterschied sich von den offiziellen Funktionsträgern erheblich. Das hatte seinen guten Grund, denn sie wollten sich von diesen äußerlich und innerlich absetzen, benutzten deshalb das äußere Erscheinungsbild als Signal. „Ich bin anders, denke anders, vertrete andere Ziele!“ Die Gesellschaft war sichtbar geteilt und diskutierte offen und aggressiv darüber.
Rolf Jaeger war in der Lehre. Er verdiente im ersten Lehrjahr 30,- Mark im Monat und bekam schon mit, dass drinnen in der Stadt zum dreifachen Preis andere Frisuren angeboten wurden als bei ihm am Stadtrand. Peter Ochs, Viddal Sasum, Pragutti, Mussel und Bartolome wurden international bekannt und international auch anerkannt. Sie versuchten Modeerscheinungen in der Oberbekleidung aufzugreifen und die dazugehörige Frisur anzubieten. Stars wurden beobachtet, ihr Einfluss auf die Konsumenten, Vorbilder wurden hochstilisiert. Ihr Ziel war es, Trends zu setzen, handwerkliches Können mit Pfiffigkeit und Einfallsreichtum zu verbinden. Das war nicht immer einfach, aber was sich als schlicht erwies, war ohnehin langweilig. Ihre Entwürfe und Provokationen wurden dankbar von Presse und Fernsehen aufgegriffen und erbittert diskutiert. Ihre Veranstaltungen beim Showfrisieren gerieten zu Medienereignissen, in einem Maße, als hätten sie schon die Vermarktungstechniken drauf, die erst später perfektioniert werden sollten. Friseure gingen auf die Bühne und wurden gefeiert wie heute Pop-Stars. „Medienereignisse“ sind halt dann nur Medienereignisse, wenn die Medien dabei sind. Die Show der Kreativen brachte den handwerklichen Vorgang des Haareschneidens hinaus auf die Bühne. Schnell musste sie sein, die Show, improvisiert, sie sollte repräsentieren, Appetit machen auf „Aussehen“. Der Herstellungsprozess eines Haarkleides wurde herausgeholt aus dem verborgenen Kämmerchen im Salon und als eine besondere Art der Theatervorstellung präsentiert. Weg von der verklemmten Heimlichtuerei, weg vom verschämten Kampf um die Strähne hinter den Kulissen. Lockenwickeln wurde zum öffentlichen Ereignis. Und plötzlich verschwanden dann auch die Paravents und Kabinenvorhänge zwischen den Behandlungsstühlen in den Salons.
Endlich konnte auch das „Anders-Sein“ in gesellschaftspolitisch vertretbare Bahnen gelenkt werden. Langes Haar wurde auf einmal „gesellschaftsfähig“. Das junge Publikum sprang darauf an. Die Kritik am „Alten“, am „Überkommenen“ bekam ein neues Kleid. Alles war erlaubt, nur handwerklich gut gemacht musste es sein. Die jungen, selbständigen Friseure nahmen die Möglichkeiten dankbar auf. Endlich Raum für Kreativität, für Einfälle und natürlich auch für Ruhm. Sie wollten anders sein als die „Normalos“ und präsentierten daher Tragbares und Untragbares. Darin waren sie sich mit den Modedesignern einig. Zusammen präsentierten sie ihre Vorstellungen, und die Gegner der „normativen-Kraft-des-Faktischen“ nahmen diese Vorstellungen dankbar auf.
Die Kerle blieben zwar erst einmal relativ langweilig. Lang war immer noch angesagt. Aber bei mutigen Damen konnten sich die Coiffeure richtig austoben:
Als Rolf Jaeger 1977 bei Ochs in Frankfurt anfängt, hat er damit den ersten Schritt seiner Karriere gemacht. 1972 wurde er bei Wettbewerben Deutscher Friseurmeister und mischt seitdem ganz vorne mit. Zusammen mit anderen und gemeinsam mit einer großen deutschen Haarkosmetikfirma bestimmt er mit, was nun als modern gilt.
Wie konnte es kommen, dass der Friseur auf einmal aus der dienenden Rolle heraustrat und zum Bestimmer wurde. Wie konnte es kommen, dass der Dienstleister in Sachen Haare nicht mehr durch den Dienstboteneingang kam, sondern durch die große Drehtür, dem Hauptportal.
Es gab sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen waren den Medien die Stars ausgegangen. Nicht etwa, dass es weniger gegeben hätte als vorher, der Bedarf an Promis und solche die es sein wollten, war gestiegen. Mehr Druckseiten mussten gefüllt werden, die Zahl der Sendeminuten beim Fernsehen stieg. Mehr Berichte mussten her. Damals bereits erkannte der Kabarettist Hildebrand: „Es gilt die Maxime, „verfeaturest Du mich, verfeature ich Dich“. Auf gut Deutsch: Lädst Du mich in Deine Show ein, lade ich Dich in meine Show ein. Förderst Du mich, fördere ich Dich. Eine Situation, bei der alle Beteiligten gewonnen haben. So ist das bis heute und begründet, warum eigentlich immer die gleichen Leute in den vielen Talk-Shows auftreten. Am oberen Ende wird dann langsam weggestorben. Das aber ist kein Problem, denn am unteren Ende kommen immer wieder neue Selbstdarsteller nach. Niemand muss also befürchten, dass ein Mangel an mehr oder weniger begnadeten Talk-Show-Gästen eintritt.
Jetzt ist ein Mensch, der, wie der Friseur, andere Menschen verändert, im Prinzip ein interessanter Mensch. Nicht nur, dass Promis ihn wegen ihrer Frisur um die halbe Welt fliegen lassen, sondern auch, weil er maßgeblich beteiligt ist, Promis zu „machen“.
Ein Heer von Models, männlichen und weiblichen Geschlechts, wartet darauf endlich auf die Titelseiten der großen Blätter zu kommen. Denn merke: Je öfter auf dem Titelblatt, desto höher das Honorar. Wenn das keine Motivation ist. Um auf die Titelseiten zu kommen musste man auch bereits damals zwei Fähigkeiten mitbringen. Da war die Überzeugungskraft des Models bei den Redaktionen diesen Wunsch durchzudrücken. Und: Man musste gut aussehen (oder das, was die Redaktion dafür hielt).
Nun ist „gut aussehen“ natürlich eine höchst umstrittene Angelegenheit. Jeder, aber auch wirklich jeder, versteht von „gut aussehen“ etwas, ist schnell mit seinem Urteil bei der Hand und befolgt die eigenen Regeln selten selbst. In Wirklichkeit bestimmt natürlich längst nicht „Jeder“, wer auf Titelblättern stattfindet, sondern die Chefs der Zeitschriften. Die lassen sich nicht so ohne weiteres hereinreden, achten aber sehr wohl auf die Verkaufszahlen ihrer Auflagen. Aber deshalb bestimmen die Kunden – schön wäre es ja – noch lange nicht, was abgebildet wird. Aber der Fotograf und die Visagistin und der Schneider und der Designer wissen es bei der Aufnahme schon zu richten. Und natürlich der Friseur. Natürlich der Friseur, denn nichts kann erotischer sein als Haare. Und weil erotische Haare (und anderes) die Auflagen steigern, bekamen auf einmal Friseure den Ruf von Künstlern. Haarkünstlern. Außerdem hatten einige von ihnen begriffen, dass es nicht ausreicht ein guter Handwerker zu sein, sondern auch, dass zu einem erfolgreichen Künstler eben auch die Selbstvermarktung gehört. Auf einmal hatten Friseure ihre eigenen „Haargestaltung-Events“. Und das Fernsehen war da und die Zeitungen und das Radio, und Haarkünstler waren auf einmal wer. Aus dem Dienstleister, besser, aus einer Handvoll Dienstleistern, war auf einmal eine Handvoll Künstler geworden. Eine völlig neue, aber moderne Kunstrichtung war geboren.
Bereits damals galt ebenso wie heute: Ein Medienereignis ist nur dann ein Medienereignis, wenn die Medien dabei sind. Aber das hatten wir schon. So kamen Friseure, besser, eine Handvoll Friseure auf die Titelseiten der allseits informierenden Presse. Und deshalb durften sie – vorausgesetzt sie waren jetzt bekannt genug – auch fürderhin durch den Haupteingang gehen, wollten sie denn ihr Klientel heimsuchen. Kaum jemand hat damals diese Veränderung bemerkt, aber als sehr demokratisches Element der Handwerkeremanzipation wollen wir es dennoch begrüßen.
Deshalb kam Rolf Jaeger auch zu diesem Event nach Ostberlin. Es war nicht die erste Veranstaltung dieser Art, bei der er mitarbeitete.
So ein Ereignis hat seinen eigenen Reiz. Eigentlich geht es nur darum, dem interessierten Fachpublikum zu zeigen, was demnächst modern ist und wie man es macht. Das ist der Vorher-Nachher-Effekt. Wie sieht ein langweilig frisiertes, uninteressantes Modell vor der Prozedur aus, und was kommt hinterher geschminkt, gut gelaunt und exquisit gestylt von der Bühne. Das einzige, was der Veranstalter braucht, ist eine Bühne, gute Friseure (ein ganzes Team pro Model) und ein Model. Der fachkundige Zuschauer braucht ein gutes Gedächtnis, denn es nützt überhaupt nichts bei dem Vorher-Nachher-Spiel, wenn der Zuschauer das Vorher wieder vergessen hat. Deshalb pflegt man auch eine Großbildleinwand, Videorecorder und Kameras mitzubringen, damit das Vorher wieder in Erinnerung zurückzurufen ist.
Im Prinzip aber ist dies der langweiligere, weil informativere Teil. Deshalb gibt’s fürs Volk die große Show. Dann nämlich treten die Meister ins Rampenlicht, Musik schwillt an und die „Post geht ab“. Das Ganze ist so ein Zwischending von „Berliner Sechs-Tage-Rennen“ und „Deutschland sucht den Superstar“, auch wenn es nur ums Haareschneiden geht.
Gebraucht werden dazu Mädchen mit möglichst langen Haaren aller Farben, am liebsten aber blond. Blond kommt am besten. Diese Mädchen sollten zudem gut anzusehen sein, denn schließlich geht es bei Schönheit nicht nur um Haare.
Jetzt stelle Mann und Frau sich vor: Trompetengeschmetter und Trommelwirbel, der Spot ruht auf dem Meister, psychedelisches Licht auf der Bühne, zuckende Blitze lassen den Saal erzittern, der Meister greift zur Schere. Aktion. Blitzschnell fällt das Haar, lange Strähnen fliegen weg, reißen im Publikum der ersten Reihen Löcher der Begeisterung. Noch hat der Saal nicht genug und das Mädchen eine Kurzhaarfrisur. Der Meister aber thront bei aller Arbeit verbal über allem Lärm der Show, über aller Hektik. Mit kühler Stimme kommentiert er das haarige Schlachtfest und lässt zu keiner Sekunde sein Bedauern über gefallenes Haupthaar verlauten. Mit Föhn und Kamm wird das Mädchen traktiert, die Musik steigert sich zum Crescendo, zum Fortissimo, die letzte Locke fällt, der letzte Sprayer sprayt, erschöpft lässt der Meister den Kamm entgleiten. Das Werk ist vollbracht. Die Zeit: elf Minuten und achtzehn Sekunden. Eine nette Frisur, bisschen kurz vielleicht. Was aber für eine einmalige Show. Gigantisch. Grad so, wie es sich der Meister gedacht hat. Das Publikum tobt und trampelt, das Beste, was es je gesehen hat. Bis zum nächsten Mal. Verbeugung auf der Bühne, scheues Zurückweichen vor den Ovationen der Menge. Hilfloses Hinweisen auf die Helfer, dieses „ich kann es ja nicht alleine, alle sind beteiligt“. Wer aber der Star ist, ist klar. Der Meister weiß wo’s langgeht und der bestimmt auch die Vorstellung. Das Mädchen muss sich jetzt sechs Jahre lang die Haare wachsen lassen, damit sie wieder mitspielen darf. Dann aber ist sie zu alt und wird auf keine Show mehr eingeladen werden. So hart ist das Geschäft mit der Show, wenn’s um Haare geht.
Auch Rolf Jaeger hat bei diesen Shows mitgespielt – als Friseur versteht sich – und es hat ihm gefallen, denn er war noch ein junger Mann. Heute sieht er solche Events differenzierter. Schade um die schönen Haare, sagt er, man hätte aus denen noch ganz anderes machen können. Den Mädchen aber hat’s gefallen, denn auch sie waren jung, unternehmenslustig und endlich standen auch sie mal in der ersten Reihe. Elf Minuten und achtzehn Sekunden lang. Davon werden sie noch ihren Enkelkindern erzählen und vergilbte Fotos herauskramen. Damals, so werden sie sagen können, damals haben wir „Mode“ gemacht, „Trends“ gesetzt.
Die Friseure im Parkett werden nach Hause gegangen sein, um eine Erfahrung reicher, und werden ihre Schere tunlichst von den Haaren ihrer Klientinnen gelassen haben, denn sonst hätte es Krach mit den Ehemännern gegeben. Aber, wie eine modische Kurzfrisur auszusehen hatte, wussten sie nun. Das war ja auch was Schönes.
Die große Zeit dieser Events ist vorbei. Nur noch selten bekommen langmähnige Schönheiten so dekorativ die Haare abgeschnitten, und eigentlich ist dies schade, wo doch um Haare öffentlich so wenig passiert. Der Friseur arbeitet heute mehr im Verborgenen. Nur das Ergebnis seiner Bemühungen wird noch öffentlich gezeigt und pressetechnisch gewürdigt. Medienereignisse bei jedem größeren Ball.
Die Bühnen fürs Haareschneiden sind also abgebaut, die Vorhänge sind gefallen, die Musik ist verstummt, die Scheinwerfer erloschen.
Sind die Scheinwerfer tatsächlich erloschen, die Kameras ausgeschaltet, die Bühnen abgebaut?
Natürlich nicht. Die Ereignisse haben sich geändert. Heute finden die Präsentationen in Studios statt. Nach Drehbuch inszeniert. Auf Takt geschnitten. Verfremdet nach allen Regeln der elektronischen Bildbearbeitung. Video-Clip heißt das Medium und fördert die Bekanntheit der Coiffeur-Stars und das Geschäft Weniger. Millionenfach stärker als früher. Spezialisierte Fernseh-Sender verbreiten das „neue“ alte Schönheitsideal mit dem gesamten Angebot der Zubehörindustrie in alle Welt. Zu jedem willigen jungen, alten, auf jeden Fall aber zahlungskräftigen Kunden. Dabei sein, frei sein, uniform sein. Auch eine Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen. Quasi nach Katalog. Das neue persönliche Image wird gleich mitgeliefert.