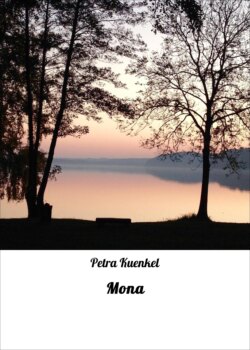Читать книгу Mona - Petra Kuenkel - Страница 4
Kapitel 2: Möglichkeiten
Оглавление1
„Guten Morgen, hier spricht der Kapitän“, weckte mich eine weit entfernte Frauenstimme. „Ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht gehabt. Wir beginnen jetzt unseren Sinkflug nach Mumbai und werden in 30 Minuten landen.“
Ich setzte mich auf, nahm die Schlafbrille ab und erwischte mich bei dem Gedanken, ob British Airways bei den Piloten schon weiter als unser Konzern mit der Frauenquote war. Benommen schob ich die Decke beiseite und richtete den Sitz auf. Der Flug von London nach Mumbai war so kurz, dass ich die Zeit zum Schlafen bis zum letzten Moment ausnutzen wollte. Deswegen hatte ich auf das Frühstück im Flugzeug verzichtet. Müde rieb ich mir die Augen und strich meine zerzausten Haare glatt, die sich morgens nur ungern zähmen ließen. Ich war froh, dass keiner meiner Kollegen im Flugzeug saß. Wann immer möglich vermied ich es, den privaten Jet des Konzerns zu nutzen, was sich nur dann nicht umgehen ließ, wenn ich die Vorstände begleiten musste. Flugreisen bedeuteten für mich eine Auszeit, die herausgenommen war aus der Schnelligkeit des Geschäftslebens. Meine Hypothese war, dass es den meisten reisenden Geschäftsleuten ebenso ging. Oft genug hatte ich beobachtet, wie die Herren – die Mehrzahl der Reisenden war ja männlich – es sich in ihren Sitzen in der Business Class bequem machten, nur um sofort in eine soziale Starre zu fallen. Sie ignorierten die Anwesenheit von Sitznachbarn und warteten auf die willkommene Ansage, das Handy abzustellen und den Laptop auszuschalten. Als freuten sie sich auf eine Zeit frei von allen Ansprüchen, ob beruflich, sozial oder privat.
Ich liebte solche Zeiten im Flugzeug. Seit einem halben Jahr reiste ich mit einem guten ökologischen Gewissen. Als meine Tochter noch bei mir wohnte, hatte sie mich vor jeder Dienstreise gefragt, wie ich den Co2-Fußabdruck meiner zahlreichen Flüge ausgleichen würde. Sie hatte mir eine Liste mit Projekten hingelegt, für die ich spenden sollte. Ihrer Ansicht nach konnte ich mir mit dem Finanzausgleich ein besseres Gewissen zumindest „kaufen“. Nina konnte da hartnäckig sein. Zwei Wochen nachdem sie nach Südafrika gegangen war, hatte sie mir eine Email geschickt mit einem Weblink zu einer Südafrikanischen Bank, die in ihrer Werbung behauptete, sie sei Co2-neutral. Nina hatte die Frage angeschlossen, wie es denn bei uns im Konzern wäre. Ich schrieb ihr zurück, dass es bei dem Thema ein Unterschied wäre, ob man ein Automobilkonzern sei oder eine Bank. Aber Nina hatte nicht locker gelassen – was sei das Leben ohne Herausforderungen? Ihre Beharrlichkeit führte dazu, dass ich mich mit dem Thema eingehender beschäftigte. Da die Sache im Konzern thematisch nicht mein Territorium war, hatte ich sie der Umweltabteilung als Innovation ans Herz gelegt und den Vorstand von einem Reputationsgewinn überzeugt, bevor er die Entscheidungsvorlage in den Händen hielt. Co2-Ausgleich für Dienstreisen aller Art war nach einem halben Jahr durchgesetzt und das Thema Offenlegen der Co2-Bilanz in guten Händen. Fortschritte waren eine Frage der Zeit und des geschickten Managements des Vorstandes. Ich liebte es zu gestalten, ohne dass man am Ende wusste, wo die Idee hergekommen war. Mit dem Thema Frauenquote im Management hatte ich jetzt allerdings eine Vorgabe, für deren Umsetzung ich alleine verantwortlich war.
Ich brachte den Sitz in die Landeposition, zog meine Schuhe an und machte den Gürtel meiner Jeans zu. Wenige Tage nach dem Telefonat mit Deepali hatte das Werk in Chennai um meine Anwesenheit in der Klärung einer schwierigen Personalangelegenheit gebeten. Damit waren alle Zweifel ausgeräumt. Ich entschied, den merkwürdigen Wink des Schicksals zu akzeptieren und beschloss, zuvor einen Abstecher nach Mumbai zu machen, um Deepali zu treffen.
Die Kapitänin bat die Crew, den Landeanflug vorzubereiten. Da ich am Gang saß, konnte ich von der Stadt nicht viel sehen. Ich schob den Schirm zurück, der als Sichtschutz zu meinem Nachbarn diente, um einen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Aber es war zu dunstig, um irgendetwas zu erkennen. Daher grüßte ich den Herrn neben mir nur kurz und schloss dann wieder die Augen.
„Sie sind sicherlich zum ersten Mal in Mumbai, oder?“, fragte der Nachbar, als hätte er nur darauf gewartet, endlich ein Gespräch anzufangen.
Ich öffnete die Augen.
„Stimmt!“
Neben mir saß ein indischer Mann ungefähr Mitte fünfzig in einem untadeligen Anzug, sodass ich mich fragte, ob er in dieser Kleidung geschlafen hatte und wie es möglich war, dass der Anzug so korrekt saß.
„Dann können Sie gar nicht sehen, was sich in den letzten Jahren alles verändert hat in dieser Stadt.“
„Nein, das kann ich das nicht, aber ich bin gespannt zu sehen, wie die Stadt genau heute ist.“
„Ein neuer Stadtentwicklungsplan des Ministeriums für erneuerbare Energien sieht vor, dass in den nächsten Jahren ungefähr 60 Städte als „Solarstädte“ entwickelt werden sollen. Bereits heute haben 48 Städte einen Antrag eingereicht und 37 Städte Entwicklungspläne, die auf die Anerkennung des Ministeriums warten. Mumbai ist schon genehmigt. Wenn man sich nur entschließt, ist alles möglich. Man kann eine ganze Stadt verändern und auch ein ganzes Land.“
„Sicher“, erwiderte ich freundlich, „Indien hat sich ja enorm wirtschaftlich entwickelt.“
„Das meine ich nicht. Es geht nicht allein um die Wirtschaft. Ich rede vom Menschen. Wenn sich das Bewusstsein ändert, ist alles möglich.“
Ich schwieg, weil ich nicht wusste, was ich antworten sollte. In dem Moment setzte das Flugzeug auf und bremste scharf. Der Herr betrachtete mich mit einem merkwürdigen Lächeln, das mir unangenehm war.
„Wie sich die Zukunft entwickelt, hängt von unserem Denken ab“, fing er wieder an, als wir auf das Terminal zurollten. „Das meine ich.“
Ich hoffte darauf, dass das Flugzeug bald zum Aussteigen bereit wäre.
„Vertrauen ist entscheidend“, setzte er unbeirrt fort. „Man muss darauf vertrauen, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie richtig sind. Es hat alles eine Ordnung, auch wenn wir sie nicht immer verstehen.“
Der Pilot verlangsamte die Fahrt und die Maschine kam zum Halten. Mein Nachbar stand auf, zeigte auf mein Handgepäck und als ich nur kurz nickte, nahm er den silbernen Rollkoffer aus der Ablage und reichte ihn mir. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich an den Umschlag mit dem alten Manuskript, das ich eingepackt hatte, weil ich in einer ruhigen Minute auf meiner Dienstreise darin weiterlesen wollte. Mir war, als müsste ich es beschützen. Der Steward gab das Flugzeug zum Aussteigen frei. Ich nahm den Koffer mit einem Dank entgegen und verabschiedete mich mit guten Wünschen für seine Rückkehr in sein Heimatland. Er hatte mich mit seinen merkwürdigen Bemerkungen aus dem Konzept gebracht. Da er mich vorließ, stieg ich als Erste aus und lief einer anonymen Traube von Menschen voran durch das Terminal, ohne mich nach meinem Reisenachbarn umzusehen. Nun stand ich in der Schlange der Nicht-Inder vor der Passkontrolle. Immerhin gab es hier eine Klimaanlage. Die kurze Strecke zwischen Flugzeug und Ankunftshalle kündigte an, welche Hitze mich draußen erwarten würde. Hinter den Kabinen, in denen die Beamten saßen, stand weithin sichtbar in großen Buchstaben ein Zitat von Ghandi an der Wand: „Du musst selbst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest.“ Das hätte Nina gefallen.
Ich hatte beschlossen, die Reise anders anzugehen als andere Dienstreisen. Als meine Sekretärin mich darüber informierte, dass sie das Taj Mahal Hotel in Mumbai gebucht wäre, erklärte ich ihr, sie solle das Hotel stornieren. Wegen des Terroranschlags vor einigen Jahren würde ich dort nicht übernachten wollen. Sie sollte im Reiseführer nach einem kleineren Hotel suchen, das zentral läge, drei Sterne würden reichen. In Chennai würde ich dann wieder in einem Fünf Sterne Hotel übernachten. Die Tage in Mumbai wollte ich anders verbringen. Ich brauchte das Gefühl zu reisen, ein Hauch von Unbekanntem, Unbestimmbarem. Auf die Frage, wer mich am Flughafen abholen sollte, antworte ich zum Erstaunen meiner Sekretärin, niemand, ich würde ein Taxi nehmen. Der ungläubige Blick sprach für sich.
Als ich mit dem leichten Koffer vor die Halle des Flughafens trat, traf mich die morgendliche Hitze Mumbais wie ein Schlag. Nicht weit weg von mir sah ich meinen Sitznachbarn wieder und als hätte er auf mich gewartet, eilte er auf mich zu.
„Entschuldigen Sie, wahrscheinlich wundern Sie sich über mich, aber ich muss auf meine Intuition hören und sie ansprechen. Haben Sie vielleicht heute noch Zeit für ein Gespräch? Selbstverständlich an einem öffentlichen Ort. In welchem Viertel wohnen Sie?“
„In Kolaba.“
„Dann vielleicht um 15.00 im Café Starbucks, in Kolaba?“
Von der Hitze und der Situation überfordert, willigte ich ein. So schnell, wie er auf mich zugelaufen kam, war er wieder in der Warteschlange für die Taxis verschwunden, als hätte er es besonders eilig. Die Zuordnung von Passagieren für die Taxis erschien mir nicht sehr effizient und fand nach einem System statt, das sich mir nicht erschloss. Während die Schlange der Wartenden chaotisch durcheinander geriet, standen die gelben Taxis ordentlich aufgereiht vor dem Terminal. Die Fahrer lungerten in Gruppen zusammen, gestikulierten und rauchten. Mir kam es vor, als würden sie sich streiten, anstatt Gäste transportieren zu wollen. Verstört von der merkwürdigen Begegnung ging ich auf das vorderste Taxi zu. Die hintere Tür war verbeult, sodass der Fahrer kräftig ziehen musste, um sie zu öffnen. Mein Rollkoffer verschwand in einem Kofferraum, den der Fahrer mehrfach kräftig zudrücken musste, bevor das Schloss hielt. Schicksalsergeben ließ ich mich auf die durchgesessene Rückbank fallen. Auf die Frage, wohin ich wollte, nannte ich erschöpft den Namen des Hotels und ich feilschte noch einige Minuten um den Preis. Dann fuhren wir los. Endlich konnte ich Mumbai auf mich wirken lassen.
Als ich zur Schule ging, hatte mir meine Großmutter erklärt, Synchronizitäten wären Ereignisse, die aufeinander folgten ohne Kausalzusammenhang, und dennoch einen Sinn ergäben. Sie hatte mir ständig Vorträge über die Bedeutung der Intuition gehalten. Das Leben sei eine Aneinanderreihung von Nachrichten an die Seele, auf die man hören sollte. Das Universum würde einem Hilfestellungen geben, die man nur wahrnehmen müsste, damit man von Herausforderungen des Lebens lernen konnte. Erst hatte mich das fasziniert und mich auch angestachelt, Dinge einfach auszuprobieren, spontan zu sein und mich treiben zu lassen. Später hatte ich es dann als Unfug abgetan. Die täglichen Herausforderungen, Kinder und Karriere zu verbinden, entfernten mich immer weiter von dieser Art das Leben zu sehen. Und im Konzern hatte eine solche Sichtweise auf die Dinge keinen Platz. Ungelöste Fragen und Zufälle durfte es nicht geben, oder zumindest sollte man nicht laut sagen, dass es sie gab. Der Moment, an dem ich wusste, dass ich nach Mumbai fahren würde, war wie eine Erinnerung an diese andere Art und Weise in der Welt zu sein. Und jetzt auch noch das Treffen mit meinem Sitznachbarn. Es hätte in die Geschichten meiner Großmutter gepasst.
Wir fuhren in die Morgendämmerung hinein auf die Stadt zu. Überall schliefen Menschen auf der Straße. Rechts und links der Fahrbahn und auf dem Mittelstreifen, auf Pappkartons, manche auf Matratzen, manche auf dem nackten Boden, viele Mütter mit Kindern. Ich begann zu zählen. Als ich schon nach wenigen Minuten über hundert war, gab ich auf. Sollte ich den Taxifahrer fragen, ob es hier immer so viele Obdachlose gab? Ich beschloss zu schweigen und einfach zu beobachten. Was wusste ich schon von Indien? Was wussten wir Menschen überhaupt voneinander? Ich versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, in Mumbai auf der Straße zu leben, eine alte Matratze und einen Gehweg mein Zuhause zu nennen. Wo würde ich mich waschen? Wie würde ich Schutz suchen? Ich hatte seit Jahren nicht mehr Zeit gehabt, eine fremde Stadt auf mich wirken zu lassen. Meistens war die Fahrt zwischen Flughafen und Fünf-Sterne-Hotel vollgepackt mit Arbeitsbesprechungen oder Telefonaten. Und anders als meine Tochter war ich nicht der Typ, der sich grundsätzlich mit den Schwachen dieser Welt identifizierte. Ich erwischte mich bei dem zynischen Gedanken, wie es wäre, mich und einige Manager aus unserem Konzern einmal mit einer solchen Erfahrung zu konfrontieren. Ein paar Tage in Mumbai auf der Straße leben. Sich von Almosen ernähren. Lernen zu betteln, lernen, um Unterstützung zu fragen. Lernen, dabei das eigene Selbstwertgefühl nicht zu verlieren und die eigene Identität, den Glauben an sich selbst nicht von der Größe des Dienstwagens abhängig zu machen. Die Gedanken halfen mir nicht – was ich sah, war unerträglich. Als wir an einer Verkehrskreuzung kurz hielten, sah ich zwei kleine Kinder, die neben einer liegenden Frau hockten. Sie bewegte sich nicht und starrte mit offenen Augen in die Weite. Sie musste schwer krank sein. Das Mädchen von vier oder fünf Jahren mit zerzausten Haaren und einem braunen dreckigen Kleid saß dicht an die Frau gedrängt und legte ihren Kopf auf deren Brust. Der Junge, nur wenig älter, barfuss, in Shorts und einem ebenso verdreckten hellblauen Hemd, hockte etwas abseits, als würde er warten und wissen, er könnte nichts tun. Ein Passant lief vorbei und warf dem Jungen ein paar Münzen hin, die er gierig einsammelte. Ich schluckte, als das Taxi wieder anfuhr, Tränen schossen mir in die Augen.
Die Welt war brutal. Und wir alle mischten mit, in unserer eigenen Welt gefangen. Wenn wir mit dem Elend konfrontiert wurden, fühlten wir uns ohnmächtig. Wir wähnten uns hilflos, flüchteten in Gegenden, die uns vor solchen Anblicken bewahrten. Damit bewiesen wir uns, dass die Welt auch andere Bilder hatte, und erklärten uns, dass wir nichts tun konnten. Ich hatte plötzlich Sehnsucht nach Nina. Sie hätte eine ihrer leidenschaftlichen Reden begonnen, über die strukturellen Ursachen von Armut, über Gesellschaftssysteme, die das soziale Ungleichgewicht in Gang hielten, über die Gleichgültigkeit der Reichen gegenüber den Armen. Der Taxifahrer schien die kranke Frau gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich wischte mir die Tränen ab.
Der Verkehr nahm zu, je weiter wir uns dem Zentrum näherten. Langsam schob sich die Blechlawine von Autos voran. Dazwischen überquerten Menschen auf wundersame Weise die Straße, mitten durch das dauerhafte Hupkonzert. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern an der Hand balancierte ein Bündel bunter Stoffe auf der Schulter durch den Verkehr. Fahrzeuge und Menschen schienen ein unsichtbares Komplott miteinander einzugehen. Jeder durfte jederzeit die Straße überqueren und sich zwischen den Autos und Bussen durchschlängeln, als hätte das Chaos ein System, das ihnen bekannt war. Fast wie ein Morgensport, ein Roulette-Spiel, eine Herausforderung des Schicksals. Oder ein Beweis für die Kooperationsfähigkeit zwischen Autofahren und Fußgängern. Es kam mir vor wie eine selbst organisierte Ordnung, in der alle Akteure die Regeln kannten, nur ich nicht.
Auf der rechten Seite tauchte das Meer auf. Wir fuhren jetzt auf der Uferpromenade. Das Hotel konnte nicht mehr weit sein. Ein schwerer gelber Dunst hing über dem Meer, der Horizont war nicht zu erkennen. Unzählige Frachter lagen träge in der Bucht vor Anker. An der nächsten Ampel kaufte der Taxifahrer eine Tageszeitung. Er reichte sie mir nach hinten, wiegte den Kopf nach rechts und links und fragte mit seinem indischen Akzent im Englischen, ob ich Zeitung lesen wolle. Der Verkehr würde auf der Halbinsel zunehmen und es würde noch einen Augenblick dauern. Aus Höflichkeit begann ich, in der Zeitung zu blättern, aber das Bild der beiden Kinder neben der kranken Mutter ging mir nicht aus dem Sinn. Ich überflog die Titelzeilen. Es ging darum, wie aus Mumbai eine Solarstadt werden sollte. Hatte mein Nachbar im Flugzeug nicht darüber gesprochen? Ich blätterte weiter. Auf der ersten Lokalseite hielt ich inne – dort war ein Foto von ihm abgebildet. ‚Zukunftsforscher Girish Puja im Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Mumbai’, sagte die Bildunterschrift, und der Untertitel – ‘Das Unmögliche möglich machen’. Der Artikel handelte davon, aus Mumbai eine Stadt zu machen, die sich mit Hongkong oder Singapur messen konnte und zudem ihre Energie zu 100% aus Sonnenlicht bezog. Das war ein weiter Weg, dachte ich und schlug die Zeitung wieder zu.
Das Taxi hielt vor einem bescheidenen grauen Hotel mitten im Stadtteil Kolaba in einer Seitenstraße, nicht weit entfernt von der großen Uferpromenade. Ein Hotelangestellter öffnete die Wagentür, wünschte mir, wie ich fand, übermäßig freundlich einen Guten Morgen und nahm mir den Rollkoffer ab. Wieder hatte ich den Gedanken, ich müsste das Manuskript beschützen. Aber der freundliche Herr stellte mein Gepäck nur an der Rezeption ab. Die junge Dame hinter dem Tresen begrüßte mich zu meinem Erstaunen mit meinem Namen. Sie schob mir die Schlüssel für mein Zimmer entgegen und überreichte mir einen Zettel mit den Zugangsdaten für das Internet. Ich war beeindruckt.
Das Zimmer im dritten Stock konnte ich nur mit einem alten Fahrstuhl erreichen, dessen dauerhafte Fuktionstüchtigkeit ich anzweifelte. Bevor ich mir überlegen konnte, was ich tun würde, wenn ich zwischen den Stockwerken stecken blieb, ruckte es und die Tür öffnete sich ratternd. Mein Zimmer lag am Ende des Flurs, es war nicht sehr groß, aber geschmackvoll in dezenten Pastellfarben eingerichtet. Durch die leicht geöffneten französischen Fenster drang verhalten der Lärm der Stadt ins Zimmer, begleitet von einer Hitze, die mich schwer atmen ließ. Die roten Seidenkissen auf dem Bett waren so drapiert, wie ich es in Paris hätte erwarten können. Ich legte mich auf das übergroße Bett und versuchte anzukommen.
Warum machte ich diese Reise eigentlich? Ein Anruf, ein Hinweis auf Chris, eine Mischung aus Zweifel und Gewissheit, Furcht und Gespanntsein und das Gefühl, dass dies nur der Anfang von etwas Größerem war. Als Studentin war ich viel gereist. Während andere sich bemühten, Geld zu verdienen oder Praktika zu machen, war ich unterwegs gewesen. Oft ohne konkretes Ziel. Ich hatte es geliebt, mich treiben zu lassen, ein Lebensgefühl zu kultivieren, wo Momententscheidungen zählten, wo es keine festen Planungen gab. ‚Emergenz’ war heute der Fachbegriff dafür im Management. Eine Betrachtungsweise, die besonders wichtig war für Führungskräfte, die zu starr planten. Auch ich selbst hatte lange nicht mehr die Gelegenheit gehabt, die Dinge auf mich zukommen zu lassen.
Gegenüber dem Bett hing ein Bild, das wie eine Kopie von Monet wirkte. Farbtupfer, die eine Szene ergaben, aber so verwischt, dass nur ein Gefühl entstand. Sich treiben lassen, dachte ich. Das passte.
Ich beschloss, meine Zeit in dieser Stadt langsam anzugehen und jeden Augenblick zu genießen. Der Tag war für mich reserviert, ich wollte durch die Straßen schlendern, die Mengen von Menschen zwischen den eng gebauten Häusern als Eindruck aufnehmen, mich treiben lassen, ohne Zeitdruck. Dass meine Absicht durch die Verabredung mit meinem Sitznachbar aus dem Flugzeug durchkreuzt war, ärgerte mich jetzt.
2
Ich konnte die Cafés von Starbucks nicht leiden, weil sie überall in der Welt gleich waren. Dagegen liebte ich die vielen kreativen, unprofessionellen, aber liebenswerten Cafés in Berlin. Außerdem war Starbucks immer überfüllt, zu jeder Tageszeit, überall auf der Welt. Entgegen meiner Abneigung saß ich nun dort, hatte mir einen mittelgroßen Café Latte geholt und einen Platz erobert, an den sich auch eine zweite Person setzen konnte. Ich stocherte mit dem Holzstab zum Rühren in meinem aufgeschäumten Kaffee und wartete nervös. Worauf hatte ich mich hier eingelassen? Das Café war voll mit jungen Leuten, von denen sich die meisten mit ihrem Laptop, ihrem Ipod oder ihrem Smartphone beschäftigten. Im Hintergrund lief leise indische Musik. Die Welt wird sich immer ähnlicher, dachte ich, die Gesichter der Menschen sehen hier anders aus, aber sie verhalten sich nicht anders als in Berlin. Ich war wie immer zu früh und da ich ungern alleine im Café saß, holte ich das Manuskript hervor, um weiterzulesen. Ich verstand nicht, worum es ging, aber der Text reizte mich wie eine Entdeckungsreise in eine andere Welt. Sie erinnerte mich an meine Großmutter, die immer voller unerwarteter Geschichten steckte. Wenn ich sie als kleines Kind mit meiner Mutter in ihrer Wohnung in einem Berliner Hinterhaus besuchte, war es, als würde ich eine Märchenwelt betreten. Ihr einziges Zimmer war vollgestopft gewesen mit antiken Möbeln, die von vielen Umzügen leicht beschädigt waren. Wenn meine Mutter gegangen war, kochte meine Großmutter einen Zaubertee aus Hagebutten- und Pfefferminzblättern. Sie stieß mich sanft auf das Sofa mit dem Brokatüberwurf und fing an Geschichten zu erzählen. Alles im Leben war für sie eine Geschichte. Als Kind konnte ich nie unterscheiden, was Realität war und was sie erfunden hatte. Jetzt konzentrierte ich mich auf den Text.
„Ich habe dich nicht sehen können“, sagte Morgaine mit einem verhaltenen Lächeln, als Ciarán ihre Gemächer betrat.
„Aber ich konnte dich sehen.“ Er legte seinen Umhang auf einen Schemel und fuhr sich mit der Hand durch sein langes braunes Haar. Dann breitete er einladend die Arme aus.
„Ich habe dich vermisst, obwohl ich weiß, dass es Unsinn ist. Und ich weiß, daß es dir ebenso ging. Es gibt keine Zeit, meine Liebe.“
„Ich weiß.“ Morgaine reichte ihm die Hand und ließ sich in seine Arme ziehen. Als sie seine Lippen spürte, dachte sie, er hat recht, es gibt keine Zeit, es ist immer noch so wie beim ersten Mal. Die Zeit versinkt, wenn ich ihn küsse. Ciarán bedeckte ihr Ohr zärtlich mit Liebkosungen, dann ihre Augen und ihren Nacken. Vorsichtig entfernte er ihre heilige Kette, das Amulett mit der Mondsichel, die sie nur als Priesterin trug, nicht als Frau, und öffnete ihr Kleid. Er liebte ihre kleinen Brüste, die in seine Hände passten. Fest umfasste er ihre Hüften, hob sie auf und trug sie auf das große Bett. Als er ihre Schamlippen berührte, wusste er, dass sie auf ihn gewartet hatte.
Ciarán war noch ein Junge gewesen, als er eines Tages in einem abgerissenen Umhang mit wilden Locken am Ufer gestanden hatte, um die Barke zu rufen. Das gelang nicht vielen, ihm jedoch, ohne dass man gesagt hatte, welche Worte er sprechen musste. Der Fährmann hatte ihn auf die Insel übergesetzt und dort war er verschüchtert ausgestiegen. Er hatte nicht viel geredet, außer wenn er direkt angesprochen wurde. Nach und nach stellte sich heraus, dass er in die Zukunft sehen konnte und Vorahnungen hatte. Mehr und mehr Menschen aus seinem Dorf waren zu ihm gekommen, um ihm einen Blick in ihre Zukunft abzuringen. Bis ihm seine Mutter eines Tages erklärt hatte, sie müsse ihn wegschicken, weil es zu gefährlich für ihn würde. Das Sehen sei zwar eine wichtige Gabe, meinte sie, es würde einen Jungen wie ihn jedoch in Schwierigkeiten bringen. Er müsse deshalb fort, um auf einer Insel zu leben. Dort wäre er geschützt. So verbrachte er seine späten Jugendjahre auf der Insel, zurückgezogen, bis er von der jungen Priesteranwärterin entdeckt wurde. Es war Morgaine, die Ciarán in die Liebe einführte, als er siebzehn war. Entsprechend der Tradition wurde diese Aufgabe von den Priesteranwärterinnen erfüllt. Morgaines Lehrerinnen hatten sie zuvor in die hohe Kunst der körperlichen Liebe eingeweiht. Sie musste sich einen Jüngling suchen, um ihr gewonnenes Wissen zu erproben und weiter zu geben. Meist waren die Männer jünger, auch das war Tradition. Ein Mann, der in die Kunst der Liebesspiele durch eine Priesterin eingeweiht wurde, musste unberührt sein. Morgaine hatte nie in Erfahrung gebracht, ob Ciarán nur ein guter Schüler war, oder ob er die Kunst der Liebe schon längst erlernt hatte. Sie fragte ihn nie. Aber sie wusste nach der ersten Nacht, daß es keinen anderen Mann als ihn für sie geben würde.
„Und“, fragte Morgaine, nachdem sie erfüllt eine lange Weile still geruht hatten. „Was geht in der Welt vor?“
„Ich weiß nicht, ob du es wissen willst.“
„Ich will es nicht wissen, deshalb sehe ich es nicht. Und dennoch frage ich dich. Erzähle es mir, damit ich höre, was ich ohnehin vermute.“
„Sie führen Krieg.“
„Gegen was?“
„Gegeneinander. Und gegen die Schwachen. Sie morden und vergewaltigen Frauen und Kinder.“
„Warum tun sie das?“
„Ich weiß es nicht, ich kann den Grund nicht erkennen. Doch die, die es machen, fangen mehr und mehr an, die Wirklichkeit zu regieren. Zerstörung gebiert Zerstörung, Gewalt sät Gewalt. Ohnmacht erzeugt das Streben nach Macht.“
„Macht ist nicht immer verwerflich, Ciarán“, wandte Morgaine ein.
Es gibt nur die Macht, die einem anvertraut wird, dachte sie, aber sagte es nicht. Macht bedeutete, den Menschen zu dienen. Das war ihre Haltung als Priesterin.
„Ich weiß, was du denkst, meine Liebe.“ Ciarán seufzte. „Aber die Wirklichkeit entwickelt sich anders. Macht ist zu einem Handel unter Menschen geworden. Sie verkaufen ihre Seele für den Zugang zu Macht. Wenn diese Macht bedroht ist, werden sie gewalttätig, um sie aufrecht zu erhalten. Die Welt hat viele Gesichter, nicht nur dasjenige, das ihr auf der Insel sehen möchtet.“
Morgaine schwieg. Dann entgegnete sie ihm schließlich mit fester Stimme:
„Ciarán, wir denken uns in unsere Wirklichkeit, es ist unser Geist, der die Welt erschafft, wie sie ist. Haben wir versagt? Haben wir unsere Macht nicht ausreichend genutzt?“
Er nahm ihren Kopf und zog ihn zu sich hin, um sie zu küssen.
„Ich weiß es nicht, du bist die Herrin vom See. Du bist mit den großen Kräften dieser Welt in Kontakt. Ich weiß nur, daß die Welt sich ändert in eine Richtung, die wir nicht für sinnvoll halten.“
„Und was tust du dagegen, Ciarán?“
Er schwieg. Morgaine strich ihm zärtlich über sein Gesicht. Es gibt keine Zeit, dachte sie. Und doch werde ich ihn vermissen. Denn er wird in der Welt sein und ich werde den Nebel über die Insel legen, damit sie für immer geschützt ist.
„Du musst das Wissen der Frauen bewahren“, sagte Ciarán mit einer Festigkeit, die das Gespräch beenden sollte.
Ich überflog die letzten Seiten noch einmal, was hatte da gestanden? Wir denken uns in unsere Wirklichkeit, es ist unser Geist, der die Welt erschafft, wie sie ist.
In diesem Augenblick sah ich ihn die Tür zum Café öffnen. Schnell schob ich das Manuskript in den Umschlag zurück. Wieder trug er einen tadellosen grauen Anzug. Ein gepflegter gut aussehender Herr, der auf jeden Fall auf sein Äußeres achtete. Girish hatte mich schon gesehen und steuerte winkend durch das volle Café auf mich zu.
„Guten Tag, darf ich mich setzen? Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie gleich an Ihrem ersten Tag hier beanspruche, aber ich musste Sie einfach dringend sprechen.“
Schon im Flugzeug war mir die Freundlichkeit seiner Augen aufgefallen. Ich nahm eine Tiefe in seinem Blick wahr, die ich nur von Chris kannte. Zugleich war mir die Vertrautheit, mit der er auf mich zukam, unangenehm. Ich fragte mich, ob das die indische Art war, auf Frauen zuzugehen. Als hätte er meine Gedanken gelesen, fügte er hinzu:
„Meiner Frau war es nicht recht, dass ich gleich schon wieder zu einem Treffen gehe, aber sie hat gesagt, sie verzeiht es mir in diesem Fall. Gedulden Sie sich noch einen Moment? Ich hole mir rasch einen Kaffee.“
Er balancierte eine große Tasse Tee wie ein wertvolles Kunststück zwischen den jungen Leuten hindurch, blieb vor unserem Tisch stehen und fragte mich nach meinem Namen, bevor er sich setzte. Als ich ihn nannte, lächelte er wissend, wiegte den Kopf leicht nach rechts und nach links und sagte:
„Ach, ich wusste es. Manchmal sehe ich einen Menschen, falls Sie wissen, was ich meine. Dann weiß ich, was in einem Menschen vorgeht, ich erfasse die Bedeutung. So ging es mir, als ich Sie neben mir im Flugzeug sitzen sah kurz vor Mumbai. Ich habe nach der Landung sofort meine Frau angerufen und ihr von Ihnen erzählt. Sie hat mich gebeten zu beschreiben, wie Sie aussehen und sofort gesagt – das muss Mona sein. Daher habe ich sie bei den Taxis abgefangen und um ein Gespräch mit Ihnen gebeten. Sie ahnen es schon. Deepali Puri ist meine Frau.“
Ich muss ihn verwirrt angestarrt haben. Im Bruchteil von Sekunden gingen mir alle merkwürdigen Ereignisse der letzten Wochen durch den Kopf. Das Manuskript, die ärgerliche Vorstandssitzung, der Anruf von Deepali, die Begegnung im Flugzeug, das Café, in dem ich mich nicht wohl fühlte. Eine Kette von Ereignissen, die zusammenhingen, ohne einen Sinn zu ergeben. Wo führte das hin? Um die Situation in den Griff zu bekommen, entschied ich, die Führung in unserer Unterhaltung zu übernehmen.
„Ich habe ihr Bild in der Zeitung gesehen. Erzählen Sie mir, was Sie beruflich genau machen?“
Girish legte die Hände auf den Tisch. Mit Erschrecken sah ich wie er seine Finger ineinanderschob, so wie auch ich es tat, wenn ich angestrengt war.
Er lachte. „Ich bin Zukunftsforscher. Ich weiß, das klingt merkwürdig. Es ist die beste Bezeichnung, die ich meiner Arbeit geben kann. Ich versuche herauszufinden, was die Zukunft in sich birgt. Ich erforsche, wie Menschen Zukunft gestalten. Nicht Sie alleine und ich alleine, als einzelne Individuen, sondern wie wir gemeinsam als Menschen Zukunft gestalten.“
Ich lehnte mich zurück und verschränkte die Arme.
„Und wie genau erforschen Sie das?“
„Ich verbinde qualitative und quantitative Methoden, um mögliche Zukunftsszenarien zu definieren. Der Kern des Ganzen ist: Ich beobachte. Und zwar beobachte ich Muster – wie Menschen zusammenwirken, positiv oder negativ. Die Komplexität der Welt ist ja in Muster geordnet, nicht wahr? Wir müssen nur lernen, sie zu sehen und zu verstehen. Dann müssen wir lernen, die Komplexität der Welt in andere Muster zu ordnen, solche, die für uns alle förderlicher sind – und das bewusst, oder viel mehr strategisch!“
Girish schien völlig in seinem Element zu sein.
„Meine Frau und ich haben entdeckt, dass wir beide von der Zukunft fasziniert sind, davon, wie Menschen Zukunft gemeinsam gestalten. Sie passiert ja ohnehin, aber wie beeinflussen Menschen sie konstruktiv? Ko-kreativ nennen wir das. So, dass es alle weiter bringt und nicht nur zum Vorteil einiger reicht.“
Ich warf ein: „Es wird viel Unsinn in der Welt gemacht, weil Menschen versuchen gemeinsam Zukunft zu beeinflussen, meinen Sie nicht? In der Menschheitsgeschichte gibt es dafür ja zahlreiche Beispiele.“
„Sie haben recht, Mona. Wir fragen uns natürlich, wann man das Zusammenspiel menschlicher Aktionen als konstruktiv bezeichnen kann. Meine Frau und ich haben da folgende Arbeitsdefinition – Konstruktiv sind Aktionen dann, wenn sie lebensfördernd sind.“
Mein Unbehagen wuchs.
„Lebensfördernd für wen?“
Ich dachte an die kranke Mutter mit den Kindern auf der Straße. Hier ein theoretischer Ansatz – da das Elend auf der Straße. Voneinander losgelöste Welten.
„Die Herausforderung ist“, fuhr Girish unbeirrt fort, „zu lernen, welchen größeren Kontext man einbeziehen muss, wenn man sich gemeinsam in die Zukunft denkt. Es sind ja unsere Intentionen, die die Wirklichkeit der Zukunft bestimmen. Ist der Kontext zu klein, vernachlässigen wir das größere Ganze und schotten uns ab. Ist der Kontext zu groß, fühlt man sich ohnmächtig. Verstehen Sie?“
Ich verstand nicht, worauf er hinaus wollte, aber musste an meinen Konzern denken und die Weigerung der meisten Manager, über die Welt des Konzerns hinauszudenken. War ich da anders? Das politische Ränkespiel war davon getrieben, sich selbst Vorteile zu verschaffen. Die Auswirkungen unseres Konzerns auf den Rest der Welt spielten dabei keine Rolle.
„Und was machen Sie konkret damit?“, fragte ich, statt ihm zu antworten.
Girish lehnte sich zurück.
„Ich unterstütze und begleite Projekte, in denen sich Menschen vorgenommen haben, gemeinsam auf eine positive Zukunft hinzuwirken. Nehmen Sie das Beispiel Mumbai. Vor zehn Jahren hat niemand geglaubt, dass man eine solche Stadt modernisieren kann, die Luft in der Innenstadt war unerträglich. Jetzt wollen wir eine Solarstadt werden. Eine Stadt, in der jeder Zugang zu Energie hat. In Zukunft werden wir nur noch mit Elektroautos fahren. Ist das nicht ein Markt für Ihren Konzern?“
„Schon, ja.“
Ich zögerte, weil ich mein ungutes Gefühl nicht los wurde und keine konzernpolitischen Angelegenheiten mit einem Fremden besprechen wollte. Der Entwicklungsbereich der E-Mobilität kam nur schwerfällig voran. Die Konkurrenz lag eindeutig vor uns. Warum hatte mich dieser Mann in das Café gebeten? Elektroautos konnten nicht der Grund sein. Ich war froh, als er nicht weiter nachfragte und stattdessen das Thema wechselte.
„Haben Sie gesehen, wie viele Menschen in Mumbai auf der Straße leben?“
„Ja, um ehrlich zu sein, das hat mich geschockt.“
„Sehen Sie, das ist ein gutes Beispiel. Sie können das Problem nicht lösen, wenn Sie denken, Obdachlosigkeit ist der Kern des Ganzen, denn dann fangen Sie an Unterkünfte zu bauen. Und die lösen nicht die Ursachen der Obdachlosigkeit. Sie müssen das Muster verstehen, für das die Menschen auf der Straße nur ein sichtbares Anzeichen sind.“
Worauf wollte er hinaus? Und was wollte er von mir? Natürlich gab es größere Zusammenhänge für ungleiche Gesellschaftsverhältnisse.
„Es ist unser Denken, Mona, genauer unser kollektives Denken.“
„Sie meinen, die Menschen sind selbst schuld an ihrer Obdachlosigkeit?“
„Keineswegs! Sie verstehen mich völlig falsch. Es geht nicht um das Denken der Obdachlosen, sie sind genauso gefangen wie wir in unserem Denken.“
„Worum dann?“
„Wir alle verharren in einer Denkwelt der Gegensätze, arm und reich, Gewinner und Verlierer. Sehen Sie sich im Café um. Hierher kommen nur die Privilegierten. Wir denken, unser Leben hätte nichts mit den Obdachlosen auf der Straße zu tun.“
Ich sah wieder das Bild der kranken Frau vor mir. Was hätte ich schon tun können? Daher fragte ich nach.
„Was würde das praktisch bedeuten, wenn wir anders denken würden?“
Girish holte tief Luft und rückte seine Krawatte zurecht.
„Für Mumbai heißt das, die unterschiedlichsten Menschen zusammenzubringen, die bereit sind, gemeinsam eine Stadt der Zukunft zu denken ohne die Probleme der Gegenwart zu ignorieren. Die Solarstadt ist nur der Aufhänger. Die Zahl der Obdachlosen reduziert sich stetig. Der innerstädtische Smog hat abgenommen. Die Begrünung der Innenstadt hat begonnen, und vor allem – viel mehr Menschen fühlen sich verantwortlich dafür, sich für ihre Stadt einzusetzen.“
Ich schob vorsichtig meine Kaffeetasse beiseite und sah auf die Uhr. In Mumbai wurde es früh dunkel und ich wollte noch ausreichend Zeit haben, durch die Straßen zu bummeln.
„Das ist sehr mutig und sicherlich lobenswert“, bemerkte ich in der Hoffnung, das würde das Gespräch beenden.
Girish pausierte und wiegte seinen Kopf leicht nach links und nach rechts, was, dass wusste ich ja, die indische Art war, Zustimmung zu äußern.
„Ach ja, ich bin wieder zu sehr bei meinen eigenen Projekten, zu sehr begeistert. Das kritisiert meine Frau immer an mir. Das ist ja auch nicht der Grund, weshalb ich Sie treffen wollte.“
Ich stutzte.
„Was ist dann der Grund?“
„Mona“, Girish lehnte sich nach vorne. Er sah sich kurz im Café um, als würde er sich vergewissern wollen, dass niemand ungebeten zuhört.
„Stellen Sie sich ihrer Aufgabe! Es ist gut, dass Sie sich jetzt auf den Weg gemacht haben, Mona. Die Welt braucht Menschen wie Sie. Sie müssen Ihre Aufgabe voranbringen und dürfen nicht aufgeben. Geduld ist wichtig und Durchhaltewillen. Sie müssen vertrauen, die Dinge haben ihre Ordnung, wir müssen nur lernen, sie zu verstehen. Nehmen Sie Ihre Aufgabe an! Das ist es, worum ich Sie bitten möchte.“
3
Am Abend sorgte ein Wolkenbruch für eine leichte Abkühlung und am nächsten Morgen hatte es aufgeklart. Jetzt zogen am Himmel kleine Wolken wie aufgereihte Perlen nach Süden. Wir hatten den Zug aus Mumbai heraus genommen, weil Deepali mir einen besonderen Ort zeige wollte. Vor uns breitete sich träge der Fluss aus, der uns von einer magischen Landschaft grüner Hügel trennte. Sie wellten sich in die Ferne soweit ich sehen konnte. Das verrostete Passagierschiff hatte die Anlegestelle verlassen. In einer guten halben Stunde würden wir am anderen Ufer sein. Auf dem Deck tummelten sich junge Pärchen mit kleinen Kindern, die wild zwischen den Erwachsenen hin und her liefen. Drei ältere Frauen in bunten Saris mit goldbestickten Rändern lehnten an der Reling neben uns, als würden sie abschätzen, wie man am besten ins Wasser springt, falls die Fähre kentern sollte. Die jüngeren Leute trugen Shorts, kurze Kleider oder Jeans wie Deepali und ich. Ob Peking, Mumbai oder Berlin, die Mode war überall gleich. Mit meinen streng nach hinten zurückgebunden Haaren fiel ich hier sicher nicht als Ausländerin auf. Wir hatten eine Holzbank auf dem oberen Deck ergattert und genossen den kühlenden Fahrtwind. Deepalis schwarze kurze Haare wehten im Wind und sie machte ununterbrochen Fotos mit ihrem Smartphone. Mit ihren Jeans und dem weißen T-Shirt wirkte sie jung, obwohl sie mindestens so alt wie ich sein musste. Sie hatte den zielstrebigen Blick einer Frau, die wusste, was sie wollte und zugleich einen jugendlichen Charme in ihren Bewegungen. Ob Chris sie attraktiv gefunden hatte?
Nach dem Treffen mit Girish war ich fest entschlossen gewesen, Mumbai umgehend zu verlassen. Noch im Café beschlich mich das Gefühl, in eine Falle geraten zu sein, als wäre ich Statistin in einer geheimen Dramaturgie, die ich nicht kannte. Ich war froh, dass Girish sich nach kurzer Zeit mit der Begründung verabschiedete, seine Frau würde auf ihn warten. Höflich gab ich ihm mit, dass ich mich auf das Treffen mit Deepali am nächsten Tag freuen würde. Danach war ich durch die Stadt geschlendert und hatte lange neben dem gerade renovierten Triumphbogen am Taj Mahal gestanden, um gedankenverloren auf das stille gelblich Meer zu sehen. Ich fragte mich, wie lange die vielen Frachter hier in der trüben Bucht vor Anker liegen mussten, bevor sie gelöscht wurden. Später schlenderte ich ziellos durch die Stadt. Ich genoss das Alleinsein in der Menschenmenge und wunderte mich, dass ich im Gegensatz zu den anderen Europäern auf rätselhafte Weise in Ruhe gelassen wurde. Zurück auf der Uferpromenade sah ich, wie hinter dem Dunst, in dem die Schiffe geduldig warteten, sich über dem Meer ein Gewitter zusammenbraute. Rechtzeitig vor dem Wolkenbruch erreichte ich das Hotel. Ich entschied mich zu bleiben, um Deepali nicht zu enttäuschen. Man wusste ja nie, wie wichtig diese Verbindung zur Konkurrenz werden konnte. Die Unterhaltung mit ihrem Mann würde ich nicht von mir aus ansprechen.
„Dass Frauen zunehmend die Rolle von Entscheidungsträgern wahrnehmen werden, ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist“, erklärte Deepali mir gerade lautstark, um das Knattern der Schiffsmaschine zu übertönen.
„Das verändert, wie Entscheidungen getroffen werden. Frauen sind strategischer, weil sie schneller lernfähig sind.“
Ich war froh, dass das Gespräch sich auf einer fachlichen Ebene bewegte.
„Inwiefern sind Frauen strategischer?“
„Man muss natürlich fragen, strategisch für was? Ich bin überzeugt, dass die globalen Fragen, die uns beschäftigen, Fähigkeiten brauchen, über die viele Frauen verfügen: Pragmatismus, Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit und einen Sinn für das größere Ganze, meinen Sie nicht?“
Ich zögerte. So hatte ich das bisher nicht gesehen.
„Frauen sind die besseren Krisenmanager“, fuhr Deepali fort, „und Krisen haben wir ja wirklich genug! Die Umfeldbedingungen für Managemententscheidungen verändern sich rasend. Alles wird komplexer, uneinschätzbarer. Wer kann denn heute noch planen? Frauen lernen schneller, sie können sich anpassen, ohne dass ihr Ego ihnen ein Bein stellt. Sieh dir die drei älteren Damen dort an der Reling an, sie wagen den Blick über den Tellerrand und müssen ohnehin für ihre Familien täglich innovative Lösungen finden.“
Ich erinnerte mich an eine Unterhaltung, die ich vor Wochen mit dem Finanzvorstand des Konzerns geführt hatte. Er verglich das Management der Investitionen in der Finanzkrise mit Achterbahnfahren. Man wusste nie, ob man bei der nächsten Kurve aus der Bahn geschleudert würde.
Dennoch wollte ich ihr weder zustimmen, noch widersprechen. Ich versuchte, das Gespräch zu dem Thema zu lenken, wofür ich mir von ihr Anregungen erhoffte.
„Und wie schaffen Sie es in Ihrem Konzern, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen?“
„Starre Strukturen auflösen, mehr Flexibilität ermöglichen, Gestaltungsmöglichkeiten bieten, alberne Territorialkämpfe verhindern, dem Zufall eine Chance geben. Eine andere Arbeitsatmosphäre schaffen, in der Frauen sich zu Hause fühlen. Agilität ist die Fähigkeit der Zukunft, eine Mischung aus Veränderungsbereitschaft, Reflektion und Kreativität.“
Ich war perplex über ihre präzise Antwort.
„Und das geht bei Ihnen?“
„Alles geht, wenn man es will.“
Das Schiff näherte sich schlingernd einer wenig vertrauenserweckenden Steganlage. Die Maschine dröhnte so laut, dass ich befürchtete, sie würde explodieren. Am Ufer stand eine Menschenmenge, die offensichtlich schon auf die Rückfahrt wartete. Auf dieser Seite des Flusses lag ein Vergnügungspark, ein beliebtes Ausflugsziel in Mumbai. Die Silhuette eines beängstigend hohen Riesenrades blinkte neben einer verschlungenen Achterbahn in der Mittagshitze. Von einem Tempel, den Deepali erwähnt hatte, war nichts zu sehen. Die Fähre legte knirschend an einem morschen Holzsteg an, wurde lieblos vertäut und die Passagiere sprangen über einen gefährlichen Spalt auf morsche Holzplanken. Während die Menge sich schnatternd auf den Weg zum Vergnügungspark machte, zog Deepali mich beiseite und zeigte auf einen schmalen Pfad. Ausgetretene Treppenstufen schlängelten sich durch blassgrüne Büsche steil bergauf. Wir waren die Einzigen, die auf dem Steig zum Tempel hinaufkletterten. Als wir fast oben angekommen waren, tauchte eine goldene Kuppel auf. Ich war überrascht über die Größe und zugleich Maßgenauigkeit und fragte mich, wie viel Ingenieursintelligenz es gebraucht hatte, um diese Konstruktion stabil zu machen.
„Eine faszinierende Leistung“, bemerkte Deepali, als hätte sie meine Gedanken gelesen. „Ein intensiver Dialog von Fachleuten zur besten Vorgehensweise Es waren übrigens etliche Ingenieurinnen beteiligt.“
Auf dem Vorplatz türmte sich Baumaterial und Schutt, als hätte sich niemand darum gekümmert es zu entsorgen. Durch eine hohe geschnitzte Tür mit unendlich vielen Verzierungen betraten wir den Innenraum. Die große Halle war zur Hälfte mit Menschen gefüllt, die im Schneidersitz saßen und meditierten. Die Stille traf mich unerwartet. Deepali bedeutete mir zu schweigen. Wir zogen die Schuhe aus, stellten sie in ein Regal und gingen im gedämpften Licht barfuß weiter, um uns einen Platz zu suchen. Ein zart bemaltes Rundgewölbe legte sich schützend über die Meditierenden, die gleißende Helligkeit des Mittags war von schmalen Fensterschlitzen gebannt. Die Ruhe überwältigte mich wie ein plötzlicher Nebel. Nur das vereinzelte Hüsteln und Räuspern erinnerte mich daran, dass hier Menschen saßen. Deepali reichte mir eines der blauen Kissen. Ich setzte mich und versank augenblicklich in einer anderen Welt, die mir zeitlos und ohne Grenzen erschien. Eine angenehme Schwere hüllte mich ein. Das erste, was vor meinen geschlossenen Augen erschien, war das Manuskript. Ich dachte mich in die merkwürdige Welt von Morgaine hinein, die in diesem Moment etwas sehr Vertrautes hatte. Wieder kam es mir vor, als wäre ich in eine der Geschichten von meiner Großmutter geraten.
Als Deepali mir sanft an die Schulter tippte, kam es mir vor, als wären nur ein paar Minuten vergangen. Steif in den Gliedern und benommen im Kopf erhob ich mich, vorsichtig um niemanden zu stören, und schlich ihr hinterher zum Ausgang. Schweigend zogen wir die Schuhe an. Als ich im grellen Sonnenlicht vor dem Eingang der Pagode auf die Uhr sah, stellte ich fest, dass ich über eine Stunde meditiert hatte.
„Wir müssen das letzte Schiff bekommen“, sagte Deepali lachend, als wollte sie mich zurück in die Wirklichkeit holen, legte ihren Arm um meine Hüfte und schob mich sanft auf den Weg. Im Laufschritt liefen wir hinunter zum Schiffsanleger. Unbeeindruckt von der Unregelmäßigkeit der Treppenstufen, setzte sie ihre Rede fortsetzte, als wäre nicht mehr als eine Stunde im Schweigen vergangen.
„Der Bau der Pagoda ist eine hervorragende Planungsleistung, aber dem ging etwas voraus, was man nicht planen kann. Das hat mich fasziniert.“
„Und was war das?“, fragte ich, während mein Blick in die Ferne schweifte. Am Horizont konnte ich blass die Silhouette von Mumbai erkennen. Dahinter kündigte sich ein Gewitter an. Depali blieb abrupt stehen und drehte sich zu mir um.
„Es ist die Fähigkeit von Menschen, das Unmögliche zu denken“, sagte sie nachdenklich. „Deshalb habe ich Sie hierher gebracht.“
Ich befürchtete, das Gespräch würde in eine mir unangenehme Richtung gehen und schwieg. Was hatte sie mit mir vor?
„Sehen Sie, Mona, in Mumbai, wo Grund und Boden so teuer sind wie kaum an einem anderen Platz der Welt, hätte man ein solches Gebäude nicht planen können. Es mussten ganz viele Faktoren zusammenkommen, damit das geht.“
„Und welche waren das?“
Jetzt war ich doch neugierig geworden.
„Es musste Menschen geben, die eine Idee hatten, einen Traum, oder, in der Sprache unserer Unternehmenswelt, eine klare Vision. Die Bereitschaft, das Unmögliche zu wagen. Als sich die Idee wie eine Kettenreaktion in den unterschiedlichsten Köpfen verfestigte, begann eine Veränderung. Die Absicht hatte sich in den Herzen verankert. Einer der Meditierenden entschloss sich eines Tages, das Grundstück zu spenden. Eine Gruppe von Ingenieuren kam zusammen und begann auf freiwilliger Basis die Planung und Supervision des Baus. Ein Unternehmen aus Gujarat spendete das Material. Immer mehr Spenden trafen ein. Zug um Zug konnte die Pagode gebaut werden.“
An der Anlegestelle wartete schon das Schiff. Wir beeilten uns an Bord zu gehen und mussten uns mit einem Stehplatz an der Reling begnügen. Die Fähre war eindeutig überladen. Das trübe dunkle Wasser spülte in sanften Wellen Unrat ans Land. Ein schmaler Teppich von Plastikmüll bedeckte die Uferzone. Ich dachte daran, dass Nina kritisch nachfragen würde, warum Menschen Geld für eine goldene Pagode ausgaben, anstatt es sinnvoller einzusetzen, und damit den Armen zu helfen oder die Umwelt zu verbessern. Der Motor dröhnte beängstigend, als sich das Schiff vom Ufer entfernte. Es schaukelte bedrohlich in den Wellen, die in der Vorahnung des Gewitters größer wurden. Wir hielten uns an der Reling fest. Ein starker Wind war aufgekommen und kündigte Regen an. Am Himmel braute sich eine Wolkenfront zusammen. Es würde nicht lange dauern und einer dieser tropischen Regengüsse, nach denen alle Straßen überflutet waren, würde auf uns niederprasseln.
„Mein Vorgänger im Unternehmen legte viel Wert darauf, dass jeder Manager einmal im Jahr für eine Woche meditierte. Es klingt banal, aber ich habe erst da begriffen, dass das Äußere und das Innere zusammengehören.“
Deepali war nicht von ihrem Thema abzulenken.
„Deswegen war ich gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Früher hielt ich Meditation für Unfug – oder für Luxus. Bevor ich in mein jetziges Unternehmen eingetreten bin, habe ich in Mumbai eine Organisation geleitet, die sich um Obdachlose kümmerte. Wir haben hervorragende Arbeit gemacht und vieles erreicht. Aber ich habe gemerkt, dass wir nicht an das System, sozusagen das ‚Denksystem’, herankamen, das den Kreislauf der Armut aufrecht erhält. Wir waren nur die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft.“
Deswegen hatte ihr Mann von den Obdachlosen gesprochen! Die beiden passten gut zusammen. Dennoch überraschte mich eine solche Karriere. Bei uns hätte niemand mit einer Vergangenheit im sozialen Bereich Chancen auf so eine Position im Konzern gehabt.
„Und, was hat Sie bewogen, ausgerechnet die Aufgabe in einem Automobilkonzern anzunehmen?“
„Die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Mona. Das müssten Sie doch verstehen!”
Sie sah mich an, als wäre ich ein begriffstutziges Kind.
“Hinter dem Gesamtkonzept meines Konzerns stehe ich. Mobilität für alle Schichten der Bevölkerung. Die Umweltbilanz ist nicht vorzeigefähig, das ist mir klar. Aber ich brauchte eine neue Herausforderung. Wir sind doch alle auf der Suche, nicht wahr Mona?“
Sie sah mich prüfend an, während ich versuchte, den Gedanken an Chris abzuschütteln. Vielleicht war es Deepalis Begeisterungsfähigkeit, die sie so attraktiv machte?
4
Als ich abends im Hotel auf meinem Bett lag und der Verkehrslärm Mumbais durch das Fenster in mein Zimmer im dritten Stock drang, kam es mir vor, als wären nicht knapp zwei Tage vergangen, sondern Wochen. Draußen prasselte ein Sturzregen auf die Straße zwischen und erzeugte mit gleichmäßigen Trommelschlägen einen Rhythmus, der sich in mein Gehirn hämmerte, als wollte er mir das Denken verbieten. Ich starrte auf das Gemälde an der gegenüberliegenden Wand und fühlte mich wie in einem Traum, dessen Sinn ich nicht erfassen konnte. Warum wollte ich hierherkommen? Hatte mich meine Sehnsucht nach Chris getrieben? Was hatte ich erhofft, was erwartet? Ich überlegte, wann ich das letzte Mal eine Situation erlebt hatte, in der nicht ich Aufgaben delegierte und Vorträge hielt. Deepali hatte mich den ganzen Tag belehrt. Sie war eine brillante Rednerin, genauso wie ihr Mann. Beide schienen so überzeugt von ihren Ideen zu sein, dass keine andere Weltsicht zwischen die Atemlücken ihrer Ausführungen passte. Ich hatte mich in mein Schicksal ergeben und zugehört.
Nach der Ankunft der Fähre waren wir in eine Rikscha gesprungen, weil meine Begleiterin meinte, wir müssten uns beeilen, um dem Regen zu entkommen. Als wäre Eile ein Wort, das zu diesem Land passen würde, in dem mir alles zäh und verlangsamt vorkam wie in einem Film, den man in Zeitlupe abspielt. Im Regionalzug auf dem Weg zurück nach Mumbai schwieg Deepali endlich, als hätte sie alles gesagt. Mit rhythmischen Stößen rollten die Waggons durch die regenfeuchte Landschaft, aus der in Schwaden Dunst aufstieg. Ich saß gedankenverloren auf einer Holzbank und sah starr aus dem Fenster. Chris ging mir nicht aus dem Kopf. Warum hatte er mich verlassen, um in ein Land zu gehen, von dem die meisten Menschen noch nicht einmal wussten, wo es lag? Warum hatte er Deepali empfohlen, mich nach Mumbai einzuladen? Warum meldete er sich nicht bei mir? Das Rattern des Zuges machte eine Unterhaltung unmöglich. Die Waggons waren überfüllt wie das Schiff. Sogar bei uns in der ersten Klasse standen Menschen im Gang. Als wir die Vorstädte erreicht hatten, ertönte in kurzen Abständen ein schrilles Pfeifen, wenn der Zug dicht an Märkten und Häusern vorbeifuhr. Bei jedem Halt boten Trauben von Händlerinnen in farbigen Saris durch die heruntergezogenen Fenster Essbares an die Fahrgäste feil. Schreiend drängten sie ihnen Bananen, Papayas und Feigen auf, während Bahnangestellte sie zu verscheuchen versuchten, sobald der Zug schwerfällig anfuhr. In der Abenddämmerung zogen die heruntergekommenen Slums von Mumbai vorbei, von namenlosen Gassen durchschnitten, in denen Kinder im Unrat spielten. Als wir in Kolaba aus dem Zug ausstiegen und uns aus dem überfüllten Bahnhofsgebäude gerettet hatten, blieb Deepali unvermittelt stehen und fragte: „Sagen Sie, Mona, wie stehen Sie zu Christopher Jones? Sie müssen nichts sagen, aber es interessiert mich. Ich bin da sehr direkt.“
Ich hatte geahnt, dass die Frage kommen würde. Trotzdem traf sie mich unvorbereitet mitten ins Herz. Es ärgerte mich, dass ich nicht wusste, wie ich antworten sollte.
„Eine adäquate Bezeichnung für das zu finden, was uns miteinander verbindet, fällt mir schwer“, wich ich aus.
Vor uns lief eine Gruppe von Frauen in bunten Saris durch die Gasse. Ich fixierte sie, um zu vermeiden, dass Deepali mein Gesicht sah. Aus dem Stück Himmel, das zwischen den Häusern zu sehen war, drückten tiefschwarze Regenwolken auf die Dächer der Stadt. Ich fragte mich, ob wir es trocken zum Hotel schaffen würden.
„Ich kenne ihn zu wenig“, fuhr ich widerstrebend fort, ohne sie anzusehen. „Um ehrlich zu sein. Er ist ein Rätsel für mich. Ich fand ihn faszinierend. Wir hatten gute Gespräche. Vor einigen Wochen hat er ein Stellenangebot in Kinshasa angenommen, wie Sie sicherlich wissen. Seitdem haben wir nur sporadisch Kontakt.“
Deepali blieb stehen. Sie hielt mich so fest am Arm, dass ich mich zu ihr umdrehen musste.
„Entschuldigen Sie Mona, ich wollte Sie nicht verletzen. Ich kenne Chris seit fünf Jahren, aus der Zeit, als er in der Pharmaindustrie gearbeitet hat. Er hatte sich damals gerade entschieden, den Konzern zu verlassen. Er müsse sein Element finden, sagte er mir, den Raum, der sein Raum wäre. Er ist auf der Suche, Mona! Sie müssen das verstehen!“
Sie hakte mich unter und wir schlenderten schweigend weiter.
„So ähnlich hat er es mir auch gesagt.“
Ich hätte das Thema gerne vermieden. Aber sie fuhr fort:
„Ich halte viel von ihm, Mona. Es gibt Menschen, deren größte Stärke es ist, ein Katalysator für andere zu sein. Christopher ist jemand, der anderen hilft, ihr Potenzial freizusetzen. Ohne die Gespräche mit ihm hätte ich es vielleicht nie gewagt, von einer sozialen Organisation zu einem Automobilkonzern zu wechseln.“
Ich sah sie ungläubig an, während sie unbeirrt fortfuhr.
„Er hat eine gute Intuition, und er sieht in Ihnen ein Potenzial, das mein Mann und ich ebenso in Ihnen sehen, Mona. Was immer es ist, ich glaube, Sie sollten dem nicht ausweichen.“
Bei dem Gedanken an die Unterhaltung stand ich kopfschüttelnd vom Bett auf und stellte mich an das leicht geöffnete Fenster, um den Regen zu beobachten, der noch immer wie eine Wand aus Wasser in die Straße vor dem Hotel stürzte. Unbarmherzig riss er alles mit sich: Unrat, Matten, Spielzeugteile, leere Zigarrenschachteln. Was um Himmels willen sollte der Hinweis, dass ich meine Aufgabe finden müsse? Brauchte ich andere, um zu wissen, was ich tun sollte? Zeigte mein bisheriges Leben nicht, ob im Privaten oder im Beruf, dass ich auf keine Hilfe angewiesen war? Schon gar nicht von Menschen, die ich kaum kannte.
Die Regentropfen prasselten auf das gusseiserne Geländer, das den schmalen Balkon vor meinem Fenster umgab. Jeder Tropfen erzeugte eine Fontäne, die das klare Wasser in alle Richtungen spritzte. Was hatte Deepali auf dem Schiff gesagt?
„Frauen werden verändern, wie wir Ökonomie denken.“ Ich hatte sie verwundert angesehen. „Unser Denken heute ist das eines Haben-Wollens und Vermehrens. Ein ständiger Kreislauf in einem Hamsterrad, in dem wir selbst zum getriebenen Tier werden. Das muss sich ändern. Die Wirtschaft der Zukunft wird den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und die Liebe. Genau das werden Frauen tun. Dafür müssen wir kämpfen.“
Sie hatte mich herausfordernd angesehen und die Frage angefügt, ob ich bereit sei für eine Revolution.
Ich schloss das Fenster, als würde dieser Akt dem Regen ein Ende setzen können und nahm den Umschlag mit dem Manuskript vom Nachttisch. Mir war danach, in das Märchen zu versinken und an meine Großmutter zu denken. Ich las:
Ciarán hatte sich früh am Morgen von ihr verabschiedet und war hinunter zum Strand gelaufen, um die Barke zu rufen, die ihn über den See in die Welt jenseits der Insel brachte. Er blieb nie länger als einige Tage, doch dieses Mal war es besonders kurz. Etwas hatte ihn gedrängt, das Morgaine nicht nachzufragen wagte. Sie hatten sich in der Nacht geliebt, und für Stunden ineinander verschlungen wach gelegen, als hätten sie die Zeit anhalten wollen. Nie fragte sie, wann er ginge, wohin er gehen würde, was er tun würde oder wann er wiederkäme. Das war gegen die Regeln der Tradition. Ein Mann war frei zu tun und zu lassen, was er für sinnvoll hielt. Eine Frau war frei, sich jederzeit einen anderen Liebhaber zu nehmen. Morgaine hatte von diesem Recht nie Gebrauch gemacht. Sie begehrte nur Ciarán und hatte nie gefragt, ob er andere Frauen neben ihr hatte. Körperliche Liebe war ein ritueller Weg, die Verbindung mit der großen Kraft zu erneuern. Eine andere Person als Eigentum für sich zu beanspruchen, hätte den Fluss der Energie zerstört. Eifersucht war für sie ein Indiz für einen nicht ausreichend kultivierten Geist. Morgaine lächelte. Aber ich würde es merken, dachte sie, seine Hände würden sich anders anfühlen, wenn er dasselbe mit einer anderen Frau täte. Freiheit bedeutete eben nicht, alles zu machen, was man konnte. Aber es zu dürfen.
Ein verheißungsvoller Herbstmorgen vertrieb den Dunst vom See. Die Sonne bahnte sich einen Weg durch den tiefliegenden Nebel. Zwischen den schwer mit Früchten behangenen Apfelbäumen hatten die Priesterinnen das Gras ein letztes Mal vor dem nahenden Winter geschnitten. Die Ernte der Früchte würde bald beginnen. Sehnsüchtig betrachtete Morgaine den stillen See, auf dem in der Ferne die Barke ihren Geliebten davon trug. Am Ufer reihten die Frauen die Körbe für die Apfelernte auf. Sie lachten und spielten fangen mit den Kindern, die wild umhertobten. Morgaine freute sich über die Unbefangenheit, mit der die Frauen ihrer Arbeit nachgingen. Ihre eigene Lehrpriesterin hatte ihr eingeschärft, dass es innere Haltungen gab, die man als Erwachsener neu lernen musste, um wahrhaftig zu „sehen“. Nur Selbstvergessenheit verbunden mit innerer Aufmerksamkeit half dabei, sich in die Geschehnisse zu finden und so alles in seinem Zusammenhang zu verstehen. Man musste lernen, den Lauf der Zeit als Ganzes zu betrachten, um daraus zu entscheiden, was zu tun war und wie man das Muster eines zusammenwirkenden Geschehens ändern konnte. Morgaine hatte verschiedene Arten ausprobiert, genau das ihren eigenen Schülerinnen deutlich zu machen. Es war nicht einfach zu verstehen. Man musste es erfühlen. Erst die Erfahrung lehrte einen das Prinzip. Am Anfang der Lehrzeit sagte sie immer zu ihren Schülerinnen: „Die Welt entwickelt sich, weil sie beobachtet wird, weil wir sie sehen. Die Wirklichkeit ist kein Faktum, sondern ein Ergebnis dessen, was Menschen sehen, dann benennen und danach tun. Wenn ihr lernt, eure Gabe – wahrhaftig zu sehen – zu entwickeln, tragt ihr eine große Verantwortung.“ Die jungen Frauen, stolz darauf als Priesterschülerin ausgewählt worden zu sein, verstanden das am anfangs nicht. Morgaine seufzte, als sie an die Vergangenheit dachte, in der ihr alles so vertraut und verlässlich vorgekommen war. Die Zukunft hingegen erschreckte sie mit ihrer Ungewissheit. Hoffentlich würde der Besuch bei der Eremitin ihr mehr Klarheit verschaffen.
Mira, ihre treue Dienerin, trat aus dem niedrigen Haus und grüßte ehrfürchtig. Sie hatte für ihre Herrin einen Beutel mit Naturalien gepackt und eine Decke so zusammengerollt, daß man sie tragen konnte. Beides stand schon auf der knorrigen Holzbank an der Hauswand, auf der Morgaine gerne die Morgensonne genoss. Heute war dafür keine Zeit. Sie musste rechtzeitig aufbrechen.
„Für die kühlen Nächte“, sagte Mira in sorgenvollem Ton. „Es ist ja schon Herbst.“
Morgaine nahm ihr Reisegepäck entgegen und bedankte sich.
„Herrin, wollen Sie wirklich alleine gehen?“, fragte die Dienerin zaghaft. Sie war immer unruhig, wenn Morgaine eine ihrer Wanderungen alleine unternahm. Schließlich war diese die Herrin vom See, und es war Miras Aufgabe, dafür zu sorgen, daß sie gesund blieb und ihre Aufgaben wahrnehmen konnte.
„Mach dir keine Sorgen, es ist nicht weit.“
Mira nahm all ihren Mut zusammen: „Darf ich fragen, wohin Sie gehen? Ich meine, falls Ihnen etwas zustößt, dann kann ich Sie suchen!“
Morgaine überlegte, ob Mira sah, was sie selbst nicht sehen konnte. Sie fühlte in sich hinein, aber fand keine Beunruhigung.
„Mira, du musst lernen, mir zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen. Es ist zu viel Sorge in deinem Geist, das hindert dich an deiner Entwicklung. Dieses Mal, sollst du es wissen: Ich gehe zur Eremitin auf den Berg. Ich werde morgen Abend rechtzeitig und gesund wieder da sein.“
Nach dem Gespräch mit Ciarán über die Welt jenseits ihrer Insel hatte Morgaine beschlossen, sich mit der Eremitin zu besprechen und dann den Rat der neun weisen Priesterinnen einzuberufen. Sie wollte wissen, was zu tun sei, um die Insel vor der Welt zu schützen. Da sie die Lösung weder sehen noch erfühlen konnte, erhoffte sie sich eine Hilfestellung der weisen alten Frau, die schon weit länger als sie selbst die hohe Kunst des Sehens ausübte.
Bis zum Mittag wanderte sie über üppige Herbstwiesen. Dann näherte sie sich dem großen dunklen Wald, der den einzigen Inselberg wie einen undurchdringlichen Vorhang aus Dickicht bedeckte und erst kurz vor dem Gipfel eine unwirtliche Gesteinsformation preisgab. Dort, am Ende eines schmalen Pfades, war die Höhle der Eremitin. Als es in der Nachmittagssonne kühler zu werden begann, warf sich die Herrin vom See eine wollene Decke über die Schultern. Sie ging schnellen Schrittes auf den Wald zu, bis sie die Öffnung fand, die wie ein magisches Tor den Weg ins Dickicht zuließ. Sofort spürte sie das heftige Treiben, Eichelhäher kündigten sie an, Rehe stieben aufgeschreckt davon. Ein Fuchs wartete an einem Baum und verschwand erst, als Morgaine näher trat. Sie spürte, wie das kleine Volk sich zuflüsterte, daß die Herrin vom See unterwegs sei, aber es zeigte sich ihr niemand. Ob sie ahnten, warum sie diese Wanderung machte? Ob sie mehr über die Welt wussten, als sie? Das kleine Volk hatte gelernt zu erscheinen und sich zugleich unsichtbar zu machen. Das schützte sie vor der Welt.
Als es zu dämmern begann, setzte sie sich an einen Baumstamm und aß von dem Brot, das Mira ihr mitgegeben hatte. Sie suchte Gras und Zweige zusammen und bereitete sich ein Nachtlager. Durch die Äste der Bäume drang das verhaltene Licht eines Sternenhimmels. Eine zarte Mondsichel stand im Westen über den Wiesen und blinzelte durch den dichten Wald. Eine gute Zeit, um mir Rat einzuholen, dachte Morgaine.
Sie machte es sich unter ihrer Decke bequem und konnte nicht umhin, an Ciarán zu denken. Er hätte alle Voraussetzungen erfüllt, um in den Kreis der Druiden auf der Insel aufgenommen zu werden. Aber er hatte sich anders entschieden. Da er keine Harfe spielen wollte, war er zum Boten zwischen der Welt und der Insel geworden, oder, Morgaine rückte ihre Gedanken zurecht, der Welt jenseits der Insel. Denn die Insel war ja ein Teil der Welt. Noch, dachte sie. In Ciarán steckte ein Krieger, das hatte sie von Anbeginn gefühlt. Er musste kämpfen, auch wenn sie nicht wusste wofür oder wogegen. Er erzählte selten davon, was er tat und was er erlebte. Viel lieber fragte er Morgaine aus und hörte ihr zu. Nur einmal hatte er gesagt, er wäre froh, wenn sie ihn begleiten könnte. Frauen würden nicht auf ihn hören und er könnte sich ihnen nicht verständlich machen. Was er wohl gemeint hatte? Sie war nicht darauf eingegangen, weil sie die Insel nicht verlassen wollte, und Ciarán hatte die Sache nicht wieder angeschnitten. Vielleicht muss ich die Welt besser verstehen lernen, dachte Morgaine, während sie beobachtete, wie die Sterne wanderten. Dann sprach sie ein Nachtgebet, zog die Decke über ihren Kopf und fiel in einen tiefen Schlaf.
Ein Eichelhäher weckte sie im Morgengrauen, als würde er sie vor einer Gefahr warnen wollen. Sie erinnerte sich an einen Traum, in dem sie geflogen war. Ein gutes Omen, dachte sie, rollte die Decke ein und verstaute alles in einem Bündel, um sich auf den Weg zu machen.
Der mit Moos bewachsene Pfad schlängelte sich stetig bergauf durch das Dickicht. Das Zwitschern der Vögel kündete den Sonnenaufgang an. Sie würde vor den ersten Sonnenstrahlen am Waldrand sein. Von dort aus war es nur ein kurzer Weg durch ein lichtes Wäldchen von Krüppeleichen bis zu der Höhle der Eremitin. Als sie aus dem Wald heraustrat, breitete sich eine Wiese voller Morgentau vor ihr aus. Die Baumwipfel leuchteten in der Morgensonne. Morgaine hielt inne, sammelte sich und dachte an den Ort, der ihr Ziel war. Sie sah die Eremitin vor ihrem inneren Auge und kündigte in Gedanken ihren Besuch an. Dann schritt sie beherzt fort, bis der Eingang der Höhle nur noch wenige Schritte entfernt lag. Die Eremitin trat aus dem Dunkel heraus und hob warnend den Krückstock, auf den sie sich gestützt hatte.
„Ich habe lange auf Euch gewartet“, krächzte sie mit heiserer Stimme. Sie setzte sich auf einem Holzblock am Eingang der Höhle und schloss die Augen, als wäre die Anstrengung des Sprechens zu groß. Sie hatte ihr dünnes graues Haar zu einem Zopf zusammengebunden und stützte ihr Kinn auf den Stock. Morgaine grüßte die alte Frau in aller Ehrerbietung. Sie überreichte ihr mit ausgestreckten Händen das für sie mitgebrachte Essen, das diese gierig mit knochigen Fingern ergriff und sich in den zahnlosen Mund stopfte. Malmend und kauend bedeutete sie der Besucherin mit einer Handbewegung, sich zu setzen. Die Tradition verlangte zu warten, bis die Eremitin das Wort ergriff. Nach einem genüsslichen Rülpsen umschlang die Alte ihre Knie, grinste schelmisch und begann in näselndem Tonfall zu sprechen.
„Ihr kommt spät, obwohl Ihr wisst, daß es keine Zeit gibt und die, die jetzt ist, erfordert entschiedenes Handeln“, knurrte sie. „Was bringt Euch erst jetzt her?“
Auf ihrem zahnlosen Gaumen kauend rollte sie bedrohlich mit den Augen. Um ihren Respekt zu bezeugen, blickte Morgaine auf den Boden, während sie sprach..
„Die Welt entwickelt sich in eine andere Richtung, als wir es für sinnvoll halten, ehrwürdige Eremitin. Ich muss wissen, was zu tun ist.“
Nach einer Pause, die Morgaine unendlich erschien, und in der sie ihren Blick nicht vom Boden ließ, begann die Eremitin zu sprechen.
„Die Wirklichkeit ist ein Abbild unseres Geistes. Wenn er gefangen ist, ist die Welt gefangen. Dann wissen wir nicht mehr, daß die Freiheit innen ist. Deshalb führen wir Kriege. Deshalb tun wir uns und anderen Gewalt an.“
Als die Eremitin lange nicht weitersprach, begann Morgaine leise:
„Ehrwürdige Eremitin, ich höre, daß es so ist. Und doch denken wir auf der Insel eine andere Wirklichkeit.“
Die Eremitin fing an schallend zu lachen, und wiegte ihren hageren Köper langsam hin und her, bevor sie in dem gleichen näselnden Ton fortfuhr:
„Herrin vom See, die Insel ist Teil der Welt. Wenn Ihr den Zugang zur Insel erschwert habt, war das richtig, weil es Euch ermöglicht hat, Eure Regeln und Rituale zu bewahren. Aber so sehr Ihr das auch wünscht, Ihr könnt sie nicht bewahren. Die Insel wird untergehen, weil sie dem Gesetz des Lebens gehorcht, wie alles andere. Ihr könnt sie nicht retten.“
Morgaine fühlte eine aufsteigende Beklemmung, die ihr die Kehle zuschnürte. Als Herrin vom See war es ihre Aufgabe, die Insel und damit das Wissen zu bewahren. Diesem Dienst hatte sie als leitende Priesterin den Schwur gegeben. Sie wollte nicht versagen und schluckte, um ihre Tränen zu unterdrücken. Da hob die Eremitin erneut an:
„Alles ist eins, es gibt keine Grenze zwischen der Insel und der Welt. So wenig wie es Zeit gibt. Und doch vergessen die Menschen es mehr und mehr. Daß alles zusammengehört. Daß alles sich zu einem Ganzen zusammenfügt. Daß jedes Denken jedes andere Denken beeinflusst. Daß die Menschen gemeinsam im Denken ihre Wirklichkeit erschaffen.“
Zwischen ihren Sätzen legte sie bedeutungsschwere Pausen ein, als wartete sie auf eine Frage von Morgaine. Aber diese schwieg. Sie kannte die Weisheit von der Einheit der Dinge. Sie war ein wesentlicher Teil ihrer Tradition. Die Eremitin fuhr sich mit ihren bleichen Händen durch das schüttere Haar, als wollte sie dem, was sie zusagen hatte, besonderen Nachdruck verleihen.
„Die Menschen jenseits der Insel haben begonnen, in Gegensätzen zu denken, und so werden noch mehr Gegensätze entstehen. Aus diesen Gegensätzen werden Kämpfe entstehen. Gewalt wird sich verbreiten und das wird zu neuen Gegensätzen führen. Alle Versuche, die Gegner auszulöschen, werden nur zu neuen Gegnern führen. Daraus werden viele Dinge entstehen und Erkenntnisse geboren, die den Menschen in ihrer Entwicklung helfen werden. Aber das Leid wird vermehrt, die Gewalt wird wachsen. Die Trauer wird eine tägliche Begleiterin sein.“
„Was können wir tun?“ Morgaine unterdrückte ihre Furcht.
„Es wird eine Sphäre der Gegensätze geben und es wird eine Sphäre des Absoluten geben. Die Menschen werden in ihrem Inneren immer das Absolute suchen, aber sie werden nicht wissen, wie sie es benennen sollen.“
„Was können wir tun, ehrwürdige Eremitin?“ wiederholte Morgaine ihre Frage drängender.
„Ihr könnt die Insel nicht bewahren, Herrin vom See. Jedoch müsst ihr das Wissen um das Absolute bewahren. Tragt es in die Welt! Verbreitet es! Findet die Form, die es schützt und die jeder Mensch versteht.“
„Ihr meint, wir sollen die Insel verlassen? Ist die Gefahr nicht zu groß?“
„Die Essenz Eures Wissens sollt ihr bewahren. Nicht die Rituale“, setzte die Eremitin ihre Rede fort, ohne auf Morgaines Frage einzugehen. „Das ist alles, was ich Euch zu sagen habe, Herrin vom See. Geht und nehmt meinen Frieden.“
Morgaine senkte den Kopf. Es war eindeutig, sie würde nicht mehr erfahren. Enttäuscht erhob sie sich und verbeugte sich neun Mal vor der Eremitin, die zusammengesunken und mit geschlossenen Augen da saß und sie mit einer schwachen Handbewegung segnete. Sie drehte sich um und verließ mit bedächtigen Schritten die Höhle.
„Wartet“, rief die Eremitin ihr hinterher. „Ein Wort noch. Wenn Ihr das Wissen um das Absolute bewahren wollt, müsst Ihr die Welt lieben, wie sie ist.“
Ich schob das Manuskript in den Umschlag zurück und streckte mich. Was für eine merkwürdige Geschichte. Ich knipste die Leselampe am Bett aus und lag im dunklen Raum wach, in den vom Fenster her ein blasser Schimmer der emsigen Stadt drang. Mumbai schien selbst bei Sturmgewitter keine Pause einzulegen. Der Regen hatte nachgelassen, vom Trommelgeräusch war nur ein gleichmäßiges Tropfen geblieben, das auf mich einschläfernd wirkte. Morgen früh würde ich im Flugzeug nach Chennai sitzen. Der Personalleiter unseres indischen Werkes würde mich am Flughafen erwarten, um mich auf der Fahrt in die Stadt über eine schwierige Personalangelegenheit zu informieren. Fast freute ich mich darauf, wieder in die Welt des Konzerns einzutauchen. Ich sehnte mich danach, die Mona zu sein, die in schwierigen Situationen Lösungen fand und schnell komplexe Fragen beantworten konnte.