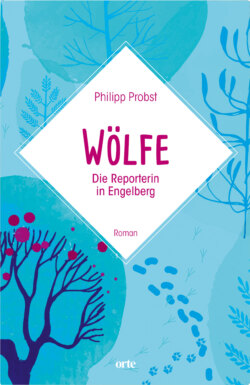Читать книгу Wölfe - Philipp Probst - Страница 5
PROLOG
ОглавлениеSie konnte den kleinen Plüschbären nicht wegwerfen. Das brachte sie nicht übers Herz. Sie hielt ihn, drückte ihm einen Kuss auf die Schnauze und legte ihn in die Kuschelecke ihres Sofas zu den anderen Tieren.
Sechsundzwanzig Stofftiere waren es mittlerweile: acht Bären, vier Hunde und vier Katzen, je ein Reh, Fuchs, Wolf, Hase, Igel und Elefant, eine Giraffe, ein Schimpanse, ein Walfisch und ein Hai. Marlène besass einen ganzen Zoo.
Auch die Rose, die neben dem Bären vor ihrer Wohnungstür gelegen hatte, konnte sie nicht einfach in den Müll werfen, schliesslich war es eine Pflanze, ein Lebewesen. Wie so oft zuvor stellte sie sie in einer kleinen Vase auf den Balkon. Dort waren sie aus ihrem Blickfeld. Denn sie betrat den Balkon nur noch selten. Und in nächster Zeit gar nicht: Sie würde eine längere Zeit abwesend sein.
Marlène schlüpfte in ihre neuen Skihosen, in ihre neue Daunenjacke, setzte die neue Wollmütze auf und zog sie tief ins Gesicht. Sie prüfte im Spiegel, ob wirklich keine einzige Strähne ihrer dunkelblonden Haare zu sehen war. Schliesslich setzte sie die grosse, neue Sonnenbrille auf und ergriff ihren vollbepackten und ebenfalls neuen Rucksack und verliess das Haus.
Sie hatte schon so viel unternommen, um sich vor ihm zu schützen. Jetzt diese Flucht. Aber es war ihr klar, dass er sie trotz ihrer Verkleidung, ihrer neuen Identität, die sie sich zu geben versuchte, erkennen würde, falls er irgendwo auf der Lauer lag. Er würde sie an ihrem Gang erkennen. Deshalb versuchte sie, möglichst grosse Schritte zu machen, was aber unnatürlich aussah. Zudem fiel sie, wenn sie eine Strasse überqueren und auf den Verkehr achten musste, immer wieder in ihren gewohnten Schritt zurück. Sie wurde nervös. Wollte zurückschauen, ob er ihr bereits folgte. Aber sie zwang sich, sich nicht umzudrehen.
Erst als der Zug anfuhr und sie den ganzen Wagon abgecheckt hatte, fühlte sie sich besser und etwas sicherer. Sie nahm die Mütze ab, schälte sich aus der Jacke und nahm die Sonnenbrille von der Nase, die sie gar nicht gebraucht hätte. Es war noch früh am Morgen, dunkel und wolkenverhangen.
Als sie in Luzern umsteigen musste, zog sie alles wieder an, ging mit grossen Schritten den Perrons entlang. Sie schaute weder links noch rechts noch zurück.
In Engelberg regnete es leicht. Trotzdem behielt sie die Sonnenbrille auf und marschierte los. Marlène ging durch den Touristenort, der an diesem Novembertag wie ausgestorben wirkte, blickte aber auch jetzt weder nach rechts noch links, immer nur nach unten, ab und zu geradeaus, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Sie passierte das imposante Kloster mit der integrierten Stiftsschule, kam an der Talstation der Brunni-Seilbahn vorbei und bog kurz darauf in die Strasse Richtung Horbis ein. Eine Pause gönnte sie sich erst, als sie den Wald erreichte. Sie atmete tief durch und wagte einen Blick zurück.
Es war niemand zu sehen.
Sie nahm die Sonnenbrille ab und konnte weiterhin keinen Menschen erspähen. Sie ging weiter. Nun getraute sie sich, ihren gewohnten Gang zu gehen: kurze, schnelle Schritte. Das erleichterte den Fussmarsch. Marlène konnte sich etwas entspannen und ihren Blick geradeaus richten. Nur wenn ihr ein Auto entgegenkam oder sie überholte, wurde sie nervös, setzte die Brille auf und schaute nach unten auf den nassen Asphalt. Aber keiner der Autofahrer stoppte und kümmerte sich um sie.
Schliesslich erreichte sie hinten im Talkessel den kleinen Weiler Horbis, kam an der Kapelle vorbei und verliess beim Restaurant Bergfrieden die Strasse. Ein schmaler Weg führte sie weiter durch einen Wald, dann durch eine steile Furche entlang eines Bachs. Sie atmete heftig. Sie musste stehen bleiben. Aufschnaufen. Niemand folgte ihr. Rechts erblickte sie die Höhlen in den Felsen. Und sie erinnerte sich an ihre Kindheit, als sie mit ihren Brüdern darin Verstecken gespielt hatte.
Sie erreichte das Haus. Es war kurz nach Mittag. Es regnete zwar nicht mehr, aber die Wolken hingen noch immer tief. Der mächtige Titlis, der auf der gegenüberliegenden Seite des Engelbergertals zu sehen sein sollte, war vollständig verhüllt. Auch der markante Gipfel hoch über dem Haus, der 2606 Meter hohe Felsklotz Hahnen, war in den Wolken versteckt. Ob es dort oben schon geschneit hatte?
Sie kramte den Schlüssel aus der Jacke, stieg die Aussentreppe zur Terrasse hinauf und betrat die Hütte. Sie war direkt in den steilen Hang gebaut, der hintere Teil war im Berg verankert. Der obere Stock der Hütte wurde als Ferienwohnung genutzt, im unteren hauste in den Sommermonaten der Senn. Daneben befand sich eine zweite Hütte. Es war der Stall, in dem alle Geräte und Werkzeuge untergebracht waren.
Marlène stellte den Rucksack ab, öffnete einen Fensterladen und schaute sich um. Alles war so, wie sie es erwartet hatte. Die Stühle ruhten verkehrt herum auf dem Holztisch, auf der kleinen Küchenkombination lagen die Tücher perfekt zusammengefaltet neben der Spüle. Im Schaft lagerten Lebensmittel in Büchsen, die Etiketten nach vorne gerichtet. Es waren viele Büchsen. Typisch für ihre Mutter, sie bunkerte nicht nur zu Hause, sondern auch im Ferienhaus Lebensmittel für mehrere Wochen. Nun stellte Marlène ihre lang haltbaren Esswaren dazu. Randen- und Selleriesalate in Tüten, getrocknete Bohnen, Teigwaren. Die uperisierte Milch, Kaffeerahm, Käse und Trockenfleisch deponierte sie draussen auf dem Sims zwischen Fenster und Laden.
Neben dem Cheminée lag das gespaltene Holz minutiös aufgestapelt, die Anfeuerpaste und die Zündhölzer waren daneben platziert. Sie schaute kurz ins Kinderzimmer mit den zwei Doppelstockbetten und erinnerte sich daran, wie sie sich mit ihren Brüdern immer wieder darum gestritten hatte, wer von den drei Geschwistern unten schlafen musste. Meistens war sie es, die Älteste.
Ein Lächeln huschte über ihre Lippen.
Im dritten Raum, dem Schlafgemach ihrer Eltern, waren die Betten wie auch die Kommode mit Leintüchern zugedeckt. Über der Kommode hing das alte Sturmgewehr ihres längst verstorbenen Grossvaters an der Wand. Ob ihr Vater auch irgendwo Munition versteckt hatte?
Es roch muffig. Sie öffnete das Fenster, die Läden und schaute hinaus in die wolkenverhangene Landschaft und den dunklen Tannenwald.
Sie fühlte sich in Sicherheit.
Ihr Schlaf war unruhig. Sie hörte immer wieder Geräusche. Aber sie konnte sie zuordnen. Der Wind liess die Bäume hin und her wippen, das Holz der Hütte knarrte, und die Schritte, die sie zu glauben hörte, bildete sie sich nur ein. Zumindest versuchte sie, sich das einzureden. Sie würde sich mit der Zeit daran gewöhnen. Niemand würde hierherkommen. Niemand würde sich zu dieser Jahreszeit hierher verirren. Niemand wusste, dass sie hier war. Schon gar nicht er.
Doch auch in der zweiten Nacht lag sie meistens wach. Oder sie sass dick eingepackt und mit Wollsocken an den Füssen vor der fast erloschenen Glut im Cheminée und versuchte, ein bisschen Wärme aufzunehmen. Trotzdem zitterte sie.
In der dritten Nacht konnte sie es nicht mehr schönreden, Marlène hatte eine furchtbare Angst. Sie zweifelte ernsthaft, ob ihre Idee gut war: sich eine Zeit lang in die Einsamkeit zurückzuziehen, zu sich selbst zu finden, Tagebuch zu schreiben, in der Natur zu sein und den ganzen Horror der letzten Monate zu verarbeiten.
Sie wollte nicht aufgeben. Aber sie änderte den Tagesablauf. In der vierten und fünften Nacht liess sie das Feuer und die Petroleumlampe brennen, sass am Tisch und schrieb. Erst gegen Morgen legte sie sich schlafen. Zumindest für drei, vier Stunden. Das klappte gut.
In der sechsten Nacht – sie war gerade in ihr Tagebuch vertieft – hörte sie plötzlich ein Kratzen, ein Scharren, ein Rumpeln. Sie wagte kaum zu atmen. Sie blies die Lampe aus. Die Glut in der Feuerstelle tauchte die Hütte in schwaches, rötliches Licht. Alles war wieder still. Sie erhob sich und packte ihre Taschenlampe. Sie öffnete die Türe und linste vorsichtig hinaus.
Sie leuchtete den Bergweg hinunter. Nichts. Sie fuhr mit dem Lichtkegel die Weide ab, auf der im Sommer die Kühe grasten. Nichts. Sie suchte den Wald ab. Nichts. Als sie die Taschenlampe auf die Wipfel der Bäume richtete, sah sie, dass diese weiss gepudert waren. Es hatte geschneit.
Sie schloss beruhigt die Türe, verriegelte sie und legte sich schlafen. Als sie gegen zehn Uhr aufwachte, sah sie, dass auch auf der Weide und am Boden ein Hauch Schnee lag. Sie zog sich an und ging nach draussen. Sie suchte nach Spuren. Wenn jemand in der Nacht da war, müsste er Fussabdrücke hinterlassen haben. Doch ausser Tierspuren fand sie nichts. Sie ging den Bergweg ein Stück hinunter bis zur Verzweigung. Es gab zwei Wege nach Engelberg: jenen über das Seitental Horbis, den sie gegangen war, und jenen direkt hinunter ins Engelbergertal. Beide waren etwa gleich lang. Sie schaute ganz genau auf die beiden Wege. Doch sie fand keine Spuren.
Marlène ging zum Haus zurück, öffnete den Fensterladen und nahm die Milch, den Käse und das Trockenfleisch in die Hütte hinein und gönnte sich ein ausgiebiges Frühstück. Plötzlich schien ein Sonnenstrahl in die Stube. Sie beendete ihre Mahlzeit, legte die Lebensmittel zurück auf den Fenstersims, verriegelte den Laden, zog ihre dicken Kleider an und machte einen Spaziergang. Die Wolken verzogen sich. Die Sonne wärmte und liess den Schnee schnell schmelzen.
Nun hatte sie freie Sicht auf Engelberg und ins Engelbergertal. Auch der 3238 Meter hohe Titlis strahlte hell. Der Gletscher war zugeschneit. Schnee lag auch auf dem Stand, der Zwischenstation der Titlisbahn. Von dort fährt die grosse Schwebebahn, die Titlis-Rotair, hinauf zum Klein Titlis, dem Nebengipfel des Titlis. Im Winter transportiert die Bahn die Skifahrer und im Sommer viele asiatische Touristen, die einmal in ihrem Leben Schnee anfassen wollen, in alpine Höhen.
Der Spaziergang tat ihr gut. Sie fühlte sich besser, leichter, selbstbewusster. Sie fühlte sich bestätigt: Ihr Plan war gut. Das Schreiben, die Einsamkeit, die Natur – all das stärkte sie, heilte ihre Seele. Sie war auf dem richtigen Weg.
Weil sie der ausgedehnte Spaziergang ermüdet hatte, ging sie an diesem Abend früher zu Bett und schlief sofort ein.
Sie erwachte, weil sie ein Knarren hörte, ein Kratzen. Eindeutig. Sie glaubte, es mache sich jemand an der Türe zu schaffen.
War er hier?
Sie bekam eine Höllenangst. Sie wagte kaum zu atmen. Aber es war still.
Doch plötzlich war es wieder da, dieses Geräusch! Rüttelte jemand am Fensterladen?
Wieder Ruhe.
Sollte sie sich verstecken? Wo? Im Kinderzimmer? Unter einem Bett? Nein, er würde sie finden! Was würde er mit ihr machen? Sie töten? Sie quälen?
Marlène schaute sich um. Gab es einen Gegenstand, den sie als Waffe einsetzen und ihm auf den Kopf schlagen könnte? Das Gewehr! Der alte Karabiner ihres Grossvaters! Wo aber war die verdammte Munition?
Sie hatte keine Zeit, danach zu suchen. Sie eilte ins Schlafzimmer, nahm das Gewehr von der Wand und ging zur Türe. Sie schloss sie auf, gab ihr einen Tritt und zielte mit dem Karabiner in die Nacht hinaus. Sie hörte ein Rascheln. Sie nahm die Taschenlampe, trat hinaus in die Nacht. Sie leuchtete den Weg hinunter. Nichts. Die Weide. Nichts. Sie liess den Lichtkegel langsam entlang des Waldrands streifen.
Dann sah sie es: Etwas reflektierte den Schein ihrer Taschenlampe. Ganz schwach. Augen? Reflektoren eines Kleidungsstücks? Sie schwenkte mit der Taschenlampe zurück. Sie zitterte.
Es war nichts mehr zu sehen.
Aber nun wusste sie: Sie war nicht allein.