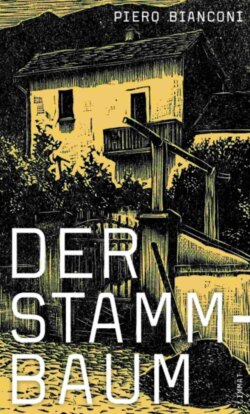Читать книгу Der Stammbaum - Piero Bianconi - Страница 15
2 Mergoscia
ОглавлениеMärz 1966
Ich bin nach Mergoscia hinaufgestiegen, denn mich verlangte darnach, etwas aus der Vergangenheit wiederzufinden; nicht nur Erinnerungen an mich als Knaben, der ich ab und zu ein paar Wochen dort oben verbrachte, und der ich oft hinging, um die Grosseltern und die Onkels zu besuchen. Jetzt aber finde ich mich zwischen den Häusern des hochgelegenen Weilers, im «Benitt», wo meine Vorfahren lebten und von wo meine Eltern herkamen, nicht mehr zurecht. Von den Leuten, die ich dort kannte, blieben kaum zehn Personen übrig, und sie bieten keine Gewähr für Nachkommenschaft. Die Feuerstellen in den Häusern sind dazu bestimmt, zu verlöschen. Zwischen den verlassenen Häusern ohne Dächer, die Mauern sind oft gut gebaut, aber sie stürzen trotzdem entmutigt ein, zwischen jenem strengen Grau des Steins und den Schornsteinen, die seit Jahrzehnten nicht mehr rauchen, steht ab und zu ein wieder aufgebautes oder auch ein ganz neues Haus, und zwischen dem abgestuften Silbergrau der Steinplatten sind rote Flecken von Ziegeln zu sehen. Von dieser Handvoll Häuser, sagt man mir, sind gut fünfzehn im Besitz von Deutschschweizern, die hier ihre Ferien verbringen; ja einige wohnen sogar dauernd hier.
Es ist März. In einem dunkeln und feuchten Durchgang zwischen den Häusern blüht Seidelbast, ein schmächtiges Zweiglein mit seinem lieblichen Duft. Draussen in den abschüssigen Wiesen steigen hellblaue Rauchsäulen auf. Man hört niemanden, nur das Aufflattern eines Vogels. An einigen Stellen erkenne ich noch die abgewetzten Steine, geglättet von unendlich vielen Schritten; jenen bläulichen, weiss geäderten, und die Treppenstufe, die unter dem Fuss wackelt wie vor sechzig Jahren. Und das hier sind die Stufen, auf denen die genagelten Schuhe des Grossvaters erklangen, worauf denen im Haus die Worte im Mund erstarben. Ich finde tausend Dinge wieder, aber das Bild von einst finde ich nicht mehr. Das Weiss des Verputzes blendet im sonnigen Hof des Grossvaters Rusconi und verjagt die dünnen Schatten der vielen Toten. Alles ist viel zu sauber. Und auch der Geruch ist derjenige fremder Leute. Es bleibt nur das naive Fresko auf der Mauer, die Mutter Gottes, die den toten Sohn im Schoss hält und die einst einer meiner Vorfahren im 18. Jahrhundert malen liess.
Ich stehe da und suche ein Zeichen aus früheren Zeiten, einen Hinweis, der mir die erschreckende Last der Vererbung erklärte, diesen Wirrwarr aus Müdigkeit und Kraft, aus Kühnheit und Zaghaftigkeit, aus Bosheit und untätiger Güte, die mein Wesen ausmachen. Ich suche etwas, das mir erklärte, weshalb ich auf den Schultern so etwas wie eine unendliche, auf der Spitze stehende Pyramide von Menschen zu tragen meine: Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern, Vorfahren ohne Antlitz, eine ganze anonyme Masse. Und weshalb ich ein erdrückendes Gewicht verspüre, körperliche und geistige Lasten, lang vergangene Falten und Wunden, die ich nicht beseitigen kann. Es ist ein Eindruck, der mit den Jahren immer stärker wird. Die oberflächlichen Anwandlungen, der dünne Firnis der Erziehung und Erfahrung, die weniger wesentlich sind, als man glauben möchte, verschwinden. Etwas Tieferes und Wahreres enthüllt sich. Eine geheime Schichtenbildung, fast so etwas wie eine moralische Geologie, kommt zum Vorschein. Wiederum müssen Schmerzen erlitten werden, die unheilbar bleiben, weil sie alt und anonym sind, und ebenso Demütigungen, Leiden und Mühsale. Wiederum müssen die Knochen alle Müdigkeiten der Ahnen erfahren. Und es gibt keine Ruhe, die sie stillen könnte. Sie sind im Blut, zuinnerst im Fleisch.
In den Häusern der Bianconi, der Grosseltern väterlicherseits, ist nichts mehr vorhanden, weder Papiere noch irgendein anderer Hinweis oder ein Schriftstück. Die Häuser sind veräussert worden. Alles ist zerstört. Die wenigen Papiere wurden von fremden Händen dem Feuer überantwortet.
Als Knaben gingen wir oft unsere Tante Nina besuchen, die dort allein lebte. Sie war klein, ein wenig verkrümmt, wachsgelb und hatte einen einzigen grossen blanken Zahn im Mund. Sie allein war übrig geblieben, um den Herd zu hüten. Über dem Feuer stand andauernd der bronzene Kaffeetopf. Und dort flüsterte sie ihre Requiem eterna und ihre Gebete für die Lebenden und Toten und räusperte sich und spann dabei – arm und gütig wie sie war – ihren Rocken leer. Sie erzählte, als ihre Mutter (die Grossmutter Mariorsola, wir nannten sie MammarÌa, und ein Bildnis von ihr hält meine Erinnerung an sie wach) im Sterben lag, hätte sie sie gebeten, ihr eine Erinnerung zurückzulassen, ein Wort, einen Ratschlag, eine Lebensregel. «Tu allen Leuten Gutes!», sagte die Grossmutter zu ihr. Und nach einer Weile, als sie sie nochmals um dasselbe bat, erhielt sie die gleiche Antwort: «Tu allen Leuten Gutes!» Und das tat sie denn auch immer. Selber arm und elend, fand sie Mittel und Wege, denen, die noch elender waren, mit ihrer stets kräftigen Mildtätigkeit zu helfen: mit einer Schüssel voll Minestra, ein wenig Brot, einem guten Wort. Sie hatte sich, wer weiss unter wie viel Entbehrungen, dreissig Franken gespart, drei halbe Taler, um sich ein Kleid schneidern zu können. Dann aber gab sie sie dem Pfarrer, damit er sie nach Indien sende und den Hunger der Ärmsten dort drüben stille …
Sie trug noch die alte Tracht, den Rock und die Schürze dicht unter der Brust gegürtet, und das kurze Mieder, das sich über dem Weiss des aus Hanf gesponnenen Hemdes öffnete. Sie war Asthmatikerin und verbrachte ganze Sommernächte unter einem grossen Birnbaum neben dem Haus. Immer empfing sie uns voller Freude, immer hatte sie einen Apfel, eine Birne oder eine Handvoll gerösteter Kastanien für uns bereit. Sie wunderte sich nie, wenn sie uns unversehens kommen sah: «Ich wusste, dass jemand kommen würde; heute Morgen hat das Feuer gepustet!» Dort neben dem Feuer kauerte sie und hörte ihm zu und deutete es. Auch sprach sie mit den Toten und den weit entfernt Lebenden, mit den Brüdern, die sich dann und wann ihrer erinnerten. Mein Vater hielt ihr immer ein kleines Fässchen voll Wein bereit. Sie starb im Jahre 1922, als sie 68 Jahre alt war.
Auch vom Grossvater Francesco Bianconi, dem Pà Cecc, gibt es eine vergrösserte Fotografie. Eine andere Erinnerung habe ich nicht an ihn. Er starb im Jahre 1904, als ich fünf Jahre alt war. Er war 84 Jahre alt geworden. Es ist in unserer Familie zur Gewohnheit, ja, fast zur streng eingehaltenen Tradition geworden, sich spät zu verheiraten. Das dehnt und verlängert die Intervalle zwischen den Generationen und schafft erschreckend grosse Abstände … Aus dem Bildnis schaut mich ein schönes, klares, heiteres Gesicht an; der Mund ist ein bisschen ironisch, die Stirn ist hoch, und das Haar fällt lang zu beiden Seiten des Kopfes herab. Auch er hatte versucht, das Glück zu erproben, aber es war ihm nicht gelungen. Er hatte sich nach Australien eingeschifft, doch war er eiligst wieder zurückgekehrt, vielleicht sogar auf demselben Segelschiff, und hatte somit nichts nach Hause gebracht als die Schulden für die Reisespesen, die Musse langer Monate auf dem Meer und die verlorene Zeit.
Er war ein scheuer und sanfter Mensch. Als Scherenschleifer zog er durchs Land, besonders durch die Täler bei Lugano, wo bis vor einigen Jahren die Alten sich seiner noch erinnerten. Mit seinem Schleifrad schlief er in den Heuschobern und sparte sich alles vom Munde ab, um die Familie durchzubringen: jeden Becher Wein, jeden Bissen, der nicht unumgänglich nötig war. Als er dem Haus ein paar kleine Kämmerchen anbauen lassen musste, weil die Kinderzahl wuchs, mass er die Höhe der Türe und des Küchenplafonds an seiner Gestalt. Er war ein sehr kleines Männchen, und so musste man sich, wenn man eintrat, bücken, und auch drinnen konnte man nur zwischen den Deckenbalken aufrecht stehen. Aber der Tante Nina ging es dort gut, denn auch sie war klein und von den Jahren und Krankheiten bucklig geworden. Der Grossvater Bianconi war ein weiser Mann, er beschied sich mit dem wenigen, das er besass, oder war sogar zufrieden mit nichts. Er mass alles an seiner klösterlichen Genügsamkeit. Er passte den Schritt seinen Beinen an oder nahm ihn sogar noch ein bisschen kürzer, als die Beine es waren. (Was sicher nicht die beste Art ist, die Beine länger werden zu lassen.) An dieser niedern Tür kann man ein Lebensprogramm ablesen, ein fast horazisches Lebensbekenntnis, einen Sinn fürs Masshalten, der vielleicht nicht möglich ist ohne ein bisschen Egoismus. (Diese Tugend ist bei den Nachfahren nicht ganz verloren gegangen. Mein Vater hat sie geerbt und sein ganzes Leben lang wert gehalten …)
Aus dieser Tür sind mein Vater und zwei seiner Brüder herausgetreten, um nach Amerika auszuwandern. Nur der jüngste Bruder, Pietro – er soll sehr intelligent gewesen sein –, ist Lehrer geworden und zu Hause geblieben.
Aber nicht einmal von Onkel Pietro ist etwas auf uns gekommen. Nur durch Zufall ist es mir gelungen, ein schmales Heft mit der Reinschrift italienischer Aufsätze aus dem Jahre 1879/80 ausfindig zu machen. Ferner sein Lehrerdiplom vom 24. Juni 1883, das vom Direktor F. Antognini und vom Staatsrat Marino Pedrazzini unterzeichnet ist. Ein schönes Lehrpatent mit lauter Zehnern (ein Vorwort erklärt: «Die Note zehn entspricht den besten Leistungen»), und nur einer Neun (beinah höchste Leistung) in Kalligrafie und im Singen. Fürs Turnen hat er keine Note erhalten. Es heisst, er sei als Knabe von einem bösen Hund erschreckt worden; davon war er ungelenk und ein wenig bucklig geworden. Jener Rektor Antognini hatte die Brüste der Caritas, die sie ihrem Tugendamt gemäss im Refektorium des Franziskanerklosters, das zum Lehrerzimmer geworden war, einem nackten Knäblein reichte, prüde verschleiern lassen. Dieser unbedeutende Vorfall kennzeichnet das Klima der Schule, wie man es in den Aufsätzen Onkel Pietros wiederfindet. Sie sind von einer rhetorischen Unaufrichtigkeit, die einen ärgert und zugleich zum Lächeln reizt; eitle Wortspielereien. Doch bei einem der ersten Aufsätze, mit dem Titel «Stellt euch die Aufgabe, einen eurer Verwandten oder Freunde über die wenigen bisher verbrachten Schultage zu unterrichten, und fügt irgendeinen weiteren Bericht hinzu, den ihr als passend erachtet» muss man bedenken, dass mein Onkel damals fünfzehnjährig und eben erst aus seinem Bergdorf heruntergekommen war; dort liest man nämlich ein paar Sätze, die aufrichtig klingen: «Ich tue hiermit kund, dass ich dieses Jahr hier in Locarno ins kantonale Gymnasium aufgenommen wurde. Ich überlasse es dir, dir vorzustellen, wie sehr ich mich am Anfang schämte, denn keiner kannte mich, und alle schauten mich an, und ich war sehr verwirrt, als ich mich so von all den Schülern umgeben sah und keinen einzigen kannte! Dennoch fasste ich Mut und antwortete, so gut ich es konnte, auf die Fragen des Herrn Professor. Jetzt aber kenne ich meine Gefährten schon … Wir sind etwas mehr als zwanzig Schüler und haben drei Stunden Schule im Tag.»
Daraus spürt man so recht die Empfindung der Scham und der Demütigung des wer weiss wie gekleideten Knaben, der darüber hinaus auch körperlich ungelenk war und mitten unter den kühnen Gefährten stand. Doch drei Jahre später war er der Tüchtigste von allen.
Er war nur ein Jahr lang Lehrer, ich glaube in Cugnasco. Dann starb er zwanzigjährig, im Jahre 1884.
Wenn sich im Haus der Bianconi nichts mehr finden lässt, so ist glücklicherweise im Haus der Grosseltern mütterlicherseits, bei den Rusconi, manches erhalten geblieben. Es waren dies weniger armselig lebende Leute und sie waren der Erde fester verhaftet. In der sonnigen Loggia, wo wir nicht lasen, nein, nur die Bilder in den Zeitungen anschauten, die der Onkel Gottardo aus Kalifornien erhielt, die bunten cartoons mit den Karikaturen, die wir dann auf den Seiten des «Corriere dei Piccoli» wiederfanden, Happy Hooligan, verwandelt in Fortunello, dort war eine Truhe erhalten geblieben, ein Schrein mit alten Papieren. Es waren notariell beglaubigte Dokumente, Verträge, Empfangsbestätigungen, aber vor allem Briefe, viele Briefe aus Australien und Amerika. Die Briefe der Auswanderer und oft sogar auch die Briefe von zu Hause, die der Ausgewanderte ehrfürchtig zurückgebracht hatte, als er heimkehrte. Kurz, ein ganzes Familienarchiv. Alte vergilbte Papiere voller Wasserflecken (und die Kopiertinte bringt Effekte zustande, wie sie der Tachismus bevorzugt). Regengüsse hatten die Truhe manchmal durchnässt, doch glücklicherweise war sie von Mäusen verschont geblieben. Diese Papiere sind uns erhalten. Nicht, dass sie ganz unbekannt gewesen wären. Irgendjemand hat vor mir schon den kleinen Schrein durchstöbert – nicht mit eitel Neugier bewehrt wie ich, sondern mit einer nützlichen Schere – und hat alle Briefmarken akkurat herausgeschnitten, sich um das Geschriebene aber nicht gekümmert. Dieses besass keinen Handelswert. Und ausserdem war es ein Ergebnis der Traurigkeit, voll vom Geruch der Einsamkeit und der Mühsal.
Es ist typisch für die weniger Armen unter den Armen, dass sie hartnäckig alles beiseitelegen und nichts, aber auch gar nichts fortwerfen, nicht einmal einen verrosteten Nagel. Alles könnte noch einmal zu etwas dienen, man kann nie wissen … Leute, welche in der Bedrängnis leben, bewahren nichts auf. Sie können nur das dringend Notwendige behalten. Sie leben ein Dasein, das keine Schichtenbildung erlaubt. Es sind Menschen ohne Geschichte, sie werden sogleich ausgelöscht. Während die knauserige Ehrfurcht, welche Papiere und Briefe aufbewahrte, mir gestattet, die Vergangenheit ein wenig abzuschreiten, in der Zeit zu graben, eine Gestalt oder eine Tat meiner Vorfahren wieder aufzufinden, aus ihrem mühevollen Dasein ein paar Fragmente zu rekonstruieren. Kurz – Geschichte zu schreiben.
Die Geschichte armer Leute, welche durch die Welt zogen, mit nichts anderem bewehrt als ihren Armen, lauter Tagelöhner am Anfang, dazu verurteilt, den Esel zu spielen, wie der Grossvater Barbarossa schreibt, und sich mit elenden Löhnen zu begnügen. Sie kannten die Sprache des fremden Landes nicht und waren in ihre blasse, schweigsame Mühsal eingemauert. Es sind magere Briefe, gewöhnlich wenig mehr als ein Gestammel, und sie kamen selten ins Haus, wo sie gierig erwartet wurden. Manchmal lagen Jahre des Schweigens dazwischen. Sie beginnen alle mit dem stereotypen Anfang, der unverändert blieb und eigentlich sinnlos war: «Ich gebe euch Nachricht von meiner guten und erfreulichen Gesundheit und hoffe zu Gott, dass auch ihr gesund seid.» Es muss eine Formel gewesen sein, die sie in der Schule gelernt hatten, wer kann sagen, wie man dieses «erfreulich» erklären soll. Denn wenige Zeilen weiter unten sprechen sie von elendiglicher Gesundheit, von Krankheiten …
Man spürt die Behinderung der Hand, die nicht an die Feder, sondern an die Spitzhacke gewöhnt war, und die Schwielen trug vom Melken der Kühe, unendlich vieler Kühe. (Und ich erwerbe mir hier Schwielen an den Fingern, indem ich die Tasten der Schreibmaschine betätige …) Oft besassen sie nicht einmal die materielle Möglichkeit zu schreiben. Sie lebten draussen an abgelegenen Orten, in weit entlegenen «Ranches». Doch nur selten sprechen sie von der Mühsal, von dem langen Arbeitstag, der begann, wenn die Sterne verblichen und mit dem Auftauchen der Sterne endete, oder von den Demütigungen, von der Einsamkeit; denn sie waren nicht fähig, sich mitzuteilen, oder mochten vielleicht auch die Lieben zu Hause nicht beunruhigen. Sie sprechen vom Wetter, diesem fundamentalen Thema, dieser immerwährenden Sorge, vom Wetter, welches die guten oder schlechten Ernten bestimmt. Von Monaten eintönigen Lebens, von endloser Trockenheit, von aussergewöhnlicher Kälte und so weiter. Sie sprechen von ihren Landsleuten, von den Patriotti, die sie ab und zu treffen, von irgendeiner frohen Stunde, die sie gemeinsam verbringen, von jemandem, der – angelockt von dem fernen Schimmer des Goldes – herüberkommt (und immerzu kamen welche herüber), und der Nachrichten bringt von zu Hause; von einem Gefährten, der zufrieden oder enttäuscht abreist und von der ewigen Sorge ums Geld, von – verglichen mit der Mühe – mageren Löhnen. Und wenn sie zu Anfang ein paar Batzen zusammensparten, geschah es, weil sie rein nichts ausgaben, weil sie sich bis zum Letzten mit wenig begnügten, um die Reiseschuld abzahlen zu können. Die Summe wurde ihnen gewöhnlich von der Gemeinde vorgestreckt. Und um etwas nach Hause schicken zu können, damit die Zurückgebliebenen fröhlich seien. Oft beklagen sie sich über fehlende Arbeit, über elende Jahre, in denen sie keinen Rappen beiseitelegen können. Es sind Briefe, die sich um wirtschaftliche Fragen drehen. Aber nie erklingt ein Aufschrei der Empörung oder eine Verwünschung. Es ist die stumme Hartnäckigkeit der Ameise: schweigen und büffeln. Nie ein Jammern, ausser über die ersten Zeiten, weil sie die Sprache nicht können, was sie inmitten der Leute grausam isoliert. Ein Einziger, den ich kenne, gab der Verzweiflung Ausdruck, er begann zu trinken. Er sagte, er habe so viel Whisky getrunken, «dass man damit einen ganzen Monat lang eine Mühle hätte treiben können». Aber er zog sich recht gut aus der Schlinge und kehrte in die Heimat zurück. Und als er, noch nicht alt zwar, aber doch recht gesetzt geworden war, trank er nur noch den herben heimatlichen Wein. Denn man muss sagen: Wenn sie erst einmal wieder zu Hause waren, liessen sie sich, auch wenn sie ein paar Batzen in der Tasche hatten, rasch von dem einstigen Leben wieder einfangen und begannen zu schuften und zu schwitzen wie früher. Schnell nahmen sie die einstigen Gewohnheiten wieder an und taten nichts, um das frühere Leben ein bisschen zu verbessern. Doch machten sie sich Luft, indem sie die Länder «dort drüben» in den Himmel lobten, als wären diese ein verlorenes Paradies … Öfters kauften sie sich auch ein kleines Gütchen, einen Weinberg und ein Haus, draussen in Minusio oder in Tenero, wie dies der Grossvater Rusconi ungeachtet seiner andern Güter tat, und auch, und zwar endgültig, mein Vater.