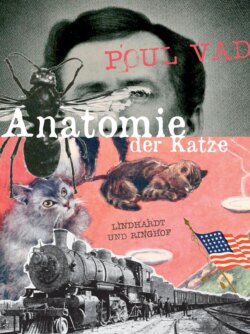Читать книгу Anatomie der Katze - Poul Vad - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSein Verschwinden wäre mit anderen Worten das höchste Glück, das mir widerfahren könnte? fragte der Marquis.
Parfaitement, antwortete Rodrigue, dann könnten der Herr Marquis die Marquise ungestört genießen. Und, fügte er hinzu, die finanzielle Transaktion, die in die Verbindung, wie in jede Verbindung dieser Art, einfließt, wird zweifellos weitaus gesünder sein, wenn Stéphane de Crâne, der notorisch wahnsinnig ist und von dem es heißt, er führe lange Gespräche mit seinen Hunden, wenn er des Nachts stundenlang mit ihnen in den Straßen von Paris herumläuft, nicht einer der Kontrahenten ist.
In diesem Augenblick spürte der Marquis entsetzt, daß er die Gewalt über seine Maske an seinen Kammerdiener abgetreten hatte.
Was sollen wir denn tun? fragte er mit schwacher Stimme.
Etwa eine Woche später wurde Stéphane de Crâne von zwei Männern angegriffen, während er mitten in der Nacht, in ein Gespräch mit seinen beiden Hunden vertieft, durch die Rue de l’Echaudé spazierte. Anfangs sagten sie nichts, sondern schlossen bloß auf, der eine schräg vor ihm, der andere schräg hinter ihm. Er konnte ihre Gesichter nicht sehen, die unter großen Schlapphüten versteckt waren.
Aladdin jaulte: Die giftigen Gedanken dieser Männer sind so voller Angst und Bosheit, daß sie selbst fast daran ersticken.
Nureddin knurrte: Paß an der nächsten Straßenecke auf!
Doch an der nächsten Straßenecke geschah nichts Ernsthaftes: Nur wurde Stéphane de Crâne, der nach rechts abbiegen wollte, von den beiden Fremden daran gehindert und gezwungen, geradeaus weiterzugehen.
Während sie weitergingen, sprach er leise mit seinen beiden Hunden. Sie näherten sich der Seine, und alle drei Männer verlangsamten unwillkürlich ihre Schritte. Die beiden Männer, die gekauft worden waren, Stéphane de Crâne zu töten, begannen ihre Vorbereitungen zu treffen. An einem dunklen Abend auf der Straße einen Menschen zu erschlagen ist gar nicht so ganz einfach, wenn man sicher sein will, daß es ordentlich gemacht wird. Am Kai angelangt, blieben sie stehen. Stéphane zitterte am ganzen Körper. Die enorme Faust, die schon lange sein schmächtiges linkes Handgelenk in eiserner Umklammerung hielt, hatte jeden Gedanken an Widerstand, geschweige denn Flucht, unmöglich gemacht. Der andere der beiden stand halb abgewandt und befühlte ein letztes Mal die lange, spitze und scharfe Messerklinge. Er befürchtete trotzdem, nicht tief genug eindringen zu können und vor allem, falsch zu treffen, solange der Delinquent den weiten Umhang trug, der seinen Oberkörper verhüllte. Nuschelnd brachte er seine Wünsche vor, aber es dauerte etwas, bevor Stéphane erfaßte, worum er bat.
Ach so, sagte er mechanisch, als er verstand. So helfen Sie mir doch, fügte er, an den Besitzer der Eisenfaust gewandt, hinzu. Sagen Sie, fragte er, während er den Umhang ablegte, wieviel ist mein Leben wert – in barem Geld?
Der Henker hatte jedoch mit seiner linken Hand Stéphanes rechten Oberarm gepackt, so daß er den Körper gut im Griff hatte. Er hatte während der letzten Tage Gelegenheit gehabt, sein Opfer zu studieren: dessen Größe, Umfang – der bescheiden war – und seine Bewegungen. Deshalb war er im Dunkeln imstande, das Messer mit solcher Kraft zu führen, daß die Klinge, die sich tief einbohrte, genau ins Herz traf. Stéphane, der nach Luft schnappte, hörte den Stoß der Faust wie einen hämmernden Schlag gegen den Brustkasten.
Die beiden Männer hielten den Körper zwischen sich aufrecht, als stützten sie einen Zechkumpanen. Sie begaben sich auf die Brücke. Als sie die Mitte erreicht hatten, blieben sie stehen und lehnten die Leiche an die Balustrade, über die der Oberkörper zusammensackte. Während der eine noch den Oberkörper stützte, bückte sich der andere, zog die Stiefel von den Füßen und hob die Beine hoch. Auf diese Weise bugsierten sie den Toten über die Kante und ließen ihn fallen.
Mitternacht war vorbei, als Madame de Taisévouze die beiden Hunde vor ihren Fenstern hörte. Ihre Mitteilungen erschienen ihr beunruhigend. Sie rief nach dem Kammermädchen, das sie hereinließ. Die Hunde krochen auf dem Fußboden ihres Gemaches entlang, und als sie ihre Augen sah, glaubte sie, die Hunde habe der Wahnsinn gepackt. Auf ihre Aufforderung hin begannen sie schließlich zu erzählen. Als sie beim Höhepunkt ihres Berichts angelangt waren, war ihr klar, daß sie den Verstand verloren hatten.
Während Stéphane zwischen den beiden Gestalten des Todes dahinwanderte, blickte er von einem zum anderen und fragte: Wer von euch ist nun eigentlich wer?
Der eine drückte vertraulich sein Handgelenk und sagte: Erkennst du mich nicht? Ich bin der Tod, der in jedem guten oder glücklichen Augenblick auf dich wartete. Ich gab dir einen kleinen Wink. Stéphane lächelte: Ich bin im Bilde! Aus irgendeinem Grund mußte ich immer einen Blick zur Seite werfen.
Und da war ich oder, genauer gesagt: Da verschwand ich gerade. Vielleicht konntest du gerade noch einen kurzen Blick von mir erhaschen? Ein schönes Spiel, nicht wahr?
Makaber, sagte Stéphane, jedenfalls von meinem Standpunkt aus betrachtet. Aber es ist mir dennoch gelungen, damit zurechtzukommen, ja, es sogar zu schätzen. Da wir nun aber endlich Gelegenheit haben, miteinander zu reden, muß ich dir doch sagen: Ich glaube nicht, daß dir selber klar ist, welche Wirkung du hast. Die ist ganz erheblich für eine nur einigermaßen sensible Intelligenz.
Stéphane wandte den Kopf zur anderen Seite und sagte zu dem zweiten Tod, der mit abgewandtem Gesicht schweigend neben ihm herging: Sollten wir uns auch kennen?
Der zweite Tod, der nicht sonderlich entgegenkommend wirkte oder vielleicht in seine eigenen Gedanken vertieft war, antwortete nicht, und Stéphane fuhr, etwas eindringlicher, fort: Vor vielen Jahren war ich in eine Schlägerei verwickelt und sah das Blut zwischen den Lippen eines jungen Mannes hervorsickern, der durch den Schlag eines Stuhlbeins zu Boden gestreckt worden war. In Neapel nahm mich mal ein Arzt zu einem Krankenbesuch bei einem Kardinal mit, der Syphilis hatte; das, was an ihm noch lebendig war, strebte mit aller Macht seiner Grenze zu. Glücklicherweise gelang es.
Der zweite Tod wandte den Kopf. Wegen der Hutkrempe und des Dunkels konnte Stéphane das Gesicht nicht sehen, aber ein Gestank fauligen Zahnfleischs schlug ihm entgegen.
Ich gehe mit Messern, Kugeln und Keulen um, sprach der zweite Tod, dessen Stimme dunkel war, aber einen lebhaften und fast fröhlichen Anflug besaß.
Ich bediene mich der dem Körper selbst eigenen Veralterung, fuhr er fort, nehme aber gern eine der Krankheiten zu Hilfe, von denen mir eine Unzahl zur Verfügung steht. Zuweilen gehe ich recht hart vor, zerre an allen Sehnen und Nerven oder packe den Körper und drükke zu, wie eine Hand, die eine reife Frucht zerdrückt, bis das Fruchtfleisch zwischen den Fingern hervorspritzt.
Eine Zeitlang gingen sie schweigend weiter.
Stéphane sagte: Ich friere.
Die beiden Gestalten preßten sich dichter an ihn.
Stéphane sagte: Nun bereue ich. Ich habe das Gefühl, daß in der Reue irgendeine Läuterung liegt, die ich ebensosehr oder ebensowenig brauche wie jeder andere Mensch, obgleich das in gewisser Weise lächerlich wirkt. Mich reut nun, daß ich als Neunjähriger das Steckenpferd meines Spielkameraden zerbrochen habe. Er hatte es selbst gemacht. Er wußte nicht, daß ich es zerbrochen hatte, und ich habe es ihm nie erzählt. Weshalb ich es tat, weiß ich nicht mehr, vermutlich war es ein Anfall von Neid. Meine Reue macht es zwar nicht wieder heil – abgesehen davon, daß niemand die Zeit zurückrollen kann, aber ich bereue es trotzdem.
Der erste Tod lächelte ihn aufmunternd an: Nun dauert das Ganze nicht mehr so lange. Ich bin bei dir, und diesmal verlasse ich dich nicht.
Der zweite Tod spuckte aus und murmelte irgend etwas.
Stéphane de Crâne entdeckte, daß er allein war. Die beiden Gestalten waren verschwunden. Er wollte Madame des Taisévouze eine Botschaft schicken, einen letzten Gruß, aber nun war es zu spät. Als nächstes wollte er bereuen, daß er nicht etwas eher daran gedacht hatte, doch von diesem Reuegefühl blieb er verschont: Es war auch bereits zu spät zum Bereuen. Erschrocken entdeckte er, daß die beiden Gestalten in ihn eingedrungen waren und sich mit ihm vereinigt hatten, ohne daß ihm klar war, wie das vor sich gegangen war.
Das ist aber seltsam, sagte er zu sich. Er sah gerade noch eine graue Katze im Dunkel verschwinden und dachte, da war ja eine Katze, worauf er endlich die Augen aufschlug und dem Alptraum ein Ende setzte.
Verstört vor Schmerz, ging Madame de Taisévouze in ihrem Gemach auf und ab, warf sich auf das Bett, auf den Fußboden, auf den Kaminvorleger, zerriß ihre Kleidung, zerfetzte die Laken, fiel schließlich um und blieb wie leblos liegen, doch mit weit geöffneten Augen.
Als sie sich am Morgen erhob und einen Schmerz in den Gliedern spürte, der sie seither nie mehr ganz verließ, begriff sie, daß sie nun am Wahnsinn der beiden Hunde teilhatte. Sie begann sofort mit ihnen zu reden, und es zeigte sich, daß sie einander vollkommen verstanden.
Der Marquis, der darum gebeten hatte, ihr eine Morgenvisite abstatten zu dürfen, weil er sehen wollte, wie es ihr ging, und weil er gleichzeitig feststellen wollte, ob ihm die Maske wieder gut sei, fand sie aufrecht, von den beiden Hunden umgeben, in einem Raum, der aussah wie ein Schlachtfeld; der Ausdruck ihrer Augen war so mild, daß er ernstlich erschrak. Danach war der Rest Schweigen, doch als Maria Elisabeth die »Bibliothèque Nationale« verließ, betrachtete sie die Hunde, die ihr auf ihrem Weg begegneten, mit einer neuen Aufmerksamkeit und hörte vor allem so intensiv auf ihr Bellen und Knurren, daß sie eine Zeitlang nahe daran war, die gewöhnliche Sprache der Menschen zu vergessen und, völlig von dieser neuen Wissenschaft erfüllt, zur heftigen Verzweiflung ihrer Umgebung, selbst diese Laute zu imitieren begann. Bald wurde ihr jedoch klar, daß dies eine Sackgasse war, weshalb sie sich sagte: Du kannst und sollst nicht das Leben eines Hundes leben. Statt dessen stürzte sie sich in das Studium der Grammatik der Hundesprache. Sie entdeckte jedoch schnell, daß die kläffenden Köter, die zu hören sie Gelegenheit hatte und die vor allem nur einander zu übertönen suchten, eine reine Karikatur der Hunde und der Sprache waren, an die sie dachte. Wenn sie aber versuchte, sich dem einen oder anderen Bekannten mitzuteilen, bekam sie immer nur zu wissen, was sie da sage, sei weiter nichts als eine Täuschung.
Sie war von dem Gedanken besessen, selbst in den Besitz eines Afghanenpaares zu gelangen. Aber wo in Europa sollte sie sie suchen? Und wer sollte sie in ihr Geheimnis einweihen? Eines Tages, im Jardin du Luxembourg, glaubte sie auf der anderen Seite einer Rasenfläche so ein Paar zu sehen. Doch es verschwand, bevor sie es einholen konnte.
Einige Jahre später stieg sie auf dem kleinen Bahnhof Melk in Österreich aus dem Zug. Hoch oben über der kleinen Stadt lag das Stiftsgebäude, und sie begann zu dem gewaltigen Komplex emporzuwandern. Es war ein Wintertag, sie begegnete fast niemandem, und in der völligen Stille empfand sie die Bewegung ihrer eigenen Person als etwas nahezu Gewalttätiges, eine Kränkung, eine Schamlosigkeit, deren fast unzüchtige Natur sie sich krümmen ließ.
Das ist aber schrecklich, dachte Maria Elisabeth, ich gehe immer weiter, obgleich es schamlos und lächerlich ist. Was müssen die guten Leute in dieser Stadt von mir glauben?
Außerdem hatte sie, um das Maß der Schamlosigkeit und Lächerlichkeit voll zu machen, das starke Gefühl, daß die ordentlichen Häuser wie die sie umgebende Landschaft und der gewaltige Luftraum sie ebenfalls betrachteten, und zwar mit ähnlicher Mißbilligung.
Und das alles wegen irgendwelcher dummen Hunde, fuhr sie fort. Wo habe ich denn meinen Verstand gelassen?
Wenig später blieb sie stehen. Ihr wurde schwindlig. Sie hatte den Eindruck, das Bewußtsein zu verlieren. Jedenfalls begrüßte sie sich selbst, als sei sie fortgewesen, erleichtert darüber, sich wiederzufinden: Alles beim alten, die Welt steht noch!
Nichtsdestoweniger fühlte sie sich nun davon überzeugt, daß sie es lernen würde, die Sprache der Afghanen zu verstehen. Sie wußte es mit Bestimmtheit. Sie mußte nur den einmal eingeschlagenen Weg weitergehen. Aber wird er jemals zum Ziel führen? fragte sie sich zweifelnd im selben Atemzug.
Im Kloster wurde sie empfangen, als sei sie erwartet worden, und in die Bibliothek geführt. Es war ein großer Raum mit Büchern in zwei Stockwerken. Mitten im Raum stand ein alter Globus, der in einer Holzeinfassung aussah, als sei er in einem Stuhl angebracht worden, wo er Ruhe gefunden hatte. Am Ende des Raumes befand sich ein großes Fenster, durch das man eine Terrasse erblickte, deren begrenzende Balustrade mit ihren schwellenden und schweren Barockformen sich als Silhouette gegen die Weiße des Himmels und der verschneiten Landschaft abzeichnete.
Die Menge weißen Lichtes, die durch dieses Fenster hereinströmte, reichte jedoch bei weitem nicht aus, den Raum wirklich zu beleuchten: Große Teile lagen im Halbdunkel.
Die Kälte schlug über Maria Elisabeth zusammen: Dieser gewaltige Raum hinter den dicken Mauern würde sich nie heizen lassen. Hier herrschte, so begriff sie, immer eine winterliche Kälte. Tausende von dunklen Bücherrücken bedeckten die Wände, alle von unbegreiflichem Alter. Wer benutzt wohl jemals diese Bibliothek? dachte sie bei sich. Welche phantastischen Kuriosa sind hier begraben? Welch absurder Fleiß steckt hinter der Errichtung einer so einzigartigen Nekropole?
Ihr eigener kleiner Körper aber – denn er wirkte so klein in diesem Raum – war voll warmen Blutes, und es dröhnte darin von der Katastrophe ihres Geschlechts.
Hingeschleppt zu ihr, als sei es eine Steintafel, und auf dem Tisch angebracht: ein Foliant, dessen zolldicker Einband die gleiche Farbe hatte wie Holz, das Jahrhunderte hindurch auf dem Grund eines Moores gelegen hat. Als sie das Buch aufschlug, quietschte es darin, als flüchtete eine Masse Mäuse aus seinen heimlichen Fächern oder als drehe sich der Einband in halb zusammengerosteten Eisenangeln. Das Titelblatt überraschte sie mit einer Architektur von Buchstaben, deren scharf getriebene Linien, Fugen und Proportionen eine eingehende Kenntnis der Axiome einer vergessenen Mathematik verrieten.
De canibus loquentibus. Tractatus de scientia secretissima antiquorum populorum gentilium et islamiticorum a Duwaine, mendace magniloquo, collectus.
Diese strahlenden Ankündigungen ließen Maria Elisabeth ziemlich kalt. Sie schlug den Folianten an einer zufälligen Seite auf, völlig mit sich im reinen darüber, daß es sich hier kaum um ein Buch handelte, das man so einfach von der ersten bis zur letzten Seite durchlas, und im übrigen völlig darauf eingestellt, jegliches weitere Studium aufzugeben, sollte sich das wider Erwarten als notwendig erweisen. Soweit sie den Text deuten konnte, bestand er aus ziemlich sinnlosen Wortgefügen; deshalb blätterte sie schnell weiter bis zu einer Schautafel, die, wie sich zu ihrer großen Erleichterung zeigte, etwas ungeheuer Einfaches, selbst ihr Verständliches zeigte, nämlich eine arabische Stadt mit Stadtmauer, Kuppeln, Minaretten und einer vereinzelten Palme im Vordergrund, an deren Fuß, der Stadt zugewandt, eine burnusgewandete Figur mit zwei Hunden stand. Doch dann entdeckte sie eine Eigentümlichkeit des Bildes, die seine Bedeutung veränderte. Sie sah, daß der Himmel mit den Wolken und der Kontur der Stadt das Bild eines ungeheuren Hundes abgab oder, genauer gesagt, das Bild von zwei sich in entgegengesetzte Richtungen wendenden Hunden: zwei Hunde, die einen gemeinsamen Körper besaßen, sich aber dennoch als zwei Hunde unterscheiden ließen. Die Figuren im Vordergrund hatten ihre Aufmerksamkeit nun offensichtlich auf diese himmlischen Hunde gerichtet und keineswegs auf die Stadt der Menschen, die leer und öde wirkte: eine Konstellation aus leeren Schalen und Polyedern mitten in einer Wüste.
Das Vexierbild amüsierte Maria Elisabeth. Sie dachte daran, wie herrlich es sein müßte, dem Gebell der himmlischen Hunde lauschen zu können, und es erschien ihr nicht abwegig, daß es außer irdischen Hunden, die immer herumliefen und das Bein an Hausmauern und Bäumen hoben und die sich seit Urzeiten den Menschen angeschlossen hatten, auch kosmische Hunde geben müsse, die aus ihrem Himmel auf die Erde herunterpinkelten und deren ungewöhnliche Paarungen in innig gesetzmäßigen Bahnen auf den Reisen durch diese fernen Räume stattfanden.
Die Darstellung trug ein etwas naives Gepräge. Genau das machte sie glaubwürdig.
Sie schlug eine weitere Tafel, weiter hinten in dem Folianten, auf. Sie war seltsam. Sie stellte ein Skelett dar, das heißt all die Knochen, die zusammen ein Skelett bildeten, über die ganze Seite verstreut. Mit etwas gutem Willen konnte man sehen, daß es sich um einen Hund handelte, um einen zerlegten und deformierten Hund, dessen einzelne Skeletteile jedoch jeweils mit einer Nummer versehen waren (die mit so kleinen Typen gesetzt waren, daß Maria Elisabeth im Halbdunkel Schwierigkeiten hatte, sie zu deuten, obgleich sie die Nase fast ganz auf das Papier setzte). Auf der Gegenseite waren alle Nummern mit der Angabe der Bezeichnung für den betreffenden Skeletteil aufgeführt. Als Maria Elisabeth genauer hinschaute, ging ihr auf, daß jede Rippe, jeder Knorpel der Wirbelsäule, jeder einzelne Knochen der vier Beine und so weiter einen eigenen Namen hatte, was ihr tiefen Respekt vor der zugrundeliegenden Wissenschaft einflößte. Nichtsdestoweniger verspürte sie keinen Hang, sich darein zu vertiefen, denn sie konnte es nicht lassen, die ganze Zeit über den lebendigen Hund vor sich zu sehen. Als sie die Überschrift über der Texttafel las, wurde ihr klar, daß es sich um einen Hund in der Erde handelte: einen toten und begrabenen Hund, dessen Skelett durch den Druck der Erdmassen im Laufe der Jahrhunderte aus den Fugen geraten war. Doch ihr Geist ließ den Hund unwillkürlich wiederauferstehen, fügte die Knochen zusammen, hängte das Fleisch daran, schloß ihn in einen Pelz ein – und froh und munter sprang ihr der Hund entgegen, glücklich darüber, der fürchterlichen Anatomie des Todes entronnen zu sein.
Die folgenden Seiten waren nicht im eigentlichen Sinne Tafeln, aber auch keine reinen Textseiten. Dagegen waren sie aus Bildchen zusammengesetzt, die den Charakter eines Fragments trugen – wie die Teile eines Puzzlespiels –, aus seltsamen graphischen Zeichen und Wörtern und kurzen Sätzen, die alle in sinnreichen und schwer durchschaubaren Konstellationen über die Seite verstreut waren. Maria Elisabeth wurde klar, daß es sich dabei um den Versuch – einen genialen und verzweifelten Versuch – zur Notation der besonderen, hochentwickelten Sprache der Afghanen handelte. Vor ihr tat sich eine phantastische Welt auf, als sie die Seiten sah, die die Aufzeichnung eines einzigen »Wau« enthielten. Selbst die kleinsten Variationen in der Länge der Laute trugen einen Sinn. Die Einzelteile des Lautes – und der Laut setzte sich aus einer schwindelnden Anzahl von Teilen zusammen – wechselten ihre Bedeutung, je nachdem, ob dieses »Wau« den Bruchteil einer Sekunde kürzer oder länger war. Entsprechend verhielt es sich selbst mit den kleinsten Variationen in Tonhöhe, Lautstärke und so weiter.
Es zeigte sich jetzt, daß die vier Elemente sowie die Dimensionen der Zeit und des Raumes die Grundzellen bildeten, aus denen diese ganze Sprache aufgebaut war. Auf der Grundlage dieser Elemente ließ sich durch Kontaminationen, ungeheure Verdichtungen, ein jedes Phänomen benennen, und gleichfalls bezeichnen konnte man die Reihen von Zuständen, die wir Veränderungen oder Ereignisse nennen. Ebenfalls wurden sowohl Gefühle wie auch abstrakte Begriffe durch verwickelte Paarungen innerhalb der genannten grundlegenden Elemente und Dimensionen dargestellt, so daß es kein einziges Gefühl, keinen einzigen Begriff gab, die nicht mit der Erde, der Luft, dem Wasser oder dem Feuer verknüpft waren. Der Begriff Gott beispielsweise war durch eine besondere Paarung der Begriffe »Alles und Nichts« entstanden. Diese wiederum waren in einer Weise gebildet, die anscheinend verwickelt, in Wirklichkeit aber ganz klar war. »Alles« war beispielsweise das Ergebnis einer Benennung aller Elemente – ausgehend von der Festlegung des Begriffs »Menge und Endziel« (wenn man das so nennen konnte) im Begriff »Menge aller Mengen« – sowie der Begriffe »Form und Formlosigkeit« in allen Möglichkeiten ihrer Reihenfolge. »Form und Formlosigkeit« wiederum wurden durch spezielle Paarungen der primären Elemente gebildet. »Nichts« dagegen wurde ganz einfach durch »kein Hund« ausgedrückt, wobei natürlich sowohl der Begriff »kein« wie auch das Wesen »Hund« nach den gleichen findigen, im übrigen geltenden Regeln aufgebaut waren.
Die Paarung von »Alles und Nichts« wurde nicht durch eine einfache Addition (a + n) ausgedrückt; die Algebra kannte überhaupt keinen Ausdruck für diese Operation. »Alles und Nichts« waren so ineinander eingeschlossen, daß sie eine gegenseitige Bedingtheit bildeten. Durch Variationen der Dimensionen von Zeit und Raum, die als Teile in den Begriff »Alles« eingingen, ließ sich der Gesamtbegriff »Alles/Nichts« (vergleichbar mit einer chemischen Verbindung) unendlich weit fortschieben oder ganz nah heranziehen, und Maria Elisabeth begriff, daß es hier um das ging, was die Philosophen Transzendenz und Immanenz nennen. Durch Zusätze in der Form von Präfixen und Suffixen konnte man den Begriff noch weiter konkretisieren und all die Götter, die Menschen jemals angebetet haben, benennen: Einige hatten mehr vom Wesen des Feuers, andere mehr von dem der Erde oder der Luft. Ganze Mythologien, ganze Himmel von Göttern, ganze Geschlechter ließen sich auf diese Weise nicht allein ohne große Mühe bezeichnen, sondern im selben Atemzug auch charakterisieren.
Ein einziges »Wau« konnte, wie gesagt, Bedeutungen enthalten, die, in menschliche Sprache umgesetzt, durch einen ganzen Satz ausgedrückt werden mußten. Es ist klar, daß sich die Zahl der Bedeutungen mit »Wau Wau« vervielfachte, doch hier spielte die Beherrschung des Intervalls eine entscheidende Rolle. Ja, letztlich lag in ihr der endgültige Prüfstein der Meisterschaft. Es zeigte sich, daß einige Hunde versucht hatten, das Intervall und seine Bedeutung zu beschreiben und näher zu bestimmen. Um dies jedoch mit ausreichender Genauigkeit tun zu können, mußten sie das Intervall zu Hilfe nehmen – was die Hunde amüsierte, für die Hundeforscher, die Canologen, die damit auch nicht weiter waren, aber eine Quelle der Verzweiflung darstellte.
Der unbekannte Verfasser des betreffenden Abschnitts mußte zugeben, daß der Versuch, eine Notation zu schaffen, von vornherein zum Scheitern verurteilt sei. Die geheimnisvollen, subtilen und evidenten Gesetzmäßigkeiten dieser Sprache lassen sich nun einmal nicht notieren, hatte er zum Schluß geschrieben. Er hatte jedoch hinzugefügt: Doch glaube ich, daß niemand dem Ziel näher gekommen ist als ich.
Was das Studium dieser Seiten so unterhaltsam machte, war die Tatsache, daß sich alle diese schwierigen Dinge, diese komplizierten Begriffe und unbestimmbaren Bestimmungen auf ein fröhliches und klingendes »Wau« bezogen. Es erschien Maria Elisabeth, als höre sie es, und sie träumte von Afghanen, bis ihr plötzlich einfiel, daß man sie vielleicht vergessen habe. Die Kälte des Raumes war durch ihren Mantel, den sie anbehalten hatte, hindurchgedrungen. Sie war unter die Haut gedrungen, tief in ihren Körper hinein. Sie erhob sich und begann auf und ab zu gehen. Den Folianten, der noch immer aufgeschlagen dalag, hatte sie vergessen; sie überlegte, was wohl das nächste ist.
Die Antwort erhielt sie erst viele Jahre später, in einer Seitenstraße des Kopenhagener Arbeiterviertels Nörrebro. Der Lumpensammler im zweiten Stock rechts des Hinterhauses von Nummer 24 lag völlig angezogen auf einem Bett, dessen dreckiges Laken die Farbe von brauner Schuhcreme hatte. Sein Gesicht war von der tauben und gequälten Menschenfeindlichkeit des Strafgefangenen gezeichnet, und nichts an seinem Ausdruck verriet, ob er ihre Anwesenheit billigte oder mißbilligte.
Sie fühlte sich dennoch wohl (sie hatte sich unaufgefordert auf die Kante eines Stuhls gesetzt), als sei sie sicher, daß sie einander verstehen würden. Außerdem war sie auf beklommene Weise glücklich beim Anblick der beiden Afghanen, die in einer Ecke des Zimmers auf einer alten Matratze lagen. Der Lumpensammler, Pinnaghel Jochumsen, beschrieb ihr sein Dasein. Es war voller Wechselfälle, Entbehrungen und Widerwärtigkeiten gewesen. Sein ganzes Leben über war er von Richtern verfolgt worden. Der Richterstand hatte von Anfang an ein Auge auf ihn geworfen. Er war der Sohn eines Richters. Die väterliche Ausübung des Richteramtes war überaus niederträchtig gewesen; er hatte nämlich immer alles in seiner Macht Liegende getan, um die Unschuldigen zu bestrafen und die Banditen laufen zu lassen. Um den Unschuldigen keine Fluchtmöglichkeit zu geben und sich selbst an den Sinn des hohen Amtes, das er innehatte, zu erinnern, hatte er vor den Fenstern seines Amtszimmers Gitter anbringen lassen. Da er aber mit Haut und Haar Richter war, Richter, wenn er arbeitete, Richter, wenn er ausspannte, Richter, wenn er aufwachte und wenn er schlief, hatte er auch die Fenster der hochherrschaftlichen Villa, die er bewohnte, vergittern lassen, und er saß dem Mittagstisch, um den sich die Familie versammelte, nicht vor, ohne Urteile zu fällen: Das Essen, das Wetter oder die russisch-französischen Verhandlungen erhielten ihr Urteil.
Als Dreizehnjähriger empfing Pinnaghel sein erstes Urteil, gefällt wurde es von seinem Vater. Er blieb der Schule so hartnäckig und konsequent fern, daß der Lehrer ihn aufgab. Als sich herausstellte, daß Pinnaghel seine gesamte Zeit in einem Hundezwinger verbrachte, erstattete die Schulbehörde Anzeige gegen ihn, und es half Pinnaghel nichts, daß er erklärte, er gehe in eine Hundeschule. Während der Verhandlung meinte der Staatsanwalt mit großem Nachdruck, Hundeschulen für Menschen seien in der dänischen Gesetzgebung ein unbekannter Begriff, und die wirklichen Motive des Angeklagten, die ihn dazu brächten, sich der Erfüllung der Schulpflicht zu entziehen, seien Faulheit, Widerspenstigkeit und allgemeiner bürgerlicher Ungehorsam. Der Verteidiger redete viel von Pinnaghels schwach entwickeltem Verstand und erklärte, streunende Köter, die nicht die gleiche standesgemäße Erziehung genossen hätten wie die gut getrimmten Hunde der Familie Jochumsen selbst, hätten einen nachteiligen Einfluß auf den leicht zu beeinflussenden Jungen gehabt. Die Verhöre des Richters verrieten Pinnaghel, daß dieser Mensch, den man seinen Vater nannte, nicht allein nichts begriff, sondern geradezu ein feindliches Prinzip verkörperte. Deshalb nahm er das Urteil mit bitterer Befriedigung entgegen. Er wurde zur Unterbringung in einem Internat verurteilt und bemerkte bei seiner Ankunft ohne Erstaunen die dekorativen, schmiedeeisernen Gitter, deren geschwungene und phantasievolle Formen die Fenster des Schlafsaals schmückten. Der Vorsitzende des Internatsvorstands war zufällig ein Richter, und als Pinnaghel zum zweitenmal dabei erwischt worden war, wie er im Schlafsaal vor den Augen aller Kameraden masturbierte, wurde er vor diesen Richter gebracht, in dessen forschendem Blick er die atavistische Angst seines Vaters wiederfand.
Nachdem man ihn in ein Arbeitslager für Gewaltverbrecher und unzurechnungsfähige Personen überführt hatte, war Pinnaghel bald imstande, sich die Strategie seines Lebens zurechtzulegen. Als Fünfzehnjähriger hatte sein Gesicht die charakteristischen Züge eines verstockten Delinquenten. Er mußte seinen Arsch für ein paar ausgewachsene Kerle hergeben, die ihn brüderlich miteinander teilten und eifersüchtig darüber wachten, daß kein anderer ihm nahe kam. Voller Staunen reiste er nach seiner Entlassung nach Deutschland, wo er als Streuner und Obdachloser verhaftet wurde. In seiner Zelle brütete er eine finstere und bittere Hoffnungslosigkeit aus, in der Nacht aber träumte er von singenden Hunden. Als die Gefängniswärter sein Frühstück brachten, waren sie entsetzt, als sie ihn auf allen vieren auf dem Zellenfußboden herumkriechen sahen. Aufgrund seines jugendlichen Alters wurde er nach Dänemark zurückgeschickt, wo ihn sein Vater, der Richter, in Empfang nahm. Als Pinnaghel die herrschaftliche Villa wiedersah, lächelte er: Beim Anblick ihrer vergitterten Fenster begriff er, daß der Richter dazu verurteilt war, sein ganzes Leben hinter Schloß und Riegel zu verbringen. Bis zu diesem Augenblick hatte Pinnaghel mehr oder weniger blind gehandelt, außerstande, es anders zu machen, doch auch ohne seine eigene Natur, ihre dumpfe und hartnäckige Eigensinnigkeit, oder die mystische Metaphysik der Gesellschaft, der Gefängnisse oder des Richterstandes zu begreifen. Nun aber gingen ihm die Zusammenhänge auf; es war, als würde sein fiebriges Gehirn in eiskaltes Wasser gesenkt, und während er zu überschlagen versuchte, wie viele Jahre ihm zur Durchführung seines Vorhabens bleiben würden, teilte er seinem Vater ruhig mit, daß er sich von jetzt an als für die Gesellschaft endgültig verloren betrachte; er habe nämlich beschlossen, sich der aufrührerischen Sprache der sprechenden Hunde zu widmen.
Der Richter, der sich gerade dazu entschlossen hatte, den Sohn in einem letzten verzweifelten Rettungsversuch zum Leben zu verurteilen, weigerte sich, Pinnaghels Erklärung anzuerkennen. Das nahm Pinnaghel leicht. Kein Urteil des Richters konnte ihn mehr erreichen, geschweige denn anfechten; obwohl es ihm gleichgültig geworden war, versuchte er seinem Vater zu erklären, weshalb es sich so verhielt.
Ich habe den Tod selbst in die Hand genommen, erläuterte er, ich habe ihn mir ganz und gar zu eigen gemacht. Diese Tat erkennt keine gesetzgebende Gewalt der Welt an oder, genauer: Keine gesetzgebende Gewalt kennt sie. Sie stellt eine so schwere Verweigerung dar, daß kein Gesetz sie zu erwähnen wagt, aus Furcht, sie könnte dadurch eine weitere Verbreitung finden. Als mir aufging, daß du der Eingesperrte bist und ich der Freie bin, da habe ich gleichzeitig begriffen, daß es sich auch in allen anderen Fragen so umgekehrt verhält.
In derselben Nacht, nachdem er das Haus seines Vaters verlassen hatte, wurde er – auf Befehl von höchster Stelle, hieß es – verhaftet, als er in Begleitung eines entlaufenen und polizeilich gesuchten Hundes die Frederiksbergallee hinunterspazierte, und verbrachte den Rest der Nacht zusammen mit einem vornehm gekleideten, jedoch betrunkenen Mann, der auf den Fußboden der Zelle kotzte. Pinnaghel litt an Angstanfällen, die Erstickungsgefühle verursachten, denn niemandem wird die Auszeichnung dieser Hellsichtigkeit zuteil, ohne daß sie ihm durch Mark und Bein geht. Am nächsten Morgen starrte er sehnsüchtig auf die Beamten, mit dem Ausdruck eines verlorenen Hundes, und folgte mit den Augen der geringsten Bewegung, während sie Kaffee tranken, ihn verhörten und Berichte schrieben. Später am Tag wurde er mit der Begründung des Landes verwiesen, sein Umgang mit den Hunden belästige die Hundebesitzer; kaum aber hatte er die Grenze nach Deutschland überschritten, so wurde er erneut verhaftet und erhielt diesmal eine strengere Strafe, weil er zurückgekehrt war, nachdem man ihn bereits einmal dieses Landes verwiesen hatte. Damit begann sein Dasein in der Verbannung, das ihm gestattete, nicht allein viele Länder, sondern auch viele Gefängnisse dieser vielen Länder zu sehen und viele der zahlreichen Richter dieser vielen Länder, und alle erinnerten sie ihn – in einem oder mehreren Punkten – an seinen Vater.
Während er sich durch die Unterwelten und Armenviertel der Großstädte gekämpft hatte, durch Schmutz, Niedertracht und Hoffnungslosigkeit; durch das Elend der Prostitution, durch Hunderte von unbeseelten Liebesnächten, die in seiner Erinnerung blieben und ihn immer weiter mit magischem Licht bestrahlten; durch die Verwünschungen der Einzelzellen und die fürchterlichen Hierarchien der Gefangenenlager, hatte er entschlossen und geduldig sein Gehör trainiert, hatte sich nicht eine einzige Gelegenheit entgehen lassen, in den verschiedenen Ländern, durch die er hindurchkam, der Sprache der Hunde zu lauschen, und war unweigerlich ziemlich vielen Gleichgesinnten begegnet, mit denen er seine Erfahrungen austauschte.
Pinnaghel Jochumsen berichtete das alles mit einer gewissen mürrischen Arroganz. Nun war seit seiner Heimkehr nach Dänemark schon eine Reihe von Jahren verstrichen. Er beklagte sich nicht. Einzig eine zunehmende Schlaflosigkeit quälte ihn. Die Angstanfälle waren selten geworden, dafür aber schloß er jede Nacht nur für zwei bis drei Stunden die Augen. Möglicherweise sei er damit ja billig davongekommen, erklärte er.
Was er damit meine? wollte Maria Elisabeth wissen.
Damit meine er, daß man, wenn man erst einmal von dem Gedanken an die sprechenden Afghanen besessen sei, in seiner Seele nie mehr Frieden finde.
Maria Elisabeth war nicht mehr jung und fand, sie habe nichts Nennenswertes zu verlieren. Außerdem sah sie keinen Weg zurück.
Das klingt aber fast, als müßte man sich verschreiben, sagte sie.
Pinnaghel Jochumsen war wütend. Der Gipfel der Wut waren in seinem Fall ein paar unverständliche Grunzer und ein seltsames Verdunkeln seines ganzen Gesichts, dazu ein stierender Blick, so, als habe er soeben ein Heer von giftigen kleinen Ameisen entdeckt, die auf ihn zu und unter seine Kleidung marschierten.
Ein paar Deutsche, stöhnte er, haben ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie aus dem bürgerlichen Zauberkreis ausgetreten sind. Sie bilden sich in vollem Ernst ein, der Teufel wohne in einem sprechenden Hund. Das ist der reinste Blödsinn, eine einzige Mystifikation. Sie spazieren in einer Welt strebsamer Leichen umher und glauben, mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung, weil sie nicht tot sind.
Pinnaghels Entrüstung kannte keine Grenzen. Ihm zuzuhören amüsierte Maria Elisabeth.
Verschwenden Sie nie auch nur einen Gedanken an solch dummes Zeug, warnte er, das führt nur ins Verderben.
Nun lenkte Elisabeth das Gespräch auf ein anderes Thema, das sie sehr beschäftigte und von dem sie den Eindruck hatte, es komme ihm große Bedeutung bei, nämlich auf die Frage, weshalb es so wichtig sei, daß zwei Hunde zusammenseien.
Nun ja, antwortete der ehemalige Häftling, zwei Stimmen sagen mehr als das Doppelte von einer Stimme, aber ich kriege Kopfweh und Herzschmerzen, wenn ich es erklären soll. Die eine Stimme muß dasein, um die andere aufzuheben, und umgekehrt, sonst wären ihre Aussagen überhaupt nicht zu ertragen, was ich am besten durch ein Beispiel erklären kann. Stellen Sie sich vor, der eine Hund sagte: Den Abschluß der großartigen Mahlzeit bildete ein wohlschmeckender Knochen. Der Hund wird seine ganze Seele in diesen Satz legen. Ist das so verwunderlich? Ließen sich nicht alle Leiden, Tränen, Begierden und Genüsse eines Hundelebens in diesem Satz vereinen? Er würde ein erdrückendes Gewicht bekommen, allein die Gegenwart des Knochens würde die Vorstellung des lebenden Ochsen, von dem er stammt, beschwören, ein nahezu unerträglicher Gedanke. Deshalb Hund Nummer zwei, der im selben Atemzug sagt: Den Abschluß der großartigen Mahlzeit bildete ein wohlschmeckender Knochen. Wie kann das nun angehen? Der Zuhörer versteht augenblicklich, daß diese Mahlzeit, weit entfernt davon, großartig zu sein, viel eher eine reine Fiktion oder Einbildung ist, daß ihr »Abschluß« nicht in der wirklichen Dimension der Zeit vor sich geht, sondern in ihrer lächelnden Spiegelung, und daß es sich bei dem »wohlschmeckenden Knochen« um die Fata Morgana der Stofflichkeit in der Landschaft der Sprache handelt. Mit anderen Worten: Der eine Hund ergreift das Phänomen, nimmt es an sein Herz, verzehrt es – gut mit Speichel und anderen Sekreten vermischt – und löst es in sich auf; wogegen der zweite es ermordet oder hinwegschleudert, außer Reichweite. Der eine Hund ruft uns, der zweite hält uns auf Abstand. Aber – Pinnaghel Jochumsens Gesicht wurde wiederum dunkel, er sah aus, als beherrsche ihn ein heftiger Zorn – das haben die Canologen auf den Tausenden von Seiten und in den Millionen von Fußnoten ihrer Beschreibungen, Analysen, Theorien und Einführungen in der Regel auf die bestialischste und verbrecherischste Weise verpfuscht.
Maria Elisabeth erschrak nicht, denn sie fühlte in ihrer Seele die gleiche dumpfe Wut wie Pinnaghel Jochumsen, obgleich es ihrer Natur näher lag, sich über die Phänomene, die seine Galle übergehen ließen, lustig zu machen.
Wissen Sie aber auch – Pinnaghel stöhnte schwer und wechselte die Stellung –, daß nach einem unter den Afghanen weit verbreiteten Glauben am Tag des Jüngsten Gerichts die Canologen in zwei Gruppen geteilt werden sollen, die Schafe von den Böcken. Die Schafherde wird ganz klein sein, die Böcke werden allesamt geschlachtet, und da ihr Fleisch für Hunde ungenießbar ist, soll es Schakalen, Hyänen und Geiern zum Fraß vorgeworfen werden.
Auf diese Weise führten Pinnaghel Jochumsen und Maria Elisabeth ihr Gespräch ein paar Tage lang weiter. Maria Elisabeth dachte überhaupt nicht daran, daß sie auf einem unbequemen Holzstuhl saß, auf dem man genaugenommen unmöglich mehr als ein paar Stunden hintereinander sitzen konnte. Bei ein paar Gelegenheiten aßen sie auch irgend etwas, und einmal entdeckte Maria Elisabeth, daß sie geschlafen hatte. Sie hatte aber den Eindruck, das Gespräch im Schlaf fortgesetzt zu haben, denn als sie aufwachte, beantwortete Pinnaghel Jochumsen gerade eine sehr vernünftige Frage, die gestellt zu haben sie sich nicht entsann.
Wenn Sie von hier fortgehen, sagte er, dürfen Sie nicht mehr daran denken, daß Sie das Geheimnis der Afghanen erforschen wollen. Sie werden auf einen unerwarteten Spiegel treffen, der Ihnen den Rest erzählen wird.
Plötzlich stand sie auf der Straße und führte eifrig ihr Gespräch mit dem alten Lumpensammler weiter, während sie langsam allein fortging. Die Leute wichen erschrocken zur Seite, sie blieb stehen und sah sich im Spiegel einer Schaufensterscheibe. Das war es wohl, was er gemeint hat, sinnierte sie. Die Leute glauben, ich sei betrunken oder krank oder betrunken und krank. Meine Haare sträuben sich nach allen Seiten. Meine Augen sehen ganz wahnsinnig aus. Ich spreche laut mit mir selbst und kann nicht einmal gerade gehen. Aber sieh mal an – da ist ja ein Hotel! Ich muß mich ausruhen. Ich nehme mir ein Zimmer und lege mich ein Weilchen hin.
Auch auf ihrem Zimmer gab es einen Spiegel, und auch dieser Spiegel zeigte Maria Elisabeth ein müdes und verwüstetes Gesicht. Da haben wir es schon wieder, sprach sie zu sich. Weshalb ich aber wohl das Geheimnis der Afghanen nicht mehr erforschen darf? Bevor sie sich hinlegte, schaute sie sich in dem Zimmer um, das unendlich trübselig aussah. Die Tapete war verblichen, der Kleiderschrank ramponiert, der Teppich zerlöchert. Ihr Blick fiel auf den zwischen Bett und Wand eingeklemmten Nachttisch. Zu ihrer Verblüffung entdeckte sie, daß auch er sie widerspiegelte, und blieb stehen, aus Angst, die Spiegelwirkung könne verschwinden. Maria Elisabeth, sagte sie, da hast du dich – du bist wirklich rührend!
Weit weg hörte sie sich lachen.
Die Müdigkeit übermannte sie, sie legte sich auf das Bett, ohne sich auszuziehen. Als sie viele Stunden später erwachte, lagen am Fußende des Bettes zwei Afghanen, etwa zwei Monate alte Welpen. Der Wirt erklärte, sie seien von einer Person abgeliefert worden, die behauptet habe, sie seien ein Geschenk, und das Ganze sei mit dem betreffenden Gast, Maria Elisabeth Hvide, abgesprochen.
Und das sind doch Sie, nicht wahr? schloß der Wirt fragend.
Das muß wohl stimmen, antwortete Maria Elisabeth und dankte ihm.
Daraufhin machte sie sich sofort daran, ihre Welpen die wunderbare Sprache der Afghanen zu lehren, die sie sich gleichzeitig auch selbst aneignete.
Madame Blanche erzählte mir viele Jahre später: Es ist meine Dummheit und mein Unglück, daß ich mich in kopflose Abenteuer stürze, und selbst zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte klüger sein sollen, gingen die Leidenschaften mit mir durch – das heißt, anfangs habe ich natürlich alles unter Kontrolle, glaube ich jedenfalls, doch unmerklich gehe ich immer mehr in dem Spiel auf, und bevor es mir klar wird, ist es Ernst geworden. An jenem Tag im Mai 1936, als Edith zusammen mit ihrem Mann und dem Scholier zu Gast bei mir war, hatte ich mich schon längst darauf eingestellt, daß mit solchen Abenteuern Schluß sei. Obgleich ich mich bei weitem noch nicht alt fühlte – ich war in den Fünfzigern –, meinte ich doch, über die Stürme der Leidenschaft hinauszusein, die es in allen Knochen ächzen lassen und mich zuweilen haben fürchten lassen, daß ich den Verstand verlieren würde. Was für ein Leben haben die Menschen gelebt, die das nicht erfahren haben? Aber ich sollte eines anderen belehrt werden. Eine Zeitlang betrachten wir voller Scham die lächerlichen Verirrungen unserer Jugend, doch wir lernen es, einen nachsichtigeren Maßstab an sie anzulegen. Dann glauben wir uns sicher in einer Kleidung von Jahren, die nur verschleiern kann, daß die Torheit, die wir einmal genährt haben, noch immer ebenso unausrottbar in uns lebt. Unser Fall ist jetzt noch lächerlicher und unwürdiger als in der Jugend – aber ich preise ihn dennoch! Ich habe die Sicheren nie ausstehen können. Meiner Meinung nach ist der Sichere ein ganz simpler Betrüger – mag er seine Sicherheit auch in Weisheit und geistige Überlegenheit kleiden. Na, aber das, was ich hier sage, ist auch nichts weiter als billige Lebensweisheit – ich muß wohl lieber anfangen zu erzählen, was geschah, denn das ist jedenfalls die reine, schiere Wahrheit.
Ich beschloß kurz und gut, sie zu verführen, denn ich war ganz unerwartet von einem unzähmbaren Verlangen, sie zu berühren, ergriffen worden; sie war nämlich in Wirklichkeit sehr sensuell, was sie jedoch selbst nicht wußte, und ich fand, es müßte wunderbar sein, wenn sie es entdeckte und wenn ich an diesem Erlebnis zusammen mit ihr teilhaben könnte.
Zunächst drückte ich ihre Hand. Daran an sich ist weiter nichts Sonderbares, aber ich weiß es besser. Man kann durch die Hand die ganze Kraft seines Wesens in einen anderen Menschen hinüberströmen lassen, und man kann einen anderen Menschen spüren und sich eine Vorstellung von ihm machen, als sähe man geradewegs durch ihn hindurch und könnte das Herz, die Eingeweide und das Gehirn sehen. Oh, nicht alle sind dazu imstande, bei weitem nicht, es erfordert ein Vertrauen auf die angeborene Sensibilität, das nicht üblich ist. Auch das wird in uns getötet. Und die Hand, was geschieht mit der Hand? Sehen Sie einmal, hier ist sie, mit der Handfläche und den fünf Fingern, so voller Leben und Kraft und Möglichkeiten, wie ein Wesen mit seiner eigenen, selbständigen Existenz, voller launischer Neigungen, und wir können entscheiden, ob wir sie lieben und ehren – oder verwerfen, bezwingen, bekriegen wollen.
Die Fingerspitzen sind fünf Antennen, die die Welt absuchen und erzählen, woraus sie besteht. Sie liebkosen auch mit der leichtest denkbaren Berührung. Doch die Hand macht nicht nur Erfahrungen, sie führt auch Handlungen aus, die wir nicht einmal bemerken, und unablässig stellt sie uns der Umwelt dar, so daß niemand im Zweifel darüber ist, wer wir sind.
Ich drückte also Ediths Hand und behielt sie etwas länger in der meinen, als es eigentlich notwendig war. Nicht, daß ich es angenehm gefunden hätte, denn ihre Handfläche war klamm, und ihre dünnen Finger zitterten, sondern weil ich bereits begonnen hatte, mein Vorhaben auszuführen. Außerdem war meine Hand sofort darauf versessen, sie richtig zu berühren, und genauso passierte es. Noch hätte ich umkehren können, wenn man so sagen darf, aber die Hand gab den Ausschlag. Gut, meine Hand, sagte ich, du sollst deinen Willen haben, aber bist du dir auch im klaren darüber, welches Risiko ich eingehe? Die Sache ist nämlich die, daß ich im Gegensatz zu der Hand die Kosten kannte: Den Schmerz würde letzten Endes ich haben. Sollte ich es deshalb unterlassen, dem Wink zu folgen, den mir die Hand gab? Ich glaube, ich würde geradewegs in die Hölle gehen, sollte meine Hand sagen, komm, hier entlang, hier erwartet dich das Abenteuer! Und um es gleich vorwegzunehmen, einmal habe ich so einen Spaziergang tatsächlich unternommen, ich weiß also, wovon ich rede; doch davon erzähle ich hinterher. Es war nun ganz natürlich, daß ich ihr anbot, sich ein wenig zu waschen, denn genau das braucht man nun einmal, wenn man während einer Reise Aufenthalt hat, und obgleich die Reise nicht sehr lange gedauert hatte, so mußte man damals wirklich nicht viele Minuten mit dem Zug fahren, damit man schmutzig war und durchaus Lust haben konnte, ein wenig Kohlenstaub von sich abzuwaschen. Sie ließ sich also ohne weiteres von mir mitziehen, freute sich sogar, und ich nutzte das aus und sagte, sie könne ja eigentlich ebensogut richtig baden, es dauere nur einen Augenblick, und sie fühle sich hinterher viel angenehmer – sie sei ja auch ganz schweißnaß! Ihre zaghaften Proteste halfen kein bißchen. So, als wollte ich ihr alles zeigen, ging ich selbst mit in das Badezimmer, das sehr groß war, fast ein Saal. Ich hatte einen Vorhang, hinter dem sie stehen konnte, während sie sich entkleidete, und inzwischen bereitete ich das Bad vor. Hören Sie: Ich zitterte am ganzen Körper. Ich hatte Angst. Ich pflegte sonst nie Angst zu haben, aber nun hatte ich Angst. Meine Einsamkeit, das Gefühl der Verlassenheit war plötzlich so heftig geworden, daß es mich durchschüttelte. Sollte ich wirklich den Rest meines Lebens hier verbringen, lediglich zusammen mit den Hunden und einigen lächerlichen Bewunderern und Anbetern, die sich bei ausgewählten Gelegenheiten vor mir auf die Knie warfen, mir ewige Treue schworen und jedes Wort, das ich sagte, verschluckten, als seien es reine Worte der Weisheit, obgleich es zum großen Teil nur Possen und Humbug waren und ich mich damit amüsierte, dieser Suada eine raffinierte Form mit einigen Spritzern verbalen Parfüms zu verleihen, das sie völlig benebelte? Natürlich würde ich hierbleiben, aber weshalb sollte ich keine Freundin bei mir haben – wenn nun einmal mein ganzer Körper und meine Seele darauf eingerichtet waren? Ach, mein armer Körper, er war nicht mehr jung, und würde er sie nicht erschrecken? Ein fürchterlicher Sturmwind fegte durch ihn hindurch, erfüllte ihn mit wilder Kraft und Wahnsinn, und ich ging umher, emsig und ruhig wie eine sehr viel ältere Schwester, und sagte zu ihr, nun sei das Bad fertig, bitte. Sie hatte ein Badehandtuch um sich gewickelt, als ahne sie irgend etwas, und ich konnte ihr ansehen, daß die Luft dank der Ausstrahlung meines Körpers mit einer Kraft geladen war, die sie nicht unberührt ließ, obgleich sie natürlich überhaupt nicht wußte, was hier vor sich ging.
Als sie im Wasser lag, konnte sie mich nicht daran hindern, sie zu waschen; ich ließ meine Hände sie mit so weichen und freundlichen Bewegungen einseifen, daß ihre angespannten Nerven völlig zur Ruhe kamen. Nachdem ich sie abfrottiert hatte, führte ich sie in mein Zimmer, das nebenan lag, ließ sie einen meiner Schlafröcke auswählen und nahm selbst ein Bad. Während ich in der Badewanne lag, rief ich sie. Sie trat ein, blieb aber an der Tür stehen. Ich war ungeduldig, aber dennoch ruhig, weil ich wußte, daß man sich Zeit nehmen muß. Deshalb sprachen wir erst etwas miteinander, und dann bat ich sie, mir einen Handspiegel hinüberzureichen, der beim Waschbecken lag. Sie kam damit zu mir hin, und ich ergriff ihre Hand, als sie ihn mir reichte. Nun konnte sie nicht anders, nun mußte sie mich betrachten. Mein grausamer Körper war unter Wasser weniger abschreckend. Weshalb grausam? Der Körper ist grausam, das ist sein Privileg. Ein Körper, der nicht grausam ist, ist kein Körper. Die Grausamkeit erwacht im Körper wie ein unvermeidlicher Zauber, der ihn in Besitz nimmt. Die große Zärtlichkeit ist darin verborgen. Er ist ohne Boshaftigkeit. Der Körper der Frau, der im Gegensatz zu dem des Mannes die Organe in sich verbirgt, besitzt seine eigene Grausamkeit. Die Organe sind hineingelegt wie in eine Tüte, eine Tüte voller saftiger und bluterfüllter Dinge, die zum Schwellen und Beben gebracht werden können. Dennoch ist der Körper fest und geschlossen wie eine Vase. Aber mein Körper war ja überhaupt nicht mehr jung. Seine Haut war bereits zäh und fast rauh geworden, und die Vase, von der ich spreche, wurde in meinem Fall schon allmählich formlos, denn meine Hüften waren breit, und ich hatte keine Taille mehr. Doch das wurde in gewissem Umfang durch das Wasser verschleiert, wie Sie sich sicher vorstellen können, alles in allem sah ich also ganz anziehend aus. Das fand sie offenbar auch. Ich glaube, es war das erste Mal, daß sie den Körper einer Frau richtig ansah, denn ich bin nicht einmal sicher, daß sie sich mit ihrem eigenen richtig bekannt gemacht hatte. Und was war mit dem anderer? Etwas hatte sie ja wohl gesehen, in der verstohlenen Weise, die man beim Umkleiden in Turnhallen und Badeanstalten benutzt. Aber ich meine »betrachtet«, mit der gierigen Neugierde, die unser Blick hat, wenn er die Dinge, die wir wirklich kennenlernen wollen, ergreift und verzehrt. Genauso aber sah sie mich jetzt an, und während sie so dastand und mich betrachtete, wurde in ihr alles auf den Kopf gestellt. Während sie mich anschaute, sah sie nämlich auch sich selbst an. So ist das mit diesen Dingen, und sie bekam geradezu einen Körper geschenkt, bloß weil ich sie sozusagen zur Badewanne hinschleppte und meine ganz Figur vor ihr ausstellte, ohne mich zu schämen, sondern geradezu besessen war von all dem Stolz, den man spürt, wenn man nun einmal einen Körper besitzt, der allerhand erfahren hat und mit dem man viele Jahre lang Gutes und Böses geteilt hat.
Ich war ja ein ältliches Raubtier, meine Brüste, die an der Wasseroberfläche trieben, ähnelten großen Bergen aus Fleisch, und wenn ich die Beine etwas breitmachte, war es, als presse all das in der Tüte Verborgene an das Licht des Tages. Doch, doch, ich veranschaulichte in vollem Maße den physischen und fleischlichen Aspekt der Liebe, und die Grausamkeit meines Körpers war nicht mißzuverstehen. Ich streckte eine nasse Hand aus und berührte sie. Mit den Fingerspitzen zeichnete ich leichte, feuchte Streifen auf ihre Haut, die unter der Berührung erbebte. Ich schrieb mit den nassen Fingerspitzen meine Worte auf ihre Haut, und sie stand ganz still und empfing bebend diese Inschrift. Es ist vielleicht mißverständlich, wenn ich so viel von Grausamkeit spreche. Diese Grausamkeit hat nichts mit Qualen zu tun, jedenfalls nicht im gewöhnlichen Sinne. Ich schrieb meine Liebe auf ihren Körper wie eine weiche und flüchtige Botschaft, fast diskret, unschuldig, als wisse niemand von uns etwas von diesen Dingen oder verstünde, was all das solle.
Sie dachte nicht mehr daran, sich zurückzuziehen, aber natürlich war sie erschrocken. Ich lächelte sie an, und nun sah ich, daß sie mir gern dienen wollte, sie wußte nur nicht richtig, wie sie es anstellen sollte. Hätte ich nur die gleiche Stärke besessen, als ich jung war, dann hätte alles anders ausgesehen!
Hol das Handtuch! Stell dich hinter mich! Frottier mich ab! Ich sagte das alles ganz weich, als sei es etwas, was ich ihr erlaubte, und sie tat fügsam, worum ich sie bat. Auf diese Weise gewöhnten wir uns aneinander, auf diese Weise gewöhnte ich sie an mich und, was vielleicht das Wichtigste war: Auf diese Weise gewöhnte ich sie an sich selbst. Ihr Körper war schmächtig, fast so, als seien die Knochen darin aus Stroh, aber nach dem Bad war ihre Haut herrlich warm, und sie roch gut, kann ich Ihnen sagen! Was sich zwischen uns abspielte, das ist für einen Mann nur schwer oder unmöglich zu begreifen, und es ist auch kaum zu erklären. Die Sache ist die, daß der Mann und alles, was zum Mann gehört, eben herausgelassen wird. Nicht nur sein plumper Körper, seine Gerüche – und dann das Sperma, das letztlich immer ausläuft und unsere Backen und Schenkel naß macht und fast unvermeidlich das Laken verschmutzt, so daß das Ganze schließlich eine klamme und unangenehme Angelegenheit wird. Sondern sein ganzes Wesen, seine Absichten, seine unerträgliche Verletzlichkeit, sein Kindischsein und sein lächerlicher Stolz. Irgendwann muß er immer getröstet werden. Nicht ganz selten heult er, wenn er nicht im Gegenteil brutal wird. Und seine Brutalität hat nichts mit der Grausamkeit zu tun, von der ich spreche, das muß Ihnen klar sein! Dann will er uns absolut schwanger machen, und dann! Ja dann, dann hat er uns an der Leine. Ach, welch ein Kindskopf bleibt er immer, gleichgültig, wie alt er wird, nichts weiter als ein Kindskopf, dem man die rotzige Nase trocknen, den man am Abend in den Schlaf wiegen und den man fast füttern muß, als sei er noch immer ein Baby – und dann will er uns trotzdem an der Leine haben, darauf lauert er, und zu alledem betrachtet er es auch noch als sein gutes Recht, als eine Art göttliche Ordnung, die das alles so weise zu seinem Vorteil eingerichtet hat.
Alles, was ich hier sage, erklärte ich der kleinen Edith, alles und noch viel mehr, was ich nicht wiederholen kann, und sie nickte gehorsam und sagte ja. Aber innerlich zweifelte ich daran, ob sie verstand, ob sie verstehen würde, trotz der Tatsache, daß ihre Hingabe im Augenblick total erschien. Ich war mit anderen Worten in Wirklichkeit verzweifelt und hätte wie eine Wahnsinnige gebrüllt und geschrien, wenn ich meinen innersten Gefühlen und Ahnungen Luft gemacht hätte, die keine Ahnungen waren, sondern ein trauriges Wissen, das schwer wie ein Bleigewicht in mich eingesunken war. Vielleicht hätte ich brüllen und schreien sollen. Ich flehte sie an. Ich flehte diese Provinzstadtfrau an, weil ich es mir einen Augenblick lang gestattet hatte, an eine Illusion zu glauben. Dieses eine Mal war ich weich gewesen. Weshalb sollte sie nicht bleiben können? Ich bot ihr eine besondere Stellung im Haus an. Sie hätte da zusammen mit mir leben können, alles hätte gut sein können, doch sie wollte nicht. Zuletzt schalt ich sie. Sie starrte mich erschrocken an. Natürlich durchschaute ich mich und meine törichten Illusionen, das schlimmste war jedoch, daß ich das Gefühl hatte, auch sie durchschaue mich in ihrer eigenen naiven Weise und habe deshalb Erbarmen mit mir. Das konnte ich ihr nicht vergeben. Jedenfalls nicht damals. Jetzt ist es mir natürlich gleichgültig.
Nein, ich begriff, daß ich sie sich selbst geschenkt hatte, nur damit sie direkt zu den Männern gehen konnte. Den Gedanken konnte ich nicht ertragen, Törin, die ich war. Deshalb mußte ich sie verletzen. Das gelang mir auch. Ich fügte uns beiden eine ordentliche Wunde zu, die uns die Trennung wieder möglich machte. Ich sagte ihr eiskalt und ganz bewußt die ungeheuerlichsten Dinge; unter Aufbietung aller meiner Kräfte und der letzten, die mir noch verblieben waren, ließ ich sie einen Schmerz fühlen, der gesund und lebenspendend war, weil er akut und unverschleiert war. Es war das letzte, was ich für sie tun konnte.
Doch nun will ich Ihnen den traurigen Bericht von den Leiden einer jungen Frau geben, meine eigene Geschichte, sozusagen das Portal zu allem, was folgte.
Ich entstamme einem Geschlecht von Offizieren, Schauspielerinnen und wahnsinnigen Pfarrern. Unter den Vorvätern der Ahnengalerie entsinne ich mich unter anderem an einen alten Haudegen mit Vorderlader, der neben einer zerschossenen Kanone stand und augenscheinlich bereit war, in dem Haufen von Leichen, der ihn umgab, umzufallen. In der Familie gab es immer irgend jemanden, der ein Auge, einen Arm oder ein Bein verloren hatte, und viele waren auf fernen Schlachtfeldern umgekommen, die aufzusuchen sie sich gezwungen fühlten, wenn es in unserem Teil der Welt zu friedlich zuging, was oft der Fall war. Da waren auch die Tragödinnen, die in seltsamen Gewändern die stolzen, unglücklichen und dämonischen Figuren der klassischen Dramatik in Stücken von Shakespeare, Racine, Corneille und Schiller kreierten. Wenn ich ihre Porträts betrachtete, konnte ich alle die Seufzer, jedes Stöhnen und alle die Schreie hören, die über ihre Lippen gekommen sein mußten, und ich wurde grün und gelb vor Neid bei dem Gedanken an die Leidenschaften, die sie hatten durchleben dürfen. Na, vielen von ihnen war es ziemlich dreckig ergangen: unglückliche Ehen, wirtschaftlicher Ruin, plötzlicher Fall von der strahlendsten Berühmtheit in totale Vergessenheit, Selbstmord, früher Tod nach kurzer, aber heftiger Krankheit, mehr oder weniger freiwillige Verbannung, öffentliche Enthüllungen von entehrenden Verbindungen oder schamloser und unnatürlicher Neigungen, Eifersuchtsdramen, Rivalisierungen – kurz, alles, was man sich an Bösem, Demütigendem und Bitterem vorstellen kann. Doch auf den Bildern sahen sie allesamt strahlend aus, und die Leidenschaften, die sich in ihren Gesichtern spiegelten, wirkten so edel oder jedenfalls erhaben, daß ich sie keinen Augenblick lang zu dem traurigen Ergebnis ihres Lebens in Beziehung brachte. Im übrigen war ich sicher, daß ich mich mit ihnen in tiefster Übereinstimmung befand, wenn ich selbst das Glück eines strahlenden Augenblickes gern mit aller möglichen Schande und mit Unglück bezahlen wollte. Außerdem verliebte ich mich ganz einfach in sie alle, stundenlang träumte ich, ich sei ihr Streicheltier, und der Gedanke an die knisternden Geräusche, die von ihren Gewändern aus Taft, Seide und Musselin ausgingen, erhitzte mich. Doch dann waren da außerdem die Pfarrer, die Außenseiter der Familie, so muß man sie wohl, glaube ich, nennen, obgleich sie irgendwie gut zu den anderen paßten. Es waren strenge, zerquälte Männer, oft Brüder oder Väter der leichtsinnigen Schauspielerinnen, deren amoralische Neigungen sie sozusagen im Namen der Familie durch eine extra fromme und pflichterfüllende Lebensführung aufzuwiegen suchten. Deshalb hatte keiner von ihnen irgendeine Geschichte, sie waren wie Repetitionen ein und derselben Rolle, sie nahmen es auf sich, diese Rolle von Anfang bis Ende mit demütigem Sinn und unglaublicher Standhaftigkeit durchzuspielen. Einige von ihnen waren jedoch als große Prediger bekannt. Sie zogen gegen Satan in den Krieg, der in ihrer Vorstellung so gegenwärtig war, daß ihn die verschreckte Gemeinde buchstäblich im Kirchenschiff vor sich sehen konnte, und nur unter Entfaltung kühner oratorischer Leistungen überwanden sie ihn. Dann habe ich mir überlegt, ob nicht die Todesverachtung der Offiziere und die Schauspielerei der Schauspielerinnen in diesen schwarzgewandeten Prälaten zusammenkam und sich in ihrem Inneren mit dem unglückseligen Hang zu schwermütigen, düsteren und pantastischen Grübeleien vereinigte, die ihnen dieses zermarterte Aussehen verliehen und die vereinzelte von ihnen mehr als einmal dazu brachten, in der Bekämpfung von Satan zu körperlichen Mitteln zu greifen. Von der Kanzel flog die Bibel quer durch die Kirche, um mit einem Krachen die Tür zum Vorraum zu treffen, die Seine Majestät gerade hinter sich zugemacht hatte.
Leider eignete ich mich nicht für die Theaterlaufbahn, ich war viel zu plump, besonders meine Nase war zu groß, und mein Körper und meine Glieder waren nicht imstande, die geschmeidigen und musikalischen Bewegungen auszuführen, die nun einmal notwendig sind, wenn man der Rolle Leben verleihen und das Publikum verzaubern will.
Deshalb reagierte ich irgendeinen dunklen, in mir wohnenden Hang ab, indem ich zeichnete. Ich zeichnete mit einem ziemlich kräftigen Strich, und zu meinem großen Kummer hatte ich auf dem Papier oft nicht genug Platz für meine Modelle. Gelegenheit zum Modellzeichnen zu bekommen, das war damals für ein junges Mädchen so eine Sache. Zwar interessierten mich nur weibliche Modelle, was die Situation etwas leichter machte, aber dennoch träumte ich natürlich davon, nach Paris zu reisen, um mich weiterzubilden und weil ich das Gefühl hatte, daß mir dort eine weit größere Auswahl an Modellen zur Verfügung stehen würde. Mein Vater war Oberst der Leibgarde, ritt ein schwarzes Pferd und hatte reich geheiratet. Ich reiste mit seinem Segen nach Paris. Er nahm Abschied von mir, als sei ich ein Sohn, der an die Front müsse.
Ich war eine junge Frau, aber ich war es nicht so wie alle anderen jungen Frauen. Das Lachlustige, Kalbrige, Verschämte, Erwartungsvolle und Unerfahrene, das ich an anderen jungen Frauen beobachtete, hatte ich selbst nie gekannt. Ich war Kind gewesen, und etwa mit vierzehn wurde ich – fast von einem Tag auf den anderen – Frau und erwachsen. Ich betrachtete die Welt mit einer gewissen Überlegenheit und kühlen Neugierde. Ich fand sie seltsam und interessant, aber ich hegte keine romantischen Erwartungen. Dagegen stellte ich mir vor, daß ich Leidenschaften erleben würde. Das wollte ich mir nämlich selbst erlauben.
So ein Mensch war ich, als ich die »Académie des Dames« betrat, die in einer Seitenstraße des Boulevard Montparnasse untergebracht war. Das Haus war voller Frauen, die nach Modell zeichneten: Einige träumten von Skulpturen à la Rodin, andere wollten Tänzerinnen à la Degas zeichnen, doch ihr gesamtes Dasein in diesem Atelier hatte für mich nur eine Bedeutung, die überhaupt nichts mit ihren mehr oder weniger gut untermauerten künstlerischen Ambitionen zu tun hatte. Für mich waren wir in einer kultischen Anbetung der Frau versammelt, die mitten im Raum stand und von Zeit zu Zeit zu uns herunterstieg; und unter der Atmosphäre von Ernst und schweigender Arbeitsamkeit, die die meiste Zeit über herrschte, lauerte eine andere Atmosphäre von latenter Erotik. Wie konnte es anders sein? – So viele Frauen beisammen, dicht beieinander, so viel Verlangen nach gegenseitiger Zärtlichkeit, die Sehnsucht, erobert zu werden, Angst und Widerwillen gegenüber diesem fremden und herrschsüchtigen Geschlecht mit seinem Atem aus Cognac und aufgeblähten Bäuchen, der heuchlerischen Farce seiner Ritterlichkeit und seiner Eroberungslust, die sich in jedem beliebigen Augenblick mit der ersten besten Straßendirne zufriedengeben konnte. Ich suchte mir erst eine junge Russin aus, nennen wir sie Anna. Sie war rothaarig und hatte ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen. Ihre Zeichnungen waren zart wie Schatten und ähnelten eher halb materialisierten Träumen als Porträts der Modellfigur, die inmitten des Wirrwarrs von Staffeleien in dem kalten Licht des großen, nach Norden gehenden Atelierfensters für uns Modell stand. Sie wurde jeden Tag von ihrem Mann begleitet und wieder von ihm abgeholt: Pünktlich hielt er mit der Droschke vor der Tür, und ich hatte Gelegenheit, sein Gesicht zu studieren. Es war das alte, matte und versteinerte Gesicht eines noch jungen Mannes, eingerahmt von Koteletten, gleichsam überlagert von einem feinen Nebel, der ihm einen fahlen Schimmer verlieh, eine sehr hohe Stirn, die Selbstbewußtsein und unantastbare Traditionen ausstrahlte. Eigentlich war es ebensosehr er wie Anna selbst, der meine Gedanken um sie kreisen ließ. Sein Aussehen, seine geizige Wachsamkeit – soweit ich sehen konnte, berechtigte nichts den wohlhabenden, müden und genußsüchtigen Taugenichts dazu, der einzige Vertraute ihres Körpers und ihres Gemüts zu sein. Nein, dieser Gedanke versetzte mich in Raserei. Ja, freilich war ich eine schöne junge Frau, das war ich wirklich – wenngleich ein bißchen groß –, aber in Wirklichkeit war ich Dynamit.
So ging ich in den Straßen umher, ich sah die Armen, die Kranken, die Blinden und die alkoholisierten Gaukler mit ihren jämmerlichen Affen, die rund umher in den Vorstädten auftraten, die tuberkulösen Prostituierten und die mißgebildeten und abgestumpften Artisten, deren Kunst darin bestand, sich Stricknadeln durch die Arme und durch die Brusthaut zu bohren und sie mit Gewichten und seltsamen Medaillen zu behängen. Ich betrachtete das alles mit passionierter Kühle, mich ging es nichts an, ich fühlte mich in der geschmeidigen Haut intakt, die mich einschloß und die ich mit so großer Sorgfalt pflegte, alleine mit meinem Dynamit.
Liebe Anna, geh doch mit mir in den Louvre! Er wartete unten in der Droschke. Die Wanderung durch die Säle gab die Möglichkeit flüchtiger Berührungen und anderer Zaubereien, die nun einmal mit so etwas wie meinem Vorhaben verbunden sind.
Ich schenkte ihr Konfekt, sagte aber dann, erzähle es ihm nicht! Sie war verwirrt. Ein anderes Mal im Louvre standen wir vor der Mona Lisa, und ich sagte, Leonardo hat eine Spiegelung von etwas geschaffen, was er selbst nicht verstand. Nur Frauen verstehen es. Die Männer haben immer von ihrem rätselhaften Lächeln gesprochen. Ja, für sie ist es rätselhaft. Es ist ihnen nie eingefallen, uns zu fragen, und das mit gutem Grund. Sie haben Angst davor, sie könnten uns sagen hören, was sie nicht hören wollen. Im übrigen würden sie uns nicht glauben, aber sie wollen es trotzdem nicht hören. Sie haben ihre Bruderschaft, treiben aber Keile zwischen uns, machen uns zu Feinden voneinander, damit wir nichts Ähnliches haben können. Aber wir verstehen das Lächeln der Mona Lisa. Für uns ist es kein bißchen geheimnisvoll. Sie lächelt uns an. Ihr Lächeln spricht zu uns von den Dingen, die wir gemeinsam haben können, wenn sie nicht dabei sind. Ich drückte mich gern auf französisch aus, und was ich sagte, klang auf französisch noch interessanter und überzeugender, als es sonst der Fall gewesen wäre. Ich bin auch sicher, daß es ebensosehr die Sprache war und der Genuß, der damit verbunden war, ihr zu lauschen, wie der eigentliche Inhalt, was auf Anna so verführerisch wirkte, wie es tatsächlich der Fall war.
Träume und Dynamit! Nachdem ich Anna erobert hatte, die ohne Skrupel und mit der größten Eleganz ihren Mann hinters Licht führte, begann mich das Verhältnis ein bißchen zu langweilen. Aber glücklicherweise hatte meine Vertraulichkeit mit Anna zu anderen Möglichkeiten geführt. Es zeigte sich nämlich, daß sie keineswegs ganz unerfahren war, sondern mir den Zugang zu einem ganzen Kreis von Verbindungen eröffnen konnte – die sie freilich selbst nicht pflegte –, die Beziehungen zur Akademie hatten. Das war die wahre »Académie des Dames«, in die ich nun aufgenommen wurde, ein geheimer und weit verzweigter Bund von Frauen mit gemeinsamen Interessen, die zur Vollkommenheit meinen eigenen entsprachen. Das war für mich natürlich ein großes Glück; obgleich mir klar wurde, daß ich auf künstlerischem Gebiet keine nennenswerten Fortschritte machte, besuchte ich doch weiterhin die Akademie. Zwar war es mir allmählich gelungen, das Modell auf dem Papier zu behalten, aber die allzu große Heftigkeit meiner Bleistift- und Kohlezeichnung zu bezwingen, dazu war ich nicht imstande, und die ganz schwarzen, rastlos überarbeiteten und seltsam proportionierten Ergebnisse meiner Anstrengungen entsprachen überhaupt nicht dem, was mir in dem Augenblick, als ich den ersten Strich aufs Papier brachte, vorgeschwebt hatte.
Eines Tages dann stand sie da, die junge schwedische Frau, die ich meine Beatrice nenne. Mag sein, daß sie keine eigentliche Schönheit war, ja, das ist sogar höchstwahrscheinlich. Sie war ein blondes, nordisches Mädchen mit ziemlich gewöhnlichen Farben, einem regelmäßigen Gesichtsoval, aber mit sehr ausdrucksvollen Augen, die leicht verschreckt wirkten, wie die eines Tieres, das jeden Augenblick davonlaufen kann. Ihr Verlobter war ein junger Offizier. Sie zeigte mir eine Fotografie von ihm. Er sah keck aus, Säbel an der Seite, stramme Positur und ein Ausdruck, als sei er darauf vorbereitet, einer jeden Gefahr zu trotzen. Im Augenblick nahm er mit Bravour an ermüdenden und dramatischen Manövern in den Einöden des nördlichen Schwedens teil. Sie war in Begleitung ihrer Mutter nach Paris gereist, um unter gehöriger Aufsicht die künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in hübschen Aquarellen an den Tag gelegt hatte, deren Zartheit eine katastrophale und gefährliche Eigenschaft besaß, eine gläserne Zerreißbereitschaft, die ihre seelische Konstitution widerspiegelte.
Ich erwachte in der Nacht, gejagt von Bildern, die von der Laterna magica unbekannter Kräfte in mein Gehirn projiziert wurden. Dynamit in Funktion! Ich stand auf, lief während der Nacht in den Straßen umher, und ich brauchte die Männer, die mich ansprachen, nur anzuschauen, um sie in die Flucht zu jagen. Ich wußte, daß sie, meine Beatrice, unschuldig war. Ihr Geschlecht war geschlossen wie die weichen und schmollenden Lippen eines niedlichen und ängstlichen Kindes, und der Bausch ihrer Schamhaare war nie gebrochen worden, sondern war jetzt, da sie einundzwanzig war, genauso dicht und verfilzt wie mit siebzehn. Ich sehnte mich danach, meine Finger so scharf wie einen Vogelschnabel hineinzubohren, und das mag egoistisch und brutal klingen, doch teils war ich wirklich von ihr besessen – und wenn man besessen ist, was ist man dann, wenn nicht egoistisch und brutal, wenn wir ganz ehrlich sein sollen? –, teils glaubte ich nicht und glaube es noch immer nicht, daß das ihr an sich schaden konnte. Ihre Unschuld war ja doch kein guter Schutz gegen eine Welt, die voller Bosheit ist, und was würde meine Brutalität sein, verglichen mit der des Mannes, und sich der zu unterwerfen, darauf mußte sie ja eingestellt sein.
Ich stellte ihr also nach und lehrte sie eine weibliche Zärtlichkeit kennen, die ihr neu war. Ich weihte sie langsam in die Geheimnisse unserer Körper ein. Ich war versucht, sie ihr in exotischen Bildern voller starker Farben auszumalen, aber was soll’s! – Der Körper ist ja trotz allem ein höchst handgreifliches Ding, und ich fühle mich ehrlich gesagt fast beschämt, wenn ich alle die poetischen Umschreibungen oder haarklein ausgemalten und übertriebenen Beschreibungen und Umschweife höre, in denen die Männer vor allem schwelgen, wenn sie auf diese Dinge zu sprechen kommen. Nein, was zwischen uns vorging, das bedarf überhaupt keiner näheren Beschreibung, denn das Lustgefühl kann man ja sowieso weder wiedergeben noch erklären, und was das moralische Mysterium betrifft – ich ziehe es vor, es so zu nennen –, an dem ein liebendes Paar teilhat, so wird es dem, der nicht zu irgendeinem Zeitpunkt selbst darin eingeweiht worden ist, sowieso verschlossen bleiben. Und dann ist da alles Drumherum, zerknüllte Laken, knarrende Matratzen, die Spuren von munteren und grausamen Kämpfen – ich gebe zu, daß ich das alles sehr poetisch finde, daß ich gerne in der Erinnerung dabei verweile –, aber wenn man das so aufzählt, dann klingt es ja, ehrlich gesagt, ziemlich trivial.
Außerdem könnte das die Vorstellung vermitteln, unsere gesamte Zeit sei auf diese Weise vergangen, daß zwischen uns nichts weiter gewesen sei als das, was im Bett geschah. Und du lieber Himmel: Das war sehr wichtig, und im Bett begann es erst wirklich – aber außerdem hatten wir viele andere Dinge gemeinsam. Lassen wir nun einmal die Oper, in die wir immer Beatrices Mutter mitgenommen hatten, und lassen wir den Louvre und das Luxembourg-Museum. Ich denke lieber an unsere Spaziergänge in Paris, wo wir zusammen auf Entdeckungsfahrt gingen. Ich kannte die Stadt ziemlich gut, so daß ich fast als Führer auftrat, aber weil Beatrice dabei war, wurde alles für mich irgendwie neu. Sie war wie ein Medium, durch das ich die Dinge auf eine neue Weise spürte. Sie lachte, wenn sie die Affen der Gaukler sah, und der Anblick der Blinden ließ sie weinen. Das Elend der Prostituierten erfüllte sie mit Mitgefühl, und während ich sie wie ein Zoologe betrachtet hatte, der irgendeine Art studiert, so versuchte sie – vergeblich natürlich – sich vorzustellen, wie es sein müßte, »so eine zu sein«! Sie fühlte sich unglücklich und beschämt, wenn sie von einem der Armen oder einem Bettler angesprochen wurde, und der Anblick eines der degenerierten und widerwärtigen Artisten, die selbst mitten im Winter auf einem der Boulevards mit nacktem Oberkörper zu sehen waren, während sie einen Säbel schluckten oder Feuer aus dem Mund spien, erfüllte sie mit einer unerklärlichen physischen Angst.
Wenn sie in der Akademie zeichnete, hatte sie immer Mühe, die Figur richtig auf dem Papier anzubringen. Das heißt, anbringen konnte sie sie schon, aber in der Regel wurde sie sinnlos klein und verschoben, ein in der unteren Ecke mit schwarzen, kaum sichtbaren Bleistiftstrichen gezeichneter Zwerg, so, als habe sie Angst vor der Mitte, wo ja die Kraft von einem Stück weißen Zeichenpapier auch am stärksten verdichtet ist. Sie lachte selbst, wenn sie das Ergebnis sah, doch obgleich sie beharrlich versuchte, gelang es ihr fast nie, diese Neigung zu überwinden. Beatrice hatte eine Stoffpuppe, die sie Friedrich nannte. Sie hatte die Puppe seit ihrer Kindheit und hatte sich nicht bequemen können, sich von ihr zu trennen. Ganz im Gegenteil, sie folgte ihr auf ihren Reisen überallhin, aber dafür sprach sie von ihr in nachsichtigem und scherzhaftem Ton. Der böse Friedrich, wie sie ihn aus irgendeinem Grund ab und zu nannte, hatte seinen Platz auf ihrem Kopfkissen, und sie verriet mir, daß sie immer lange Gespräche mit ihm führte, bevor sie einschlafe.
Beispielsweise hatte sie Friedrich alles über unser Verhältnis anvertraut, und Friedrich war es auch, der sie tröstete, wenn wir uns einmal gezankt hatten. Ich war verblüfft, als ich Friedrich zum erstenmal sah. Er erwies sich nämlich als ein alter Mann mit langen, schlottrigen Armen und Beinen, und obwohl ich ja gewußt hatte – denn Beatrice hatte es mir erzählt –, daß es sich um eine Stoffpuppe handelte, überraschte es mich, daß dieser Friedrich der Tröster und Vertraute ihres Herzens, ein verblichener, fleckiger und aus den Nähten platzender Fetisch aus Wolle und alten Lappen war.
Der heftige Einbruch des Liebesaktes in das Bewußtsein eines Körpers, den Beatrice zum erstenmal erlebt hatte, hatte ihre Hormonproduktion so richtig in Gang gebracht. Ich hatte plötzlich Angst, sie zu verlieren. Es war, als stünde sie allem und allen offen. Zu meinem großen Entsetzen entdeckte ich, daß ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, ohne sie zu sein. Ich versuchte, einen kühlen Kopf zu behalten. Ich sagte mir, daß ich ja genau wüßte, daß früher oder später die Stunde der Trennung schlagen würde – was augenblicklich dazu führte, daß mein Bewußtsein sich total verdunkelte. Deshalb begriff ich, daß die Katastrophe unumgänglich war. Ich sprach mit Beatrice darüber: Sie klammerte sich an meinen Hals und sagte, daß sie mich nie, nie verlassen würde, aber das waren nur Worte. Sie glaubte zwar selbst daran, während sie sie aussprach, aber ich kannte ihr Herz.
Nun verriet sie mir auch, daß sich ihr Verhältnis zu Friedrich geändert habe. Eines Abends, als sie zu Bett gegangen war, hatte er nämlich darum gebeten, zwischen ihren Brüsten liegen zu dürfen. Anfangs fand sie das eine wunderliche Idee, aber er hatte sie immer weitergequält, und schließlich hatte sie nachgegeben. Da sie ganz still lag, hatte es sie nicht gestört, daß er dort lag, sie fand es im Gegenteil ganz angenehm, und obgleich er augenscheinlich der Ansicht war, daß ihm dies das Recht zu einer gewissen Narrenfreiheit gebe, konnte sie sich über seine unschuldigen Einfälle nur amüsieren. Was mich betrifft, so konnte ich dieses Amüsement nicht teilen. Ich mußte immer daran denken, daß Friedrich aussah wie einer von diesen alten Greisen in einer schwedischen Häuslerhütte, in etwas verschlissenen und zerfransten Sachen und mit Tabaksabber im Bart. Ich tat, als sei nichts, aber es mag schon sein, daß Beatrice bereits zu dem Zeitpunkt ahnte, was in mir vorging. Jedenfalls konnte ich in der folgenden Zeit nicht umhin, über Friedrich nachzudenken, vor allen Dingen am Abend, wenn ich mich schlafen gelegt hatte. Während ich mich zuvor mit friedvollem Gemüt hingelegt hatte – das heißt: relativ, denn wenn zwei Menschen voneinander besessen sind, so, wie das mit mir und Beatrice der Fall war, dann kann keiner von ihnen jemals wirklich Frieden in seinem Gemüt haben –, so lag ich nun da und drehte und wendete mich und konnte die verdammte Stoffpuppe nicht aus dem Kopf kriegen. In der darauffolgenden Zeit sagte Beatrice jedoch nichts von Friedrich, schließlich, als ich es nicht länger aushalten konnte, fragte ich sie eines Tages leichthin – so leichthin ich nun einmal konnte – und mit einem munteren Tonfall, wie es denn ihrem Bettkameraden gehe? Wiegst du ihn noch immer zwischen deinen Brüsten in den Schlaf? Beatrice sagte nein und sah ziemlich gekränkt aus, doch ihrem verletzten Ausdruck konnte ich entnehmen, daß die Frage mit dieser Antwort noch nicht erschöpft war. Nach einigem Schweigen begann ich sie also auszufragen, und obgleich sie anfangs ziemlich mürrisch war und nicht mit der Sprache heraus wollte, so gelang es mir allmählich doch, sie so zu locken, daß sich ihre Zunge löste. Ihr habt wohl süße Geheimnisse, du und dein Friedrich, sagte ich lächelnd, während ich ihr Haar liebkoste, und ihr Blick verschleierte sich ganz, sie lächelte, als sei sie von den süßesten Gedanken erfüllt. Es zeigte sich denn auch, daß Friedrich, statt zwischen ihren Brüsten zu ruhen, nun seinen Platz zwischen ihren Beinen gefunden hatte, wo es ihm offensichtlich so gut ging, daß er sich nichts Besseres wünschen konnte, wo er dafür aber auch jeden Abend angebracht zu werden verlangte.
Ach, meine arme Phantasie, die nicht umhinkonnte, sich in die erotische Perversion, deren Zeuge ich hier war, zu vertiefen! Meine süße, unschuldige Beatrice war bei weitem nicht so unschuldig, wie ich die ganze Zeit über angenommen hatte: Selbst in ihrer Entdekkung der Liebe war sie voller Unschuld gewesen. Nun mußte ich meine Auffassung revidieren. Es ging mir nämlich auf, daß sich das liebe Kind dieser Puppe nicht nur in einem zärtlichen und intimen Liebesverhältnis hingab, sondern daß es ihr einen ausgesuchten Genuß bereitete, mich zu ihrem Mitwisser zu machen. Ihr Verlobter, dessen Ankunft sich nun hastig näherte, war für mich zu einer unbedeutenden und ungefährlichen Figur zusammengeschrumpft. Ich erblickte eher einen Bundesgenossen in ihm. Das Seltsamste war, daß ich meinen besten Bundesgenossen in Beatrice selbst hatte.
Beatrices unkomplizierte Jungmädchenseele war eine Wildnis voller widerstreitender Eingebungen, und der Teil von ihr, der danach verlangte, in der Liebeserfüllung, die wir zusammen erlebt hatten, Frieden zu finden, betrachtete verzweifelt und offensichtlich, ohne etwas dagegen tun zu können, die schleichenden und sie überrumpelnden Neigungen, denen sich ihr anderer Teil mit so großem Genuß hingab. Innerhalb ein und derselben Stunde konnte sie mit hintergründiger Boshaftigkeit einige Bemerkungen über die neueste Entwicklung in ihrem Verhältnis zu Friedrich fallenlassen und mir gleichzeitig weinend anvertrauen, daß diese manifestierte Bosheit ihr selbst die größten Leiden bereite. Sie dachte jedoch nicht im Traum daran, sich von Friedrich zu trennen, was das einfachste und effektivste gewesen wäre, und als ich es ihr einmal geradeheraus vorschlug, da weigerte sie sich zu glauben, daß dies kein Spaß gewesen sei. Dann sagte sie zu mir, ihr größter Kummer sei, daß wir kein Kind bekommen könnten. Diesen mir recht abstoßend vorkommenden Gedanken fand sie so bezaubernd, daß sie sich den weitschweifigsten Phantasien über dieses unmögliche und hypothetische Kind hingeben konnte; über dessen Geschlecht war sie sich jedoch nicht ganz sicher, weshalb sie sich auch nicht entscheiden konnte.
Das natürlichste wäre selbstverständlich ein Mädchen, sagte sie gedankenverloren, stell dir vor: ein Mädchen, das erst ein niedliches kleines Wesen ist, das wir mit den hübschesten Kleidern schmükken können und das zu unserem Kameraden heranwächst. Sie soll viel von dir haben, denn du bist so klug und stark – aber auch etwas von mir, nicht war? – auch ein klein bißchen von mir! Und wenn es eine Junge würde – denn das ist doch gut denkbar, nicht wahr? Das ist nicht ganz unmöglich, nicht wahr? –, dann könnten wir ihm ganz heimlich Mädchensachen anziehen, wenn wir mit ihm spielen. Es gibt nichts Niedlicheres als kleine Jungen in Mädchenkleidung, nicht wahr? Aber natürlich sollte er zu einem feschen Kerl heranwachsen wie mein ... Ich meine nur: falls es ein Junge werden sollte. Denn das ist doch trotz allem nicht ganz undenkbar, oder?
Das ist absolut vollständig undenkbar, sagte ich empört, das kannst du dir doch selbst ausrechnen.
Ich meinte nur, die erschreckte Beatrice flüsterte fast, aber trotzdem hartnäckig, wenn es nun vielleicht doch passieren sollte, nicht wahr?
Nun war ich ganz kalt und ruhig geworden und antwortete deshalb: Wenn es ein Junge werden sollte, was ich für eine Unmöglichkeit halte, dann erwürge ich ihn nach der Geburt mit meinen eigenen Händen.
Beatrice begann zu weinen, und ich mußte sie trösten, aber es war, als seien wir beide von irgendeiner seltsamen Distraktion getroffen worden und nicht ganz anwesend, weder sie in ihrem Weinen noch ich in meinen tröstenden Worten. Woran dachten wir? Weiß der Himmel, woran, doch sobald wir selbst diese Distraktion entdeckt hatten, begannen wir sie resolut zu bekämpfen und mußten deshalb unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten. Das Ergebnis war, daß wir beide in tiefes Sinnen versanken und damit noch weniger anwesend waren, wir waren mit Welten beschäftigt, die für den anderen nicht zugänglich waren.
Ich hatte oft und wiederholt versucht, Beatrice dazu zu überreden, ihre Zukunft mit mir zu teilen. Nichts hätte sie lieber getan, aber so ohne weiteres ihre Mutter zu verlassen, gerade jetzt, das konnte sie doch nicht. Sie besaß überhaupt weder genug Stärke noch Selbständigkeit, um einen solchen Schritt zu machen, und ich wußte schon lange, daß die Gespräche, die wir über unsere gemeinsame Zukunft geführt hatten, nichts anderes waren als Luftschlösser. Diese Wahrheit begann nun Beatrice zu dämmern.
Ich hatte jedoch auch nicht vergessen, daß mein größter Gegner Friedrich war. Denn selbst wenn Beatrice nun fortreisen und sogar heiraten mußte – der Gedanke war abscheulich, darin waren wir uns einig –, so würden wir auch weiterhin die Verbindung aufrechterhalten können, zuweilen uns treffen können – überhaupt redeten wir einander alles mögliche ein, während wir so über die unabwendbare Zukunft phantasierten. Aber war Friedrich auch ein Teil davon? Irgendwie war mir klar, daß er zerstört werden mußte, und dazu schien es mir nur einen einzigen Weg zu geben: Man mußte ihn lächerlich machen. Deshalb begann ich, wenn wir uns in Gesellschaft anderer befanden, von dieser seltsamen Stoffpuppe zu erzählen, die nun treu so viele Jahre hindurch Beatrice begleitet hatte, und ich machte das so witzig und elegant, daß Friedrich unter Umständen dem Gelächter ausgeliefert wurde, in dem Beatrice ihm nicht zu Hilfe kommen konnte. Arme Beatrice, das Gelächter traf sie blutig, und sie mußte ihre Gefühle verbergen. Wie kommt es bloß, daß bestimmte Gegenstände der Liebe eines Menschen würdiger sind als andere? Ein Tier zu lieben, das ist in den Augen der meisten bereits schlimm genug – jedenfalls, wenn es die einzige Liebe eines Menschen ist. Aber eine Stoffpuppe! Die Liebe eines erwachsenen Menschen zu einer Stoffpuppe, das ist eine schreckliche und gefährliche Sache. Gerade deshalb bekriegte ich Friedrich. Ich fand nicht das Verhältnis lächerlich, doch ihn lächerlich zu machen, das war ein Werkzeug, das ich in meinem Krieg einsetzen konnte. Ich versuchte, die Ergebnisse meiner Strategie zu bewerten – und entdeckte, daß zwischen uns nun keine Liebe mehr bestand, sondern irgendeine mörderische Beschäftigung, die die Liebe als Deckmantel benutzte und mehr oder weniger daran gebunden war.
Meine Strategie gelang, das muß ich schon sagen. Ihre Ergebnisse waren furchteinflößend, aber auch unvorhergesehen. Beatrice hatte nun noch größere Schwierigkeiten beim Modellzeichnen, wo sie im übrigen ansonsten gewisse bescheidene Fortschritte gemacht hatte. Nun fiel ihr die Aufgabe wirklich schwer. Zunächst saß sie nur da und starrte auf das Modell, als sei irgend etwas Auffälliges daran, von dem sie die Augen nicht abwenden konnte. Wenn sie dann endlich anfangen wollte zu zeichnen und gerade den ersten Strich aufs Papier bringen wollte, zögerte sie einen Augenblick und warf noch einen Blick auf das Modell. Sie begann am Bleistift zu kauen. Sie schaute sich nach allen Seiten um, als suche sie Hilfe, näherte den Bleistift wiederum dem Papier, konnte sich dann aber trotzdem nicht entschließen. So verging die Zeit, bis das Modell seine Stellung änderte, mit dem Ergebnis, daß sie höchstens einen einzelnen Strich gemacht hatte, dessen zusammenhanglose Gegenwart auf dem weißen Bogen ihr monströs und unberechtigt erschien.
Eines Tages, als ich in der Wohnung, die sie zusammen mit ihrer Mutter auf dem Boulevard Saint-Germain bewohnte, einen Besuch machte, wurde ich Zeuge von Friedrichs Untergang und direkt in seine Beisetzung verwickelt. Ihre Mutter – diese nette und würdige Dame, Erbin von Eisenwerken, großen Höfen und unermeßlichen Wäldern – trippelte nervös umher und erzählte mir atemlos, Beatrices Benehmen komme ihr absonderlich vor. Es zeigte sich nun, daß Beatrice Friedrich zerlegt hatte. Sie hatte erst den Kopf abgerissen, danach die Arme und Beine, und zuletzt hatte sie den Körper aufgeschlitzt und in Stücke gerissen. Die verstümmelte Stoffpuppe lag auf dem Fußboden ihres Zimmers, und sie schaute mich mit einem sonderbaren Lächeln an, das mich die Augen abwenden ließ. Die ganze Zeit über war es mir so erschienen, als sei mein Unglück größer als das von Beatrice: Wenn sie erst von mir getrennt und mit diesem Mann vereint war, würde sie sicher in einem neuen Dasein Ruhe finden und höchstwahrscheinlich – ich machte mir keine Illusionen im Hinblick auf die Beständigkeit ihrer Gefühle – darin glücklich werden. Ich selbst dagegen machte mich auf ein Leben in mehr oder weniger totaler Einsamkeit gefaßt. Das würde ich sicher auch ertragen können, aber ich mußte stark sein, sehr stark. Der Anblick der jämmerlichen, losgerissenen Teile der Stoffpuppe ließ mich begreifen, daß Beatrice etwas von sich selbst verstümmelt und geschändet hatte und daß ich tief an dieser blutigen Handlung beteiligt war. Deshalb war es auch mehr als eine reine Formsache, als sie mich darum bat, ihr beim Aufsammeln der Fetzen zu helfen. Ich bückte mich, hob ein Bein, einen Arm und einige Wollfäden auf. Dann kam sie zu mir mit den übrigen Resten, die sie selbst zusammengesucht hatte, und legte sie in meine Hände.
Friedrich, wahrscheinlich ein Geschenk von irgendeiner alten Tante, war fast nicht wiederzuerkennen, und ich empfand, wie absonderlich es war, persönlich an dem traurigen Schicksal dieses gefährlichen Spielzeugs teilzunehmen, aber genau dazu zwang mich Beatrice.
Es war das letzte Mal, daß ich sie sah. Sie war etwas geistesabwesend, als denke sie die ganze Zeit über an irgend etwas weit Entferntes. Ich nahm die Reste der Stoffpuppe mit hinunter und warf sie in den Mülleimer.
Ich glaube schon, daß ich unglücklich war, aber ich entsinne mich nicht. Große Unglücke und Schmerzen verleihen dem Leben Inhalt wie nichts anderes. Dennoch vergißt man sie bekanntlich. Na, natürlich kann ich mich gut erinnern, daß es mir schrecklich ging, wenn ich mich ein bißchen anstrenge. Doch nun kehre ich zu meinem Geschlecht zurück, von dem ich anfangs erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ich zu den Offizieren, den Schauspielerinnen oder den wahnsinnigen Pfarrern zu rechnen bin – vielleicht gehöre ich in alle drei Kategorien, denn oft scheint es mir, als sei ich im Krieg gewesen und schwer verwundet worden, ich bin in mehreren Rollen aufgetreten, und der Wahnsinn, der Gespenster sieht und hört, den kenne ich ausgezeichnet. Doch davon wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Ich war also am Ende, und wenn wir in meiner Familie am Ende sind, dann ist das ein Zustand, mit dem nicht zu spaßen ist. In der folgenden Zeit trieb ich ziellos in Paris umher, ohne mich dazu entschließen zu können, was ich mit mir selbst anstellen sollte. Eines Tages saß ich auf einer Bank im Jardin du Luxembourg neben einer alten Frau. Kennen Sie die alten Frauen von Paris? Immer ganz in Schwarz und auf eine besondere Weise gealtert, die sich nicht erklären läßt. Sie sind wie eine Art Fauna, die mit zur Stadt gehört, denn man hat fast den Eindruck, daß die Häuser selbst sie geboren haben: die düsteren Pförtnerlogen und diese dunklen Tunnel aus Korridoren in den Seiten- und Hinterhäusern und die feuchten Schächte der Höfe, all das, was ein jeder, der in Paris gelebt hat, kennt und was viel mehr Paris ist als der Eiffelturm und der Triumphbogen und der Place de la Concorde.
Die Frau war uralt und geschrumpft und trug einige Lumpen, die sozusagen in den zerfetzten Lappenschuhen gipfelten, die sie an den Füßen trug. Ich glaube, wir kamen überhaupt nur ins Gespräch miteinander – es war nichts, was ich wollte, es geschah bloß –, weil ich so elend aussah. Ich muß einem Wrack sehr ähnlich gewesen sein. Um nun alle Zwischenschritte zu überspringen, will ich lieber gleich erzählen, daß es sich herausstellte, daß sie Dänin war. Sie war also nicht von einem der Häuser geboren worden, doch so sieht man aus, wenn man lange genug dort gelebt hat und arm genug ist. Sie war – ganz im Gegenteil – in Kopenhagen geboren, sie war Schauspielerin gewesen und war als junges Mädchen in Heibergs Vaudevilles aufgetreten. Sie hieß Camilla und war voller Temperament. Sie brauchte eine größere Bühne als Kopenhagen, um sich entfalten zu können. Das Leben sollte jedenfalls nicht ohne Abenteuer abgebrannt werden. Das führte im Laufe von wenigen Jahren zu großem Elend. Ein Kind, das sie in Paris mit einem polnischen Violinvirtuosen zeugte, starb schnell. Sie reiste viel umher, aber irgendwie war sie von Paris eingefangen worden und kehrte immer wieder zu den dunklen Pförtnerlogen, den kalten und feuchten Wohnungen und zu der ganzen strahlenden und animierten Lebensentfaltung zurück, die so aufreizend auf ästhetische Gemüter wirkt, daß viele von ihnen lieber im größten Elend zugrunde gehen wollen, als sich unter Erhaltung eines gewissen Wohlseins in dem vertraulichen Frieden von eher stillstehenden Umgebungen durchzuschlagen.
Nun war meine Neugierde geweckt worden, denn aus den Antworten auf meine Fragen konnte ich entnehmen, daß ich einer quicklebendigen Ausgabe der Schauspielerinnen gegenübersaß, deren phantastischen Schicksale die Geschichte der Familie illuminierten. Eine Tragödin war Camilla zwar nie gewesen, aber dafür hatte sie im wirklichen Leben mehr erlebt als die meisten. Der Höhepunkt, an den sie am liebsten zurückdachte und über den sie am liebsten sprach, waren die Schrecken, die sie in Paris während des Krieges und der Kommune erlebt hatte. Sie war vor den Nationalgardisten aufgetreten, das Pflaster der Straße war ihre Bühne, ein neues und dankbares Publikum huldigte ihr, diesem Publikum war es gleichgültig, daß ihre Kleider schon längst aus der Mode und immer wieder geflickt waren. Als der Hunger immer gräßlicher wurde, organisierte sie die Durchführung von radikalen Maßnahmen zu seiner Bekämpfung und zur Einführung von bisher nie gesehenen Gerichten auf der Tageskarte. Nachdem sie das erste Mal eine Katze gefangen, geschlachtet und zerteilt hatte, fühlte sie sich wie in eine Gemeinschaft des Elends aufgenommen, zu der Zugang zu erlangen nicht jedem gegeben war. Nun können sich die Katzen nicht mehr sicher wähnen, erklärte sie grimmig, und was euch betrifft, Kinder – so sagte sie zu den großen, halb verhungerten Mannsbildern –, so sollen meine beiden Hände euch in den nächsten paar Tagen schon Essen in eurem Bauch verschaffen.
Während ich Camilla zuhörte, mußte ich unwillkürlich an Beatrices und meine Geschichte denken. Ich dachte an die große, geräumige Wohnung, in der Friedrich seine Tage geendigt hatte, an die Akademie, wo wir arbeiteten – und bis zu einem gewissen Grade zum Schein arbeiteten, denn niemand von uns bildete sich ein, ein großer Künstler zu sein, aber wann wurde es dann eigentlich Ernst? –, und an unsere Spaziergänge in der Stadt als Beobachter. Was für eine Rolle spielten unsere kleinen Leiden, wenn man an die Hungrigen und Verletzten von damals dachte? Wenn Camilla mit der Wirklichkeit fertig geworden war, war es dann nicht verächtlich und lächerlich von mir, aufgrund von Liebeskummer und einer zerfetzten Stoffpuppe den Untergang der Welt zu erleben? Waren das nicht alles Leiden, die nur deshalb eine so große Rolle spielen durften, weil sie von einer größeren, brutaleren, elementaren und anspruchsvollen Wirklichkeit abgetrennt waren – der Wirklichkeit, auf die Menschen im allgemeinen nun einmal angewiesen sind und die ab und zu von fürchterlichen Katastrophen in Form von Kriegen und Revolutionen getroffen wird? Ja, so verhält es sich ganz sicher, sagte ich zu mir, doch im nächsten Augenblick stieg Beatrices Bild vor mir empor, und ich wußte nicht mehr, wie es möglich sein sollte, die menschlichen Leiden zu klassifizieren – und ich weiß nicht, ob ich dabei an meine eigenen oder besonders an die ihren dachte. Doch noch heute durchfährt es mich eiskalt, wenn ich an ihr Gesicht denke, als sie mir die Reste der Stoffpuppe hinreichte, und irgend etwas in mir krümmt sich in Abscheu und Entsetzen, wenn ich daran denke, was ich an jenem Tag im Mülleimer verschwinden ließ.
Camilla, die neben mir an die Zubereitung der enthäuteten und zerlegten Katzen dachte, gluckste vor Lachen und zeigte mir ihren zahnlosen Kiefer.
Ja, so war das, sagte sie, aber niemand kann sich vorstellen, was ich damals erlebte.
Die Schrecken und der Hunger in der belagerten Stadt waren unbeschreiblich, aber ich sage Ihnen, liebes Kind, da waren auch Mut und Stolz und eine Ausdauer, von der man nicht hätte träumen können. Ja, die wirklichen Schauspieler kennen das alles, das kann ich Ihnen versichern – gleichgültig, ob sie auf der Opernbühne stehen oder in dem kleinsten Kabarett, um nicht zu sagen auf der Freilichtbühne des schäbigsten Vorortviertels: Die wirklichen Schauspieler, die geborenen Gaukler, die sich dem eisernen Gesetz des Gauklerdaseins unterworfen haben – kleine Mädchen, die irgendwelche Lumpen mit Nadeln aufstecken, um wie Königinnen zu strahlen, und die die dummen Augen aller Zuschauer zwingen, diesen Strahlenglanz wirklich zu sehen –, die kennen es, weil sie an jedem Abend ihr Leben einsetzen und mehr Mut mobilisieren müssen, als ein kleines Menschenherz augenscheinlich fassen kann, doch gerade dazu ist das kleine Menschenherz ganz genau geschaffen worden. Und plötzlich waren alle Menschen imstande, den gleichen Mut zu zeigen, und die Barrikaden der Trümmer bildeten eine Szenerie, die nach Helden, wirklichen Helden rief – nicht nach Lügenmäulern, aufgeblasenen Offizieren, Advokaten oder Politikern, die von Heldenmut nur reden –, sondern nach ganz gewöhnlichen, kleinen zähen Helden, denen es schwerfällt, sich auszudrücken; denn die Szenerie war Wirklichkeit. Hier war es unmöglich zu kneifen, doch ach, wie wurde ich von dieser Wirklichkeit zerschlissen. Und entweder war ich nicht mutig genug, oder ich war einfach nur wie alle anderen auch, jedenfalls mußte ich ab und zu einen Ort finden oder irgendwo Zuflucht suchen, wo ich mich aufhalten konnte, ohne daß irgend jemand an mich Ansprüche stellte, auch ich selbst nicht.
Eines Abends gehe ich so an der Seine entlang. Ich gehe unten am Kai entlang und denke, jetzt ist es fast so, als sei ich außer der Zeit: Hier fließt das Wasser faul vorbei und spiegelt den Abendhimmel. Hier sind keine Menschen, die um das Recht kämpfen, Atem holen zu dürfen, um das Brot und den Wein, um das Wort, um irgendwelche Grenzen – das Wasser fließt einfach vorbei, und mir ist alles egal, und ich versuche, es nachzuahmen. Eine Weile will ich alles durch mich hindurchfließen lassen, ich will wie ein Flußbett sein, durch das die Dinge einfach hindurchfließen können, und dann kommen die Sterne am Nachthimmel vielleicht auch zu mir und spiegeln sich in mir. Mit anderen Worten: Selbst inmitten des Lärms und der Katastrophe bin ich ein empfindsames Gemüt, ich brauche nur etwas Stille, nur die Einsamkeit einiger Minuten, und sofort bin ich bereit, mich solchen Träumereien hinzugeben. Aber dennoch, um die Wahrheit zu sagen – ganz hingeben konnte ich mich nicht. Irgendwo in meinem Hinterkopf schmerzte es immer weiter: Was wird morgen? Was mit meinen Freunden? Wo finde ich die Kraft, noch einen Tag zu ertragen? Wie soll ich den Glauben bewahren, und wie mache ich es, daß der Glaube und die Begeisterung in meine Beine strömen, so daß sie tanzen können? Denn es war wirklich ein Tanz für das Leben. Ich tanzte für die Verlorenen auf den Schanzen. Ich wollte tanzen, nicht, damit sie vergessen konnten – die Zerbrechlichkeit der Schanze, die Rücksichtslosigkeit der Übermacht, ihre eigene Todesangst vergessen –, sondern um sie noch mehr zum Leben zu erwecken, um den Traum in ihnen zu wecken, ihm Fleisch und Blut zu verleihen, ihn wild und unersättlich zu machen, und so ein Tanz ist vielleicht nicht der schwierigste – aber jedenfalls einer der schwierigsten überhaupt, den man auf sich nehmen kann. Sie verstehen sicher, daß das hier etwas ganz Neues für mich war, wo ich doch meist in Operetten und solchen Sachen aufgetreten war. Aber ich hatte es in mir, wenn ich das sagen darf.
Na, das aber war also der Grund: Ich hatte mir zwar so einen freien Abend genommen und ließ meine Gedanken zur Ruhe kommen und versuchte, dieses Flußbett zu werden, das die Dinge dahinströmen läßt, ohne einen Unterschied zu machen, ohne zu verschmähen und zu verwerfen, ohne zu verurteilen, ohne mich vor ihnen zu ängstigen oder mich darüber aufzuregen, um ein so blanker und lebendiger Spiegel zu werden, wie es die Sterne nun einmal verlangen – hören Sie, bin ich nicht poetisch? So war es tatsächlich –, jedoch wollte es mir letzten Endes nicht wirklich gelingen.
Das ist aber auch der verdammte Krieg, sagte ich zu mir. Weshalb habe ich mich nicht in Wien oder in London oder in Rom niedergelassen – irgendwo, wo kein Krieg ist. Und weshalb sitze ich hier in Paris in der Falle und tanze mir die Füße blutig für diesen verdammten Pöbel, auf ihrem harten Pflaster, statt irgendwo auf den glatten Brettern einer Bühne aufzutreten, hinter deren strahlendem Rampenlicht ich die Minister, Fürsten und Generäle des Parketts und diese Damen da ahnen kann, deren Köpfe allesamt berühmten Skulpturen ähneln, wie man sie jedes Jahr im Salon sieht, weil das Haar hochgekämmt ist und so einen Aufsatz bildet, der auf dem Kopf ruht und ihn verlängert – nur mit dem Unterschied zu den Skulpturen, daß sie die Köpfe mit kleinen, nicht sehr ausladenden Bewegungen bewegen und verwundert mit den Augen zwinkern und kleine, lebendige Singvögel in ihren Kehlen eingebaut haben, die ansonsten genauso glatt und rein in den Linien sind und ohne eine einzige Falte wie das feinste, glatte, polierte Marmor. Trotz allem liebe ich es ja, wenn sie klatschen, das will ich gern zugeben, wenn ich so über einen Saal hinausblicke, der siedet und braust, und der Beifall mir gilt und wenn ich das Licht in den Juwelen und in den Orden blitzen sehe, dann friert es mich den Rücken entlang, ich friere vor Glück und fühle mich stark wie eine Zauberin, die ihre ganze Stadt verhext hat und sie in der Hand hält.
Na, nun verliere ich gewiß den Faden, aber was ich sagen wollte, war also, daß ich mich da so fragte, was eigentlich der Sinn der ganzen Sache sei, und insbesondere, was der Sinn der Tatsache sei, daß ich mit den Untersten zusammen in die Falle gegangen war, wenn ich ebensogut – wenn ich nur rechtzeitig nachgedacht und daran gedacht hätte, was meinem eigenen Besten diente – mit den Oberen hätte meinen Spaß treiben können. Denn gleichgültig, wie man es dreht und wendet, letztlich ist sich ja ein jeder selbst der Nächste, nicht wahr? Und dennoch konnte ich nicht bereuen. Ich konnte meine eigene Dummheit verfluchen, und das tat ich auch, aber bereuen konnte ich nicht. Nein, da war nichts zu machen. Ich hatte mich den Unteren verschrieben.
So stand mein Schicksal vor mir, während ich da an der Seine entlangging und mit mir abrechnete und der Tatsache ins Auge sah, daß meine Karriere vorbei war, daß ich aus dem Sumpf, in den ich gesunken war, nie mehr hochkommen würde, daß ich höchstwahrscheinlich auf die eine oder andere Weise zugrunde gehen würde – denn entweder würde ich irgendwann erschossen werden, und damit Schluß, oder meine Aussichten waren allem Anschein nach für alle Zukunft verdorben, weil ich mich mit dem Pöbel gemein gemacht hatte; und sollte es wirklich nicht der Fall sein, wo sollte ich da die Kraft hernehmen, um hinterher weiterzuleben, in neuen Singspielen oder lächerlichen Komödien aufzutreten, die Kraft, an irgend etwas dessen, was danach kommen würde, zu glauben. Es kam mir nämlich so vor, als hätte ich in den letzten Wochen mehr Kraft verbraucht als in meinem gesamten bisherigen Leben, und ich hatte mich doch eigentlich nicht geschont. Ja, in meinem kleinen Körper hatte ich Reserven entdeckt, das kann man schon sagen, ich war in unbekannte Tiefen hinabgetaucht, die sich mir eröffnet hatten, und hatte ihnen unentdeckte Schätze entrissen, mit dem Ergebnis, daß ich jeden einzigen Morgen mit dem merkwürdigen Gefühl erwachte, neu geboren zu werden. Aber mir war völlig klar, daß das nicht dauern konnte. Eines Tages würde ich verschlissen sein. Seltsamerweise störte mich das nicht im geringsten. Soll ich mit den Unteren zugrunde gehen, so tue ich es eben, sagte ich zu mir, und dann dachte ich nicht mehr darüber nach.
Ich wurde durch ein Flüstern aus meinen Gedanken und Träumereien geweckt. Es war, als riefe mich jemand, und mein erster Gedanke war, daß irgendein hungriger Nationalgardist gerade jetzt, wo ich hier unten am Kai Ruhe gesucht hatte und nun aus der Dämmerung unter der Brücke – denn ich ging gerade unter einer der Brücken hindurch – die Frau entdeckt hatte, die einsam da vorbeiging, und deshalb von einem noch größeren Hunger gepackt worden war und mich deshalb anrief, damit sie ihr Elend miteinander teilen konnten. Ich zögerte. Ja, durchfuhr es mich, ich will in das Dunkel hineingehen. Ich habe nach Parfüm duftende Männer hinter den schweren Seidenportieren pompöser Himmelbetten umarmt; ich habe die blanken Knöpfe in stramm sitzenden Uniformen gezählt und, während ich mich hinter einem Schirm entkleidete, das Klirren des Säbels gehört, der auf einen Tisch gelegt wurde; meine kleine Hand hat die Zunge eines schweißigen Theaterdirektors geführt – ja, Sie wissen schon, was ich meine! –, weil er Schwierigkeiten hatte und so gerne wollte; all das und noch viel mehr habe ich getan, weshalb sollte ich also jetzt nicht in das Dunkel hineingehen, wo die Erde hart ist wie Stein und wo mich vielleicht irgendein zerlumpter Nationalgardist erwartet, der eine Fahne von billigem Wein hat und unter dem Arm nach Schweiß stinkt und dessen Gesichtszüge ich im Dunkeln noch nicht einmal unterscheiden kann?
Nachts sind alle Katzen grau, sagt man ja, und ich möchte gerne für mich selbst hinzufügen, wenn man beschlossen hat, in das Nachtdunkel hineinzugehen, dann kann man durchaus sicher sein, daß es noch dunkler ist, als man geglaubt hatte, und es kann leicht alle möglichen Überraschungen bergen. Denken Sie nur an Thor, der vor der Nacht Schutz in einer Höhle oder in einem Haus mit reichlich Platz gesucht hatte und am nächsten Morgen entdeckte, daß es sich um den einen Handschuh eines fürchterlichen Riesen handelte. So kann es einem gehen, wenn man absolut in das Dunkel hineinspazieren möchte, und hinterher nützt es gar nichts, wenn man sich beklagt. Ich hörte dieses Flüstern noch einmal, als riefe mich jemand, und nun war mir aus irgendeinem Grund klar, daß es kein Nationalgardist war. Da ich immer für alles zu haben gewesen bin, trippelte ich also entschlossen näher, und ich sage Ihnen – das war jedenfalls kein Nationalgardist!
Die Mauer dort unter der Brücke ist aus gewaltigen Steinen erbaut, großen Quadern, die nur roh zugehauen und übereinandergestapelt sind, so daß es aussieht wie ein Bauwerk aus irgendeiner Urzeit oder aus einer Zeit, wo diejenigen, die regierten und solche Mauern aufführten, rücksichtslose und grausame Tyrannen waren, die sich vor ihren Untertanen in Gebäuden schützen mußten, die am ehesten noch an Gefängnisse erinnerten. Mitten in dieser Riesenmauer ist da ein Tor, nein, eine Öffnung, denn sie ist mit einer so kräftigen Gittertür verschlossen, daß sie aussieht, als könne sie tausend Jahre halten.
Aus dem Loch kommt auch ein tausendjähriger Gestank – ein Gestank von Schlamm, der so alt ist, daß man glauben sollte, er stamme aus der Zeit, als Noah mit der Arche herumschwamm und die Wasser endlich sanken; das muß ein fürchterlicher Anblick gewesen sein, so ein Modder! –, ein Gestank von Schimmel und Verwesung und von Exkrementen, die, so sollte man glauben, jahrhundertelang in langsam dahingleitenden Wassern wie auf großen Ozeanen herumgetrudelt waren. Dann ist der ursprüngliche scharfe Gestank längst verschwunden, aber etwas anderes ist an seine Stelle getreten, na, und viel mehr, was sich unmöglich mit Worten beschreiben läßt. Und dann muß man bedenken, daß es dort immer klamm ist. Als ich da also im Dunkeln stand und das Gitter angelehnt war, da bekam ich diesen kalten, klammen Luftstrom – mit allen Gerüchen, die ich gerade eben beschrieben habe – geradewegs ins Gesicht, und er legte sich auch um meinen Körper, so daß ich vom Scheitel bis zur Sohle zu zittern begann, und eine Stimme in mir sagte, kehr um, kleine Camilla, kehr um, bevor es zu spät ist! Doch auf diese Stimme (ich kannte sie nämlich sehr gut) habe ich nie gehört, deshalb kommt es mir auch so vor, als hätte ich nicht nur meine fünfundsiebzig Jahre gelebt, sondern dreimal fünfundsiebzig Jahre oder mehr.
Wie ich nun so dastehe und am ganzen Körper zittere und auf das Gitter starre, das einen Spalt breit offensteht – ich konnte es gerade eben ahnen, als sich meine Augen erst einmal an das Dunkel gewöhnt hatten –, da merke ich, wie etwas Glattes meinen Fuß berührt, meinen rechten Fuß, um ganz genau zu sein. Ich hatte kein lebendes Wesen erblicken können und glaubte schon, daß das mit der Stimme, die mir zuflüsterte, die reine Einbildung gewesen sei. Das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn man so in sich versunken herumläuft, daß man sich dann in Wirklichkeit danach sehnt, daß einen jemand ruft, jemand, der einen braucht, und tatsächlich war es auch eine bittere Enttäuschung für mich, daß der Nationalgardist, den ich mir vorgestellt hatte, nicht dastand und auf mich wartete. Aber nun berührt also etwas Glattes meinen rechten Fuß, und als ich hinuntersehe, um nachzuschauen, was es ist, erschrecke ich so sehr, daß ich im selben Augenblick völlig zu zittern aufhöre. Da saßen zwei ausgewachsene Ratten und guckten mich an. Obgleich es dämmrig war, konnte ich sehen, daß sie fürchterlich mager waren, im Dunkeln leuchtete ihr Pelz mit einem seltsamen Glanz, und ihre großen Augen waren wachsam und seidenweich, anziehend und abstoßend zugleich, wie bei sehr grausamen Menschen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man von Polizeigendarmen oder Soldaten verhaftet wird, aber ich bin ganz sicher, das hier war zehnmal schlimmer, denn hier bestand nicht die geringste Möglichkeit, sich der Tricks zu bedienen, zu denen eine Frau im äußersten Notfall nun einmal ihre Zuflucht nehmen kann und deren ich mich jedenfalls immer ohne Zögern bedienen würde, wenn es sich als notwendig erweisen sollte. Oft und immer wieder habe ich darüber nachgegrübelt, weshalb ich mich nicht einfach umgedreht hatte und davongelaufen war, und ich wette, genau daran denken Sie jetzt auch gerade. Ja, wenn ich es doch erklären könnte! Vielleicht ist das eines der Rätsel dieser Welt? Vielleicht hat es etwas mit der verrückten Art und Weise zu tun, in der sich diese Welt nun einmal dreht und die wir so gut kennen? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, daß ich zu dem Schluß gekommen bin: Der eigentliche Grund, weshalb ich nicht einmal erwog umzudrehen und davonzulaufen, war: Ich wollte nicht.
Sehen Sie, Sie ahnen nicht, was es mich gekostet hat, bis hierher zu kommen. Denn seither ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht Grund gehabt hätte, mich darüber zu beklagen, daß ich wie ein Dummkopf stehengeblieben war; nicht ein einziger Tag, dem ich nicht dafür danken konnte, daß mir gerade in dem Augenblick das nötige Gehirnschmalz fehlte; denn seit dem Augenblick nämlich steht mein Leben im Zeichen der Ratten, und das ist nicht besonders lustig für einen Menschen, wie Sie sich sicher vorstellen können. Es wäre sehr bequem, wenn ich irgend jemand anderem die Schuld zuschieben könnte, denn dann könnte ich mich wenigstens wirklich über mein Schicksal beklagen. Aber ich sage mir: Wer mag sich schon jemanden anhören, der sich immer beklagt? Nein, dazu hat niemand Lust, und ich selbst auch nicht. Wie hart es also auch sein mag, letztlich sage ich mir immer: Kleine Camilla, du hast es nur dir selbst zuzuschreiben, daß es so gekommen ist. Wenn Sie dann nach diesen Worten so etwas wie einen kleinen Seufzer hören, dann haben Sie sicher nicht verkehrt gehört, denn mein Herz schnürt sich zusammen bei dem Gedanken an all die Freude und all das Glück, das mir hier im Leben entgangen ist, und ich muß aufpassen, damit ich meine Klagen nicht gegen mich selbst richte, denn welchen Zweck hätte das?
Aber sehen Sie, wenn ich das gesagt habe, so muß ich doch schnell hinzufügen, daß es die eiskalten und grausamen Augen der beiden Ratten waren, die mich daran hinderten, meine Füße auch nur einen Millimeter wegzurücken. Ich war überzeugt, hätte ich auch nur die kleinste Andeutung eines Fluchtversuchs gemacht, so hätten sie sich irgendwie auf mich gestürzt, und das wurde mir später auch bestätigt. In solchen Situationen benutzen sie nämlich eine ganz bestimmte Taktik, die uralt ist – so heißt es. Die eine Ratte geht zum Angriff auf den Fuß des Opfers über, während die andere sich bereithält. Die Angreifende beißt sich mit einer so fürchterlichen Kraft und Plötzlichkeit fest, daß dies das Opfer sehr oft vor Schmerz lähmt und es auf der Stelle umfällt. Manchmal wird der Angegriffene natürlich versuchen, die Ratte abzuschütteln, indem er seinen Fuß schwingt, aber das ist praktisch unmöglich. Die zweite Ratte benutzt die Gelegenheit zu einem Biß in den anderen Fuß, und dann können nur noch die wenigsten sich auf den Beinen halten. Ich will gar nicht von denen reden, die imstande sind, sich zu bücken, um mit den Händen zu versuchen, die Ratte, die sich festgebissen hat, loszureißen. Dann ist es für die andere Ratte eine Kleinigkeit, sich mit einem Sprung in der Nase festzubeißen. Aber wie gesagt, die meisten fallen schnell um, und sobald der Arme am Boden liegt, sitzt Ratte Nummer zwei ihm mitten im Gesicht. Hier geht sie zuerst – und das geht so schnell, daß niemand abwehrend die Hände erheben kann – auf die Augen, danach reißt sie ein Loch in die Wangen, und durch ein solches Loch geht sie zum Angriff auf die Zunge über. Und als wäre das nicht genug, so hat die Ratte, die im Fuß festsaß, ihren Biß aufgegeben, aber bestimmt nicht, um sich hinzustellen und Zuschauer zu spielen. Ganz im Gegenteil, sie richtet den letzten und entscheidenden Angriff auf das Opfer. Die Ratte weiß ganz genau, wo die Mastdarmöffnung ist, und während sich der Bedauernswerte, der nun weder sehen und bald auch nicht mehr sprechen kann, vor Schmerzen windet, bohrt sie sich da hinein. Eine Ratte ist nicht zimperlich, ihr ist es gleichgültig, was ihr auf diesem Weg begegnet. Sie wird von dem, was sie eventuell in diesem Bereich antreffen kann, nur angefeuert und drängt sich mit noch größerer Rücksichtslosigkeit und mörderischer Kraft vorwärts. Zu dem Zeitpunkt ist es natürlich aus mit dem Opfer, das auch sehr bald stirbt, ohne richtig begriffen zu haben, wie es geschieht und was da eigentlich geschieht; die Ratten aber verlieren keine Zeit, sondern verlassen den Tatort so schnell und lautlos wie Schatten, und erst wenn sie in irgendeinem Versteck in Sicherheit sind, machen sie sich daran, sich zu reinigen und zu putzen, während sie über den überstandenen Kampf sprechen.
Im allgemeinen verlieren sie darüber nun nicht sehr viele Worte, denn die Ratten neigen weder zur Angeberei noch überhaupt dazu, in ihren Taten zu schwelgen, denn für sie ist das eher eine Art Handwerk, eine Profession; und wenn Fachleute, egal, welcher Art, miteinander reden, dann ist kein Platz für Umschweife und Wortgeklingel.
Dafür aber, doch das ist eine ganz andere Geschichte, besitzen die Ratten eine ganze Menge alter Sagen und Chroniken, in denen von den Taten, die ihre Vorväter vor vielen Generationen ausgeführt haben, die Rede ist. Freilich nennen sie selbst sie nicht Sagen oder Chroniken, sondern glauben voll und ganz, sie handelten von wirklichen Begebenheiten, die vor mehreren Jahrtausenden eingetroffen seien, damals, als die Ratten noch nicht in der Kanalisation, den Kellern und Kasematten von großen Städten oder einsam gelegenen Festungen wohnten, sondern dagegen in Erd- und Felsenhöhlen, gasigen Sümpfen oder verrottenden Wäldern in den Einöden, die damals die Erde bedeckten, und wo sie kämpften, um eine Existenz zu bewahren, die keineswegs dadurch erleichtert wurde, daß große konzentrierte Menschenmassen Kehricht und Abfall anhäuften. Das begann erst so ganz langsam, als sich die Menschen in den ersten Dörfern sammelten, in den ersten fest ansässigen Gemeinschaften, die einen Fleck in der Wildnis rodeten und die ersten Ratten dazu brachten, ihre Verstecke an den Flußufern zu verlassen. Die Menschen stammten jedoch von einem Geschlecht von Riesen ab, das im Gegensatz zu den Menschen nicht in Herden lebte, sondern einsam umherstreifte, weshalb sie auch immer mehr oder weniger wahnsinnig und verrückt waren. Damals waren die Ratten zwar auch größer als die heutigen, eine mittelgroße Ratte besaß die Größe eines Hundes – selten höher als ein Boxer –, die Riesen aber waren dafür so groß, daß ihre Exkremente einen mehrere Meter breiten Fluß stauen und damit große Überschwemmungen und Naturkatastrophen hervorrufen konnten. So, wie wir Wörter wie Kuhfladen und Pferdeäpfel haben, nannten die Ratten diese Ablagerungen Riesenfelsen, was sicher daher kommt, daß die Riesen, außer Bäumen, Echsen und Tintenfischen, gerne Felsstücke aßen – Gneis, Quarz und Kiesel –, die dem Stuhl ihr Gepräge gaben und dazu beitrugen, diesen phantastischen Formationen, wenn sie erstarrt waren, eine steinharte Oberfläche und oft und gern auch eine monumentale Massivität zu verleihen. Vor allem aber schätzten die Riesen eine ausgewachsene Ratte als Nachtisch und betrachteten das als eine große Delikatesse. Die Ratte Dslf wurde eines Tages von dem Riesen Soll gefangen. Das entdeckte die Ratte Mgbt, die Dslf zu Hilfe kam. Bis zu diesem Tag war niemals eine Ratte einer anderen Ratte zu Hilfe gekommen. Sie hatten immer nur die Flucht gekannt. Mgbt konnte sich selbst nicht erklären, wie es zugegangen war, aber irgendwie hatte er gesehen, wie Soll sich darauf vorbereitete, Dslf zu verzehren. Sonst hatten die fliehenden Ratten immer nur einen unerklärlichen, knirschenden Laut gehört, wenn ein Riese einen ihrer Kameraden gefangen hatte.
Soll hielt seinen zappelnden Fang am Schwanze, und der Anblick von Dslf, der hoch oben in der Luft hing, den Kopf nach unten und Todesangst im Gesicht, bewirkte eine Revolte in Mgbts Seele und damit eine Änderung im Dasein der Ratten. Was war das Geräusch der knirschenden Knochen, das die fliehenden Ratten zu hören pflegten, gegen den Anblick der Hilflosigkeit der gefangenen Ratte? Die Ratten hatten nun einmal nicht die Phantasie, sich vorzustellen, was da geschah. Pfeifend stoben sie davon, bis sie sich außer Gefahr fühlten. Dann strebten sie zusammen, drückten sich dicht aneinander und versuchten zu vergessen, was geschehen war.
Doch nun hatte Mgbt es mit eigenen Augen gesehen, und das war nicht angenehm. Der sabbernde Mund des Riesen war voller großer, scharfer Zähne, für eine Ratte besonders unheimlich, aber ganz pervers und unnatürlich war der Anblick der großen, hellrosa, feuchten Lippen, quabbelig und schmatzend, die von einer kräftigen, ungepflegten Bewachsung voller Essensreste, toter Fledermäuse und eingetrocknetem Rotz umgeben waren.
Undeutlich spürte Mgbt, daß er nie so würde weiterleben können wie zuvor. Was immer er tat, er würde immer Dslf vor sich sehen, dieser Anblick würde seinen Schlaf stören und es ihm überhaupt unmöglich machen, auch nur fünf Minuten hintereinander seinen Seelenfrieden zu finden. Auch wenn er mit seinen Genossen zusammen war, würde er einsam sein, und plötzlich verstand er die Einsamkeit der Riesen und den Irrsinn, der sie – zur großen Verwunderung der Ratten – manchmal dazu brachte, sich selbst vor den Kopf zu schlagen, so daß er voller blauer Flecken und Blutergüsse war, oder dazu, ziellos herumzujagen, um sich danach plötzlich und unmotiviert hinzuschmeißen.
Doch jetzt war nicht die Zeit für solche Erwägungen und Überlegungen, das fuhr nur so durch Mgbts Kopf, und im nächsten Augenblick sprang er, ohne sich zu bedenken, auf Solls Fuß los, der das nächste und im übrigen auch das einzige Angriffsziel darbot. Soll, der durch den unvorhergesehenen Schmerz völlig gelähmt war, wußte im ersten Augenblick nicht, was er unternehmen sollte. Es gelang Mgbt, eine Sehne des Fußes durchzubeißen, doch damit begann der Kampf erst richtig. Todesangst, Haß und Rachegefühl feuerten die beiden Ratten an, ihre Bewegungen waren die ganze Zeit über so schnell, daß Soll sie mit den Händen nicht erwischen konnte. Er setzte sich schwerfällig auf den Hintern, um mit der Hand leichter Mgbt vom Fuß entfernen zu können, wo er sich festgebissen hatte. Nun zeigte sich jedoch, daß Dslf nicht weniger Geistesgegenwart, Mut und Todesverachtung besaß. Da Soll den Schwanz nicht losgelassen hatte, konnte Dslf die Hand nicht ordentlich angreifen. Resolut wand er sich deshalb hemm, biß seinen eigenen Schwanz fast ganz am Ansatz ab und ging darauf auf Solls nichtsahnende Hand los.
Der Kampf wogte viele Stunden lang hin und her und wurde mit einer Grausamkeit geführt, die nicht geplant war, sondern der Situation entsprang und später zu einem unentbehrlichen Teil der Taktik der Ratten wurde. Es gelang den beiden Ratten, den Riesen vor Schmerz zu Boden gehen zu lassen, und nun war es Dslf, der zum Angriff auf Solls Gesicht überging. Er fürchtete zwar den Bart, den Mund, die Zähne – diesen mörderischen, fürchterlichen und stinkenden Schlund mitten im Kopf – und hielt sich die ganze Zeit vorsorglich davon fern, aber um so eifriger versuchte er, die großen, blutunterlaufenen Augen des Riesen zu erreichen. Solls eine Hand patschte ihn immer wieder weg, doch bevor der Kampf zu Ende war, war es ihm jedenfalls gelungen, das eine Auge des Riesen zu blenden, was Soll sehr viel Spott von seiten der anderen Riesen eintrug, die, so zeigte sich, fast bar jeder Fähigkeit zum Mitgefühl waren.
Nun hatte Soll jedoch Mgbt vom Fuß weggerissen, dessen Sehnen mehr oder weniger zerfetzt waren und wo die Haut, infolge der Wildheit, mit der die Ratten gekämpft hatten, in Fetzen herabhing. Um nicht von der fürchterlichen Hand des Riesen gefangen zu werden, die die Knochen in dem Körper der Ratte hätte zermalmen können, wenn sie richtig hätte zupacken können, kroch Mgbt zwischen den Beinen empor und unter den kurzen Schurz, den Soll trug und mit dem er seinen behaarten Unterleib verbarg. Hier dann fand er den Weg in Solls Gedärm. So schleimig und glatt, wie es da war, war es eine Kleinigkeit für Mgbt, hineinzugleiten; es war dort auch sehr geräumig, so geräumig, daß er großen Schaden anrichten und dem entsetzten Riesen die schrecklichsten Wunden beibringen konnte. Nun wurde es Soll zuviel. Dieser Angriff brachte ihn an den Rand des Wahnsinns, weil er sich nicht mit den Händen verteidigen konnte, die im übrigen ja sowieso schon genug damit zu tun hatten, Dslf von dem zweiten Auge wegzuhalten. Soll fuhr so plötzlich empor, daß der unvorbereitete Dslf zur Erde purzelte, Soll stand grätschbeinig und krümmte seinen Bauch und ging in die Knie. Er löste einen Rutsch von Riesenfelsen, die auf Mgbt zudonnerten, eine kochende Masse voller zermalmter Steine, Kies und unverdauter Knochenreste, die sich am besten mit dem Lavastrom des Vesuvs oder anderer berühmter Vulkane im Ausbruch vergleichen läßt. Mgbt wurde zwar halb betäubt und war nahe daran, den Erstikkungstod zu erleiden, aber er hielt so lange durch, bis der Rutsch vorbeiging – er landete mit einem mächtigen Getöse, das im Umkreis vieler Meilen zu hören war, auf der Erde zwischen Solls Beinen. Zu Mgbts Pech hatte Soll gerade an diesem Morgen eine sehr solide Mahlzeit eingenommen. Er hatte Kies an den Ufern des Flusses Laugar aufgesammelt, hatte ein paar große Echsen gefangen, die ebenfalls dort lagen, und hatte seine Mahlzeit mit einigen großen Vögeln abgeschlossen, deren einzelne Federn bis zu vier Meter lang werden konnten – es waren also mit anderen Worten ein paar ordentliche Burschen. All das hatte Soll in der Zwischenzeit verdaut, die erste Portion Riesenfelsen war demnach nur der Anfang. Der benommene und halb betäubte Mgbt hörte weiter oben in den Därmen ein drohendes Donnern und war sich klar, daß es nun zu entkommen galt. Aber es war zu spät. Der nächste Rutsch aus Riesenfelsen war so heftig, daß Mgbt das Bewußtsein verlor, mit herausgeführt und unter dem Bergrutsch, der fast eine halbe Stunde dauerte, begraben wurde.
Dort kam Mgbt um.
Nun ging Soll. Dslf suchte seinen Stamm auf und erzählte, was geschehen war. Die Ratten wunderten sich und schauderten, aber sie begriffen instinktiv, daß für sie eine neue Zeit angebrochen war.
Dslf sagte: Wir haben gegen Soll gekämpft, das Wichtigste aber ist, daß Mgbt sich umdrehte, den Tod sah und gegen den Tod gekämpft hat. Von nun an soll uns der Tod nie mehr kampflos haben, flieh vor ihm, wenn es möglich ist, aber geh auf ihn los, wenn es keinen anderen Ausweg gibt.
Danach gingen die Ratten zu den großen Ansammlungen von Riesenfelsen, die wie aus der Erde geschossene Berge dalagen und unter denen Mgbt begraben lag. Sie dampften noch, und der Gestank, den sie in der Landschaft verbreiteten, erfüllte die Ratten mit dem Verlangen, die Gedärme aller Riesen, die sich auf der Oberfläche der Erde bewegten, in Stücke zu reißen.
Eine Ratte entdeckte, daß auf der Erde zwischen den deutlichen Abdrücken der Füße des Riesen große rote Flecke zu sehen waren. Als sie näher daran rochen, zeigte es sich, daß es Blut war. Zwei der Ratten wurden losgeschickt, um festzustellen, was mit Soll passiert war.
Nach Ablauf von anderthalb Tagen kam die eine von ihnen zurück und erzählte: Wir folgten den Blutspuren, die immer deutlicher wurden. Soll war erst nach Nordosten gegangen, hatte sich aber dann nach Norden gewandt. Nachdem er bis zum Rand der großen Ebene nach Norden gegangen war, war er nach Westen abgebogen, dann nach Süden, dann nach Norden und dann nach Westen. Er war mit anderen Worten augenscheinlich völlig verstört herumgeirrt, und es lief immer mehr Blut aus ihm heraus. Als wir ihn erreichten, hatte er sich hingelegt. Die ganze Zeit über lief das Blut aus dem Mastdarm, er hielt mit der einen Hand das blinde Auge, während er vor Schmerzen stöhnte und zwischendurch bitterlich jammerte. Als wir ihn so liegen sahen, freuten wir uns, daß die Ratten nicht so einsam umherirren wie die Riesen, und wir begriffen, daß wir dem Tod nie mehr Gelegenheit bieten dürfen, uns einzeln zu holen, sondern daß wir uns allesamt, sosehr wir können, wehren müssen. Soll wurde immer schwächer. Ab und zu schrie er etwas, als riefe er, aber niemand von den anderen Riesen kam ihm zu Hilfe. Diejenigen, die vorbeikamen – und es geschah, daß ein Riese am Horizont auftauchte und mehr oder weniger zufällig an der Stelle vorbeikam, wo Soll lag –, lachten entweder oder zeigten mit dem Finger auf das Auge, das nicht da war, oder sie schlichen vorbei, als schämten sie sich, und warfen nur im Vorübergehen einen verstohlenen Blick auf ihn. Zuletzt war Soll so entkräftet, daß er sich nicht rühren konnte. Wir krochen auf ihn hinauf, spazierten auf ihm herum und studierten seinen Körper, aber ansonsten ließen wir ihn liegen, weil wir uns erst über ihn hermachen wollten, wenn wir alle zusammen wären. Deshalb beschlossen wir, daß ich zurücklaufen und das, was Sie gerade gehört haben, erzählen sollte.
Die Ratten brachen auf und machten sich auf den Weg. Als sie zu Soll kamen, war er tot. Sie warfen sich sofort auf die Leiche, und da sie viele und allesamt sehr hungrig waren, war es eine Kleinigkeit für sie, alles Eßbare zu verzehren, so daß das Skelett bald völlig sauber und blitzend weiß in der Sonne dalag. Sie lösten den Schädel vom Rest des Körpers und kullerten ihn nach Hause zu ihrer Siedlung. Sie wußten nicht, weshalb sie das taten und was sie damit anfangen sollten, aber wahrscheinlich fühlten sie, daß dieser Schädel, wenn sie ihn nur hätten, sie immer an den Tod und an die ersten Kämpfe der Ratten erinnern würde.
So wurde mir die Geschichte erzählt, als ich in die Welt der Ratten gekommen war, eine Stadt wie eine Art unterirdisches Venedig, mit breiten Kanälen, schmalen Kanälen, Gassen, Pfaden und Plätzen, in eine ewige Stille versunken, die nur ab und zu von einem Platscher unterbrochen wurde, der immer so klang, als käme er von weit her. Ich wurde zur Versammlungsstelle der Ratten geführt, die gerade so ein großer Platz war, wo sie sich alle unter dem Vorsitz ihres Königs versammelt hatten. Es ist mir unmöglich zu erklären, wie ich überhaupt sehen konnte, denn aus der Welt von oben drang nicht der kleinste Lichtstrahl herunter. Alles lag jedoch in einen ganz schwachen Lichtschimmer gebadet da, wie in einer Mondnacht bei uns, wo man nur den Mond nicht sehen kann. Vielleicht lag es daran, daß meine Augen die gleichen Eigenschaften bekommen hatten wie die der Ratten, einfach, weil ich nicht nur widerstrebend mitgegangen, sondern, wie gesagt, stehengeblieben war, weil ich stehenbleiben wollte, in die Welt der Ratten eintreten wollte, damals, als sie sich mir so überraschend offenbarte.
Die Ratten saßen mäuschenstill. Es waren Tausende und aber Tausende, eng aneinandergedrückt, so daß sie fast so etwas wie einen Teppich bildeten, der den Platz in seiner ganzen Ausdehnung bedeckte. Sie saßen in den anstoßenden Gängen, auf kleinen Mauervorsprüngen, selbst oben unter den niedrigen Gewölben, wie immer sie es geschafft haben mochten, sich da festzuhalten. Sie waren irgendwie ein einziges großes Tier, dessen Seele seine Wohnung in allen diesen kleinen Abbildern seines Körpers genommen und sich darin verteilt hat, denn irgendwie merkte ich, daß die ganze mächtige Versammlung von denselben Gedanken beherrscht wurde. Sie waren allesamt fürchterlich mager, und in ihren Augen las ich eine verzweifelte Entschlossenheit, eine sonderbare Mischung aus fatalistischer Geduld und unverschleißbarer Tatkraft. Hier stand ich vor den Alleruntersten, den Gefürchteten, Verhaßten und Verachteten, in deren Königreich in diesem Augenblick eine andächtige Stimmung herrschte, als erwarteten sie, Zeuge eines Rituals zu werden, dessen magische Kraft ihr Schicksal mit einem Schlag wenden – oder es vielleicht bestätigen und sie damit in der Identität des Hasses und der Boshaftigkeit bestätigen – würde, die ihr namenloser Gott war.
Der ganze Körper des Rattenkönigs war von Narben übersät, ihm fehlte ein Auge, und er hinkte schwer auf dem linken Hinterbein. Nichtsdestoweniger strahlte er eine Kraft aus, die die Stellung, die er einnahm und die im übrigen nicht durch äußere Zeichen der Würde angegeben war, völlig erklärte. Für jedes Bein hatte er sieben Königinnen und sieben für den Schwanz. Sie saßen in fächerförmigen Reihen vor ihm, streckten abwechselnd auf Befehl des Königs den Hintern in die Luft und sangen dazwischen im Chor mit heiseren, zischenden Stimmen verschiedene Litaneien, deren obszöner Inhalt so platt, so ordinär und geradezu ehrlos war, daß es zu meiner großen Überraschung fast schön klang, was wahrscheinlich nicht beabsichtigt war.
Nun erwartete ich natürlich, daß mit mir irgend etwas geschehen würde, und die erwartungsvolle Stille der tausendköpfigen Schar ließ mich das Schlimmste befürchten. So dumm war ich jedoch, daß ich selbst zu dem Zeitpunkt meinen Leichtsinn nicht bereute. Denn obgleich ich Angst hatte, auch Angst um mein Leben, war meine Neugierde dennoch so groß, daß sie die Angst aufwog. Wenn ich denn wirklich in dieser Unterwelt, die völlig den Gesetzen und Bestimmungen der Menschen entzogen war, in irgendeinem Ritual geopfert werden sollte, dann war das jedenfalls nicht sinnloser als der Tod, den Franzosen und Deutsche einander mit ausgeklügelten Mordwaffen zufügten und den kennenzulernen ich so reichlich Gelegenheit gehabt hatte. Eher im Gegenteil.
Meine bangen Ahnungen wurden jedoch beschämt. Eine nahezu unmerkliche Bewegung des königlichen Kopfes ließ die tausendköpfige Schar aufbrechen. Es war, als würde die gesamte Umgebung auf einmal lebendig, doch das geschah in tiefstem Schweigen, und im Verlauf eines Augenblickes lagen der Platz, die Wände, die Gewölbe völlig öde da. Übrig waren nur noch der König, seine Königinnen – die ihren kreischenden Gesang abgebrochen hatten – und ein paar andere Ratten, die an Minister oder Diplomaten oder auch Gewohnheitsverbrecher erinnerten. Es zeigte sich, daß die Ratten die Lage sehr düster beurteilten. In der großen, hungernden Stadt blieb fast nichts übrig für die Ratten. Eine Zeitlang konnten sie schon hungern, dauerte die Unterernährung jedoch zu lange, dann würden sie zu entkräftet sein und deshalb eine leichte Beute für ihre Feinde abgeben. Gleichzeitig hatten die Menschen angefangen, sich für sie zu interessieren, nicht nur, um sie auszurotten – das kannten sie, und darüber lachten sie –, sondern um sie zu essen. Das war etwas ganz Neues für die Ratten, sie fühlten sich gedemütigt bei dem Gedanken, von den verhaßten Feinden verzehrt zu werden. Es überraschte sie auch, daß der Preis, der in den Fleischergeschäften für eine Ratte verlangt wurde, im Verhältnis zu dem Preis von anderem Fleisch so lächerlich war. Nur ein Spatz war billiger! Eine Ratte konnte man für zwei Francs bekommen, während eine Katze zehnmal so viel kostete. Mit anderen Worten, ich konnte merken, daß ihr Selbstgefühl getroffen war. Ratten hatten nichts gegen Haß und Verachtung. Sie fanden es in Ordnung, daß die Menschen sie mit allen Mitteln, auch den giftigsten, bekämpften, doch an dem augenblicklichen Zustand erschien ihnen einiges entehrend. In einem Fleischerladen zu enden, das war für eine Ratte ein ebenso fürchterlicher Gedanke wie für einen Calvinisten die Aussicht, in der Hölle zu landen.
Doch die Ratten wichen auch vor den ungewöhnlichsten Handlungen nicht zurück. Deshalb hatten sie beschlossen, einen Menschen zu sich zu locken, der in ihrer Gewalt sein sollte. Das würde die Moral der ganzen Gesellschaft stärken. Und was man einmal tun konnte, konnte man dann auch wiederholen. Aber außerdem wollten sie sich diesen Menschen dann auch zu Diensten machen. Zwar waren sie selbst Meister, wenn es darum ging, in der Stadt Stellen zu finden, die die beste Ausbeute erbrachten, doch die augenblicklichen Zustände hatten die Menschen dazu gezwungen, sorgfältiger zu sein. Auf diese Weise wurde ich Gefangene, ein lebendiges Opfer, das in bestimmten Abständen allen Ratten vorgezeigt wurde, und gleichzeitig ihr Helfer im Kampf um das Dasein.
Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich das sage, aber ich muß gestehen, daß es mir in der Gesellschaft der Ratten gutging. Das liegt sicher an meinem leichtsinnigen Gemüt, und ich will gern glauben, daß mit mir was nicht in Ordnung ist. Ich hatte nie einen Gedanken an die Tatsache verschwendet, daß unter dem Boden der Gesellschaft noch ein Boden liegt. Ich begann zu denken, daß man unter den Untersten immer noch jemanden findet, der noch weiter unten ist. Das Besondere an den Ratten war ihr wütender Stolz. Obgleich er mir nicht immer unbedingt berechtigt erschien, begriff ich, daß hier einer der Gründe ihres Überlebens lag. Ich ging deshalb bereitwillig darauf ein, ihnen zu dienen, und kannte die Verhältnisse »da oben« so gut, daß ich ihnen wirklich viele wertvolle Auskünfte geben konnte. In der hungernden Stadt gab es noch immer viele, die sich mästeten. Ich wußte, wo es Abfalleimer gab, die ebensosehr oder noch mehr als unter normalen Umständen überflossen. Es war, als würden die Bäuche der Reichen noch unersättlicher, wenn alle anderen hungerten und Not litten; als müßten sich ihre Gaumen an noch größeren Mengen der besten Jahrgangsweine, die ihre Keller füllten, laben; als verlange ihr Bewußtsein, daß noch größere Haufen als normalerweise in den Abfalleimern landeten, deren Inhalt, der nicht in verkehrte Hände fallen durfte, von den ergebensten Dienern bewacht wurde, die mit ihren eingefallenen Wangen, den vorspringenden Knochen und der fahlen Haut von der Treue zeugten, mit der sie der gnädigen Herrschaft dienten: Die Hunde konnten die besten Stücke bekommen, der Rest mußte verrotten. Das war, kurz gesagt, wie geschaffen für die Ratten. Aber deshalb schissen und pißten diese feinen Damen und Herren auch sehr viel mehr als gewöhnlich, und ich hatte von vielen Armen gehört, die sich buchstäblich kaputtschufteten, weil sie die Kloeimer in der Faubourg Saint-Honoré leeren mußten und selbst kein Brot auf dem Tisch hatten.
In meiner Entrüstung über diese fürchterlichen Zustände wurde es mir eine wahre Leidenschaft, den Ratten zu helfen, und zuletzt hatte ich nichts anderes im Kopf als ihr Wohl und Wehe. Deshalb überraschte es mich irgendwie auch nicht, als mir Seine Majestät vorschlug, ich solle in die Reihe der Königinnen eintreten. Aufgrund meiner nur allzu menschlichen Natur würde ich notwendigerweise eine Sonderstellung einnehmen, aber dagegen hatten die übrigen fünfunddreißig Königinnen nichts einzuwenden. Sie nahmen mich unter sich mit den einzigartigsten, abscheulichsten Litaneien in fünfstimmiger Polyphonie auf, und ich fühlte meine Seele von einer Tristesse durchdrungen, die ich nie zuvor gespürt hatte und die mich stark und unbeugsam machte, als der König mit seiner zischenden, pfeifenden Stimme an die versammelten Ratten gewendet verkündete: Königin über die Kloaken von Paris!
Ich streckte sofort meinen Hintern in die Luft, und in der Stille, die folgte, pflanzte er seinen Rattensamen in mich. Hinterher tanzte ich zu den gespenstischen Tönen der Litaneien Cancan.
Nun, da ich etwas von der Ratte in mir hatte – und bald merkte ich, daß es darin zu wachsen begann –, fühlte ich, daß mein Leben weitgehend verändert war. Etwas war geschehen, und dieses Etwas bewirkte, daß ich nie mehr dieselbe sein würde wie zuvor. Mit der Hälfte meines Wesens war ich eine der Verdammten geworden, nicht mehr nur ein Gast, ein Tourist in der Hierarchie der Erniedrigung, sondern ich war jetzt imstande, ihren Stolz und ihre Scham zu teilen, während ich es gleichzeitig noch immer so betrachten konnte, als befände ich mich außerhalb. Deshalb begann ich nun auch Dinge zu sehen, für die ich früher keinen Blick gehabt hatte oder die ich ganz einfach nicht hatte sehen können. Die Ratten waren eine gleichförmige Masse gewesen. Nur der König und die ihn Umgebenden unterschieden sich von den anderen. Aber so war es ja überhaupt nicht. Es gab kleine Unterschiede, die einem plötzlich ins Auge sprangen. Im Laufe der Zeit bewirkten diese Unterschiede, daß mir der König eigentlich auch nicht so anders vorkam als alle die anderen. Doch, halt! Es gab einen Unterschied. Der bestand gerade darin, daß er König war. Ich begann zu fühlen, daß diese Entdekkungen meine Seele zerreißen würden. Ich war Mensch und doch nicht Mensch, weil ich eine Ratte in mir hatte. Ratte, wirklich Ratte war ich natürlich auch nicht – obgleich ich nun die klamme Berührung des Schlamms als Liebkosung empfand und mich schon längst damit abgefunden hatte, daß meine Haut gelb und grün wurde, daß auf dem Kopf, unter den Achseln und zwischen den Beinen der Schimmel wuchs und ein Haufen halb verrotteter Kartoffelschalen als Abendessen dienen mußte.
Ich weiß nicht, wie lange ich mein Kind trug, denn die Ratten haben keine Zeitrechnung wie wir, bei ihnen ist die Zeit ebenso undeutlich wie alles andere, ein langer, unterschiedsloser Augenblick zwischen Geburt und Tod. Doch oben in der anderen Welt, bei den Menschen, hatte sich alles verändert. Der Krieg war vorbei, Paris machte sich auf eine heroische Zukunft gefaßt, und nun gab es wieder Mengen von Abfall in allen Mülleimern. Das interessierte mich jedoch alles überhaupt nicht, und was die Ratten betrifft, so hatten sie augenscheinlich vollständig vergessen, weshalb ich in ihre Welt aufgenommen worden war. Ich brauchte ihnen nicht mehr bei der Futtersuche zu helfen. Auf Geheiß des Königs brachten sie mir das Beste, was sie beschaffen konnten. Ich lag mit schwellendem Bauch in einem dunklen Winkel, wo ich völlig ungestört sein konnte, denn ich fühlte die Zeit für meine Niederkunft näherrücken und wurde von angstvollen Gedanken gepeinigt, die sich natürlich alle um das Kind, das ich zur Welt bringen sollte, drehten.
Die Wehen ließen mich laut stöhnen. Die Ratten, die sich in der Nähe aufhielten und es hörten, flüchteten erschreckt. Sie hatten noch nie etwas Ähnliches gehört und fürchteten, daß mir etwas Böses und Schädliches, etwas Unnatürliches geschehen sei, das auch ihnen etwas zuleide tun könne. Das Gerücht lief von Mund zu Mund, der König, der sich selbst näherte, um zu hören, ob die Gerüchte wahr gesprochen hätten, erteilte den strengen Befehl, alle Ratten sollten sich außer Hörweite meiner unheimlichen Laute begeben. Das Echo der letzten gemeinen Litaneien der fünfunddreißig fettwanstigen Königinnen erstarb unter den Gewölben, und ich war mir selbst überlassen. Was half es, daß ich die Königin der Kloaken gewesen war? Zum erstenmal erfüllten mich die niedrigen Gewölbe, das Dunkel, das stehende Wasser der Kloaken und der faulige Gestank mit Abscheu, und als ich vor Angst und Schmerz schrie, gellte mein Ruf nur in eine Leere, die mir das Gefühl gab, das einsamste Geschöpf der Welt zu sein. Nun bin ich aber ganz verloren, dachte ich zwischendurch, wenn die Schmerzen abklangen, und dieser Gedanke sollte mir die Niederkunft natürlich nicht leichtermachen.
Die Geburt fand zu einem Zeitpunkt statt, als ich völlig umnebelt war. Ebensosehr von der fürchterlichen Angst, mit der mich die Einsamkeit erfüllte, wie von den Schmerzen, doch einen Augenblick später war ich wieder zu mir gekommen und hatte meine Umsicht und Tatkraft wiedergewonnen. Das Kind war ein Junge, das merkte ich schnell, denn er hatte einen ungewöhnlich langen Pimmel, dünn und schleimig wie ein Wurm, und außerdem hatte er von Geburt an dünne, spitze Nagerzähne; die verlor er jedoch mit sechs Jahren und bekam dann richtige Menschenzähne in den Mund, was sein Aussehen im übrigen stark veränderte und seinen Kopf weniger rattenartig erscheinen ließ.
Ich legte mein Kindchen sofort an die Brust, es saugte begierig, obgleich das, was da herauskam, keine richtige Milch war, sondern irgendein saurer Saft, der den Magen eines gewöhnlichen Menschenkindes dazu gebracht hätte, sich vor Schmerzen zu verkrampfen. Es lag sicher daran, daß ich so viele Wochen hindurch nicht an der Luft und am Licht gewesen war, sowie an der Kost, die ich gegessen hatte, daß meine Brüste nun eine Nahrung hervorbrachten, die, wie sich zeigte, genau das war, was das Neugeborene brauchte. Abgesehen von den Dingen, die ich bereits erwähnt habe, unterschied der Junge sich nicht sonderlich von einem normalen Menschenkind, wenn man einmal von den Augen absieht. Aber natürlich wäre es völlig verrückt, wollte man von den Augen absehen, um so mehr, als sie so ungefähr auch das erste waren, was mir auffiel. Denn als er an meiner Brust lag, schaute er mit ihnen direkt in meine empor, und sie waren rund, stecknadelkopfartig und konnten sich nicht schließen, da ihnen die Lider und Wimpern fehlten. Er selbst sagt, daß es ihm keine Schmerzen bereite, aber ich glaube, das liegt daran, daß er sich so sehr daran gewöhnt hat, daß etwas in seinem Kopf weh tut, daß er sich nicht darüber im klaren ist, daß wir das Schmerz nennen. Wenn er plötzlich imstande wäre, die Augen zu schließen, würde es ihn sicher mit Schrecken erfüllen, daß die Welt nicht mehr da ist. Angenommen, sie käme nie wieder!
Sobald ich gehen konnte, trug ich ihn auf den Armen umher. Nun, da ich nicht mehr stöhnte oder schrie, hatten die Ratten nicht mehr so viel Angst vor mir, doch es war, als hätten sie die Lust verloren, etwas mit mir zu tun zu haben.
Vielleicht hatten meine Töne, die ihnen so unheimlich vorkamen, sie mißtrauisch gemacht. Sie strichen hastig an mir vorbei und verlangsamten das Tempo erst wieder, wenn sie von mir weg waren. Den König sah ich überhaupt nicht. Ich wanderte in den Gängen umher, oft bis zur Hüfte im Wasser, wie ich es gewöhnt war, und suchte nach ihm, doch überall, wo ich hinkam, kehrten mir die Ratten den Rücken zu, wichen zurück oder flüchteten geradezu. Mit der Zeit empfand ich mit immer größerer Deutlichkeit, daß ich ausgestoßen war, und wurde von einem Gefühl der Verzweiflung übermannt, das mich zum Äußersten trieb. Mein Gemüt muß völlig verdunkelt gewesen sein, ich entsinne mich auch nur ganz schwach an das, was geschah, während ich immer erschöpfter und verzweifelter im Dunkeln umherwanderte. Vermutlich geschah überhaupt nichts. Ich war nur allein. Zuletzt stellte ich mich an einer Stelle, wo, wie ich wußte, der König vorbeizukommen pflegte, mit dem Hintern in die Luft auf, in der Hoffnung, ihn auf diese Weise zu mir locken zu können. Ich richtete mich erst auf, als ich entdeckte, daß mein kleiner Sohn, den ich neben mich gelegt hatte, einen Pimmel bekommen hatte, der lang und steif war und wie eine Weidenrute schwankte.
Zu dem Zeitpunkt war ich wohl nahe daran auszurasten, ja, ich glaube, das war der schlimmste Augenblick von allen, denn ich hatte keine einzige vernünftige Idee oder einen Plan im Kopf und eigentlich auch keinen unvernünftigen. Wenn da jemand vorbeigekommen wäre und zu mir gesagt hätte, spring in den Kanal, der geradewegs in die Seine führt, und da kannst du mit deiner entarteten Nachkommenschaft ersaufen, dann hätte ich das auf der Stelle getan.
Meine nächste Erinnerung ist etwas Entsetzliches. Es war, als bedürfe es irgendeines Schreckens, um mich zum Leben zu erwecken und meinen Verstand zu retten.
Durch die Kanäle begann Blut zu fließen. Es sickerte die Wände hinunter, es tropfte von den Decken, es bahnte sich seinen Weg durch die Gänge, und in der klammen Luft wirkte es lauwarm und verbreitete einen süßlichen Gestank. Die Ratten gerieten außer sich. Sie stoben umher, als sei irgendeine Naturkatastrophe geschehen. Einige von ihnen wälzten sich in dem Blut und gebärdeten sich schreiend und pfeifend, während sie darin herumrollten, so daß es nach allen Seiten spritzte. Es war eine richtige Schweinerei. Andere scheuten es, waren aber dennoch davon in den Bann gezogen, denn jedesmal, wenn sie geflohen waren, kehrten sie wieder zurück und schnupperten daran. Ich bin völlig sicher, daß bei dieser Gelegenheit eine Menge Ratten total den Verstand verloren. Und gleichzeitig tropfte das Blut immer weiter und lief als dicker Strom, der die ganze Zeit über anschwoll und immer klebriger wurde. Sein Geruch erfüllte mich mit einem Gefühl des Ekels und des überraschten Erkennens. Als ich mein Kind gebar, war das Blut, das aus mir herausgeströmt war, dünn wie Wasser gewesen, fast farblos und mit einem nicht sehr starken, doch seltsamen scharfen und säuerlichen Geruch, als sei es mit Essig vermischt. Jetzt wußte ich plötzlich wieder, was richtiges Menschenblut ist, und ich begriff auch, weshalb die Ratten so verstört waren. Ich begann eine merkwürdige Sehnsucht nach den Menschen zu empfinden, und gleichzeitig verwandelten sich der Abscheu und der Ekel, die das Blut in mir hervorgerufen hatten, in Trauer und Mitgefühl.
Ich tobte vor Trauer, denn es liegt mir nun einmal nicht, in Jammer und Elend zu versinken, doch als plötzlich in den Kanälen Menschen auftauchten, konnte ich schon merken, daß ich lange aus ihrer Welt weggewesen war.
Die Welt der Ratten ist so still und friedlich. Die Ratten flitzen lautlos umher, und die langsamen Bewegungen des Schlamms, wenn er in den Kanalleitungen dahintreibt, löst nur ab und zu ein leichtes Plätschern oder ein schwaches Brodeln aus. Aber die Menschen, die nun auftauchten, die machten vielleicht ein Theater! Sie taumelten herum wie betrunken, und obgleich sie gedämpft sprachen, klang es wie der schlimmste Lärm und Spektakel. Hinzu kam, daß sie riesig wirkten, doch das lag sicher nur daran, daß ich so viele Monate lang nur die Ratten vor Augen gehabt hatte: groß und plump, wie gewaltige Maschinen, die nicht ganz richtig zusammengeschraubt sind. Sie wußten weder aus noch ein, das war ganz deutlich – wußten nicht, wo sie hingehen und was sie überhaupt mit sich anfangen sollten. Wenn mehrere zusammen waren, begannen sie sich schnell zu streiten und teilten sich in zwei oder mehrere Parteien. Einige von ihnen gerieten in Schlägereien und ertranken, weil sie hinfielen und während der Schlägerei zu Boden gingen oder in den Fluß hinausgeführt wurden, weil sie viel zu entkräftet waren, um sich an den glatten Steinen festzukrallen. Andere machten sich zielbewußt auf den Weg, allein oder in ganz kleinen Gruppen, wurden jedoch bald durch die rätselhafte Geographie der Kanalisation verwirrt und verloren den Verstand unter dem Einfluß der unüberschaubaren Verzweigungen des schleimigen Dunkels. Schließlich gaben sie nacheinander auf und legten sich überall zum Sterben nieder, eingesperrt in einen Wahnsinn, der vielleicht irgendwie die Grausamkeit des Endes milderte.
Anfangs waren die Ratten völlig von Sinnen über diese brutale und seltsam sinnlose Störung der traditionsreichen Harmonie ihrer ererbten Welt. Bald jedoch nahmen sie eine beobachtende Haltung ein, studierten aus ehrerbietigem Abstand, wie die Streitenden einander in den Untergang trieben, lauschten den lispelnden Stimmen der Wahnsinnigen und hielten Wache bei den Sterbenden, die deshalb ihre letzte Einsamkeit von einem Kreis kleiner, glühender Augenpaare bevölkert sahen, die Stunde um Stunde näherrückten.
Und was konnte ich tun? Ich war selbst völlig gelähmt vor Entsetzen und war so lange von den Menschen fort gewesen, daß ich Angst vor ihnen hatte. Sie wirkten so unberechenbar, wer wußte, was ihnen einfallen würde? Schließlich aber nahm ich mich doch zusammen und ging zu einem hin, der sich in einer Ecke niedergelassen hatte oder dort umgefallen war und um den bereits eine Menge neugieriger Ratten einen Kreis gebildet hatten. Die scheuchte ich weg, und obgleich sie pfiffen und zischten, wagten sie dennoch nicht, mir den Gehorsam zu verweigern. Es war eine Frau, die dort lag. Ich näherte mich vorsichtig, bereit zu verschwinden, wenn sie auch nur das kleinste Zeichen von Angriffslust zeigen sollte. Doch das tat sie nicht. Sie war eingeschlafen, und ich setzte mich neben sie mit meinem Kind auf dem Arm und wartete darauf, daß sie aufwachte. Sie war sicher schrecklich ermattet, denn sie schlief sehr lange, aber zuletzt schlug sie doch die Augen auf. Da sie natürlich erwartet hatte, genauso allein zu sein wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich hingelegt hatte, erschrak sie ein wenig, aber ich saß ganz still und begnügte mich damit, sie anzuschauen, so daß sie schnell begriff, daß ich ihr nichts tun wollte. Ich habe vergessen zu erzählen, daß sie verbunden und augenscheinlich schwer verletzt war und daß ihr Gesicht so weiß war wie eine Kalkmauer. Es war deutlich, daß sie nicht mehr lange leben würde. Ihre Augen waren zwar schwach und verschleiert, hatten aber dennoch eine seltsame Kraft in sich, und ich saß immer weiter da und schaute sie an, als sei es das erste Mal, daß ich ein Paar Augen sah. So empfand ich es auch. Denn die Augen der Ratten, von denen ich umgeben gewesen war, waren völlig anders. Dann ging mir ein Licht auf. Ihre Augen hatten nämlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, sie waren ganz normal, so, wie Augen nun einmal sind, aber weil ich direkt aus der Gesellschaft der Ratten kam, schien es mir, daß ich diese seltsame Kraft sah, von der ich gerade erzählt habe. Ja, Pustekuchen! Ich kann mir vorstellen, daß sie vielleicht Fleischersfrau oder so etwas gewesen ist, jedenfalls war sie sehr einfach gekleidet, und ihre Hände – ja, nun war sie natürlich so entkräftet, daß sie einfach nur dalagen – waren solche Pranken, wie man sie von harter Arbeit bekommt.
Aber sehen Sie, mit den Ratten ist das so, sie sind zwar mutig, und sie helfen auch einander, so, wie ich es erzählt habe, und opfern sich freudig für die gemeinsame Sache, wenn es sich als unumgänglich erweist, aber sie waren schreckeinflößend. Sie waren zu vollkommen, kann man schon sagen. Sie hatten etwas Metallisches an sich. Sie hielten zusammen, aber sie mochten sich dennoch nicht, und selbst ihre Todesangst war merkwürdig taub, als sei sie eher eine Art Krankheit des Nervensystems. Aber die Frau hier, die hatte Angst, und das verstehe ich gut, so, wie ihre Lage war. Sie hatte Angst vor dem Sterben. Und genau das konnte ich ihr ansehen. Und ich konnte ihr ansehen, daß sie dankbar war, daß ich da war, obgleich ich ja nicht das geringste tun konnte. Oje, das war schrecklich! Sie lag da und starb mir ganz langsam unter den Händen weg, und ich konnte sie nur ansehen. Sie war zu schwach, um zu sprechen, sie konnte also nicht sagen, woran sie dachte. Vielleicht hatte sie Mann und Kinder, vielleicht lebten ihre Mutter und ihr Vater noch, vielleicht wollte sie einen Priester zum Beichten? Was weiß ich! Ich redete ein bißchen zu ihr, fast wie zu einem Kind, das man beruhigen und trösten will, und ich schwöre, daß ich sie nun schon genauso mochte, als wäre sie mein eigenes kleines Kind gewesen. Das Schlimme war nur, daß sie nicht die einzige war. Ich wußte, daß rund umher andere lagen, denen es ebenso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer erging. Ab und zu hörte ich jemanden um Hilfe rufen, dann hatte ich die größte Lust, zu ihnen hinzueilen. Aber nein, das konnte ich nicht übers Herz bringen, ich konnte die, bei der ich saß, nicht verlassen. Die Rufe wurden immer schwächer, vermutlich sind sie ja alle im Dunkeln krepiert.
Na, aber zuletzt starb sie natürlich auch, und obgleich ich mich völlig versteinert fühlte, konnte ich ja nicht da sitzen bleiben wie ein Grabmal, außerdem mußte ich an mein Kind denken. Und nun hatte ich genug von den Ratten. Ich wollte zu den Menschen zurück, auch wenn sie sich noch so sehr totschlugen und überhaupt schändlich benahmen. Ich begann zu gehen, indem ich mich an die Mauer drückte, in den Winkeln verbarg und auf alle mögliche Weise die Ratten zu meiden suchte, während ich nach einem Ausgang suchte. Ich war zwar recht ortskundig, aber ehrlich gesagt war ich durch die jüngsten Ereignisse etwas wirr im Kopf und taumelte anfangs nahezu ziel- und zwecklos umher. Endlich sah ich dann Licht voraus, und während ich auf den fernen Lichtschein zustürzte, geschah etwas Merkwürdiges. Ich begann den Kanal zu riechen! Pfui Teufel, der stank vielleicht! Er stank nach Schlamm und feuchten Mauern und nach all dem, was herumtrieb, und nach Ratten, nicht zuletzt nach Ratten. So ein richtiger scharfer Geruch, der mir fast Brechreiz verursacht hätte. Vermutlich lag es an den sterbenden Menschen, die im Imperium der Ratten so viel Spektakel veranstaltet hatten, daß ich überhaupt die Möglichkeit erhielt zu entkommen. Es war ein reines Wunder. Ich wage überhaupt nicht, mir vorzustellen, was geschehen wäre, wenn der Rattenkönig jemanden hinter mir hergeschickt hätte. Sie hätten mir mit Leichtigkeit den Weg versperren können, und dann wäre mein Schicksal besiegelt gewesen und auch das meines Kindes.
Nun kam ich also raus, und seltsamerweise kam ich genau da raus, wo ich reingekommen war. Mir wurde ganz komisch, als ich so dastand und auf die Seine sah. Es war direkt schön. Es war, als wäre ich nach Hause gekommen. Mein armes Kind konnte nicht sehen. Es mußte sich die Hände vor die Augen halten, damit das starke Licht sie nicht kaputtmachte. Es zitterte und bebte, und plötzlich ging mir auf, daß es so mager war wie ein reines Skelett. Ab und zu nahm es einen Moment lang die Hände von den Augen und wandte die Schnauze, doch dann begann es auch sofort wieder zu zittern, es zuckte und zappelte, als bekäme es Krämpfe, so stark wirkte der Eindruck. Als ich auf die Straße hinauskam, schauten mich die Leute so seltsam an, und erst als ich mich in einem Spiegel sah, verstand ich, weshalb. Ich hatte völlig vergessen, daß mein Haar voller Schimmel und ich selbst fast halbnackt war, weil meine Kleider, die mürbe und morsch geworden waren, in Fetzen an mir hingen, und daß das, was von meinem Gesicht und von meinen Armen und Beinen zu sehen war, eine kränkliche, gelbgrüne Farbe zeigte und die Ähnlichkeit mit Menschenhaut völlig verloren hatte.
Ich wurde zum Schrecken für alle anderen im Haus; selbst als ich mich gewaschen und mein Haar gekämmt hatte, sahen sie mich noch immer an, als trüge ich irgendeine Deformität mit mir herum oder als sei ich die Hexe im Pfefferkuchenhaus. Doch das war mir egal. Die meisten von ihnen sind jetzt tot. Sie waren schwach, sie sind weg, aber ich war stark, und ich starb nicht. Ich verbarg meinen Theodor vor ihren Blicken. Tagsüber behielt ich ihn in der Wohnung und schloß die Fensterläden, um seine schmerzenden Augen zu schonen. Am Abend nahm ich ihn zuweilen mit und führte ihn durch Straßen und auf Boulevards, wo der Anblick der Menschenmengen in Bewegung ihn anfangs völlig verschreckte und wo er instinktiv zu den Kais hinunterlief, als suche er nach einem Eingang zu den Kanälen und wolle um jeden Preis zu ihrem widerwärtigen, klammen, schleimigen Dunkel zurück. Beim Anblick seiner rattigen Schnauze – bereits als Zweijähriger hatte er Flaum auf den Wangen und um den Mund – und seiner kugelrunden Augen ohne Lider und Wimpern wandten sich die Leute ab. Ich sah durchaus, welchen Ekel sie empfanden, obgleich sie natürlich versuchten, es zu verbergen, und einige sogar so taten, als fänden sie, er sei ein süßes kleines Kind. Doch er durchschaute sie, und Sie hätten ihn sehen sollen, wenn die Leute ihn unter dem Kinn kraulten: Dann fauchte er sie an, und dann zogen sie ihre fetten Finger schon weg!
Auf diese Weise war mir eigentlich bereits bestimmt, wie mein Leben jetzt weiterverlaufen würde. Ich mußte mich für meinen Sohn opfern, der nicht dazu geschaffen war, unter Menschen zu gehen, wo er nur auf Spott und Unverständnis stoßen würde. Ich knapste und knauserte, verließ den kleinen Raum nur, wenn es zwingend notwendig war, und brachte ihm gleichzeitig all die Erziehung bei, die er brauchen würde, wenn sich die Zeit näherte, wo er, ohne daß ihm ein Leid geschah, imstande sein würde, sich unter Fremde zu wagen. Auf unseren zwölf Quadratmetern vermittelte ich ihm einen Begriff von den Himmelsrichtungen, den Himmelskörpern und den Kardinalpunkten des Raumes. Ich zeigte ihm an den vier Wänden die vier größten Kontinente, komplett mit den wichtigsten Ländern, Städten, Bergketten und Flüssen, und mit Hilfe eines Eimers Wasser vermittelte ich ihm die Vorstellung von den Weltmeeren. Es fiel mir leicht, die Weltgeschichte durch lebende Bilder zu demonstrieren, die mir die Gelegenheit boten, die bewegendsten Auftritte zu mimen. Auch die Botanik versäumte ich nicht, denn wir hatten eine Topfblume, deren Blüten er auseinanderpflücken durfte, bis er ihren Aufbau verstanden hatte. Wogegen ich etwas zurückhaltender war, wenn es um das Tierreich ging. Ich schaffte jedoch einen Kanarienvogel an, dessen Gesang er gern lauschte und der ihm dadurch einen tiefen Einblick in die Seltsamkeiten der Zoologie gewährte.
Auch die Rechenkunst versäumte ich nicht. Ich brachte ihm die Zahlen bei, indem ich ihm eins auf den Kopf gab. So zählten wir auf, was das Leben an Leiden und Freuden zu bieten hat, legten zusammen und dividierten, nahmen mal und zogen ab, und mit der Summe in mente gingen wir direkt zur Philosophie über und studierten die weitschweifigen Systeme der großen Denker, wobei sich sehr schnell herausstellte, daß es sich dabei um ebenso viele eitle Versuche handelte zu verdecken, daß sie in Wirklichkeit nichts gegen die unbarmherzige Logik unserer Zahlen auszurichten vermochten. Lesen lernte er fast zu schnell, denn da er seine Augen nie schließen konnte, mußte er sie konstant beschäftigen. Auf kleinen Streifzügen nach Einbruch der Dunkelheit sammelte ich Zeitungen und Zeitschriften jeder Art aus Papierkörben und Abfalleimern auf. Dadurch lernte er die Welt bald kennen, denn ich kann Ihnen versichern, daß Bücher zu diesem Zweck ganz überflüssig sind. Wenn man sorgfältig allen Abfall an gedrucktem Papier, den man finden kann, einsammelt und danach liest, dann wird man früher oder später mit allem Bekanntschaft machen, was hier in der Welt geschrieben und gedacht worden ist; vielleicht in verkürzter und geraffter Form, aber trotzdem ... Er las jeden Fetzen von A bis Z, aber nicht genug damit, er entsann sich auch an alles, was er las, und erarbeitete auf diese Weise ein phänomenales Arsenal an Wissen über sozusagen alles zwischen Himmel und Erde. Man mag meine Erziehung angreifen, doch hier besitzt er jedenfalls einen Schatz, den niemand ihm nehmen kann. Seine Entwicklung hätte leicht sehr einseitig verlaufen können, ja, er hätte durchaus als richtiger Stubengelehrter enden können, wie man sagt, und so sah es eine Zeitlang auch aus. Doch dann nahm ich mich auch dieser Seite der Angelegenheit an und begann mit ihm zu turnen. Ich erlaubte ihm, auf den Möbeln herumzuklettern, und allmählich wurde er so geschmeidig wie eine Katze. Ich gab ihm schwere Gegenstände zum Heben, damit er seine Armmuskeln trainierte, und jeden Tag mußte er fünfhundertmal um den Tisch herumgehen. Schließlich ließ ich ihn über mich bockspringen, und das lernte er allmählich so leichtfüßig, daß die Nachbarn aufhörten, sich über die schweren Aufschläge auf dem Fußboden zu beklagen. Er gewann diesen Sport nun sehr lieb, und noch heute muß ich mich zuweilen aufbauen, obgleich ich allmählich steife Glieder bekomme und fast Zusammenfalle, wenn er sich auf meinem Rücken abstützt.
Ich möchte behaupten, daß niemand ihm das Tanzen besser beibringen konnte als ich, und ich habe ihm sogar Gesangsunterricht gegeben, abgesehen davon, daß ich ihm natürlich ganz allgemein Manieren anerzog. Aber ich mußte das ja alles ganz allein machen. Deshalb hat es auch länger gedauert, als es sonst bei Kindern der Fall ist, die Mutter und Vater und mehrere Schulmeister haben, die ihnen all das beibringen können, worum ich mich allein kümmern mußte.
Jetzt ist er Anfang Dreißig, und es gibt nur noch zwei Dinge, über die ich ihn nichts habe lehren können. Das sind Gott und die Liebe.
Ich bin ja Protestantin, und Pfarrer habe ich nie ausstehen können, sie sind das einzige, um das ich in dieser Stadt und überall, wo ich sonst noch gewesen bin, immer einen weiten Bogen gemacht habe. Gleichzeitig haben mir die Pfarrer Gott immer verleidet. Doch dann sage ich mir, daß das vielleicht mein Fehler ist – ich meine: Es kann ja sein, daß ihm mit ihnen gar nicht gedient ist. Es ist ja schon vorgekommen, daß eine achtbare Person von einer Bande Speichellecker umgeben war, von denen sich zu distanzieren ihr verwehrt war.
Ich will jedoch auch ehrlich zugeben, daß ich eine Religion vorgezogen hätte, wo es neben einem Gott auch eine Göttin gibt. Das wäre mir jedenfalls verständlicher erschienen, und gleichzeitig hätte ich meinem Sohn die Liebe erklären können. Das Thema habe ich jedoch, ehrlich gesagt, etwas oberflächlich behandelt, denn meiner Meinung nach eignet es sich nicht in erster Linie für die Theorie.
Ich fürchte mich nicht, alles geradeheraus zu sagen, so, wie es nun einmal ist – auch nicht zu meinem Sohn. Doch irgendwo hören die Worte auf und etwas anderes beginnt, darüber sind wir uns sicher einig! Und ich konnte ihm meinen Körper nicht zur Verfügung stellen, obgleich ich es manchmal erwogen habe. Denn wo sollte ich eine Frau finden, die sich nicht durch seine Augen schrecken ließ? Die nicht vor ihm zurückweichen würde, wenn sie plötzlich die Rattenschnauze ahnte? Ich selbst hätte das alles ertragen können, denn ich habe Schlimmeres gesehen, aber von meiner Sorte laufen auch nicht sehr viele herum.
Nein, das ist das einzige, was mir noch fehlt. Erst wenn das geschehen ist, hat sie eine Art Abschluß gefunden, die Geschichte, die an jenem Abend, als ich unten an der Seine stand und hörte, wie mich jemand aus dem Dunkel rief, ihren Anfang nahm. Komisch, ich fühle mich immer ein bißchen heiter, wenn ich an den Augenblick denke, trotz all der Kümmernisse und Unglücke, die er mit sich brachte. Wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich nicht in das Dunkel hineingegangen wäre? Hätte ich überhaupt anders handeln können?
Sehen Sie, ich meine, das wäre ein schrecklicher Gedanke, alles ist so gelaufen, wie es laufen mußte. Nun fehlt mir nur der Abschluß. Dann wird das Dunkel schon wieder eingreifen und eine neue Geschichte gebären.