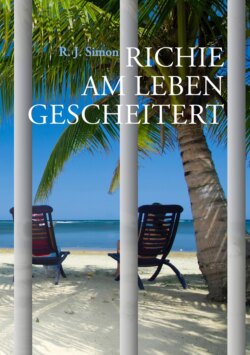Читать книгу Richie am Leben gescheitert - R. J. Simon - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
ОглавлениеJetzt schweifen Richies Gedanken in jene Zeit ab, als er die Schule erfolgreich abgeschlossen hatte. Nun ging es für ihn, wie für alle anderen, darum, eine Lehrstelle zu finden, um einen Beruf zu erlernen.
Seine Leidenschaft waren damals schon Autos und Motorräder. Die Wände seines Zimmers waren nicht, so, wie bei anderen Jugendlichen, mit Stars und Popgruppen, sondern mit Rennmaschinen, Tourenwagen und Luxussportwagen beklebt. Folglich lag es nahe, dass er den Beruf des Autoschlossers ergreifen würde.
Auf dem Arbeitsamt, wo Richie zu einer Berufsberatung und zur Vermittlung einer Lehrstelle vorstellig wurde, bekam er dann auch prompt Streit mit dem Berater. Wenn jemand eine andere Meinung als Richie vertrat, konnte das ja leicht geschehen, wenn derjenige versuchte, ihm seine persönliche Betrachtungsweise aufzuzwingen.
Der Berufsvermittler erzählte ihm, dass er sein äußeres Erscheinungsbild verändern solle, um einen seriösen Beruf mit Zukunft und Aufstiegschancen ergreifen zu können. Solche Reden wollte Richie nun aber überhaupt nicht hören. Für sein damaliges Alter und seine Einstellung war das reinstes Opa-Geschwätz. Richie war angezogen wie alle Jungs in dieser Zeit: Jeanshose, T-Shirt, Jeansjacke, hochhackige Stiefel und er hatte lange, wirre Haare. Er wollte kein Snob sein, sondern cool und easy. Die Hippiebewegung aus den USA war gerade am Ausklingen, so dass schon mit Richies Einstellung und der des Beraters Welten aufeinander prallten.
Weiter meinte der Typ, der Beruf des Autoschlossers sei nicht gut bezahlt, unheimlich schmutzig, besäße kaum Aufstiegschancen und mit 40 Jahren wäre das Kreuz kaputt, was keine guten Voraussetzungen für die Zukunft und ein erfolgreiches Leben seien.
In Richies Ohren alles dummes Zeug. Richie sagte zu ihm, dass ihn das alles nicht interessiere, weil er Autoschlosser und nichts anderes werden wolle, was ihm aber der Berater unbedingt auszureden versuchte. So entstand eine Grundsatzdiskussion, bei der Richie nicht einen Millimeter nachgab. Was bildete der Typ sich eigentlich ein? Das Gespräch ging dann eine ganze Weile hin und her. Der Mann vom Arbeitsamt argumentierte immer wieder mit den Aspekten, die gegen diesen Beruf sprachen, Richie dagegen beharrte auf seinem Berufswunsch.
In diesem Alter fehlt einem Jugendlichen natürlich der nötige Weitblick, aber die Wünsche und vorhandenen Fähigkeiten sollten doch bei der Berufswahl nicht außer Acht gelassen werden. So gab es dann auch für Richie keine Alternative. Er wurde im Verlauf dieser unsinnigen Debatte immer gereizter. Für Richie war der Schreibtischtäter vor ihm ein Paradebeispiel eines Bürohengstes, der vom Leben keine Ahnung hatte und die Jugend ohnehin nicht verstand. Der kannte nur sein Büro und irgendwelche Untersuchungen und Statistiken. Als der Spinner dann erneut mit seinen Argumenten von vorne begann, weil ihm wohl auch nichts Besseres einfiel, brannte bei Richie die Sicherung durch. Sie drehten sich im Kreis! Er machte dem nervenden Kerl in unmissverständlichem Ton klar, dass er Bewerbungsunterlagen und ein paar Adressen von Werkstätten haben wollte, die diesen Beruf ausbildeten. Zudem könne dem Berater doch der Schmutz und die Bezahlung ganz egal sein. Das sei einzig und allein seine Angelegenheit, brauste Richie mit erhobener Stimme auf, und für ihn sei das alles in Ordnung. Basta! Der Knaller hatte es jedoch immer noch nicht verstanden und fing etwas pikiert wieder damit an, Richie solle sich das doch noch einmal besser überlegen. Daraufhin war es bei Richie ganz aus. Er meinte zu ihm in gefährlicher Tonlage, dass er selbst auch den Beruf verfehlt hätte. Dann stand Richie ohne eine weitere Bemerkung auf und verließ das Büro, die Tür kräftig ins Schloss werfend. Noch auf der Treppe in dem Amt schimpfte Richie laut über die Borniertheit dieses Beraters, in der stillen Hoffung, dass dieser – oder noch besser: dessen Chef – es hören würde.
Richie fand dann seine Lehrstelle auch ohne diesen deplatzierten Bürokraten, der nur in seinem Sessel saß und keine Ahnung vom praktischen Arbeiten hatte. Seine Ausbildung begann Richie bald in einer kleinen Autowerkstatt. Genau genommen war es eine Tankstelle mit angebauter Halle, in der Autos und Motorräder repariert wurden. Dass dieser Beruf schmutzig war, das wusste Richie auch schon vorher. Es störte ihn aber nicht im Geringsten. Wozu gab es denn Wasser und Waschmittel? Die schlechte Bezahlung, wie Richie im Vergleich zu Freunden aus anderen Berufszweigen feststellte, war das einzige Manko. Die Arbeit und der Beruf machten ihm aber trotzdem so viel Spaß, dass das ein adäquater Ausgleich für das fehlende Geld war. Was hätte ihm ein Beruf mit Topbezahlung genützt, wenn er sich dafür im Alltag zu Tode langweilte oder sich immer nur ärgerte?
Wegen seines unverbesserlichen Fehlers, sich nie richtig in der Gewalt zu haben und sich nichts gefallen zu lassen, bekam Richie natürlich auch während seiner Ausbildung öfter Differenzen mit seinem Meister und dem Gesellen. Früher war die Ausbildung ohnehin härter als heute. Obwohl seine erst 13 Jahre zurücklag, hatte sich da schon sehr viel geändert. Damals traf der Satz „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ voll zu. Lehrlinge hatten erst mal grundsätzlich nichts zu melden. Genau das Richtige für den Charakter von Richie! Die Lehrlinge hießen noch „Stifte“ und wehe, man hätte gemault, wenn ein Geselle sagte, man solle ihm Frühstück oder etwas zu trinken holen. Ein satter Tritt in den Hintern wäre das Ergebnis gewesen und es gab niemanden, bei dem man sich hätte beschweren können.
Richie handelte sich einmal einen blauen Fleck ein, weil ihm ein Geselle einen Schraubenschlüssel ans Bein warf. Richies Fehler lag nur darin, dass er der Meinung war, dessen ölverschmiertes Werkzeug nicht reinigen zu müssen. Also ging Richie zum Meister, der auch der Chef war, und beschwerte sich über seinen Gesellen, den Bluterguss vorzeigend. Der Meister sah es sich flüchtig an und meinte dazu lediglich, dass das aussehe, als ob er die Treppe der Montagegrube heruntergefallen wäre. Richie solle sich nicht so anstellen und seine Arbeit weiter tun. Damit war der Fall abgeschlossen und die Beschwerde abgeschmettert.
Im ersten Lehrjahr musste Richie, wie das so üblich ist, meistens die Dreckarbeiten verrichten. Sämtliche Arbeiten, die anfielen und die die Gesellen nicht gerne erledigten, blieben an ihm hängen. Also machte Richie größtenteils Ölwechsel, Arbeiten an der Auspuffanlage, Abschmierarbeiten und fegte abends natürlich brav die gesamte Werkstatt. Auch das Gesetz, dass ein Azubi keine produktive Arbeit leisten dürfe, gab es nach seiner Ansicht nicht – oder es beachtete niemand. Das wurde alles erst später ab Ende der 70er Jahre propagiert und eingehalten, um die Lehrlinge besser zu schützen.
Im zweiten Ausbildungsjahr bekam Richie schon seinen eigenen Werkzeugkasten und reparierte selbstständig Fahrzeuge, natürlich unter der Aufsicht des Gesellen und des Meisters. Aber gängige Arbeiten, die er nach deren Meinung fehlerfrei erledigen konnte, wurden kaum noch überwacht. Das war im Grunde genommen ein großes Lob für Richie, denn seine Ausbilder zeigten dadurch, dass sie wussten, was er schon zu leisten imstande war und wie hoch sie seine fachlichen Fähigkeiten ansahen. Obwohl er ja noch Lehrling war, wurden an ihn ab dem Zeitpunkt fast die gleichen Maßstäbe angelegt, wie an einen Gesellen, mit allen Risiken und Konsequenzen und vor allem mit der Einhaltung der festgelegten Vorgabezeiten. Er durfte nicht mit einer Art „Lehrlingsbonus“ trödeln. Wenn er mit einer Arbeit zu langsam war, gab es sofort Ärger. Und selbstverständlich wurden diese Arbeiten, die Richie durchführte, auch beim Kunden abgerechnet, als wenn sie von einem Gesellen erledigt worden wären.
Dass ein Stift keine Überstunden machen durfte, wurde ebenso von niemandem kontrolliert, beziehungsweise kein Lehrling ging ernsthaft dagegen an. Richies Arbeitszeit begann um 7 Uhr und wäre regulär um 15.30 Uhr zu Ende gewesen. Irrtum! Hatte er ein Auto oder ein Motorrad in Arbeit und die Fertigstellung dauerte voraussichtlich nicht mehr lange, musste Richie auf alle Fälle das Fahrzeug abholbereit machen. Die Begründung des Meisters dafür war ganz einfach: „Hättest du den Tag über nicht getrödelt, wärst du jetzt fertig! Der Kunde wartet auf sein Auto.“ Dabei spielte es keine Rolle, ob das bis 16.00 Uhr oder sogar bis 16.30 Uhr dauerte, es ging dabei schließlich um bares Geld. Und manches Mal wurde Richies Einsatz ja auch extra belohnt, oft durch ein großzügiges Trinkgeld vom Eigentümer des Fahrzeugs, um das es ging, oder – was allerdings selten war – sogar durch den Chef selbst.
Meistens kam Richie erst zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr nach Hause, obwohl er mit dem Mofa nur fünf Minuten für den Weg brauchte.
Damals wurde ein Stift noch so richtig ausgebeutet. Andererseits lernte Richie so auch von Anfang an, richtig, effizient und verantwortungsvoll zu arbeiten, und er war nachträglich nicht mehr erzürnt deswegen. Er legte eine erstklassige Gesellenprüfung ab. Hätte er versucht, gegen die allgemein übliche Behandlung als Stift etwas zu unternehmen, wäre das im Endeffekt sein eigener Schaden und nicht der des Ausbildungsbetriebes gewesen. Richie versuchte oft, sich zu wehren, bevor er seine Ausbildung jedoch vorzeitig hätte abbrechen müssen, hielt er sich dann doch lieber zurück und biss sich durch diese Zeit.
Im Vergleich dazu sind die Ausbildungen heute ein Zuckerschlecken. Weil sie immer irgendwelche Vorschriften zu beachten haben, kommen die Azubis heute doch gar nicht mehr richtig zum Lernen, wie man arbeitet, weil sie schon beinahe vor der Arbeit beschützt werden. Ob das besser ist? Richies und alle vorangegangenen Generationen hatten die Ausbildung auch gut überstanden und waren gute Handwerker gewesen.
So, wie Richies Charaktereigenschaften waren und auch heute noch sind, kann man sich gut vorstellen, dass er ständig gegen den Strom schwamm, was ihm aber, wie schon festgestellt, nichts half. Wegen seiner kleinen und großen Streits mit dem Meister und den Gesellen, befürchtete Richie, als es auf das Ausbildungsende zuging, dass er nach seiner Gesellenprüfung ohne Anstellung dastehen würde. Er rechnete nicht damit, dass er einen Arbeitsvertrag bei der Werkstatt bekommen würde. In dieser Beziehung täuschte er sich aber. Richie war zwar eigensinnig und der Umgang mit ihm zeitweise schwierig, aber er war ein guter Arbeiter. Das war für den Chef wichtig! So wurde er dann auch als Geselle in diese Werkstatt übernommen.
Doch schon nach zwei Tagen bekam Richie Zwist mit einem seiner Kollegen. Ein paar der Arbeiter sahen in ihm immer noch den Stift und behandelten ihn dementsprechend. Sie meinten, weiterhin das Recht zu haben, Richie zum Essen Holen zu schicken und ihm Arbeiten auferlegen zu können, die sie selbst nicht gerne machten. Einer seiner Kollegen war dabei am rabiatesten und übertrieb es einfach. Dem drohte Richie eben nach zwei Tagen prompt Prügel an. Richie baute sich vor ihm auf und legte ihm dar, wenn sich sein Verhalten ihm gegenüber nicht bessern würde, er sich ein paar einfing – auch wenn der andere älter und natürlich länger in der Firma war. Das war Richie total egal. Nur wer anderen Respekt entgegenbringt, hat diesen auch selbst verdient, war Richies gesunde Einstellung dazu, da spielte das Alter keine Rolle.
Dieses Mal hatte sich Richie aber verhältnismäßig gut im Griff und warnte erst, anstatt ohne Vorwarnung zuzuschlagen. Die entstandene Auseinandersetzung der beiden wurde naturgemäß laut, so dass diese auch dem Chef nicht verborgen blieb. Der kam sofort aus dem Büro und fragte, was da los sei.
Mit viel Durcheinandergerede und gegenseitigen Schuldzuweisungen wurde er aufgeklärt, um was es ging. Richie begann in seiner explosiven Art dann fast einen noch schlimmeren Fehler, als zu prügeln. In der Aufregung und seiner Unbeherrschtheit sagte er zu seinem Chef, er solle seine Papiere fertig machen, weil er auf der Stelle kündige. Der Chef kannte Richie aber zum Glück nun schon weit über drei Jahre und wusste um dessen Hitzkopf. Und einen guten Arbeiter, der Richie zweifellos war, wollte er nicht verlieren. Den anderen Gesellen schickte er an seine Arbeit und auf Richie wirkte er beruhigend ein. Er bagatellisierte die Angelegenheit und fragte, als sich Richie wieder abgekühlt hatte, ob er das ernst gemeint hätte mit der Kündigung. Natürlich ließe er ihn gehen, wenn das sein Wunsch wäre, aber er würde sich freuen, wenn er bei ihm bliebe, erklärte er Richie in aller Ruhe. Obgleich Richie nicht unkompliziert war, besaß er für seinen Chef einen großen Wert. Richie feierte nie krank und war immer für die Arbeit da. Ebenso erledigte er seine Aufgaben schnell und gewissenhaft, weil sein Beruf letztendlich sein Hobby war. Bei Richie kam die Bezeichnung „Beruf“ wirklich von „Berufung“. Der Chef konnte immer auf Richie zählen, wenn es mal eng wurde und er jemanden brauchte, der eine Extraschicht einlegte, um ein Problem zu lösen. Auf Richie war grundsätzlich in jeder Beziehung Verlass, was man nicht von all seinen Kollegen behaupten konnte.
Die Arbeitslage war in jener Zeit hervorragend für Arbeitnehmer, also musste der Chef die Drohung schon ernst nehmen. Damals gab es mehr Arbeit als Arbeiter, was bedeutete, dass Richie wahrscheinlich schon am nächsten Tag wieder eine Anstellung gehabt hätte. Und wegen des bekannten Eigensinns von Richie, dem in diesem Moment egal gewesen wäre, was mit ihm anschließend geschah, nahm der Werkstattleiter seine Aussage nicht als leere Drohung auf. Weil er aber Richie nicht als Mitarbeiter verlieren und vor allem für Frieden in seinem Unternehmen sorgen wollte, redete er gleich darauf mit dem anderen Kollegen ein paar klare Takte, um künftig solchen Ärger erst gar nicht wieder entstehen zu lassen. Reden konnte der Chef, das war sein Element, in dem er immer siegte.
Die Kollegen änderten ab diesem Tag ihr Verhalten Richie gegenüber und akzeptierten ihn als gleichwertigen Mitarbeiter. Das Stift-Image war endlich abgelegt. Niemand war Richie böse wegen seines Schrittes, die Sache rabiat geradezurücken. Im Gegenteil, sie bekamen dadurch eher Respekt vor ihm, weil es doch zeigte, dass er für das Einstand, was er sagte, und sich auch durchsetzte. Richie hatte schließlich keinen Verrat geübt oder einen anderen denunziert, was unter Kollegen wohl das übelste Vergehen ist. Er hatte sich nur gewehrt und offen gezeigt, dass er sich nichts gefallen lassen würde. Alle, die es bis dahin noch nicht gemerkt hatten, stellten bald fest, dass Richie ein guter, ehrlicher und kollegialer Mitarbeiter war. Es zweifelte keiner mehr daran, dass Richie nie jemanden linken oder verraten würde. Richie zeigte nun auch, was als Lehrling nicht in der Form möglich war, dass er nämlich stets zur Verfügung stand, einem Kollegen zu helfen, wenn der mit seiner Arbeit alleine nicht zurechtkam. Richie kannte sich in so manchen Dingen besser aus, als die Altgesellen und konnte ihnen damit oft wertvolle Tipps geben. Kurz: Richie war alsbald sehr beliebt und voll integriert in die Truppe. Auch mit dem Kollegen, mit dem zu Anfang seiner Gesellenzeit Probleme bestanden, verstand er sich später hervorragend.
Mit 18 Jahren, noch in der Ausbildung, machte Richie bereits den Führerschein für Auto und Motorrad. Dafür sparte er schon seit seinem ersten Lehrlingsgeld. Den Lappen, wie der damalige graue Führerschein gerne genannt wurde, hatte er schon in der Tasche, als er die Gesellenprüfung absolvierte, weil sich die beiden Prüfungen fast überschnitten. Sein nächstes großes Ziel war, sich endlich ein eigenes Motorrad kaufen zu können. Er konnte es kaum erwarten, das Geld endlich zusammengespart zu haben. Mit fast 19 war es dann so weit. Der Zeitablauf passte gut zusammen, denn seine Prüfungen legte er im Winter ab und da wäre es unsinnig gewesen, sich ein Motorrad zu kaufen und anzumelden. Aber zu beginn des Sommers war er am Ziel. Richie hatte genug Geld zur Seite gelegt und kaufte sich eine 1000-cm³-Rakete. Na ja, was damals halt eine Rakete war… Im Vergleich zu dem, was die Asphaltsplater von heute an PS und Beschleunigung so hergeben, war das nicht so sensationell. Für diesen Feuerstuhl aber gab Richie seinen letzten Pfennig. Er war sein ganzer Stolz. Richie sparte nach dessen Anschaffung auch noch weiter, um sich diverse Extras für sein geliebtes Moped zu kaufen. Bald gehörte sein „Hocker“, wie er sein Motorrad auch gerne nannte, zu den heißesten in der Stadt.
Richie fand dann auch über seinen alten Schulfreund Knopf Anschluss an eine Motorradgruppe – keine Rocker, wenn sie auch oft fälschlicherweise dafür gehalten wurden, sondern einfach eine Clique aus Leuten, deren Hobby das Motorradfahren war. Auf der Straße verhielten sie sich auch nicht wie rücksichtslose Verkehrsrowdys. Natürlich gaben sie ihren Pferdchen auch gelegentlich freien Lauf und hielten sich nicht immer an die Geschwindigkeitsvorgaben, wenn die Straße übersichtlich und frei war. Aber dies immer ohne Risiko für sich und andere Verkehrsteilnehmer.
Ihr Alter lag zwischen 18 und 35 Jahren. Die Gruppe bestand damals aus zwölf Kerlen, von denen vier feste Freundinnen hatten, die natürlich auch immer mit dabei waren. Jeder von ihnen besaß sein eigenes Motorrad. Sie alle verstanden sich prächtig und waren sich nahezu immer in allem einig. Mit ihren heißen Öfen unternahmen sie allerhand. Fast jedes Wochenende fuhren sie zusammen eine Tour zu einem Ziel, das sie vorher abstimmten. Dabei ging es meist um irgendeine Sehenswürdigkeit oder eine Veranstaltung, die für sie interessant war. Oder sie befuhren eine der berüchtigten Motorradstrecken. Ein Mal im Jahr veranstalteten sie auf einem alten verlassenen Betriebsgelände ein großes Fest mit Grillen, Bier und einem Geschicklichkeitswettbewerb, bei dem sie mit viel Spaß ermittelten, wer seinen Hocker am besten im Griff hatte.
Am liebsten fuhren sie auf ihren Touren in den nahen Schwarzwald oder Odenwald, wo man mit einem Motorrad die herrlich geschwungenen Bergstraßen in der guten Luft genießen konnte. Paul aus dieser Gruppe besaß ein Buch, in dem die schönsten Straßen Deutschlands und die wichtigsten Europas beschrieben waren. Das begann mit der Schwarzwaldhochstraße, der Romantischen Straße, über die Burgen- und die Märchenstraße bis hin zur Côte de Azur. Davon suchten sie sich gelegentlich eine Strecke aus und befuhren sie am Wochenende. Sie nahmen sich irgendwann vor, alle in dem Bildband vorgestellten Straßen zu erkunden und zu durchfahren, was ihnen am Ende auch zum großen Teil gelang. Die aufgeführten Straßen in Deutschland zumindest bereisten sie alle.
In der Sommerzeit legten sie alle ihren Urlaub nach vorheriger Absprache so, dass sie ihn überwiegend gemeinsam verbringen konnten, denn dann war es ihnen möglich, auch längere Reisen zu unternehmen. Oft ging es dann Richtung Süden, ans Meer. Natürlich mit den Bikes. Die Alternative mit einem Auto kam keinem in den Sinn. Ihr gemeinsamer Spaß wurde auch nie getrübt, wenn sie über längere Zeit zusammen waren. Sie hatten immer eine Menge zu lachen und stets gute Stimmung. Ernsthaften Streit bekamen sie untereinander eigentlich nie. Sogar Richie kann sich an keine Situation erinnern, in der er mit einem aus der Clique aneinander geraten wäre.
Ihre kollektive Freude am Motorradfahren konnten ihnen auch die Schwierigkeiten nicht verderben, die oft auf ihren Touren wegen des Vorurteils „Rocker“ auftraten. Für die damals unaufgeklärte, unbelehrbare Bevölkerung schien jeder, der eine Lederkombi trug, ein Rocker zu sein. Dass die Mehrzahl friedliche und gutartige Motorradfahrer waren, realisierten diese Leute nicht. So waren auch sie nur eine fröhliche und witzige Motorradgruppe, denen normalerweise jeder Streit fern lag. Sie wollten einfach nur mit ihren Feuerstühlen durch die Gegend brausen und den Fahrtwind sowie die Fliehkräfte dabei genießen. Das war ihre große Freiheit und Lebenseinstellung. Ihre Ideologie, die über allem stand.
Lächelnd fällt Richie jetzt ein, wie sie in Spanien einmal kräftig die Puppen tanzen ließen. Dort waren sie mehrmals an verschiedenen Orten im Urlaub. In diesem dreiwöchigen Urlaub, an den Richie jetzt gerade denkt, wurden sie von den Einheimischen bald liebevoll „Gruppo Loco“, die verrückte Gruppe, genannt. Jeder Tag war geprägt von Ausgelassenheit und jeder Einzelne von ihnen war unentwegt zu allerlei Unsinn aufgelegt, was ihnen ja auch letztendlich den Namen einbrachte. Überall, wo die 15-köpfige Gruppe auftauchte, war der Teufel los und es gab etwas zu lachen. Ob sie sich am Strand, sonst irgendwo in dem kleinen Ort oder in ihrer Stammkneipe aufhielten, die sie in diesen drei Wochen hatten, wenn sie auftauchten, blieb kein Auge trocken. Wo sie einfielen ging der Punk ab. Sie gingen niemals einzeln aus, sondern traten stets als Einheit auf, immer alle oder keiner, und sie waren in dem kleinen Ort bald weit und breit bekannt – selbstverständlich nur im positiven Sinne. Die Einheimischen hatten ihre Freude an ihnen, egal, ob sie in ein Lokal oder in ein Straßencafé kamen, sie wurden überall gern gesehen und man hieß sie herzlich willkommen. Sie machten keinen Ärger und ihr Unfug ging niemals auf Kosten anderer. Jeder Wirt wusste von vornherein, dass er mit diesen Ausgeflippten gutes Geld verdiente und dass es mit ihnen nicht langweilig werden würde. Richie und seine Freunde verkonsumierten Unmengen Sangria und Lumumba, doch niemand musste befürchten, dass sie dann alkoholisiert ausfällig werden könnten. Das lag ihnen fern und kam kein einziges Mal vor. Also konnte jeder Wirt ohne Bedenken an sie so viel ausschenken, wie sie bestellten und seine Vorräte hergaben. Sie schafften es mehrfach, sämtliche vorhandene Mengen eines Getränkes zu vernichten, auf das sie sich jeweils gerade eingestellt hatten.
Das Restaurant, in das sie fast jeden Mittag oder Abend zum Essen kamen, war recht einfach eingerichtet. Der Boden war mit rostroten rechteckigen Kacheln gefliest und die Wände mit einfachem Rauputz verkleidet. Die Tische bestanden – ebenso wie die Sitzmöbel – aus Korbgeflecht und hatten Glasscheiben als Tischplatten. In den Korbsesseln saß man bequem und das Essen, das aufgetischt wurde, war hervorragend und vor allem reichlich. Gelegentlich bereitete der Wirt extra für sie ein landestypisches Gericht zu, um es ihnen näher zu bringen. Paella war so ein Beispiel, das er ab und zu ankündigte und dann in Volksfestmengen für sie zubereitete. Das war Kulturaustausch pur und hatte für beide Seiten seinen Reiz. Das Restaurant war auch Bodega und nicht nur ein reines Speiselokal. Sie hatten sich dort ihre Tische zusammengestellt, die der Wirt schon nach dem dritten Tag nicht mehr auseinanderstellte, so lange ihr Aufenthalt in dem Ort dauerte. Das war also ihr Stammplatz, den der Wirt stets für sie freihielt. Es bedeutete für ihn Umsatz, wenn die 15 Leute täglich zu ihm kamen, und so wollte er sie natürlich nicht verärgern, sondern sicherstellen, dass sie sein Lokal möglichst oft aufsuchten. Dabei entwickelte sich auch trotz der Sprachbarriere eine Freundschaft zwischen den Gästen und ihm.
Eines Tages, als sie wie üblich mittags zum Essen bei ihm waren, machten sie dem Besitzer des Lokals verständlich, dass er für den Abend reichlich Muscheln bereithalten sollte. Es war nicht einfach, ihm zu erklären, was sie wollten, weil sie ja so gut wie nicht spanisch sprachen. Aber er verstand, was ihr Wunsch war.
Richie und seine Freunde hatten vormittags am Strand die Idee gehabt, einmal ein zünftiges Muschelessen zu veranstalten. Zwar auf ihre besondere Art, aber immerhin ein Muschelessen. Solche Delikatessen wie Muscheln, Krebse oder Hummer, einfach alle Früchte des Meeres, gab es schließlich nirgendwo besser und frischer, als in den südlichen Ländern, so, wie man auch die Paella nirgends besser als in Spanien bekommen kann, wo die Zutaten frisch verarbeitet werden und exzellent zum Klima passen. Nicht, wie bei uns, aus der Tiefkühltruhe, sondern wirklich frische Ware aus dem unerschöpflichen Meer.
Am Abend dann fiel also die ganze Meute mit beachtlichem Appetit und einer großen Rolle Plastikfolie in dem Restaurant ein. Die Folie besorgten sie sich aus einer Fabrik in der Nähe. Grinsend begrüßten sie nacheinander den Wirt, der noch nicht in das, was ihn erwartete, eingeweiht war. Allerdings zweifelten sie auch nicht daran, dass er Einwände gegen das vorbringen würde, was sie vorhatten, zu veranstalten. Unter dem Staunen des Wirtes und eines älteren Dorfbewohners, der an der Bar saß, begannen sie gemeinsam, die Folie auszubreiten. Damit bedeckten sie den Boden unter und rund um ihren Tisch großzügig. Auch den Tisch selbst und ebenso die Wand dahinter, wo sich ein Fenster über die gesamte Länge des Tisches befand, belegten und behängten sie sorgfältig mit Folie. Die Wand bedeckten sie, das Fenster wurde frei gelassen. Das Fenster stand weit offen, um die laue Abendluft als Abkühlung in den Gastraum zu lassen. Schließlich tat es gut, wenn die Hitze, die den Tag über herrschte, etwas nachließ. Im Freien vor dem Fenster wurde deswegen dann von den Jungs auch großflächig die Folie ausgebreitet. Die Ecken und Kanten der Folie beschwerten sie mit größeren Kieselsteinen, damit der leichte Wind sie nicht erfasste und wegtrug.
Der Wirt ahnte bei dem Anblick, den die arbeitenden Jungs boten, Schlimmes und raufte sich unsicher die Haare. Er griff aber in das Tun seiner Stammgäste nicht ein, sondern ließ sie, wie vermutet, gewähren und wartete ab. Er war wohl selbst sehr gespannt, was das werden sollte, setzte sich auf einen Hocker an die Bar zu dem einzigen Gast und beobachtete, was da geschah. Er war auf alles gefasst. Während der Vorbereitungen lachte die Gruppe schon übermütig über das verdutzte Gesicht des Wirtes und malte sich aus, wie er wohl schauen würde, wenn es richtig losging. Die Frau des Wirtes kam ebenfalls aus der Küche hinzu, so, wie einer seiner Söhne. Die beiden blieben hinter der Theke stehen und verfolgten mit fragendem Gesichtsausdruck das Geschehen. Sie waren gekommen, um zu sagen, dass die Muscheln und die dazugehörigen Soßen so weit fertig waren und aufgetischt werden könnten, aber nun standen sie da und sahen zunächst zu, wie der Gastraum präpariert wurde.
Als die Jungs und die Frauen mit dem Auskleiden des Raumes fertig waren, nahmen sie auf ihren Stühlen Platz und der Wirt begann mit seinem Sohn töpfeweise Miesmuscheln aufzutischen. Das tat er mit einem besonders breiten Grinsen, denn er glaubte ihren großen Worten nicht und war der Meinung, dass sie die Menge an Muscheln, die er besorgt hatte, nicht verzehren könnten. Und zudem war er darauf gespannt, was ihre Mägen dazu sagen würden, denn wenn man diese Kost nicht gewöhnt ist, kann sie eine durchschlagende Wirkung haben.
Doch die Muschelesser langten kräftig zu. Einer der auf den Tisch gestellten Töpfe, allesamt randvoll mit Schalentieren, war bald leer. Auch die anderen reichten nicht lange. Der Wirt musste immer wieder neue volle Töpfe und Schüsseln herbeibringen und seine Meinung kippte dann ganz schnell. Er staunte nicht schlecht, welches Tempo die Gruppe beim Essen der Muscheln vorlegte. Wie sie später erfuhren, jagte der Wirt zwischendurch seinen Sohn mit dem Mofa zu einem Schwager, der am Hafen ein Fischgeschäft betrieb, um Nachschub zu holen, weil er bald merkte, dass seine Vorräte nicht ausreichen würden.
Die Szene glich einem Fressgelage! Jeder von ihnen aß eine Muschel nach der anderen so schnell, als wollte er einen Rekord aufstellen. Die Gruppe war regelrecht aus dem Häuschen, sogar die Frauen standen den Männern nicht nach. Sie lachten und grölten und stopften sich dabei das Fleisch der Muscheln beinahe unanständig mit den Händen in den Mund. Die Schalen der Meerestiere warfen sie dann, wie die alten Germanen ihre abgenagten Knochen, hinter sich zum Fenster hinaus oder einfach auf den Boden. Deswegen legten sie sinnvollerweise vorsorglich überall die Folie aus. Dazu wurde literweise Rotwein getrunken, der dem einen oder anderen gelegentlich auch wieder aus dem vollen Mund zurück über die Kleidung lief. Sie aßen sozusagen iberische Spezialitäten auf germanische Weise.
Mit dieser Aktion wurde die Clique dann endgültig stadtweit, ja, sogar überregional bekannt. Vor dem Fenster um die ausgelegte Folie herum versammelte sich ein Teil der Dorfgemeinschaft und sah belustigt dem bunten Treiben zu, wobei die Zuschauer schon darauf achten mussten, nicht von den herumfliegenden Schalen getroffen zu werden. So etwas hatten sie in ihrem Ort bis dahin noch nicht erlebt.
Der älteste Sohn des Wirtes verständigte obendrein noch einen Reporter einer überregionalen Tageszeitung. Der traf dann auch wenig später ein, weil das beschriebene Geschehen seine Neugier erweckte, und machte Bilder von dieser ungewöhnlichen Veranstaltung. Das war ihm eine Story für die nächste Ausgabe wert. Kopfschüttelnd und lachend fotografierte er und machte sich seine Notizen. Empört hatte sich über das Verhalten der Deutschen keiner, wie es umgekehrt wahrscheinlich hierzulande der Fall gewesen wäre. Wenn das Muschelessen auch im Ablauf sehr unmoralisch war, so verhielten sie sich doch nicht obszön oder wiesen die Zuschauer durch ekelerregende Gesten zurück. Alle fanden den Einfall originell und amüsant. Besonders den Mitwirkenden an diesem „Mahl“ bereitete es eine sichtbar helle Freude, urig mit den Händen zu essen und dabei nicht auf die Tischdecke, den Boden und die Kleidung achten zu müssen.
Dem Wirt gingen am Ende fast die Augen über, als er feststellen musste, dass seine deutschen Freunde doch tatsächlich seine ganzen Muschelvorräte aufgegessen hatten, noch dazu, wo seine eigenen, die er extra besorgte, nicht einmal ausgereicht hätten. Nach seinen Angaben reichte die Menge, die sie verzehrten, normalerweise für zwei bis drei Monate!
Nach einer kleinen Verdauungspause, die dringend nötig war und die der Wirt mit kostenlosem Schnaps als Unterstützung förderte, fingen sie zusammen an, die Reste des großen Fressens zu beseitigen. Als dann alles wieder sauber und so aufgeräumt war, wie sie das Lokal antrafen, bezahlten sie ihre Zeche und entschädigten den Wirt nochmals durch ein großzügiges Trinkgeld für das Durcheinander, das sie angerichtet hatten. Anschließend bummelte die Gruppe bis in die späten Abendstunden durch den Ort und am Strand entlang. Bewegung war dringend erforderlich, um das Essen zu verdauen.
Die von dem Wirt befürchteten Nebenwirkungen blieben jedoch völlig aus. Womöglich waren sie alle durch das Ereignis dermaßen aufgekratzt, dass negative Nachwehen keine Chance hatten. Hier und da tranken sie noch einen Cocktail oder Longdrink, Bier bestellte sich keiner von ihnen bei dem Völlegefühl, das sie belastete. Essen wollte an diesem Abend auch keiner mehr etwas. Sie waren verständlicherweise alle sehr gut gesättigt. In nächster Zeit wollte auch keiner mehr Muscheln sehen. Das reichte vorerst jedem für eine Weile.
Am nächsten Tag fanden sie sich wie üblich wieder vollzählig in ihrem Lokal zum Mittagessen ein. Noch als sie damit beschäftigt waren, die Stühle zurecht zu rücken, um sich zu setzen, kam der Wirt mit der Tageszeitung an ihren Tisch und präsentierte diese breit grinsend. Voller Stolz zeigte er auf den Artikel und das Foto darin, auf dem sein Restaurant zu sehen war.
Jeder versuchte als erster einen Blick in die Zeitung zu werfen, die den Wirt so glücklich machte. Darin war außer dem Bild des Lokals noch eines von ihnen abgedruckt, wie sie ihr Mahl abhielten. Das rief ein großes Hallo hervor. „Guck mol wie du aussiesch“, „eh Langer, voll getroffe“ und „he glotscht du bleed in die Kamera“, überschlugen sich die Kommentare.
Den Text, der die Bilder wie ein Rahmen umschloss, verstanden sie natürlich nicht. Das einzige, was sie aus dem Text lesen und verstehen konnten, war: „Nino’s Restaurant“, der Name „ihres“ Lokals. Der Wirt übersetzte ihnen dann das Geschriebene in sein gebrochenes Deutsch. Es interessierte sie aus verständlichen Gründen, was da stand, und ihm machte es Freude, seinen Namen in der Zeitung zu sehen. Es wurde von einer lustigen, ausgelassenen Bande berichtet, die es wohl verdient hätte, ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen zu werden. Die Formulierung „Bande“ war dabei keinesfalls bösartig aufzufassen. Der Artikel war nicht so geschrieben, dass man den Eindruck bekam, es wäre eine Horde Wilder in das Lokal eingefallen. An der Stelle, wo sein Name geschrieben stand, konnte man ein noch breiteres Grinsen als sonst im Gesicht des Wirtes sehen. Seinen Namen betonte Nino besonders und saß vor Stolz steif und gespannt auf seinem Stuhl. Weiter wurde erzählt, wie lange der „Schmaus“ dauerte, wie viele Personen daran teilgenommen hatten und wie viele Kilogramm Muscheln sie schätzungsweise verschlangen. Ganz klar: Das Ereignis wurde nicht als Schweinerei oder abartige Veranstaltung geschildert, der Artikel war lustig und mit Humor geschrieben, so weit das durch die Übersetzung herauskam. Der Schreiber erzählte von den Vorbereitungen, die von den jungen Leuten getroffen wurden, um es nicht zu einer Schweinerei kommen zu lassen, und wie ausgelassen die Stimmung während des Essens war. Der Abschlusssatz des Berichtes war dann noch ein dickes Lob an Nino: „Wie gut müssen die Muscheln bei Nino schmecken, dass die Touristen sämtliche Vorräte des Ortes leer essen!“
Jeder Einzelne von ihnen fand es stark, in der Zeitung zu stehen, was ihnen dann auch gleich einen Grund zum Feiern gab. Später kaufte die Clique dann auch gleich am nächsten Zeitungsladen die Bestände dieser Zeitung leer, weil jeder seine eigene besitzen wollte, um den Bericht den Reiseandenken hinzuzufügen.
Am Abend sponserte der Wirt die Feier der Gruppe dann auch mit zwanzig Flaschen seines Hausweines, als Dankeschön für die kostenlose Reklame, die der Artikel für ihn und sein Restaurant bedeutete. Das Fest, an dem sogar ein paar Dorfbewohner gerne teilnahmen, war gelungen und dauerte bis spät in die Nacht. Keiner ging nüchtern aus dem Lokal und es flossen noch etliche Weinflaschen mehr als die von Nino spendierten. Sogar von so manchem Einheimischen bekamen sie zwischendurch eine Runde Schnaps ausgegeben. Die Gastfreundschaft in dem Ort war unglaublich. Alle freuten sich mit ihnen und dass ihr Dorf in der Zeitung genannt wurde, machte alle stolz. Da bekam der Ausdruck „Lokalpatriotismus“ ein neues Gesicht.
An einem anderen Tag in diesem Urlaub wurden sie alle zu Kindern. Sie waren am Strand und alberten und tobten im Sand und im Wasser herum, bis einer, Richie glaubt, es sei Tom gewesen, auf die Idee kam, eine Sandburg zu bauen. Wie das so ist in einer ausgelassenen Gesellschaft, begann sofort jeder, eine solche zu errichten. Bis wieder ein anderer den Einfall hatte, es müsse doch keine Burg sein. Warum nicht etwas anderes? Zum Beispiel ein Auto. Darin lag natürlich noch mehr Reiz und die Idee wurde gleich aufgegriffen. In drei Gruppen begannen sie, je einen Rennwagen aus Sand zu formen. Die Sandmodelle sollten so groß werden, dass man sich hineinsetzen konnte. Das bedeutete, dass sie eine beachtliche Menge Sand bewegen mussten, was sie sich jedoch ohne Probleme zutrauten. Zu Anfang gruben sie jeweils ein Loch in den Strand und häuften die Sitzbank an, damit man sich schon einmal setzen und dafür Maß nehmen konnte. Mit einem dieser so entstehenden Autos waren sie zu nahe am Wasser, so dass sich in dem Loch, das den Fußraum darstellte, immer wieder Wasser ansammelte und man nasse Füße bekam. Das störte aber keinen, sie fanden es eher komisch. „Rennwage mit fließend Wassa“, war dann auch Knopfs passender Kommentar.
Nun begannen sie, die Karosserien um die Sitzbänke herum zu modellieren. Der Strand war beeindruckend breit und bot damit genügend Platz, so dass sie niemanden mit ihren Bauarbeiten störten. Einer der entstehenden Wagen wurde ein Formel-1-Bolide, die anderen beiden Tourenwagen. Die waren leichter zu bauen, weil sie eine kompaktere Form und nicht solche hohen abstehenden Spoiler besaßen, wie ein Formel-1-Renner. Es gelang aber jeder Gruppe, ein tolles Rennauto nur aus Sand zu bauen. Der Aufwand war beachtlich und es gestaltete sich nicht so leicht, wie gedacht. So mussten sie auch stets Wasser vom Meer holen und die Bauten damit bespritzen, was dem rieselnden Sand erst Festigkeit gab. Dazu wiederum wurden verschiedene Gefäße wie Eimer oder leere Wasserflaschen besorgt. Die Frauen überlegten kurz, ob sie dazu ihr Haarspray holen und zur Verfügung stellen sollten.
Die Tourenwagen hatten am Ende aus bautechnischen Gründen kein Dach, sahen also eher einem Cabrio ähnlich. Richie prägte dann den Begriff des „Tourenroadsters“.
Mit diesen Sandgebilden erregten sie dann erneut Aufsehen in ihrer Umgebung. So mancher Badegast blieb stehen und sah ihnen eine Weile zu und es wurde oft fotografiert. In die Zeitung schafften sie es aber mit dieser Aktion nicht wieder.
Als die Autos fertig waren, schrieben sie noch mit gesammelten Muscheln Startnummern darauf und bewunderten ihre Werke stolz. Dann bestiegen sie nacheinander vorsichtig die Wagen und spielten wie kleine Kinder Autorennen. Tom gab mit einem Handtuch als Flagge den Starter. Trotz ihres Alters hatten sie dabei einen Heidenspaß. Später verließen sie dann ihre Kunstbauten, um sich im Meer den Sand von den Körpern zu spülen, der sich überall, sprichwörtlich in jeder Ritze, festgesetzt hatte. Sie schwammen und tauchten und kühlten sich ebenfalls gründlich ab, denn ihre Körper waren sehr aufgeheizt, weil sie sich doch die gesamte Bauzeit über in der prallen Sonne aufhielten. Das tat richtig gut.
Als sie nach annähernd einer Stunde wieder zurück an den Strand kamen, waren ihre drei Rennwagen längst zum Spielplatz für Kinder geworden. Die Eltern machten dabei wieder fleißig Bilder von ihren strahlenden Zöglingen in den Sandautos. Keiner der Erbauer regte sich darüber auf, zumal sie sehen konnten, wie vorsichtig jedes Kind im Umgang mit den Gebilden war, um es nicht zu zerstören.
Nur am nächsten Tag waren sie alle etwas enttäuscht, als sie morgens zum Strand an ihren gewohnten Platz kamen. Aus ihren schönen Rennwagen waren unförmige Sandhügel geworden, die in der Mitte ein Loch aufwiesen. Der Wind hatte sie über nacht nach seinen Vorstellungen umgestylt. Also begossen sie jedes Auto mit einem Glas Sangria, den sie mitgebracht hatten, und feierten Beerdigung.
An einem weiteren Tag in diesen drei Wochen wollten sie sich alle auch einmal vornehm geben. Sie machten sich mit dem Bus auf in die nächste Stadt in ein nobles Restaurant, um zu speisen wie die reichen Leute. Jeder von ihnen hatte eine gute Garnitur Kleider mit, die sie zu diesem Zweck anzogen. Infolgedessen fuhren sie auch mit dem Bus und nicht mit ihren Mühlen. So unterschieden sie sich rein äußerlich zuerst nicht in diesem ungewohnten Umfeld von den übrigen Gästen
Chris aus der Clique, dessen Vater in irgendeinem Unternehmen der Vorstand war, wollte ihnen zeigen, wie man sich in solchen Restaurants und in diesen Kreisen bewegt. Für Chris war das kein ungewohntes Terrain, so, wie für seine Freunde. Der kleine Schönheitsfehler dabei war nur, dass Chris sich schon morgens mit Rotwein die Zähne putzte. Bis zum Mittag war er dann an diesem Tag schon ziemlich betrunken, weil er auch nach dem Zähneputzen nicht die Finger vom Wein lassen konnte. Chris benahm sich zwar, wie es sich gehörte, torkelte nur etwas und redete gelegentlich dummes Zeug. Keiner wusste, was ihn an diesem Tag geritten hatte, dass er so dem Alkohol zusprach. Das war normalerweise gar nicht seine Art.
So gingen sie also, Chris in die Mitte nehmend, in das Lokal und baten um einen Tisch für 15 Personen. Einen solchen gab es natürlich nicht und die Kellner stellten auch keine Tische zusammen, um eine solche Tafel zu bilden. Also wurden sie auf vier beieinander stehende Tische verteilt.
Chris sagte noch zu ihnen, bevor sie sich aufteilten: „Ihr müsst Hummer bestelle, des macht ma so, wenn ma Geld hot!“
Diesen Tipp beherzigte aber keiner von ihnen. Sie bestellten sich lieber alle etwas Handfestes. Dabei wurde so manch einer belehrt, dass es auch keine Pommes Frites gab. Diejenigen, die diese zu bestellen versuchten, schwenkten aber schnell auf Bratkartoffeln um. Nur Chris blieb seiner Meinung treu und orderte für sich einen Hummer. „Schön durch“, fügte er seiner Bestellung noch hinzu. „Ihr fallt uff!“, rief er gedämpft mit alkoholischem Unterton von Tisch zu Tisch.
Richie saß am selben Tisch wie Chris und lachte sich fast tot über dessen alkoholverseuchten Versuch, vornehm zu sein.
Dann wurden die Speisen serviert. Es sah alles sehr appetitlich aus und sie begannen gemeinsam, ihr Essen einzunehmen. Doch als es mehrfach in Richies Nähe verdächtig krachte, musste er von seinem Teller hochsehen und fiel dabei fast vor Lachen vom Stuhl. Das Bild spottete jeder Beschreibung. Auch die übrigen Mitglieder der Clique wurden aufmerksam und versuchten, genau wie Richie, ihr Lachen zu unterdrücken. Jeder, in dessen Blickfeld Chris war, kämpfte gegen einen Lachanfall, um die anderen Gäste nicht zu stören und um nicht aufzufallen. Sie konnten alle fast selbst nichts mehr essen, weil sie ständig Chris beobachteten. In seinem alkoholverwirrten Kopf verwechselte der wohl die Gourmet-grundlagen völlig. Chris focht mit seinem Hummer einen schweren Kampf aus, den er aber langsam Stück für Stück gewann. Zuerst schälte er das zarte Fleisch des Tieres aus dem Panzer und legte es in die silberne Schale, die er für die Überreste beigestellt bekam. Dann brach er die großen Scheren ab und legte diese ebenfalls dazu. Nun begann Chris tatsächlich, den Hummer von den Armen her aufzuessen. Es krachte bei jedem Bissen furchtbar und selbst das Kauen war als Knirschen deutlich zu hören. Chris hatte einige Mühe, die man ihm auch deutlich ansah, aber er schaffte es bis zum Ende. Von dem Hummer blieben einzig der Kopf und die Scheren sowie das zarte Fleisch übrig.
Als der Kellner zum Abräumen erschien und sich ebenfalls das Lachen schwer verkneifen musste, sah er aus, als lächele er Chris freundlich an. Er sprach sehr gut deutsch und fragte höflich: „Hat es geschmeckt, der Herr?“
Chris tupfte sich weltmännisch wie ein Kenner die Lippen an der Serviette ab, wobei unzählige Krümel des Panzers um den Mund kleben blieben, und antwortete laut: „Hervorragend! Ein dickes Lob an die Küche!“
So verbrachten Richie und seine Freunde insgesamt drei unwahrscheinlich tolle und unvergessliche Wochen in Spanien. Jeder von ihnen erinnerte sich lange und gerne an diese Zeit. Es wurde an keinem Tag langweilig und es gab ständig etwas zu lachen. Keiner wollte die Zeit missen, denn sie hatten unglaublich viel Lustiges erlebt.
Als der Urlaub zu Ende ging, beschlossen sie deswegen auch einstimmig, noch zu bleiben, was selbstverständlich nur ein Wunsch und nicht umsetzbar war. Sie musste ja wieder zurück in ihr eigentliches Leben.
Einen bleibenden Eindruck hatte bei ihnen auch der Stierkampf hinterlassen, den sie besuchten. Ob solche Spektakel in der heutigen Zeit noch sinnvoll sind, ist für Richie ein anderes Thema. Beeindruckend war es auf alle Fälle anzusehen, wie der Torero gegen den Stier antrat.
Oft stellte sich einer der Gruppe in Anlehnung an das Gesehene unverhofft in Positur, stampfte mit einem Fuß auf und mimte so den Matador. Dazu hielt er andeutungsweise die Arme seitwärts, als ob er das berühmte rote Tuch hielt, und rief: „Torro!“ Daraufhin fand sich immer ein anderer, der den Stier spielte und gebückt auf den Matador zustürmte. Wenn er ihn dann hauteng passierte, grölten alle übrigen der Gruppe laut: „Olé!“ Das gerne auch mitten auf der Straße. Ihren Namen „Verrückte Gruppe“ hatten sie schließlich nicht unbegründet verliehen bekommen. Dieses Spiel trieben sie sogar auf den Feuerstühlen während der Fahrten, besonders oft auf der Heimreise von Spanien. Am Anfang der Strecke gab es keine 50 Kilometer, in denen sie diese Show nicht abzogen. Einer der Vorausfahrenden hob den Arm seitlich heraus und war der Matador. Daraufhin beugte einer der hinten Fahrenden seinen Oberkörper noch weiter vor als normal, schaltete einen Gang herunter, um voll beschleunigen zu können, um dann als Stier den Matador zu passieren.
Richie brachte es dabei mehrmals zur Bestleistung, weil er es schaffte, derart zu beschleunigen, dass er mit einem Wheely, also nur auf dem Hinterrad, seinen Spurt auf das imaginäre Tuch startete. Nur das Olé-Rufen der Clique entfiel natürlich, wegen der Helme.