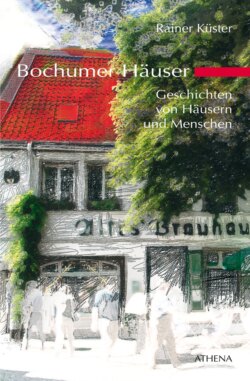Читать книгу Bochumer Häuser - Rainer Küster - Страница 6
Rundgang mit Heinrich Kämpchen
ОглавлениеMax Geißlers »Führer durch die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts« widmet sich zeitgenössischen Erzeugnissen der schönen Literatur, lehnt es aber ausdrücklich ab, sich mit dem »zersetzenden Geist verweichlichten Artistentums und der Dekadenz« zu befassen. Das Werk ist im Jahre 1913 erschienen, also ein Jahr nach dem Tode Heinrich Kämpchens. Seine strengen Maßstäbe hinderten den Autor des Buches nicht, dem Bochumer Dichter eine knappe Seite zu widmen. Das war zu jener Zeit eher die Ausnahme, denn in den großen Werken zur deutschen Literaturgeschichte war Kämpchens Name nicht verzeichnet; daran hat sich bis heute wenig geändert.
Wer aber bei Google den Namen Heinrich Kämpchen eingibt, der wird auch fündig und erhält zunächst einmal den Hinweis auf 702 Suchergebnisse im Internet, von denen allerdings nur etwa 240 Treffer angeboten werden. Man erfährt dort, dass es nicht nur im Süden Bochums, sondern auch in anderen Städten des Ruhrreviers, nämlich in Bottrop, Essen, Hattingen und Herne, Heinrich-Kämpchen-Straßen gibt. Dass in Bochum eine Hauptschule den Namen Heinrich Kämpchens trägt. Wer will, kann bei e-Bay eine CD mit Liedern aus der Feder des Bergmanns Heinrich Kämpchen erwerben. Hier und da werden Bändchen mit seinen Gedichten angeboten; es sind auch ein paar Werke über ihn geschrieben worden. Einige seiner Gedichte sind sogar irgendwo auf einer Internetseite abgedruckt, Verehrer haben dafür gesorgt. Und last, not least widmet die Stadt Bochum dem Arbeiterdichter auf ihrer Homepage einige Zeilen, zu finden unter der Rubrik »Bochumer Persönlichkeiten«.
Wer war nun Heinrich Kämpchen, von dem man auf der städtischen Homepage lesen kann, dass er sich als Sozialdemokrat und Gewerkschafter im Kampf der Bergleute engagiert habe?
Geboren wurde er am 23. Mai 1847, allerdings nicht in Bochum, sondern in Altendorf an der Ruhr. Er besuchte die Dorfschule in Höntrop; nach der Entlassung aus der Schule nahm er nicht sofort die Arbeit im Bergbau auf, sondern wurde auf Wunsch seines Vaters noch zwei Jahre lang von einem Privatlehrer in Wattenscheid in den Elementarfächern unterrichtet. Als Sechzehnjähriger begann Heinrich Kämpchen dann mit der Arbeit unter Tage auf der Dahlhauser Zeche Hasenwinkel, also auf einer der ältesten Zechen im Ruhrgebiet.
Zu dieser Zeit vollzog sich mit dem Abteufen des Schachtes Julius Philipp (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Zeche in Wiemelhausen) im Grubenfeld Hasenwinkel der Übergang vom Stollenbergbau zum Tiefbau. Es war die Zeit stürmischer technischer Entwicklungen. Die Bevölkerungszahlen der Städte und Gemeinden im Kohlengräberland stiegen rapide an. Im ökonomischen Bereich gab der Staat mehr und mehr die Kontrolle über den Bergbau auf. Damit erlosch auch seine Fürsorgepflicht, was zur Folge hatte, dass auf traditionelle Privilegien verzichtet werden musste und schließlich aus dem Bergmann der Bergarbeiter wurde. Privates Kapital floss ein, Aktiengesellschaften wurden gegründet. Die privaten Unternehmer schufen neue Arbeitsordnungen, sie reduzierten die Löhne bei verlängerten Schichtzeiten. Die Folge war, dass die Zahl der Unfälle unter Tage sprunghaft anstieg.
Lohneinbußen, erheblich längere Schichtzeiten und das berüchtigte Wagen-Nullen – ungenügend beladene Förderwagen wurden nicht angerechnet – waren einige der Gründe, warum es schließlich zum Arbeitskampf kam. Auch Heinrich Kämpchen lehnte sich mit seinen Kameraden auf gegen das Leid der Bergleute, gegen die »Bergmannsnot«, wie es in seinen Gedichten heißt. Er wurde Sprecher und Vertrauensmann seiner Arbeitsbrüder im großen Bergarbeiterstreik des Jahres 1889, der mit spontanen Arbeitsniederlegungen – ein Streikrecht gab es nicht – in Bochum begonnen hatte. Es folgten Streiks in Essen und Gelsenkirchen, und auf dem Höhepunkt der Streikbewegung befanden sich an der Ruhr etwa 90.000 Bergleute (von 105.000) im Ausstand.
In seinem Kämpchen-Buch »Aus der Tiefe« erzählt Wilhelm Helf, wie es damals im Dahlhauser Bergbau zuging:
»Die Belegschaft der Zeche Hasenwinkel hatte sich versammelt, um zur Streiklage Stellung zu nehmen. Ein Bergmann eröffnete die Versammlung mit den Worten: ›Kameraden, wir müssen treu und fest zusammenhalten!‹ Danach wandte er sich zu dem Dichter und sagte: ›Heinrich, nu kür du!‹«
Am Ende siegten die Unternehmer. Die Streikführer wurden ausgesperrt. Heinrich Kämpchen wurde als Hetzer und Aufwiegler gemaßregelt, verlor seine Arbeit und wurde später zum Berginvaliden. Nach dem Arbeitskampf im Jahre 1889 hat er nicht mehr unter Tage gearbeitet. Das Anfahrverbot traf ihn, dessen Vater Bergmann und Obersteiger gewesen war, besonders hart. Bis zu seinem Tode musste er sich mit einer kargen Knappschaftsrente und den Honoraren für seine Texte über Wasser halten. Sein persönliches Schicksal scheint er in dem Gedicht »Bergmannslos« verarbeitet zu haben. Dort heißt es in den Strophen 5 und 6:
Er hat zu viel im Engen
Gekrümmt sich und gebückt,
Bis ihm von allem Kriechen
Der ganze Leib zerdrückt.
Mit sechzehn Jahren stieg er
Als Knappe in den Schacht,
Nun, nach kaum zwanzig Jahren,
Steigt er zur Grabesnacht.
Im Jahre 1890 tauchte Kämpchens Name an erster Stelle in der polizeilichen Überwachungsliste des Amtes Linden-Dahlhausen, der so genannten schwarzen Liste, auf, da er im Verdacht stand, »der socialdemokratischen Partei anzugehören«. Er wurde dann später Delegierter für den Kongress der Bergarbeiter und Mitglied im Kontrollausschuss der Bergarbeitergewerkschaft, die 1889 gegründet worden war. Im Jahre 1962, dem fünfzigsten Todesjahr Heinrich Kämpchens, bezeichnete ihn die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie als »einen der Pioniere der Arbeiterbewegung«.
Aber Kämpchens Biographie hatte viele Facetten. Er schrieb in seiner freien Zeit Lieder und Gedichte, viele, in denen er die Ausbeutung und Verelendung der Bergarbeiter anklagte, aber auch eine ganze Reihe, in denen er die Liebe zu seiner Heimat, zu seinem Westfalenland verewigte. Dass sich Heimatliebe und soziales Engagement nicht zu widersprechen brauchen, zeigt Kämpchens »Westfalenlied«, dessen dritte und vierte Strophe ich hier zitiere:
Mein Heimatland, du bist mir teuer,
wie hätte sonst ich Sohnesrecht –
doch hass ich auch wie Blut und Feuer
den Zwingherrn und den feigen Knecht.
Und ob auch deine Schlösser ragen
in stolzer Pracht zum Himmelsblau –
das Volk muß doch die Lasten tragen,
das arme Volk, von jedem Bau.
Schön bist du, Land der roten Erde,
im Morgenglanz, im Abendlicht –
nur auch ein Land der Freiheit werde,
dies will und fordert mein Gedicht.
Daß deine Söhne nicht mehr länger
verkümmern noch bei kargem Sold –
o schafft es mit, ihr freien Sänger,
die ihr nicht singt um Gunst und Gold.
Die Gedichte erschienen meistens in der »Deutschen Berg- und Hüttenarbeiterzeitung«. Drei Gedichtsammlungen gibt es, die vom Autor selbst zusammengestellt und in der Zeit von 1898 bis 1909 publiziert wurden. Sie heißen »Aus Schacht und Hütte«, »Neue Lieder« und »Was die Ruhr mir sang«. Im Vorwort zur ersten Sammlung hat Kämpchen sein bescheidenes literarisches Selbstverständnis formuliert:
»Wenn ich mit einer Gedichtsammlung an die Öffentlichkeit trete, so geschieht dies vornehmlich auf Wunsch und Wollen meiner Freunde und Kameraden aus dem Bergmannsstande. Einen literarischen Wert beanspruchen diese Gedichte nicht; es sind eben schlichte Arbeiterlieder und wollen auch nur als solche gelten.«
Gelebt hat Heinrich Kämpchen viele Jahre in Linden, unweit der Grenze nach Dahlhausen. Dort steht bis auf den heutigen Tag an der Dr.-C.-Otto-Straße – damals hieß sie noch Bahnhofstraße – das Haus mit der Nummer 46, in dem Kämpchen dreißig Jahre lang als »Kostgänger« bei der Familie Küper gewohnt hat und wo er schließlich am 6. März 1912 gestorben ist.
Das Haus mit dem Erker, der zwei Stockwerke erfasst, steht direkt an der Straße, ein Gartenzaun begrenzt es zur Nachbarschaft. Der schmuckvolle Eingang liegt an der Seite, vielleicht stammen die schönen Stuck-Verzierungen noch aus der Zeit, als Kämpchen die Dachstube bewohnte. Eine Gedenktafel, die an den »Bergarbeiter, Streikführer und Dichter« erinnert, wurde erst vor wenigen Jahren angebracht. Sie ist von der Straße aus nicht besonders gut zu erkennen, eigentlich nur von jemandem wahrzunehmen, der schon weiß, was er sucht. Die Gedenktafel enthält eins der wenigen Porträts, das Kämpchen als jungen Mann zeigt – hier ist er 33 Jahre alt. Auf der Tafel sind seine wichtigsten Lebensdaten verzeichnet, und ein kleines Stück Kämpchen-Literatur ist dort auch abgedruckt. Dabei handelt es sich um die beiden ersten sowie die vorletzte Strophe eines Gedichts, das in der Originalfassung aus elf Strophen besteht:
Heimat
So liegst du wieder ausgespannt
vor meinen Blicken, lachend Land,
mit deinen Tälern, deinen Höh’n
mit Berg und Burgen wunderschön.
Wie oft schon hast du mich entzückt,
du Land, mit jedem Reiz geschmückt,
wenn ich die Augen schweifen ließ
auf dich, mein Heimatparadies.
Und schafft das Leben Müh und Qual,
du bist doch schön, mein Heimattal!
Du hast gelabt mich und erquickt,
wenn Schwermut mir das Herz bedrückt.
Liest man in Kämpchens Sammlung »Neue Lieder« auch noch die auf der Lindener Gedenktafel nicht abgedruckten Strophen, so erkennt man unschwer, dass dieses Gedicht der unmittelbaren Umgebung des Dichters, nämlich der »silberhellen« und »blanken« Ruhr und ihrem Tal gewidmet ist. Wenn er in die Dachstube des Hauses Küper stieg, musste sich Heinrich Kämpchen wahrscheinlich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um einen Blick auf die Ruhr zu werfen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er sie damals sehen konnte.
Im Jahre 1984 erschien im Oberhausener Asso Verlag ein Buch mit einer Sammlung von Kämpchens Gedichten, das von Walter Köpping eingeleitet und von den vier Herausgebern gewissenhaft kommentiert worden ist. Es trägt den Titel »Seid einig, seid einig – dann sind wir auch frei«; das ist ein an Schillers »Wilhelm Tell« erinnerndes Zitat aus Kämpchens bekanntem Lied »Glück auf!«, dem Internationalen Knappenlied, wie es in allen Publikationen genannt wird. In diesem Buch ist ein Interview aus dem Jahre 1979 abgedruckt, in dem Hedwig Spiekermann, die Tochter der Familie Küper, bei der Kämpchen als »Kostgänger« gelebt hatte, im Alter von 89 Jahren ihre Erinnerungen an den Dichter geschildert hat:
»Als H. K. gemaßregelt wurde, das war nach dem Streik – er war vielleicht 42 Jahre alt –, bekam er keine Arbeit mehr auf der Zeche. Er hat sich kümmerlich durchgeschlagen. Er hat, wenn Kirmes war, ein kleines Tischchen von uns mitgenommen und Zigarren verkauft, weil er ja kein Geld mehr kriegte. Die Kollegen kannten ihn, und er hat viel verkauft. Zum Glück war meine Mutter gut, und an Essen und Trinken hat es ihm nicht gemangelt; er hat sehr billig bei uns gewohnt. Er selbst war sehr genügsam. Er bekam dann auch nicht viel Invalidengeld, früher gab es ja nicht so viel Rente. Unterstützung von seinem Bruder hätte er nicht angenommen.
Später ging es dann besser, da er Einnahmen durch seine Gedichte hatte. Er hat dann Gedichte gemacht, die er nach Bochum zur ›Bergarbeiterzeitung‹ brachte. Er sagte dann zu mir: ›Halt mir die Daumen, dass mein Gedicht in Bochum angenommen wird.‹ Das war nicht sicher, aber meistens hat es geklappt. Dann bekam er Geld für das Gedicht. H. K. hatte ein gutes Verhältnis zur »Bergarbeiterzeitung«. Es kam auch vor, dass er etwas an den Gedichten ändern sollte. Das hat er dann getan – er war nicht ärgerlich darüber.
Die Gedichte schrieb er meistens abends, wenn er im Bett lag, oder morgens ganz früh. Sie fielen ihm dann am besten ein. – Für manche Gedichte hat er auch länger gebraucht. Er kritzelte sie auf ein Papier, mit einem ganz kleinen Bleistift. Wenn ich ihm dann einen größeren geben wollte, hat er das immer abgelehnt. Morgens hat er das Gedicht dann ins Reine geschrieben und sofort nach Bochum gebracht. Er ging meistens einen Weg zu Fuß – und der Weg war sehr weit –, die Straßenbahn war zu teuer.«
In dem eingangs erwähnten Literaturführer von Max Geißler wird ein Besucher des Hauses Küper in Linden zitiert, der die Wohn- und Arbeitsverhältnisse Heinrich Kämpchens einfühlsam beschreibt:
»Anspruchslos wie der mit den Nöten des Lebens vertraute Dichter selbst ist auch die Ausstattung seines Heims, in dem er lesend, träumend und Verse schreibend seine stillen Tage in genügsamer Beschaulichkeit verbringt. An den Wänden ein paar abgeblasste Bilder und ein Vogelbauer, auf den schmalen Fenstersimsen in roten Tontöpfen einige Blumen – das ist neben dem Notwendigen der einzige Luxus; aber Kämpchen müsste kein Dichtersmann und Fabulierer sein, wenn er in diesem Poetenwinkel sich nicht wohlfühlen sollte.«
In ihrem Interview beschreibt Hedwig Spiekermann Kämpchen als gerecht und ehrlich. Schöne, ruhige Musik habe er geliebt, keine Tanz- oder Marschmusik. Autos seien ihm verhasst gewesen, denn die Abgase waren ihm nicht geheuer. Körperlich habe er immer zart, etwas kränklich gewirkt, »nicht bettlägerig, aber schwach«. Auf dem bekannten Bild aus dem Jahre 1909 wirke er kräftiger, als er war; es mache der große Bart, »dass er nicht so schmächtig aussah«. Meistens hatte er einen grünen Anzug an, schlicht und einfach. Auf der Straße trug er einen Lodenmantel.
Einer von denen, die immer wieder nachdrücklich an Heinrich Kämpchen erinnern und auch manchmal dessen Wege gehen, ist Hans Drescher, pensionierter Konrektor an der Hauptschule. Er hat mich eingeladen, ihn auf seinem Rundgang zu begleiten. Wir beginnen – wo denn sonst? – auf der Heinrich-Kämpchen-Straße. Herr Drescher lebt selbst in dieser Straße, im Haus Nr. 32. Dort ist er Nachbar von Hugo Ernst Käufer, einem heutigen Bochumer Dichter, von dem ich denke, dass er sich mit Heinrich Kämpchen gut verstanden hätte; beide geradlinig und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ausgestattet, das hätte sie verbunden; beide haben es in ihrer literarischen Arbeit nicht nötig gehabt, Herkunft und Heimat zu verleugnen. Seinen Kollegen Kämpchen hat Hugo Ernst Käufer in dem kleinen Text »Kortum & Kämpchen« so beschrieben: »Ein Prolet, für den das Wort Waffe war, der für die Hoffnung auf bessere Zeiten stritt, in denen der Mensch nicht mehr des Menschen Wolf ist.«
Der Rundgang mit Herrn Drescher, dessen beide Großväter auch Bergleute waren, führt die Heinrich-Kämpchen-Straße hinab, bis sie in die Keilstraße mündet. Weiter unten, am Schulzentrum Südwest, sind wir schon in Dahlhausen, dort passieren wir die Theodor-Körner-Schule und landen vor der Heinrich-Kämpchen-Schule, der Hauptschule im Zentrum. Sie ist im Neubau untergebracht; das scheint auch weiterhin so zu bleiben, obwohl in den Zeitungen immer wieder von Umzugsplänen die Rede ist. Es klingelt zur großen Pause. Der Namensgeber der Anstalt wäre sicherlich überrascht, wenn er die bunte Mischung sehen könnte, die da aus den Eingangstoren strömt, auch die Vielfalt der Sprachen hätte ihn verwundert.
Unser Weg führt uns die Dr.-C.-Otto-Straße hinauf, wo wir wenige Meter vor der Linkskurve am Haus Nr. 46 verharren, noch einmal die Tafel studieren, die dem Gedächtnis des Dichters gewidmet ist. Wir überqueren die Straße, folgen dem Kesterkamp, dann über die Hattinger Straße hinweg, vorbei am Tusculum des Dr. Krüger. Herr Drescher erzählt mir, dass er sich schon in seiner Arbeit zum Staatsexamen mit Kämpchen beschäftigt hat. Während seiner Zeit als Volks- und Hauptschullehrer hat er immer wieder den Schülern Texte des Bochumer Dichters nahe gebracht.
Wir stehen auf dem katholischen Friedhof der Pfarrgemeinde Liebfrauen in Linden. Auf dem Feld A liegt das Reihengrab von Heinrich Kämpchen. Die Pfarrgemeinde hat dafür gesorgt, dass der Bereich um Kämpchens Grab nicht wieder belegt wurde. Man hat die Grabstätte zum Ehrengrab erhoben, so dass der Erhalt für immer gesichert ist. Auf der schwarzen Granitsäule, einer Stiftung von Freunden und Mitstreitern des Arbeiterdichters, steht das kleine von ihm selbst verfasste Gedicht:
Blickt hin zur Gruft, die ihr vorüber geht!
Ein Sohn des Volkes schläft hier, ein Poet.
Für Recht und Freiheit hat sein Herz geglüht.
Er war ein Kämpfer und sein Schwert das Lied.
Drei Jahre vor seinem Tod hat Kämpchen das Gedicht geschrieben und der damals noch ganz jungen Hedwig Küper, der späteren Hedwig Spiekermann, vorgelesen. Als sie anfing zu weinen, hat er nur gesagt: »Ach, davon sterb ich doch nicht.« Auch die bronzene Gedenkplatte der IG Bergbau und Energie, welche die Grabstätte schmückt, trägt ein Kämpchen-Gedicht. Es spricht von der Toleranz des Autors und zugleich von seiner Menschlichkeit:
Nur Toren und Verräter
Sie teilen uns geschwind
In Christen und Nichtchristen
Wo wir doch Brüder sind.
Die letzte Station unseres Rundgangs ist die Liebfrauenkirche in Linden. War Heinrich Kämpchen ein religiöser Mensch? Ja, das war er wohl, sagt Herr Drescher:
»Kämpchen war Mitglied der Pfarrgemeinde, die 1858 zur selbständigen ›Katholischen Liebfrauengemeinde Linden-Dahlhausen‹ erhoben worden war. In ihr lebte eine große Anzahl von Bergleuten, die nach ihrer Tradition eine starke religiöse Bindung aufwiesen.«
Als Mitglied der Pfarrgemeinde wird Kämpchen mehrfach erwähnt. In einer Niederschrift des Kirchenvorstands aus dem Jahre 1902 findet sich der Hinweis, dass Kämpchens sozialkritische Gedichte und seine Haltung in den Bergarbeiteraufständen ihm in der Pfarrgemeinde Anerkennung und Wertschätzung einbrachten. Aber die Gemeinde hat ihm auch einiges zurückgegeben. In den Protokollen des Kirchenvorstands aus den Jahren 1907 bis 1910 ist jeweils vermerkt, dass Heinrich Kämpchen die Kirchensteuer erlassen wurde. »Der Beschluss«, sagt Hans Drescher, »kündet von der Not des gemaßregelten Arbeiterführers. Ebenso wird aber die soziale Haltung der Kirchengemeinde offenkundig.«
Auf dem Heimweg komme ich noch einmal am Schulzentrum Südwest vorbei. Was könnte man heutigen Schülern, und nicht nur denen, deren Schule nach Heinrich Kämpchen benannt wurde, über den Arbeiterdichter erzählen? Was könnte man ihnen mit auf den Weg geben? Vielleicht, dass es richtig ist, sich für die gerechte Sache einzusetzen, auch wenn man Gefahr läuft, nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Vielleicht, dass es Menschen gibt, deren Glaube und deren Solidarität nur Kehrseiten derselben Medaille sind. Und vielleicht auch, dass der Umgang mit Literatur oder besser noch das eigene Schreiben vieles wettmachen kann, was das Leben an Enttäuschungen bereithält.
(2005)