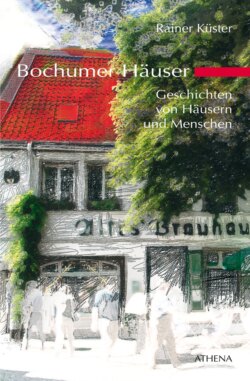Читать книгу Bochumer Häuser - Rainer Küster - Страница 7
Fremd zieh ich wieder aus
ОглавлениеIm Jahre 1876 entstand vor den Toren Bochums, auf der Vöde, der großen Gemeindewiese im Nordosten der Stadt, ein schöner Park, der später noch mehrfach erweitert werden sollte. Nur wenige Jahre zuvor hatte der Kuhhirte und Tagelöhner Kortebusch, der als Fritz Kortebusch in die Annalen eingegangen ist, aber in Wirklichkeit Heinrich hieß, hier zum letzten Mal das Rindvieh der Bochumer Bürger von der Weide nach Hause getrieben. In dieser Phase einer gewissen pastoralen Vakanz ergriffen die Mitglieder des Magistrats die Initiative und sorgten dafür, dass die Weide, deren ländlich-bäuerliches Gepräge nicht von allen Bochumern geschätzt wurde, als sichtbares Zeichen von Fortschritt und Urbanität in einen öffentlichen Park umgewandelt wurde.
Im ältesten Teil des Parks soll einmal eine Büste des Kaisers, nämlich Wilhelms des Ersten, gestanden haben; die Büste war, so heißt es, dem Andenken an die Goldene Hochzeit des Kaiserpaares im Jahre 1879 gewidmet. Kurze Zeit vorher war auch die erste Ausgabe des Parkrestaurants, damals noch ein schlichter Fachwerkbau mit einer großen, nach Südwest angrenzenden Terrasse, eingeweiht worden. In den folgenden Jahren veranstaltete der Parkhauspächter am 22. März, also zu Kaisers Geburtstag, immer ein Festessen. Eine Straße, die in unmittelbarer Nähe des Parks angelegt und seit 1890 im deutschen Renaissance-Stil bebaut wurde, trug politisch korrekt den Namen Kaiserring. Eingebettet in die nördlichen und südlichen Arme des Kaiserrings lag die Parkstraße.
Seit 1976 heißt nun das Ensemble von ehemaligem Kaiserring und Parkstraße »Am Alten Stadtpark« und sieht auf dem Stadtplan so aus wie ein seitenverkehrtes großes E, denn der gesamte Komplex ist drei- oder, wenn man so will, viergeteilt. Heute gibt es ganz in der Nähe dieser Straße wieder ein Denkmal, wenngleich ein bescheidenes. Es würdigt Josef Hermann Dufhues, den Bochumer Rechtsanwalt und Notar, der nach dem Kriege als bedeutender Landespolitiker so viel für unsere Stadt getan hat.
Wer sich dem Bochumer Stadtpark von der Bergstraße aus nähert und den Anstieg über den mittleren Zugang der Straße »Am Alten Stadtpark« wählt, nimmt auf der linken Seite ein üppiges Doppelhaus wahr, das allerdings einen merkwürdig asymmetrischen Eindruck macht. Die beiden Gebäudehälften, die sich nicht miteinander zu vertragen scheinen, weisen die Hausnummern 39 und 41 auf. Die linke Seite wirkt deutlich älter als die rechte; mit ihren Altanen, Erkern, Haupt- und Nebengiebeln, den verschiedenen neogotischen und antikisierenden Schmuckformen vermittelt sie noch etwas vom großbürgerlichen Glanz der Gründerzeit. Die rechte Seite ist dagegen eher schlicht und zweckmäßig gehalten; es ist der Stil der fünfziger Jahre, der hier in demonstrativer Bescheidenheit zu Tage tritt.
Der eigentliche Grund aber, warum das Doppelhaus so asymmetrisch aussieht, ist wohl ein anderer. Während in der linken Hälfte, unterhalb des ausgebauten Dachgeschosses, nur zwei Etagen eingerichtet sind, gibt es im selben Bereich auf der rechten Seite drei. Links wirkt das Gebäude großzügig, geradezu herrschaftlich, rechts scheint mit Wohnraum gegeizt worden zu sein. Wenn man das Haus länger von seiner Frontseite her betrachtet, kann einem schwindelig werden. Keine Bochumer Behörde hat diese bauliche Schlagseite verhindert.
Aber so ist es natürlich nicht immer gewesen. Das prächtige Gebäude – übrigens das Hochzeitsgeschenk eines wohlhabenden Schwiegervaters – war einmal eine einzige Villa mit vierundzwanzig Räumen, links und rechts so einheitlich und schön, wie es die prominente Lage am Stadtpark erforderte. Eine Bombe, die während der schweren Luftangriffe gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die rechte Seite des Hauses erheblich zerstörte, hat die Zweiteilung verursacht. Nur wenige Jahre, bevor diese Bombe fiel, ereignete sich in der noch unversehrten Bochumer Villa, deren Adresse damals »Parkstraße 11« lautete, Folgendes:
Eine junge Frau von siebzehn Jahren, deren Familie in der Villa wohnte, hatte gerade mit ihrer Mutter das Haus betreten. Die Bochumer Straßen waren an diesem grauen, nasskalten und regenverhangenen Novemberabend des Jahres 1938 ziemlich leer gewesen – abgesehen von den Männern in den braunen Hemden, die in militärischen Formationen durch die Straßen marschierten. Eine merkwürdige Anspannung hatte in der Luft gelegen, die junge Frau hatte Angst gehabt.
Zu Hause machte sie sogleich das Radio an und hörte, dass vor zwei Tagen in Paris ein Mann jüdischer Herkunft den deutschen Botschafter erschossen hatte. Wie man das NS-Regime kannte, musste mit einem Vergeltungsakt gerechnet werden, wahrscheinlich hatten die Machthaber nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Kurz darauf rief eine Freundin an, die der jungen Frau berichtete: »Jetzt plündern sie die jüdischen Geschäfte.« Die Familie lief ans Fenster im Obergeschoss, von dem man damals noch über den Park hinweg freie Sicht auf die Stadt hatte. An vielen Stellen brannte es. Von draußen riefen ihnen Nachbarn zu, die Nazis hätten die Synagoge angesteckt.
Wenig später kam aus der Goethestraße auch die ältere Schwester mit ihrer Familie ins Haus an der Parkstraße. Sie alle hatten Angst um den Schwager, mussten befürchten, dass er verhaftet würde. Noch am Abend machten sich die junge Frau und ihre Schwester gemeinsam mit dem Schwager auf und schleusten ihn irgendwie zum Bahnhof, wo sie ihn zunächst einmal unter einer Bank im Wartesaal versteckten. Wie durch ein Wunder gelangten sie wieder heil nach Hause. Die Bäume im Park waren schon groß genug, um Schutz zu bieten. Als sie zu Hause ankamen, war es inzwischen 6 Uhr morgens.
Dann passierte es. Die Eingangstür der Villa wurde aufgebrochen. Die Bewohner hörten, dass Holz splitterte und Glas zerbrochen wurde. Etwa dreißig Männer, einige von ihnen trugen Reitstiefel, stürmten ins Haus. Sie waren mit Hämmern und Äxten bewaffnet. Einer konnte ein bisschen Klavier spielen. Er setzte sich sogleich an den Flügel, den die Mutter – eine ausgebildete Pianistin – so sehr liebte, und spielte das Horst-Wessel-Lied. Anschließend trampelten fünf andere mit ihren Stiefeln auf dem Resonanzboden des Flügels herum, bis er zerbrach. Die Horde zerschlug in ihrer Zerstörungswut alle Kunstschätze, die im Gebäude gesammelt und sorgfältig aufbewahrt worden waren. Auch drei oder vier Originale von Hans Thoma waren darunter gewesen, eines bedeutenden Schwarzwälder Malers, der bei den Nazis nicht unbedingt im Ruf eines »entarteten Künstlers« gestanden hatte. Nach zwei Stunden war der Spuk vorbei.
Auf den Bochumer Straßen aber war die Sache noch nicht beendet. Im Laufe des Vormittags wurden jüdische Männer, junge und ältere, die nicht mehr hatten fliehen können, von den Nazis zusammengetrieben und auf offenen Lastwagen abtransportiert. Die junge Frau aus der demolierten Villa am Stadtpark hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie, dass ein Jugendfreund mit vielen anderen auf der Pritsche eines Lastwagens stand. Die Verhafteten wurden von dem NS-Pöbel beschimpft, gedemütigt und mit Peitschen geschlagen. Als der Wagen anfuhr, blickte der Freund nach oben. Die junge Frau meinte, Tränen in seinen Augen zu sehen.
In Rosemarie, so hieß sie, starben an diesem Tage alle Heimatgefühle, die mit der Villa am Stadtpark verbunden gewesen waren. Obwohl sie so jung war, lag die Geborgenheit der Kindheit weit zurück. Sie wusste, dass sie in Bochum nicht würde bleiben können. Ihr Vater, Dr. Julius Marienthal, war – wie sein späterer Kollege Josef Hermann Dufhues – ein angesehener Rechtsanwalt und Notar gewesen. Als so genannter Altanwalt, Offizier und Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg war er mit seiner Familie bisher zumindest körperlich verschont geblieben. Beruflich sah die Situation schon erheblich schwieriger aus; im Jahre 1935 hatte er zugleich mit anderen jüdischen Rechtsanwälten sein Amt als Notar in Bochum verloren, und seit kurzem durfte er nur noch als jüdischer »Konsulent«, also als Rechtsbeistand für Juden tätig sein.
Die Mitglieder der Familie mussten ständig auf der Hut sein. Rosemarie hatte den Eltern schon früher Sorgen bereitet. Wegen einer unbedachten Äußerung war sie drei Jahre zuvor vom weiteren Besuch ihres Lyzeums, welches seit 1937 den Namen Schiller-Schule trug, ausgeschlossen worden. Jemand hatte sie wohl denunziert, vielleicht unfreiwillig. Drei Jahre lang hatte sie dann in der Schweiz eine von Nonnen geleitete Schule besucht, bis die Eltern ihren Internatsaufenthalt nicht mehr bezahlen konnten. Nur mit Mühe hatte sie – ziemlich genau eine Woche, bevor der NS-Pöbel in ihr Elternhaus eingedrungen war – wieder nach Deutschland einreisen können, denn in ihrem Ausweis war ein großes »J« eingestempelt, das sie als Jüdin und damit als unerwünscht kennzeichnen sollte. Auf der Heimreise hatte sie sich als Nonne verkleidet. Anfang November des Jahres 1938 war sie in ihr Elternhaus in Bochum zurückgekehrt.
Eine Woche später, also nach dem 9. November, der Pogromnacht, war der Familie Marienthal endgültig klar – es ging jetzt für die Tochter nur noch ums Überleben. Und rückblickend kann man erleichtert sagen: Irgendwie hat es am Ende geklappt, so lange es auch gedauert hat. Rosemarie Molser, so heißt sie heute, lebt vierundachtzigjährig in Rochester in den Vereinigten Staaten. Wie sie allerdings dort hingekommen ist, das ist noch einmal eine Geschichte für sich. Ganz genau kennt diese Geschichte Dr. Hubert Schneider, Historiker und Vorsitzender des wichtigen Bochumer Bürgervereins »Erinnern für die Zukunft«, der sich des Gedenkens an zerstörtes jüdisches Leben in unserer Stadt angenommen hat. Ich möchte mir die Geschichte der Rosemarie Molser von Herrn Schneider erzählen lassen.
Er empfängt mich an einem spätsommerlichen Oktobertag in seiner Querenburger Wohnung, reicht mir eine Tasse Kaffee und zeigt mir ein üppiges Konvolut. Es ist gewissermaßen die schriftliche Hinterlassenschaft der Familie Marienthal, die ihm Frau Molser bei einem Amerikabesuch zu treuen Händen übergeben hat. Ich darf hineinsehen und mich kundig machen über die atemberaubende Geschichte der jungen Frau, die in ihrem Bochumer Elternhaus nicht bleiben durfte und sich auf die Reise machte. Sie selbst hat ihre Odyssee später unter dem Titel »Escape to the Congo« in dem Band »Perilous Journeys« in englischer Sprache erzählt.
Einen Monat nach den Ereignissen des Reichspogroms, der berüchtigten Kristallnacht, von denen oben die Rede war, wurde Rosemarie zur Gestapo beordert, wo man ihr klarmachte, dass sie das Land innerhalb von sechs Wochen zu verlassen habe, weil sie aus der Schweiz illegal eingereist sei. Was war zu tun? Es gab Agenturen, die Hausmädchen nach England vermittelten. Aber Rosemarie war eine höhere Tochter, wie man damals sagte, und kein Hausmädchen.
Die Familie Marienthal wurde aktiv; sie fälschte für Rosemarie eine ganze Vita als Haushilfe zusammen. Die Papiere bekundeten, dass sie kochen, bügeln, putzen, Betten machen und Toiletten reinigen konnte – was auch immer gewünscht war. Fiktive Empfehlungsschreiben von irgendwelchen Hausfrauen wurden beigefügt. Mit diesen Papieren konnte sie sich bewerben. Die Wirkung blieb nicht aus, es gab tatsächlich ein Angebot aus England. Im Februar 1939 gelangte sie nach High Wycombe im schönen Buckinghamshire, nordwestlich von London. Aber die Hausfrau, für die sie dort tätig sein musste, war ein regelrechter Drachen, überhaupt nicht interessiert an dem jüdischen Schicksal des Mädchens. Sie fand denn auch schnell heraus, dass Rosemarie nichts von alledem konnte, was in ihren wunderbaren Papieren stand. Hinzu kam, dass sie an der Schule zwar die alten Sprachen und Französisch gelernt hatte, nicht aber Englisch. Ein schwieriger Anfang.
Der einzige Trost waren die vielen Briefe, die sie auch in England regelmäßig aus Afrika erreichten. Sie stammten von dem jüdischen Arzt Herbert Molser, der früher einmal in Deutschland Rosemaries Onkel behandelt hatte und mit dem sie seit ihrer Zeit im Schweizer Internat in Briefkontakt stand. Molser war zwölf Jahre älter als Rosemarie und praktizierte nun in Belgisch-Kongo, dem afrikanischen Land, das später, nach der Unabhängigkeit, Zaire hieß und sich heute Demokratische Republik Kongo nennt. Rosemarie hatte die Briefe, die Herbert aus seiner afrikanischen Einsamkeit schrieb, anfangs nicht so recht ernst genommen. Da war der große Altersunterschied, und auch die Eltern waren skeptisch gewesen. Aber allmählich fand sie doch Gefallen an der Korrespondenz.
In seinen Briefen versuchte Herbert ihr klarzumachen, dass es nach dem Einmarsch der Deutschen in der Tschechoslowakei und dem Anschluss Österreichs nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis Rosemarie auch in England nicht mehr sicher war. Sie solle nach Afrika kommen; dort würde ihr nichts passieren, und außerdem konnte sie ihm in seiner Praxis helfen.
Rosemarie hatte inzwischen in einer Art autodidaktischem Crashkurs Englisch gelernt. Ihre frisch erworbenen Sprachkenntnisse reichten immerhin aus für eine Anzeige in der »London Times«, in welcher sie sich als französisches Kindermädchen ausgab, das eine Stelle suchte. So kam sie zu einer netten, jungen Familie in Sussex, in der sie sich wohl fühlte und wo sie wie ein Mitglied der Familie behandelt wurde. Nur wenn der Herr des Hauses wieder mal zu viel Whisky getrunken hatte, stieg er ihr nach, und sie musste sich verstecken.
Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Bitten Herberts wurden immer dringlicher. Doch Rosemarie zögerte noch. Durfte sie nach Afrika emigrieren, während ihre Eltern und die jüngere Schwester unter schwierigsten Bedingungen noch in Bochum wohnten? Die ältere Schwester und ihr Mann hatten es zwar geschafft; sie lebten seit ein paar Monaten in New York. Aber die Eltern konnten kein Visum für die Vereinigten Staaten bekommen, und um nach England zu emigrieren, hätten sie mehr Geld gebraucht, als sie noch hatten. Es gab wohl mütterlicherseits ein paar englische Vettern, doch die waren desinteressiert und wollten nicht helfen, denn sie schämten sich ihrer deutschen Verwandtschaft. Was Rosemarie betraf, so hatte sie immer noch ihren deutschen Pass, das »J« kümmerte die Engländer wenig, denn sie wurde nun als »enemy alien«, als feindliche Ausländerin, angesehen.
Schließlich entschied sie sich doch für Afrika, ventilierte aber durchaus selbstbewusst, wie es nach ihrer Ankunft weitergehen könnte. Sie würde ohnehin nur dann in Afrika bleiben, wenn es ihr dort auch gut gefiel. Wenn nicht, blieb ihr immer noch die Möglichkeit, zur Schwester nach Amerika weiterzureisen. So etwa stellte sie sich die nähere Zukunft vor.
Die Flüge in den Kongo gingen ab Brüssel. Sie brauchte also ein Visum für Belgien, damals noch ein neutrales Land. Es begann ein Hindernislauf ohnegleichen. Die belgische Botschaft stellte sich stur, wollte keine jüdischen Flüchtlinge mehr im Lande haben. Rosemarie war hartnäckig und verbrachte zwei Tage auf den Stufen der Botschaft in London. Die genervten Belgier gaben ihr am Ende, was sie brauchte. Die Familie, bei der sie als Kindermädchen gearbeitet hatte, brachte sie an die Fähre in Dover. Es war ein Abschied für immer. Alle Mitglieder dieser englischen Familie kamen beim deutschen Blitzkrieg im Jahre 1940 um, ein Schicksal, das Rosemarie höchstwahrscheinlich mit ihnen geteilt hätte, wäre sie damals in England geblieben.
Die Überfahrt nach Antwerpen war gespenstisch, denn die Engländer hatten den Ärmelkanal vermint, um deutsche U-Boote zu treffen. Selbst der Kapitän kannte die Position der Minen nicht. Die Passagiere mussten sich an Deck aufhalten und ständig Schwimmwesten tragen. Die See war rau, und es blies ein kalter Wind. Aber alles ging gut. Zur Feier der glücklichen Ankunft in Antwerpen gab es Applaus, die Passagiere fielen sich in die Arme. Rosemarie wurde von einer Tante abgeholt, die sie dringend bat, sofort bei den Eltern anzurufen. Als sie ihnen am Telefon erzählte, was sie vorhatte, waren sie zunächst strikt gegen die Afrikareise und gaben schließlich nur zögernd ihren Segen.
Die nächsten Probleme gab es bei der belgischen Fluggesellschaft. Frankreich lag mit Deutschland im Krieg und erlaubte es deshalb deutschen Bürgern nicht, französisches Gebiet zu überfliegen. Obwohl Rosemarie dem französischen Konsulat glaubwürdig versichern konnte, dass sie weder Bomben noch eine Kamera mit sich trug, blieben die Franzosen hart. Sie könnte ja auch eine Spionin sein, sagten die französischen Beamten.
Immerhin gab es noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Seelinie nach Belgisch-Kongo. Aber als Rosemarie im Büro der zuständigen Gesellschaft eine Fahrkarte für das nächste Schiff kaufen wollte, lachten die sie aus. Ob sie – bitte sehr – nicht wüsste, dass in Europa ein Krieg ausgebrochen war. Das müsse ihr doch klar sein, dass da gar nichts zu machen sei. Alle Kabinen waren restlos ausgebucht, mindestens für das nächste halbe Jahr. Rosemarie brach zusammen, begann zu weinen, und alle Leute um sie herum wurden auf sie aufmerksam, einige bedauerten sie. Ein Mann, der unmittelbar hinter ihr stand, sprach sie an:
»Jetzt lass das mal sein, und hör mir zu!«
Er war ein junger katholischer Priester, der ruhig und verständnisvoll wirkte. Es wurde still in dem Büro.
»Mein Kind,«, sagte der Priester, »du hast das ganze Leben noch vor dir. Ich will zwar in den Kongo, wo ich meinen Dienst in der Gemeinde antreten möchte. Aber du musst dein Leben retten. Wenn mich die Deutschen schnappen, kann mir nicht viel passieren. Aber wenn sie dich schnappen, wird es ganz schlimm. Hier, nimm meine Fahrkarte nach Afrika. Ich habe einen Platz für das nächste Schiff gebucht. Gott sei mit dir!«
Bevor Rosemarie auch nur reagieren konnte, hatte er ihr schon sein Ticket in die Hand geschoben und war in der Menge verschwunden.
Am 25. September 1939 ging Rosemarie an Bord der Leopoldville. Das Ziel war die Westküste Afrikas. Sie teilte sich eine Kabine mit zwei jungen Frauen aus Belgien. Gemeinsam waren sie die einzigen weiblichen Wesen an Bord. Der Rest waren Männer, dreihundert an der Zahl, die alle irgendwo im Kongo arbeiteten. Es sei eine wunderbare Reise gewesen, sagt Rosemarie Molser, man tanzte und feierte und konnte für zwei entspannte Wochen das ganze Elend hinter sich lassen.
In Matadi ging sie von Bord und nahm den Zug nach Leopoldville, dem heutigen Kinshasa. Im Hotel fand sie einen Gruß von Herbert vor. Und doch, sie war jetzt wieder allein, und es wurde ihr erst richtig klar, auf was für ein Unternehmen sie sich eingelassen hatte. Am nächsten Tag ging’s weiter, mit dem Dampfer den River Congo flussaufwärts, ein bisschen wie in Joseph Conrads »Herz der Finsternis«. Das Ziel war Stanleyville, das heute Kisangani heißt, ein Ort mit bewegter Geschichte zwischen Kolonialzeit und Unabhängigkeit. In den 50er Jahren war die Stadt die Hochburg eines gewissen Patrice Lumumba, der dort später verhaftet wurde, bevor ihn seine Gegner ermordeten.
Noch einmal dauerte die Fahrt zwei Wochen, bis Herbert Molser die Adressatin seiner vielen Briefe endlich empfangen konnte. Als der Flussdampfer in Stanleyville anlegte, stand er schon am Kai und wollte Rosemarie mit einem Kuss begrüßen. Aber die war sich ihrer Sache noch längst nicht sicher und drehte vorsichtshalber den Kopf zur Seite. Mit den beiden fing es nicht gerade enthusiastisch an. In Herberts Auto, einem Cabrio der Marke Oldsmobile, wurden sie schon nach wenigen Minuten von einer Frau angehalten, die dem Doktor in französischer Sprache signalisierte, sie werde am Nachmittag in seine Praxis kommen, da ihr Kind krank war. Aber Herbert reagierte zurückhaltend.
»Das geht leider nicht«, sagte er zu der Frau.
»Warum nicht?«
»Ich werde heute heiraten!«
»Wie bitte?«, fragte Rosemarie, die ja Französisch konnte und alles verstanden hatte.
Herbert war verwundert: »Hast du denn meine Briefe nicht bekommen?«
»Welche Briefe?«
»Ich habe dir an alle Stationen des Flussdampfers Briefe geschrieben, in denen ich die Situation genau erklärt habe!«
»Man hat mir keine Briefe gegeben!«
Nun war es an Herbert, die Sache aufzuklären. Es gab inzwischen neue Vorschriften in der belgischen Kolonie. Ausländerinnen, die in den Kongo einreisten, hatten nachzuweisen, dass sie finanziell unabhängig waren, oder sie mussten einen Ansässigen heiraten, und zwar innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Ankunft. Nur wenn Herbert und Rosemarie sich trauen ließen, durfte sie bleiben. Da sie zu allem Überfluss an einem Freitag angekommen war, mussten sie bis um vier Uhr am Nachmittag geheiratet haben. Anschließend war das Standesamt bis zum Montag geschlossen. Das war zu spät, denn inzwischen würde man Rosemarie schon wieder zurückgeschickt haben, und zwar nach Deutschland.
Als sie ziemlich genervt in Herberts Haus ankamen, musste er noch einen Patienten aufsuchen. Rosemarie war für ein paar Augenblicke allein. Alles brach jetzt über ihr zusammen. Sie weinte bitterlich, weil man sie genötigt hatte, in eine Welt zu reisen, die ihr völlig fremd war, weil sie einen Mann heiraten sollte, den sie nur aus seinen Briefen kannte, und weil die Alternative im Grunde keine war.
Während der Trauungszeremonie musste Herbert sie anstoßen, damit sie überhaupt das »Oui« herausbrachte. Zu Hause machten sie hinterher eine Flasche Champagner auf. Aber schon zehn Minuten später zog sich Rosemarie in ihr Zimmer zurück, schloss sich ein und blieb dort mehrere Tage lang. Sie konnte nicht einmal ihre Eltern anrufen, da sie wusste, dass die ohnehin mit ihrem afrikanischen Abenteuer nicht einverstanden waren. Aber Herbert war sehr geduldig mit ihr und blieb es auch bis zu dem Tag, an dem in Stanleyville ein gewaltiges Gewitter niederging, ein Umstand, der Rosemarie in Angst und Schrecken versetzte. Herbert muss es damals irgendwie gelungen sein, sie zu trösten, und das war dann auch der eigentliche Anfang ihrer Ehe.
Das Klima in der neuen Heimat war feucht und heiß. Rosemarie verbrachte ganze Tage in der Badewanne, um sich abzukühlen, aber oft gab es gar kein Wasser. So richtig kochen konnte sie immer noch nicht, und wenn sie es versuchte, war die Hitze in der Küche unerträglich. Auch die politische Situation des Ehepaars Molser war schwierig, denn obwohl sie Juden waren, galten sie immer noch vor allem als Deutsche. Auch die Nachrichten, die Rosemarie von zu Hause erhielt, waren deprimierend. Zwei weitere jüdische Familien waren inzwischen in das Elternhaus in der Bochumer Parkstraße gezogen. Alle versuchten sie, noch irgendwie aus Deutschland rauszukommen, aber man konnte keine Visa erhalten.
Ganz schwierig wurde es für die Molsers, nachdem Deutschland am 10. Mai 1940 die Westoffensive begonnen hatte und deutsche Truppen in Holland und Belgien einmarschiert waren. Schon am nächsten Tag wurde Herbert verhaftet und eingesperrt. Dass sie Juden waren, zählte in Belgisch-Kongo nicht. Wie damals in England galten sie auch hier als Feinde, als »enemy aliens«.
Es folgte eine Zeit des Hungers für Rosemarie. Nach sechs schwierigen Wochen wäre es ihr fast gelungen, Herbert im Gefängnis zu besuchen, aber er war nicht mehr da. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Rosemarie ohnmächtig. Als sie erwachte, sagte man ihr, Herbert lebe jetzt in einem Lager für Kriegsgefangene und sie könne dort zu ihm ziehen. Wieder blieb ihr gar keine Wahl, denn sie hatte kein Geld und nichts mehr zu essen. Da sie keinen Koffer besaß, packte sie, was irgendwie von Wert war, in ein Bettlaken und zog in das Gefangenenlager.
Dort lebten die beiden in einer kleinen Hütte, deren Dach vergammelt war. Vom frühen Abend bis zum nächsten Morgen um acht wurden sie in der Hütte eingesperrt. Die Hitze war unerträglich. Sie hatten nur eine schmale Liege, so dass einer von ihnen immer auf dem Boden schlafen musste. Essen gab es nicht. Sie kochten sich eine schreckliche Suppe aus Blättern, Öl und irgendwelchen afrikanischen Wurzeln und ernährten sich wochenlang davon. Umgeben waren sie in dem Lager von anderen deutschen Gefangenen, die sie stets spüren ließen, dass sie Juden waren. Sie wurden tyrannisiert und lebten in ständiger Todesangst.
Nach dem Kriegseintritt Italiens wurde ein zweites Gefangenenlager eingerichtet, und man forderte Herbert auf, als medizinischer Aufseher für beide Lager tätig zu sein. Zwei Monate später erkrankte Rosemarie an Blinddarmentzündung. Der Chirurg, der sie operierte, war ein übler Metzger. Rosemarie infizierte sich infolge der Operation so massiv, dass sie später keine Kinder bekommen konnte. Zwei Monate blieb sie im Hospital, wo Herbert sie nicht einmal besuchen durfte. Als sie in das Lager zurückkehrte, wog sie nur noch 90 Pfund.
Eine Schwester vom Roten Kreuz sorgte dann dafür, dass die Molsers in den Süden des Kongo verlegt wurden, wo es nicht ganz so heiß war. Nach wochenlangen Strapazen landeten sie in Biano, einem kleinen Ort bei Elizabethville, dem heutigen Lubumbashi. Dort wohnten sie im selben Haus mit einem österreichisch-schweizerischen Paar, die schlimme Antisemiten waren. Sie beschimpften die Molsers und bestahlen sie. Eines Tages lotsten sie Rosemarie aus dem Haus und fütterten derweil ihre Hunde mit dem Essen der Molsers, das für eine ganze Woche reichen sollte. Ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz erlöste sie aus dieser unwillkommenen Hausgemeinschaft. Als er hörte, dass Herbert Arzt war, versuchte er zu helfen. Im Mai 1941 wurde Herbert Chefarzt eines Krankenhauses mit 120 Betten in Elizabethville. Das Schlimmste lag jetzt hinter ihnen.
Inzwischen hatten Rosemaries Eltern es doch noch geschafft, über Spanien und Portugal nach Amerika zu emigrieren. Wahrscheinlich waren sie die letzten Juden gewesen, die noch aus Bochum, vielleicht sogar aus Deutschland herausgekommen waren. Aber es gab noch eine weitere große Sorge. Herberts Eltern lebten in Berlin in einem sogenannten Judenhaus, das hoffnungslos überfüllt war. Sie hatten kein Geld mehr, und Herbert konnte mit seinen Eltern nur mit Hilfe des Roten Kreuzes korrespondieren. Im Jahre 1942 erhielt er eine letzte Nachricht von ihnen. Dann war alles still.
Als im Mai 1945 der Krieg zu Ende war, mussten Rosemarie und Herbert eine Entscheidung treffen. Berlin lag in Trümmern, und es gab noch immer keine Nachricht von Herberts Eltern. Schließlich entschieden sich die beiden Molsers für die USA. Sie wollten auch nach Amerika emigrieren, wie Rosemaries Familie. Aber sich aus dem Kongo zu verabschieden war fast so schwierig wie vor sechs Jahren hineinzukommen. Irgendwie gelang es ihnen im Februar 1946, eine DC-4 zu besteigen, eine Propellermaschine, die immerhin drei Tage brauchte, um sie bis nach New York City zu bringen.
Dort gab es ein Wiedersehen mit Rosemaries Mutter und den beiden Schwestern. Aber der Vater war im Oktober 1944 in der Fremde verstorben. Dr. Julius Marienthal, der einer Bochumer Kaufmannsfamilie entstammte, die seit 200 Jahren in Westfalen lebte, hatte sich in der neuen Welt nicht mehr zurecht gefunden. Der national gesinnte Mann, der im Ersten Weltkrieg als EK I- und EK II-Träger seinem Kaiser treu gedient hatte, der einst in Bochum Vorsteher einer erfolgreichen Anwaltskanzlei gewesen war, hatte in Amerika nicht mehr Fuß fassen können. Bevor er starb, hatte er sich in New York noch als Arbeiter am Fließband, als Hauslehrer und sogar als Butler versucht, um Geld für seine Familie zu verdienen.
Auch über das Schicksal von Herberts Eltern erhielten die Molsers in New York nun traurige Gewissheit. Als sie in Berlin von den NS-Behörden das Schreiben bekommen hatten, sie sollten sich auf ihre Deportation einrichten, sahen sie für sich keinen anderen Ausweg als sich umzubringen. Einerseits war dies eine erschütternde Nachricht, andererseits glaubten Rosemarie und Herbert, dass seine Eltern die richtige Entscheidung getroffen hatten. Auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee erinnert heute eine Grabstelle an das Ehepaar.
Herbert musste sich noch einmal einer zusätzlichen medizinischen Ausbildung unterziehen, um überhaupt in Amerika als Arzt praktizieren zu dürfen. Rosemarie arbeitete achtzig Stunden in der Woche als Kinderfrau in Privathaushalten, später auch in einem Altenheim. Eine Wohnung hatten sie in Washington Heights gefunden, dem Stadtteil im nördlichen Manhattan, wo sich viele deutsche Juden angesiedelt hatten. Nach den strapaziösen Jahren in Belgisch-Kongo, im Herzen der Finsternis, genossen sie trotz harter Arbeit das aufregende kulturelle Leben in der amerikanischen Metropole.
So verging das erste Jahr in der Freiheit Amerikas. Dann zogen sie weiter nach Rochester, in die Stadt am Ontario-See, im Nordwesten des Staates New York, wo sie sich endgültig niederließen. Anfangs kamen noch keine Patienten in Herberts Praxis; in dieser Zeit machte er Hausbesuche, die ältere Ärzte nicht mehr übernehmen wollten. Wenn Herbert von seinem spärlichen Verdienst zehn Dollar übrig hatte, dann kaufte er sich meistens eine Schallplatte mit klassischer Musik. Es verging noch einmal ein Jahr, bevor sich die ersten Patienten einstellten, und irgendwann wurde aus dem Unternehmen doch noch eine sehr erfolgreiche Praxis. Rochester war im Übrigen ein guter Ort für Familien. Da Rosemarie selbst keine Kinder bekommen konnte, adoptierten die Molsers einen Jungen, Bruce, und ein Mädchen, Kathy. Es kamen Enkelkinder, und die Ehe zwischen Rosemarie und Herbert währte schließlich 61 Jahre, bis Herbert im Alter von 92 starb.
Rosemarie Molser sagt: »Herbert hat mir geholfen, erwachsen zu werden. Und ich habe ihm später geholfen, alt zu werden.«
Sie fügt hinzu: »Mein Leben war eine merkwürdige Mischung aus Tragödie und Glück. Es hat mich gelehrt, dass man Grausamkeit und Schrecken überleben und gleichwohl liebevoll und nachsichtig bleiben kann. Schnell urteilen, das kann wohl jeder, aber die Würde des Menschen zu achten ist oft schwierig. Mir ist es so ergangen, dass ich an der Grausamkeit so vieler fast zerbrochen wäre, doch hatte ich auch Glück, und ich überlebte schließlich, weil es immer ein paar Menschen gab, die helfen wollten.«
Das Haus der Familie Marienthal am Bochumer Stadtpark wurde nach dem Kriege verkauft. Aber auch hier stand kein guter Stern über dem Gebäude, das durch den Bombeneinschlag schwer gezeichnet war. Ein Bekannter der Familie, der sich um die Angelegenheit kümmerte und der die behördlichen Dinge in Bochum regeln wollte, sorgte für einen Kaufabschluss exakt zehn Tage vor der Währungsreform, so dass von dem Geld nichts mehr für die Familie übrig blieb.
Rosemarie Molser lebt heute in Verhältnissen, wie sie vielleicht denen ihrer Familie in Bochum entsprochen hätten, wenn es anders gekommen wäre. Sie ist in sozialen Einrichtungen engagiert und beteiligt sich am jüdischen Leben ihrer Stadt. Oft wird sie von Schulen eingeladen, um den Jugendlichen vom Schicksal der Marienthals zu erzählen, ein Angebot, das sie gern wahrnimmt. Im letzten Jahr hat sie Bochum besucht und sich mit einigen ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen der Schiller-Schule getroffen, also der Schule, von welcher sie wegen einer ehrlichen und gleichwohl unbedachten Äußerung als junges Mädchen, im Grunde als Kind, relegiert worden war. Mit ihren Mitschülerinnen Inge und Christel hat Rosemarie Kaffee getrunken. Sie hat die Gräber der Großeltern aufgesucht. Und mit Hubert Schneider ist sie zum »Alten Stadtpark« gefahren, wo sie noch einmal das Haus betrachtet hat.
Als ich diesen Text aufschreibe, zählen wir schon das Jahr 2005. Es ist jetzt Anfang März. Der Winter gebärdet sich hartnäckig, will nicht weichen, es gibt ihn also doch noch. Nach dem Schreiben muss ich noch einmal raus. Spazierengehen an der frischen, knackigen Luft sei gesund, höre ich, mache mich also zu Fuß auf, wieder einmal die Grummer Teiche entlang, ein gutes Stückchen an der Bergstraße, dann nach links und die mittlere Gabelung zum alten Stadtpark hinauf. Das Haus der Marienthals steht in dieser Jahreszeit sehr frei da, denn die Bäume und Sträucher sind immer noch kahl. Wunderlich erscheint mir nach wie vor die Asymmetrie der beiden Hälften – das passt nicht zusammen.
Auf dem Heimweg durch den Stadtpark, in dem es schon am späten Nachmittag luftig und kalt ist, muss ich den Kragen meines Mantels hochschlagen. Mir kommen die Eingangsverse zur Schubertschen »Winterreise« in den Kopf. »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus«, so heißt es im ersten Lied des Zyklus. Wilhelm Müller aus Dessau, der Heimatstadt von Moses Mendelssohn, hat den Text geschrieben. Dessau, das ist der Ort, in dessen Stadtpark vor fünf Jahren der Mosambikaner Alberto Adriano von drei Neonazis erschlagen wurde. Es ist auch die Stadt, in deren Straßen erst vor ein paar Tagen dreihundert Rechtsradikale einen »Trauermarsch« inszenieren durften, um ihre unappetitliche Version des Andenkens an das Bombardement der Stadt vor 60 Jahren zu zelebrieren.
»Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.« Es scheint so, als ob viele Juden, die später aus ihren Häusern und aus Deutschland vertrieben wurden, zunächst einmal nicht wahrgenommen hätten, dass sie bei manchen ihrer Nachbarn schon als Fremde galten, seit sie eingezogen waren. Beim Auszug wussten sie es alle. Man kann es ihnen nicht verdenken, wenn einige der Überlebenden bis heute Fremde bleiben wollen.
(2005)