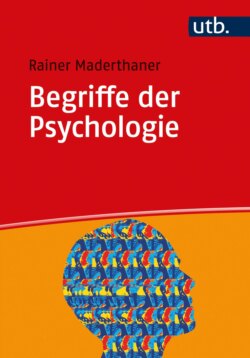Читать книгу Begriffe der Psychologie - Rainer Maderthaner - Страница 8
ОглавлениеB
Begriffe im Überblick
Basisemotionen • Bayes-Logik • Bayes-Theorem • bedingte Wahrscheinlichkeit • Bedürfnishierarchie • Bedürfniskomplementarität • Bedürfnispyramide • Bedürfnisse • Befragung • Begriffe • Begriffslernen • Behaviorismus • behavioristische Perspektive • Belohnungssystem • beobachterabhängige Urteilsverzerrungen • Beobachtung • Beobachtungslernen • Bestätigungsfehler • Bestrafung • Bestrafungssystem • Betroffenheit • Bewältigungsarbeit • Bewegungsparalaxe • Bewegungstäuschung • Bewertungsfunktion • Bewertungssystem • Bewusstsein • Bewusstseinslage • Bewusstseinszustände • Beziehungsabbruch • Beziehungsregeln • Bicameral Mind • Bindungsstil • Bindungsverhalten • binokulare Tiefenhinweise • Binomialverteilung • Biofeedback • biologische Perspektive • biologischer Rhythmus • biologischer Speicher • biopsychosozialer Ansatz • Biorhythmus • Bumerang-Effekt • Bystander-Phänomen
Basisemotionen siehe S. 308
Lange Zeit beschäftigte man sich mit der Frage, ob es eindeutige Abgrenzungen zwischen emotionalen Zuständen gibt bzw. ob man sogenannte Basis-, Primäroder Grundemotionen annehmen kann. Je nach theoretischem Ansatz ergaben sich zwischen zwei und über zwanzig solcher Basisemotionen, sodass manche Forscher die Sinnhaftigkeit derartiger Klassifikationen bezweifeln (Ortony & Turner, 1990). In mimischen Ausdrucksuntersuchungen jedenfalls wurden kulturübergreifend zwischen sechs und sieben Grundemotionen relativ übereinstimmend klassifiziert (Elfenbein & Ambady, 2002, 224): Glück/Freude (79 %), Trauer (68 %), Überraschung (68 %), Ärger (65 %), Ekel (61 %), Furcht (58 %) und Verachtung (43 %). Kulturintern sind die Werte zutreffender Emotionseinschätzung um etwa zehn Prozentpunkte besser. Ebenfalls als Grundemotionen vorgeschlagen wurden von verschiedenen Forschern Interesse, Schmerz, Mut, Verzweiflung, Schuld, Scham, Hass, Erleichterung, Bedauern, Neid, Enttäuschung, Zorn, Verwunderung und Hoffnung.
Bayes-Logik siehe S. 275
Wenn sich in Denk- und Schätzprozessen die im → Bayes-Theorem aufgezeigten Verhältnisse zumindest annähernd abbilden, spricht man auch von → statistischem Denken oder von Bayes-Logik (»Bayesian reasoning«).
Bayes-Theorem siehe S. 78
Das nach dem britischen Mathematiker und Geistlichen Thomas Bayes (1702– 1761) benannte Theorem erlaubt wahrscheinlichkeitstheoretisch korrekte Schätzungen über die Gültigkeit von Hypothesen:
p(H) ist die → Apriori-Wahrscheinlichkeit einer Hypothese, p(D/H) ist die → bedingte Wahrscheinlichkeit von Daten unter der Bedingung einer Hypothese und p(H/D) ist die Wahrscheinlichkeit für eine Hypothese nach deren Revision aufgrund neuer Erfahrungen, die man → Aposteriori-Wahrscheinlichkeit nennt.
bedingte Wahrscheinlichkeit siehe S. 274
Die bedingte Wahrscheinlichkeit p(D/H) ist die Wahrscheinlichkeit, mit der eine hypothesenkonforme Erfahrung bei Gültigkeit der Hypothese auftritt (z. B., wie wahrscheinlich es ist, dass ein Lügner lügt).
Bedürfnishierarchie siehe S. 313
Maslow (1943), ein Vertreter der Humanistischen Psychologie, wollte das Spektrum menschlicher Motivation nicht nur auf biologische oder überlebenswichtige Bedürfnisse beschränkt sehen, sondern bezog auch kulturelle und geistige Triebkräfte mit ein. Er postulierte eine Bedürfnishierarchie, gemäß der die unteren bzw. Basisbedürfnisse (»Mangelbedürfnisse«) weitgehend erfüllt sein müssen, bevor die höheren Bedürfnisse wirksam werden (»Wachstumsbedürfnisse«). Auch wenn der empirische Nachweis einer solchen Rangreihung kaum zu führen ist, entspricht diese doch der Alltagserfahrung und der Lebensweisheit, dass ohne ausreichende Befriedigung der vitalen Grundbedürfnisse sich die »höheren« Motive kaum entwickeln können.
Bedürfniskomplementarität siehe S. 354
Je weiter private Beziehungen fortgeschritten sind, desto bedeutsamer wird die Übereinstimmung in den Bedürfnissen (»Kompatibilität«) bzw. deren Verträglichkeit. Der populäre Spruch »Gegensätze ziehen sich an« dürfte nur dort stimmen (wenn überhaupt), wo durch den Partner bei weitgehender Bedürfnisübereinstimmung ein Ausgleich eigener Schwächen gewünscht oder erwartet wird. Wichtige partnerschaftliche Bedürfnisse, in denen Übereinstimmung erzielt werden sollte, sind Intimität, Ebenbürtigkeit und Vertrauen (Kelley & Burgoon, 1991).
Bedürfnispyramide siehe S. 313
Jene Motive, die in unterschiedlicher Stärke auch gleichzeitig vorhanden sein können, werden oft als → Bedürfnisse bezeichnet. Schaefer (1992) unterscheidet diesbezüglich physische (z. B. Nahrung, Freizeit), mentale (z. B. Liebe), soziale (z. B. Freunde) und Umweltbedürfnisse (z. B. gute Luft). Ein Beispiel für eine Klassifikation von Bedürfnissen hinsichtlich ihres Stellenwerts für das Überleben des Menschen ist die weithin bekannte Bedürfnispyramide von Maslow (1943; Maslow & Lowery, 1998). siehe → Bedürfnishierarchie.
Bedürfnisse siehe S. 312 f.
Motive oder Bedürfnisse sind mentale Repräsentationen (Vorstellungen) wertbesetzter zukünftiger Zustände, die angestrebt oder vermieden werden bzw. verhaltensregulierend wirksam sind.
Befragung siehe S. 32, 91
Die Befragung ist ein sehr häufig eingesetztes sozialwissenschaftliches Verfahren der Datenerhebung, welches in strukturierter Form auch einer statistischen Auswertung zugeführt werden kann. Da die verschiedenen Varianten der Befragung zu den häufigsten Methoden der Datengewinnung in den Sozialwissenschaften zählen, werden sie auch manchmal als deren »Königsweg« bezeichnet (Ebster & Stalzer, 2003). »Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen. Durch verbale Stimuli (Fragen) werden verbale Reaktionen (Antworten) hervorgerufen: Dies geschieht in bestimmten Situationen und wird geprägt durch gegenseitige Erwartungen« (Atteslander, 2003, 120) Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Befragungen ist der Grad ihrer Standardisierung. Hinsichtlich der Freiheitsgrade bei der Durchführung von Gesprächen mit Untersuchungspersonen unterscheidet man standardisierte, teilstandardisierte und nichtstandardisierte Befragungen (Interviews).
Begriffe siehe S. 197 f.
Begriffe sind mentale Repräsentationen einer bestimmten Konfiguration von Merkmalen, die mit einem Namen versehen sein können.
Begriffslernen siehe S. 263
Beim Begriffslernen sollen für Gruppen von Objekten, Situationen oder Prozessen jene Merkmale und Merkmalsrelationen herausgefunden werden, die ihnen gemeinsam sind. Der Prozess ist vergleichbar mit jenem in der → Inferenzstatistik, wo von Fällen mit variierenden Variablenausprägungen auf einen gesetzmäßigen Zusammenhang der Variablen geschlossen wird.
Behaviorismus siehe S. 24
Vor allem in den USA dominierendes wissenschaftstheoretisches Konzept, bei dem das Verhalten des Menschen durch einfache »Reiz-Reaktions-Modelle« erklärt wird. Etwa ab 1960 löste der → Kognitivismus (»Kognitive Wende«) den Behaviorismus ab. Das Verhalten des Menschen wird nun durch komplexe, hierarchische Regulationsprozesse eines kognitiven Systems erklärt, dem psychische Funktionen zugeschrieben werden (Interpretation, Klassifikation, Lernen, Denken, Urteilen etc.).
behavioristische Perspektive siehe S. 50
Ein auf das »objektiv« beobachtbare Verhalten (amerikan.: »behavior«) des Menschen (und von Tieren) ausgerichteter Ansatz, bei dem die gesetzmäßige Aufklärung von Reiz-Reaktions-Beziehungen im Vordergrund steht und der auf Aussagen über »innere« – bewusste oder unbewusste – Prozesse verzichtet.
Belohnungssystem siehe S. 302
Die neuronale Steuerung von Annäherungs- und Vermeidungsprozessen im Gehirn wird einerseits dem Belohnungssystem (Tegmentum, Nucleus accumbens, …) und andererseits dem → Bestrafungssystem (Zentrales Höhlengrau, Amygdala, Septum, Hippocampus,…) zugeschrieben. Angenehme Konsequenzen bzw. Belohnungen führen üblicherweise zu einer Fortführung bzw. späteren Wiederausführung des aktuellen Verhaltens (»behavioral activation system«), während negative Konsequenzen bzw. Bestrafungen dieses hemmen (»behavioral inhibition system«).
beobachterabhängige Urteilsverzerrungen siehe S. 82
Störeffekte in psychologischen Experimenten, engl.: »observer bias«; entstehen durch persönliche Motive und Erwartungen und sollten vonseiten der Forscherinnen und Forscher beachtet werden.
Beobachtung siehe S. 90
Die Selbst- und Fremdbeobachtung zählt zu den ältesten Forschungsinstrumenten der Psychologie. Die wissenschaftliche Beobachtung unterscheidet sich von jener des Alltags durch ihre Theoriegeleitetheit und Systematik. »Unter Beobachtung versteht man das systematische Erfassen von wahrnehmbaren Verhaltensweisen, Handlungen oder Interaktionen einer Person oder Personengruppe zum Zeitpunkt ihres Auftretens« (Ebster & Stalzer, 2003, 221). Grundsätzlich sollte die Beobachtung als Mittel der Informationsgewinnung in allen Untersuchungen zumindest begleitend eingesetzt werden, und auch die beschriebenen Gütekriterien von Tests sollten eigentlich für alle Datengewinnungsverfahren in der Psychologie gelten. So sind auch Beobachtungen einer Objektivitätsprüfung zu unterziehen, indem die Übereinstimmung verschiedener, unabhängiger Beobachterinnen oder Beobachter festgestellt wird.
Beobachtungslernen siehe S. 200
Albert Bandura (1965) zeigte auf, dass das Lernen am Modell bei Kindern die vielleicht wichtigste Lernform ist, besonders im Bereich des Sozialverhaltens. In einem berühmten Experiment geht es um die → Imitation aggressiven Verhaltens durch vierjährige Kinder. Jedes Kind sah zunächst einen Kurzfilm, in dem ein Erwachsener aggressive Verhaltensweisen und Verbalisierungen gegenüber einem aufblasbaren Stehaufmännchen zeigte. Die erwachsene Modellperson bekam dafür im Film entweder Belohnungen wie Limonade, Süßigkeiten und Lob, oder sie wurde getadelt und bekam einen Klaps, oder aber es folgten keine beobachteten Konsequenzen. Danach wurde jedes der Kinder mit der Puppe allein gelassen und hinter einer Einwegscheibe beobachtet. Nach der Beobachtung eines aggressiven Modells zeigten die Kinder viele ähnliche aggressive Verhaltensweisen und Kommentare (wobei Jungen allgemein aggressiver waren als Mädchen). Jene Kinder allerdings, die beobachtet hatten, wie das Modell für sein Verhalten bestraft wurde, zeigten deutlich weniger Aggressionen.
Bestätigungsfehler siehe S. 264
Eine deutlich ausgeprägte, wahrscheinlich für viele Fehlleistungen des Alltags verantwortliche Denkneigung betrifft die Bestätigungstendenz beim Prüfen von Hypothesen. Wenn wir allgemeine Aussagen (z. B. Meinungen, Vorurteile) im Kopf haben, testen wir üblicherweise positiv, das heißt, wir suchen Beispiele, die der Annahme entsprechen, und nicht Gegenbeispiele, die Chancen für eine Widerlegung böten. Wason (1960) konnte diesen Bestätigungsfehler (»confirmation bias«) auch bei einfachen Hypothesen über Gesetzmäßigkeiten in Zahlenreihen überzeugend nachweisen.
Bestrafung siehe S. 191 f.
Allgemein findet instrumentelles Lernen dann statt, wenn wiederholt eine bestimmte Situation wahrgenommen wird (»diskriminativer Hinweisreiz«; SD), in der bestimmte Verhaltensweisen (R) zu bestimmten Konsequenzen führen (K). Wenn die Konsequenz die Auftrittswahrscheinlichkeit des Verhaltens erhöht, spricht man von → Verstärkung, wenn sie die Auftrittswahrscheinlichkeit senkt, spricht man von Bestrafung.
Bestrafungssystem siehe S. 302
Die neuronale Steuerung dieser Prozesse im Gehirn wird einerseits dem → Belohnungssystem (Tegmentum, Nucleus accumbens,…) und andererseits dem Bestrafungssystem (Zentrales Höhlengrau, Amygdala, Septum, Hippocampus, …) zugeschrieben. Angenehme Konsequenzen bzw. Belohnungen führen üblicherweise zu einer Fortführung bzw. späteren Wiederausführung des aktuellen Verhaltens (»behavioral activation system«), während negative Konsequenzen bzw. Bestrafungen dieses hemmen (»behavioral inhibition system«).
Betroffenheit siehe S. 278
Untersuchungen zur → Risikowahrnehmung von Slovic, Fischoff und Lichtenstein (1980, 1985; Slovic, 1987) ergaben insgesamt 18 differenzierende Charakteristika zur Klassifikation von Risiken mit interessanten Rückschlüssen auf die Risikoeinschätzung in der Bevölkerung. Ein Merkmal, das mit erhöhter Risikoeinschätzung verbunden war, ist Betroffenheit (»known to exposed«): Ereignisse, die einen selbst betreffen können, erscheinen gefährlicher.
Bewältigungsarbeit siehe S. 430
Klaus Grawe extrahierte aus den als wirksam nachgewiesenen einzelnen Therapietechniken vier allgemeine, schulenübergreifende → psychotherapeutische Wirkfaktoren, die er als zukünftige Therapierichtlinien einer »Allgemeinen Psychotherapie« oder als Wirkkomponenten einer idealen »Psychologischen Therapie« (Grawe, 1998) empfahl. Als wichtigsten und größten Wirkfaktor identifizierte Grawe die »aktive Hilfe zur Problembewältigung«. Sie fördert in Problemsituationen die Selbstwirksamkeitswahrnehmung und hilft, Hilflosigkeit zu reduzieren. Selbstsicherheitstraining, Entspannungstraining oder Angstbewältigungstraining sind Beispiele dafür, wie durch Vermittlung psychologischen Wissens und entsprechender Strategien kritische Lebenssituationen besser gemeistert und neue, positive Erfahrungen gemacht werden können.
Bewegungsparalaxe siehe S. 139
Wir nützen für die Rauminterpretation die Bewegungsparalaxe, das ist die – geometrisch begründete – stärkere Verschiebung der Objekte im Vordergrund verglichen mit jenen im Hintergrund, wenn wir uns quer zu ihnen bewegen (z. B. beim Blick aus einem Zugfenster).
Bewegungstäuschung siehe S. 150
Da die Wahrnehmung von Bewegungen für höher entwickelte Organismen eine lebensrelevante Bedeutung besitzt, haben sich dafür im Laufe der evolutionären Entwicklung einige relativ starre – und deshalb auch täuschungsanfällige – Wahrnehmungsmechanismen herausgebildet. Eine solche Bewegungstäuschung, die bereits von den Gestaltpsychologen vor etwa hundert Jahren untersucht wurde, besteht darin, dass zwei in Nachbarschaft kurz hintereinander aufleuchtende Lichtpunkte als ein bewegter Punkt wahrgenommen werden (»Phi-Phänomen«). Diese Täuschung entsteht auch dann, wenn nicht Lichtpunkte, sondern Bildelemente ihre Position schrittweise von einer Darstellung zu anderen verändern, was bekanntlich die Voraussetzung für die Entwicklung der Filmtechnik war: Bewegte Szenen, die mit 24 Bildern pro Sekunde fotografiert wurden, lösen bei gleichermaßen schnell aufeinanderfolgender Darbietung einen natürlichen Bewegungseindruck aus.
Bewertungsfunktion siehe S. 252 f.
Wenn für einen Problemtyp keine sichere Lösungsstrategie verfügbar ist (»Algorithmus«), dann muss mittels → Heuristiken eine schrittweise Annäherung an Zielzustände versucht werden. Um allerdings einschätzen zu können, ob und wie stark man sich dem Ziel nähert, ist den Zuständen im Problemraum eine Bewertungsfunktion zuzuordnen (z. B. Einschätzung der Entfernung zu einem gesuchten Ziel, Chanceneinschätzung für einen Gewinn, Attraktivität einer Situation). Ein vom Prinzip her auch in der Mathematik und Statistik eingesetztes heuristisches Verfahren zur Optimierung von Zuständen ist die
»Methode der Unterschiedsreduktion«, bei der jener Pfad im Problemraum ausgewählt wird, der schrittweise mit der größten Bewertungszunahme verbunden ist.
Bewertungssystem siehe S. 172 f.
Das Aktivierungssystem stellt nur einen groben Regulationsmechanismus zur biologischen Bewertung von Lebensumständen dar, sodass sich in der Phylogenese komplexer Lebensformen (Säugetiere) bald auch ein differenzierteres zentralnervöses Bewertungssystem, nämlich das → limbische System (→ Amygdala), herausbildete. Dieses nimmt laufend einen Vergleich zwischen Ist- und Sollwerten im biologischen und psychischen Bereich vor und stellt fest, ob die gegebene Situation grundsätzlich eher als günstig oder als ungünstig einzuschätzen ist (Critchley & Garfinkel, 2018). Führt dieser Vergleich zu einem positiven Ergebnis, dann manifestiert sich dies subjektiv in einem positiven Gefühl (Zufriedenheit, Freude, Glück,…), verbunden mit der Tendenz, den vorhandenen Zustand aufrechtzuerhalten und die gerade ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen oder in Zukunft zu wiederholen (z. B. Essen, wenn etwas gut schmeckt). Weichen jedoch die Istvon den Sollwerten zu stark ab, dann kommt es zu einem negativen Gefühl, wie etwa Unruhe, Angst oder Aggression, verbunden mit der Tendenz, den vorhandenen Zustand zu verändern und in Zukunft zu vermeiden. In die Bewertung der Situation fließt auch die Wahrnehmung des eigenen Aktivierungsniveaus und der körperlichen Empfindungen mit ein (Critchley & Harrison, 2013).
Bewusstsein siehe S. 103–106
Das Bewusstsein hat innerhalb der Psyche die besondere Funktion, den Output aus verschiedenen Systemen zu integrieren, den Transfer in Langzeitspeichersysteme zu bewirken und Informationen an psychische »Filterprozessoren« (z. B. Aufmerksamkeit) oder »Servomechanismen« (z. B. Sprachzentren) als modulare Informationsverarbeitungssysteme weiterzugeben. Als eine der wichtigsten Funktionen fällt dem Bewusstsein nach Mandler (1979, 78) »die Prüfung potenzieller Handlungsmöglichkeiten und die Bewertung der situativen Gegebenheiten« zu. Nach Solso (2005, 150) scheint das Bewusstsein »der hauptsächliche Prozess zu sein, mit dessen Hilfe sich das Nervensystem an neuartige, herausfordernde und informative Ereignisse in der Welt anpasst«.
Bewusstseinslage siehe S. 108
Mit Bewusstseinslage umschreibt man den Grad an bewusster Kontrolle psychischer Abläufe, der bei äußerster Konzentration im Wachzustand sein Maximum und im Tiefschlaf sein Minimum erreicht.
Bewusstseinszustände siehe S. 108–116
Als Bewusstseinszustände bezeichnet man Ausprägungen des Bewusstseins wie die Bewusstseinslage, Schlaf, Traum, Hypnose, Mediation und Zustände, die durch psychoaktive Medikamente und Drogen ausglöst werden.
Beziehungsabbruch siehe S. 358
Für das Scheitern romantischer Beziehungen (Liebesbeziehungen) führt Gottman (1998a, 1998b) vor allem vier Hauptgründe an, die zu einem Teufelskreis negativ dominierter Kommunikation führen:
•Tendenz zu Kritik (an der Person, nicht am Verhalten)
•Abwehr (z. B. von »Schuld«, Verantwortung, Einsicht, Selbsterkenntnis)
•Verachtung (z. B. Beleidigen, Beschimpfen, Spott, Sarkasmus)
•Abblocken (z. B. Schweigen, Zurückziehen, Mauern)
Der Wunsch, den anderen ändern zu wollen, führt häufig zu einem kommunikativen »Forderungs-Rückzug-Muster« (Malis & Roloff, 2006), welches häufig zur Verschlechterung in Partnerschafts- und Eltern-Kind-Beziehungen beiträgt. Um aber eine längerfristige erotische Partnerschaft erfolgreich aufrechterhalten zu können, ist nach Gottman (1998b) zumindest ein Häufigkeitsverhältnis von 5 : 1 zwischen positiven und negativen Verhaltensweisen nötig. Als Gründe für einen Beziehungsabbruch geben Frauen zu geringe Offenheit des Partners, zu wenig eigene Autonomie und einen Mangel an Aufgaben- und Verteilungsgerechtigkeit an, während Männer zu wenig »Romantik« im Zusammenleben beklagen (Baxter, 1986).
Beziehungsregeln siehe S. 357
Argyle und Henderson (1986) gehen in einer internationalen Studie der Frage nach, welche Beziehungsregeln für soziale Relationen (z. B. Arbeits-, Nachbarschafts-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen) als die wichtigsten erachtet werden, und bezogen dafür Befragungspersonen aus vier Ländern ein (Großbritannien, Italien, Japan, Hongkong):
•Die Intimsphäre des anderen respektieren
•Vertrauliche Mitteilungen bewahren
•Den anderen nicht öffentlich kritisieren
•Während des Gesprächs immer wieder Augenkontakt halten
Häufige Verstöße gegen diese Regeln schwächen nach Meinung der Befragten eine Beziehung oder führen zu einem Beziehungsabbruch.
Bicameral Mind siehe S. 19
Julian Jaynes (Psychologieprofessor in Princeton) stellte aufgrund antiker Texte aus der Zeit von 3000 bis etwa 700 v. Chr. (Sumer, Babylon, Ägypten, Mayakultur,…) die Hypothese auf, dass die damaligen Menschen noch kaum über ein introspektives (sich selbst wahrnehmendes) Bewusstsein verfügt hätten, sondern nur über eine »bikamerale« Psyche. Darunter versteht Jaynes (1976/1993) eine relativ unabhängige Arbeitsweise beider Gehirnhälften, bei der die rechte Hälfte akustische oder visuelle Halluzinationen in die linke Gehirnhälfte projiziert, welche als »Stimmen« oder »Erleuchtungen« von Göttern interpretiert worden sein könnten. Jaynes bezeichnet solche halluzinierten »Götterstimmen« als neurologische Imperative, welche vielleicht erzieherische oder sittliche Anweisungen (soziale Kontrolle!) zum Ausdruck brachten.
Bindungsstil siehe S. 420 ff.
Der Bindungsstil ist ein besonders wichtiges Vorhersagekriterium psychischer Gesundheit einer Person. Die »Bindungstheorie« von Bowlby (1969, 1973, 1980) betont die evolutionäre Bedeutung des Bindungsbedürfnisses ab der Geburt bis ins Erwachsenendasein und beschreibt die Folgen positiver und negativer Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Feinfühligkeit der primären Bezugsperson (meist Mutter). Mary Ainsworth entwickelte ein standardisiertes Beobachtungsverfahren zur Identifizierung von bestimmten Verhaltensmustern, wie Kinder im Alter von 11 bis 20 Monaten auf eine Trennung von der Mutter reagieren (Ainsworth et al., 1978). siehe → Bindungsverhalten.
Bindungsverhalten siehe S. 420
Mary Ainsworth entwickelte ein standardisiertes Beobachtungsverfahren zur Identifizierung von bestimmten Verhaltensmustern, wie Kinder im Alter von 11 bis 20 Monaten auf eine Trennung von der Mutter reagieren (Ainsworth et al., 1978). In diesen Bindungsmustern (→ Bindungsstilen) drückt sich zum einen das Bindungsverhalten gegenüber vertrauten Personen aus und zum anderen eine Repräsentation der erlebten Beziehungen (»Inneres Arbeitsmodell« nach John Bowlby), einschließlich einer Repräsentation von sich selbst und den anderen (Selbstwertgefühl und Vertrauen; s. Zimmermann et al., 1995; Gallo & Smith, 2001).
binokulare Tiefenhinweise siehe S. 140
Eine lebenswichtige Wahrnehmungsfunktion ist die Transformation zweidimensionaler Netzhautbilder in eine dreidimensionale Interpretation der Wahrnehmungswelt. Aus der Wahrnehmungsforschung wissen wir, dass für die räumliche Interpretation von visuellen Eindrücken sowohl spezielle Hinweisreize in den flächigen Bildern als auch Rückmeldungen aus dem Wahrnehmungsvorgang herangezogen werden. → Monokular sind dabei jene Indikatoren, die auch einäugig wirksam werden, während die binokularen Tiefenhinweise nur über beide Augen zustande kommen. Ein physiologischer Mechanismus, der sich nur für die Einschätzung naher Distanzen (etwa bis zu zwei Metern) eignet, ist das Ausmaß der → Konvergenz der Augenachsen in Richtung eines fixierten Objekts. Je stärker die Augenachsen von der parallelen Ferneinstellung in eine konvergierte Naheinstellung überwechseln müssen, als desto näher wird das Objekt empfunden. Ein zweiter Hinweis auf die räumliche Tiefe eines Objekts stammt von den unterschiedlichen Perspektiven beider Augen bzw. von den in beiden Augen unterschiedlichen Netzhautbildern für nahe Gegenstände, was auch als → retinale Disparität oder als »binokulare Querdisparation« bezeichnet wird. Die etwas unterschiedlichen linksäugigen und rechtsäugigen Abbildungen naher Gegenstände werden vom Gehirn für die Berechnung einer Räumlichkeitsinterpretation genützt, was am Beispiel sogenannter »magischer Bilder« eindrucksvoll demonstriert werden kann. Diese und andere → optische Täuschungen lassen sich durch den Versuch des Wahrnehmungssystems erklären, flächige Darstellungen unter Heranziehung von Tiefenhinweisen räumlich zu interpretieren.
Binomialverteilung siehe S. 73
Die besondere Bedeutung der → Normalverteilung (oder »Gauß’schen Glockenkurve«) und der (mit ihr verwandten) Binomialverteilung in der Statistik ist darauf zurückzuführen, dass beide als Idealformen zufallsbedingter Verteilungsprozesse angesehen werden. Bei empirischen Variablen wird angenommen, dass sich ihre Werte aus einer wahren Komponente und einer zufälligen Fehlerkomponente zusammensetzen.
Biofeedback siehe S. 194
Als Biofeedback bezeichnet man die zumeist elektronische Registrierung und optische oder akustische Rückmeldung von physiologischen Reaktionen (z. B. Herzschlag, Blutdruck, Muskelspannung). Damit werden im physiologischen System Funktionsveränderungen trainierbar, die sonst nicht willkürlich steuerbar sind.
biologische Perspektive siehe S. 50
Bei dieser Forschungsausrichtung werden psychologische Phänomene hauptsächlich durch die Funktionsweise der Gene, des Gehirns, des Nervensystems oder anderer biologischer Systeme erklärt.
biologischer Rhythmus siehe S. 109
Viele Lebensprozesse werden vom Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst, sodass sich im Laufe der Evolution auch beim Menschen eine Art »innere Uhr« herausgebildet hat. Dieser → zirkadiane Rhythmus (Biorhythmus) reguliert die Wachheit des Organismus in Phasen von »zirka« einem Tag (lat. »dies«: Tag), genauer 24–25 Stunden (»Chronobiologie«). Die kleinen individuellen Abweichungen des → Biorhythmus vom realen 24-Stunden-Tagesrhythmus werden durch die verantwortlichen Steuerungszentren im Gehirn (Suprachiasmatische Kerne, Hypothalamus, Zirbeldrüse) aufgrund von Lichtwahrnehmungen und Tagesrhythmus (z. B. Essintervalle) korrigiert (Birbaumer & Schmidt, 2006). Bei regulärem Biorhythmus sinken in der Nacht die Körpertemperatur, die Atemfrequenz, die Herzrate, die Sauerstoffaufnahme und der Appetit, hingegen nehmen die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die Schmerzempfindlichkeit, die Reaktionszeit und die Fehleranfälligkeit des Verhaltens zu.
biologischer Speicher siehe S. 210
Da zu speichernde Erfahrungen und Wissensinhalte umso größere Lebensrelevanz besitzen, je häufiger sie in Erlebnisfolgen vorkommen, lösen dichte Wiederholungen von Erfahrungen einen raschen Lernprozess aus. Tatsächlich lässt sich sowohl bei einfachen als auch bei komplexen Lernvorgängen (z. B. Silbenlernen, Addieren, mathematisches Beweisen, schriftstellerische Fertigkeit) der erzielte Lernfortschritt mittels einer positiven Potenzfunktion beschreiben (0,0 < Exponent < 1,0; Anderson, 2000). Dieses → Potenzgesetz des Lernens (»power law of learning«; Newell & Rosenbloom, 1981) besagt, dass erste Wiederholungen von gleichartigen Erfahrungen relativ schnell zur Einprägung führen und die nachfolgenden immer langsamer. In analoger Weise sollte die Löschung von »statistisch unnützen« Einprägungen erfolgen, das sind solche, die nicht durch besondere Speicherfaktoren, wie zum Beispiel durch Aktivierung oder Emotionalität gefestigt werden. Tatsächlich lässt sich bei vielen Lerninhalten auch der Vergessensprozess annähernd durch eine Potenzfunktion charakterisieren – nun aber mit negativem Exponenten (→ Potenzgesetz des Vergessens). Der biologische Speicher hat also die Tendenz, alles wieder zu löschen, was nicht permanent in seiner Lebensrelevanz bestätigt wird. Anderson (2000, 233) sieht die Ursache für diese schnelle Vergessensbereitschaft in der evolutionären Anpassung des Gedächtnissystems an die jeweilige »statistische Struktur der Realität«. Als Indiz für diese Annahme führt er die Themen in den Headlines von Zeitungen an, deren Wahrscheinlichkeit, an einem bestimmten Tag in der Zeitung vorzukommen, sich relativ exakt über die (negative) Potenzfunktion ihres Erscheinens in vorangegangenen Zeitungsausgaben errechnen lässt.
biopsychosozialer Ansatz siehe S. 401
Da unter Umständen auch »normale« Alltagsbedingungen oder bestimmte Extremsituationen zu außergewöhnlichen bzw. speziellen Bewusstseinszuständen (z. B. durch Hyperventilation, Alkoholgenuss, Fieber) oder irrationalen Verhaltensweisen führen und auch diagnostische Fehlinformationen vorliegen können, müssen nach dem sogenannten biopsychosozialen Ansatz schon bei der Diagnose, besonders aber bei der näheren Analyse von psychischen Störungen sowohl biologische, psychische als auch soziale Situationsbedingungen mitberücksichtigt werden.
Biorhythmus siehe S. 109
Viele Lebensprozesse werden vom Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst, sodass sich im Laufe der Evolution auch beim Menschen eine Art »innere Uhr« herausgebildet hat. Dieser → zirkadiane Rhythmus (Biorhythmus) reguliert die Wachheit des Organismus in Phasen von »zirka« einem Tag (lat. »dies«: Tag), genauer 24–25 Stunden (»Chronobiologie«). Die kleinen individuellen Abweichungen des Biorhythmus vom realen 24-Stunden-Tagesrhythmus werden durch die verantwortlichen Steuerungszentren im Gehirn (Suprachiasmatische Kerne, Hypothalamus, Zirbeldrüse) aufgrund von Lichtwahrnehmungen und Tagesrhythmus (z. B. Essintervalle) korrigiert (Birbaumer & Schmidt, 2006). Bei regulärem Biorhythmus sinken in der Nacht die Körpertemperatur, die Atemfrequenz, die Herzrate, die Sauerstoffaufnahme und der Appetit, hingegen nehmen die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die Schmerzempfindlichkeit, die Reaktionszeit und die Fehleranfälligkeit des Verhaltens zu.
Bumerang-Effekt siehe S. 342
Bei einer stabilen und argumentativ gut abgesicherten Meinung ist der Akzeptanzbereich für eine mögliche Einstellungsveränderung wesentlich kleiner als bei instabilen Meinungen. Wird dieser Akzeptanzbereich bei Überzeugungsversuchen überschritten, dann verfestigt sich eher die ursprüngliche Meinung oder entwickelt sich sogar in die unerwünschte Gegenrichtung. Dieser Bumerang-Effekt (Hovland, Harvey & Sherif, 1957; Rhine & Polowniak, 1974), der durch überzogene, rhetorisch aufdringliche Manipulationsbemühungen (von wenig glaubwürdigen Gesprächspartnern) entsteht, lässt sich durch eine »Schritt-für-Schritt-Technik« unterbinden, bei der wiederholt nur kleine Einstellungsveränderungen in die intendierte Richtung bewirkt werden.
Bystander-Phänomen siehe S. 366
Darunter versteht man die Abnahme der Hilfsbereitschaft des Einzelnen in dem Ausmaß, in dem er andere potenzielle Hilfspersonen wahrnimmt. In ihrem Experiment zum Bystander-Phänomen luden Darley und Latane (1968) 72 Studierende ein, an einem Kommunikationsexperiment teilzunehmen. Die Personen saßen einzeln in Versuchsräumen und kommunizierten über Mikrofon und Kopfhörer mit verschieden vielen (fiktiven) anderen Personen über Studienprobleme. Sie bekamen hintereinander jeweils zwei Minuten Redezeit, jeder war nur von allen anderen Versuchsteilnehmern gemeinsam zu hören, nicht aber vom Versuchsleiter; wechselseitig war keine Kommunikation möglich. Nach dem ersten Durchgang wurde von einem Teilnehmer (per Tonband) ein akustisch deutlich erkennbarer epileptischer Anfall eingespielt, und es wurde die Zeit gestoppt, wie lange jeder andere Teilnehmer brauchte, um Hilfe zu holen, wenn er sich mit dem »Opfer« allein glaubte oder wenn er annahm, dass eine weitere Person mithörte, oder aber vier weitere Personen. Als etwa nach 60 Sekunden die Verbindung mit dem »Opfer« abbrach, hatten in der 2er-Gruppe 85 %, in der 3er-Gruppe 62 % und in der 6er-Gruppe nur 31 % der eigentlichen Versuchspersonen Hilfe organisiert.