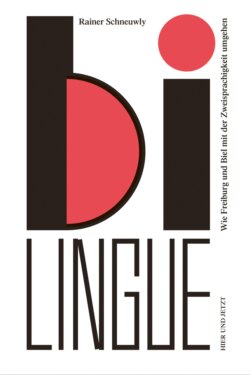Читать книгу Bilingue - Rainer Schneuwly - Страница 7
Alltagssprache Das Bieler und das Freiburger Modell In Biel ist es üblich, dass man auf der Strasse oder in einem Restaurant in der Muttersprache des Gegenübers angesprochen wird. Meistens passt man sich sprachlich an. Nicht so in Freiburg: Dort ist Französisch Trumpf. In den Läden geht das Personal davon aus, dass auch Deutschsprachige Französisch verstehen und sprechen.
ОглавлениеApril 2018 in Biel, in einem Warenhaus: «Bonjour», sagt die Verkäuferin zum Kunden. Dieser antwortet in Schweizerdeutsch, er suche einen Schreibblock. Die Verkäuferin antwortet in Hochdeutsch, Papeterieartikel befänden sich etwas weiter hinten im Laden, ungefähr dort, bei den weissen Regalen. Sie zeigt mit dem Finger in jene Richtung. Der Kunde geht hin, wählt einen Schreibblock und zahlt an der Kasse.
September 2018 in Freiburg, ebenfalls in einem Warenhaus: Ein Kunde fragt im Sensler Dialekt – das Senslerdeutsche ist die in und um Freiburg geläufige Variante des Schweizerdeutschen und hat seinen Namen vom Sensebezirk, der früher grösstenteils zur Stadt Freiburg gehörte – eine junge Verkäuferin, ob sie Deutsch verstehe. Die Frau schaut den Kunden entgeistert an und antwortet nicht. Sie hat offensichtlich nichts verstanden. Der Kunde nimmt einen zweiten Anlauf und formuliert sein Anliegen in Französisch, er suche ein Hemd mit kurzen Ärmeln. Ob es das zu dieser Jahreszeit noch gebe?
Diese kleinen Szenen sind auf den ersten Blick unbedeutende Ereignisse im Alltag der beiden Städte Biel und Freiburg. Doch sie sind für das Verhältnis von Deutsch und Französisch aussagekräftig. Sie zeigen nämlich auf, dass in Biel allgemein akzeptiert wird, dass es zwei Sprachen gibt, und dass es für die Kundin, den Kunden grundsätzlich möglich ist, in einem Laden in ihrer Muttersprache zu sprechen. In Freiburg hingegen wird vorausgesetzt, dass Deutschsprachige Französisch sprechen und fähig sind, ihren Wunsch in der Sprache Molières auszudrücken. Schafft der deutschsprachige Kunde das nicht, steht er vor einem Problem.
Wie die Verständigung in den zweisprachigen Städten Biel und Freiburg genau funktioniert, analysierte ein Team von Linguisten rund um die Professoren Bernard Py (Neuenburg) und Iwar Werlen (Bern) in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts mithilfe von angehenden Sprachwissenschaftlern.
Im Auftrag der Linguisten führten die Studierenden zuerst in Biel siebzig Gespräche durch. Sie fragten beispielsweise Passanten nach dem Weg oder liessen sich von Verkäuferinnen und Verkäufern zu einem Produkt beraten. Alle Gespräche wurden aufgezeichnet, fünfzig wurden ausgewertet. Die meisten Gespräche wurden in Französisch initiiert, denn man wollte wissen, wie im mehrheitlich deutschsprachigen Biel auf die Minderheitensprache reagiert wird und ob sie gegenüber dem Deutschen benachteiligt ist.
Wie im 2010 erschienenen Werk «Leben und Reden in Biel/Bienne»2 nachzulesen ist, bestätigten die Untersuchungen ein Verhalten, das in den 1980er-Jahren bereits der Sprachwissenschaftler Gottfried Kolde beobachtet und das er als «Bieler Modell» bezeichnet hatte. Gemeint ist, dass in Biel in der Regel jene Person die Sprache festlegt, die das Gespräch eröffnet: Unabhängig davon, welche Erstsprache die zweite am Gespräch beteiligte Person spricht, das Gespräch wird in der initiierten Sprache fortgesetzt.
Auf ihre Fragen auf Bieler Strassen und in Geschäften erhielten die Studierenden in 46 von 50 Fällen eine Antwort in jener Sprache, in der sie gefragt hatten. In 32 dieser 46 Fälle passte sich der oder die Befragte ans Französische an, in 11 Fällen an das Schweizerdeutsche und in 3 Fällen ans Hochdeutsche. Nur in 4 Fällen erfolgte also keine Anpassung. 20 Gespräche wurden nicht näher untersucht, weil sie zwischen Gleichsprachigen erfolgten: Die Studierenden stiessen auf Passanten oder Verkaufspersonal gleicher Muttersprache.
Die Sprachwissenschaftlerin und Philosophin Sarah-Jane Conrad schreibt zu diesem Resultat im erwähnten Werk, mit ihrer aktiven Verwendung beider Sprachen gestünden alle erwähnten 46 Personen ihrem Gegenüber immer auch das Recht auf die eigene Sprache oder gar auf Einsprachigkeit zu. «Denn mit der eigenen Anpassung zeigen sie, dass sie weder erwarten noch fordern, dass ihr Gesprächspartner die Partnersprache kennt.» Indem anderen das Recht auf Einsprachigkeit eingeräumt werde, untermauere man die prinzipielle Gleichbehandlung beider Sprachen zusätzlich und verankere sie beide wirksam und emblematisch im öffentlichen Raum.
Bei den Gesprächen in Bieler Läden galt als Initialsprache jene, welche die beziehungsweise der Studierende verwendete, also nicht jene, in der sie oder er von der Verkäuferin beziehungsweise dem Verkäufer angesprochen wurde: Eine Studentin betrat beispielsweise einen Laden und wurde von einem Verkäufer mit «Grüessech wou» begrüsst. Reagierte sie mit «Bonjour», quittierte dies der Verkäufer mit «Bonjour» – und weiter ging das Gespräch in Französisch.
Zwei Bielerinnen üben in einem «Sprachtandem» ihr Deutsch respektive Französisch mit der Hilfe des Gegenübers, das die fremde Sprache als Muttersprache spricht. So lernen beide. (Bild: Adrian Streun/Bieler Tagblatt)
Conrad folgert, das Bieler Modell setze voraus, dass Personen, die in Biel eine Dienstleistung anbieten, zweisprachig sein müssten: «Nur dann können sie sich wie beschrieben sprachlich anpassen.» Perfekte Sprachkenntnisse würden aber nicht vorausgesetzt. Es herrsche Toleranz und Pragmatismus.
Mit Pragmatismus ist etwa auch gemeint, dass es laut den Befragten in Biel gang und gäbe ist, mitten in einem Satz die Sprache zu wechseln, wenn jemand dazukommt, von dem man weiss, dass er oder sie Deutsch oder Französisch nicht beherrscht. «Sich bielerisch zu verhalten, heisst demnach nicht nur, sich im Gespräch mit Unbekannten diesen sprachlich anzupassen und so die Kommunikation überhaupt einmal zu ermöglichen», schreibt Conrad. Es gehe auch darum, im Alltag jene Sprache zu wählen, in der man ein Gespräch möglichst problemlos führen könne. Die Sprachwahl werde nur in den seltensten Fällen ausdrücklich thematisiert.
Die Linguistin spricht auch von einem «Bieler Sozialvertrag», der wie folgt lautet: «Jede Sprachgruppe akzeptiert und toleriert auf individueller wie kollektiver Basis die andere Sprachgruppe und macht für sich selber den gleichen Anspruch geltend.» Der Bieler Sozialvertrag besage also nicht, welche Sprache jemand zu sprechen habe, sondern mit welcher Haltung die Sprache gesprochen werden solle und wie sich die Beteiligten zu begegnen hätten: geprägt von gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz. «Diese drei Aspekte bilden den Kernpunkt der Bieler Kommunikation», so Conrad.
Der Welschbieler Journalist Jean-Philippe Rutz sagt, er beginne in Biel ein Gespräch, etwa wenn er im Restaurant etwas bestelle, grundsätzlich in Französisch. Schliesslich gelte es zu demonstrieren, dass Biel auch französischsprachig sei und dass Französischsprachige das Recht hätten, in ihrer Sprache bedient zu werden. Wenn sich erweise, dass das Gegenüber das Französische nicht beherrsche, sei er aber überhaupt nicht irritiert und wechsle ohne Umschweife auf Hoch- oder Schweizerdeutsch. Meistens wird Rutz, in Biel aufgewachsen, auf Französisch bedient.
Ich habe 2018 in Biel getestet, ob das Bieler Modell auch wirklich zur Anwendung kommt: Neun Mal betrat ich ein Geschäft oder eine Gaststätte und sprach jene Sprache, welcher sich die Verkäuferin oder der Kellner nicht bediente. In einem Warenhaus wurde ich mit «Grüessech, bonjour» begrüsst. Ich wählte nach der zweisprachigen Begrüssung Deutsch, was wir in der weiteren Unterhaltung fortführten. Resultat: In acht von neun Fällen passten sich die Gesprächspartnerinnen und -partner meiner Initialsprache an.
Nicht in meiner Sprache wurde ich einzig in einem Kiosk am Guisan-Platz bedient. Obwohl ich auf Französisch gesagt hatte, ich wolle diese Packung Kaugummi kaufen, sagte die Verkäuferin: «Drüsächzg» – das mache 3.60 Franken. Auch als ich mit einem Zögern eine zweite Aussage provozierte, wiederholte sie «Drüsächzg». Vielleicht missachtete sie das Bieler Modell, weil sie gerade in ein intensives Gespräch mit der deutschsprachigen Kollegin involviert war, als ich den Kiosk betrat. Und passte sich mir, dem Kunden, deshalb nicht an.
In Anlehnung an den Begriff «Bieler Modell» kann man von einem «Schweizer Modell» sprechen. Dies dann, wenn beispielsweise ein Italienischsprachiger auf einen Deutschsprachigen trifft, beide die andere Sprache mindestens passiv beherrschen und deshalb jeder in seiner Sprache sprechen kann. Auch dieser Begriff ist in der Linguistik eingeführt; ihn hat laut Conrad ebenfalls der Sprachwissenschaftler Gottfried Kolde in den 1980er-Jahren geprägt. Dieses Modell wird in den Eidgenössischen Räten verwendet oder in Sitzungen von überregionalen Unternehmen, die mehrsprachige Angestellte beschäftigen. Conrad sagt, das Schweizer Modell komme in Biel durchaus auch zur Anwendung. Sie zitiert etwa eine Informantin, die ihr berichtete, in ihrem Büro rede sie Deutsch, die Kollegin Französisch.
Geringere sprachliche Anpassung in Freiburg
Die Berner und Neuenburger Linguisten wollten in den Jahren 2000 bis 2004 eigentlich nur den Sprachgebrauch in Biel erforschen. Sie erhielten aber von etlichen Bieler Auskunftspersonen den Hinweis, in Freiburg unterscheide sich die Situation stark von jener in Biel. Das liess die Wissenschaftler aufhorchen und sie beschlossen, in der Saanestadt ebenfalls siebzig Gespräche durchzuführen. In Freiburg wurden die Interviews eher in Deutsch durchgeführt, um wie in Biel die Akzeptanz der Minderheitensprache zu testen.
Resultat: Erstens verweigerten in Freiburg mehr Personen das Gespräch als in Biel. Die Studierenden führten die Interviews jeweils mit einem versteckten Mikrofon durch – sowohl in Biel als auch in Freiburg –, waren aber aus rechtlichen Gründen gezwungen, unmittelbar nach dem Gespräch die Befragten darauf hinzuweisen und zu fragen, ob die Aufnahme verwendet werden dürfe.
Zweitens passten sich die Befragten in Freiburg nur in 22 der 70 durchgeführten Interviews der von den Studierenden gewählten Initialsprache an. Es kam somit in nur rund halb so vielen Gesprächen (in Freiburg 22; in Biel 46) zu einer Anpassung. Zahlreich waren die Situationen, in denen die Studierenden Deutsch sprachen, aber eine französische Antwort erhielten. «Nicht selten wurden unsere Mitarbeitenden auch direkt aufgefordert, ihre Kenntnisse des Französischen aktiv einzubringen und die Sprache zu wechseln. Die Anzahl Aufnahmen, in denen unsere Mitarbeitenden gebeten wurden, die Sprache zu wechseln, ist mit elf mehr als doppelt so hoch wie in Biel», schreibt Conrad.
Die Auswertung der Befragungen in Freiburg zeige, fährt Conrad fort, dass Französisch in Freiburg häufig unverzichtbar sei und französischsprachige Personen «ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die deutschsprachige Kundschaft oder ein deutschsprachiger Passant Französisch spricht oder dieses zumindest versteht». Anders als in Biel verweigere die französischsprachige Mehrheit in Freiburg somit der deutschsprachigen Minderheit das Recht auf Deutsch und folglich das Recht auf Einsprachigkeit – unabhängig davon, ob nun das Schweizer Modell verwendet oder der Kunde aufgefordert werde, die Sprache zu wechseln. «Hingegen fordert die französische Mehrheit dieses Recht für sich selber ein, wenn sie ein Deutsch redendes Gegenüber bittet, die Sprache zu wechseln. Die sprachlichen Rechte und Pflichten innerhalb der beiden Freiburger Sprachgruppen sind damit unterschiedlich verteilt.»
Die St. Michaelsgasse (Rue St-Michel) in Freiburg. In dieser Gasse, die zum Kollegium St. Michael und zur Universitäts- und Kantonsbibliothek führt, halten sich stets viele Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten auf. Entsprechend zweisprachig ist das Ambiente. (Bild: Charles Ellena)
In Anlehnung an das Bieler und das Schweizer Modell könnte man also von einem «Freiburger Modell» sprechen: Nicht die Initialsprache der Kundin, des Kunden ist entscheidend für die Fortführung des Gesprächs, Umgangssprache ist prinzipiell die lokale Mehrheitssprache.
Auch in Freiburg habe ich die aus den frühen Nullerjahren dieses Jahrhunderts stammenden Forschungsergebnisse stichprobenartig überprüft. In zehn Läden respektive Restaurants sprach ich das Personal in Senslerdeutsch an. Das Resultat dieser Stichproben ist natürlich nicht repräsentativ, es stimmt aber ziemlich gut mit den Erkenntnissen der Neuenburger und Berner Linguisten überein: In mehreren Fällen reagierte das Personal gar nicht auf mein Deutsch und forderte das Geld in Französisch ein. Allerdings beklagte sich niemand über mein Deutsch und niemand forderte mich auf, Französisch zu reden. Es ist aber ganz klar, dass man es sich in Freiburg einfacher macht, wenn man von Beginn an Französisch spricht. Ein Verkaufsgespräch ist meist eine Situation, in der nicht viel Zeit vorhanden ist. Es muss rasch gehen. Also traute ich mich beispielsweise nicht, in einer Bäckerei, wo Punkt zwölf Uhr mittags alle ein Sandwich wollten, den Deutschtest zu machen. Ich verlangte mein Brot auf Französisch.
Indem die Deutschsprachigen in Freiburg selbst stets Französisch sprächen, bestätigten sie die Stärke des Französischen in der Stadt noch, merkt Conrad an. Ihr ist im Übrigen aufgefallen, dass häufig weder die Aussprache noch das Vokabular oder die Syntax sonderlich deutsch geprägt sind, wenn Deutschsprachige in Freiburg Französisch parlieren. Mit anderen Worten: Sie sprechen im Allgemeinen gut Französisch.
Nicht selten merkt ein Französisch sprechender Deutschfreiburger im Gesprächsverlauf in einem Freiburger Laden aufgrund einer kleinen sprachlichen Unsicherheit oder anhand des Akzents, dass das Gegenüber deutschsprachig ist. Dann lacht man und setzt den Dialog in Deutsch fort.
André Perler, ein junger Deutschfreiburger Dialekt-Experte und Radiomacher, sagt, er spreche in Freiburg das Personal in Läden und Restaurants grundsätzlich in Deutsch an. Er signalisiere so, dass er als Deutschfreiburger in Freiburg das Recht habe, Deutsch zu sprechen. Sein Kollege Marco Koller, Lokaljournalist und Student, sagt meistens «Guettag, Bonjour» – und drückt damit aus, dass er deutschsprachig ist, signalisiert aber gleichzeitig Flexibilität. Es komme eben auch auf die Situation an, sind sich Perler, Koller und ein weiterer junger Freiburger, der Student Matthias Schafer, in einem Gespräch zu diesem Buch einig. In einer kleinen, von Französisch sprechenden Portugiesen betriebenen Bäckerei beispielsweise sei es nicht sinnvoll, auf Deutsch zu pochen. Verlangen könne man aber beispielsweise Deutschkenntnisse des Personals in einer grossen Institution wie der Post.
Koller und Schafer haben festgestellt, dass in Freiburg hin und wieder das Englische verwendet wird, wenn beispielsweise jemand mit französischer Muttersprache, der nicht gut Deutsch spricht, auf einen Deutschsprachigen trifft – doch das geschehe eher selten, sagt Koller. Er erzählt, ein Kellner in einer Freiburger Bar habe beispielsweise auf Englisch gewechselt, als dieser bemerkte, dass er das Gespräch für seine Deutschschweizer Kollegen von Französisch auf Deutsch übersetzte. Auch informiere die Verwalterin seines Mietshauses die Bewohner in Französisch und Englisch über gewisse Hausregeln, nicht aber in Deutsch.
Evelyne Zbinden, eine 36-jährige in Freiburg aufgewachsene Biotechnologin, erzählt, sie sei zusammen mit französischsprachigen Kindern aufgewachsen. Sie habe sich nicht daran gestört, dass sie sich sprachlich anpassen musste. Im Gegenteil, sie habe von der Zweisprachigkeit profitiert: Auf diese Weise habe sie kostenlos Französisch gelernt. Auffallend in Freiburg sei, dass in einer zehnköpfigen Gruppe mit einem Französischsprachigen alle zehn Personen Französisch sprächen, sagt sie. Die neun Deutschsprachigen passen sich an.
Florence Lagger, eine 39-jährige Restauratorin französischer Muttersprache, stammt aus dem Kanton Wallis und spricht sehr gut Deutsch. Sie hat in Freiburg einen Job gefunden. Auf die Frage, ob sie die Stadt zweisprachig wahrnehme, sagt sie, Freiburg sei für sie ganz klar französisch geprägt mit einer deutschsprachigen Minderheit.
Munteres Hin und Her in Biel und Freiburg
In Biel und Freiburg wird nicht nur Deutsch und Französisch respektive Deutsch oder Französisch gesprochen. Manchmal reden beide Sprachen beherrschende Bieler und Freiburger auch wild durcheinander Deutsch und Französisch. Der Welschbieler Journalist Jean-Philippe Rutz sagt, Sätze wie etwa «on schwenze» («wir schwänzen») oder «il s’est fait schlaguer» seien in der Schule früher gang und gäbe gewesen. Noch heute würden solche Sätze kreiert.
In Freiburg ist dieses Hin-und-her-Wechseln zwischen den Sprachen als «Bolz» bekannt. Ursprünglich galt es als «Sprache der Freiburger Unterstadt», es ist aber keine Sprache und auch kein Dialekt, sondern einfach ein Mix aus Senslerdeutsch und Französisch. Die dort lebenden Deutschsprachigen waren darauf angewiesen, gut Französisch zu sprechen, sie wuchsen in gemischtsprachigen Familien auf oder spielten in der Freizeit mit französischsprachigen Kindern. Sie waren – respektive sind – dermassen in beiden Sprachen «zu Hause», dass sie beide verwenden.
Die Freiburgerin Fränzi Kern-Egger hat das Bolz in zwei Büchern verewigt. Sie heissen «Üsa Faanen isch as Drapùù» («Unsere Fahne ist ein ‹drapeau›»; von frz. le drapeau, die Fahne) und «D Sùnenerschyy vam ‹Soleil Blang›» («Die Sonnenenergie des ‹Soleil Blanc›» – das «Soleil Blanc» ist ein Restaurant in der Freiburger Unterstadt).3
Kern-Eggers Geschichte «De Foppalmatsch» im erstgenannten Buch beginnt wie folgt: «Lösch Sùnntig bǜn i so gäg di öufi anni i ds ‹Tannöör› yy, bǜ det im en a Eggeli ùf en as Tabure ghocket ù han as Ggaaffi ù Le bschtöut. A Blätz wyt va mier syna zwee Ùnderstettler zäme ghocket. Bǜm ena Baalong Wyyssa hii si ùber e Foppalmatsch dysggüttiert, wa sich am Samschtig am Aabe zwǜschen ‹Etuaal-Spoor› ù ‹Ssangtral› ùf ùm Terraingj hinder de Gäärte derulii het.»
Fränzi Kern-Egger besuchte also an einem Sonntag gegen elf Uhr morgens das Restaurant Les Tanneurs in der Freiburger Unterstadt. In einer Ecke setzte sie sich auf einen Hocker (auf ein «tabouret», frz.) und bestellte einen Milchkaffee (Café au lait). Ein Stück weit entfernt von ihr sassen zwei Unterstädtler beieinander. Bei einem kleinen Glas («un ballon») Weisswein diskutierten sie über das Fussballspiel, das am Samstagabend zwischen Etoile-Sport und Central Freiburg – zwei Fussballklubs der Freiburger Unterstadt – ausgetragen worden war. Fränzi Kern-Egger spricht vom «Foppalmatsch», da für Fussball das französische Wort «le football» verwendet wird. Und das ü im Wort «dysggüttiert» steht da, weil Kern-Egger damit die französische Aussprache des Verbs diskutieren benützt. Der Match «s’est déroulé»; er fand statt, und zwar auf dem «Terraingj», also dem Fussballfeld mit dem Namen «Hinter den Gärten» an der Saane.
Das Bolz ist letztlich das, was Linguisten Code-Switching nennen und was etwa Secondos aus Italien praktizieren. Sie wechseln ja auch fliessend und innerhalb eines Satzes von Italienisch auf Schweizerdeutsch und zurück. Allerdings gibt es laut Fränzi Kern-Egger einige Bezeichnungen, welche man in der Freiburger Variante des Code-Switching nie je in Deutsch verwenden würde, etwa Eislaufen. Dafür wird der Begriff patiniere (von frz. patiner) verwendet. Für den Freiburger Germanisten Walter Haas überwindet dieser Umgang mit den zwei Sprachen die Sprachgrenze, oder besser: Er lässt die Grenze verschwinden.
«Biels Zweisprachigkeit schadet der Sprache!»
In den 1920er-Jahren wurde eine öffentliche Diskussion darüber geführt, ob die Zweisprachigkeit in Biel dem guten Deutsch oder dem guten Französisch schaden würde. Lanciert wurde die Debatte von den Redaktoren des Bieler Jahrbuchs im Jahr 1927. Das Bieler Jahrbuch ist ein Werk, in welchem seit gut hundert Jahren mehrere Autorinnen und Autoren Artikel zu aktuellen Themen publizieren. Die Jahrbücher enthalten jeweils auch die «Bieler Chronik», welche stichwortartig die wichtigsten Ereignisse chronologisch wiedergibt.
Grundtenor der Beiträge von Heinrich Emil Baumgartner (dem deutschsprachigen Redaktor der Ausgabe 1927) und Adolphe Kuenzi (dem französischsprachigen Redaktor) war, dass die Qualität der Sprache leidet, wenn Deutsch ständig auf Französisch trifft und umgekehrt.4 Bieler gingen in der Regel unbefangen mit Sprache um, mischten sorglos Deutsch und Französisch, so Baumgartner. «Das trägt die Hauptschuld, dass wir heute in Biel weder eine bodenständige Mundart, noch ein anständiges Schriftdeutsch und Französisch hören.»
Das französische Wort suche heute «unsere Bieler Sprache geradezu heim», fährt Baumgartner fort und bringt Beispiele für «deutsch-französische Redensarten» wie «es Faible ha» und «mach doch nit gäng söttigi Sottise» («Mach doch nicht immer solche Dummheiten»). In behördlichen Erlassen zeige sich «die starke Durchdringung des Schriftdeutschen mit französischen Wörtern» ebenfalls: «Die gemachten Bemerkungen sind zu notieren», «Er war wegen Indisposition ersetzt worden.»
Kuenzi bringt Beispiele für die schlechte, vom Deutschen beeinflusste Verwendung des Französischen, etwa «il veut pleuvoir» (berndeutsch: «es wott cho rägne», auf gut Französisch etwa «il semble qu’il va pleuvoir») oder «Tu m’es au chemin» («Du bist mir im Weg»). Kuenzi sieht durchaus auch Vorteile der Zweisprachigkeit, verteufelt sie keineswegs, verlangt aber – wie Baumgartner – nach einem besonderen Effort der Bieler bei der Pflege ihrer Sprache.
Der Einfluss der Zweisprachigkeit auf die Sprache der Bielerinnen und Bieler wird auch in Bieler Jahrbüchern späterer Jahre hin und wieder thematisiert, so etwa im Jahr 1981. In einem Beitrag dieses Jahrgangs ist die Rede von Übersetzungen wie «Entrée défendue» (für «Betreten verboten», auf Französisch eigentlich «Défense d’entrer» – «Entrée defendue» meint eher «Eintreten wird bekämpft»), «Danger de vie!» («Lebensgefahr»; auf Französisch üblicherweise «Danger de mort!»).5
«Mit tollkühner Selbstverständlichkeit» setzten Stadtangestellte deutscher Muttersprache immer wieder «die lustigsten französischen Sprachgebilde» in die Welt, schreibt der damalige städtische Übersetzer Jacques Lefert im Bieler Jahrbuch von 1992.6 Er stelle aber mit Befriedigung fest, so Lefert weiter, dass dies in Biel zu keinen wilden Auseinandersetzungen führe. «Toleranz […] wird am Jurasüdfuss gross geschrieben.»