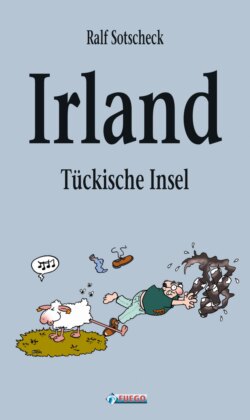Читать книгу Irland - Tückische Insel - Ralf Sotscheck - Страница 7
ОглавлениеHandwerker sind Vampire
Es war die Mutter aller Schiffskatastrophen. Und sie hatte ihren Anfang in Irland genommen. Die Titanic war der Stolz von Belfast. 1912 ist sie in die Geschichte geschwommen. Zunächst schwamm sie freilich in einen Eisberg. Vier Stunden später war von dem Schiff nichts mehr zu sehen. Nur 703 Menschen wurden gerettet, 1.503 starben. Mit Hilfe von Ultraschall hat man herausgefunden, dass es keineswegs ein großes Loch war, das dem in Belfast gebauten Kahn zum Verhängnis wurde, sondern lediglich sechs handbreite Risse.
Wie dem auch sei – das Boot ist längst zur Legende geworden, es gibt zahllose Bücher und Filme, von denen allerdings manche nicht den erhofften Profit einbrachten. »Hebt die Titanic« zum Beispiel war nicht nur grottenschlecht, sondern auch überaus teuer. Lew Grade, der Produzent, sagte damals, es wäre billiger gewesen, statt dessen den Ozean abzusenken. Auch das Broadway-Musical »Titanic« war nicht sonderlich erfolgreich. Die Generalprobe musste drei Mal wegen »technischer Schwierigkeiten« abgesagt werden: Das Schiffsmodell war im Gegensatz zu seinem Vorbild tatsächlich unsinkbar. Produzent Michael Braun erlebte das nicht mehr. Er war nach der ersten Probe an einem Herzinfarkt gestorben. Das gleiche Schicksal droht den Käufern einer CD mit Titanic-Liedern. Einer der Songs heißt: »Eis, Eis! O nein, o nein!« Oh nein.
Rund um den Globus sind Hunderte Titanic-Clubs gegründet worden. Die Ulster Titanic Society hält sich für die einzig authentische, weil sie in Belfast residiert. Schließlich, so sagen die Mitglieder, sei die Titanic hier länger als an irgendeinem anderen Ort gewesen. Abgesehen vom Meeresboden. War es aber damals gar kein Unglück, sondern ein Versicherungsbetrug? Vieles spricht dafür. Der Besitzer der Titanic, John Pierpoint Morgan, und seine Freunde sagten ihre Teilnahme an der Jungfernfahrt in letzter Sekunde ab. Viele von der Besatzung blieben ebenfalls an Land, weil sie angeblich Angst vor dem Schiff hatten. Und der Kapitän Edward Smith war ein Bruchpilot ersten Ranges: Er hatte bereits so viele Schiffe versenkt, dass man ihm eigentlich nicht mal ein Gummiboot anvertrauen durfte, geschweige denn das größte Schiff der Welt. Er soll denn auch trotz der Warnungen mit Volldampf in den Eisberg gerast sein.
Vermutlich lag es aber gar nicht an dem Kapitän, sondern an den irischen Handwerkern, die das Schiff gebaut hatten. Die kriegen alles klein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bei mir fing das Unglück damit an, dass ich mich bei der Kabelgesellschaft Cablelink über das erbärmliche Bild beschwerte. Noch am selben Abend stand ein schlechtgelaunter junger Mann vor der Tür und wollte ein neues Kabel ziehen. »Der Anschlusskasten unter dem Dach muss weg«, behauptete er. »Die Büsche davor stören den Empfang.« Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich über rudimentäre physikalische Kentnisse verfüge und seine Behauptung sofort als Lüge entlarven konnte. »Ich diskutiere nicht«, schnitt er mir jedoch das Wort ab. »Der Kasten kommt weg.«
Cablelink-Angestellte müssen wie rohe Eier behandelt werden: Ohne Kabel kann man nämlich weder die britischen Sender noch den Nachrichtenkanal empfangen. Der giftige Mechaniker genoss ganz offensichtlich seine Macht und schickte mich in die Küche zum Tee kochen, während er den Bohrer unten an der Hauswand ansetzte. Im nächsten Augenblick war es dunkel. Die Stille wurde nur durch leises Wasserplätschern unterbrochen. Der Tölpel hatte nicht nur das Stromkabel, sondern auch das Heizungsrohr unter dem Fußboden durchbohrt. Freilich wälzte er die Schuld sofort auf mich ab: »Da dürften gar keine Rohre verlaufen.« Das leuchtete mir ein. Ich hätte sie vorher beiseite räumen müssen. Wer konnte aber ahnen, dass der zerstörungswütige Mensch sich um 10 Zentimeter verschätzen und mit seinem Bohrer tief im Fußboden statt auf der anderen Seite der Wand landen würde?
Schließlich hatte er Erbarmen und holte Hilfe: Sieben Kollegen, die mir den Rat gaben, den Haupthahn zu schließen. Auf diese geniale Idee war ich bereits ohne ihr Zutun gekommen. »Mehr können wir heute auch nicht machen«, sagten die sieben einstimmig. Bei einer Tasse Tee, zubereitet auf dem Campingkocher, berieten sie über das weitere Vorgehen. Das Wasser hatte sich inzwischen unter den Teppichen im Wohnzimmer und Flur verteilt und arbeitete sich langsam bis ins Hinterzimmer vor. Bei jedem Schritt quietschte es leise. Am nächsten Morgen standen die »Magnificent Seven« wieder vor der Tür. Das Stromkabel war kein Problem, aber das Heizungsrohr war weitaus schwieriger. »Ich habe überhaupt nichts gegen Engländer«, sagte der teetrinkende Anführer. »Aber diese Heizung ist von einem Engländer eingebaut worden.« Das Reparatur-Hindernis bestand darin, dass in England metrische Rohre benutzt werden, während irische Rohre in Zoll gemessen werden. Ein Ersatzrohr gab es nur in Belfast.
Man wartete. Ich wusste längst, wer Tee und wer Kaffee bevorzugte, wer die Heißgetränke schwarz oder mit Milch zu sich nahm, und wieviel Zucker in die entsprechenden Tassen gehörte. Am Abend war es dann soweit, doch die Freude hielt sich in Grenzen: Das gesamte Heizungssystem war voller Luft. Es dauerte geschlagene drei Tage, bis es der Siebenerbande gelang, die Blähungen zu beseitigen. Der Besitzer des kleinen Ladens fragte mich, ob ich eine Pension eröffnet hätte, als ich am dritten Tag in Folge ein Päckchen Tee und ein Pfund Kaffee kaufte.
Der Fernsehempfang war danach schlechter als zuvor. »Das liegt an der Signalstäke«, erklärte der Cablelink-Täter. »Wir müssen das am Sender regeln.« Also war die ganze Verwüstung unnötig? »So kann man das nicht sehen«, sagte er. »An das neue Kabel kannst du sechs Fernseher anschließen.« Will ich aber nicht. »Dann sei getröstet: Der Empfang ist jetzt im gesamten Viertel schlecht.« Das ist die irische Lösung: Gleiches Recht für alle. Dabei hatte ich noch großes Glück gehabt, dass ich nicht in Limerick wohne. Die westirische Stadt ist für die nach ihr benannte Gedichtform bekannt. Außerdem hat Frank McCourt der Stadt mit seinem Buch »Die Asche meiner Mutter« ein Denkmal gesetzt, wenn auch ein wenig schmeichelhaftes, denn er hat Limerick als klerikalistisches Kaff dargestellt, in dem es ständig regnet. Im Rest des Landes ist Limerick hingegen als »Stab City« verschrien – als »Stadt der Messerstecher«. Die wahren Kriminellen sitzen dort aber offenbar in den Behörden.
John und Shirley O’Reilly kamen eines Tages aus dem Urlaub zurück und freuten sich auf einen entspannten Abend in ihrem neuen Haus in Limerick. Zu ihrer Überraschung fanden sie lediglich eine Wiese vor. Das Haus war weg, mitsamt Möbeln und persönlichen Gegenständen. Der Polizist, dem sie den Diebstahl ihres Eigenheims meldeten, tippte auf eine größere Verbrecherbande, denn so ein Haus sei ja nicht so leicht wegzuschaffen. Nachforschungen ergaben jedoch, dass die Stadtverwaltung das Haus abreißen ließ, weil die O’Reillys angeblich gegen die Bauauflagen verstoßen hatten. Man habe sie mehrmals gewarnt und den Abriss schriftlich angekündigt. Der Beamte wunderte sich allerdings, dass sie sich jetzt O’Reilly nannten. Die Briefe seien an Familie Murphy geschickt worden. Die Abrissfirma hatte sich in der Adresse geirrt und das falsche Haus dem Erdboden gleichgemacht. Haha, kleiner Zahlendreher, meinte der Beamte, kann ja mal passieren. Das fand John O’Reilly nicht. Er ist Jurist. Die Stadtverwaltung musste ihr Sparschwein schlachten.
Daran ist sie freilich gewöhnt. Fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor hatte die Straßenbaubehörde in Limerick vier kleine Landhäuser abreißen lassen, weil eine Autobahn gebaut werden sollte. Die Eigentümer waren zwangsenteignet worden – jedenfalls drei von ihnen. Die vierte, Mary O’Shaughnessy, war ebenso verblüfft wie die O’Reillys, als sie nach Hause kam und eine Geröllhalde vorfand. Sie hatte kurz zuvor mit der Renovierung des hundert Jahre alten Cottages begonnen, denn es stand der Autobahn ja nicht im Weg. Bei der Abrissfirma war man offenbar nicht in der Lage, bis drei zu zählen – ein typisches Problem: Die meisten irischen Handwerker stehen mit der Mathematik auf Kriegsfuß. Das hat oft fatale Folgen.
Áine, die Gattin, wünschte sich Morgensonne im Schlafzimmer. Leider spielte das blöde Himmelsgestirn dabei nicht mit. Es geht an der falschen Stelle auf: Die Sonnenstrahlen erreichen erst mittags das Zimmer, was für mich als Eule, wie Spätaufsteher im Fachjargon genannt werden, völlig ausreichend wäre. Áine hingegen ist eine Lerche, also eine Frühaufsteherin.
Das Ansinnen, mein Arbeitszimmer mit dem Schlafzimmer zu tauschen, wies ich aufgrund der Horrorvorstellung, mit Tausenden von Büchern umziehen zu müssen, kategorisch zurück. Stattdessen schlug ich törichterweise vor, ein Fenster in die Giebelwand einbauen zu lassen.
Ich gab meine Bestellung bei Kevin auf, dem örtlichen Vertreter einer großen Fensterfirma in Cork. Das Fenster solle 150 Zentimeter breit und 75 Zentimeter hoch werden, sagte ich. Er werde vorbeikommen, um nachzumessen, meinte er. Das sei völlig sinnlos, entgegnete ich, schließlich gebe es noch gar kein Loch in der Wand, da die Lieferzeit für das Fenster ja zwei Wochen betrage und man Einbrechern, fremden Katzen und dem Regen nicht unnötig Zeit geben sollte, ins Haus einzudringen.
Nach dreizehn Tagen rückten wir der Wand mit schwerem Gerät zuleibe. Am Abend war ein exaktes Loch gestemmt, während sich der Zementstaub im ganzen Haus und in den Schränken verteilt hatte. Mir begann zu dämmern, dass der Bücherumzug das kleinere Übel gewesen wäre. Am Abend rief ich Kevin an und fragte, wann das Fenster am nächsten Tag geliefert würde. Er erzählte mir daraufhin von seinem schwarzen Auftragsbuch und seinem Faxgerät, zwischen denen es offenbar ein Missverständnis gegeben hatte. Ich verstand kein Wort, ahnte aber, dass meine Bestellung es nicht bis zur Fensterfirma nach Cork geschafft hatte. Kevin wollte das nun umgehend mit Dringlichkeitsvermerk nachholen. Zehn Tage würde es dennoch dauern. Die verbrachte ich damit, ein Misteldrosselpärchen am Nestbau in dem für das Fenster vorgesehenen Loch zu hindern.
Neun Tage später rief ich wieder bei Kevin an. Der Monteur käme am nächsten Vormittag, versprach er. Abends um sieben tauchte er endlich mit dem Fenster unter dem Arm auf. Ich sah von weitem, dass schon wieder etwas schiefgegangen war. Das Fenster war 35 Zentimeter zu schmal. Der Monteur behauptete, genau so sei es bestellt gewesen, und verwies auf seinen Auftragszettel. Dort stand »1150 Millimeter«. Ich rief abermals bei Kevin an und berichtete ihm von dem Malheur. »Diese Idioten«, schimpfte er, »ich habe ihnen doch die exakten Maße durchgegeben. Natürlich musste ich sie vorher umrechnen, denn wir arbeiten mit Millimetern. Also habe ich eine Eins davor gesetzt.« Er meine wohl, er habe eine Null ans Ende gehängt, korrigierte ich. »Wieso eine Null?« fragte er. Irland ist seit vielen Jahren dezimalisiert, Kevin leider nicht. Die Morgensonne kommt nun etwas später als geplant ins Schlafzimmer. Damit ist niemandem gedient: Für eine Eule ist das immer noch zu früh, für eine Lerche ist es zu spät.
In dem völlig unbegründeten Vertrauen darauf, dass nicht jeder Besuch eines Handwerkers mit einer Katastrophe enden kann, beschloss ich, mir von einem Hobbytischler einen billigen Küchenschrank bauen zu lassen. Das Geld dafür war noch von der Entschädigung übrig, die Cablelink für die Überschwemmung nebst wochenlangem Heizungsausfall bezahlt hatte, die der Fernsehmonteur angerichtet hatte. Der Nachteil bei Schwarzarbeitern ist, dass sie nur an Wochenenden Zeit haben, so dass sich der Bau des Schränkchens sechs Wochen hinzog und das Sägemehl, das sich über sämtliche Lebensmittel verteilt hatte, fester Bestandteil des Speiseplans geworden war.
Dann sollte das Bauwerk doch noch fertig werden. Ich ahnte nichts Böses, als der Tischler mangels Babysitter sein Kleinkind mitbrachte. Kinder haben ein sicheres Gespür dafür, wie sie mit geringstem Aufwand die größtmögliche Wirkung erzielen. Die Kleine beförderte mit einem Fußtritt den Besen zur Seite, der die gesamte Schrankkonstruktion vorübergehend halten sollte. Und so brach alles zusammen und begrub den tischlernden Vater unter sich. In den Trümmern der Küche fand ich die Telefonnummer des fahrbaren Mittagstischs.
Manche Menschen werden aus Schaden klug. Ich gehöre leider nicht dazu. Eigentlich hatte ich nach all den Verwüstungen das Haus zur »No Go Area« für Handwerker erklärt. Ein paar Knoblauchzehen und eine Gießkanne voller Weihwasser sollten sie abwehren, denn Dublins Handwerker saugen ihre Opfer bis aufs Blut aus und richten ihr Werk der Vernichtung mit Vorliebe nach Einbruch der Dunkelheit an. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Dubliner Schriftsteller Bram Stoker durch die Vorfahren meiner Handwerker zu seinem Dracula-Roman inspiriert worden ist.
Doch dann ließ meine Wachsamkeit einen Moment nach, weil ich meinen Nachbarn erspähte, der auf der Motorhaube seines Autos stand und durch ein Fernglas sein Dach beobachtete. Oben kletterten zwei Männer herum und machten besorgte Gesichter. »Wir machen die Regenrinnen sauber«, erklärte einer von ihnen. »Das solltest du auch machen lassen, verstopfte Regenrinnen können böse Folgen haben.« Er kam die Leiter herunter und zeigte mir das Foto einer Ruinenlandschaft. »Daran sollen verstopfte Regenrinnen schuld sein?« fragte ich ungläubig, und er nickte bedeutsam. Inzwischen weiß ich, warum mir das Foto bekannt vorkam: Es war eine Aufnahme von Coventry nach dem Luftangriff der Nazis.
Jedenfalls willigte ich in die Reinigung der Dachrinnen ein, weil mir schon schwindlig wird, wenn ich auf einen Hocker steigen muss, um eine Glühbirne auszuwechseln. Damit sie an die hintere Dachrinne gelangen konnten, mussten die beiden Männer ihre Leiter durch das Haus zum Hintereingang tragen und dabei drei Ecken bewältigen. Das ging erwartungsgemäß schief: An der ersten fegten sie einen Blumentopf vom Regal, bei der zweiten zogen sie eine Furche in die Wand, und an der dritten Ecke musste ein Bilderrahmen dran glauben.
»Glücklicherweise haben sie beim Säubern der Regenrinnen bemerkt, dass zahlreiche Dachziegel lose waren«, erklärte mein Nachbar mir. »Sie haben die Ziegel festzementiert.« Offenbar ist das Problem weiter verbreitet, als man annimmt – die beiden Handwerker diagnostizierten auch bei mir lose Ziegel. Zum Beweis schwenkten sie ein paar davon durch die Luft und malten in düsteren Farben ein Bild der Zerstörung, das der Regen anrichten würde, falls ich den Schaden nicht umgehend reparieren ließe.
Das klingelnde Telefon hielt mich davon ab, einen weiteren Fehler zu begehen. Der irische Kollege am anderen Ende, dem ich von der verblüffenden Zerstörungskraft ungewarteter Regenrinnen erzählte, sagte, es sei doch ein Segen, wenn man seriöse Handwerker kennen würde. »Die unseriösen«, so fügte er unter Hinweis auf eine Fernsehdokumentation hinzu, »reißen dabei nämlich gleich noch ein paar Dachziegel heraus und erzählen ihren naiven Opfern, man müsse die Ziegel sofort einzementieren, um das Unheil abzuwenden.«
Vor Baumchirurgen warnte er mich leider nicht. Die Trauerweide vor dem Haus sei in erbarmungswürdigem Zustand, sagte der fremde junge Mann mitfühlend – viel zu dichte Äste, sie könne ja gar nicht atmen. Dann malte auch er ein Bild des Schreckens. Das gehört offensichtlich zur Grundausbildung für Handwerker. Über kurz oder lang werde der Baum umfallen und das Dach abdecken, sagte er. Oder, wenn er in die andere Richtung stürze, werde er eine Gruppe Schulkinder unter sich begraben. Möglicherweise knicke er auch zur Seite und verwandele den nagelneuen Kleinwagen der Nachbarn in einen Schrotthaufen. Egal, welches der drei Katastrophenszenarien eintrete, die Kosten würden mich jedenfalls unweigerlich in den Ruin treiben, ganz zu schweigen von der Gefängnisstrafe für kriminelle Vernachlässigung eines Baumes. Wer hätte gedacht, dass das harmlos scheinende Gewächs im Vorgarten in Wahrheit eine heimtückische Zeitbombe ist?
Dankbar nahm ich das Angebot der Baumrettung an, zumal der nette Herr nur 50 Euro Aufwandsentschädigung für seine Bemühungen haben wollte. Zufällig hatte er seine Kettensäge dabei. Er borgte sich meine Leiter und begann, im Baumwipfel herumzufuhrwerken. Ast um Ast fiel zu Boden, der Kettensägenbotaniker schien in einen Harzrausch zu geraten. Nach zwanzig Minuten war er fertig. Ich hatte natürlich angenommen, er würde die amputierten Äste mitnehmen, aber er dachte gar nicht daran. Für die Entsorgung musste ich einen Müllcontainer mieten. Kosten: hundert Euro am Tag.
Die beiden Fahrer, die das Stahlungetüm anlieferten, lachten sich schlapp beim Anblick des Baums, der wie ein begossener Pudel aussah. Hieß der Experte vielleicht Aengus, fragten sie. Nun ja, sein Akzent deutete auf diesen urschottischen Namen hin. Er sei bekannt, klärten mich die beiden Containerfahrer auf: Er habe bereits ganze Dubliner Straßenzüge in baumfreie Zonen verwandelt. Ich habe den Knoblauch und das Weihwasser inzwischen durch eine Selbstschussanlage und zwei Fangeisen ersetzt.
Seit die Handwerker Hausverbot hatten, lebten wir ruhig und zufrieden, ohne zu ahnen, dass die Saboteure im Blaumann einen Gegenschlag ausheckten, bei dem sie nicht mal das Haus betreten mussten. Es war an einem Freitag abend. Im Fernsehen kündigte der »Masked Magician« an, dass er den Zaubertrick mit der schwebenden Jungfrau enthüllen werde. Die Dame lag quer in der Luft, als es einen Knall gab, gefolgt von Stille und Dunkelheit. Waren das die Kollegen des Zauberers, die den Trickverrat verhindern wollten? Weit gefehlt, es waren die Klotzköpfe von der Stromgesellschaft, die das Hauptkabel bei Wartungsarbeiten sauber durchtrennt hatten, und weil ihnen das nicht genügte, musste das Fernsehkabel gleich mit dran glauben. Das ganze Viertel lag in Finsternis.
Inzwischen hatte auch die Einbruchsalarmanlage – wir wohnen in einer miesen Gegend – gemerkt, dass der Saft weg war. Dank eingebauter Batterie schnarrte sie nun alle zwei Minuten mit Roboterstimme: »Störung! Stromausfall um 20 Uhr vier.« Als ob das nicht nervtötend genug wäre, schickte die Sirene hoch oben an der Wand jedesmal zwei schrille Pfeiftöne hinterher. Ich montierte das quiekende Gerät ab und warf es in den Nachbarsgarten.
Dreieinhalb Stunden lang informierte uns der Alarmroboter im Zweiminutentakt, dass der Strom ausgefallen war, dann fügte er plötzlich hinzu: »Jetzt okay.« Das Licht ging wieder an, der Fernseher erst zwei Stunden später, aber da war der Zauberer längst im Bett, vermutlich mit der schwebenden Jungfrau, und wie der Trick funktioniert, werde ich nie erfahren.
Schlimmer war, dass beim Einschalten des Stroms in der Telefonzentrale die Sicherungen explodierten und zwei Dutzend Leitungen lahmgelegt wurden, darunter natürlich auch unsere. Der Notdienst, den ich per Handy anrief, erklärte, dass man im Notfall zwar Anrufe entgegennehme, aber an die Reparatur sei erst am Montag zu denken. Bis dahin würde er alle Anrufe aufs Handy umleiten. Montag rief er im Morgengrauen an. Ob ich es selbst sei, wollte der vermeintliche Kommunikationswiederhersteller wissen, und als ich bejahte, freute er sich: »Dann ist ja alles in Ordnung.« Gar nicht wahr, entgegnete ich, er selbst habe doch die Anrufe aufs Handy umgeleitet. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Nach vier Hausbesuchen und einem Kabelsalat drehte der Alarmroboter vollends durch und rief hysterisch nach seinen Sensoren, die an diversen Fenstern angebracht sind.
Das Kabel zum Haus sei tadellos, sagte der Störungsdienstler, alles andere sei mein Problem. Das Telefon funktionierte dann wochenlang nur in eine Richtung einwandfrei. Ich wurde heiser, weil ich immer ins Telefon brüllen musste, und halb taub, weil meine Gesprächspartner irrtümlich annahmen, sie müssten auch brüllen.
Als meine Leitung angeblich repariert war, hatte ich ein Meeresrauschen im Hörer, das der Kommunikation nicht gerade förderlich war. Schlimmer noch war, dass sich das Telefon bei dieser Episode offenbar in die Alarmanlage verliebt hatte. Wenn der eingebaute Anrufbeantworter sich einschaltete, fiel ihm die Alarmanlage beim ersten Satz ins Wort und rief mit Roboterstimme: »Bitte gib das Passwort ein.« Dann redete wieder der Anrufbeantworter. So unterhielten sie sich eine Weile und vernachlässigten dabei ihre eigentlichen Pflichten.
Der kugelrunde Telecom-Mechaniker rückte zuversichtlich mit einer Art Schuhkarton an, den er über der Scheuerleiste an die Wand schraubte. »Israelische Ware«, meinte er, »was Besseres ist nicht auf dem Markt. Deine Gesprächspartner werden denken, sie sitzen bei dir auf dem Schoß.« Dann sang er einen grauenhaften Schlager – bis er die Leitung testete. »Das ist vollkommen unmöglich«, stöhnte er. »Alle Testgeräte geben grünes Licht, die Leitung ist also theoretisch perfekt.« Praktisch aber nicht. »Hat jemand das Haus mit einem Fluch belegt?« fragte er argwöhnisch.
Er montierte den Schuhkarton wieder ab und erklärte, er werde nach der Mittagspause zurückkommen. Bis dahin sei die Leitung leider tot. Das war sie auch, aber das Telefon gab hin und wieder einen Piepser von sich. Plötzlich klingelte es ganz normal. Als ich mich meldete, fragte eine barsche Männerstimme: »Wer bist du?« Ich verriet es ihm, und er herrschte mich an: »Was machst du in meinem Haus? Und wo ist meine Frau?« Mein Einwand, dass er sich wohl verwählt habe, bügelte er ab: »Unsinn. Ich habe meine Nummer gewählt, sie steht ja hier auf meinem Telefonbildschirm.«
Ich legte entnervt auf, die Leitung war wieder tot, bis der Mensch erneut anrief. Diesmal war er richtig wütend: »Hole sofort meine Frau ans Telefon.« Ich sagte, sie sei vorhin mit dem Milchmann durchgebrannt, und ich sei der Makler, der das Haus verkaufen soll. Wahrscheinlich ist an diesem Tag irgend jemand in Dublin mit Affenzahn vom Büro nach Hause gerast.
Ich warnte derweil meine Mitbewohner, dass »die singende Eircom-Knalltüte mit der Kellertürstimme gleich wieder hier sein« müsse. »Ich bin schon hier«, antwortete er, »und dass ich nicht singen kann, weiß ich selber.« Ich hatte die Tür offen gelassen. Er hatte einen neuen israelischen Schuhkarton mitgebracht, schraubte ihn an die Wand – und rollte verzweifelt auf dem Fußboden herum. »Brummt wohl immer noch«, meinte ich mitfühlend. »Jetzt hört es sich an, als ob man in einen Haartrockner spricht«, kicherte er irre. »Dieses Telefon ist ein Fön.«
Nachdem sie ihn abgeholt hatten, gelang es seinem Kollegen, die Nebengeräusche zu beseitigen. Es war der einzige kompetente Handwerker, der jemals das Haus betreten hatte.