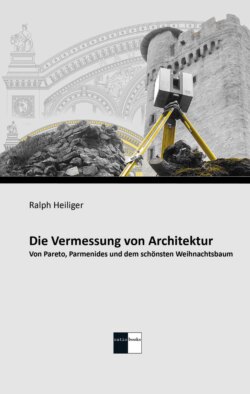Читать книгу Die Vermessung von Architektur - Ralph Heiliger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.01 Gutes Planen braucht gute Grundlagen
ОглавлениеStellen Sie sich vor, wir planen eine Reise mit dem Auto. Bis vor wenigen Jahren war das noch eine Herausforderung: Wir nahmen die Karte zur Hand, studierten das Kartenbild und überlegten uns eine Fahrtroute. Dann ging es los. Über die Autobahn – kein Problem. In der Stadt? Mit der Karte auf dem Schoß, den Finger auf der Stelle, wo wir gerade waren, und mit dem Auge wechselnd auf die Straße und dann wieder auf die Karte. Nicht selten verpassten wir die eine und andere Abfahrt. Manchmal staute sich hinter uns der Verkehr. Schön, dass es heute Navigationssysteme gibt. Da braucht man nicht lange in die Karte zu schauen. Wir stellen unseren Zielort ein, und das Navi weiß, wo wir sind, und berechnet selbständig, wie wir schnellstens an unser Ziel kommen. Selbst wenn wir uns zwischendurch verfahren, weiß unser Navi jederzeit, wo wir sind, und berechnet einen neuen Kurs. – Wissen wir, was da passiert?
Man sagt so schnell: GPS! Und denkt an die Satelliten, die da oben herumschwirren. Die wissen, wo wir sind. Und die führen uns zum Ziel. – Wenn das mal so einfach wäre. Was tun denn die Satelliten? Gar nichts! Die schwirren nur rum. Das einzige, was die tun, ist, uns ihre Position bekanntzugeben, ihre eigene! Was haben wir davon? Nun, wenn wir drei, vier oder auch mehr Satelliten empfangen, können wir aufgrund deren Position unsere eigene berechnen. Das ist Physik und ein bisschen Mathematik. Keine Hexerei. Jetzt kennen wir unsere Position. Und nun? Wissen Sie, wo Sie sich befinden, wenn Ihre Koordinaten lauten: X = 5 612 345 m und Y = 2 567 367 m? Stellen Sie sich Google-Maps vor, aber ohne Karte. Es gäbe nur eine weiße Fläche. Bei einer Reiseroutenplanung lägen Ausgangsort und Zielort in dieser weißen Fläche. Die Reiseroute wäre eine Reise durchs Nichts. Ohne Karte nützt uns das ganze GPS nichts. Die Karte bildet einen wesentlichen Teil unserer Reiseplanung. Erst mit der Karte ergibt unsere Position einen Sinn. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Mit dem kartierten Straßen- und Wegenetz kann unser Navi die Route berechnen. Wir können losfahren.
Auch ohne GPS sind wir früher ans Ziel gelangt, vielleicht über den einen oder anderen Umweg, weil wir gewisse Straßenschilder übersehen hatten. Oder weil uns das Kartenlesen schwer fiel. Heute, mit GPS, geht das alles viel einfacher. Wir sagen dem Gerät, wohin wir wollen, und es findet den Weg alleine. Wir haben ihm gesagt, wie es das machen soll, wir haben es programmiert. Kluge Köpfe haben die Technik entwickelt, Wissenschaftler und Ingenieure die Software programmiert. Und die Vermessungsingenieure haben eine wahre Fleißarbeit vollbracht: Sie haben in vielen Jahren und Jahrzehnten, ja in Jahrhunderten in mühevollen, akribischen Vermessungen eine Karte gezeichnet, ein maßstäblich verkleinertes und generalisiertes Abbild unserer Erde, mit Wegen und Gewässern, Ortschaften, Wald und Wiesen.
Die Karte bietet Orientierung. Sie verhilft uns gleichsam zu einem neuen Sinnesorgan. Wir erkennen Zusammenhänge, die wir ohne Karte nicht durchschaut hätten. Der Blick auf die Karte verrät uns, in welche Richtung wir uns bewegen müssen, um zum Ziel zu gelangen. Das ist das große Verdienst der Geodäten: Sie schaffen Bestandskenntnis! In jeder Beziehung. Ohne Vermessung keine Karte, kein GPS, kein Navigationssystem, aber ohne Vermessung auch kein Mondflug, keine Kenntnis über Kontinentaldriften und vieles mehr.
Nicht anders verhält es sich beim Planen im Bestand. Wer im Baubestand plant, wer Stützen und Mauern zugunsten einer neuen Nutzung verändern möchte, wer den neuen Anbau ohne Höhenversatz an den Altbau dransetzen möchte, wer Rücksicht auf Denkmaleigenschaften nehmen will, der muss seinen aktuellen Zustand kennen. Die Vermessung schafft Bestandskenntnis. Das Bauaufmaß liefert maßlich-geometrisch und inhaltlich exakte Grundlagen für das Planen im Bestand. Auf dieser Grundlage lässt sich analysieren, was erhalten werden kann, was verbessert werden muss und was abgerissen werden darf. So lässt sich gut planen.
Doch sei eine Frage erlaubt: Bedarf das Planen tatsächlich dieser Exaktheit? Bedeutet Planen nicht kreatives Entwerfen?! Kreativität braucht doch Freiraum? Auf die Frage des Journalisten, Kunst- und Architekturkritikers Hanno Rautenberg „Womit beginnt denn für Sie ein Entwurf?“, antwortet der amerikanische Architekt Greg Lynn: „Für mich ist immer die Frage, wie bewege ich mich in einem Haus, und was nehme ich wahr, wenn ich mich in ihm bewege? Man soll eine rhythmische Veränderung spüren, wie in einer Musik, die alle Elemente verbindet.“72 Und Peter Zumthor, schweizer Architekt und Denkmalpfleger, erklärt: „Wenn ich eine neue Bauaufgabe habe, einen neuen Ort, dann gehe ich hin, sehe mich um und beginne im Kopf mögliche Anatomien mit möglichen Materialien einzusetzen. Und ich schaue, welche Energien da zu fließen beginnen.“73
Entwerfen bedeutet unumstritten kreatives Schaffen. Allgemein wird Kreativität als ein irrationaler und inkonsistenter Prozess gesehen.74 Anschaulich hat es die Uni Weimar in ihrem Vorlesungsverzeichnis zur Architekturgeschichte geschildert: „Dichter schreiben selten darüber, wie sie schreiben. Ähnliches kann von Architekten gesagt werden: Wenn es heute in der Arbeit von Architekten noch so etwas gibt wie letztes auratisches Geheimnis, dann dürfte es der Akt des Entwerfens sein. Nun wird aber gerade diese Königsdisziplin, das Entwerfen mit samt den begleitenden Prozessen, in der Architekturgeschichte selten wahrgenommen. Dies verwundert kaum, denn fragt man Architekten genauer, wie sie bei ihren Entwürfen konkret vorgingen, erhält man meist recht nebulöse oder anekdotische Antworten: So soll etwa Alvar Aaltos Methode […] angeblich darin bestanden haben, ‚... mit kindlichem, vertrauensvollem – und genialem – Instinkt der Bleistiftspitze zu folgen, von Schnörkel zu Schnörkel, direkt hin zum Meisterwerk, wenn der Verstand längst benebelt von der soundsovielten Zigarette und dem letzten Whisky im Morgengrauen dahindöst.‘ “75
Ein Entwurf verläuft in verschiedenen Phasen. Zu Beginn werden Ideen gesammelt. Sie werden weiterentwickelt, geändert und mit neuen Ideen verknüpft. Verschiedene Entwurfsvarianten entstehen und werden verworfen. Sie sind bewusst vorläufig, nicht perfekt ausgearbeitet. Es ist die Phase der Handskizze. Die Handskizze kann spontan entstehen, ohne großes Equipment. Sie fördert das Herantasten, drückt den vorläufigen Charakter der Varianten aus. Form, Gestalt und Funktion bleiben in dieser Phase ungenau. Sie lassen Spielraum zur Interpretation. In seiner persönlichen Handschrift bringt der Architekt seine Gedanken zu Papier. Indem er die Linien mehrfach überzeichnet, findet er schließlich die gewünschte Kontur.76
Kreatives Entwerfen braucht Freiraum. Was sollen uns da exakte Daten bringen? Maßlich-geometrisch und inhaltlich exakte Grundlagen – für was? Für ein schnörkeliges, benebeltes Skizzieren? Sind exakte Daten nicht eher hinderlich als förderlich? Binden sie nicht den Architekten, der nicht allein Ingenieur, sondern zugleich Künstler ist? Bindungen sind doch jedem Künstler fremd?
Zuviel Wissen schränkt die Phantasie des Architekten ein. So schränken die DIN-Normen die Kreativität ebenso ein77 wie die Arbeit am Baudenkmal naturgemäß die schöpferische Kraft des Architekten bremst.78 Im Entwurfsstadium ist die Unschärfe groß. Exakte Daten stehen der Kreativität des Entwurfsprozesses entgegen.79 Exakte Bestandsdaten setzen Bindungen, die zum Zeitpunkt des kreativen Schaffens kontraproduktiv sind.
„Wie entwirft ein Architekt?“, fragt der Architekt Stephan Braunfels und erklärt: „Jeder hat seine eigene Technik. In den ersten Gesprächen mit dem Bauherrn werden die Rahmenbedingungen besprochen. Ein Modell entsteht im Kopf, eine Grundfigur, die immer wieder verändert wird. In vielen Schichten lege ich Skizzenpapier über den Lageplan und lote die Möglichkeiten der ersten Idee nach allen Richtungen aus.“80 Warum spricht Braunfels von „Rahmenbedingungen“ und „Möglichkeiten“? Weil sie selbstverständlich sind. Kreativität entsteht in Begrenztheit. Immer! Der Physiker und Nobelpreisträger Gerd Binning erklärt, man könne nicht kreativ sein, wenn man nicht zugleich begrenzt sei.81
Architekten sind in ihrem Entwurf nie frei! Ihre Kreativität entsteht stets in Abhängigkeit der Rahmensituation. Da ist der Bauherr mit seinen Wünschen und Vorstellungen, da ist das Planungsrecht, der Bebauungsplan, die Statik, der Brandschutz und die Energieeinsparverordnung und auch der Denkmalschutz mit seinen Bindungsplänen. Darin besteht gerade die Kunst des Architekten: in der Begrenztheit eine optimale Lösung zu schaffen. Das Bauen im Bestand definiert eine der größten Begrenztheiten.
Genügt dann nicht für den Entwurf ein einfaches Architektenaufmaß? Einige wenige wichtige Maße bilden eine ausreichende Basis für den Entwurfsprozess. Wofür dann noch ein weiteres, exaktes Aufmaß?
Planen und Entwerfen werden im täglichen Sprachgebrauch oft nicht klar unterschieden. Entwürfe stellen konzeptionelle und gestalterische Ideen dar. Sie sind Ausdrucksmittel, die das Konzept prägnant und ästhetisch vermitteln. Sie sollen Bauherren, Investoren oder Jurys bei Wettbewerben überzeugen. Ihre zeichnerische Darstellung unterliegt keinen speziellen Regeln, sie sind realistisch, können aber auch künstlerisch-abstrakt gehalten sein. Demgegenüber enthalten Planungen die Anweisungen zur Bauausführung. Sie sind spezielle zeichnerische Darstellungen von Bauplanungen.82 Wir sind bei der Umsetzung der kreativen Lösung angelangt: Aus der künstlerischen Darstellung wird die Konstruktionszeichnung, aus dem Entwurf die Planung.
Das Bauaufmaß ist nicht die Grundlage des kreativen Entwerfens. Das Bauaufmaß ist die Grundlage des Planens. Der Baubestandsplan ermöglicht die passgenaue Ausarbeitung des Entwurfs und gewährleistet die passgenaue Umsetzung der Planung in den Bestand. Das ist der Zweck eines Bauaufmaßes: Planen auf maßlich-geometrisch verlässlicher Basis, Simulieren von Planungsvarianten mit Realitätsbezug in der Gewissheit, dass die Planung in die Realität übertragbar ist.
Stimmige Pläne bringen Gewissheit. Mit der Gewissheit in der Planung folgen Terminsicherheit, Kostenstabilität in der Ausführungsphase, Imagegewinn für den Bauherrn. Überraschungen auf der Baustelle werden auf ein Minimum reduziert, mitunter auch ganz vermieden. Je besser die Planungsgrundlagen, desto besser die Planung. Gute Grundlagen ermöglichen gutes Planen.
Wollen Architekten denn auch gut planen können? Können sie wollen?