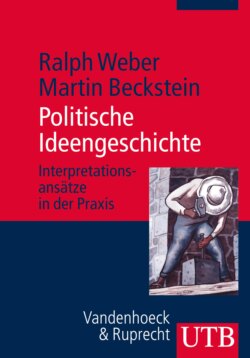Читать книгу Politische Ideengeschichte - Ralph Weber - Страница 10
ОглавлениеKapitel 1 Der analytische Ansatz: Am Beispiel des Federalist Paper Nr. 10
Der analytische Ansatz zur Interpretation von Texten der politischen Ideengeschichte – zuweilen auch Oxford Ansatz genannt – bedarf im Grunde nicht langatmiger Erläuterung. Er bezeichnet das, was wir ohnehin intuitiv tun zu müssen glauben, wenn wir uns einen Text nicht nur ansehen, sondern ihn wirklich studieren wollen. Anstatt das Geschriebene nur zu überfliegen und ein wenig in die Einleitung und den Schluss hineinzulesen, nehmen wir uns vor, genau zu betrachten, was die einzelnen Sätze des Texts besagen. Wir versuchen uns in die Lage zu bringen, den Text in eigenen Worten wiederzugeben, um dessen Inhalt uns selbst und anderen erklären zu können. Weil der analytische Ansatz vergleichsweise ebenso naheliegend wie theoretisch schlicht und praktisch einfach zu handhaben ist, findet er in Lehrbüchern wie Vorlesungen zur politischen Ideengeschichte (und Philosophie) nur selten Erwähnung.
Drei Gründe sprechen dennoch für eine systematische Darlegung des analytischen Ansatzes. Erstens kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedem völlig klar ist, wie gemäß dem analytischen Ansatz genau vorzugehen ist. Zweitens erachten unseres Wissens alle heutigen Fachexegeten von Texten der politischen Ideengeschichte den analytischen Ansatz als defizitär und legen ihren Arbeiten andere Interpretationsansätze zugrunde. Die genaue Kenntnis des analytischen Ansatzes ist also auch deshalb wichtig, weil wir sonst nicht wissen können, welche Grenzen unserer intuitiven Herangehensweise an Texte gesetzt sind. Schließlich ist die Kenntnis des analytischen Ansatzes für die ideengeschichtliche Interpretationspraxis deshalb von Vorteil, weil er Analysestrategien bereitstellt, auf die fast alle anderen Ansätze trotz ihrer Ablehnung des analytischen Ansatzes in „Reinform“ in der ein oder anderen Weise doch zurückgreifen.1
Der analytische Ansatz versteht Textinterpretation nach seinen Maßstäben als eine recht bescheidene Aufgabe. Es sollen lediglich im Text befindliche Fragen, Thesen, Argumente, Theorien und Antworten identifiziert werden. Die Aufgabe der kritischen Prüfung, ob die im Text identifizierten Fragen, Thesen, Argumente, Theorien und Antworten funktionstüchtige politiktheoretische Werkzeuge und somit für uns relevant sind, wird vom analytischen Ansatz nicht übernommen. Er verrichtet nur die notwendige Vorarbeit dafür. Er unterzieht die Texte einer deskriptiven Analyse, um eine systematische Diskussion zu ermöglichen. Vereinfachend gesagt wird ein Text zu verstehen gesucht, indem zerlegt, sortiert und zusammengefasst wird, was Schwarz auf Weiß im Text geschrieben steht.
1. Zur Theorie des analytischen Ansatzes
Der analytische Interpretationsansatz ist theoretisch und in der praktischen Anwendung maßgeblich durch Philosophen und Philosophinnen geprägt worden, die im 20. Jahrhundert an der Universität Oxford tätig waren. Ihr Beitrag bestand dabei nicht zuletzt darin, dass sie die „analytische Methode“ (die vorab durch Philosophen aus Cambridge wie G.E. Moore entwickelt wurde), auf den Bereich der politischen Philosophie übertrugen.2 Für die Interpretation von Texten bedeutete dies zunächst, dass man sich auf die sprachphilosophische Klärung von politischen Begriffen und den Nachweis konzeptueller Fehler und methodischer Missverständnisse beschränkte. In der Folge ging man aber dazu über, in weniger destruktiver Absicht die logische Verknüpfung der politischen Begriffe zu Argumenten und Theorien nachzuvollziehen und die Texte als Antwortversuche von politischen Autoren auf „permanente oder zumindest wiederkehrende Probleme der Philosophie“ zu deuten.3
Reflexionsbox 2: Überzeitliche Ideen
Der Begründer der Disziplin der politischen Ideengeschichte, Arthur Oncken Lovejoy, gab als Ziel der Disziplin das Studium von überzeitlichen Grundideen (unit ideas) aus. In detaillierten Analysen sollte die Geschichte dieser überzeitlichen Grundideen nachvollzogen werden, d. h. wie Begriffe (z. B. Recht, Freiheit, Vertrag) im Laufe der Geschichte bestimmt, modifiziert, mit anderen Begriffen kombiniert und artikuliert wurden.4 Die Vertreter des analytischen Ansatzes insistierten nicht unbedingt auf der Existenz von überzeitlichen Ideen, suggerierten aber wohl, dass sich einige Ideen (oder zumindest Fragen) als ziemlich langlebig erwiesen und sich historisch nur wenig verändert haben. Kritiker, die von einer stärkeren Beeinflussung von Autoren durch ihren historischen intellektuellen Kontext ausgehen, charakterisieren das Ideengeschichtsverständnis des analytischen Ansatzes deshalb überspitzt als fiktives Gespräch zwischen antiken, neuzeitlichen und modernen Autoren in einem zeitlosen Elfenbeinturm. Die Vertreter des analytischen Ansatzes entgegneten darauf nicht ganz zu Unrecht, dass die Klassiker der politischen Ideengeschichte in einen eben solchen überzeitlichen Dialog einzutreten gewillt gewesen scheinen. Die Vertreter des analytischen Ansatzes konnten ihnen somit in gewisser Hinsicht besser gerecht werden als ihre Kritiker, indem sie z. B. Hobbes als einen Menschen des 20. Jahrhunderts diskutierten, so wie Hobbes Aristoteles als seinen Zeitgenossen ansprach.
Für den analytischen Ansatz ist zentral, was in einem Text steht. Warum jemand den Text geschrieben hat, wer dieser Jemand war und welche Absichten dieser Jemand mit dem Text im Sinn hatte, wird konsequent ausgeklammert:
Manche meinen, um zu verstehen, was ein Mann sagte, müssten wir wissen, warum er es sagte. Das ist falsch. Wir müssen nur betrachten, wie er Wörter verwendete. Um Hobbes zu verstehen müssen wir nicht wissen, welchen Zweck er mit dem Leviathan verfolgte und was er über die rivalisierenden Ansichten der Royalisten und Parlamentarier dachte. Wir müssen nur wissen, was er mit Wörtern wie Recht, Freiheit, Vertrag und Verpflichtung meinte […] Ich beschränke mich [deshalb] darauf, was meine Autoren zu sagen haben und lasse die Ursprünge ihrer Theorien oder die Umstände, in denen sie entwickelt wurden, fast vollständig außer Acht.5
Um gemäß der Theorie des analytischen Ansatzes einen Text zu verstehen, braucht man also nicht den historischen Kontext, die Biografie des Autors, weitere Texte des Autors und seiner Zeitgenossen oder spätere Rezeptionen zu beachten; alles, was es herauszufinden gilt, steht im zu untersuchenden Text selbst.
Reflexionsbox 3: Aussagegehalt und Autorintention
Wenn wir über ideengeschichtliche Texte sprechen, sagen wir häufig so etwas wie „Im Text kritisiert Thomas Hobbes die Position Y“ oder „Was Hannah Arendt meint, ist Z“, wodurch die Person des jeweiligen Autors ins Spiel gebracht und suggeriert wird, dass entscheidend ist, was er oder sie beim Schreiben im Kopf hatte. In den Kopf eines Autors hineinzusehen ist naturgemäß schwierig. Verlässlicher scheint zu sein, darauf zu fokussieren, was ein Autor schrieb. Der analytische Interpretationsansatz beschränkt sich dementsprechend auf die Aussagen, die Schwarz auf Weiß in den Texten geschrieben stehen. Im Rahmen einer analytischen Interpretation geht es deshalb nicht darum, was Hobbes oder Arendt „eigentlich meinten“, sondern nur darum, welche Aussagen die Sätze ihrer Texte treffen.
Wie ist vorzugehen, wenn man einen Text für interpretationsbedürftig oder, mit Blick auf den analytischen Ansatz, analysebedürftig befunden hat? Drei Analyseschritte lassen sich unterscheiden: Die Analyse des Aussagegehalts, die Klärung der Begriffe und die Rekonstruktion der Argumente des Texts.
Im ersten Analyseschritt wird der inhaltliche Aussagegehalt des Texts identifiziert. Die Sätze eines Texts beherbergen dessen inhaltliche Aussagen, fallen aber nicht unbedingt mit diesen zusammen. Allerdings sind die Sätze der meisten Texte der politischen Ideengeschichte sehr wortreich und schließen Füllwörter, literarische Floskeln, rhetorische Wendungen und Umschreibungen mit ein, die dem Sprachrhythmus, der besseren Lesbarkeit oder effizienteren Überredung der Leser dienen, aber keine zusätzlichen, im engeren Sinn inhaltlich relevanten, Informationen liefern. Sie können deshalb gestrichen werden. Selbiges gilt für ganze Sätze, die beispielsweise bereits getätigte Aussagen wiederholen, zusammenfassen oder mit weitgehend überflüssigen Details und Beispielen ausschmücken. Sogar in extrem technisch anmutenden Traktaten können Streichungen geboten sein. Das bekannteste Beispiel stellt der Nachsatz an einen logischen Beweis „quod erat demonstrandum“ (was zu beweisen war) dar. Andere Sätze können durch Paraphrasierung stark gekürzt werden. Ein Beispiel aus Platons Der Staat mag dies illustrieren:
| Text | Aussagen |
| SOKRATES: Kannst du mir aber eine größere und heftigere Lust nennen als die, die man mit der Aphrodite verbindet? GLAUKON: „Nein“, versetzte er, „und auch keine wahnsinnigere.“ (403a) | A: Die mit der Aphrodite assoziierte Lust ist die stärkste Lust. |
Eine Herausforderung bei der Identifikation und Paraphrasierung des inhaltlichen Aussagegehalts eines Texts ist mitunter grammatischer Art. Allem voran gilt dies für Pronominalbezüge, denn häufig ist nicht eindeutig, auf welches Subjekt des Vorsatzes sich Pronomen (wie z. B. er, sie, es, dieser, jenes, etc.) beziehen. Beim Satz „Die Regierung, sagt die Kanzlerin, könne der Gesellschaft nicht helfen. Sie ist innerlich zerrissen“ ist unklar, auf wen oder was sich das Personalpronomen „sie“ bezieht, ob also die Regierung, die Kanzlerin oder aber die Gesellschaft zerrissen ist. Manchmal geben die zuvor oder danach stehenden Sätze Aufschluss über den Pronominalbezug. Wenn dies nicht der Fall ist, können nur Hypothesen aufgestellt werden, die sich eventuell im Zuge der Interpretation stützen oder zurückweisen lassen (A’: Die Regierung ist zerrissen; A’’: Die Kanzlerin ist zerrissen; A’’’: Die Gesellschaft ist zerrissen).
Sobald die Einzelaussagen des Texts identifiziert und so klar und knapp wie möglich aufgelistet sind, können die Hauptaussagen, die Leitfrage und das Untersuchungsergebnis des Texts bestimmt werden. Damit kann ein grober Überblick über die Argumentationsstruktur des Texts gewonnen werden.
Im zweiten Anaylseschritt klärt man die Begriffe des Texts, wobei solche im Vordergrund stehen, die unklar oder in politikphilosophischen Diskussionen umstritten (wie z. B. Gesetz, Verpflichtung, Freiheit) sind. Wenn der Text Definitionen dieser Begriffe bereitstellt, hilft das natürlich sehr. Zusätzlich müssen aber sämtliche Stellen, an denen die jeweiligen Begriffe vorkommen, auf Kohärenz und zusätzliche Definitionskriterien untersucht werden. Diese Parallelstellenstrategie kann zudem auf sehr ähnliche Begriffe oder andere Begriffe, die womöglich als Synonyme fungieren, ausgeweitet werden. Unmittelbar im Anschluss an den oben zitierten Textausschnitt aus Platons Der Staat wird so die mit der Aphrodite assoziierte Lust als die Liebe gekennzeichnet. Die Aussage des Textausschnitts kann deshalb durch die Begriffsbestimmung noch prägnanter reformuliert werden: „Die Liebe ist die stärkste Lust.“
Die Analyse der Aussagen und Begriffe dient der Vorbereitung des dritten Schritts, der Rekonstruktion der Argumente. Mit der Rekonstruktion der Argumente ist nicht gemeint, die im Text vorkommenden Argumente auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und zu korrigieren. Eine solche systematische Diskussion von Argumenten bietet sich zwar im Anschluss an die Interpretation eines Texts mit dem analytischen Ansatz an, ist aber nicht Teil davon. Bei der Rekonstruktion der Argumente geht es allein darum, die Aussagen des Texts, die Bestandteile von Argumenten sind, zu identifizieren und deren logischen Zusammenhang nachzuvollziehen.
Ein Argument besteht in der Regel aus mindestens zwei Prämissen und einer Schlussfolgerung. Zum Beispiel:
| Alle Menschen sind sterblich. | = Prämisse |
| Sokrates ist ein Mensch. | = Prämisse |
| Sokrates ist sterblich. | = Schlussfolgerung |
Selten werden Argumente in Texten der politischen Ideengeschichte so klar und geordnet präsentiert. Prämissen können nach der Schlussfolgerung nachgereicht und Schlussfolgerungen können als Behauptungen vorausgeschickt werden. Die erste Frage des dritten Analyseschritts richtet sich dementsprechend darauf, welche Aussagen als Prämissen und welche als Konklusionen fungieren. Auf Signalwörter der Logik ist hierfür besonders zu achten. Prämissen können durch Wörter wie „da“, „weil“, „insofern“ oder „wenn“ angezeigt werden und Schlussfolgerungen durch Wörter wie „also“, „daraus folgt“, „deshalb“ oder „dann“. Ebenso häufig wie (aus logischer Sicht) ungeordnete Argumente kommen unvollständige Argumente vor, bei denen eine logisch notwendige Prämisse unerwähnt bleibt (sogenannte Enthymeme) oder komplexe Argumente, die Zwischenschlussfolgerungen überspringen. Für die Rekonstruktion der Argumente des Texts kann es schließlich nützlich sein, die Typen der jeweiligen Argumente zu bestimmen. Handelt es sich z. B. um induktive oder deduktive Argumente, Analogien oder kausale Argumente.6
Infografik 1: Der analytische Ansatz
Der analytische Ansatz interpretiert einen Text, indem systematisch ausgewertet wird, was der Text inhaltlich und explizit aussagt.
Aus Gründen des Platz- und Zeitmangels wird man im Rahmen einer analytischen Interpretation nicht sämtliche fehlenden Prämissen und Schlussfolgerungen ergänzen und sämtliche Einzelargumente rekonstruieren können. Man muss also beurteilen, welche Argumente einer detaillierten Analyse unterzogen werden sollen und dem verbesserten Verständnis der Gesamtargumentation des Texts am meisten zuträglich sind.
2. Das Anwendungsbeispiel: James Madisons Federalist Paper Nr. 10
Den analytischen Ansatz wollen wir anhand des Federalist Paper Nr. 10 von James Madison illustrieren. Bei diesem Text handelt es sich um einen Kommentar zur Amerikanischen Verfassungsdebatte, der heute als eines der wichtigsten Dokumente der konstitutionellen Gründungsgeschichte der USA gilt. Veröffentlicht wurde der Artikel am 22. November 1787 in der Zeitung New York Packet unter dem Pseudonym „Publius“. Neben James Madison verwendeten auch John Jay und Alexander Hamilton dieses Pseudonym. Gemeinsam veröffentlichten sie zwischen Oktober 1787 und August 1788 insgesamt 85 Zeitungsartikel, um die Ratifikation des Amerikanischen Verfassungsentwurfs zu befördern. (Man bezeichnet sie als die Föderalisten.) Gegen Publius erhoben Autoren ihre Stimme, die ihrerseits unter Pseudonymen, wie z. B. Cato, Brutus, Centinel oder Federal Farmer schrieben (die sogenannten Anti-Föderalisten).
All dies muss uns aber im Folgenden nicht interessieren, denn der historische Kontext, die Biografie des Autors und die Rezeptionsgeschichte spielen beim analytischen Ansatz keine Rolle. Es geht nur um das, was explizit im Text geschrieben steht, die Interpretation erfolgt textimmanent. Wie zuvor dargelegt, muss deshalb im Folgenden lediglich der Aussagegehalt bestimmt und die zentralen Begriffe geklärt werden, um daraufhin die Argumente des Federalist Paper Nr. 10 rekonstruieren zu können.
3. Vom Wortlaut zum Aussagegehalt: Die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10
3.1 Untersuchungsziel und Hauptaussagen des Texts
Das Federalist Paper Nr. 10 ist weitgehend klar geschrieben, so dass der erste Analyseschritt – die Identifikation des Aussagegehalts – keine allzu großen Herausforderungen bereithält. Nehmen wir uns die ersten Zeilen des Texts im Detail vor. Zunächst filtern wir die Einzelaussagen („A“) aus dem Text heraus. Dabei heben wir sogleich uneindeutige Pronominalbezüge (durch eckige Klammern) und klärungsbedürftige Begriffe (durch Unterstreichung) hervor.
| Text | Aussagen |
| „Keiner der vielen Vorteile, die von einer sinnvoll aufgebauten Union zu erwarten sind, verdient sorgfältiger untersucht zu werden als der, mittels ihrer die Gewalt der Faktionen brechen und unter Kontrolle halten zu können. Nichts lässt den Befü rworter der Volksregierung so sehr um deren Ruf und Schicksal bangen wie das Wissen, welch starke Neigung zu diesem gefährlichen Laster ihr zueigen ist. Er wird deshalb jeden Plan gebü hrend zu wü rdigen wissen, der ein geeignetes Heilmittel dagegen bereitstellt, ohne dabei die Prinzipien zu verletzen, die fü r ihn bindend sind.“ (P1)7 | A1: Eine wohlgeordnete Union verspricht viele Vorteile. A2: Die Fähigkeit, die Gewalt der Faktionen zu unterbinden, ist ein solcher Vorteil. A3: Die Integrität und die Existenz von Volksregierungen wird durch [dieses] Problem gefährdet. A4: Volksregierungen sind für das Problem anfällig. A5: Befürworter von Volksregierungen streben nach einer Lösung für das Problem, die nicht die Prinzipien der Volksregierungen verletzt. |
Den unterstrichenen unklaren Begriffen (Union, Gewalt der Faktionen, Volksregierung, Prinzipien der Volksregierung) kann sinnvoll erst nachgegangen werden, sobald alle Aussagen des Texts identifiziert sind, da sich später möglicherweise Definitionen finden lassen. Zunächst gilt es die Einzelaussagen im Text zu Hauptaussagen zu komprimieren. Die fünf Einzelaussagen des zitierten Textausschnitts lassen sich aber vereinfachend unter folgender Überschrift zusammenfassen: Faktionen sind ein Problem für Volksregierungen. Aufgrund des grammatisch uneindeutigen Pronominalbezugs in A3 („dieses“) muss allerdings in Betracht gezogen werden, dass das Problem weniger in den Faktionen selbst, als vielmehr in einem bestimmten Aspekt von Faktionen, nämlich „der Gewalt von Faktionen“, besteht.
Hauptaussage Paragraf 1
Faktionen sind ein Problem für Volksregierungen.
Oder:
Die Gewalt, die von Faktionen ausgeht, ist ein Problem für Volksregierungen.
Im zweiten Paragrafen wird sehr wortreich ausgeführt, dass die Hauptkritikpunkte an der Amerikanischen Volksregierung zum Abfassungszeitpunkt – „Misstrauen gegenüber Verpflichtungen der öffentlichen Hand und das Bangen um private Rechte“ – auf den „Faktionsgeist“ zurückzuführen ist. Der dritte Paragraf reicht eine Definition von „Faktion“ nach und im vierten Paragrafen erweist sich, dass die Doppeldeutigkeit des Pronominalbezugs im ersten Abschnitt, die unklar ließ, ob das Problem in der Gewalt der Faktionen oder den Faktionen selbst besteht, beabsichtigt gewesen war, da nun zwei Vorschläge zur Problemlösung unterbreitet werden:
Es gibt zwei Methoden, das Übel der Faktion zu kurieren: erstens, durch Beseitigung ihrer Ursachen; und zweitens, durch Kontrolle ihrer Wirkungen. (P4)
Hauptaussage Paragraf 4
Das mit den Faktionen verbundene Problem kann gelöst werden, indem entweder die Bildung von Faktionen verhindert wird oder aber die Auswirkungen von Faktionen reguliert werden.
Die folgenden Paragrafen verfolgen zunächst den ersten Problemlösungsvorschlag und dann den zweiten. Wenn man das Übel an der Wurzel packen wolle und die Bildung von Faktionen verhindern möchte, könne dies nur dadurch geschehen, dass entweder die Freiheit der Bürger unterminiert wird oder alle Bürger dazu gebracht würden, dieselben Meinungen, Interessen und Leidenschaften zu teilen. Dieser erste Problemlösungsvorschlag wird daraufhin verworfen. Nimmt man sich stattdessen vor, nur die Auswirkungen des Problems zu regulieren, dann zeigt sich, dass das Problem im Rahmen einer Volksregierung tatsächlich nur bei Mehrheitsfaktionen besteht. Unterschiedliche Formen von Volksregierungen („reine Demokratien“ und „Republiken“) stellen wiederum unterschiedliche Möglichkeiten zur Regulierung der Effekte von Faktionen bereit, wobei auch die Anzahl der Bürger und die Größe des Territoriums relevante Faktoren seien. Die Diskussion wird durch die Aussage abgeschlossen, dass eine große Republik am Besten die Auswirkungen der Faktionen regulieren könne. Die Struktur der Gesamtargumentation des Texts, inklusive der Leitfrage der Untersuchung, kann damit wie folgt dargestellt werden:
Grobstruktur des Federalist Paper Nr. 10
Natürlich lässt es diese Darstellung nicht zu, sämtliche Einzelaussagen oder auch nur die Hauptaussagen wiederzugeben. Sie gibt lediglich einen Überblick über die thematische Anordnung des Aussagegehalts des Texts und bezeichnet somit nur die Zusammenfassung des Ergebnisses des ersten Analyseschritts, der aus der Identifikation aller Einzelaussagen, der Klärung von zweideutigen Pronominalbezügen und der Komprimierung auf Hauptaussagen besteht, so wie er am ersten Paragrafen im Detail durchgeführt wurde. Im dritten Analyseschritt – der Rekonstruktion der Argumente des Texts – werden wir nochmals genauer auf einige Einzel- und Hauptaussagen zurückkommen. Zuvor gilt es aber klärungsbedürftige Begriffe näher zu bestimmen.
3.2 Begriffsklärungen
Bereits im ersten Paragrafen sind uns einige klärungsbedürftige Begriffe aufgefallen: Union, (Gewalt der) Faktionen, Volksregierungen, Prinzipien der Volksregierung. In den folgenden Paragrafen kommt eine Vielzahl von weiteren klärungsbedürftigen Begriffen (wie z. B. Freiheit, Eigentum, reine Demokratie, Republik) vor und wir sind gezwungen, uns auf die Klärung jener Begriffe zu beschränken, die die größte Bedeutung für die systematische Rekonstruktion der Argumente des Texts haben. Dies sind Faktion, öffentliches Wohl und Republik.
Faktion
Der Begriff der Faktion ist von entscheidender Bedeutung für die Interpretation des Federalist Paper Nr. 10. Die Leitfrage des Texts zielt ja auf die Lösung des mit der Existenz von Faktionen verbundenen Problems ab. Die Bestimmung des Begriffs der Faktion wird dadurch unterstützt, dass der Text eine ausführliche Definition bereitstellt:
Unter einer Faktion verstehe ich eine Anzahl von Bü rgern, sei es die Mehrheit, sei es eine Minderheit, die von gemeinsamen Leidenschaften oder Interessen getrieben und geeint sind, welche im Gegensatz zu den Rechten anderer Bü rger oder den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft stehen. (P3)
Eine Faktion erfüllt gemäß dieser Definition drei Kriterien: (i) es handelt sich um eine Gruppe von Bürgern, (ii) die Gruppe teilt bestimmte Leidenschaften oder Interessen und (iii) die Handlungsabsichten der Gruppe sind mit den Rechten anderer Bürger oder den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft inkompatibel. Auch wenn die Definition weitgehend verständlich ist, verweist sie aufgrund des dritten Kriteriums auf eine weitere klärungsbedürftige Unterscheidung, nämlich die zwischen den Interessen einer Faktion und den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft. Bevor wir aber dieser Unterscheidung (über den Begriff des öffentlichen Wohls) nachgehen, gilt es erstens zu kontrollieren, ob die Verwendung des Begriffs der Faktion an anderen Stellen des Texts Aspekte miteinschließt, die über die Definition hinausgehen oder ihr widersprechen, sowie zweitens, ob im Text andere Begriffe im selben oder ähnlichen Sinn verwendet werden.
Im Hinblick auf Ersteres ist festzuhalten, dass der Begriff der Faktion an sämtlichen Stellen des Texts im Sinn der Definition verwendet zu sein scheint. Allerdings werden neben der Definition weitere, für die Begriffsbestimmung potenzielle relevante, Informationen gegeben, die untereinander nicht völlig harmonieren. Paragraf 9 beginnt damit, dass Faktionen letztlich von der menschlichen Natur herrühren („Die verborgenen Ursachen für die Entstehung von Faktionen liegen also in der menschlichen Natur“). Die Wortwahl in der Diskussion von konkreten Ursachen für die Bildung von Faktionen im Text suggerieren aber, dass Faktionen nicht essenziell mit der menschlichen Natur verbunden sind, sondern vielmehr von kontingenten Umständen abhängen. Faktionen entstünden beispielsweise solange Eigentum ungleich verteilt sei oder solange die Regierung die unterschiedlichen Fähigkeiten der Bürger, Eigentum zu erwerben, schütze (P8). Insgesamt seien Versuche, Faktionen zu unterbinden entweder unweise oder kaum realisierbar; als theoretisch unmöglich werden sie aber nicht bezeichnet (P7).
Im Hinblick auf Begriffe, die in ähnlichem Sinn wie „Faktion“ verwendet werden, fällt der Begriff der Partei auf. Zunächst wird auf den Unmut von amerikanischen Bürgern verwiesen, das öffentliche Wohl und die Rechte von Minderheiten würden zu oft in den Konflikten der rivalisierenden Parteien ignoriert (P2). Dies legt nahe, dass Parteien nicht identisch mit Faktionen sind, weil Faktionen ja definitionsgemäß – und nicht nur empirisch gesehen häufig – dem öffentlichen Wohl oder den Rechten von Bürgern entgegenstehen. An anderer Stelle aber werden Faktionen und Parteien gleichgesetzt: „So ist zu erwarten, dass die zahlenmäßig stärkste Partei oder mit anderen Worten: die mächtigste Faktion die Oberhand gewinnen wird“ (P11). Wie sich in diesem Zitat bereits andeutet, ist im Text eine leichte Begriffsverschiebung zu konstatieren, da Faktionen nach der Gleichsetzung mit Parteien zunehmend mit der größten oder dominanten Partei identifiziert werden. Doch diese Begriffsverschiebung scheint durch den Gang der Untersuchung gerechtfertigt zu sein, da in den Paragrafen 15 und 16 zu erkennen gegeben wird, dass nur Mehrheitsfaktionen ein Problem für die Volksregierung darstellen, da Minderheitsfaktionen aufgrund des Majoritätsprinzips in Schach gehalten würden.
Öffentliches Wohl
Für den Begriff des öffentlichen Wohls stellt der Text keine Definition bereit. Wir müssen uns daher Einsichten über die Bedeutung des Begriffs im Text durch die Parallelstellenstrategie erhoffen. Dafür sind zunächst alle Verwendungen des Begriffs „öffentliches Wohl“ relevant sowie weiter die Stellen an denen andere Begriffe synonym verwendet werden. „Öffentliches Wohl“ scheint im Text im selben Verständnis wie „Öffentliches Gut“, „Wohl des Ganzen“, „Gemeinwohl“, „ständige Gesamtinteressen der Gemeinschaft“ sowie ferner sogar „Erforderniss[e] der Gerechtigkeit“ oder „Gerechtigkeit“ verwendet zu werden, denn die Frage danach, was Faktionen ignorieren und verletzen, wird scheinbar austauschbar mit dem einen oder anderen Begriff beantwortet. Die Analyse des Begriffs der Faktion hat gezeigt, dass Faktionen (bzw. Parteien) immer (oder meist) das Wohl ihrer Mitglieder auf Kosten des Wohls anderer Bürger und der Gesamtgesellschaft zu vergrößern suchen. Dies impliziert, dass dominante politische Gruppierungen den Staat zur Förderung von ihren Partikularinteressen einspannen. Allerdings impliziert es auch, dass die anderen politischen Gruppierungen nur dadurch abgehalten werden, ihrerseits den Staat zu instrumentalisieren, da sie zahlenmäßig unterlegen sind. Faktionen rivalisieren um die Geltungsmacht ihrer jeweiligen Partikularinteressen. Worin besteht dann das öffentliche Wohl? Kann es dergleichen überhaupt als politiktheoretisch fassbare Kategorie geben, wenn, wie vom Text suggeriert, die Neigung zur Faktionsbildung in der Natur des Menschen liegt und Parteien nicht nur meistens, sondern notwendig das eigene Wohl über das anderer stellen? Welche Politik könnte anstatt auf der Förderung von Partikularinteressen auf das öffentliche Wohls ausgerichtet sein?
Aufgrund dessen, dass sich der Begriff des öffentlichen Wohls textimmanent nur vage bestimmen lässt, können nur unterschiedliche Hypothesen aufgestellt werden: Das öffentliche Wohl könnte die Summe sämtlicher rivalisierender Partikularinteressen bezeichnen. Für diese Hypothese spricht, dass der Begriff des öffentlichen Wohls anscheinend synonym mit dem Ausdruck „Gesamtinteresse der Gemeinschaft“ verwendet wird. Da die Partikularinteressen untereinander aber in Konflikt stehen und auch die Begriffe „Erfordernisse der Gerechtigkeit“ und „Gerechtigkeit“ synonym anmuten, könnte das öffentliche Wohl alternativ einen fairen Kompromiss zwischen den rivalisierenden Interessen bezeichnen. Dementsprechend findet sich im Text die Überlegung, dass sich eine politische Ordnung nicht auf die Anwesenheit von „aufgeklärten Staatsmänner“ verlassen könne, obschon diese imstande wären, die „widerstreitenden Interessen auszugleichen und sie alle dem Gemeinwohl dienstbar zu machen“ (P12).
Denkbar wäre aber auch, dass die gesellschaftlichen Gesamtinteressen utilitaristisch zu deuten sind, womit die Beförderung eines bestimmten Partikularinteresses unter Umständen den gesellschaftlich größten Nutzen verspricht und die Zurückstellung anderer Partikularinteressen legitimiert. Schließlich könnte das öffentliche Wohl aber auch gänzlich getrennt von den konkreten Interessen der einzelnen Bürger und Gruppierungen sein. Dem öffentlichen Wohl wäre dementsprechend mit einem libertären Minimalstaat gedient, der keinen Zweck außer der Gewährleistung von Individualrechten hat, so dass die Bürger ihre Zwecke (ausschließlich) privat verfolgen können. Gegen Ende des Texts steht dementsprechend, dass eine religiöse Sekte zu einer politischen Faktion degenerieren könne (P27), womit einerseits die spezifischen religiösen Überzeugungen von Gruppierungen legitimiert werden, solange sie privat ausgelebt werden, und andererseits die Illegitimität von Faktionen darin verortet wird, dass sie legitimen Privatinteressen öffentliche Geltung verschaffen wollen.
Republik
Der Begriff der Republik wird im Text wiederum definiert und zwar erstens mittels einer positiven Definition und zweitens mittels der Abgrenzung gegen die Regierungsform der Reinen Demokratie. Die Definition lautet: „Eine Republik hingegen, also eine Regierungsform mit Repräsentativsystem […]“ (P18). Die im Text vorgenommene Abgrenzung zur Reinen Demokratie offenbart, dass die Republik als eine Unterform der Volksherrschaft aufgefasst wird, in der die Bürger nicht wie in der Reinen Demokratie direkt mit Regierungsaufgaben betraut sind (P17). Stattdessen herrschen die Bürger nur indirekt durch Repräsentation, indem sie eine beschränkte Anzahl von Bürgern durch Wahl zu Volksvertretern bestimmen. Im weiteren Unterschied zur Reinen Demokratie ist die Republik aufgrund des Mittels der Repräsentation über ein größeres Territorium und eine größere Anzahl von Menschen ausweitbar (P19). Eine Republik kann damit hinreichend als repräsentative Demokratie (im Gegensatz zur direkten Demokratie) charakterisiert werden.
3.3 Rekonstruktion der Argumente
Nach der textimmanenten Bestimmung von zentralen Begriffen kann zur Rekonstruktion der Argumente des Texts übergegangen werden. Wiederum sind wir hier gezwungen, uns auf die Wichtigsten zu beschränken. Erstens das Argument, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen, und zweitens das Argument, dass das Problem der Faktionen nicht an den Ursachen angegangen werden kann; und drittens, dass repräsentative Demokratien die negativen Auswirkungen von Faktionen besser in den Griff bekommen als direkte Demokratien.
Argument 1: Faktionen sind ein Problem der Demokratie
Dass Faktionen ein Problem für Volksregierungen (bzw. Demokratien) darstellen, wird zu Beginn des Federalist Paper Nr. 10 behauptet. Im direkten Anschluss folgt die Begründung. Diese soll nun im Detail betrachtet werden. Dafür wird die Textstelle auf der Grundlage der tabellarischen Gegenüberstellung von Text und Aussagen, wie sie im ersten Analyseschritt erstellt (wenngleich nur anhand der ersten Zeilen des Texts illustriert) wurde, auf Prämissen und Schlussfolgerungen hin untersucht.
| Text (mit Auslassungen) | Aussagen |
| „Instabilität, Ungerechtigkeit und Konfusion waren, wenn sie in die öffentlichen Institutionen Einzug gehalten hatten, in der Tat die tödlichen Krankheiten, an denen die Volksregierung ü berall zugrunde gegangen ist. Zugleich sind sie nach wie vor ein beliebtes und ergiebiges Thema, aus dem die Gegner der Freiheit ihre am bestechendsten wirkenden Argumente beziehen. […]. Überall hört man die Klagen der besonnensten und ehrbarsten Bü rger, die sich ebenso sehr fü r öffentliche und private Redlichkeit einsetzen wie fü r die öffentliche und persönliche Freiheit, dass unsere Regierungen zu instabil sind, dass das Gemeinwohl in den Konflikten der rivalisierenden Parteien missachtet wird und dass zu oft Maßnahmen beschlossen werden, die nicht den Erfordernissen der Gerechtigkeit und den Rechten der Minderheit entsprechen, sondern nur aufgrund der größeren Macht einer interessengeleiteten und erdrückenden Mehrheit durchgesetzt werden. [… Solche Missstände] sind wohl hauptsächlich, wenn nicht sogar ausnahmslos Auswirkungen der Unbeständigkeit und Ungerechtigkeit, mit denen der Geist der Faktionen unsere öffentliche Administration vergiftet hat.“ (P1–P2) | A6: Instabilität, Ungerechtigkeit und Konfusion sind die Ursachen für das Scheitern von Demokratien. A7: Demokratiekritiker konstatieren der gegenwärtigen Ordnung eben diese Missstände. A8: Die tugendhaftesten Demokratiebefürworter konstatieren der gegenwärtigen Ordnung ähnliche Missstände. A9: Derartige Missstände sind Auswirkungen der Instabilität und Ungerechtigkeit. A10: Instabilität und Ungerechtigkeit sind Auswirkungen von Faktionen. |
Die zu Beginn des Federalist Paper Nr. 10 aufgestellte Behauptung, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen, soll durch die Aussagen A6 und A10 begründet werden. Vereinfacht stellt sich das Argument wie folgt dar:
| Argument 1a | |
| Instabilität und Ungerechtigkeit sind die Ursache für das Scheitern von Demokratien (A6). | = Prämisse |
| Faktionen verursachen Instabilität und Ungerechtigkeit (A10). der Demokratie. | = Prämisse |
| Faktionen bedrohen die Demokratie. | = Schlussfolgerung |
Das Argument ist – formal betrachtet – schlüssig. Die Konklusion folgt logisch aus den Prämissen. Wie überzeugend das Argument ist, hängt deshalb von der Plausibilität der beiden Prämissen ab. Während die Evaluation der Argumente erst der Gegenstand einer systematischen Diskussion des Federalist Paper Nr. 10 wäre, die an die (deskriptive) Analyse sich anzuschließen anbietet, ist bereits hier zu kontrollieren, ob der Text selbst die Prämissen untermauert. Die Aussagen A7, A8 und A9 sind hierfür nur bedingt ergiebig. Die Aussagen A7 und A8 fungieren lediglich als Prämissen für die unausgesprochene Konklusion, dass die gegenwärtige Demokratie an Missständen leidet, die in früheren Situationen zum Scheitern von Demokratien geführt haben.
| Argument 1b | |
| Instabilität und Ungerechtigkeit sind die Ursache für das Scheitern von Demokratien (A6). | = Prämisse |
| Die gegenwärtige Demokratie leidet an Missständen wie Instabilität und Ungerechtigkeit, und zwar gemäß Kritikern (A7) wie Befürwortern (A8) der Demokratie. | = Prämisse |
| Die gegenwärtige Demokratie ist vom Scheitern bedroht, wenn nicht sowohl die Kritiker wie die Befürworter der Demokratie falsch liegen. | = Schlussfolgerung |
Die Aussage A9 behauptet schließlich ohne weitere Begründung das kausale Verhältnis zwischen den von Zeitgenossen wahrgenommenen Missständen einerseits und der Instabilität und Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Regierung andererseits, ebenso wie die Aussage A10 einen kausalen Zusammenhang zwischen Instabilität und Ungerechtigkeit einerseits und der Existenz von Faktionen andererseits behauptet. Textimmanent lassen sich keine weiteren offensichtlichen Begründungen der Behauptung finden, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen. Denkbar scheint lediglich, dass der Begriff des Gemeinwohls – je nachdem wie er bestimmt wird (siehe 3.2) – eine Begründung ex negativo impliziert, weil das Gemeinwohl ja den Faktionen definitionsgemäß zuwider steht.
Argument 2: Das Problem der Faktionen kann nicht an den Ursachen behandelt werden
Für eine Lösung des Problems der Faktionen könne man, wie zuvor festgestellt (Hauptaussage 4), entweder an den Ursachen oder den Wirkungen von Faktionen ansetzen. Im Paragrafen 5 wird daraufhin ausgeführt, dass der ursachenorientierte Lösungsansatz untauglich ist und die Paragrafen 6–8 begründen diese Behauptung mit zwei Argumenten. Das erste Argument besagt, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für Faktionsbildung sei. Die Freiheit abzuschaffen wäre aber töricht.
| Text (mit Auslassungen) | Aussagen |
| „Bei keiner Methode könnte man mit größerem Recht sagen, dass das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit, als bei der erstgenannten. Freiheit ist fü r Faktionen, was die Luft fü r das Feuer ist: die Nahrung, ohne die es augenblicklich erlischt. Aber es wäre nicht weniger töricht, die fü r das politische Leben unverzichtbare Freiheit abzuschaffen, weil sie die Faktionsbildung nährt, als die Abschaffung der fü r das animalische Leben unentbehrlichen Luft zu fordern, weil sie dem Feuer seine zerstörerische Macht verleiht.“ (P6) | A11: Das Mittel zur Problemlösung ist schlimmer als das Problem. A12: Freiheit ist eine notwendige Bedingung für Faktionen. A13: Freiheit ist eine notwendige Bedingung für das politische Leben. |
Die analytische Herausforderung besteht zunächst darin, den Aussagegehalt der Analogie zu identifizieren. Es ist unerheblich, ob Freiheit Ähnlichkeiten mit Luft und Faktionen Ähnlichkeiten mit Feuer besitzen; worauf es ankommt, ist das analoge Verhältnis von einerseits Freiheit/Faktionen zu Luft/Feuer sowie andererseits Freiheit/politisches Leben zu Luft/animalisches Leben. Während die erste analoge Proportion für sich allein betrachtet den logischen Schluss impliziert, dass wir die Freiheit zerstören sollten, da sie Faktionen ermöglichen, versinnbildlicht die zweite analoge Proportion die Widersinnigkeit eines solchen Schritts: Weil Freiheit eine notwendige Bedingung nicht nur für Faktionen, sondern für das gesamte politische Leben ist, schütte der ursachenorientierte Lösungsansatz das Kind mit dem Bade aus.
Die Triftigkeit des Arguments hängt damit vor allem an der Richtigkeit der analogen Proportionen, sowie daran, ob die Aussage A13 eine plausible Prämisse darstellt. Die Textstelle betrachtet es als eine selbstevidente Wahrheit, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für Politik darstellt, was an sich eher zweifelhaft erscheint. Indem der restliche Text mitberücksichtigt wird, erweist sich aber, dass Freiheit, Politik und selbst Regierung in einen konzeptuellen Zusammenhang mit Demokratie gestellt werden – Demokratiekritiker werden z. B. als „Gegner der Freiheit“ bezeichnet (P1) –, so dass die Abschaffung der Freiheit als Mittel zur Beseitigung von Faktionen abgelehnt zu werden scheint, weil dadurch die Demokratie abgeschafft würde. Und wie zu Beginn des Texts erläutert, wird eine Lösung für das Problem der Faktionen gesucht, das mit den Prinzipien der Demokratie kompatibel ist (P1).
Auch das andere Argument hebt die Inkompatibilität des ursachenorientierten Ansatzes mit den Prinzipien der Demokratie hervor. Anstatt die Freiheit abzuschaffen, könne man das Problem zwar alternativ durch Gleichschaltung8 lösen – indem man „jedem Bürger dieselbe Meinung, dieselben Leidenschaften und dieselben Interessen verschafft“ (P5) – doch würde auch dadurch notwendig die Demokratie abgeschafft. Während die Behauptung nur Wenigen kontrovers erscheinen wird, ist die im Text gelieferte Begründung bemerkenswert. Denn abgesehen davon, dass es schwer realisierbar sei, die unterschiedlichen Meinungen und Leidenschaften (die Menschen nun einmal haben) anzugleichen, so Madison, dürfte eine Demokratie nicht die Eigentumsverhältnisse angleichen, die ihrerseits zur Ausprägung von unterschiedlichen Interessen führten (in P8–P10):
| Argument 2 |
| (1) Aufgrund von unterschiedlichen individuellen Begabungen gelingt es manchen Menschen besser als anderen, sich Eigentum anzueignen. |
| (2) Reiche Menschen haben andere Interessen als arme Menschen. |
| (3) Damit die Bürger eines Staats dieselben Interessen hätten, müsste das Eigentum gleich verteilt werden. |
| (4) Aber der Hauptzweck eines demokratischen Staats ist der Schutz der individuellen Begabungen (inklusive jener, die der Aneignung von Eigentum dienen). |
| (5) Folglich ist Gleichschaltung (durch Angleichung der Interessen) keine akzeptable Lösung für das Problem der Faktionen in der Demokratie. |
Argument 3: Das Repräsentationsmodell ist die Lösung zum Problem der Faktionen
Nachdem ursachenorientierte Lösungsansätze verworfen wurden, geht das Federalist Paper Nr. 10 zur Frage nach wirkungsorientierten Lösungsansätzen über. Faktionen seien in der Demokratie bei zahlenmäßig unterlegenen politischen Gruppierungen kein Problem, da der Angriff von Minderheitsfaktionen auf das öffentliche Wohl oder die Rechte Anderer durch das Majoritätsprinzip vereitelt wird (P14). Mehrheitsfaktionen hingegen stellen ein Problem dar, da sie durch das Majoritätsprinzip gerade zur politischen Gestaltung ermächtigt werden (P15). Die entscheidende Frage ist also, ob demokratische Systeme eine Lösung für das Problem der Mehrheitsfaktionen haben.
Reine Demokratien, in denen alle Bürger direkt an der Regierung beteiligt sind, heißt es daraufhin, verfügten im Gegensatz zu Republiken über keinen institutionellen Schutzmechanismus (P17–P18). Wie ist diese Behauptung begründet? Weshalb können Republiken besser die Auswirkungen von Mehrheitsfaktionen kontrollieren als Reine Demokratien? Paragraf 19 rekapituliert zwei Unterschiede der beiden Typen von Volksregierungen. In den Folgeparagrafen werden daraufhin die institutionellen Vorteile von Republiken für die Kontrolle der negativen Effekte von Mehrheitsfaktionen diskutiert.
Der erste Unterschied zwischen Republiken und Reinen Demokratien ist, dass in der Republik die Bürger nicht direkt sondern nur mittels Repräsentanten an der Regierung beteiligt sind. Im besten Fall würde die Weisheit der Repräsentanten als Filter dienen, durch welchen die eigenwilligsten Meinungen, Leidenschaften und Interessen der einzelnen Bürger aus dem politischen Prozess herausgehalten oder zumindest abgeschwächt werden könnten. Im schlechtesten Fall aber würden sich besonders bornierte und hinterlistige Menschen erst die nötigen Wählerstimmen erschleichen, um dann die Interessen der Bürger zu betrügen (P20). Zwar ermögliche die Feinjustierung des Verhältnisses von Anzahl von Repräsentanten zu Anzahl von Bürgern die schlechten Fälle zu minimieren (P22– P23), doch könne nicht gänzlich verhindert werden, dass sich das Instrument der Repräsentation manchmal verschärfend auf das Problem der Mehrheitsfaktionen auswirke.
Dem zweiten Unterschied wird deshalb mehr Relevanz attestiert. Republiken seien Reinen Demokratien bezüglich der Kontrolle von Mehrheitsfaktionen überlegen, weil sie sich über eine größere Spannweite des Territoriums und Anzahl der Bürger erstrecken lassen:
| Text | Aussagen |
| Je kleiner eine Gemeinschaft ist, umso geringer wird wahrscheinlich die Zahl der Parteien und Interessengruppen sein, aus denen sie sich zusammensetzt. Je geringer die Zahl der Parteien und Interessengruppen, um so eher wird eine Partei die Mehrheit erringen. Und je kleiner die Zahl der Individuen, die eine Mehrheit bilden, und je kleiner der Bereich, innerhalb dessen sie operieren, umso leichter werden sie zu einer Einigung gelangen und ihre Unterdrü ckungsabsichten ausfü hren können. Erweitert man den Bereich, so umschließt er eine größere Vielfalt an Parteien und Interessengruppen. Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, daß eine Mehrheit ein gemeinsames Motiv hat, die Rechte anderer Bü rger zu verletzen. Wenn aber ein solches gemeinsames Motiv besteht, wird es fü r alle, die es teilen, schwerer, sich der eigenen Stärke bewusst zu werden und gemeinsam zu agieren. (P25) | A14: Je kleiner das Territorium und die Anzahl der Bürger, desto weniger politische Splittergruppen. A15: Je weniger politische Splittergruppen, desto leichter kann eine Gruppierung zur Mehrheitsfaktion werden. A16: Je kleiner das Territorium und die Anzahl der Bürger, desto leichter können Allianzen geschmiedet werden. A17: Wh. A14. A18: Wh. A15. A19: Wh. A16. |
Die sechs Aussagen A14–A19, die zur Begründung der Behauptung dienen, dass Republiken aufgrund der größeren Spannweite des Territoriums und der Anzahl der Bürger Vorteile im Umgang mit Mehrheitsfaktionen gegenüber Reinen Demokratien haben, können auf drei reduziert werden, da die drei Vergleichssätze in der Form von drei Konditionalsätzen mit (nahezu) identischem propositionalen Gehalt wiederholt werden. Die Aussagen A14 und A15 (bzw. A17 und A18) liefern dabei eine Begründung, die Aussage A16 (bzw. A19) eine zweite.
Republiken sind Reinen Demokratien im Hinblick auf die Kontrolle der Auswirkungen von Mehrheitsfaktionen weniger aufgrund der Institution der Repräsentation überlegen, sondern aufgrund der Größe des Territoriums und der Anzahl der Bürger, die jeweilige Staaten umfassen kann. Der letzte Argumentationsschritt des Federalist Paper Nr. 10 wendet diese Einsicht analog auf Republiken selbst an: Große Republiken können die Bildung von Mehrheitsfaktionen und deren partikularistische Machenschaften besser als kleine Republiken hemmen (P26).
4. Möglichkeiten und Grenzen des analytischen Ansatzes
Der analytische Interpretationsansatz erlaubt es, die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10 durch die Analyse dessen, was wörtlich im Text ausgesagt ist, zu rekonstruieren. Die Interpretation geht über eine textimmanente Klärung der Aussagen und deren argumentative Anordnung nicht hinaus. Während hier einige Stellen übersprungen und Begriffsklärungen weggelassen werden mussten, kann man sich das Ergebnis einer vollständigen analytischen Interpretation des Federalist Paper Nr. 10 ohne allzu große Vereinfachung als eine prägnantere, genauer formulierte, klarer strukturierte – und damit aus analytischer Sicht: bessere – Version des Texts vorstellen. Wenn die textimmanente Klärung der Aussagen des Federalist Paper Nr. 10 und deren argumentativer Anordnung richtig und vollständig durchgeführt wurde, gäbe es aus analytischer Sicht keinen Grund, weshalb Studierende sich überhaupt noch den Originaltext vornehmen sollten – es sei denn zum Zweck der Einübung des analytischen Ansatzes.
Durch den Fokus auf die Argumente eines Texts bereitet der analytische Ansatz die weiterführende theoretische Reflexion über Politik sehr gut vor. Er hilft uns Argumente zu identifizieren, die wir in heutige Diskussionen z. B. über die Vor- und Nachteile von direktdemokratischen und repräsentativen Mechanismen einbringen können. Auch lädt er dazu ein, im Rahmen einer systematischen Diskussion die im Text vorgebrachten Argumente auf Plausibilität zu prüfen, weiter zu entwickeln oder zu modifizieren. Um den in Argument 2 vorgebrachten starken Zusammenhang zwischen unreguliertem Eigentumserwerb und Demokratie (bzw. freiheitlicher Ordnung) zu untermauern, könnte beispielsweise auf Robert Nozicks Anarchie, Staat, Utopia zurückgegriffen werden. John Rawls’ Eine Theorie der Gerechtigkeit böte sich dahingegen für eine Entgegnung an.
Bei der Analyse eines Texts kommt man kaum um den analytischen Interpretationsansatz umhin. Die meisten anderen ideengeschichtlichen Interpretationsansätze zielen dementsprechend auch auf die Aneignung des argumentativen Inhalts eines Texts ab. Allerdings wird sich in den folgenden Kapiteln zweierlei zeigen: Erstens wird weniger Wert auf eine akribische textimmanente Analyse des Aussagegehalts, der Begriffe und Argumente gelegt. Zweitens wird in der textimmanenten Analyse nur ein erster Analyseschritt gesehen, dem andere, nicht textimmanente Analyseschritte folgen müssen, um die Bedeutung des Texts wirklich zu verstehen. Es wird also davon ausgegangen, dass der analytische Ansatz allein unzureichend für eine adäquate Interpretation ist.
Eine Grenze des analytischen Ansatzes, die hinsichtlich des Federalist Paper Nr. 10 ins Auge springt, ist die (willentliche) Ignorierung von Rhetorik. Von den stilistischen Mitteln, mit denen ein Autor seine Leser für seine Ansichten zu gewinnen versucht, wird bei der analytischen Rekonstruktion der Argumente ja abstrahiert, aber die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10 lebt nicht zu geringem Anteil gerade davon, dass der Text ein rhetorisches Meisterwerk ist. Am Deutlichsten zeigt sich dies vielleicht durch den rhetorischen Ausschluss von alternativen Lösungsmöglichkeiten: Das Problem der Faktionen könne nur über die Ursachen oder Wirkungen gelöst werden – wieso aber sollte es unmöglich sein, an den Faktionen selbst anzusetzen und beispielsweise bestimmte Arten von Faktionen (die z. B. verfassungsfeindliche Positionen vertreten) zu verbieten?9
Damit verbunden ist eine zweite Grenze, nämlich die Nichtberücksichtigung des historischen Kontexts. Warum machte sich Madison die Künste der Rhetorik zunutze und bemühte sich nicht, seine Argumente maximal klar und transparent zu präsentieren? Nun, wahrscheinlich weil er überzeugen wollte, und zwar weniger das Tribunal der universellen Vernunft, als vielmehr konkrete Zeitgenossen – eben jene, die im Staat New York über die Annahme oder Ablehnung des Amerikanischen Verfassungsentwurfs zu entscheiden hatten. Die Betrachtung dieser Motivation zur Abfassung des Texts beeinflusst die Interpretation maßgeblich. Es wird ersichtlich werden, dass der letzte, marginal wirkende Argumentationsschritt, in dem analog große Republiken gegenüber kleinen bevorzugt werden, der entscheidende ist. Gegner der Amerikanischen Verfassung (die Anti-Föderalisten) hatten nämlich argumentiert, dass die Schaffung einer föderalen Republik der Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund ihrer Größe zum Scheitern verurteilt sei. Madison widmet sich dem Problem der Faktionen deshalb wohl weniger, weil er sich für das „überzeitliche“ politiktheoretische Problem der Faktionen interessierte, als mehr deshalb, weil er so ein Argument für eine möglichst große Republik auf dem Amerikanischen Kontintent konstruieren konnte. Entscheidend ist, dass sich durch die Miteinbeziehung des historischen Kontexts das Verständnis der Leitfrage des Texts verändert. Anstatt der Frage, wie das Problem der Faktionen gelöst werden kann, wird untersucht, was für die Ratifizierung des Verfassungsentwurfs spricht. Im Federalist Paper Nr. 2 – das ebenfalls unter dem Pseudonym Publius veröffentlicht, wenngleich von John Jay geschrieben, wurde – gibt es bezeichnenderweise gar kein Problem der Faktionen. Amerika, heißt es dort, bietet optimale Voraussetzung für eine vereinte Union, weil es „ein vereintes Volk [hat] – ein Volk, das von denselben Ahnen abstammt, dieselbe Sprache spricht, sich zu demselben Glauben bekennt“, etc.10
Die Konzentration auf den isolierten Text in seinem Wortlaut kann also dazu führen, dass wir zwar verstehen, was im Text geschrieben steht, aber nicht, welche Sicht der Text im historischen Kontext legitimiert hat und worum es dem Autor eigentlich ging. Wenn das Plädoyer für eine große Republik, wie gesagt, gar nicht die Schlussfolgerung einer zunächst ergebnisoffenen Untersuchung über das Problem der Faktionen, sondern von vorneherein der Zweck des Federalist Paper Nr. 10 war, fragt sich, was das Plädoyer für eine große Republik letztlich motivierte. Charles Beard, der das Federalist Paper Nr. 10 als einer der ersten aus ideengeschichtlicher Warte interpretierte, argumentiert z. B., dass sich Madison von der Ratifizierung der Amerikanischen Verfassung vor allem die Festigung der ökonomischen Oberklasse erhoffte.11
Ein anderes Beispiel als das Federalist Paper Nr. 10 macht die Gefahr des Missverständnisses der Bedeutung eines historischen Texts, die dem analytischen Ansatz immanent ist, noch deutlicher. Wie allgemein bekannt ist, wurde Galilei von der Römischen Inquisition zum Widerruf seines Dialogo über das ptolemäische und das kopernikanische Weltbild aufgefordert, der einen Beweis dafür zu liefern beansprucht, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Galilei widerrief vor Gericht, doch glaubten schon damals nur die Wenigsten, dass er dies aus eigener Überzeugung tat. Gemäß einer Legende soll Galilei deshalb beim Verlassen des Gerichtsgebäudes gemurmelt haben „… und sie bewegt sich doch“. Dem analytischen Ansatz folgend dürfte man aber streng genommen weder die historischen Umstände (Gerichtsprozess) noch die Rezeption (Legende) mit einbeziehen, und müsste die Interpretation auf das beschränken, was tatsächlich im Text, bzw. den Texten (dem Dialogo und der Widerrufserklärung) steht. Als das „letzte Wort“ Galileis zum kopernikanischen Weltbild müsste dementsprechend die Aussage der Widerrufserklärung gewertet werden: „Die Erde bewegt sich nicht“.
Die willentliche Außerachtlassung des historischen Kontexts und das Desinteresse an den eigentlichen Intentionen des Autors kann selbst für die richtige Erfassung der Argumente eines Texts ein Hindernis darstellen.12 Dies zeigt sich besonders deutlich im Hinblick auf den Schritt der Klärung von Begriffen, die im Text selbst nicht eindeutig definiert werden. Wenn Begriffe textimmanent unterbestimmt sind, dann verleitet der analytische Ansatz aufgrund des Verzichts auf kontextualistische Analysestrategien dazu, sich bei deren Verständnis an heutigen Wortverwendungen zu orientieren. Da der Begriff „Parteien“ im Federalist Paper Nr. 10 nicht näher bestimmt ist, wird man dem analytischen Ansatz folgend nicht davor geschützt, sie im heute dominanten Sinn als verfassungskonforme Instrumente des demokratischen Systems zu verstehen, die von partikulären Interessensverbänden unterschieden sind (die deutsche Parteienrechtskommission hielt so z. B. 1957 fest, dass die „Tätigkeit der Parteien … dem Wohle des ganzen Volkes [dient]“13). Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff der Partei hingegen beinahe entgegengesetzt als Verschwörung gegen das öffentliche Wohl verwendet. Es darf als wahrscheinlich gelten, dass Madison eher von diesem als dem heutigen Verständnis von Parteien ausging.
Der Verzicht auf methodische Mittel, die historische Bedeutung eines Texts zu verstehen, spricht noch nicht gegen den analytischen Interpretationsansatz, da es seinen Anwendern ja um eher philosophische als historische Einsichten beschaffen sein kann. Insofern es um die Bergung von theoretischen Werkzeugen geht, spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Autor eines Texts wirklich dieses und nicht eigentlich ein ganz anderes Werkzeug entwickeln wollte. Unerfreulich ist eher, dass die theoretischen Werkzeuge, die die Autoren in ihrem historischen Kontext eigentlich entwickelten, für uns heute spannender sein könnten. Auch mag die Gefahr der fälschlichen Zuschreibung von Aussagen und Argumenten gegen analytische Ansätze vorgebracht werden. (Eine kontextuelle Interpretation könnte unter Umständen zeigen, dass das Argument X gar nicht aus dem Text des Autors Y stammt, sondern erstmals im Kommentar des Interpreten Z vorgebracht wurde.) Schließlich muss eingeräumt werden, dass eine Untersuchung mit dem analytischen Ansatz ihrem Anspruch nicht völlig gerecht werden kann, da eine vollkommen textimmanente Interpretation stets unmöglich bleiben muss. Abgesehen davon, dass für eine textimmanente Interpretation die Kenntnis der Sprache, in der der Text vorliegt, nötig ist, werden Interpreten immer eine Reihe von weiteren Vorkenntnissen über den historischen Kontext mitbringen, die bewusst oder unbewusst die Interpretation des Texts beeinflussen werden.
1 Das philosophische Methodenbuch von Damschen und Schönecker stellt eine der wenigen Einführungen dar, die den analytischen Interpretationsansatz immerhin zu rekonstruieren ermöglichen. Sie selbst erachten den analytischen Interpretationsansatz allerdings nicht als tragfähig und empfehlen bei der Interpretation von Texten in synkretistischer Manier auf text-, autor-, adressaten- und selbst leserzentrierte Interpretationsstrategien zurückzugreifen. Siehe: Damschen, Gregor und Schönecker, Dieter. 2012. Selbst Philosophieren. Ein Methodenbuch. Berlin: De Gruyter.
2 Zentrale Figuren waren dabei unter anderem Thomas D. Weldon, Margaret Macdonald, John Plamenatz und Anthony Quinton. Für einen Einblick in die anfänglichen Debatten, die zur Ausprägung des analytischen Ansatzes führten, siehe: Miller, David. 1983. „Linguistic Philosophy and Political Theory“. In: derselbe und Larry Siedentop (Hg.). The Nature of Political Theory. Oxford: Clarendon Press, S. 35–52.
3 Quinton, Anthony. 1982. Thoughts and Thinkers. London: Duckworth, S. ix. Vgl. Plamenatz, John. 1938. Consent, Freedom and Political Obligation. London: Oxford University Press, S. x; Plamenatz, John 1963. Man and Society. A Critical Examination of Some Important Social and Political Theories from Machiavelli to Marx. Bd. 1. London: Longmans, S. xvii.
4 Lovejoy, Arthur O. 1993. Die große Kette der Wesen: Geschichte eines Gedankens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
5 Plamenatz, 1963. Man and Society, S. ix, xvi. Vgl. auch Russell, Bertrand. 1900. Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. Cambridge: Cambridge University Press, S. vi: „Ohne auf Daten oder Einflüsse zu achten, streben wir einfach danach, die großen Arten von möglichen Philosophien zu entdecken. Orientierung finden wir bei unserer Suche, indem wir die Systeme der großen Philosophen der Vergangenheit studieren.“
6 Eine von vielen brauchbaren Einführungen in die Argumentationstheorie und unterschiedliche Typen von Argumenten ist: Weimar, Wolfgang. 2005. Logisches Argumentieren. Stuttgart: Reclam.
7 Die zitierten Textausschnitte orientieren sich an der deutschen Übersetzung von Barbara Zehnpfennig: Hamilton, Alexander, Madison, James und John Jay. 1993. Die Federalist Papers. Übersetzt und eingeleitet von Barbara Zehnpfennig. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, S. 93–100, „Federalist Paper Nr. 10“. Die Verweise beziehen sich auf die sich durchnummeriert vorzustellenden Paragrafen (P) des Texts.
8 Die Bezeichnung „Gleichschaltung“ ist wesentlich mit der Erfahrung des Totalitarismus im 20. Jahrhundert verbunden. Aus historisch kontextualistischer Sicht stellt diese Umschreibung für einen Gedanken eines im 18. Jahrhundert geschriebenen Text somit einen Anachronismus dar. Insofern mit dem analytischen Ansatz aber das Federalist Paper Nr. 10 als Beitrag zum überzeitlichen Gespräch über Politik gewertet wird, ist „Gleichschaltung“ eine legitime Zusammenfassung des Gedankens von Madison, dass man Faktionen durch die Angleichung der Meinungen, Leidenschaften und Interessen der Bürger unterbindet.
9 Für eine Analyse der Rhetorik des Federalist Paper Nr. 10, siehe: Ashin, Mark. 1953. „The Argument of Madison’s Federalist No. 10“, College English 15/1, S. 37–45.
10 Hamilton, Madison und Jay, 1993, S. 58.
11 Beard, Charles. 1913. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. New York: Macmillan.
12 Vgl. Skinner, Quentin, Dasgupta, Partha, Geuss, Raymond, Lane, Melissa, Laslett, Peter, O’Neill, Onara, Runciman, W.G., und Andrew Kuper. 2002. „Political Philosophy. The View from Cambridge“, The Journal of Political Philosophy 10/1, S. 1–19, hier S. 2 f.
13 Parteienrechtskommission. 1957. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens. Probleme eines Parteiengesetzes. Bericht der vom Bundesminister des Innern eingesetzten Parteienrechtskommission. Frankfurt a.M.: Metzner Verlag, S. 73.