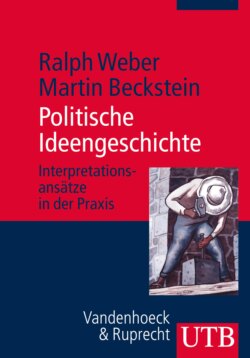Читать книгу Politische Ideengeschichte - Ralph Weber - Страница 9
ОглавлениеEinleitung Interpretationsansätze in der politischen Ideengeschichte
Weshalb lohnt sich die Beschäftigung mit Interpretationsansätzen in der Disziplin der politischen Ideengeschichte? Und noch grundlegender, weshalb ist es überhaupt lohnenswert, sich mit politischer Ideengeschichte zu befassen? Weshalb legen wir Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau und Mary Wollstonecraft nicht einfach ad acta und beschränken uns in der wissenschaftlichen Forschung auf das gegenwärtige politische Denken? Natürlich steht es jedem frei, sich privat für jahrhundertealte Texte zu interessieren, weil sie „da“ sind, so wie Edmund Hillary sich bekanntlich für den Mount Everest interessierte, „weil er da ist“. Aber es ist nicht ersichtlich, weshalb intellektuelle Erkundungslust von öffentlicher Hand zu subventionieren ist; und weshalb ein allgemeines Interesse darin bestehen sollte, die Texte von politischen Denkerinnen und Denkern vergangener Zeiten nicht nur einmalig auszuwerten, sondern immer wieder zu interpretieren. Auch wäre der gesellschaftliche Nutzen der Disziplin eher gering einzuschätzen, wenn es allein darum ginge herauszufinden, ob heutige Gedanken zur Politik schon früher gedacht wurden, wer der Erste war, der etwas gedacht hat, und inwiefern das gegenwärtige politische Denken durch frühere Reflexionen geprägt wurde. Die akademische Beschäftigung mit Texten der politischen Ideengeschichte ist kein Selbstzweck und gleiches gilt in noch stärkerem Maße für die Auseinandersetzung mit Interpretationsansätzen, doch für beides lassen sich gute Gründe anführen.
Wozu politische Ideengeschichte?
Die Beschäftigung mit Texten der politischen Ideengeschichte ist nicht zuletzt deshalb lohnenswert, weil es zu klären hilft, was Politik ist, was wir politisch tun können und was wir politisch tun sollten. Die Disziplin der politischen Ideengeschichte kann uns bei der Klärung dieser Fragen schon deshalb helfen, weil die Texte der politischen Ideengeschichte, die uns überliefert sind, eine Vielzahl von theoretischen Werkzeugen enthalten; sie artikulieren Annahmen, entwickeln Konzepte, konstruieren Argumente und liefern Antworten. Wenn wir uns mit gegenwärtigen Problemen auseinandersetzen, können wir auf dieses Sammelsurium von theoretischen Werkzeugen zurückgreifen und sie uns zunutze zu machen versuchen. Einige dieser Werkzeuge erweisen sich vielleicht als geeignet, Antworten auf heute dringliche Fragen zu finden; andere mögen uns helfen, die entscheidenden Fragen überhaupt zu stellen oder an unsere Zwecke angepasste Werkzeuge nachzubauen; und selbst Werkzeuge, die sich als dysfunktional erweisen, können uns immerhin lehren, welche Fragen wir nicht zu stellen brauchen oder welche Antworten wir verwerfen müssen.
Neben dem Zweck der Bergung von potenziell nützlichen politiktheoretischen Werkzeugen hilft die Beschäftigung mit der politischen Ideengeschichte uns zur Klärung, was politisch der Fall, möglich und wünschenswert ist, indem sie unser historisches Bewusstsein schärft. Indem wir untersuchen, wie frühere Denkerinnen und Denker gedacht haben, können wir besser verstehen, wie wir denken. Vielleicht finden wir heraus, dass wir einige ihrer Ansichten teilen und können uns durch das Studium ihrer Texte ein klareres Bild davon verschaffen, was diese Ansichten bedeuten und implizieren. Andere ihrer Ansichten werden uns fremd erscheinen, so dass uns die Eigenartigkeit und Fragwürdigkeit der von ihnen wie der von uns für selbstverständlich gehaltenen Ansichten vor Augen geführt wird.
Wozu Interpretationsansätze?
Was spricht nun aber für die Auseinandersetzung mit Interpretationsansätzen? Sind methodische Reflexionen wirklich nötig oder hilfreich für die Beschäftigung mit der politischen Ideengeschichte? Oder drohen wir uns dadurch in metatheoretischen Scheindebatten zu verlieren, die den potenziellen Nutzen des ideengeschichtlichen Studiums schmälern anstatt realisieren helfen. Es mangelt nicht an Stimmen, die den Nutzen von methodischer Reflexion über die Praxis der ideengeschichtlichen Forschung bestreiten.1 Zudem wird in Lehrbüchern und Überblickswerken, wie Busen und Weiß kürzlich festgestellt haben, in der Regel von nennenswerten Bemerkungen zur Methodik abgesehen.2 Dabei ist der Verzicht auf eine Methode gerade keine Option in der politischen Ideengeschichte. Die Frage ist nicht, ob man einen Interpretationsansatz praktiziert, sondern welchen; wie plausibel der verwendete Ansatz ist und wie konsistent man ihn anzuwenden versteht. Um theoretische Werkzeuge aus ideengeschichtlichen Texten zu bergen und über die Vergangenheit unsere eigene Situation zu reflektieren, können wir unterschiedliche Analysestrategien verfolgen. Jede Analysestrategie basiert auf unterschiedlichen Annahmen, eröffnet spezifische Möglichkeiten und impliziert spezifische Grenzen. Manche Analysestrategien eignen sich zum Beispiel zu ergründen, was Autoren gedacht haben oder was ihre Texte aussagen; andere erschließen, was ihre Texte mitteilen wollten, und wieder andere, welche Bedeutung die Texte vermittelt haben. Ein kritisches Bewusstsein über die Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Interpretationsansätze in der politischen Ideengeschichte zu erlangen ist nicht zuletzt deshalb nützlich, weil ein solches Bewusstsein vonnöten ist, um die Möglichkeiten des Machbaren auszureizen und um die Grenzen des Machbaren nicht zu ignorieren.
Dieses Lehrbuch setzt sich zum Ziel, die Möglichkeiten und Grenzen grundlegender Interpretationsansätze in der politischen Ideengeschichte theoretisch zu bestimmen und praktisch zu illustrieren. Wir teilen nicht die Vermutung, dass ein Ansatz allgemein richtig ist und alle anderen inadäquat. Vielmehr gehen wir davon aus, dass Möglichkeiten auf Chancen zur Erkenntnisgewinnung hinweisen und Grenzen auf etwas, das mit wissenschaftlicher Redlichkeit nicht zu überschreiten gehofft werden darf. Insofern ein Ansatz derartige Möglichkeiten hat – und nur so weit – ist er notwendigerweise adäquat.
Bevor wir zur theoretischen Darstellung und praktischen Anwendung der Interpretationsansätze übergehen, gilt es noch vorab zu klären, womit sich die Disziplin befasst und woran Interpreten überhaupt ansetzen, wenn sie Texte der politischen Ideengeschichte erforschen.
Politik – Ideen – Geschichte
Die Disziplin der politischen Ideengeschichte studiert die Geschichte der politischen Ideen. Was meint das genau? Fachvertreterinnen und Fachvertreter geben auf diese Frage sehr unterschiedliche Antworten. Grund dafür ist zunächst der Terminus der „Ideen“, der in seiner Bedeutung eine Bandbreite von einer mit metaphysischem Anspruch ausgestatteten Idee bis zu einem bloßen Gedanken aufweisen kann. Grob vereinfacht ausgedrückt hat sich die politische Ideengeschichte seit ihren Anfängen als selbstständige Disziplin immer weiter von einem starken Ideenbegriff verabschiedet. Ging man zunächst davon aus, dass über die Jahrhunderte hinweg dieselben Ideen gleichsam zeit- und ortsunabhängig verhandelt worden sind (in der deutschsprachigen Tradition paradigmatisch bei Meinecke, in der amerikanischen Tradition bei Strauss und bei Lovejoy), so werden diese – insoweit heute überhaupt noch von Ideen gesprochen wird – heuristisch oder im Sinn von „Motiven“ verstanden. Aller Unkenrufe zum Trotz ist es aber keineswegs so, dass stärkere Ideenbegriffe gar nicht mehr vertreten würden. Dies zeigt sich zum einen in systematischen Untersuchungen, die mehrere Schriften und Autoren versammeln und sie auf ein Problem hin analysieren oder die Entwicklung einer sich formierenden und ausdifferenzierenden Idee historisch nachzeichnen.3 Vielleicht wäre es aus dieser Perspektive betrachtet angemessener zu sagen, dass sich im Zuge einer disziplinären Weiterentwicklung eine Reihe weiterer Verständnisse neben dasjenige einer metaphysischen Idee gestellt haben, womit die Bezeichnung politische Ideengeschichte für viele zunehmend befremdender, in heutiger Zeit für einige gar schlicht anachronistisch geworden ist.
Es erstaunt daher nicht, dass derzeit mehrere Bezeichnungen eine weitgehend deckungsgleiche Verwendung finden, so etwa „Geschichte des politischen Denkens“, „Geschichte der politischen Philosophie“, oder „Geschichte der politischen Theorie“. John Gunnell hat dementsprechend kürzlich festgestellt:
Ob man von der Geschichte der politischen Philosophie, von der Geschichte der politischen Theorie oder von der Geschichte des politischen Denkens spricht, der Verweis zielt für gewöhnlich auf eine grundsätzlich gleiche fachliche Tätigkeit.4
Die Bedeutungen dieser Bezeichnungen sind natürlich nicht vollends deckungsgleich. Jede Bezeichnung trägt eigene Konnotationen: „politisches Denken“ mag eine besondere Breite anzeigen, „politische Philosophie“ der Kanonisierung von „Klassikern“ Tribut zollen und „politische Theorie“ eine systematische Vorgehensweise mit besonderem Anspruch auf Gegenwartsrelevanz verbinden.5 Auch die Bezeichnung „politische Ideengeschichte“ trägt, wie wir gesehen haben, eine solche besondere Konnotation. Vereinfacht lässt sich sagen, dass die Bezeichnungen und Konnotationen den unterschiedlichen Gewichtungen, Fokussierungen, Interessen und Zielen geschuldet sind, mit denen die „grundsätzlich gleiche fachliche Tätigkeit“ im Rahmen der Fachdisziplinen der Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichtswissenschaft betrieben werden.
Wir sprechen in diesem Band durchgängig von „politischer Ideengeschichte“, ohne aber damit einer bestimmten Konnotation den Vorzug geben zu wollen. Vielmehr gebrauchen wir die Bezeichnung, die historisch der Disziplin ihren Namen gegeben hat, weil sie noch am Besten geeignet scheint, um das überlappende Feld der „grundsätzlich gleiche[n] fachlichen Tätigkeit“ abzustecken. Im Grunde rekurrieren wir auf eine geläufige Begebenheit. In Bibliotheken werden in der Regel Bücher in einem gemeinsamen Regal, z.B. unter der Rubrik „Einführungen in die politische Ideengeschichte“, versammelt, von denen manche einen systematischen Fokus auf Argumente, andere einen historischen Fokus auf klassische Autoren und Werke und noch andere den Fokus auf Diskurse legen. Aus der Perspektive, die diesem Band zugrunde gelegt ist, stehen diese drei Bücher mit Fug und Recht im selben Regal; sie könnten aber auch ohne Weiteres in drei verschiedenen Regalen auf Leserschaft warten, je eines z. B. im Fachbereich der Politikwissenschaft, der Geschichtswissenschaft und der Philosophie. Immerhin stützt man sich trotz der Kontroverse, ob es um „Ideen“, „Theorien“, „Denken“ oder „Denker“ geht, unisono auf die Termini „Geschichte“ und „Politik“.
Das heißt nicht, dass es nicht auch zu den Termini der „Geschichte“ und „Politik“ viel Kontroverses zu berichten oder gar ganze Ideengeschichten zu schreiben gäbe.6 Beide Termini verhalten sich zur Disziplin in einem zirkulären Verhältnis, insofern neue Verständnisse von „Geschichte“ neue Wege, politische Ideengeschichte zu schreiben, ermöglichen und neue Verständnisse von „Politik“ (oder auch „des Politischen“7) den Gegenstandsbereich möglicher Objekte der Reflexion erweitern oder auch einengen. Wenn beispielsweise Karl Löwith seine Ausführungen in Weltgeschichte und Heilsgeschehen mit der Gegenwart beginnen lässt und sich sukzessive in die Vergangenheit vorarbeitet, dann begründet er dies zum einen didaktisch; zum andern ist das Vorgehen aber auch Ausdruck einer grundsätzlichen Neubestimmung des Historischen selbst.8 Oder wenn ein feministisches Politikverständnis, welches die Privatsphäre für politisch erklärt, neu artikuliert wird und Verbreitung findet, dann lassen sich neue politische Ideengeschichten schreiben. Sie fordern uns dann beispielsweise zur Berücksichtigung von Forschungen auf, die zuvor eher in der Sozialgeschichte (also außerhalb der politischen Ideengeschichte) verortet waren.
Mediale Ressourcen der politischen Ideengeschichte
Um theoretische Werkzeuge zu bergen und in Auseinandersetzung mit der Vergangenheit uns selbst besser zu verstehen, untersucht man in der politischen Ideengeschichte in der Regel Texte. Texte können aber recht unterschiedlicher Art sein. Welche Textarten zählen also zu den relevanten medialen Ressourcen des ideengeschichtlichen Studiums? Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ist man immer mehr von einer restriktiven Antwort auf diese Frage abgekommen. Heute gilt es, Texte unterschiedlicher Formate und soziokultureller Herkunft zu berücksichtigen.
Vom engen zum weiten Textbegriff
Texte sind der Gegenstand der ideengeschichtlichen Reflexion, und zunächst finden wir diese in der Form von Büchern. Wir gehen in die Bibliothek, steuern das entsprechende Regal an und nehmen Aristoteles’ Politik oder Das kommunistische Manifest zur Hand. Texte der politischen Ideengeschichte finden sich in Monografien; dazu kommen Sammelbände, Zeitschriften und Zeitungen, in denen politische Denkerinnen und Denker ihre Artikel und Interviews veröffentlichen und viele weitere Textformate, die wir beim Gang in die Bibliothek leicht vergessen: Hannah Arendt hat ihr politisches Denken zu Teilen über Radiovorträge vermittelt, Michel Foucault und Noam Chomsky ihre philosophischen Differenzen in Fernsehsendungen verhandelt. Wichtige Einblicke in das politische Denken der Renaissance sind uns mit Gemälden gegeben. Claude Lefort sieht die aussagekräftigsten Texte für den ideengeschichtlichen Übergang vom Absolutismus zur modernen Demokratie gar in monarchischen Begräbniszeremonien.9 Auch die neuen Medien stellen Foren etwa in Form von Blogs bereit, in denen politiktheoretische Reflexion einen zunehmend bedeutsamen Platz findet. Und wenngleich es nahe liegt, sich die unterschiedlichen Textformate entlang einer Achse vorzustellen, dessen einer Pol einen (alten) engen und dessen anderer Pol einen (neuen) weiten Textbegriff kennzeichnet, so ist zu bedenken, dass selbst die Klassiker des politischen Denkens weit über diese Achse verstreut sind. Aristoteles’ Politik basiert auf Vorlesungen und hat in der Form eines Buchs erst im Mittelalter, vermittelt über arabische Kommentatoren, Eingang in unsere Regale gefunden. Das kommunistische Manifest war ursprünglich eine Flugschrift.
Von der Hoch- zur Populärkultur
Während in der Disziplin schon immer auf ideengeschichtliche Texte unterschiedlichsten Formats als Reflexionsgegenstand zurückgegriffen wurde, so besteht eine genuine Neuerung hinsichtlich der Einbeziehung von Texten unterschiedlicher soziokultureller Herkunft. Erst im späten 20. Jahrhundert wurde der Blick von Texten der sogenannten ‚Hochkultur‘ systematisch auf die ‚Populärkultur‘ ausgedehnt. Texte der politischen Ideengeschichte werden seither nicht mehr nur bei akademischen und politischen Eliten vermutet, sondern auch im Alltagsleben gesucht. Die Gründe hierfür sind dreierlei: Erstens sind bedeutende politische Ideen nicht selten aus den Niederungen des politischen Tagesgeschäfts hervorgegangen, ehe sie philosophisch geschärft und modifiziert in Texten der Hochkultur artikuliert werden konnten.10 Zweitens kann nie mit Sicherheit vorausgesagt werden, aus welchem gesellschaftlichen Kreisen ein Text von herausragender ideengeschichtlicher Bedeutung und Qualität hervorgeht. Die Autorschaft des anonymen Online-Pamphlets Der kommende Aufstand, das für große Aufregung sorgte, wurde zunächst bei einer Gruppe Nonkonformisten aus dem Dorf Tarnac vermutet, woraufhin die französische Polizei im Jahr 2008 einen Klarinettisten, eine Krankenschwester und einen Gemüsehändler festnahm, auch wenn sie deren Urheberschaft schließlich nicht nachweisen konnte.
Schließlich ist ein dritter Grund, dass ideengeschichtliche Texte nicht auf einen Ort auf einer Achse soziokultureller Textwertigkeit festgeschrieben sein müssen, weil Hochkultur und Populärkultur in einem dynamischen Verhältnis stehen. Kulturelle Wertigkeit impliziert Bewertung, und diese kann sich gerade mit historischem Abstand deutlich verändern. Hochkultur kann Populärkultur werden, und umgekehrt, wie Machiavellis Der Fürst für beiderlei Dynamiken belegen mag. Ist die Schrift doch sicherlich keine repräsentative Quelle des frühneuzeitlichen Gelehrtentums, wird sie seit Langem zum Grundkanon politischer Ideengeschichte gezählt; im 20. Jahrhundert hat sie den Status von Ratgeberliteratur wiedergewonnen (unter Titeln wie Machiavelli für Frauen, Machiavelli für Manager, oder Machiavelli für Streithammel), wenngleich in etwas vulgärer Form.
Vielfalt der Ansätze – Eine Typologie
Politische Ideengeschichte ist also vornehmlich eine Textwissenschaft, wobei je nach engem oder weitem Textbegriff und soziokultureller Herkunft verschiedene Objekte Gegenstand der Untersuchung und Reflexion sein können. Ausgangspunkt ist die Identifizierung eines als interpretationsbedürftig wahrgenommenen Textmaterials. Die Herausforderung für die Ausdifferenzierung von Interpretationsansätzen besteht darin, die Analyseschritte aufzuzeigen, mithilfe derer ein als interpretationsbedürftig wahrgenommenes Textmaterial ausgelegt wird. Welche Analyseschritte für die Interpretation zielführend sind, hängt natürlich von dem genauen Leitinteresse ab, ob also wie zuvor erwähnt das Denken des Autors oder die Aussage seiner Texte erschlossen werden soll, oder die in den Texten angelegte Mitteilung an eine Leserschaft, oder aber die Bedeutung, die die Texte ihrer Leserschaft vermittelt haben. Die unterschiedlichen Leitinteressen suggerieren ihrerseits aber wiederum spezifische Verständnisse dessen, als was ein Text im Allgemeinen überhaupt zu verstehen ist. Die nachfolgende Typologie versucht daher Klarheit in das Dickicht der vielfältigen Interpretationsansätze zu bringen, indem die Interpretationsansätze anhand des angesetzten Textverständnisses geordnet werden.
Textzentrierte Ansätze: „ein Text ist der Gehalt seiner Aussagen“
Ein Text kann einfach als Text verstanden werden, als ein Argument, das jenseits der Prosa des Texts im Gehalt seiner Aussagen besteht. Der analytische Ansatz abstrahiert dementsprechend von der sprachlichen Präsentation, um den Gedanken selbst zu erfassen. Für den analytischen Interpreten macht es keinen Unterschied, ob ein Satz auf Englisch, Deutsch oder Sanskrit geschrieben ist, wie auch grammatikalische Konstruktionsarten, Akzentuierungen oder schlicht Rhetorik nicht ins Gewicht fallen. Ein einziger Aussagegehalt kann daher auf vielfache Weise ausgedrückt werden. Erasmus von Rotterdam zählte beispielsweise 195 lateinische Varianten des Satzes „Ihr Brief hat mir sehr gefallen“ auf; die Aussage des Satzes war ihrem Gehalt nach stets dieselbe.11 Bei einer analytischen Textinterpretation steht also der Aussagegehalt im Vordergrund. Im Idealfall lässt sich dieser in Form von Prämissen und Schlussfolgerungen darstellen, so dass im Anschluss an die Interpretation, der argumentative Inhalt des Texts auf Validität und Konsistenz geprüft werden kann.
Interessante Ansätze, die ebenfalls als textzentriert gelten können, sich bisher jedoch noch nicht innerhalb des Mainstreams etablieren konnten, sind in der Semiotik (Umberto Eco) und im (Post)-Strukturalismus zu verorten. Im Gefolge von Roland Barthes’ und Michel Foucaults Erklärungen zum Tod des Autors und Jacques Derridas Dekonstruktivismus haben sich neue Möglichkeiten ergeben, auch Texte aus der politischen Ideengeschichte neu zu interpretieren. Bei der ausführlichen Darstellung und Illustration von textzentrierten Ansätzen beschränken wir uns jedoch auf den analytischen Ansatz.
Autorzentrierte Ansätze: „ein Text ist von jemandem geschrieben“
Man kann einen Text aber auch als etwas verstehen, das von jemandem geschrieben wurde; der Autor rückt ins Zentrum. Die damit einhergehende Prämisse ist, dass man etwas über den Autor des Texts in Erfahrung bringen muss, möchte man das interpretationsbedürftige Textmaterial verstehen. Explizit finden autorzentrierte Ansätze in der ideengeschichtlichen Praxis Anwendung, wenn biografische Informationen über den Autor argumentativ in eine Textinterpretation eingewoben werden. Häufig wird beispielsweise behauptet, der Leviathan von Thomas Hobbes lasse sich nicht ohne dessen Erfahrung des englischen Bürgerkriegs verstehen. Nur impliziter, aber nicht weniger prämissenbehaftet, wird von einem solchen Zusammenhang des Lebens eines Autors und der Bedeutung eines seiner Texte ausgegangen, insofern der inhaltlichen Diskussion eine biografische Notiz vorangestellt wird. Warum sonst sollte das intime Verhältnis von Simone de Beauvoir mit Jean-Paul Sartre erwähnenswert sein in einer Abhandlung, die sich mit de Beauvoirs Text Das andere Geschlecht zu befassen behauptet? Misst man dem Zusammenhang von der Person des Autors einerseits und der Bedeutung des Texts andererseits die Hauptrolle zu, so kann man von einem biografischen Ansatz sprechen. Genau genommen wird dann ein Text als Ausdruck des Lebens eines Autors verstanden: Der Text hätte, angesichts der Biografie des Autors, gar nicht anders lauten können als er lautet.
Im Unterschied dazu unterstellt ein werkimmanenter Ansatz, dass man einen Text eines Autors am besten dann versteht, wenn man ihn im Zusammenhang mit den anderen Texten des Autors sieht. Dieser Ansatz kommt etwa zum Tragen, wenn man bei der Interpretation eines Texts die Qualifizierung hinzufügt, dass es sich um einen frühen Text des Autors handelt, da die späteren Texte doch alle durch das Hinzutreten eines bestimmten Motivs gekennzeichnet sind. (Hinsichtlich des Werks von Platon wird beispielsweise häufig gesagt, dass Sokrates nur anfangs eine zentrale Rolle einnimmt und in späteren Schriften immer mehr in den Hintergrund rückt.) Im Extremfall wird ein Text unter Anwendung des werkimmanenten Ansatzes in seiner Stellung innerhalb des Gesamtwerks der einem Autor zugeschriebenen Texte verstanden. Das Leben des Autors ist nicht primär für die inhaltliche Interpretation ausschlaggebend. Aber nur mittels der Identifikation des Autors können die verschiedenen Texte überhaupt als Texte des Gesamtwerks eines Autors verstanden werden.
Adressatenzentrierte Ansätze: „ein Text ist für jemanden geschrieben“
Ein Text kann aber auch so verstanden werden, dass er in der Hauptsache „für jemanden geschrieben“ ist; ein bestimmter Adressatenkreis nimmt also den Platz des Autors im Zentrum des Textverständnisses ein. Es wird daher nach der Botschaft gesucht, die der Autor mit seinem Text an seine Zeitgenossen vermitteln wollte oder tatsächlich sendete.
Der esoterische Ansatz von Leo Strauss bezieht die Möglichkeit in Betracht, dass Autoren nicht beabsichtigt haben mochten, ihre Erkenntnisse offen und explizit zu kommunizieren. Vielleicht drohten Freigeistern Repressionen; oder sie glaubten, die Gesellschaft vor unbequemen Wahrheiten schützen zu müssen; oder aber sie meinten, dass sich Leser philosophische Einsichten nicht in der gleichen Weise wie Sachinformationen aneignen können. Autoren könnten dementsprechend der adressierten Leserschaft ihre eigentliche Lehre zwischen den Zeilen zu vermitteln gesucht haben. Das, was auf den Zeilen geschrieben steht, wäre dann nur Zensoren, der politisch korrekten Öffentlichkeit oder Philosophieunempfänglichen zugedacht.
Der kontextuelle Ansatz geht hingegen davon aus, dass Autoren nicht in ein überzeitliches Gespräch mit vergangenen und zukünftigen Generationen (und zuletzt uns) eintraten, sondern ihren politischen Zeitgenossen eine Mitteilung machten. Sie taten dies nicht so sehr, weil sie es wollten, sondern weil sie gar nicht anders konnten. Die Autoren ideengeschichtlicher Texte werden als Kinder ihrer Zeit begriffen, die in historisch und kulturell kontingenten sprachlichen Konventionen, intellektuellen Traditionen und politischen Kontroversen gefangen waren. Laut dem bekanntesten Vertreter eines kontextuellen Ansatzes, Quentin Skinner, stellen ideengeschichtliche Texte ideologische Interventionen in das politische Tagesgeschäft dar. Dementsprechend richten sich die von ihm empfohlenen Analysestrategien auf die in einem Text angelegten Anspielungen auf parteiische Positionen, Bewertungen und Akzentverschiebungen. Wer die politische Rhetorik des Entstehungskontexts von Daniel Defoes Schrift Der kürzeste Weg mit den Dissentern in die Interpretation miteinbezieht, so Skinner zum Beispiel, erkenne, dass Defoe seinen Zeitgenossen keineswegs empfahl, mit Andersgläubigen kurzen Prozess zu machen, sondern sie mithilfe der ironischen Überspitzung zu größerer Toleranz bewegen wollte.12
Leserzentrierte Ansätze: „ein Text ist von jemandem gelesen“
Ein weiterer Typ von Interpretationsansätzen versteht Texte als etwas, das vor allem von jemandem gelesen wird; die Leseerfahrung wird in den Vordergrund gerückt. Dabei kann auf die Leseerfahrung eines Einzelnen oder die Gesamtheit aller Leser fokussiert werden.
Beim hermeneutischen Ansatz dreht sich alles um die Fremdheit, mit der ein Interpret als Leser eines ideengeschichtlichen Texts konfrontiert ist. Problematisiert wird dabei die zeitliche, kulturelle, sprachliche, milieubezogene und politisch-soziale Differenz, die dem Bemühen nach Verständnis entgegensteht. Der Leser tritt notwendig mit Vorannahmen und Vorurteilen an einen Text heran. Ziel ist, sich dieser bewusst zu werden und sie produktiv zu wenden. Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass es ein letztes Wort über einen historisch in den Text hineingelegten Sinn zu sprechen gälte. Vielmehr nimmt, wie Hans-Georg Gadamer es ausdrückte, die „Ausschöpfung des wahren Sinns“ kein Ende. Durch das Bemühen des Lesers ergeben sich neue Verständnisse und Sinnbezüge. Die Differenz zwischen Interpret und Text schließt sich letztlich nicht, sie ist in „ständiger Bewegung und Ausweitung“ begriffen.13
Der rezeptionstheoretische Ansatz sucht hingegen der unterschiedlichen Deutungen von Lesern gewahr zu werden, die von einem Text über die Zeit entstanden sind. Der Interpret setzt also an den Deutungen der Sekundärliteratur an und schlägt im Extremfall den interpretationsbedürftigen Text selbst gar nicht auf. Diese Vorgehensweise rechtfertigt sich entweder, weil die Bedeutung von Texten als uneindeutig und durch die Leserschaft mitkonstituiert gilt; oder weil die Auswertung der kaleidoskopischen Vielfalt von Rezeptionsdispositiven indirekt eine Interpretation des Texts ermöglicht, die weniger von den persönlichen Voreinstellungen des Interpreten belastet ist; oder einfach weil das Maßgebliche von Texten nicht in der Bedeutung erkannt wird, die sie vermitteln wollten, sondern in der Bedeutung, die sie faktisch vermittelten.
Ansätze, die über die Interpretation eines Einzeltexts hinausgehen
In der politischen Ideengeschichte gibt es über die bereits erwähnten Ansätze hinaus eine Reihe von Interpretationsansätzen, die nicht in erster Linie einen Einzeltext in den Blick nehmen, sondern sich von vornherein auf ein Kollektiv von Texten konzentrieren, dem das eigentliche Interesse gilt. So auch in der Begriffsgeschichte, die wir von diesem Typ von Ansätzen in diesem Band detailliert betrachten werden. Bei der Begriffsgeschichte spielen Texte gegenüber den Begriffen, die sie verhandeln, eine untergeordnete Rolle. Texte werden allenfalls als Sammelsurium von Bestimmungen und Deutungen bestimmter politischer und anderer Begriffe verstanden. Begriffsgeschichtler, wie ihr prominentester Vertreter Reinhart Koselleck, versuchen Entwicklungen von Begriffen über viele Texte hinweg nachzuzeichnen, um so letztlich sozialen und politischen Wandel historisch greifbar zu machen. Gerade bei der Begriffsgeschichte hat sich der Fokus über die letzten Jahrzehnte merklich weg von Höhenkammliteratur zu institutionellen Texten und Texten der Populärkultur geweitet.
In diesem Band nicht behandelt, aber gleichermaßen erwähnenswert sind eine Reihe anderer Ansätze, die in ähnlicher Weise über die Interpretation eines Einzeltexts hinausgehen und die ebenfalls in der Disziplin verfolgt werden. Wie die Begriffsgeschichte beziehen sie die Interpretation des einen Texts auf ein Kollektiv von Texten, dem das eigentliche Interesse gilt. Stichwortartig seien hier die Problemgeschichte, die Mentalitätengeschichte sowie diskurs- und systemtheoretische Ansätze erwähnt. Diese Ansätze sind nicht zuletzt durch ihr, über einen Einzeltext weit hinausreichendes Interesse überaus komplex konzipiert; sie kommen aber allesamt nicht umhin, sich mit Einzeltexten zu beschäftigen, so dass ein Verständnis der in diesem Band vorgestellten Interpretationsansätze gleichsam als Vorbereitung für diese weiterführenden Ansätze verstanden werden darf.
Damit sind abschließend zwei wichtige Punkte angesprochen. Erstens ist es durchaus ein Aspekt der Diskussion um Ansätze in der politischen Ideengeschichte, was denn nun als eigenständiger Ansatz gelten kann. Es scheint zumindest so zu sein, dass die eben erwähnten Ansätze, die auf ein Kollektiv von Texten abheben, je schon ein Textverständnis bei der Lektüre des Einzeltexts ansetzen. Wenn man zum Beispiel Problemgeschichte betreibt und sich dem Problem der sich durch Macht einstellenden Korrumpierbarkeit widmet, dann kann man die Texte und den darin enthaltenen Beitrag zur Problembehandlung noch immer als von jemandem geschrieben oder als für jemanden geschrieben oder einfach auch nur als vorliegenden Text lesen. Damit ist letztlich auch verständlich, warum es strittig ist, ob etwa der Feminismus einen eigenständigen Ansatz bereitstellt. Er könnte sich durchaus mit manchen der in diesem Lehrbuch versammelten Ansätze kombinieren oder aber als unabhängiges Set von Analysestrategien ausdifferenzieren lassen.
Zweitens sind natürlich im Grunde auch die von uns ausgewählten, grundlegenden Interpretationsansätze in ihrer Ausgestaltung durch eine anhaltende Fortschreibung auf theoretischer Ebene sowie durch konkurrierende Anwendungen in der Praxis gekennzeichnet. Im Rahmen dieses Bands kann auf diese vielfältigen Entwicklungen nur punktuell eingegangen werden. Größeres Gewicht wird dagegen darauf gelegt, die ausgewählten, grundlegenden Interpretationsansätze in Modellform zu präsentieren. Denn durch die modellhafte Darstellung und Illustration werden Vorzüge und Nachteile der einzelnen Ansätze deutlicher sichtbar, so dass gehofft werden darf, das Bewusstsein für die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen zu fördern und zu einem (selbst-)kritischen Umgang mit dem methodischen Handwerkszeug der politischen Ideengeschichte zu motivieren.
Auswahl der Texte
Im vorliegenden Lehrbuch werden die Analysestrategien der ausgewählten Interpretationsansätze erläutert und durch Anwendung auf je einen Text illustriert. Die Auswahl der Texte berücksichtigt die Kriterien unterschiedlicher Textformate sowie soziokultureller Herkunft. Dabei beschreiten wir einen Mittelweg zwischen „Klassikern“ (Platons Staatsmann, Machiavellis Der Fürst, Strauss’ Verfolgung und die Kunst des Schreibens und Madisons Federalist Paper Nr. 10) und eher vernachlässigten Texten (De Gouges’ Drei Urnen, Riveras Die Geschichte Mexikos, Huangs Mingyi daifang lu und dem hethitischen Text Die Würdenträgereide des Arnuwanda). Was die Autorschaft der Texte anbelangt, so wird ebenso einerseits auf Familiarität gesetzt, und andererseits auf noch nicht oder nur namentlich bekannte Autoren zurückgegriffen. Schließlich, auch wenn die Auswahl nur exemplarisch und ohne Anspruch auf Repräsentativität erfolgen konnte, wurden nicht nur Texte von männlichen, weißen Europäern miteinbezogen.
Männliche, weiße Europäer? Reden wir damit nicht einer politischen Korrektheit das Wort, die wir in unserer eigenen Schreibpraxis gar nicht einlösen? Haben wir nicht durchgängig von Autoren in der männlichen Form gesprochen? Darüber wollen wir in Form einer Reflexionsbox kurz nachdenken.
Reflexionsbox 1: Sexistische Sprache
Wäre es nicht gerade in einem Lehrbuch nötig, auf geschlechtsneutrale Sprache zu achten? Nicht alle Autoren der politischen Ideengeschichte waren Männer und auch nicht deren Adressaten oder Leser. Die standardmäßige Verwendung der männlichen Form suggeriert eine falsche Normalität. Umgekehrt kann eine geschlechtsneutrale Sprache über die faktisch vorherrschenden patriarchalen Verhältnisse hinwegtäuschen. Das Dilemma lässt sich nicht leicht umgehen. Im einen Fall laufen wir Gefahr, Studierende an eine sexistische Konvention zu gewöhnen. Im andern Fall würden wir einem idealisierenden Anachronismus erliegen, indem wir unser heutiges Selbstverständnis in die Vergangenheit projizieren.
Für uns ausschlaggebend war die Befürchtung, mit einer konsequent geschlechtsneutralen Sprache oder mit im Deutschen ungebräuchlichen Alternativen die Reflexion über Ansätze in der politischen Ideengeschichte zu erschweren. Wir haben uns daher in einigen Fällen des Schlüsselvokabulars für die Verwendung des generischen Maskulinums entschieden, ohne zu meinen, damit die richtige Lösung, oder auch nur die beste aller schlechten, gefunden zu haben.
1 Siehe z. B.: Ball, Terence. 1995. Reappraising Political Theory. Revisionist Studies in the History of Political Thought. Oxford: Clarendon, S. 5; Sontag, Susan. 2009. „Against Interpretation“. In: dieselbe, Against Interpretation and Other Essays. London: Penguin, S. 3–14.
2 Busen, Andreas und Weiß, Alexander. 2013. „Ansätze und Methoden zur Erforschung politischen Denkens: The State-of-the-Art?“. In: dieselben (Hg.), Ansätze und Methoden zur Erforschung des politischen Denkens. Baden-Baden: Nomos, S. 15–39.
3 Siehe z. B.: Kersting, Wolfgang. 2009. Die Politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Riklin, Alois. 2006. Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
4 Gunnell, John. 2011. „History of Political Philosophy as a Discipline“. In: Klosko, George (Hg.), The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, S. 60–72; hier S. 60.
5 Ottmann, Henning. 1996. „In eigener Sache: Politisches Denken“, Politisches Denken, Jahrbuch 1995/96: S. 1–9; Ottmann, Henning. 2001a. Geschichte des Politischen Denkens. Band 1/1: Die Griechen. Von Homer bis Sokrates. Stuttgart: Metzler, S. 1–6.
6 Für einen Klassiker, siehe: Collingwood, Robin George. 1994. The Idea of History. Oxford/New York: Oxford University Press.
7 Zum Unterschied zwischen Politik und dem Politischen, siehe: Röttgers, Kurt und Bedorf, Thomas (Hg.). 2010. Das Politische und die Politik. Berlin: Suhrkamp Verlag.
8 Löwith, Karl. 2004. Weltgeschichte und Heilsgeschehen: Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. Stuttgart: Metzler.
9 Lefort, Claude. 1988. Democracy and Political Theory. Cambridge: Polity Press.
10 Ottmann, 2001a, S. 2.
11 Siehe: von Rotterdam, Desiderius Erasmus. 1978. „Copia: Foundations of the Abundant Style (de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo)“, übersetzt von Betty I. Knott, in: Collected Works of Erasmus: Literary and Educational Writings 2, hg. von Craig R. Thompson, Toronto: University of Toronto Press, S. 348–354.
12 Skinner, Quentin. 2009. Visionen des Politischen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 74–75.
13 Gadamer, Hans-Georg. 1990. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, S. 303.