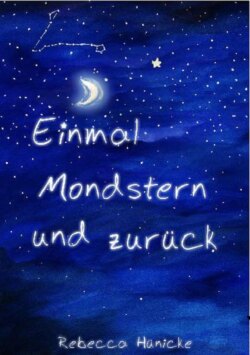Читать книгу Einmal Mondstern und zurück - Rebecca Hünicke - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеProlog
Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Sie sieht alles so klar vor Augen. Die nächsten Schritte, wie sie sie einen nach dem anderen durchführen wird. Sie weiß genau, welcher Schritt der letzte sein wird und sie hat keine Angst davor. Es ist eine Selbstverständlichkeit wie morgens nach dem nächtlichen Schlaf aufzuwachen. Angst verspürt sie keine. Ihre Sehnsucht nach einer neuen Unendlichkeit wird gleich erfüllt sein. Sie freut sich darauf, fiebert ihrem neuen Leben entgegen und möchte es jetzt gleich ergreifen. Sie weiß, sie muss geduldig sein und noch eine kleine Weile warten, nur eine kleine Weile.
Sie ist stark und sie kennt ihren Weg. Sie sieht ihn schon so lange vor sich und sie ist ihn fast bis zum Ende gegangen. Die letzten kleinen Schritte liegen vor ihr. Es sind die schwierigsten und die mühseligsten. Sie hat die Kraft, sie weiß es und sie muss nicht mehr kämpfen.
Ein letztes Lächeln. Ihr letztes Geschenk an ihre alte Welt. Ihr Atem geht schneller und sie fühlt sich zittrig. Sie ist bereit. Jetzt spürt sie, dass der letzte Moment gekommen ist.
Sie fühlt sich schwer und ihre Beine wollen sich nicht mehr so recht bewegen, wie vor einem Augenblick noch. Für einen kleinen Moment überkommt sie Zweifel. Ihr Herz rebelliert und sie hat das Gefühl es zerreißt sich, um in jeden Winkel ihres Körpers zu flüchten. Jede Faser schreit nach Leben. Es schlägt wild um sich und drückt und zieht. Sie denkt, jeder Schmerz, den sie erfährt, sei durchlebt, es gäbe keinen schlimmeren mehr. Aber da irrt sie sich.
Dieses Empfinden kennt sie noch nicht. Wie sollte sie auch, es ist doch das letzte, das endgültigste von allen. Auf ihren Schultern spürt sie eine wohlige Wärme. Er ist gekommen. Er ist wirklich da.
Sie hat ihn so oft angefleht ihr zu helfen, sie nicht im Stich zu lassen. Sie hat mit ihm gehadert, ihn verflucht und geliebt. Sie hat um seine Freundschaft gebuhlt und sich nach ihm gesehnt.
Er erhört sie und lässt sie nicht im Stich. Sie hat es sich so sehr gewünscht, nicht allein zu gehen. Nun ist er da.
Durch seine sanfte Berührung spürt sie einen leichten Druck, der sie durch die letzten Schritte führt. Sie kann ihn nicht sehen, denn er ist hinter ihr. Sie spürt seine allgegenwärtige Macht, aber keine Gestalt. Sie spürt eine Woge von Wärme, die sie einhüllt und festhält. Diese Wärme ist so stark, dass sie sich in ihre Hände begibt.
Es ist so leicht für sie die Augen zu schließen und den letzten Atemzug entweichen zu lassen.
Teil I
Sommer
Eigentlich sollte Mama schon längst da sein. Noch nie hat sie sich verspätet. Nur einmal, aber da hat sie im Sekretariat bei Frau Bienkopf angerufen. Die Sekretärin hat uns dann Bescheid gegeben, dass Mama sich verspäten wird.
Es war ein Tag vor Solveighs Geburtstag. Solveigh hatte sich ein Kuscheltier gewünscht, einen Hasen. Der war ihr größter Wunsch. Mama hatte schon in vielen Geschäften nach ihm gesucht. Entweder hatten sie ihn nicht oder das Bestellen dauerte zu lange. Nach langem Suchen hatte Mama ihn in einem Laden gefunden, dafür musste sie über eine Stunde mit dem Auto fahren.
Niemand kann Solveigh etwas abschlagen. Sie ist ein kleiner Sonnenschein. Jeden Morgen wacht sie mit einem Lächeln im Gesicht auf und ist auf den neuen Tag gespannt. Am liebsten mag sie es, wenn die Sonne sie begrüßt und ihr einen schönen Tag wünscht. Aber sie liebt auch Regen. Alle Tiere und Pflanzen seien durstig, genau wie wir Menschen. Sie freut sich dann darüber, dass sie nicht verdursten müssen.
Mama muss jeden Morgen ihre goldenen Locken bändigen und ihr einen oder zwei Zöpfe binden. Solveigh sagt ihr vorher wie viele Zöpfe sie möchte, weil es für sie immer einen Grund gibt, warum einen oder zwei. An warmen, sonnigen Tagen trägt sie gerne zwei, damit sich Zitronenfalter darauf niederlassen könnten. Dann hätte sie wunderschöne Haarspangen. Einen Zopf macht Mama ihr, wenn es praktisch sein soll oder, wenn Solveigh einen Nachdenktag hat. Zwei Zöpfe brächten ihren Kopf dann zuviel in Bewegung und lenkten sie ab.
Heute hat meine Schwester zwei Zöpfe. Beim Balancieren auf dem Schulhof schwingen ihre Zöpfe hin und her. Sie spielt Ballerina und bewegt ihre Arme elegant dazu. Am Ende des Balkens beugt sie ihren Oberkörper nach vorne und streckt ein Bein nach hinten. Ihr weißes Kleid, dessen Rock in Stufen abgesetzt ist, lässt sie in diesem Moment wie ein Engel aussehen. Ihre gerade Haltung drückt ihre Anmut aus und die Sonnestrahlen unterstreichen ihre Schönheit. Es ist wie auf einer Bühne, wenn der Star in einem bestimmten Moment durch ein Licht in den Mittelpunkt gebracht wird, um so besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt ist sie nicht Solveigh, sondern eine Prinzessin. Ihre blauen Augen leuchten wie Saphire in der Sonne und geben diesem Augenblick den letzten Schliff.
Frau Bienkopf erscheint auf dem Schulhof. Über ihrer Schulter hängt ihre grüne Umhängetasche, die sie jeden Tag mit zur Schule bringt. Sie lächelt mich an und bringt meiner Schwester ein Strahlen entgegen. „Ihr zwei seid ja noch da? Ich dachte, eure Mutter wäre inzwischen gekommen.“ Ich verneine durch ein Kopfschütteln. „Ich sage Frau Kersting von der Betreuung Bescheid, dann könnt ihr dort auf sie warten. Ihr ist bestimmt etwas Wichtiges dazwischen gekommen und kann gerade nicht anrufen“, versucht Frau Bienkopf uns zu erklären. „Ich spiele gerne Ballerina, Frau Bienkopf. Ich spiele so lange, bis Mama kommt.“ Die Sekretärin lächelt Solveigh zu und geht zurück ins Schulgebäude.
In meinem Bauch rumpelt es. Ich habe das Gefühl auf die Toilette zu müssen, aber es ist nur ein Gefühl. Wenn ich an Mama denke, schlägt mein Herz ganz schnell und ich bekomme nicht mehr so gut Luft, als ob ich gerade schnell gerannt wäre. Ich schaue meine Schwester an und freue mich über ihren Anblick. Das Warten scheint ihr nichts auszumachen. Sie spielt einfach Ballerina und nutzt die Zeit zum Üben. Ich höre unbekannte Stimmen. Ich schaue zum Hofeingang. Ein Mann und eine Frau kommen auf mich zu gelaufen. Ihre Gesichter sind ernst und sie flüstern mehr, als dass sie richtig mit einander reden. Obwohl sie auf mich zugehen, beachten sie mich gar nicht. Der Mann öffnet die Eingangstür und hält sie der Frau auf. Sie geht hindurch und er schließt sich ihr an.
Ich schaue auf meine Uhr. Es ist bereits zwei Uhr. Mama hat sich bereits eine dreiviertel Stunde verspätet. Was macht sie nur? Das Warten in der Sonne macht mich durstig. Ich nehme meine Wasserflasche aus meiner Schultasche und trinke einen Schluck. Das Wasser ist bereits warm und schmeckt nicht mehr. Ich gehe zu Solveigh und halte ihr meine Flasche hin. „Ich habe keinen Durst.“ „Trink auch etwas! In der Sonne ist es so heiß. Nachher hast du wieder Kopfschmerzen, weil du nichts getrunken hast.“ „Also gut, aber nur einen Schluck.“ Solveigh nimmt meine Flasche, die ich ihr noch entgegenhalte. Sie setzt die Flasche an den Mund. Das Wasser hat kaum ihre Lippen berührt, da verzieht sie auch schon das Gesicht. „Das ist ja warm. Das Wasser schmeckt scheußlich. Ich will das nicht trinken.“ Sie hält mir die Flasche wieder hin. Ich weiß, ich brauche gar nicht mit ihr zu diskutieren. Meine Schwester weiß immer was sie will.
Papa hat mal gesagt, sie sei ein störrischer Esel. Daraufhin hat sie den ganzen Tag „i-ah“ gemacht, wenn jemand mit ihr reden wollte. Uns drei hat das schnell genervt, aber Solveigh war es egal. Sie war den Rest des Tages in ihrem Zimmer und hat dort alleine gespielt.
Meine Schwester hat nie Langeweile. Ständig hat sie irgendwelche Ideen und wenn sie nicht gut sind, hat sie schon wieder andere. Neue. Solveigh mag Menschen, aber viel lieber noch Tiere. Wenn sie mitbekommt, dass Mama und Papa manche Menschen nicht mögen, macht sie sich Gedanken über diese Menschen. Sie hat immer eine Erklärung dafür, warum Menschen so sind, wie sie eben sind. Für sie hat einfach alles einen Grund, nur kann nicht jeder ihn erkennen. Deshalb lieben wir alle Solveigh so sehr. Sie zeigt uns, wer wir gerne sein würden.
Einmal hat Mama geglaubt, ich würde sie nicht hören, da hat sie zu Papa gesagt, Solveigh sei ihr größter Schatz. Sie mache sie mit ihrem Wesen unendlich reich. Als ich das gehört habe, war ich sehr traurig. Ich habe geglaubt, meine Eltern hätten mich nicht lieb. Ich konnte sie nicht danach fragen, weil ich heimlich gelauscht habe.
Wenn ich Mama, Papa und Solveigh zusammen sehe, sehe ich genau das. Die drei haben einander lieb. Ich kann das sogar verstehen. Schließlich bin ich anders als meine Schwester. Meine Gedanken hindern mich oft am Weiterkommen. Ich überlege oft zu lange, ob ich etwas tun oder lassen soll. Ich muss wissen, was auf mich zukommt, wenn etwas gut wird, aber auch, wenn es schlecht ausgeht. Manchmal kann ich wegen meiner Gedanken gar nicht essen oder schlafen. Und dann wache ich erst recht nicht mit einem Lächeln auf.
Ich schraube meine Flasche zu und in diesem Moment kommt Frau Bienkopf mit dem Mann und der Frau zusammen auf den Schulhof. Jetzt lächelt sie nicht mehr. Irgendwie erinnert mich ihr Gesicht an ein Gespenst. Ihre Gesichtsfarbe ist nicht mehr schön. Solveigh balanciert weiter, sie interessiert sich nicht für die Menschen, die auf mich zukommen. Die drei gehen nebeneinander und kommen immer näher, wie eine bedrohliche Mauer. Schauen sie ernst oder böse? Ich weiß es nicht. Mein Herz rast durch meinen ganzen Körper. Mir ist heiß und meine Ohren beginnen zu pochen. Mein Bauch macht komische Geräusche und möchte mir mein Frühstück zurückgeben. Mir ist übel. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Wo ist denn die Toilette? Meine Beine wackeln so schnell und meine Füße wollen nicht vorwärts gehen. Gleich falle ich um, aber das will ich gar nicht.
Die Menschenmauer gibt Worte von sich, die ich nicht verstehen kann. Das Pochen in meinen Ohren ist einem Rauschen gewichen, es ist so viel lauter. Erst als sich ein Arm auf mich zu bewegt und eine Hand meine Schulter berührt, dringen klare Worte zu mir durch. Frau Bienkopf steht vor mir und blickt mir tief in die Augen. „Louna, wir müssen etwas sehr Wichtiges bereden. Wir werden zu Herrn Stemmberg ins Büro gehen.“ Ich nicke ihr zu und gehe zu Solveigh. Ich nehme sie an die Hand und sage ihr, sie soll mitkommen. „Mama ist noch nicht da. Ich will nicht mitkommen.“ Frau Bienkopf kommt zu uns und redet mit meiner Schwester. Die Sekretärin versucht zu lächeln, um meine kleine Schwester vom Balken zu locken. Ihr Lächeln ist jetzt nur der Versuch eines Lächelns. Sie kann gerade nicht so herzlich lächeln wie eben. Frau Bienkopf fasst Solveigh an der anderen Hand und resigniert hüpft sie an unseren Händen vom Balken. Automatisch greift sie ihre Schultasche und gibt mir meine. Ich ergreife sie und muss einen festen Griff aufbringen, damit sie mir nicht entgleitet. Das Zittern kommt zurück.
Der Mann und die Frau sehen uns nur an, sagen aber kein Wort. So wie eben hält er erneut die Eingangstür auf und wir gehen hinter der Sekretärin her, zum Büro des Direktors. Hinter uns geht die Frau und das Ende der Schlange bildet der Türaufhalter.
Eigentlich möchte ich gar nicht zu Herrn Stemmberg. Er ist immer freundlich, wenn ich ihm begegne, aber trotzdem mag ich ihn nicht. Seine engsitzenden dunklen Augen wirken bedrohlich auf mich. Obwohl er stets um Freundlichkeit bemüht ist, kann dies seine brummige Stimme nicht ausblenden. Wenn er lacht, hört sich das so an, als ob ein Bär zum Angriff übergeht.
Im Zoo schauen wir immer Bären an und auf den Schildern steht jedes Mal wie gefährlich Bären sein können. Egal, ob Eisbär oder Grizzlybär, alle haben sie gefährliche Pranken mit messerscharfen Krallen. Ein Tatzenhieb könne bereits einen Menschen töten.
Die brummige Stimme und das rundliche Aussehen des Direktors erzeugen stets den Vergleich mit einem Braunbären bei mir. Die Bürotür des Direktors steht auf. Frau Bienkopf klopft trotzdem an, obwohl Herr Stemmberg uns bereits alle erwartet. Der Direktor steht auf und knöpft zuerst sein Jackett zu, bevor er auf uns zugeht.
Mit seiner Hand deutet er zu einem runden Tisch, an dem sechs Stühle stehen. Die Sekretärin zieht zwei Stühle vom Tisch weg und sagt uns, wir sollen uns dorthin setzen. Sie nimmt uns unsere Schultaschen ab und stellt sie hinter unseren Sitzplätzen an die Wand. Solveigh und ich setzen uns und unter dem Tisch ergreift sie meine Hand. Nur Frau Bienkopf redet mit uns, alle anderen starren uns nur an.
Und nun erfahren wir, wer die beiden Fremden sind. Es sind Herr Meyer und Frau Krause vom Jugendamt. Frau Bienkopf versucht eine Erklärung für das Wort Jugendamt zu finden. Mit einem einzelnen Wort ist es aber nicht getan. Sie erklärt es so: „Wenn Kinder und Jugendliche Hilfe brauchen, weil ihre Eltern sich nicht mehr um sie kümmern können, dann bekommen sie Hilfe vom Jugendamt.“ An Solveighs Blick erkenne ich ihr Unverständnis. „Das ist gut, wenn Kindern geholfen wird, die Hilfe brauchen. Louna und ich brauchen keine Hilfe. Wir haben eine Mama und einen Papa. Die sind ganz lieb und kümmern sich um uns. Wir brauchen gar keine Hilfe. Frau Bienkopf, du kennst doch unsere Mama und unseren Papa.“
Als Solveigh redet, ist nichts als ihre Stimme im Raum zu hören. Die Augen der Sekretärin verändern sich, sie sehen traurig aus. Mit einem Finger hält sie eine Träne auf, die sich aus ihrem rechten Auge davon stehlen will. Niemand stimmt meiner Schwester zu. Auch ich nicht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie wehrt sich mein Bauch dagegen.
Frau Krause sieht die Sekretärin an und nickt ihr zu. „Herr Meyer und ich sind hier, weil eure Eltern euch nicht mehr abholen können. Sie waren heute Morgen mit dem Auto unterwegs. Es hat einen großen Unfall auf einer Straße gegeben. Eure Eltern… eure Eltern haben sich bei dem Unfall schlimm verletzt und sind dann gestorben.“
Solveigh drückt meine Hand immer fester unter dem Tisch.
Das Rauschen in meinen Ohren ist wieder da und füllt meinen Kopf aus. Jetzt reden alle Erwachsenen. Ich verstehe gar nichts, ich sehe nur, wie sich ihre Münder bewegen, wie sie auf und zu gehen. Ihre Gesichter verziehen sich zu wilden Fratzen, die mich verschlingen wollen. Ich starre auf den Tisch, ich will keinen von ihnen ansehen. Ein Schleier legt sich über mich und ich schließe für einen Moment meine Augen. Einen Moment bin ich gar nicht hier. Ich bin irgendwo, nur nicht bei diesen Menschen, die so böse und schreckliche Dinge sagen. Ich will sie nicht hören. Die dürfen doch so etwas nicht sagen. Wissen sie denn nicht, dass sie Kindern damit große Angst machen?
Ein Rütteln an meiner Schulter holt mich in das Büro von Direktor Stemmberg zurück. Ich sitze noch auf dem Stuhl vor dem Tisch und um mich herum sitzen noch immer die gleichen Menschen. Inzwischen hat Solveigh meine Hand losgelassen, sie rüttelt nun an meiner Schulter. „Louna, sag ihnen, dass sie uns nicht anlügen sollen. Wir haben eine Mama und einen Papa. Mama verspätet sich heute nur und kann gerade nicht anrufen. Bitte, sag es ihnen doch.“
Zum ersten Mal kann ich eine Bitte meiner Schwester nicht erfüllen. Ich kann sie nicht einmal ansehen. Ich starre nur vor mich hin und Frau Bienkopf ergreift Solveighs Hand, damit sie nicht weiter an meiner Schulter herumreißt. Ich weiß nicht, was ich gerade denken oder fühlen soll. Alles in mir ist schwer und doch wieder so leer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit uns machen. Vielleicht hat es jemand gesagt, dann habe ich es nicht verstanden.
Meine Schwester bekommt keine Antwort von mir und sie verstummt. Die Erwachsenen stehen auf und wir machen es auch, ganz automatisch. Herr Stemmberg berührt unsere Schultern und sagt: „Wir werden euch helfen, so gut wir können. Wir werden für euch da sein.“ Frau Bienkopf gibt unsere Schultaschen Herrn Meyer und Frau Krause nimmt uns an die Hand. Die Sekretärin versucht weiterhin gegen ihre Tränen anzukämpfen, aber sie hat die Kraft nicht mehr. Sie dreht sich weg, um sich ein Taschentuch aus ihrer grünen Umhängetasche zu nehmen. Nun kullern ihre Tränen ins Taschentuch. Sie kommt noch einmal auf uns zu und nimmt jede von uns in den Arm. Wir stehen nur da und lassen es geschehen.
Frau Krause nimmt erneut unsere Hände und wir gehen mit ihr mit, als ob wir das schon immer getan haben. Der Türaufhalter geht voraus und hält uns ein letztes Mal die Eingangstür auf.
Wir vier gehen über den Schulhof und verlassen ihn über die Treppe, die zum Parkplatz führt. Frau Krause und Herr Meyer gehen mit uns zu einem großen roten Auto. Es ist ein Ringauto. So eins hat Papa auch, nur sein Auto hat eine schönere Farbe. Papas Auto ist dunkelblau. Der Mann öffnet den Kofferraum und legt unsere Schultaschen hinein und schließt ihn anschließend wieder. Vier ineinander verschlungene Ringe blicken mir entgegen.
Solveigh hat Papa mal nach der Bedeutung für die Ringe gefragt. Er sagte, es bedeute so etwas wie Familie. Jedem von uns gehöre ein Ring, weil wir eine Familie seien. Die Ringe wären wie wir, sie gehörten einfach alle zusammen und dann hat er uns drei in den Arm genommen.
Auf den Rücksitzen sind zwei Sitzschalen für Kinder, wie in Mamas und Papas Auto. Wir setzen uns in sie hinein. Frau Krause hilft meiner Schwester beim Anschnallen. Ich bin schneller als Herr Meyer und schnalle mich selbst an.
Der Türaufhalter fährt das rote Ringauto und dreht dabei das Radio leiser. Wir fahren durch die Stadt. Es ist viel Verkehr und alle Ampeln werden rot, sobald wir auf sie zufahren. Die Erwachsenen flüstern, ich kann nicht jedes Wort verstehen. Es ist mir egal. Solveigh schaut aus dem Fenster und redet nicht. Ich will auch nicht reden.
Unterwegs sehe ich viele Kinder, die ein Eis essen und Erwachsene, die mit Taschen bepackt durch die Straßen hetzen. Eigentlich ist es ein ganz normaler, schöner Sommertag. Warum sollten die Kinder kein Eis essen?
Viele Autos fahren an uns vorbei, ich zähle sie. Als ich bei fünfzig ankomme, habe ich keine Lust mehr. Das nächste Auto ist auch ein Ringauto, ein schwarzes. Ich fange von vorne an und zähle nur die Ringautos. Nach dreiunddreißig kann ich aufhören, denn Herr Meyer hat irgendwo angehalten.
Er und Frau Krause steigen aus und öffnen uns die Türen. Die Frau sagt: „Wir sind da. Ihr werdet erst einmal bei Familie Steiner bleiben.“ Der Türaufhalter holt unsere Schultaschen aus dem Kofferraum und geht dann zur Haustür. Er braucht nicht zu klingeln, denn die Tür öffnet sich bereits. Eine Frau mit kurzen, braunen Haaren und einer Brille erscheint in der Tür. Sie gibt Herrn Meyer die Hand zur Begrüßung und nimmt ihm unsere Schultaschen ab, die sie in den Hausflur an die Wand stellt.
Inzwischen sind wir ausgestiegen und stehen vor dem Auto, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. Die fremde Frau kommt auf uns zu und lächelt freundlich. Sie begrüßt uns und nennt uns ihren Namen. Sie heißt Maria und wohnt in diesem Haus mit der Nummer siebzehn. Die Hausnummer besteht aus alten Zahlen. Sie sind weiß und haben einen blauen Hintergrund. Maria mag wohl gerne Blumen, denn auf allen Fensterbänken stehen Blumenkästen, die mit bunten Blumen bepflanzt sind. Ich sehe auch lila Blüten in den Blumenmeeren. Lila ist Mamas Lieblingsfarbe und meine Schwester mag sie auch gerne.
Maria nimmt uns nicht mit ins Haus, sondern führt uns um ihr Haus herum. Wir müssen drei Stufen hochgehen und kommen an einer Terrasse an. Ein großer, weißer Sonnenschirm spendet über den Möbeln viel Schatten. Maria bietet uns allen Platz an und fragt nach, wer etwas trinken möchte. Die Erwachsenen nehmen gerne Mineralwasser, wir antworten nicht. Maria stellt uns auch Gläser hin und gießt sie halb mit Wasser voll. Die Frauen beginnen ein Gespräch und der Türöffner bringt sich darin ein.
Ich höre nicht zu. Es ist mit egal, was sie sagen. Ich schaue lieber den Luftblasen in meinem Wasserglas bei ihrem Spiel zu. Sie veranstalten ein Wettrennen. Ich favorisiere eine Luftblase und hoffe insgeheim, sie würde es als erste an die Wasseroberfläche schaffen. Wie gebannt schaue ich ins Glas, bis mich jemand am Arm berührt und ich aufblicke.
Maria streichelt sanft meinen Arm und fragt: „Hast du verstanden, was ich eben gesagt habe?“ Ich antworte nicht und schaue wieder ins Wasserglas. Ich versuche meine Luftblase wieder zu finden und bin enttäuscht. Wo eben nur meine Blase war, sind jetzt viele. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen hat.
Die Leute vom Jugendamt stehen auf und sagen uns, sobald sie einen Schlüssel von unserem Haus hätten, würden sie mit uns dahin fahren und unsere Sachen holen. Sie würden vorher anrufen. Dann gehen sie und Frau Krause winkt uns noch einmal zu.
Maria fordert uns auf zu trinken, es sei so heiß. „Ihr habt doch bestimmt Hunger. Ich hole euch Brot und Aufschnitt, dann könnt ihr erst einmal was essen.“ Solveigh fängt an zu weinen und schreit: „Ich will nichts essen. Ich will zu Mama und Papa!“ In ihrer Wut schmeißt sie ihr Wasserglas vom Tisch und erschrickt über das Geräusch des zerbrechenden Glases. Maria setzt sich neben sie auf die Bank und nimmt sie in den Arm. Einen kurzen Moment versucht meine Schwester sich dagegen zu wehren, doch ihre Angst ist zu groß und sie lässt die Frau gewähren.
Meine Schwester kann weinen, ich kann es nicht. Ihr kleiner Körper bebt vor Schmerz in Marias Armen, bis nur noch ein leises Schluchzen von ihr kommt. Ich sitze einfach nur da und schaue den beiden zu. Es ist ein falsches Bild. Solveigh sollte nicht von einer Fremden getröstet werden, sondern von Mama. Diese Frau sollte Mama sein. Ich verstehe das nicht.
Marias T-Shirt ist auf der linken Seite ganz nass von Solveighs Tränen. Es scheint die Frau nicht zu stören. „Ich fege jetzt die Scherben auf und dann zeige ich euch alles. Wir haben auch Tiere. Vielleicht mögt ihr sie ja. Unsere Hasen haben Junge bekommen, die sind sehr niedlich.“ Maria geht ins Haus und kommt mit Schaufel und Handfeger zurück. Sie fegt die Glasscherben auf und stellt alles an die Seite.
So wie wir den anderen Erwachsenen eben gefolgt sind, folgen wir auch ihr. In dem Garten wachsen noch viel mehr bunte Blumen. Es gibt auch Bäume und Sträucher. Maria hat ihr eigenes Obst und Gemüsebeete. Am Erdbeerbeet pflückt sie ein paar Beeren und hält sie uns hin. Meine Schwester liebt Erdbeeren und kann nicht widerstehen, sie greift zu. Ich will keine Erdbeeren und Maria gibt alle Früchte meiner Schwester, die sie dankend nimmt.
Am Ende der Gemüsebeete gelangen wir durch ein Tor zu einem Schuppen. An einer Seite ist ein eingezäuntes Stück Wiese. Darauf steht ein Unterstand, der mit Stroh ausgelegt ist. Die Hasenjungen zaubern Solveigh ein Lächeln aufs Gesicht. „Sind die süß. Darf ich die kleinen Hasen mal streicheln?“ Maria erklärt, sie seien erst wenige Wochen alt und die Mama will noch nicht, dass sie gestreichelt werden. Vielleicht klappt es bald.
Eine Weile bleiben wir noch bei den Hasen, dann gehen wir zurück und Maria zeigt uns ihr Haus. Es ist gemütlich. Durch die großen Fenster ist das Haus sehr hell. Die gelbe Farbe an den Wänden passt gut zu dem braunen Holz der Türen und Rahmen. Maria mag wohl gerne alte Sachen, denn überall stehen irgendwelche alten Dinge oder Möbel.
Solche Dinge haben wir schon auf Flohmärkten gesehen. Papa sucht gerne nach Teilen für seine Eisenbahn und Mama hat mit uns nach schönen Büchern gesucht. Papa hat nicht immer Glück, wir aber schon. Bei jedem Besuch finden wir tolle Bücher.
Maria erzählt uns von den Menschen, die hier mit ihr leben. Sie hat einen Mann, der Peter heißt. Sie haben zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Der Sohn heißt Lasse und ist sechzehn Jahre alt und die Tochter heißt Annabel und ist zwölf. Die beiden kommen heute später aus der Schule. Peter ist noch bei der Arbeit und kommt erst am Abend nach Hause.
Marias Haus ist sehr groß. Viel größer als unseres. Jeder Raum ist größer als bei uns Zuhause. Unten ist eine riesige Küche mit einem langen Tisch, an dem zehn Leute sitzen können. Im Wohnzimmer ist ein Kamin aus roten Steinen. Das Sofa geht an zwei langen Wänden entlang und zwei dicke, kuschelige Sessel stehen in der Nähe. Außerdem gibt es noch ein großes Badezimmer mit einer Dusche und einer Badewanne, in der eine ganze Familie baden kann.
Solveigh ist sofort von dieser Wanne begeistert und fragt Maria, ob sie darin mal schwimmen dürfe. Die Frau lacht und verspricht ihr, dass sie es heute Abend ausprobieren könne. Unten gibt es noch zwei weitere Räume, einen Vorratsraum und ein Bügelzimmer. Eigentlich war dieser Raum mal ein Spielzimmer. Marias Kinder sind jetzt zu alt für ein Spielzimmer und sie wollen es nicht mehr haben.
Über eine Wendeltreppe gelangen wir nach oben. Auch hier scheint die Sonne durch große Fenster und alles ist so hell. Lasse und Annabel haben jeder ein eigenes Zimmer. Maria und Peter haben eins zusammen, so wie Mama und Papa. Dann zeigt Maria uns noch zwei Zimmer. In jedem stehen zwei Betten, Regale und zwei Kleiderschränke. Sie sagt uns, wir dürften uns aussuchen, ob wir zusammen ein Zimmer möchten oder jede von uns ein eigenes wolle.
Für Solveigh ist es logisch, dass wir zusammen in einem Zimmer schlafen, weil sonst jede ein Bett frei hätte. Vielleicht käme noch Besuch, der übernachten möchte, der könne dann im anderen Zimmer schlafen. Mir ist es egal, auch wenn ich Zuhause mein eigenes Zimmer habe. Ich habe keine Einwände und meine Schwester lächelt mich dankbar an. Maria öffnet die Schränke und zeigt uns die Dinge, die sich darin befinden. Sie legt auf jedes Bett frische Bettwäsche und gibt uns Kleidung, die wir erst einmal anziehen können. Sie hat auch direkt zwei Nachthemden zur Hand, die sie ebenfalls auf die Betten legt. Anschließend zeigt sie uns Bücher und Spielsachen. Solveigh stöbert sofort in den neuen Dingen und ich sehe ihr dabei zu. Maria bezieht unsere Betten und legt die Nachthemden unter die Kopfkissen.
Irgendwann hält meine Schwester strahlend ein Buch hoch und sagt: „Louna, Maria hat auch „Alice im Wunderland“, das können wir doch heute Abend lesen.“ Ich sehe sie nur an und sie legt das Buch zur Seite, ohne eine Antwort abzuwarten. Sie weiß, es wird ihr vorgelesen.
Die Haustür öffnet sich und Stimmen dringen nach oben. Es sind Marias Kinder. Sie geht hinunter, um sie zu begrüßen und ihnen von uns zu erzählen. Die beiden folgen ihrer Mutter nach oben und strecken uns eine Hand zur Begrüßung hin. Mechanisch bewegt sich meine Hand den ihren entgegen, mehr kann sie nicht schaffen. Solveigh mag Annabel sofort und lässt sich von ihr ihr Zimmer zeigen. Lasse geht allein in sein Zimmer und macht dort Musik an.
Ich setze mich auf eins der Betten und starre aus dem Fenster. Maria will mich nicht bedrängen und verlässt den Raum. Sie geht nach unten und ich kann das Klappern von Töpfen und Geschirr hören. Ich weiß nicht, wie lange ich schon so dasitze. Irgendwann kommt Solveigh ins Zimmer gestürmt und will mich zum Essen holen. Ich reagiere nicht und sie versucht mich vom Bett zu ziehen. Sie gibt auf und ruft die Treppe hinunter, dass ich nicht kommen wolle.
Maria kommt nach oben und ihr folgt ein Mann. Es ist Peter, Marias Mann. Er begrüßt mich und stellt sich vor. Er trägt eine blaue Latzhose mit einem Firmenlogo auf dem Latz. Ich kann es lesen und doch wieder nicht. Es ist, als ob es eine mir unbekannte Sprache ist. Seine Hose ist mit schwarzen Schmierflecken übersät und der Kragen seines karierten Hemdes hat auch einige Flecken abbekommen. Am Hals sind schwarze Schlieren zu sehen. Auf den ersten Blick sieht es wie eine Kette aus. Maria sagt mir, falls ich doch noch Hunger bekäme, könne ich runterkommen, sie würde mir etwas vom Abendessen aufheben. Beide verlassen den Raum und Peter schließt die Tür hinter sich.
Mama und Papa sollen zurückkommen! Warum lassen sie uns allein? Was soll jetzt mit uns passieren? Sollen wir für immer bei den Steiners bleiben? Wir brauchen keine neue Familie, wir haben doch eine. Wir sind doch eine Familie, Mama, Papa, Solveigh und ich.
Bitte, kommt zu uns zurück. Lasst uns nicht allein. Sagt uns was wir tun sollen, damit ihr zurückkommt. Bitte, kommt zu uns zurück.
Ich will schreien, aber ich kann nicht. Ich will weinen und kann dies auch nicht. Ich fühle mich so leer, als ob ich gar nicht mehr existiere.