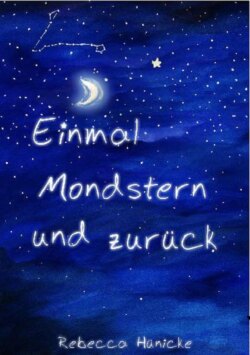Читать книгу Einmal Mondstern und zurück - Rebecca Hünicke - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеEs ist dunkel. Eben war es noch hell. Wo bin ich? Ich liege in einem Bett. Zugedeckt. Ich erinnere mich nicht, mich hingelegt zu haben. Das ist nicht mein Bett, in dem ich liege. Es riecht anders. Es fühlt sich anders an. Meine Matratze ist nicht so hart wie diese hier. Auch mein Kissen ist nicht so dick. Zuhause habe ich noch ein kleines Kuschelkissen, damit ich besser schlafen kann.
So langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Eigentlich ist es nicht richtig dunkel. Das Licht einer Straßenlaterne scheint durchs Fenster und der Mond schwebt am Himmel. Die untere Spitze seiner Sichel lugt am Fensterrahmen vorbei.
Ich bin plötzlich hellwach und stehe auf. Der Mond kommt mir ein Stück entgegen, als ich auf das Fenster zugehe. Sein Licht ist so strahlend hell. Die Umrisse seiner Sichel kann ich deutlich erkennen. Nie zuvor habe ich bemerkt, wie strahlend schön er sein kann. Ob der Mann im Mond jetzt wohl ausreichend Platz hat?
Ich versuche Sterne zu entdecken, leider kann ich aber keinen sehen. Die vielen Wolken ziehen ihre Bahnen am Himmel und veranstalten ein Schattenspiel mit dem Mond, wenn sie ihn passieren. Sie schweben so schnell an ihm vorüber, dass sein ganzes Leuchten von trüben Schatten immer wieder unterbrochen wird. Dieses Erscheinungsbild verleiht ihm Lebendigkeit. Es ist wie ein Daumenkino. Ich versinke im Spiel der Himmelskörper und sehe in jeder Wolke etwas anderes. Einmal muss ich sogar lächeln, weil eine Schnecke einen Hund jagt.
Ich habe immer noch meinen Rock und mein T- Shirt an. Meine Füße sind nackt. Irgendjemand hat mir meine Sandalen ausgezogen und mich zugedeckt. Meine Sachen riechen nicht mehr nach Blumen, wie heute Morgen. Mama hat sie gestern noch frisch gewaschen. Jetzt riechen sie verschwitzt.
Mein Magen knurrt und erinnert mich daran, dass ich zuletzt in der Schule mein Pausenbrot gegessen habe. Ich könnte in die Küche gehen und mir etwas zu essen holen. Ich überlege nur einen kurzen Moment und mein Kopf entscheidet sich dagegen. Mein Bauch will meinen Kopf mit einem lauten Knurren bezwingen- er hat keine Chance.
Ein lautes Aufatmen von Solveigh lässt mich herumfahren. Im ersten Moment glaube ich, sie geweckt zu haben, doch sie dreht sich nur geräuschvoll um und wird wieder ruhiger. Dabei rutscht ihre Decke ein Stück auf den Boden. Ich gehe zum Bett meiner Schwester und decke sie wieder richtig zu. Ihre Locken verdecken ihr Gesicht und ich streiche ihr behutsam einige Strähnen zur Seite. Noch einmal ertönt ein lautes Aufatmen aus ihrem Mund, bevor sie wieder seelenruhig weiterschläft.
Ich gehe zurück zu meinem Bett, setze mich hin und widme mich weiter dem Himmelsschauspiel. Ich schaue ihm noch eine Weile zu, bis mir die Augen schwer werden. Ich will nicht schlafen. So lange der Mond noch da ist, will ich wach bleiben. Mehrmals zwinge ich meine Augen geöffnet zu bleiben, doch sie wollen einfach nicht gehorchen. Meine Augenlider drücken sich mit aller Macht nach unten. Sie wollen mich in den Schlaf zwingen. Ich versuche sie auszutricksen. Ich lege mich hin und lasse meine Füße auf dem Boden, damit ich es unbequem habe. Einen Moment habe ich die Oberhand, denn so können sich meine Augen nicht aufs Einschlafen konzentrieren. Mein Siegestriumpf währt nur kurz, ich schlafe doch ein.
Solveigh kommt in mein Bett und kriecht unter meine Decke. Blinzelnd erwache ich, denn die Sonne blendet mich. Die Luft im Zimmer ist bereits von der Sonne erwärmt. Es ist eine wohlige Wärme. Ich spüre die Macht der Sonne auf meinem Gesicht. Es fällt mir schwer, meine Augen richtig zu öffnen. Ein orangeroter Lichtschleier legt sich über meine Augen. Ich muss mich umdrehen, um meine Augen zu öffnen. Solveighs Gesicht ist ganz nah an meinem. Für einen Moment habe ich das Gefühl in ihren strahlend blauen Augen zu versinken.
Meine Schwester lächelt mich an und kuschelt sich näher an mich heran. Ich will das nicht und rücke ein Stück von ihr weg. Ruckartig schnellen ihre Hände unter der Bettdecke hervor und sie hält mir etwas entgegen. Es ist ein Kuscheltier. Sie wirbelt es hin und her, sodass ich nicht erkennen kann, was es für ein Tier ist. „Das ist Anton. Annabel hat ihn mir gestern ausgeliehen, weil ich Piepsi nicht bei mir haben kann. Er riecht nicht so gut wie sie, aber ich konnte mit ihm einschlafen.“
Solveigh hat das Nachthemd von Maria an, es ist pink mit einer Fee darauf. Sie lacht und versprüht mit ihrem Zauberstab kleine, bunte Sterne. Meine Schwester riecht nach Schlaf und ihre Haare duften nach Kokos. Eine lockige Strähne streift mein Gesicht und ich spüre sie kaum auf meiner Wange. Es fühlt sich seidig an. Wahrscheinlich war sie gestern noch in der riesigen Badewanne. Mama hat noch nie so ein Shampoo gekauft. Es riecht so frisch und süß.
Es ist so wie die kleinen weißen Kokoskugeln, die Papa so gerne isst. Am liebsten isst er sie, wenn sie kalt sind. Mama stellt sie ihm jedes Mal in den Kühlschrank, wenn sie ihm welche gekauft hat. Sie sind immer in der gleichen Ecke, unten links auf der Glasscheibe.
Die Tür öffnet sich und Maria kommt herein. Sie stellt sich vor mein Bett und wünscht uns einen guten Morgen. Solveigh erwidert ihren Gruß, strahlt sie dabei aber nicht an. Maria bittet uns zum Frühstück herunter. Meine Schwester steht auf und legt Anton in ihr Bett. Ihre Kleidung ist nicht da, denn Maria hat sie gewaschen. Sie geht an einen der Kleiderschränke und hält Solveigh ein hellblaues Kleid mit weißen Blüten hin. Sie nickt Maria zu und nimmt das Kleid entgegen. Maria sagt mir, ich könne erst einmal duschen oder baden, bevor ich zum Frühstück komme.
Während sich Solveigh umzieht, gehe ich runter ins Badezimmer. Auf einer kleinen Holzbank liegen Handtücher und Kleidung für mich bereit. Ich sehe in den großen, runden Spiegel, der über dem Waschbecken hängt. Irgendwann starre ich nur noch ein lebloses Gesicht an. Es ist mein Gesicht. Ich erkenne mich nicht richtig wieder. Gestern Morgen habe ich noch anders ausgesehen. Mein Blick ist leer und hoffnungslos. Ich will das Gesicht fragen, wer es wirklich ist. Aber es wäre sinnlos. Es würde mir nur antworten, es sei ich. Ich würde es anzweifeln und wir würden diskutieren. Das will ich nicht. Ich bin zu müde dafür.
Ich ziehe mich aus und entdecke auf dem Wannenrand eine Flasche Shampoo. Es steht Kokos darauf. Ich ergreife sie und öffne den Deckel. Es entsteht dieses typische Knackgeräusch, wenn man Shampoo Flaschen öffnet. Sofort schlägt mir dieser frische, süßliche Duft entgegen. Ich will mehr von diesem Duft riechen und halte mir die Flasche direkt unter die Nase. Ich schließe meine Augen und muss an Solveighs seidigen Haare denken. Ich möchte, dass meine Haare sich auch so anfühlen und so gut duften.
Mit dem Shampoo in der Hand drehe ich mich um und sehe noch einmal in den Spiegel. Das andere Ich ist nicht verschwunden. Es ist noch existent. Es ist kein Traum. Graue Augen fixieren mich. Es sind meine Augen. Dunkelblonde Haare umrahmen mein Gesicht. Es sind meine Haare. Das rechte Ohr ist nicht vollständig von diesen Haaren bedeckt und ein roter Ohrstecker in Hufeisenform sticht hervor. Es ist mein Ohrstecker. Im Spiegel, das bin ich und doch bin ich mir fremd.
Die warmen Wasserstrahlen prasseln auf mein Gesicht und wandern von dort über meinen Körper. Die Wärme hüllt mich ein und lässt mich für einen Moment vergessen. Die Duschtür beschlägt allmählich und verwehrt mir bald einen klaren Blick in den Raum. Das warme Wasser umschließt mich immer enger. Meine Arme hängen herunter und drücken sich an die Seiten meines Körpers. Ich senke den Blick und verfolge das Wasser zum Abfluss. Schnell bahnt es sich einen Weg zu den sechs Löchern am Boden, die es verschlingen. Kaum hat es den Boden erreicht, versinkt es in einem tiefen, dunklen Abgrund. Ich beneide das Wasser um seine Fähigkeit. Ich will zu Wasser zerfließen und ihm ins Unendliche folgen.
Ein kaltes Nass lässt mich erschaudern und sagt mir, wo ich bin. Das Wasser ist inzwischen kalt und ich drehe schnell den Hahn zu. Auf der Ablage sehe ich die Flasche Kokosshampoo stehen. Ich rieche an meinen Haaren und sie verströmen nicht den Kokosgeruch wie bei meiner Schwester. Ich resigniere, denn das Wasser ist kalt. Ich verlasse die Dusche und trockne mich ab. Das weiße Handtuch von Maria ist flauschig weich und es riecht sauber.
Mamas Handtücher haben einen leichten Lavendelgeruch. Lavendel hat Mamas Lieblinsfarbe.
Es klopft an der Tür und Maria fragt, ob ich Hilfe bräuchte. Ich antworte ihr nicht. Sie kommt herein und fragt: „Möchtest du frühstücken? Solveigh und ich spielen Memory. Sie will auf dich warten.“ Ich starre sie an und kurz darauf geht sie zurück in die Küche.
Ich zögere beim Anziehen. Ich kann mich nicht überwinden, Marias Sachen anzuziehen. Meine Hand schafft es nicht, sie anzufassen. Ich blicke auf beide Wäschestapel. Meine eigenen Sachen gehören mir und sie sind von Mama und Papa- von Zuhause. Ich entscheide mich für meine eigene Kleidung.
Mir wird übel und Sterne tanzen vor meinen Augen. Ich zittere und muss mich auf den Fußboden setzen. Mein Herzschlag pocht laut in meinen Ohren und ein Rauschen wie eine starke Wasserströmung zwingt mich, die Augen zu schließen. Ein durchdringendes Schwarz mit bunten Leuchtpunkten lässt mich für einen Moment alles um mich herum vergessen. Langsam legt sich der Sturm in meinem Körper nieder und ich kann meine Augen wieder öffnen. Ich stehe auf und ziehe mich weiter an.
Solveigh und Maria spielen noch immer Memory. Der Pärchenstapel von meiner Schwester ist höher, als der von Maria. Solveigh freut sich, dass sie das zweite Spiel auch schon fast gewonnen hat. Sie sitzt auf der Küchenbank und links von ihr ist für mich eingedeckt. Ich setze mich neben sie und warte auf das Ende des Spiels. Solveigh will ihr Glück weiter herausfordern. Ich will nicht spielen- sage es ihr aber nicht.
Maria räumt das Spiel weg und fordert uns auf, uns zu bedienen. Meine Schwester greift gezielt zu Brot und Käse, dann nimmt sie die Kanne mit Kakao und gießt uns beiden etwas ein. Ich zögere noch eine Weile, bevor ich eine Scheibe Brot nehme. Belegen will ich es mir nicht.
Als Maria und Solveigh den Tisch abräumen, liegen nur noch ein paar Krümel auf meinem Teller und meine Tasse ist geleert. Ich wundere mich über diese Veränderung, denn ich kann mich nicht ans Essen und Trinken erinnern.
Solveigh nimmt das Memory- Spiel vom Küchenschrank und legt die Karten auf den Tisch. Es ist eine Variante mit Tierpärchen. Einige Bilder findet sie besonders niedlich und zeigt mir Elefanten, Giraffen und Schimpansen. Dann verdeckt sie alle Tierkarten und mischt sie mehrmals. Als sie die ersten zwei Karten aufdecken will, klingelt es an der Haustür.
Maria steht auf und öffnet sie. Sie begrüßt mehrere Personen. An den Stimmen erkenne ich Frau Krause und den Türaufhalter. Auch sie grüßen. Die drei betreten die Küche. Maria klärt uns über ihren Besuch auf.
Wieder ist es Frau Krause, die zuerst mit uns spricht. „Wir haben von der Polizei euren Haustürschlüssel bekommen. Ihr wollt bestimmt eure eigenen Sachen haben. Wir wollen mit euch und Frau Steiner zu euch nach Hause fahren, damit wir eure Sachen holen können.“ Sie betont ihre Sätze so, als ob wir einen schönen Ausflug machen würden und lächelt uns dabei an.
Meine Schwester verwirrt ihr Gerede. „Wenn du unseren Schlüssel hast, können Louna und ich zu Hause bleiben. Wir können dann immer wieder ins Haus, wenn wir aus der Schule kommen oder draußen gespielt haben oder einkaufen waren.“ Der Türaufhalter sagt auch etwas. „Das geht nicht. Ihr seid Kinder und Kinder können nicht alleine wohnen. Eure Eltern sind nicht mehr da. Jetzt müssen sich andere Erwachsene um euch kümmern. Jemand wie Herr und Frau Steiner.“
Maria sieht Herrn Meyer böse an, weil er wie eine Computerstimme redet. Solveigh starrt ihn mit großen Augen an und kämpft gegen ihre Tränen an. Ihre Unterlippe fängt an zu zittern und ihr fehlt die Kraft, dagegen zu halten. Dicke Tränen kullern über ihre Wangen, auf ihr Blumenkleid. Ein Tränenmeer ergießt sich wie ein Regenschauer über die Blumen. Maria nimmt meine kleine Schwester in den Arm und versucht sie zu trösten.
Auch Frau Krause schüttelt verständnislos den Kopf Richtung Türaufhalter. Nun ist ihm sein Auftreten peinlich und er schaut verlegen aus dem Fenster. Frau Krause meint, es wäre besser, wenn Frau Steiner mit uns in ihrem Auto hinterher fahren würde. Maria nickt zustimmend und sie kann Solveigh zum Aufstehen bewegen.
Herr Meyer und Frau Krause fahren im roten Ringauto vor und wir folgen ihnen in Marias Auto. Inzwischen hat Solveigh sich beruhigt und kann wieder reden. Sie erzählt von unserem Haus und ihrer Ente Piepsi, die sie unbedingt mitnehmen will. Sie zählt eine Liste von Dingen auf, die ihr fast genauso wichtig sind. Für mich hat sie auch eine Liste und erwartet meine Zustimmung. Ich antworte nicht und sie erzählt Maria von ihrer Freundin Nelly aus der Schule.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe bekannte Dinge, die keine Bedeutung für mich haben. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon gesehen habe und es ist mir egal. Nur einen kurzen Augenblick sehe ich Solveigh an. Sie hat heute keine Zöpfe. Nicht mal einen praktischen Zopf. Das macht Mama immer, jeden Morgen. Mama war wohl heute Morgen nicht da.
Meine Schwester zappelt in ihrem Sitz herum und plappert ununterbrochen weiter, weil wir gleich an unserem Haus ankommen. Sie sieht bekannte Menschen und nennt ihre Namen. Sie erzählt auch, wer in welchem Haus wohnt oder in welchen Geschäften wir einkaufen. Maria hat eine Engelsgeduld mit meiner Schwester und hört ihr aufmerksam zu. Je näher wir unserem Haus kommen, desto aufgeregter wird sie.
Das rote Ringauto fährt zuerst in unsere Hofeinfahrt und dann wir. Maria öffnet unsere Autotüren und ich steige aus. Solveigh ist plötzlich ganz still und guckt komisch zu Boden. Maria schnallt sie ab und fragt, warum sie nicht aussteigen wolle. Langsam dreht sie der Frau ihr Gesicht zu und flüstert ihr etwas ins Ohr. Und sie flüstert meiner Schwester etwas zurück. Ich kann es nicht hören. Als sie aussteigt, sehe ich, dass Solveighs Kleid vorne nass ist. Maria nimmt sie an die Hand und sie geht hinter ihr her.
Herr Meyer hat inzwischen unsere Haustür aufgeschlossen und hält für alle die Tür auf. Frau Krause geht als Erstes, dann Maria mit Solveigh. Ich will ihnen nicht folgen. Es ist ein falsches Bild. Die fremden Menschen gehören nicht in unser Haus. Ich starre die Hauswand an und fange an, alle Fenster zu zählen. Ich zähle einmal, zweimal, dreimal, immer weiter. Nach jedem Zählen habe ich bereits das Ergebnis sofort vergessen und beginne von vorne, bis Maria meine Hand nimmt und ich ihr irgendwie folge.
Es sind nur zwei Stufen bis zur Haustür und doch dauert es eine Ewigkeit, bis ich durch sie hindurchgehen kann. Herr Meyer wartet, bis wir im Flur sind und schließt hinter mir die Tür. Er schließt sie zu schnell, und der laute Knall erschreckt mich. Ich zucke zusammen. Maria erschreckt sich ebenfalls und lässt meine Hand los. Solveigh starrt mich mit großen Augen an.
Es ist dunkel im Flur, weil er keine Fenster hat. Die Türen der einzelnen Räume sind teilweise geöffnet, aber das Tageslicht reicht nicht aus, um den Flur richtig zu erhellen. Unsere Augen müssen sich auf das trübe Licht einstellen. Das Weiße in den Augen meiner Schwester sticht hervor und verleiht ihr für einen Moment das Aussehen einer Gespensterpuppe. Dieses Gesicht ist irgendwie gruselig. Maria schlägt vor, zuerst unsere Sachen einzupacken. Die Leute vom Jugendamt nicken uns zu und gehen einfach in unsere Küche.
Mama und Papa finden so ein Benehmen unhöflich. Man wartet auf eine Einladung oder fragt um Erlaubnis.
Solveigh geht die Treppe nach oben, direkt in ihr Zimmer. Sie geht hinter die Tür und zieht ihre nassen Sachen aus. Sie weiß schon, was sie anziehen will, denn sie greift gezielt zu einem Kleiderbügel und streift das neue gelbe Kleid vom Bügel. Flink lässt sie es über ihren Kopf gleiten und zieht anschließend eine neue Unterhose an.
Die Kinderzimmertür steht einen Spalt offen. Der bunte Schriftzug ihres Namens auf der Tür sieht verrutscht aus. Sie mag es gerne kunterbunt, deshalb hat jeder Buchstabe eine andere Farbe und ist mit verschiedenen Mustern verziert.
Solveigh liebt „Pippi Langstrumpf“. Als Mama uns das Buch vorgelesen hat, hat meine Schwester unser Haus auf den Namen „Villa Kunterbunt“ getauft. Sie hat dafür sogar eine kleine Feier geplant. Die hat sie mit einer Haustaufe eröffnet. Solveigh hat mit unserem Gartenschlauch unser Haus rundherum nass gespritzt. Anschließend haben wir vier Schokomuffins mit bunten Streuseln gegessen. Die hat sie extra mit Mama dafür gebacken. Das Beste an der Feier war das Pippi- Spiel. Solveigh hat alles Mögliche in ihr Zimmer gestellt: Stühle, Hocker, Eimer und Kisten. Wir mussten von einem Teil auf das andere gelangen, ohne den Boden zu berühren. Das war ein großer Spaß. Mama wollte ihr nicht den Spaß verderben und hat sofort eingewilligt. Papa fand die Idee für seine Kinder toll, für sich selbst nicht. Meine Schwester konnte ihn noch überreden. Und dann hatten wir alle großen Spaß. Solveighs Freude und gute Laune konnten Papas Herz erweichen, sodass auch er schnell Spaß an der Sache hatte. Nach unzähligen Runden sind wir lachend in ihr Bett gefallen und Papa hat das Pippi- Spiel zur besten Spielidee ernannt. Beim Abendessen haben wir noch lange über das lustige Spiel geredet und Solveigh erklärte uns, dass sie eigentlich das richtige Pippi- Spiel mit den Scheuerbürsten unter den Füßen spielen wollte. Sie konnte den Teppich nicht aus ihrem Zimmer bekommen und hatte sich deshalb eine andere Variante überlegt. Mama schaute überrascht und meinte, ihr Pippi- Spiel sei viel besser.
Als ich das Zimmer betrete, sitzt Solveigh auf ihrem Bett und drückt ihre Ente Piepsi ganz fest an ihr Gesicht. Maria setzt sich zu ihr und lässt ihr einen Moment Zeit. Ich bleibe in Türnähe stehen und sehe meiner Schwester beim Kuscheln zu. Maria hat inzwischen einen Arm um sie gelegt. Die Frau auf Solveighs Bett, die dort nicht sein sollte, sieht mich an und fragt: „Willst du schon mal in dein Zimmer gehen?“ Ich sage nichts und starre sie an. Ich will nicht in mein Zimmer gehen, aber auch nicht bei Solveigh und ihr bleiben. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Von unten dringen Geräusche von Schritten nach oben. Frau Krauses Schritte sind lauter, weil sie Klackerschuhe anhat. Der Türaufhalter hat einen schnellen und festen Schritt.
Meine Schwester steht mit Piepsi auf und geht zu ihrem Kleiderschrank zurück. Maria folgt ihr. Gemeinsam legen sie ihre Sachen aufs Bett. Es werden mehrere Stapel. Solveighs Reisetasche reicht nicht für alles. Sie geht zur Abstellkammer und holt noch einen großen Koffer. Es ist Papas großer schwarzer Koffer. Er ist so groß, dass sie selbst darin eingepackt werden könnte. Papa hat das mal zum Spaß gemacht. Der Koffer ist zu groß für sie und unhandlich zu tragen. Maria geht ihr entgegen und befreit sie von dieser Last. Erleichtert lässt sich Solveigh helfen.
Maria legt das Ungetüm auf den Boden und öffnet es. Stapel für Stapel verstaut sie in ihm und trotzdem ist er kaum ausgefüllt. Eine große Leere umgibt Solveighs Sachen. Diese Leere fasziniert mich. Mein Blick kann sich nicht von ihr lösen. Ich überlege, ob ich mich ganz klein mache, vielleicht passe ich noch hinein.
Der Abgrund verändert seine Form. Sein Loch wird kleiner. Hämisch grinst er mich an. Er will mich nicht zu sich lassen und wird immer kleiner.
Solveigh spricht mit mir. Sie ist mit Packen fertig und will mit mir in mein Zimmer gehen. Sie ergreift meine Hand und zieht mich hinter sich her. Mein Abgrund ist geschlossen.
Die türkisenen Buchstaben meines Namens kann ich nicht sehen, denn meine Zimmertür steht auf. Ich bleibe im Türrahmen stehen, weil meine Beine schwer werden und meine Füße nicht gegen diese Last ankommen.
Solveigh und Maria warten darauf, dass ich weitergehe und fordern mich mehrmals dazu auf. Meine Schwester albert mit ihrer Ente herum und meint, sie bräuchte Platz zum Fliegen. Sie versucht mich mit Piepsi ins Zimmer zu schubsen. Maria unterbricht sie in ihrem Spiel. Dann legt sie ihre Hände auf meine Schultern und redet mir leise zu.
Ich sehe aus dem Fenster und hinter mir packen Solveigh und Maria meine Sachen ein. Sie flüstern jetzt. Warum, weiß ich nicht.
Auf der Straße fährt ein Mann auf seinem Fahrrad an mir vorbei. Er trägt einen weißen Helm mit blauen Streifen, die mittig über die Oberfläche entlang laufen, von vorne nach hinten oder anders herum. Er trägt kurze Sachen und eine Sonnenbrille. Ich erkenne sein Gesicht nicht, aber seinen Helm habe ich schon einmal gesehen. Zwei Autos überholen ihn, ein kleines rotes und ein großes silbernes. Bevor sie ihn überholen, verlangsamen sie ihre Geschwindigkeit und fahren langsamer an ihm vorbei.
Die Äste unserer Kastanie bewegen sich sacht im Wind, so, als ob sie mir zuwinken wollten. Ein schwarzer Vogel mit orangem Schnabel lässt sich auf einem der Zweige nieder und sieht mich durchs Fenster an. Es ist eine Amsel. Bewegungslos sitzt sie da und blickt mich an. Und ich sie auch. Es ist wie das Spiel, wer am längsten dem anderen in die Augen sehen kann. Wer zuerst wegschaut oder lacht, der hat verloren.
Ich verliere, weil Solveigh mich berührt und ich erschrecke. Ich habe meinen Blick dabei gesenkt. „Wir sind fertig mit Packen. Wir gehen wieder runter.“
Meine Schwester ist unsere Anführerin. Sie geht wieder vor. Je näher wir nach unten kommen, desto lauter dringen die Stimmen von Frau Krause und Herrn Meyer zu uns. Maria hat zwei Koffer mitgenommen, die sie an der Haustür abstellt, bevor wir in die Küche zu den anderen gehen. Die Frau lächelt uns an und fragt, ob wir alles hätten. Der Türaufhalter guckt nur gelangweilt und kaut auf seinem Kaugummi herum.
Maria meint, wir könnten in Ruhe durchs ganze Haus gehen, um zu schauen, ob wir noch etwas anderes mitnehmen möchten. Solveigh will noch ihr Fahrrad mitnehmen und zeigt es Maria. Es steht noch im Garten am Zaun, obwohl sie es gestern Abend in die Garage bringen sollte.
Ich bleibe bei den anderen beiden in der Küche stehen und zähle die weißen Fliesen auf dem Boden und die grauen an der Wand zwischen den Küchenschränken. Auf dem Boden zähle ich fünfmal sieben und schätze, wie viele es insgesamt sind. An der Wand zähle ich erst fünfundzwanzig Mal acht und dann noch siebzig Mal fünf. Auch das reicht nicht aus und ich muss eine neue Schätzung machen.
Maria bittet Herrn Meyer, Solveighs Fahrrad in seinen Kofferraum zu packen. Er nickt ihr zu, verlässt kauend die Küche durch die Terrassentür und kümmert sich um das Gefährt. Bei jedem Schritt auf den Küchenfliesen machen seine schwarzen Lackschuhe Quietschgeräusche. Es sind nur wenige Schritte, sodass das Quietschen schnell verstummt.
Unser Esstisch ist vom Frühstück noch nicht abgeräumt. Wir hatten es eilig und Mama wollte unsere Müslischalen später abräumen. Auch das Müsliglas und die Milch stehen noch auf dem Tisch. Solveigh entdeckt die Milch und stellt sie in den Kühlschrank, damit sie nicht verdirbt. Maria spült unsere Müslischalen in der Spüle ab und stellt sie in die Spülmaschine. Anschließend wischt sie den Tisch ab und meine Schwester trocknet ihn ab. Es ist ein falsches Bild. Mama sollte sich um den Tisch kümmern. Solveigh will unsere Lebensmittel aus dem Kühlschrank mitnehmen, weil wir sie noch essen können. Maria holt einen Einkaufskorb aus ihrem Auto, unsere Koffer nimmt sie auf dem Weg dorthin mit.
Als sie wiederkommt, hat sie einen großen Plastikkorb mit dunklen Griffen in einer Hand. Herr Meyer folgt ihr. Meine Schwester öffnet noch einmal den Kühlschrank und gibt Maria die Lebensmittel an, die sie in ihren Korb packt. Das Telefon klingelt und die anderen blicken in die Richtung, aus der das Klingeln kommt. Es klingelt zweimal, dreimal… achtmal. Niemand geht ans Telefon, der Anrufbeantworter geht an. Mama, Papa, Solveigh und ich sagen, dass wir nicht Zuhause seien, aber der Anrufer könne uns nach dem Piep eine Nachricht hinterlassen. Es piept. Niemand will uns etwas sagen. Der Anrufer legt auf.
Solveigh weint. Sie ruft nach Mama und Papa und versucht, sich mit den Händen ihre Tränen wegzuwischen. Sie schafft es nicht. Es sind zu viele und sie kullern sehr schnell über ihr Gesicht. Frau Krause nimmt von Maria den grünen Korb entgegen, damit sie Solveigh trösten kann. Sie kniet sich vor sie hin und meine Schwester legt ihre Arme um Marias Hals und nimmt den Trost entgegen. Ich spüre, wie mich die anderen Erwachsenen ansehen. Es ist mir egal. Ich ignoriere sie.
Wir vier haben dem Anrufer mitgeteilt, es sei niemand zu Hause- es ist gelogen. Solveigh und ich sind zu Hause. Irgendwann ist es wieder ruhig in der Küche. Meine Schwester weint nicht mehr. Maria nimmt meine Hand und wir gehen wieder nach draußen zu den Autos. Der Türaufhalter ist der Erste in unserer Kolonne und macht seinen Job. Während alle anderen in die Autos steigen, schließt er die Haustür ab. Dieses Mal fährt Maria vor und er hinter ihr her.