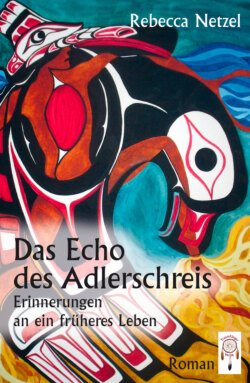Читать книгу Das Echo des Adlerschreis - Rebecca Netzel - Страница 8
DAS BUCH ADLER
ОглавлениеZuerst keimst du auf dem Dotter, und dann keimt in dir dein Bewusstsein, und du schwimmst auf dem Dotter und wirst immer größer. Dann bist du so gewachsen, dass du die Eischale ganz ausfüllst und den Dottersack unter deinem Bauch wie einen Wasserbeutel zusammenpresst, und er reduziert sich immer mehr, das fein blutigrote Geäder zieht sich in deinen Bauch zurück, die roten Verästelungen schrumpfen. Du merkst das daran, dass du nicht mehr schwebst. Irgendwann trägt dich dein Dotterkissen nicht mehr, und mit dem herrlichen Gefühl des eingekapselten Schwebens ist es vorbei. Du spürst zum ersten Mal dein Körpergewicht. Du merkst, dass du ein Eigengewicht hast, und das ist ungewohnt, und du beginnst zu zappeln. Du strampelst, aber in nunmehr beklemmender Enge, und du spürst, dass es nun Zeit ist. Du spürst, wie sich dein Gehäuse mit dir dreht, weil deine Mutter das Ei wendet. Du registrierst zum ersten Mal die Außenwelt. Es ist Zeit.
Dein Körper ist zusammengekrümmt, dein Hals an die Wölbung der Eischale gedrückt. Du versuchst dich zu strecken. Vor deinem Schnabel gibt es eine feine Membran. Dahinter ist Luft. Du durchschlägst die Membran mit deinem Schnabel, und es ist, als ob man einen Erste-Hilfe-Kasten einschlägt, um an die Notausstattung hinter der Glasscheibe zu gelangen. Jetzt läuft die Zeit. Denn der Luftvorrat in der Kammer ist begrenzt.
Mit aller aufflammenden Unruhe presst du dich jetzt gegen die Schale, ritzt mit dem Eizahn; eingeschlossen, feucht, verklebt, beengt. Die Kalkschale ist hart, sie hat dich gut geschützt. Jetzt darf sie dir nicht zum Sarg werden.
Es bröckelt. Die Eimembran ist zäh. Du ritzt und hackst weiter. Plötzlich stößt dein Schnabel durch die Wand. Du bekommst den Kopf frei, drängst, kippst, wackelst – aber der Kopf ist draußen, befreit, du kannst die Außenluft atmen und eine kurze Pause machen, um dich von deinen ersten Anstrengungen in dieser Welt zu erholen.
Doch nicht lange dauert dein Ruhen, Unrast treibt dich weiter. Du musst der Erste sein. Du musst als Erster fressen. Der Zweite zählt nur im Adlernest, wenn dem Ersten etwas zustößt. Du weißt nicht, ob du der Erste bist. Du hast es eilig.
Als du dich freigekämpft hast, machst du dich im Nest breit mit dem ganz selbstverständlichen Egoismus, der Tieren zueigen ist. Du hast keine Mordgelüste. Du willst leben, das ist alles. Tatsächlich findest du dich im Nest augenblicklich als einziger Jungvogel vor. Über dir steht ein riesenhafter Schatten auf knallgelben Hornfüßen – und neben dir liegt, vibrierend und manchmal heftig schaukelnd, ein zweites Ei.
Aber das Bild ändert sich binnen kurzer Zeit. Denn auch das zweite Ei bricht auf, und du bekommst Konkurrenz. Verständnislos starrst du den neben dir an. Er ist feucht, hell und rosig. Dass er so aussieht wie du, weißt du nicht. Du stürzt dich auch nicht in wilder Aggression auf ihn. Du weißt nur, dass du ihm das Futter vor dem Schnabel wegschnappen wirst – ehe er es tut.
Inzwischen hat der Wind deine feuchten Federn getrocknet. Du wirst flaumig. Das spürst du daran, dass dir jeder Windhauch jetzt auf dem Kopf, an Hals und Rücken kribbelt. Auch der neben dir wird flaumig. Aber erst später als du. Dann ist auch er weiß und weich, der Wind spielt in seinen Flaumfedern, und Schnabel und Beine sind trocken und rosig.
Ein frisch geschlüpftes Adlerküken ist keine Schönheit. Der mürrische Schnabel wirkt noch seltsam weich, besonders um die Schnabelwinkel. Das Gefieder ist so weiß wie Greisenhaar, es sieht so ohne Farbe irgendwie unfertig aus. Der dünne, zittrige Hals kann den großen Kopf noch kaum tragen, Kropf und Bauch sind nur ein großer, unförmiger Sack, und die später mal mächtigen Flügel, noch ohne Schwungfedern, nichts weiter als lächerliche Häkchen.
Aber du wirst wachsen. Kaum bewegt sich der Schatten über dir – deine Mutter? dein Vater? – Da hebst du den Kopf und sperrst gierig den Schnabel auf, in der Panik, etwas zu versäumen. Auch der neben dir sperrt seinen Schnabel auf, und eure Köpfe pendeln auf den dünnen Hälsen wie Blumen im Wind.
Du frisst vom ersten Moment an Fleisch. Oder, wenn du ein Seeadler bist, Fisch. Ich war bereits beides, aber an mein vorletztes Leben als Seeadler erinnere ich mich, bedingt durch den Unfall, wesentlich besser, weil ich es als Bilderfolge noch einmal gesehen habe, du weißt schon. Aber diese Bilder wiederum haben weitere Erinnerungen nach sich gezogen, hervorgebracht wie durch einen Sog, ein Strudel, der nach oben kommt und aus ungeahnter Tiefe längst Vergessenes emporwirbelt. Seitdem weiß ich, dass ich noch viel mehr war als nur ein Goldadler oder ein Weißkopf-Seeadler; ich weiß nunmehr, dass ich auch ein Luchs war und ein Puma, ein Büffel und ein Hirsch, auch war ich eine Reihe von ganz anderen Tieren in ganz anderen Ländern; ich war ein Rabe in Norwegen und ein Tiger in Indien, ich war Krokodil in Ostafrika und Schildkröte auf den Seychellen, Schwertfisch im freien Ozean und vieles andere mehr. Auch Wurm war ich und Insekt, und Orang-Utan in den Wäldern Borneos, aber auch Steppenlilie und Mammutbaum und Farn in den grauen Nebelwäldern. Dazu noch in früheren Zeiten Saurier und Säbelzahntiger.
Ich glaube, wohl die meisten Seelen waren zuvor schon vielerlei, doch die wenigsten erinnern sich daran. Dazwischen liegen Styx und Lethe. Bei mir wurde es ja auch erst durch jenen Unfallschock ausgelöst. Da begann ich, mich an frühere Existenzen zu erinnern. Ich war also schon vielerlei. Aber erzählen werde ich jetzt nur von meinem vorletzten Leben, weil ich davon die Bilder gesehen habe, und da war ich eben ein Seeadler gewesen.
Vor dir hängt etwas. Du weißt, dass es Nahrung ist. Du hast noch nie Fisch gesehen, aber niemand muss es dir sagen. Sofort hackst du danach. Die Mutter als Spenderin ist unwichtig. Geduldig hält sie mit dem Schnabel den Fisch hin, genau vor dich. Oder besser: genau vor euch beide. Denn auch der andere braucht keinerlei Erklärungen und hackt frenetisch auf den gummiartigen Fisch ein. Ihr streitet euch zum ersten Mal. Es ist eher ein elendes Piepsen, und doch ist es bitterböse.
Die Mutter wird ungeduldig und schwenkt den Fisch im Schnabel. Der tote Fisch schlenkert hin und her und knallt euch mit seiner Schwanzflosse wie Ohrfeigen um die Köpfe. Ihr seid verblüfft, und dein Bruder sperrt den Schnabel auf und der Fischschwanz hängt ihm zufällig in den Schlund, und sofort beginnt der Bruder, gierig zu schlucken und zu würgen. Aber der Fisch ist zu groß, um ihn im Ganzen zu schlucken. Wutentbrannt schlägst du deinen kleinen Hakenschnabel in den Fischleib und ziehst ihn mit einem Ruck dem Bruder wieder aus dem Rachen, aber du bist selber auch noch nicht richtig fit und fällst mitsamt Fisch hintenüber und kannst ihn gar nicht so schnell fressen. Schließlich zehrt noch jede Bewegung von deinen Dotterresten im Blut.
Doch ehe Brüderchen wieder zuschnappen kann und neuer Streit beginnt, zerreißt die Mutter den Fisch, indem sie sich mit einem Fuß daraufstellt und mit ihrem riesigen Hakenschnabel daran zerrt. Nun hält sie euch mundgerechte Stückchen vor, und es entbrennt ein erbitterter Wettkampf darum, wer sie bekommt. Du drängst den Bruder weg, und er prallt mit seinem Kopf gegen deinen und versetzt dir einen Stoß, und du versuchst, nach ihm zu hacken. Aber irgendwie werden beide satt.
Dann liegt man erschöpft hechelnd im Horst, und innen ist es mäßig weich, aber der Horstrand ist hart und holzig und wie eine Festung aus dicken Ästen und Zweigen, stabil miteinander verkantet. Der Horst ist schon sehr alt und von deinen Eltern und Großeltern und sicher schon deren Eltern benutzt worden, und jeder hat ein wenig daran herumgebastelt und repariert und dazugebaut. Im Sommer füllt er sich recht rasch mit Zecken und Milben und anderen unangenehmen Parasiten, und es liegen wohl auch Fischgräten herum und der Nestrand wird beschmutzt, weil man gerade über den Rand macht; aber die Winterregen waschen alles wieder ab, und der Horst ist für das nächste Jahr blank und sauber. Im Frühjahr wird das Nest dann von den balzenden Adlerpaaren frisch mit grünen Zweigen geschmückt.
Da liegst du also und hechelst, und weil ihr beide satt seid, herrscht auch momentan Frieden im Nest. Das merkt auch eure Mutter und hört auf, euch zu beobachten. Sie streckt ihren weißen Kopf vor und beäugt den Himmel. Es naht etwas.
Plötzlich rauscht es heftig, und man hört den dumpfen Aufprall von schweren Tritten. Die Zweige und Stöckchen am Nestrand ächzen. Ein zweiter Schatten fällt auf euch, ihr liegt jetzt wie unter einer großen gefiederten Kuppel: Der Vater ist zum Horst gekommen.
Eine Weile sehen beide Altvögel vertraut und entspannt aneinander vorbei oder besser: sie haben sich jeweils seitlich im Blick. Ihre bernsteingelben Augen leuchten, von stilettförmigen schneeweißen Federn umkränzt. Der heftige Frühjahrswind zerrt beiden Altvögeln im Nackengefieder und sträubt es wie eine Federhaube. Man braucht aber nur den Kopf drehen, und derselbe Wind streicht das Gefieder glatt. Die beiden tun es.
Eine Weile zupft sich die Mutter mit dem Schnabel einige Federn an den Schultern glatt, dann gibt sie sich plötzlich einen Stoß und wirft sich in die Luft. Sie gleitet davon, und ihr vergesst sie sogleich. Aber es ist ja noch einer da, und das beruhigt.
Der Vater hat damit gerechnet, dass die Mutter fortfliegt; er ist gekommen, um sie am Nest abzulösen, und bleibt daher ruhig sitzen. Sonst ist es immer unheimlich ansteckend für einen Vogel, einen anderen fortfliegen zu sehen, und meist fliegt er hinterher.
Es war ein gutes Jahr. Sogar Brüderchen wuchs heran, obwohl er bedeutend schwächer und leichtgewichtiger blieb als ich, weil ich ihm alle Fische aus dem Schnabel zu ziehen versuchte und es oft auch schaffte. Aber es gab letztlich doch Fische genug, und auch der Sommer war klimatisch günstig, kein Fluss führte Niedrigwasser und der Spätsommer war so mild, als hätte der Winter beschlossen, noch lange hinter dem Horizont im Norden zu warten.
Uns sprossen dunkle Federn im hellen Flaum, und das sah ganz merkwürdig aus. Schließlich bekamen wir lange graue Schäfte an den Armen, in die noch die Schwungfedern für unsere künftigen Flügel eingeschlossen waren. An den Schultern hatten wir bereits richtige Federdecken, man sah so deutlich wie nie wieder in unserem späteren Leben, mit welchem System unser Federkleid von der Natur angelegt war. Nach und nach schoben sich die weißen Babydaunen, von den neuen Federn verdrängt, nach oben und flatterten wie Wollflöckchen auf dem neuen glatten Kleid hin und her, bis sie schließlich vom Wind davongetragen wurden. Auch unsere flaumigen Kröpfe verschwanden unter dem spiegelnden dunklen Federkleid, das uns ganz neue Konturen gab.
Wie ich mich erinnere, so hatten wir Jungvögel noch nicht die leuchtend schneeweißen Federn am Kopf wie unsere Eltern, sondern sie waren dunkel. Aber wie lange unsere Köpfe dunkel blieben, weiß ich nicht mehr, es war doch etwas zu viel, was ich in der Rückblende alles gesehen habe, um sich noch an alle Details erinnern zu können. Ich weiß nur, dass ich nach vier Wintern voller blendend weißen Schneeflocken ebenfalls einen weißen Kopf hatte, oder waren es fünf Winter? Jedenfalls für den ganzen Rest meines Adlerlebens erinnere ich mich deutlich an meinen weißen Kopf, dessen Federn ich mähnenartig sträuben konnte, nur für meine Jugendzeit weiß ich es eben nicht mehr zu sagen.
Ebenso weiß ich nicht mehr, ob die Mutter uns anfangs den Fisch vorwürgte oder ihn stets frisch vor uns ablegte und uns dann mit den abgerupften Stückchen fütterte, ich erinnere mich mit Sicherheit nur an Letzteres. Wie gesagt, es war einfach zu viel in der Rückblende, und zu Verblüffendes, als dass ich mir alles hätte merken können. Wenn es nicht ein so gefährlicher Anlass gewesen wäre, hätte ich Lust, eine solche Rückblende mehrmals zu sehen.
Überhaupt, das Sehen. Du siehst und erlebst alles anders als Adler, als Tier. Ich habe nicht die Landschaft so gesehen wie heute, als Mensch. Die grandiose Weite Nordamerikas war für mich als Adler ohnehin eine völlig normale Dimension. Ich sagte mir auch nicht, schau, dort hinten ist eine Bergkette und, oh, wie schön grün die Tannen sind. Sondern alles, was zählte, war die Bewegung. Der See, wellenüberlaufen, bewegte sich – also war er interessant. Bäume und Sträucher, Wiesen und Felsen – alles war nur Kulisse für das, was sich darauf bewegte. Dafür entdeckte ich mit scharfem Auge Dinge, die dem Menschen für immer verborgen bleiben. Entfernung spielte fast keine Rolle. Auf einen Kilometer Entfernung sah ich die kleinste Regung. Sobald es etwas Lebendiges zu sehen gab – ich erspähte es, und wenn es dicht am Horizont oder tief unter mir war. Fast hätte ich geschrieben, in Schwindel erregender Tiefe unter mir, aber das wäre falsch. Adler sind schwindelfrei.
Ich erlebte auch die starken, borkigen Äste, auf denen ich saß, und die kiesigen Ufer der Seen und Flüsse viel intensiver als die Plätze, auf denen ich heute sitze, und die Straßen, auf denen ich heute gehe. Denn jeder Ast und jeder Uferstreifen waren anders, man musste sich mit ihnen auseinandersetzen – wo konnte man laufen und umherklettern? – Und es gab so viel zu entdecken, einen höher gelegenen Ast oder Felsen, auf den man flattern konnte, einen neuen Rundumblick über das Gelände … Meine heutige Welt ist viel gleichförmiger.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich als Adler Farben empfunden habe. Mir kam alles jedenfalls irgendwie farbenverschoben vor. Manches, was ich heute bunt sehe, war für mich damals beißendes Grau – für andere Farbwerte von damals fehlen mir heute die Worte. Viele Farben waren für mich zudem unerheblich. Was sollte mir das Blau des Himmels sagen, wenn ich die gute Thermik auch so unter meinen Schwingen spürte? Wichtig war vielmehr die grandiose Vogelperspektive – buchstäblich, die totale Rundum-Schau und atemberaubende Scharfsichtigkeit, die mir aus großer Ferne noch die kleinste Bewegung verriet.
Was ich auch noch genau weiß, ist, dass der Fisch fest war und fast gummiartig elastisch, so wie er es nur lebend oder ganz frisch sein konnte. Woran ich eine intensive Erinnerung bewahrt habe, ist das dumpfe „Plopp“, mit dem sich die Krallen in die straff angespannte Schuppenhaut bohrten, in den Rücken des springenden Lachses, in die Flanken der voranschnellenden Forelle.
Ich kenne den Ruck, mit dem das Eigengewicht der Beute nach unten zieht und an den Klauen lastet, wenn man mit dem Fisch in den Fängen durchstartet und mächtig mit wuchtigem Flügelschlag rudern muss, um dann nach oben zu ziehen und mit dem zuckenden Klumpen in den geschlossenen Klauen, schwer durchhängend, pendelnd, nach oben wuchtet, an Höhe gewinnt und sich dann aufschwingt, die Krallen stählern geschlossen, eingekrallt, eingedolcht in die Beute, ohne Sarkasmus, ohne bittere Freude, nur mit der Zufriedenheit eines geglückten Fanges, nur aus der Notwendigkeit heraus, fressen zu müssen.
Ich erinnere mich, wie das Zucken, das krampfartige Drehen der Beute zwischen den Klauen nachlässt und du an Höhe gewinnst, und wie sich die Beute jetzt auch besser tragen lässt, und wie du dir jetzt genügend Auftrieb errudert hast und deine Klippe auf den Rockys ansteuerst.
Weißt du, wie man landet? Natürlich hast du schon Vögel landen gesehen. Aber versuch‘ doch mal, dir das Landen ganz genau vorzustellen, so als ob du das wärst, der da landet. Es will dir nicht gelingen? Nun gut, ich beschreib‘ dir, wie sich das anfühlt für einen Adler. Also, wenn du landest, dann gibst du das flache Liegen auf der Luft, die dich trägt, auf und bäumst dich auf und drehst deine Flügelflächen in einen steilen Winkel nach vorn, um zu rütteln, um abzubremsen und dabei nicht zu stürzen. Du denkst nicht nach darüber, du tust es einfach, so wie du als Mensch nicht über jeden Schritt nachdenkst, den du tust. Aber du spürst es, du spürst, wie die Luft nicht mehr unter dir wie ein weiches Kissen liegt, sondern dir von vorn wie eine Wand oder besser: ein schwerer Vorhang gegen die Flügel prallt, und deine Tragflächen tragen nicht mehr, sondern bremsen, und du spürst den Bremswiderstand in allen Spitzen deiner Schwungfedern, die in deiner Haut stecken, und in den Handschwingen spürst du es straff und in den Armschwingen schwach, und der Wind pfeift durch deine gespreizten Daumenfittiche. Der Luftstrom darf dabei nicht abreißen, also fährst du die Daumenfittiche aus wie Landeklappen. Das Schwanzgefieder fächerst du automatisch in dem leise kribbelnden Stress, und die ausgefächerten Schwanzfedern sind in dem Moment die einzige Tragfläche. Du rüttelst heftig mit den steilgestellten Flügeln, so verlierst du nicht an Höhe, und im selben Augenblick nutzt du deinen Schwung vom Landeanflug und schwingst die Beine mit der schweren Beute nach vorne durch bis auf das Felsensims, und dann rüttelst du noch einmal stark mit den Schwingen und klappst sie ein, während du auf deiner Beute herumbalancierst. Dann glättest du dein Schwanzgefieder und rückst vielleicht noch einmal die eine Handschwinge zurecht, weil die Federn am Ellbogen nicht richtig liegen, und dann stehst du da mit deiner Beute auf dem Felsensims.
Auch und vor allem an den Abflug erinnere ich mich ausgezeichnet, mit aller Klarheit. Dann packt mich heftig die Sehnsucht, einfach noch einmal so abheben zu können, so mit einem Hopp! und sich fallenlassen, mit gespreizten Schwingen, mit weit ausgebreiteten Armen sich dem Abgrund entgegenwerfen in der Gewissheit, dass die Luft, die gute, unsichtbare Luft, einen scharf wie ein Messerschnitt darüber hinwegtragen wird, über dem Abgrund dahingleiten lässt, segeln.
Das Kreisen im Aufwind! Dies herrliche Gefühl des Getragen-Werdens! Das leise Kribbeln in den kurzen Achseldaunen! Das ruhige Gleiten auf den flach ausgebreiteten Schwingen! Nur wenn ich schwimme, habe ich heute noch einmal ein leises Aufkeimen jenes Gefühls des entspannt-ausgestreckten Liegens mitten in einer gleitenden Bewegung. Das Schwanzgefieder steuert automatisch, reflexartig, korrigiert deinen Flugwinkel, ohne dass du viel nachzudenken brauchst. Es ist angeboren. Du brauchst nur ein wenig Übung für die Koordination, aber du musst es nicht lernen. Es ist alles angeboren. Du musst nur deine Brustmuskulatur ein wenig trainieren, als Junges, noch auf dem Nest, weiter nichts. Wirf einen jungen Adler mit erst frisch entwickelten Flügelfedern in die Luft, und er wird fliegen, als habe er es zuvor bereits getan.
Daher weiß ich auch nicht mehr genau, wann ich das erste Mal geflogen bin. Es muss mit etwa zehn Wochen gewesen sein. Ich kann mich erinnern, wie ich auf dem Nestrand trainiert habe, einer inneren Unruhe folgend, wie ich mit den Flügeln geschlagen habe, immer öfter, immer heftiger. Ich erinnere mich, dass sie mir sehr groß vorkamen und wie eine riesige Balancierstange, die merkwürdig viel Luftwiderstand verursachte, der sich aber erheblich verringern ließ, wenn man es geschickt anstellte.
Und dann schlug ich, schlug ich, heftig, entschlossener mit jedem Schlag, und plötzlich merkte ich, wie die Luft unter mir zusammengedrückt wurde, solide wurde, zuverlässig wurde, und wie es mich einen kleinen Sprung lang vom Boden abhob, während ich nach unten schlug. Und nach diesem Sprung machte ich wieder einen, und dann muss ich geflogen sein, aber das war dann so schnell und wohl ebenso überraschend im ersten Moment wie schlagartig normal im zweiten, dass ich keine besondere Erinnerung an jenen ersten Flug bewahrt habe. So wie sich ein Menschenkind später ja auch nicht mehr an seine ersten Schritte erinnert. In der Rückschau habe ich mich oft fliegen sehen, klar, aber jetzt, aus der Erinnerung, ist es verwirrend viel.
Ich weiß nicht mehr, ob ich auf einer Kiefer in der Nähe gelandet bin oder gleich wieder auf dem Felsensims, vermutlich auf einer Kiefer, denn meine ersten Landeanflüge werden wohl noch ziemlich tölpelhaft gewesen sein – das Landen erfordert mehr Erfahrung als das spontane Losfliegen – und auf dem Felsensims vor einer Steinwand zu landen erfordert mehr Geschick als das Landen auf einem Ast. Jedenfalls, solange ich mich ans Fliegen zurückerinnern kann, konnte ich es bereits gut.
Ich erinnere mich, wie es war, über die Täler zu fliegen, die Schwingen reglos ausgebreitet, regelrecht eingehängt zwischen meinen Tragflächen, und nur den Kopf nach links und rechts wendend. Und selbst das war kaum nötig, denn mit den weit seitlich liegenden Augen hast du einen fast perfekten Rundumblick. Du nimmst jede Bewegung unter dir im weiten Umkreis wahr, und dazu jede Bewegung im Luftraum um dich her. Nach vorne kreuzen sich deine Blicke zu einem dreidimensionalen Bild, aber nach den Seiten nimmst du nur Bewegungen wahr. Dich interessiert auch nichts anderes als Bewegungen. Denn Bewegungen sind Beute. Und im Frühjahr sind sie ein Partner. Oder die Jungen. Oder manchmal auch ein Eindringling in dein Revier. Kampf gibt es kaum. Ein paar Scheinattacken in der Luft, und er zieht wieder fort.
Du siehst jede Bewegung, auch mit den Augenwinkeln, und du kontrollierst die ganze Ebene unter dir, oder den ganzen Berghang, oder die ganze Wasseroberfläche des Sees. Wir Weißkopf-Seeadler waren es, die vor den Düsenjets den amerikanischen Luftraum beherrschten. Unter dir die Ebene, der Hang, die Wasserfläche. Du lauerst auf jede Bewegung, sonst nichts. Die Bewegung ist das Einzige, was zählt.
Stell dir das Leben als Adler nicht romantisch vor. Wenn du als Mensch fliegst, als Drachenflieger etwa, dann genießt du sicher die dreidimensionale Weite, und die bunt gesprenkelten Blumenwiesen, und das blaue Glitzern des Sees, und die Berge dahinter, majestätische, zu Stein erstarrte Bewegung der Erde. Als Adler genießt du nur eins von alledem: die dreidimensionale Ungebundenheit, und die ist für dich obendrein selbstverständlich. So wie ein joggender Mensch zwar die Bewegung genießt, sich aber nicht wundert, wie und warum er laufen kann.
Wenn du über den See fliegst, lernst du rasch, das trügerische Spiegeln der Wellen und die wogenden Wellenschatten von den darunter dahingleitenden Schatten der Fischleiber und den bei einer Wendung aufblitzenden geschuppten Flanken zu unterscheiden. Nicht die Farbe ist es, die sich unterscheidet, und nicht die Intensität des Lichtreflexes oder des Schattens. Wieder ist es die Bewegung, die unterscheidet. Das sachte Seitlich-nach-vorn-Ausschwenken der Forelle, die sanfte Biegung ihres Leibes, ihr vorsichtiges Schlängeln, so behutsam und doch im Moment verräterisch. Da ist sie, da unter dir, selber ein Räuber, selber auf der Jagd. Du schwebst über ihr, blickst herab, ziehst einen Kreis, weil sie unter dir aus dem Blickfeld verschwindet. Dein Schatten darf nicht auf sie fallen, dann hast du dich verraten, und sie schießt davon oder taucht schräg ab. Zwischen den Steinen, in den Kiesmulden am Grund kannst du sie nicht bekommen. Dicht unter der Oberfläche musst du sie fangen, wenn sie selber Insekten jagt oder kleine Fische.
Da ist sie, schnappt ein Insekt, aufreizend nah, ganz dicht unter der Wasseroberfläche, und kleine Ringwellen laufen auf dem Wasser auseinander, da wo sie den Wasserspiegel von innen heraus durchbrochen hat. Es ist, als habe sie den See von unten herauf geküsst. Ein kleines Insekt, das auf dem Wasser trieb, ist fort, und weiter zieht die Forelle, dicht unter der Oberfläche dahin, und es ist Zeit, zuzustoßen, ehe sie wieder im Schlagschatten oder in tieferen Wasserschichten verschwindet.
Das heißt die Flügel anwinkeln, den Luftstrom, der dich trägt, abreißen lassen. Du stürzt herab, pfeilschnell, ein gefiedertes Geschoß, kaum hat die Forelle Zeit zu reagieren – schafft sie es? Eilig streckst du deine Fänge vor, kescherartig gespreizte Klauen durchschlagen die Wellen, greifen zu, schließen sich – ins Leere? – Du musst abbremsen, hochwuchten, unbedingt wieder an Höhe gewinnen, mit oder ohne Fisch, und das Wasser schäumt und spritzt auf, Wasserperlen schießen umher, und aus den diesmal heftigen Kreiswellen hebt sich, knapp an drei Krallen gefangen, die Forelle und peitscht mit sich windendem Rücken um sich.
Aber sie hängt, sie hängt an deinen Klauen, und du nimmst im Aufflug den zweiten Fuß zur Hilfe und packst sie fester, und jetzt hast du sie richtig im Griff mit beiden Klauen, und ihre Zuckungen lassen nach und du fliegst davon, um sie an einem sicheren Ort zu kröpfen.
Wir entfernten uns immer weiter vom Horst. Und mit jeder Flugschleife, die neue Distanz zwischen uns und das vertraute Nest legte, vergrößerte sich auch unser innerer Abstand von der Kinderstube. Wir wurden unternehmungslustiger und kreisten in immer weiterer Entfernung. Dabei sah das Fliegen wesentlich virtuoser aus als das Landen. Wenn wir irgendwo auf einem Ast oder am Boden niedergingen, sahen wir uns ziemlich hilflos um und liefen unbeholfen auf dem Ast oder im Gras hin und her. Meist schwangen wir uns nach kurzer Zeit wieder auf, weil wir uns in der Luft, die wir doch erst seit so kurzer Zeit erobert hatten, wohler und sicherer fühlten. So begann eine Rastlosigkeit in uns aufzukommen, die uns zum Winter hin zu Vagabunden machen sollte, bis wir ein eigenes Revier finden würden. Eine harte Wanderzeit, eine Zeit der Heimatlosigkeit sollte für uns beginnen.
Doch zunächst spürten wir davon noch nichts. Noch wirkten die Gefühlsbande unserer Eltern uns gegenüber so stark, dass sie uns nicht als Nahrungskonkurrenten empfanden.
Sie flogen mit uns zum See. Es gab keine Absprache. Sie flogen einfach hin, und wir, in unserer Ziellosigkeit, folgten ihnen, weil es bequem war, jemandem zu folgen, ohne sich Gedanken zu machen, und weil es uns egal war, wohin wir flogen. Warum also nicht zum See?
Der See sollte aber bald auch uns nicht mehr gleichgültig sein. Er lag unter uns wie ein glänzend jadegrünes Auge, und wir waren fasziniert von seinem Anblick, weil er sich an seiner Oberfläche bewegte wie ein Fisch, dessen Bild als Beutetier uns vom Schlüpfen an eingeprägt war. Er zog uns magisch an.
Als ich ihn sah, breit und verlockend, stieg ein wildes Gefühl in mir auf, und in unbändiger Lust blähte ich meine Lungen auf und schrie zum ersten Mal wie ein erwachsener Seeadler unser langgezogenes, etwas melancholisches „Hiä-ä-ä-ä!“
Das Wasser spiegelte. Was barg es? Die Eltern kümmerten sich nicht um uns. Sie zogen routiniert ihre Kreise. Mochten wir zuschauen. Schatten bewegten sich. Was war es? Wir beobachteten die Schatten. Plötzlich blitzte es in mir auf: Fisch! Fisch! Da war sie, die Forelle! Da war er, der Fisch, den ich ein Leben lang jagen würde. Über Generationen verfestigte Bilder entfalteten sich mir, ein Katalog von Wissen, ererbt von tausend Adlern, begann sich für mich zu öffnen. Ich brauchte es nicht zu lernen. Ich wusste es. Ich würde es nur zu üben brauchen, würde selbst Erfahrungen sammeln mit der Jagdtechnik, die ich theoretisch schon beherrschte. Erneut schrie ich auf in meiner Erregung: „Piä-ä-ä-ä!“ Ich, hier war mein Platz. Ich, dieser See war für mich da und ich für ihn.
Die Eltern fingen den ersten Fisch. Die Mutter, wachsam und konzentriert, stürzte plötzlich aus mittlerer Höhe herab – es rauschte, die Wasserfläche zersprang in tausend Tropfen – und hoch stieg die Adlerin mit einem sich windenden Fisch in den Fängen.
Dann stieß der Vater herab. Die Eltern waren großartige Fischer. Fast jeder Stoß ins Wasser war ein Treffer. Sie flogen mit ihren Fischen zum Ufer, die Mutter auf einen Ast, der Vater auf einen Fels. Wir bekamen nichts. Da schrien wir wütend.
Doch wir bekamen weiter nichts. Ungerührt fraßen die Eltern an ihrem Fisch. Brüderchen sah ratlos zu, doch ich stürmte wutentbrannt auf meinen Vater los, um ihm den Fisch streitig zu machen. Ein Schnabelhieb von ihm belehrte mich eines Besseren. Er war stärker. Ich flatterte in den Baum, um meine Mutter den Fisch mit mir teilen zu lassen. Ich war stärker als sie, obwohl sie größer war als mein Vater. Bei ihr würde es mir gelingen. Doch sie hatte Autorität, und das verleiht Stärke. Auch sie hackte entschlossen nach mir. Unverrichteterdinge und verwirrt flatterte ich wieder herab. Mein Magen blieb leer. Die Sonne spiegelte sich in dem See, und das Himmelsblau schien sich im Wasser ausgebreitet zu haben. Ich hatte keine Augen für diese Schönheit. Ich hatte Hunger. Missmutig lief ich am kiesigen Ufer umher. Der See lockte. Mein Magen war leer. Mürrisch schwang ich mich auf und kreiste ziellos über dem See. Wo waren die Schatten? Wo waren die Forellen?
Inzwischen waren die Eltern fürs Erste satt. Ihre Fische waren nicht sehr groß gewesen, aber der größte Hunger war gestillt. Brüderchen war am Ufer hocken geblieben. Er marschierte auf den Kieselsteinen hin und her. Plötzlich öffnete er seinen großen Schnabel und ließ ein durchdringendes und klägliches Piepen ertönen. Die Eltern wurden unruhig. Die Mutter nestelte an ihrem Gefieder. Brüderchen bettelte weiter unbeirrbar. Da flog die Mutter auf den See hinaus, fischen. Brüderchen sah ihr erwartungsvoll hinterher. Er hüpfte in ungeduldigen Sprüngen am Ufer auf und ab. Ich schwenkte herüber und beobachtete ihn.
Die Mutter kreiste über dem Wasser. Sie schwang sich höher und kreiste dann weiter draußen auf dem See. Dann – endlich – stieß sie herab. Sie kam mit dem erhofften Fisch wieder hoch. Der Fisch zappelte noch zwischen ihren Krallen. Sie kam ans Ufer zurück. Brüderchen sperrte sofort seinen klobigen Hakenschnabel wieder auf und schrie gierig. Er reckte den Hals weit vor. Die Mutter flog zu ihm und legte den Fisch vor ihm ab. Ich bekam die Wut.
Sofort fing Brüderchen an, zufrieden den Fisch zu verschlingen. Er beeilte sich, denn er sah mich kommen. Ich strich im Tiefflug zu ihm hinüber. Ich kam zu spät. Brüderchen schloss mühselig seinen Schnabel. Nur die Schwanzflosse hing noch heraus. Ich schnappte danach. Die Flosse hatte einen V-förmigen Riss. Außer ein paar Flossengräten ergatterte ich nichts. Wütend wandte ich mich ab.
Der See spiegelte verlockend. Hilf dir selbst. Mürrisch flog ich auf den See hinaus. Brüderchen hatte mit seiner kläglichen Bettelei mehr erreicht als ich. Erfolglos flog ich über den See. Mein Hunger wuchs. Ich erspähte keinen einzigen Fisch dicht unter der Oberfläche. Verdrossen kehrte ich ans Ufer zurück und machte es wie Brüderchen. Ich begann zu schreien. Aber es half nichts. Die Mutter ließ sich nicht beeindrucken. Ich hatte eben keine so jammervolle Stimme wie Brüderchen.
Dann, irgendwann, fing ich meinen ersten Fisch. Vom Hunger diktiert, patrouillierte ich im Tiefflug über dem Wasserspiegel. Mein Schatten erschreckte mehrere Forellen. Aufgescheucht und wild schwänzelnd tauchten sie ab. Ich war rasend vor Hunger und Enttäuschung. Aber ich spürte, dass ich etwas falsch machte. Ich ruderte kräftig mit den Flügeln – dicht über dem Wasser ist die Luftdecke recht dünn – und schwang mich so weit empor, bis ich mehr Luft wie ein tragendes Kissen unter mir spürte, auf dem ich schweben konnte. Von da oben spähte ich herab. Mein Schatten löste sich aus dieser Höhe diffus auf den glitzernden Wellen auf. Er konnte die Forellen nicht mehr warnen.
Ich spürte, dass ich es jetzt richtig machte. Meine scharfen Augen suchten den See ab. Ich hatte gar keine Mühe, auch aus der Entfernung jede kleinste Regung, die nicht mit der Richtung der Wellen übereinstimmte, auszumachen. Es war alles glasklar und scharf zu sehen. Heute, als Mensch, sehe ich dagegen trüb und schlecht, und die Erinnerung an früher ist daher atemberaubend.
Dann sah ich eine Forelle, und ohne zu überlegen stieß ich herab. Ich war aber überstürzt, streckte die Beine vor, peitschte mit den Schwingen zu früh zum neuen Durchstarten --- und weg war die Forelle. Einen wuterfüllten Schrei schickte ich über den See. Enttäuscht gewann ich wieder an Höhe und begann erneut zu kreisen.
Dann sah ich wieder eine, und diesmal war ich listig, klappte die Flügel zusammen und ließ mich herabfallen wie ein Stein – ins Wasser stieß ich, und sie war noch da, dicht unter der Oberfläche, und meine Krallen bohrten sich hastig in ihr zuckendes Fleisch, und einen Augenblick glaubte ich, im Wasser zu versinken und zu ertrinken, und da erst ruderte ich mit mächtigen Flügelschlägen hoch, und zwischen meinen Klauen wand sich in festem Griff meine erste Forelle.
Kurz glühte der Purpur des Herbstes. Der Winter kam so rasch, wie ein fremder Adler in ein Revier einbricht. Mit grauen Wolkenschwingen wirbelte er Schneeflocken auf und trieb sie vor sich her, in dichten weißen Schwärmen, so wie nur einige Tage zuvor die Schneegänse geflohen waren. Der Sommer war mit den Gänsen und den Purpurschwalben davongezogen und überwinterte in Mexiko und Kalifornien.
Wir saßen alle auf den hohen Tannen am Seeufer und zogen die Köpfe zwischen die Schultern. Das Schneegestöber umwirbelte uns wie ein Schwarm wütender weißer Wespen, und die windgepeitschten Schneekristalle stachen auch genauso unangenehm in die weiche Haut um die Augen. Stoisch und gleichmütig warteten wir das Ende des Schneesturms ab.
So richtig kalt wurde es erst, als nach zwei Tagen die Wolkendecke zerriss und es zu schneien aufhörte. Inzwischen war das ganze Land in eine richtige Winterlandschaft verwandelt, und unter dem Schnee lag alle Erinnerung an den Sommer begraben. Der plötzliche Schneefall war sehr ergiebig gewesen, und die großen Wapiti-Hirsche zogen, fast bis zum Bauch versinkend, durch den Schnee. Der große See war nun schwarz, alles sommerliche Leuchten war erloschen. Dunkel spiegelte das Wasser, von gleißend weißen Ufern eingerahmt.
Doch nun wurde es beißend kalt. Mit dem blau aufklarenden Himmel kam die Kälte. Der Frost wurde so rasch stärker, dass die flacheren Buchten des Sees sofort zufroren. Man konnte das angespannte Oberflächenwasser knacken hören, wenn es gefror. Eisnadeln sprossen kreuz und quer, und zuerst war die Eisschicht durchsichtig wie Glas, dann wurde sie kompakt und weiß. Der See begann, vollständig zuzufrieren.
Da schwangen sich unsere Eltern mit einem klagenden Schrei auf und flogen empor in die blaue Luft. Sie kannten den Winter. Sie wussten, es war jetzt an der Zeit, fortzufliegen, hin zum Breiten Fluss, dessen Strömung stark genug war, um dem Frost entgegenzuwirken. Der Fluss fror nur an stillen Ausbuchtungen zu. Er führte zum Frühjahr hin Eisschollen, aber er fror nie ganz zu. Dorthin flogen die Eltern. Wir kannten ihr Ziel nicht, aber wir sahen sie davonfliegen und fühlten uns plötzlich verlassen. Rasch flogen wir hinterher.
Am Fluss fingen sie gleich etwas. Wir sahen sie mit ihrer Beute am Ufer im hohen Schnee sitzen. Es gab hier keine andere Möglichkeit, um zu sitzen. Das dichte Weiden- und Pappelgestrüpp am Ufer war mit seinen schmalen Ruten zu schwach, um einen Adler zu tragen. Der Fluss gestaltete immer wieder seine Ufer um, und außer den Pionieren wie Birke und Pappel, Weide und Erle konnten hier keine Bäume auf Dauer Fuß fassen. So gab es hier keine großen alten Bäume mit starken Ästen, auf denen ein Adler hätte sitzen können. Unbeholfen watschelten wir durch den hohen Schnee.
Ich blieb den Winter über allein. Die Eltern hatten mich jedes Mal aus ihrer Nähe fortgejagt, denn die Fische hatten sich an den Gewässergrund zurückgezogen, wo die Temperaturen konstanter waren und die Kälte weniger scharf als nahe der Wasseroberfläche, und so sah man nur noch selten ihre schlängelnden olivfarbenen Rücken unter den Wellen ziehen. Das verschärfte den Futterneid.
Zudem waren auch andere Seeadler der weiteren Umgebung an den eisfreien Flusslauf gekommen, und zum Schluss waren es viele Adler, die am Ufer auf und ab liefen oder den Fluss entlang flogen, um Fische ausfindig zu machen. Heute schätze ich, dass wir wohl so ungefähr fünfzehn oder zwanzig Adler waren – eine Zahl, die das Herz jedes Naturschützers würde höher schlagen lassen.
Es gab keinen Krieg zwischen uns, keine Luftkämpfe oder Raufereien, und doch blieb jeder Adler trotz der oberflächlichen Eintracht für sich allein. Es war, als hätten sich zwanzig Einsiedler versammelt. Ich verlor jede innere Beziehung zu meinen Eltern und hörte nur noch auf meinen Magen. Brüderchen hatte ich längst vergessen. Oder war er einer von den zahlreichen anderen? Wir hätten uns nicht mehr erkannt, und hätten wir es getan, so hätten wir uns doch nicht mehr begrüßt. Wir waren allein.
Nur manchmal, wenn eine mildere Strömung im Fluss hochwirbelte und zahlreichere Forellen nach oben trug, dann kam jeder auf seine Kosten. Und wenn jeder seine Forelle hatte, dann verringerte sich auch die Distanz, und einträchtig hockten wir im Schnee und jeder zerrte an seiner Forelle. Es kam dann nur selten vor, dass einer den Kopf nach der Beute des anderen herüberreckte, und auch nicht im Ernst, da jeder selber mit dem Fuß auf der eigenen Beute stand.
Hinterher, wenn alle satt waren, schwangen wir uns dann empor und flogen ein paar Runden, endlich ohne jenes Gefühl der Unrast, das der Hunger verursacht. Dann landete erst einer, zwei folgten seinem Beispiel, und drei weitere auch, und schließlich saßen wir alle wieder auf dem Schneefeld am Ufer und begrüßten uns gegenseitig, die Hälse weit zurück zum Rücken gebogen, den Kopf hintenüber und den Schnabel halb geöffnet zu unserem schrillen Schrei. Du wirst erst gesellig, wenn du satt bist. Zumindest als Adler.
Ich weiß nicht, wie lange der Winter gedauert hatte. Die Nächte waren extrem kalt. Tagsüber hast du dich für kurze Zeit zusammenkauern können in einem Schneeloch. Aber zum Übernachten bin ich recht weit vom Fluss weggeflogen, um einen richtigen Baum als Sitzplatz zu finden, denn am Boden ist es gefährlich für einen Adler. Du weißt nicht, wer sich von hinten heranschleicht; Luchs, Wolf oder Mensch. So zog ich es vor, jeden Morgen an den Fluss zurückzukehren, während andere Adler versuchten, auf den dünnen Wipfeln der Uferbäume zu balancieren.
Irgendwann sagt dir dein Helligkeitssinn, dass die Tage wieder länger werden. Sofort wirst du munterer, wenn auch der Magen oft leer bleibt, was dich schwächt. Aber du spürst, dass der Winter nicht mehr lange Macht hat. Deine innere Uhr sagt dir, dass es Frühling wird.
Die zugefrorenen Ausbuchtungen am Flussufer begannen zu ächzen und zu stöhnen: Das Eis barst und schmolz ab. Der Fluss schwoll an und floss schneller. Wieder begann er, Eisschollen und -plättchen zu führen, die weiter oben aus den Bergen kamen. Die Luft wurde milder, und der Schnee zog sich zurück. Bald lag nur noch in den Mulden und Schlagschatten Schnee, und der erste Vogel sang.
Der Boden unter dem Schnee kam braungelb und vollgesogen wie ein Schwamm zum Vorschein. Schon nach wenigen Tagen blühten die ersten Frühjahrsblumen. Der Fluss hatte seine Magnetwirkung auf uns Adler verloren, nun, da auch die Seen wieder aus der Herrschaft des Eises befreit waren. Die Macht des strengen Winters war gebrochen.
Ich musste den Fluss verlassen, denn mit Ende des Winters schmolz auch die Eintracht unter den Adlern dahin. Plötzlich wurden wieder Reviere beansprucht. Die alten Besitzverhältnisse kristallisierten sich heraus, und neue Ansprüche stellten sie in Frage. Die geduldeten Wintergäste wurden plötzlich verjagt und beeilten sich, in ihre eigenen Reviere zurückzukehren, ehe sie diese besetzt vorfinden würden.
Zu meinen Eltern kehrte ich nicht zurück. Ich wusste, dort hatte ich nichts mehr zu suchen. Zunächst flog ich flussabwärts, aber dort fand ich jeden Flussabschnitt zwischen zwei Biegungen bereits durch ein anderes Adlerpaar besetzt, das mich mit wütenden Luftattacken vertrieb. Es war wie eine Art Spießrutenlauf. Als mir klar wurde, dass es aussichtslos war, in dieser Richtung weiterzufliegen, da alle guten Reviere am immer breiter werdenden Fluss bereits besetzt waren, kehrte ich wieder um und musste flussaufwärts noch einmal alle Reviere durchqueren, aus denen ich bereits verjagt worden war. Ich war völlig verstoßen und ohne Bleibe. So unauffällig wie möglich versuchte ich, mich an den Reviereigentümern vorbeizumogeln. Dennoch wurde ich oft von weitem schon erblickt und erbittert attackiert. Ich musste buchstäblich Federn lassen und war sehr erschöpft, als ich wieder da ankam, wo ich den Winter verbracht hatte.
Aber auch dort konnte ich ja nicht bleiben. So zog ich weiter flussaufwärts, wo der Wasserlauf immer schmäler wurde und immer weniger Fische barg.
Ich stieß auf einen zweiten jungen Adler, dem es ebenso erging wie mir. Ich hatte keine Wut auf ihn, denn da ich kein Revier besaß, hatte ich keinen Grund, ihm etwas zu missgönnen, solange er mir nicht den Fisch vor dem Schnabel wegschnappte. Ich sah ihn oft in meiner Nähe, ohne dass wir uns umeinander kümmerten.
Auch der andere zog flussaufwärts. Flussabwärts waren wir geschlagen. Uns blieb keine andere Wahl, solange wir keinen See oder Seitenarm des Flusses erblickten, wo wir uns hätten trennen können.
Doch dann änderte sich alles schlagartig. Er fischte im Fluss, und ich fischte, und eine Weile ging alles gut. Hier oben war der Fluss schon ziemlich schmal, und ich flog gelegentlich Scheinmanöver, ganz weite Schleifen, um den anderen auf Distanz zu halten. Hier im Oberlauf war das Wasser nämlich schon kristallklar, es führte noch nicht so viele Schwebepartikel mit sich wie weiter unten, und so waren auch die Fische ganz klar auszumachen, wenn sie sich bewegten, aber es gab nicht mehr viele zu sehen. Forellen gab es schon noch zahlreich, aber sie waren so schlau und geschickt, dass sie sich zwischen Geröll im Flussbett versteckten und sich nur selten verrieten. So wurde das Fischen zunehmend schwieriger.
Ich sah eine Forelle nach einem Insekt an der Wasseroberfläche schnappen, und ich war nahe genug, um herabzustürzen und sie gerade noch zu krallen. Ich flog mit ihr zu einem umgestürzten Tannenstamm, dessen Wipfel im Fluss lag. Dort wollte ich mich gerade dem Fisch widmen, der sich noch in meinen Fängen bog, da kam der andere herbeigeschwenkt. Er ließ sich ebenfalls auf dem Baumstamm nieder und hüpfte zu mir heran. Ich zischte vor Wut. Als er nach dem Fisch schnappen wollte, hackte ich erregt nach ihm. Meine Situation war ungünstig: Loslassen wollte ich den Fisch nicht, und während ich ihn verteidigte, musste ich ziemlich verkrampft auf dem Baumstamm balancieren, einen Fuß auf dem Stamm und einen auf dem Fisch.
Ich spreizte meine Flügel fächerförmig und schirmte so meine Beute ab. Nachdem ich noch ein paarmal entschlossen nach dem anderen gehackt hatte, rückte er von mir ab und sah mir missmutig beim Fressen zu. Ich behielt ihn ständig im Auge.
Nach einer Weile flatterte er auf den Boden herab, wohl in der Hoffnung, dass ich die Mittelgräte des Fisches herabfallen lassen würde, denn er war zu groß, um ihn im Ganzen zu kröpfen.
Doch ich war sehr hungrig und hackte hastig an dem Fisch herum. Sogar den Kopf verschlang ich. Dann schüttelte ich mich; erst als ich alles verschlungen und in mir in Sicherheit gebracht hatte, wich die innere Anspannung, und ich wurde ruhiger. Ich begann, mein zerzaustes Gefieder zu glätten. Dann fiel mir der andere wieder ein, der immer noch unter dem Baumstamm wartete, und wutentbrannt stürzte ich mich auf ihn. Was hatte er hier eigentlich zu suchen? Zum ersten Male war ich es, der einen anderen verjagte, und unbewusst begann ich, dieses Gelände als mein Revier zu betrachten. Bei uns Adlern zumindest ist es so: Wo du nicht gerade selber vertrieben wirst, da erhebst du automatisch Gebietsansprüche und betrachtest das Terrain als deins. Kennst du das auch von anderen Wesen?
Überrascht flog der andere auf, und das bestärkte mich und machte mich übermütig. Es machte mir richtig Spaß, ihn zu verfolgen, und so entschlossen war ich, dass es ihm gar nicht in den Sinn kam, sich umzudrehen und mich seinerseits zu attackieren. In mir festigte sich immer mehr das Anspruchsgefühl auf diesen Uferabschnitt.
Der andere suchte das Weite, ließ sich aber doch noch in meinem Gesichtskreis auf einem hohen, halb abgestorbenen Ahorn nieder. Ich ließ von ihm ab, denn die Verfolgungsjagd kostete auch Energie, und ich hatte zu lange zu wenig gefressen, um Energie vergeuden zu können. Dennoch betrachteten wir uns seit jener Begebenheit als Rivalen.
Aber es mussten mehrere Sommer und Winter vergehen, ehe ich erwachsen wurde und das Frühjahr nahte, in dem ich meine Adlerfrau kennen gelernt habe, und das war nicht kampflos. Wir lebten als Reviernachbarn wohl drei Jahre. Inzwischen begannen unsere Köpfe, weiß wie Schnee zu leuchten. Gelegentlich überflogen Artgenossen unser Gebiet, doch keiner machte uns ernsthaft Konkurrenz. Wir selbst hatten an der Reviergrenze ab und zu kleinere Scharmützel.
Ganz explosiv brach unsere Rivalität dann auf, als sich etwas für uns ganz Neues, ganz Faszinierendes ereignete. Ein weiterer Adler tauchte als Silhouette am Horizont auf. Nun ist ein Artgenosse an sich noch nichts Besonderes. Aber diese kräftige Gestalt war die einer jungen Adlerin.
Die Weiden und Birken am Fluss waren zu dieser Zeit schon hauchzart grün, und die Pappeln blühten mit lustig flatternden Kätzchen. Auch in uns Adlern hielt das Frühjahr mit einem Prickeln im Blut Einzug. Der Anblick der jungen Adlerin war ein Fanal.
Wir beeilten uns beide, so sehr wir konnten, ihr entgegenzufliegen und sie zu umkreisen. Alle drei waren wir sehr nervös, denn wir konnten uns nicht verbal verständigen. Nur unser Flugverhalten und unser gegenseitiges Taxieren konnte uns zeigen, wer wir waren, dazu vielleicht ein sehnsuchtsvoller oder wütender Schrei.
Wir umkreisten uns: rasch, wild, voller Unruhe. Lauernd und neugierig behielten wir uns pausenlos gegenseitig im Blick. Im hellblauen Frühlingshimmel kurvten wir, umkreisten uns wie lebendige Fragezeichen, unermüdlich, fast unerbittlich. Ein Adlerweibchen ist kräftig und robust. Im Adlermann weckt es keine Beschützerinstinkte. Du denkst nur an deinen Nebenbuhler, dem du diese Frau nicht gönnst.
Die Adlerin war den frischen Federn nach genauso alt wie wir: ein gerade erwachsener Jungvogel, der bisher umhervagabundiert ist und nun eine feste Bleibe sucht. Sie hatte keinen Partner. Der wäre schon aufgetaucht. Wie magisch von ihr angezogen umkreisten wir sie und blieben dabei untereinander auf maximaler Distanz, peinlich darauf bedacht, dass keiner dem anderen eine Flugschleife abschneiden konnte.
Dann hielt es der andere nicht mehr aus. Er stieß einen schrillen, erwartungsvollen Schrei aus. Das versetzte mich in Wut. Sofort attackierte ich ihn. Ich versuchte, ihn zu vertreiben. Doch diesmal vergebens. Von einem Beutefisch ließ er sich von mir noch fortjagen, von einer Adlerin nicht. Erbittert wandte er sich in der Luft um, flog in einem überraschenden Bogen unter mir durch und hinter mir hoch und attackierte mich von hinten. Plötzlich war er der Verfolger. Wir wirbelten in der Luft umeinander und hieben mit den Klauen aufeinander ein. Doch wo war die Adlerin? Als wir erhitzt von dem Luftkampf abließen und jeder in die entgegengesetzte Richtung eine Beobachtungsschleife flog, da sahen wir sie scheinbar gleichgültig auf einer Baumkrone sitzen. Sofort eilten wir wieder zu ihr.
Das Spiel hatte mit Liebe nichts zu tun. Sie hatte keine Lust, uns mit leerem Magen zuzusehen, und so wich sie uns zunächst aus und flog dann ungerührt fischen. Wir wagten es beide nicht, ihr den Fisch streitig zu machen, irgendwie war da eine Sperre, die es verhinderte, sie als Konkurrentin zu sehen.
Doch sobald sie den Fisch gefressen hatte, begann die Unruhe von neuem. Der andere flatterte auf die Adlerin zu und machte ihr Avancen. Sie dachte aber gar nicht daran, ihn nahekommen zu lassen, solange der Streit zwischen uns nicht entschieden wäre.
Ohnehin hätte ich nicht tatenlos zugesehen. Ich stürzte mich erneut wutentbrannt auf den frechen Werber. Wieder flogen die Federn. Die Adlerfrau sah jetzt interessiert zu. Plötzlich gewann sie offenbar Gefallen an der Sache und startete mit wuchtigen Flügelschlägen. Sie griff ins Kampfgeschehen ein, indem sie uns durch Scheinattacken trennte. Wieder begannen wir, abwartend umeinander zu kreisen.
Den Rest entschied ein Faktor, der hinter den Raufereien und Luftmanövern für einen Menschen gar nicht zu erkennen gewesen wäre: die Harmonie. Ich muss das erklären: Die größere Harmonie zwischen der Adlerin und einem von uns beiden war sogar wichtiger als unsere Kampfstärke. Während wir uns alle drei abwartend umkreisten, merkte ich plötzlich, dass ich mit der Adlerin häufiger Kreise umeinander flog als der andere. Hin und wieder attackierten wir männlichen Adler uns, aber es blieb bei einer Pattsituation. Die Adlerin flog uns indessen aufreizend davon und wir beeilten uns, wieder aufzuholen. Erneut umkreisten sie und ich uns häufiger und in perfekteren Kreisen als sie und der andere. Ich begann, mich optimistisch zu fühlen.
Der andere funkte uns ewig dazwischen, schnitt uns die Kreislinien ab und flatterte vor der Adlerin her, um sie zu bewegen, ihm zu folgen. Sie scherte seitlich aus und flog uns erneut davon, bis wir sie hastig wieder einholten. Das wiederholte sich einige Male. Plötzlich hatte ich genug. Als der andere wieder unsere Kreisbahnen störte, die wir umeinander zogen, packte mich die Wut und ich verfolgte ihn mit äußerster Anstrengung.
Da sprang der Funke über, und auch die Adlerin holte zu kraftvollen Flügelschlägen aus und verfolgte den anderen. Plötzlich handelten wir zu zweit. Plötzlich vertrieben wir einen anderen aus einem Revier, das vorher keiner besaß. Also war es unser Revier. Wir verteidigten es gemeinsam. Also waren wir ein Paar. Vor Freude ergriffen wir uns an den Klauen und schlugen übermütig Räder, mitten in der Luft.
Als der andere verjagt war, flogen die Adlerin und ich auf einen großen Baum zurück. Wir landeten auf demselben Baum. Es gab keinen Streit zwischen uns. Einträchtig hockten wir auf dem Baum. Wir waren endgültig ein Paar. Noch oft wiederholten wir unsere Luftkapriolen: unseren Balztanz.
Und wie auf geheime Absprache flogen wir zusammen fischen, und wir stritten uns auch nicht um den Fisch, wenn man davon absieht, dass wir uns ein paarmal anzischten, wenn der eine von uns schon seinen Fisch hatte und der andere nicht, und nach dem Fressen, beim Gefiederputzen, verringerte sich der Abstand zwischen unseren Sitzplätzen auf dem Baum immer mehr. Wir hüpften aufeinander zu und hintereinander her. Es gefiel uns. Es wurde ein Spiel daraus. Ich hüpfte in großen Flattersprüngen hinter ihr her, und sie flog dicht vor mir auf und ließ sich wenig entfernt wieder nieder. Dann, wenn ich sie mehrmals hintereinander einholte, schwang sie sich auf und strich übers Tal, flog mit Schwung an den Hängen empor und kurvte dann zum Fluss zurück. Ich folgte ihr, aber ohne jene finstere Verbissenheit wie zuvor, als der andere noch da war. Ich fühlte mich jetzt ruhig und sicher in unserem neugewonnenen Revier.
Es gefiel uns, immer wieder nach unseren Rundflügen auf jenen Sitzbaum mit den kräftigen Ästen zurückzukehren. Er zog uns magisch an. Wenn wir auf ihm saßen, begann die Adlerin immer häufiger, mit ihrem Schnabel an seinen Zweigen herumzunesteln. Auch ich begann, mich für Zweige zu interessieren. Am Flussufer spielte ich mit angeschwemmten Stöckchen. Immer wieder nahm ich sie mit dem Schnabel auf und ließ sie wieder fallen, weil ich mir nicht darüber im Klaren war, was ich damit sollte. Es war doch kein Fisch. Schließlich kam die Adlerin herbei und versuchte, mir den Stock aus dem Schnabel zu schnappen, und sie zerrte daran, aber ich ließ nicht los und flog, mit dem Stock fest im Schnabel, auf unseren Baum.
Da oben saß ich triumphierend, aber immer noch ahnungslos über dessen Verwendungszweck, mit dem Stock im Schnabel, und als ich ihn gerade fallenlassen wollte, weil ich doch nichts mit ihm anfangen konnte, da fand ich es schade, ihn einfach wegzuwerfen, und klemmte ihn quer in eine Astgabel. Es war doch mein Spielzeug, das ich verteidigt hatte.
Nachdenklich betrachtete ich den Stock, der in der Astgabel verkantet war. Es gefiel mir, was ich da gemacht hatte, ohne dass ich gewusst hätte, warum.
Die Adlerin kam zurück und landete neben mir. Auch sie starrte auf mein Kunstwerk. Plötzlich bog sie den Kopf über die Schulter zurück, und sie schrie begeistert. Der Anblick hatte etwas in ihr ausgelöst. Mit Feuereifer stürzte sie sich herab in die Tiefe und kehrte wenig später ihrerseits mit einem Stock im Schnabel zurück. Auch sie klemmte ihn ins Astwerk hinein. Ein paarmal kam die ganze Konstruktion ins Rutschen, aber sie wurde rasch sehr geschickt und arbeitete mit Schnabel und Füßen und dabei mit einer ansteckenden Emsigkeit.
Da hielt es mich nicht länger, und auch ich beteiligte mich an dem neuen Spiel, das sich herausgebildet hatte. Unermüdlich flogen wir nun hin und her und holten vom kiesigen Flussufer angeschwemmte Stöcke und Zweige, die zum Teil schon vom Transport im Wasser blankpoliert waren und hell leuchteten wie alte Knochen. Es waren sehr stabile Äste dabei, die geformt waren wie Geweihstangen oder Rippen von einem alten Wapiti. Mit zunehmendem Geschick verkeilten und verbauten wir diese Hölzer und erhielten bald in unserer hochgelegenen Astgabel in der Baumkrone eine stabile Plattform. Auf dieser konnten wir nun nebeneinander stehen.
Das brachte uns auf neue Gedanken. Warum nur nebeneinander stehen, wenn man auch aufeinander draufspringen kann. Jedenfalls kam mir die Lust dazu, und zwar mit einem Mal und unbändig, und sie ließ sich das gefallen, zuerst überrascht und dann sehr bereitwillig. Ich schäumte innerlich vor Lust und flatterte immer wieder auf sie drauf, obwohl ich mich da oben kaum halten konnte. Sie machte sich ganz flach unter mir. Das ganze Schwanzgefieder durfte ich ihr zertreten. Sie sah nach einer Weile ganz zerzaust aus. Wir waren glücklich.
Das ist die beste Zeit im Leben eines Adlers, und wir genossen unsere Zeit und bauten zwischendurch weiter an unserem Nest, und ich besprang sie im Nest immer wieder, und wenn wir erschöpft waren, dann saßen wir nebeneinander in unserem neuen Heim und hechelten.
Mit der Zeit wurden wir wieder ruhiger und unsere Heißblütigkeit flaute ab, und eines Tages entdeckte ich in unserem Nest etwas Rundes, das ich zunächst für einen großen hellen Flusskiesel hielt, ohne mich zu fragen, wie der wohl da hinauf gekommen sein könnte. Vielleicht hatte ihn ja meine Partnerin hergetragen, so wie neulich den Fischkopf.
Es hing auch wirklich mit der Adlerin zusammen, wenn auch in einer anderen Art. Sie benahm sich tagelang seltsam schwerfällig und wehleidig und trat unruhig und extrem vorsichtig im Nest von einem Bein auf das andere. Dazwischen duckte sie sich immer wieder in die Nestmulde und hechelte. Als ich auf die Idee kam, selber bequem in der Mitte zu sitzen und ihr den Platz streitig zu machen, hackte sie ungewohnt heftig nach mir. Überrascht wich ich aus und flog fort, um den Nestrand noch etwas auszubessern und zu erhöhen, weil ich nichts anderes zu tun fand, wenn ich doch nicht in die Nistmulde durfte. Weiberlaunen!
Als ich wiederkehrte, fand ich einen weiteren runden Kiesel im Nest. Die Kiesel waren aber angenehm warm. Sie waren nicht so kalt wie die Steine am Fluss, und sie rollten seltsam beim Wenden. Meine Partnerin wendete sie nämlich sorgfältig mit dem Schnabel, und sie kullerten merkwürdig in der Nistmulde umher. Nicht so wie plumpe Steine.
Meine Frau nahm umständlich und sorgfältig auf den hellen Kugeln Platz. Sie knickste in die Beine und ließ sich erst behutsam auf die Eier plumpsen, als sie sicher war, sie nicht zu zerbrechen. Denn so viel verstand ich nun: Diese hellen Dinger da hatten irgendwas mit uns zu tun, sie gehörten zu uns und wir mussten vorsichtig damit sein.
Ich weiß nicht mehr, ob ich mich am Brutgeschäft beteiligt hatte, aber ich war irrsinnig stolz auf unser Nest und wäre jedem in den Nacken gefahren, der sich unserem Besitz genähert hätte. Ich wurde auch ganz übereifrig beim Fischen und fing mehr, als ich benötigte, und trug die Beute, genau wie die Stöcke, zum Baum und legte sie dort ab, und meine hungrige Frau zerrte gierig daran und ich sah neidlos zu, weil ich satt war.
Manchmal brachte ich in meinem Eifer auch noch mehr Stöcke und Zweige mit, und sie baute das Material gleich in unseren Horst ein. Ich fand so sehr Gefallen daran, etwas zum Nest zu bringen, dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, ob ich gerade einen Zweig oder einen Fisch im Schnabel hatte. Aber meine Geschenke besänftigten sie jedes Mal, und das war gut, denn sie war recht nervös geworden. Sie brütete.
Wenn sie den Horst verließ, weil sie doch zu hungrig war und selber etwas fischen wollte, so blieb ich am Nest und bewachte es und beschirmte es mit meinen Flügeln, denn auch zu große pralle Sonnenhitze ist nicht gut für das Gelege. Manchmal muss ich auch wohl draufgesessen haben, einfach weil ich auch endlich mal wieder in der bequemen Nistmulde liegen wollte, aber auch ich war sehr vorsichtig mit den beiden ovalen Kugeln darin, auch wenn ich mich sicher etwas ungeschickter mit ihnen anstellte als meine Frau. Kehrte sie zum Horst zurück, so überließ ich ihr denn auch bereitwillig die Nistmulde, wo sie sofort geschickt auf den Eiern Platz nahm.
Sie wendete die Eier regelmäßig, und diese veränderten irgendwie die Weise, wie sie rollten und kippelten, und an einem Tag hörten wir dann ein schwaches Signal. Es war ein Piepen. Unser erstes Küken meldete sich aus dem Ei und kündigte sein baldiges Schlüpfen an.
Meine Frau stand auf und betrachtete die Eier aufmerksam. Eines davon begann, von selber ein wenig hin und her zu wackeln. In immer kürzeren Abständen nahm die Adlerin zum Brüten Platz, und schließlich stand sie unruhig ganz auf und betrachtete nur noch abwartend die Eier.
Aber es dauerte noch relativ lange. Eines der Eier hatte einen Sprung bekommen, der sich aber zunächst nicht erweiterte. Statt dessen sahen wir eine kleine helle Spitze, die von innen immer wieder gegen die Eischale und die Membran darunter stieß, schwach und doch unablässig, bis ein kleines rundliches Loch entstand.
Dann geschah erst einmal für eine Weile wieder gar nichts. Doch dann war da drinnen ein Stemmen und ein Aufbäumen, und ein feines Knacken zeigte das weitere Aufbrechen der Eischale an, und nach den Seiten sandte der Spalt neue, feine Bruchlinien aus.
Schließlich wurde die eine, kappenartige Schalenhälfte weggesprengt, und heraus fiel ein dicker Kopf an einem dünnen Hals, der sofort erschlaffte. Wieder blieb es eine Weile ruhig, doch diesmal sah man ein heftig pulsierendes Atmen. Das Küken war total nass und schmierig, und die Membranfetzen von der Eierschale klebten an seinen Schultern. Der Rest steckte noch im Ei. Doch irgendwann begann es, erneut zu strampeln und zu schieben, und schließlich hatte es sich ganz aus der Eierschale befreit. Die Mutter pickte unschlüssig an der Eierschale.
Inzwischen ertönte auch aus dem anderen Ei ein schwaches Piepen. Aber das andere Küken brauchte sehr viel länger Zeit zum Schlüpfen, und es stieß mit seinem Eizahn nur so schwach von innen durch die Schale, dass es fast die Membran nicht richtig durchtrennt hätte und innen erstickt wäre. Der Luftvorrat im Ei ist schließlich auch nur begrenzt. Doch endlich gelang es auch dem anderen Küken, die Membran aufzuritzen. Als es geschlüpft war und völlig nass und verklebt im Nest lag, trockneten bei seinem älteren Geschwister schon die Daunen.
Wir begannen mit der größten Selbstverständlichkeit, uns um die Neulinge zu kümmern. Niemand musste uns sagen, was zu tun war. Insofern ergeht es den meisten Tieren besser als dem Menschen. Du hast auch keine Angst vor deinem Nachwuchs. Du kümmerst dich einfach um ihn, das ist alles.
Es war ein guter Sommer mit gutem Wetter, so dass die Jungen weder bei Wolkenbruch im Nest ertranken noch von Hagel erschlagen wurden. Es war sogar ziemlich heiß, so dass wir den Jungen mit breit gefächerten Flügeln Schatten spenden mussten. Es war recht mühselig, so lange mit gespreizten Flügeln dazustehen.
Die Kleinen waren unersättlich und wuchsen rasch heran. Doch eines Tages geschah etwas Merkwürdiges.
Wir sahen zwei eigenartige Tiere den Baum hinaufklettern. Gewiss waren es Opossums. Sie kletterten so geschickt, wie es sonst nur diese Beutelratten tun. Aber etwas war seltsam. Sie waren viel größer als Opossums. Sie waren sogar viel größer als Baumstachelschweine. Je länger man sie betrachtete, desto deutlicher wurde, dass sie mit überhaupt nichts anderem Ähnlichkeit hatten. Sie kletterten aber verdammt gut, eben wie ein Opossum oder ein Fichtenmarder.
Sie näherten sich unaufhaltsam. Wir waren beunruhigt. Plötzlich langte einer von ihnen in die oberste Astgabel des Baumwipfels. Das war zu viel. Hier oben war unser Nest. Ich schwang mich auf und stieß auf den frechen Eindringling herab.
Der Ich-weiß-nicht-was-für-ein-Opossum schmiegte sich dicht an den Baumstamm. Ich musste achtgeben, dass ich mit meinen breiten Schwingen nirgends im Gezweig anstieß, und flatterte mühselig wieder empor zum Horst. Hier, direkt am Nest, war ich wesentlich weniger geschickt und wendig als bei meinen Luftattacken in Revierkämpfen. Während ich auf den Horstrand zurückflatterte, neben die Jungen, stieß meine Frau Helles Auge auf die Eindringlinge herab. Die Riesenmarder, oder was es auch immer waren, ließen sich nicht vertreiben. Der eine schien immer den anderen zu beschützen, so dass es sehr schwer war, sie anzugreifen. Ich versuchte es noch einmal, während Helles Auge auf den Horstrand zurückflatterte.
Im Flug streckte ich meine Klauen vor und schlug damit nach den Eindringlingen. Ich schaffte es, einen von ihnen am Vorderbein zu kratzen. Er hatte seltsam muskulöse Vorderbeine, wie ich feststellte. Dann startete ich eine Attacke von einem starken Seitenast aus. Ich flatterte auf die Riesenmarder los, streckte meinen Kopf vor und hackte nach ihnen. Die beiden wehrten mich erstaunlich wendig ab. Ihre Vorderbeine waren wirklich unglaublich geschickt. So was war mir noch nicht vorgekommen.
Oben im Horst piepsten die Jungen. Auch sie waren durch die Störung beunruhigt und plärrten verwirrt. Immer wütender umflatterten Helles Auge und ich unseren Horst und versuchten, die Jungen darin vor den fremdartigen Wesen zu verteidigen.
Eine der Riesen-Baumratten langte über den Nestrand. Sofort saß ich ihr auf dem Vorderbein und machte mich daran, es zu zerfleischen. Doch das andere Opossum stieß mich beiseite, und ich wusste nicht mehr, ob ich zuerst nach ihm oder nach dem anderen hacken sollte.
Diesen Augenblick der Unschlüssigkeit nutzten sie, um eines unserer Jungen zu packen. Das Adlerjunge schrie erbost auf und pickte ebenfalls heftig nach den Beutelratten oder Mardern, aber es war noch zu ungeschickt. Verwirrt stellte ich fest, dass es gegen seinen Willen über den Nestrand verschwand.
Helles Auge und ich tobten weiter erbittert um unseren Horst, um die Feinde abzuhalten. Ich warf einen Blick in den Horst und stellte fest, dass er noch besetzt war. Ein Junges saß darin und pendelte mit dem Kopf, offenbar hatte es eben das Gleichgewicht verloren und war hintenüber gefallen. Ein Junges? Ich stutzte. War nicht vorher mehr drin gewesen? Aber da ich mich beim besten Willen nicht besinnen konnte und zum Nachdenken auch gar keine Zeit blieb, stürzte ich mich wieder erbittert auf jene Eindringlinge.
Erleichtert stellte ich fest, dass sie offenbar aufgaben und wieder hinabkletterten. Helles Auge setzte sich einem auf den Kopf und stieß mit dem Schnabel nach ihm. Der Marder brüllte auf und scheuchte Helles Auge mit seinem erstaunlichen Vorderbein herunter.
Ich umflatterte alle. Einen Augenblick sah ich ein mir vertrautes Federbündel, und ich musste an mein Junges denken. Ja – es war mein Junges, und es piepste erbärmlich. Rasend vor Wut stürzte ich mich nochmals auf die Marder. Aber sie hatten inzwischen den Boden erreicht, und ich musste mich erneut aufschwingen, wollte ich nicht vor ihnen auf dem Boden landen. Das war zu gefährlich. Am Boden fühlst du dich als Adler entschieden weniger sicher als in der Luft.
Ich kehrte zum Horst zurück, nun, da die Räuber ohnehin von unserem Nistbaum abließen. Mein zweites Junges hatte ich inzwischen wieder vergessen. Sie hatten es eingesteckt. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Als ich auf dem Horst ankam, beruhigte ich mich langsam wieder. Alles war augenscheinlich wieder in Ordnung. Im Horst saß ein Junges, und am Nestrand stand meine Frau und schrie noch nervös. Sie brauchte länger als ich, um sich von der Ruhestörung wieder zu erholen. Nur langsam flaute unsere Aufregung wieder ab.
Der Horst war nicht verwaist. Alle waren doch noch da, oder? Ich blickte herab und sah die Eindringlinge davongehen. Sie hatten sich aufgerichtet. Plötzlich erkannte ich sie. Es waren keine Opossums. Es waren auch keine großen Marder. Es waren Menschen. Indianer, so wie ich sie auch schon öfters am Flussufer gesehen hatte.
Am Horst, so fand ich, war noch alles beim Alten. Nur stellten wir zu unserer Verwunderung fest, dass wir unseren Nachwuchs nun einfacher satt bekamen. Dass sich ein gieriger Schnabel schneller stopfen lässt als zwei, fiel uns dabei zahlenmäßig nicht weiter auf. Nur gelegentlich wetterleuchtete die Erinnerung an das zweite Junge durch mein Hirn. Dann vermisste ich es vage, doch das verbleibende Junge hielt uns zu sehr beschäftigt, um darüber nachzugrübeln, ob nun zuvor noch ein weiteres dagewesen war oder nicht. Mit dem Füttern hatten wir auch so noch genug zu tun.
Du sollst nicht überheblich sein, wenn du uns Adler danach beurteilst, dass wir nicht richtig zählen können. Der Rabe kann es, und doch ist er uns im Flug unterlegen. Ihr Menschen könnt es, und lebt ihr darum besser? Und, könntet ihr so leben wie ein Adler? Was versteht ihr vom Fliegen? Wenn ihr fliegt, so nur mit starren Hilfsmaschinen, die laut lärmen und stinkendes Kerosin fressen. Lasst einen Adler einfach Adler sein und beurteilt ihn nicht danach, was er nicht kann. Freue dich an dem, was er kann, und beobachte ihn, wie er sein Adlerleben lebt, was sonst keiner für ihn tun kann. Ein Adler lebt anders als ein Hirsch und ein Hirsch anders als ein Mensch, und jeder lebt so, dass es die Welt interessanter macht, als wenn es ihn nicht gäbe, und das ist alles. Auch das ist ein Stück von der Großen Wahrheit.
Wir haben in mehreren Brutsaisons Junge durchgebracht, und es gab noch kein Gift, das uns steril gemacht hätte oder die Eier dünnschalig werden ließ, so dass sie beim Brüten zerbrachen. Zweimal hat das jeweils ältere Küken das jüngere aus dem Nest gedrängt, und das eine fraß unten der Fuchs und das andere wir, weil es plötzlich von seinem Geschwister so blutig gehackt war, dass wir es nicht mehr als Junges erkannten, sondern für Futter hielten. Und in einem Herbst verloren wir unseren Jungvogel in einem jähen Schneesturm. Aber alles in allem waren wir erfolgreich, und unsere Jungen verließen uns und kreisten anderswo am Himmel.
Wir blieben zusammen und vertrieben gemeinsam Eindringlinge aus unserem Revier, manchmal sicher auch unsere eigenen Jungen von vergangenen Sommern, und im Winter vagabundierten wir flussabwärts, ohne uns je ganz von unserem Revier zu trennen. Jedes Frühjahr kehrten wir dorthin zurück.
Schließlich wurden wir alt, und vor allem bei mir ließen die Kräfte nach. Die Spitzen meiner Schwingen beschrieben nicht mehr jenen spannungsvollen Bogen nach oben, ich flog flach dahin wie ein ausgebreitetes braunes Tuch. Nur meine Kopffedern waren noch reiner weiß als je zuvor, auch die vereinzelten braunen Federschäfte, die ich dort früher noch gehabt hatte, waren schon seit vielen Sommern und Wintern bleich geworden.
Bevor ich im Kampf gegen einen jüngeren Eindringling Frau und Revier verloren hätte, starb ich. Ich fiel nicht vom Himmel herab wie ein Stein, was sicher sehr schön gewesen wäre – heute, rückblickend, hätte ich mir gewünscht, so im freien Segelflug zu sterben – nein, ich fühlte mich einfach kraftlos und müde und setzte mich auf meinen Lieblingsast, um zu ruhen.
Seit dem Spätherbst fühlte ich mich matt, und bei Wintereinbruch saß ich resigniert am Flussufer auf einer Eisplatte und fraß lieber die Fische, die durch den jähen Frost in einem Wasserarm eingeschlossen waren, als selber zu jagen.
Dann, an einem lichtarmen Wintertag, als die Sonne fern und blass an einem durch Eiskristalle getrübten Himmel zog, saß ich zum letzten Mal auf meinem Lieblingsbaum. Ich spürte es. Ich spürte, dass gleich meine Sonne unterging. Wo war meine Frau? Ich wusste es nicht und war zu müde, mich nach ihr umzusehen. Ich zog den Kopf zwischen die Schultern.
Irgendwann fiel ich dann tot herab, und unter dem Baum kam ein Vielfraß vorbei und verschlang dankbar jene Frucht des Todes, die da vom Ast herabgefallen war und im Schnee lag.
Ende des Buches Adler