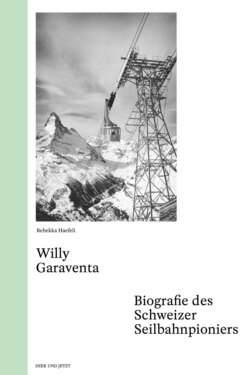Читать книгу Willy Garaventa - Rebekka Haefeli - Страница 6
Aufbruchstimmung
ОглавлениеWeltrekord in den USA
Kurz vor Weihnachten 1968 verkündet das Wintersportgebiet Squaw Valley in den USA, die Einweihung der bis dahin grössten Luftseilbahn der Welt stehe bevor. Journalisten aus den Vereinigten Staaten verbreiten die Nachricht über das Land. «NEW TRAMWAY CARRIES 120 PASSENGERS – Squaw Valley Gets Giant Cable Car» titelt die Chicago Tribune einige Wochen vor der Eröffnung.2 Die Seilbahn wird als Sensation und Weltneuheit verkauft, wobei die Journalisten den Fokus auf das aussergewöhnliche Volumen der Kabinen richten. Mit der neuen, riesigen Drei-Millionen-Dollar-Luftseilbahn könnten 120 Passagiere aufs Mal transportiert werden, heisst es; das seien so viele wie noch nie zuvor. Der Berichterstatter der Chicago Tribune erwähnt das futuristische Design der beiden Seilbahnkabinen und streicht heraus, dass die Bahn nicht in den USA, sondern in der Schweiz konstruiert worden sei. Auch das Reno Gazette-Journal macht mit einem Artikel auf die enorm grosse, neue Bahn aufmerksam, die in Squaw Valley gebaut werde: «Huge Ski Lift Being Built In Squaw Valley».3
Die Flut der Schlagzeilen reisst nicht ab. Am Tag nach der Eröffnung berichten Zeitungen in vielen Teilen der USA über das Ereignis. Die Leserinnen und Leser erfahren, dass das bekannte Wintersportgebiet Squaw Valley mit der Luftseilbahn neue Massstäbe gesetzt habe. So schreibt der Kolumnist des Pasadena Independent, die Eröffnung der Bahn spiegle den Fortschritt im Skisport in den zurückliegenden zwanzig Jahren wider.4 «Squaw Valley Still Growing – SQUAW IS BUSTING OUT ALL OVER» titelt er, was auf Deutsch ungefähr heisst: «Squaw Valley wächst weiter und übertrumpft alle». Der Journalist hält fest, Squaw Valley habe seine letzte und neueste Errungenschaft für seine Ski-Megalopolis enthüllt und neben der Bahn auch ein bemerkenswert modernes Stationsgebäude präsentiert.
Die Kunde von der neuen Seilbahn macht nicht nur Schlagzeilen in den Vereinigten Staaten, sondern weit darüber hinaus. In der Schweiz wird die Nachricht ebenfalls freudig aufgenommen, denn die Seilbahn wurde von einer kleinen Innerschweizer Firma gebaut: Karl Garaventas’s Söhne aus Goldau im Kanton Schwyz.
Der Bote der Urschweiz widmet der Einweihung einen ausführlichen Artikel und vermeldet die Eröffnung in den Vereinigten Staaten mit einer Portion Lokalpatriotismus: «Die Seilbahn mit den grössten Kabinen der Welt dem Betrieb übergeben – Erstellt von einer Schwyzer Firma».5 Der Berichterstatter erfasst die Bedeutung dieses Ereignisses ganz richtig, indem er weiter schreibt: «Dieser Auftrag zum Bau der grössten Seilbahn der Welt ehrt nicht nur die Unternehmerfirma Garaventa AG und ihre Unterlieferanten, sondern beweist erneut, dass schweizerische Qualitätsarbeit im In- und Ausland hoch geschätzt wird.»
Im Rückblick kann man sich fragen, ob die Sache mit der Weltneuheit wirklich stimmte. Ebenfalls 1968 wird am Crap Sogn Gion im Kanton Graubünden eine Bahn für 125 Personen eingeweiht; erstellt hat sie die Firma Habegger, ein Konkurrent von Garaventa.6 Überliefert ist, dass die Kabinen in Squaw Valley für ein Fassungsvermögen von 140 Personen projektiert worden waren. Da sich im Lauf der Planung herausstellte, dass das Durchschnittsgewicht der Amerikaner um einiges höher liegt als das der Europäer, ging die Rechnung am Ende nicht ganz auf. Zugelassen werden die zwei Kabinen schliesslich für den Transport von je 120 Passagieren. Auch das ist freilich mehr als bei den meisten damaligen Seilbahnen üblich. Das Wetteifern illustriert die Konkurrenz der Seilbahnbauer in jener Zeit. Sie arbeiten darauf hin, sich bei der Grösse der Kabinen gegenseitig zu übertrumpfen.
Die Squaw-Valley-Bahn markiert einen Meilenstein in der Seilbahngeschichte. Schon nach kurzer Zeit ist sie weltbekannt und wird legendär. Mehr als vierzig Jahre nach dem Bau blickt Squaw Valley in einer Jubiläumsschrift auf den Tag der Eröffnung zurück und lässt die prickelnde Stimmung von damals nochmals aufleben: Die Bahn sei ein «fantastisches Bauwerk»; die Rede ist vom «technologisch fortschrittlichsten Seilbahnsystem der Welt».7 In jeder Zeile kommt die Bewunderung für die Konstrukteure zum Ausdruck: «Das Meisterstück moderner Ingenieurskunst umfasst Meilen von Drahtseilen, komplexe elektrische und mechanische Systeme und unzählige Tonnen Zement und Stahl.» Die Bahn wird aufgrund der neuartigen Dimensionen in den USA auch «The Monster» genannt. Der Rummel in der Presse und in der Bevölkerung ist gross, und entsprechend wird der Eröffnungsanlass als Spektakel inszeniert. Um die Grösse und die Bedeutung der Seilbahn zu unterstreichen, wird «Bertha the Elephant» engagiert. Der Zirkuselefant unterhält die Gäste, während diese launig an ihren Cocktails nippen.
Irgendwo in diesem fröhlichen Trubel befindet sich an diesem Dezembertag im zu Ende gehenden Jahr 1968 auch Willy Garaventa. Er hat in Squaw Valley mit seinen Monteuren seit Wochen auf die Inbetriebsetzung der Seilbahn hingearbeitet. Die Eröffnung des Bauwerks erfüllt ihn mit Stolz und Genugtuung. Der Bau der Squaw-Valley-Bahn ist der bis dahin mit Abstand grösste Auftrag für Karl Garaventa’s Söhne, die Firma, die er zusammen mit seinem Bruder führt. Das Geschäft sichert bis auf Weiteres die Existenz des Unternehmens. Die wahre, noch viel grössere Bedeutung dieses Auftrags zeigt sich aber erst etwas später: Mit dem Bau der Luftseilbahn in den USA ist der kleinen Goldauer Firma der Durchbruch im Weltmarkt gelungen.
Wer hoch aufsteigt, riskiert allerdings auch, tief zu fallen. Zehn Jahre nach der Inbetriebnahme der Bahn, 1978, ereignet sich in Squaw Valley ein Unfall, bei dem vier Menschen sterben und rund dreissig verletzt werden.8 Während eines Sturms entgleist eines der beiden Tragseile und schlitzt eine der Kabinen auf. Es folgt eine dramatische, elfstündige Rettungsaktion im Schnee. Erneut berichten Zeitungen in den ganzen USA über die Bahn; diesmal allerdings mit Negativschlagzeilen. Der Unfall hat weitreichende Folgen. Nach dem Unglück versuchen die Amerikaner, den Garaventas eine Schuld nachzuweisen. Allen Beteiligten in Goldau ist klar, dass ein Schuldspruch mit Millionenforderungen den Ruin der Firma bedeuten würde. Doch das Verfahren endet mit einem Freispruch. Die Erfolgsgeschichte geht weiter.
Die Geschichte von Garaventa, heute zusammen mit Doppelmayr ein Weltunternehmen, begann klein und bescheiden, Hunderte Kilometer südlich von Goldau – in Italien.
Ein Italiener sucht Arbeit in der Schweiz
Die Abenteuerlust und das Fernweh, die Willy Garaventa umtreiben, kommen nicht von ungefähr. Bereits sein Grossvater, Nonno Giuseppe Garaventa, verliess als junger Mann die Heimat Italien, um im nördlichen Nachbarland zu arbeiten und Geld zu verdienen. Es ist die Geschichte eines Einwanderers, der es in der Schweiz durch Tüchtigkeit, schlaues Wirtschaften und Hartnäckigkeit zum erfolgreichen Unternehmer brachte. Ob Giuseppe als junger Mann davon geträumt hatte? Es ist nicht anzunehmen. Er nahm das Leben wohl einfach so, wie es kam. Und versuchte stets, das Beste daraus zu machen.
Giuseppe Garaventa kommt 1836 in Savignone, einem malerischen kleinen Dorf nördlich von Genua, zur Welt. Die Häuser liegen eingebettet in grüne Hügel in sanften Tälern und sind umgeben von Weinreben. Doch die Situation in Italien ist unruhig, geprägt von politischen und wirtschaftlichen Spannungen, bis 1861 schliesslich das italienische Königreich ausgerufen wird. Die Familie, aus der Giuseppe Garaventa stammt, gehört der Unterschicht an. Ob neben Not und Armut politische Motive zur Auswanderung führen, bleibt Spekulation.
Auch, wann genau Giuseppe Garaventa in Savignone sein Bündel packt und den Marsch in Richtung Norden antritt, weiss man nicht. Vermutlich verlässt er zwischen 1855 und 1860 die Heimat, in der Hoffnung, in der Ferne eine Arbeit zu finden. In der Familie erzählt man sich noch heute, ein Bruder von Giuseppe Garaventa sei mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter nach Amerika ausgewandert. Die Tochter – auch sie eine Garaventa – heiratete später einen Mann namens Sinatra; ihr gemeinsamer Sohn, Frank Sinatra, wurde weltweit bekannt als Sänger, Schauspieler und Entertainer. Opernsänger Ottavio Garaventa, der 2014 verstarb, ist ebenfalls mit der Familie verwandt.
Die jungen Männer aus Italien besitzen kaum etwas ausser den Kleidern, die sie am Leib tragen. Den Rest ihrer Güter knoten sie in ein Tuch und machen sich mit einem Stock in der Hand auf den Weg über den San Bernardino. Die Eltern und Grosseltern in Savignone haben Giuseppe Garaventa einen gewissen Stolz anerzogen. Er hat gelernt, dass ein Garaventa kein Dieb oder Bettler ist. Aber er weiss, dass jede ehrliche Arbeit ihren Teller Suppe wert ist. Giuseppe Garaventa kann weder lesen noch schreiben, doch er ist ein gesunder, kräftiger Mann und verdient nun seinen Sold als Pflasterträger und Mineur beim Bau von Bahnen, Brücken und Strassen.
Der Südländer befindet sich damals in zahlreicher Gesellschaft. Die Industrialisierung und der Eisenbahnbau in der Schweiz, der stark vorangetrieben wird, führen zu einer ersten Migrationswelle aus dem Süden. Der 1848 gegründete Bundesstaat und der einheitliche Wirtschaftsraum bilden den Boden für diese Entwicklung, die sich später noch akzentuieren wird. Im Jahr 1872 unterschreibt Louis Favre den Bauvertrag mit der Gotthardbahn-Gesellschaft. Innerhalb von nur acht Jahren soll der Gotthardtunnel gebaut werden. Vermutlich gehört auch Giuseppe Garaventa zeitweise zu den rund 3000 Beschäftigten, die im Tunnel im Einsatz sind. Das «Jahrhundert der Italiener» beginnt, in dessen Verlauf schätzungsweise fünf Millionen Italienerinnen und Italiener als Arbeitsuchende vorübergehend oder für immer in die Schweiz einwandern.9 Sie prägen fortan die Gesellschaft und den Alltag der Menschen in der Schweiz.
Über die Arbeitsbedingungen im Gotthardtunnel zwischen Airolo und Göschenen weiss man, dass sie unmenschlich hart waren; Hitze, Lärm, Staub und Nässe machten den Arbeitern zu schaffen. Die Sicherheitsmassnahmen waren ebenso ungenügend wie die hygienischen Bedingungen. Es fehlten Toiletten, und die Exkremente blieben bei grösster Hitze zusammen mit dem Abfall im Tunnel liegen. Infektionskrankheiten verbreiteten sich, und die Forderung der Arbeiter nach besseren Arbeitsbedingungen führte schliesslich zum Streik, den die Urner Polizei niederschlug. Sie schossen auf die Streikenden, es gab mehrere Tote und Verletzte.
Giuseppe Garaventa bleibt von Verletzungen und von Krankheiten verschont. Im Winter, wenn die Arbeit in der Schweiz eingestellt wird, schnürt der Saisonnier jeweils sein Bündel und macht sich auf den Weg nach Savignone, wo er sein mühsam verdientes Geld der Familie abliefert. Wie viele Personen die Familie in Italien zu dieser Zeit zählt, ist nicht bekannt, doch es müssen ledige Onkel, Tanten, Söhne und Töchter gewesen sein – eine ganze Sippschaft, die kein eigenes Heim hatte. Sie wohnten dort zusammen und mussten sich der Grossmutter fügen, denn die Nonna verwaltete auch die Finanzen.
Die Jahre gehen dahin, immer wieder zieht Giuseppe Garaventa zum Geldverdienen in die Schweiz. Mittlerweile ist er über dreissig Jahre alt. Sehr darauf bedacht, möglichst viel Geld zu verdienen, wagt er manche gefährliche Arbeit. Er unternimmt kleinere Akkorde, arbeitet also als Subunternehmer, in eigener Regie. Aber nicht immer geht seine Rechnung auf. Und vor lauter Geldverdienen hat er keine Zeit für anderes – weder zum Schreibenlernen noch zum Heiraten.
Giuseppe Garaventa macht sich selbstständig
Während der Zeit, als der Gotthardtunnel gebaut wurde, lebten die italienischen Arbeiter in einfachsten Baracken und in erbärmlichen Verhältnissen. Es ist anzunehmen, dass Giuseppe Garaventa wie die meisten Eisenbahnarbeiter in der ganzen Zentralschweiz herumreist und auf verschiedenen Baustellen arbeitet.
Nach dem Durchstich des Tunnels wird im Jahr 1882 die Gotthardbahn als Nord-Süd-Verbindung zwischen Immensee im Kanton Schwyz und Chiasso im Tessin in Betrieb genommen. Damals verkehren noch Dampfzüge. Der Bahnhof von Immensee – dem heutigen Wohnort von Willy Garaventa – ist als Kilometer null der Gotthardbahn bekannt. Die Gegend von Arth-Goldau ist schon damals ein Bahnknotenpunkt. Das Dorf floriert während des Baus der Eisenbahnlinien. Es gibt zahlreiche sogenannte Cantinas, kleine Restaurants, die von den Frauen der Bahnarbeiter und von Bauersfrauen geführt werden. Goldau wird heute noch als «Eisenbahnerdorf» bezeichnet.
Der Alltag im Dorf ist Giuseppe Garaventa zu teuer, so orientiert er sich in Richtung Berg. Er verdingt sich unter anderem als Mineur, als Tunnelbauer, beim Bau der Arth-Rigi-Bahn. Die zweite Zahnradbahn auf die Rigi wird – nach der Vitznau-Rigi-Bahn – 1875 eröffnet. Während des Baus ist die Chräbelwand, ein steiles Waldgelände mit einem Felsstreifen, eine grosse Herausforderung für die Mineure. Dieser Riesenbrocken, der viele Meter lang und breit ist, versperrt den Weg in die Höhe. Die Baukommission schreibt einen Preis aus für den, der die beste Lösung zur Sprengung dieses Gesteins findet. Davon hört auch Giuseppe Garaventa, und er will diesen Preis gewinnen. So sucht er in der Nähe dieser Wand bei einem Bauern eine Unterkunft. Fortan klettert er jede freie Minute auf dem Fels herum, ständig auf der Suche nach Höhlen oder Löchern, die nicht zuerst mühsam gebohrt werden müssen.
Giuseppe Garaventa wird fündig. Er stösst auf eine Höhle und macht der Bauleitung den Vorschlag, sie als Sprengstoffdeponie zu nutzen. Man sucht nun nach Möglichkeiten, die nötige Menge an Pulver zu berechnen. Als alle Vorarbeiten fertig sind, kommt der Tag der Sprengung. Das Vorhaben ist von Erfolg gekrönt, und Giuseppe Garaventa fühlt sich als kleiner Held. In der Familie seiner Logisgeber wird er gebührend gefeiert. Bei dieser Gelegenheit fällt ihm die junge Tochter des Hauses auf, Maria Dorothea Mettler. «I bini de Garaventa, bini gueti Mineure», sagt er zu ihr. Er sei der Garaventa, er sei ein guter Mineur. Die beiden finden Gefallen aneinander.
Maria Dorothea Mettler ist 19 Jahre jünger als Giuseppe Garaventa. Bei der Hochzeit im Jahr 1877 ist sie 22-jährig; der Bräutigam ist 41. Bereits einen Monat nach ihrer Hochzeit bringt sie ihr erstes Kind, Tochter Carolina, zur Welt. Dass die Verliebten die ordnungsgemässe Reihenfolge, zuerst zu heiraten und dann Kinder zu zeugen, nicht eingehalten haben, wird noch Folgen haben. Von einem Italiener, der nicht einmal lesen und schreiben kann, ein Kind zu erwarten, ohne verheiratet zu sein: Das ist nicht gern gesehen in der Familie, wo der Vater Kirchen- und Gemeinderat und ein Onkel Pfarrer ist.
Darum gibt man sich viel Mühe, die Angelegenheit möglichst schnell zu legalisieren. Aus Italien müssen Papiere angefordert werden. Der nicht gerade willkommene Bräutigam muss lernen, seinen Namen zu schreiben. Eine Heiratsurkunde hat schliesslich eigenhändig unterschrieben zu sein.
Die werdende Mutter muss unter diesen Umständen einiges erdulden, wie sie später erzählt. Was sie in ihrer eigenen Familie durchmacht, ist aber noch lange nicht das Schlimmste. Richtig arg wird es erst, als sie mit ihrem Mann die Winter in Italien bei seiner Familie verbringt. In der Schweiz ist Giuseppe Garaventa der Schuldige, der ein anständiges junges Mädchen verführt hat. Ennet dem Gotthard aber ist sie das Mädchen, das den gut verdienenden Arbeiter wegen des Kindes zur Heirat zwang, was bedeutet, dass sein Geld nicht mehr so reichlich in die Familienkasse fliesst. Leicht verächtlich wird sie «la tedesca», die Deutsche, genannt.
Ins Eheregister trägt sich Giuseppe Garaventa als Akkordant ein. In der Familie erzählt man sich, er habe schon vor der Hochzeit damit begonnen, Auffahrten zu Ställen für Heuwagen zu mauern. Diese Arbeit ist hart. Von Hand müssen tonnenweise Steine herangeschleppt werden, die man mit Erdreich zu Mauern verarbeitet. Die Heuwagen werden damals noch von Pferden gezogen. Nach seiner Hochzeit macht sich Giuseppe Garaventa selbstständig, und er übernimmt Akkordarbeiten an verschiedenen Eisenbahnen, wie zum Beispiel den Bau der Brückenpfeiler zwischen Walchwil und Arth-Goldau.
Er arbeitet auch mit beim Bau der Südostbahn. Der Abschnitt zwischen Biberbrugg und Arth-Goldau wird 1891 eröffnet.10 Mit einem Kompagnon übernimmt Giuseppe Garaventa die Strecke zwischen Arth-Goldau und Steinerberg. Es ist ein glückloses Unternehmen. Die Akkordanten erhalten eine hohe Konventionalstrafe, weil sie infolge des schwierigen Geländes den vereinbarten Termin nicht einhalten können. «Grossvaters Millionenloch» wird dieses Teilstück in der Familie genannt. Giuseppe Garaventas Begründung für das Fiasko ist: «Bini inegheit mit de Bergsturz. Hend sie mir verwütscht, die schlechti Kheibe!» Man habe ihn über den Tisch gezogen, sagt er sinngemäss. Schlechte Kumpane seien das! Die Arbeit an jenem Teilstück der Eisenbahn ist wohl tatsächlich wegen der Folgen des Bergsturzes so schwierig. Die Naturkatastrophe vom 2. September 1806 wird als «Bergsturz von Goldau» in die Geschichte eingehen. Dabei kamen 457 Menschen ums Leben.11 Noch heute liegen im Gebiet unter der Abbruchstelle am Rossberg zahlreiche grosse Gesteinsbrocken und erinnern an das Unglück.
In der Zeit seiner grössten Unternehmungen stehen an die sechzig bis siebzig Arbeiter im Lohn von Giuseppe Garaventa. Viele von ihnen sind Italiener wie er selbst. In diesen für ihn ertragreichen Jahren stellt er einen Sekretär ein. Später erzählt der Grossvater, der Sekretär habe ihn bestohlen; er sei eines Tages einfach mit der ganzen Lohnsumme verschwunden: «Isch er Luuskheibe gsi, isch er durrebränne mit de ganzi Lohngälde.» Viele seiner drolligen, verdeutschten Sprüche erzählen sich die Kinder und Nachbarn noch lange nach seinem Tode.
Als sich Giuseppe Garaventa entschliesst, einen festen Wohnsitz in der Schweiz zu kaufen, ist seine Frau Dorothea erleichtert. Guiseppes Familie in Italien hat sie ja nicht besonders herzlich aufgenommen. Weil «die Dorothea eini Puuremaiteli» ist, entschliesst sich der Grossvater, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dazugehöriger Käserei zu erwerben. 1895 meldet sich Giuseppe Garaventa in Goldau ab. Inzwischen hat das Paar drei Kinder bekommen. Der Zweitgeborene stirbt aber wenige Jahre nach der Geburt. Willy Garaventas Vater Karl ist am 22. November 1888 zur Welt gekommen.
Giuseppe Garaventa verlässt also mit seiner Familie Goldau und kauft für 37 000 Franken mehrere Liegenschaften in Oberimmensee. 3000 Franken kann er selbst aufbringen. 34 000 Franken erwirbt er in Schuldbriefen, die er zu 5 Prozent zu verzinsen hat. Spezialisierte Mineure verdienen damals drei bis vier Franken pro Tag, also knapp hundert Franken pro Monat.12 Ein Kilogramm Brot kostet etwa dreissig Rappen. 3000 Franken sind also eine stattliche Summe; um sie zusammenzusparen, hat Giuseppe Garaventa auch Jahrzehnte gekrampft.
1895 ist er fast sechzig Jahre alt. Er hat in seinem Leben viel geleistet. In den Jugendjahren ist er als Analphabet ohne Ausbildung aus Italien in die Schweiz eingewandert. Schlechte Voraussetzungen eigentlich, um ein eigenes Geschäft aufzubauen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Doch Giuseppe Garaventa wusste die Gunst der Stunde zu nutzen und baute sich eine Existenz auf. Mit harter Arbeit verdiente er sich sein Leben und unterstützte viele Jahre lang auch noch seine Familie in Italien. In rund zwanzig Jahren Selbstständigkeit gelang es ihm, ein kleines Vermögen zusammenzusparen, sodass er sich schliesslich Grundbesitz leisten konnte.
Der Kaufvertrag für die Liegenschaften in Oberimmensee lautet auf den Namen Josef Garaventa; der Grossvater hat seinen Namen also – ohne formell eingebürgert zu sein – den Deutschschweizer Gegebenheiten angepasst.